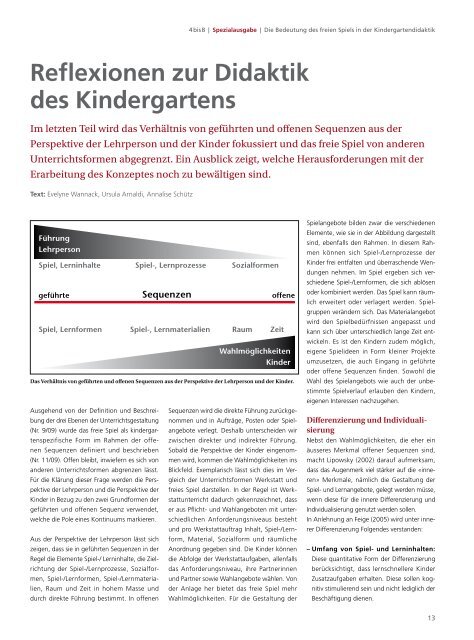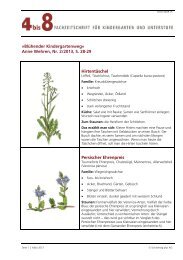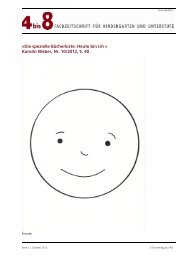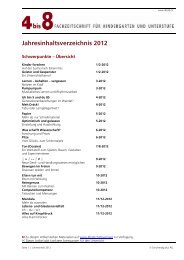Die Bedeutung des freien Spiels in der Kindergartendidaktik - 4bis8
Die Bedeutung des freien Spiels in der Kindergartendidaktik - 4bis8
Die Bedeutung des freien Spiels in der Kindergartendidaktik - 4bis8
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Reflexionen zur Didaktik<br />
<strong>des</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>gartens<br />
4 bis 8 | Spezialausgabe | <strong>Die</strong> <strong>Bedeutung</strong> <strong>des</strong> <strong>freien</strong> <strong>Spiels</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>gartendidaktik<br />
Im letzten Teil wird das Verhältnis von geführten und offenen Sequenzen aus <strong>der</strong><br />
Perspektive <strong>der</strong> Lehrperson und <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> fokussiert und das freie Spiel von an<strong>der</strong>en<br />
Unterrichtsformen abgegrenzt. E<strong>in</strong> Ausblick zeigt, welche Herausfor<strong>der</strong>ungen mit <strong>der</strong><br />
Erarbeitung <strong>des</strong> Konzeptes noch zu bewältigen s<strong>in</strong>d.<br />
Text: Evelyne Wannack, Ursula Arnaldi, Annalise Schütz<br />
Führung<br />
Lehrperson<br />
Spiel, Lern<strong>in</strong>halte Spiel-, Lernprozesse Sozialformen<br />
geführte Sequenzen<br />
offene<br />
Spiel, Lernformen Spiel-, Lernmaterialien Raum Zeit<br />
Das Verhältnis von geführten und offenen Sequenzen aus <strong>der</strong> Perspektive <strong>der</strong> Lehrperson und <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>.<br />
Ausgehend von <strong>der</strong> Def<strong>in</strong>ition und Beschreibung<br />
<strong>der</strong> drei Ebenen <strong>der</strong> Unterrichtsgestaltung<br />
(Nr. 9/09) wurde das freie Spiel als k<strong>in</strong><strong>der</strong>gartenspezifische<br />
Form im Rahmen <strong>der</strong> offenen<br />
Sequenzen def<strong>in</strong>iert und beschrieben<br />
(Nr. 11/09). Offen bleibt, <strong>in</strong>wiefern es sich von<br />
an<strong>der</strong>en Unterrichtsformen abgrenzen lässt.<br />
Für die Klärung dieser Frage werden die Perspektive<br />
<strong>der</strong> Lehrperson und die Perspektive <strong>der</strong><br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>in</strong> Bezug zu den zwei Grundformen <strong>der</strong><br />
geführten und offenen Sequenz verwendet,<br />
welche die Pole e<strong>in</strong>es Kont<strong>in</strong>uums markieren.<br />
Aus <strong>der</strong> Perspektive <strong>der</strong> Lehrperson lässt sich<br />
zeigen, dass sie <strong>in</strong> geführten Sequenzen <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Regel die Elemente Spiel/ Lern<strong>in</strong>halte, die Zielrichtung<br />
<strong>der</strong> Spiel/Lernprozesse, Sozialformen,<br />
Spiel/Lernformen, Spiel/Lernmaterialien,<br />
Raum und Zeit <strong>in</strong> hohem Masse und<br />
durch direkte Führung bestimmt. In offenen<br />
Wahlmöglichkeiten<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong><br />
Sequenzen wird die direkte Führung zurückgenommen<br />
und <strong>in</strong> Aufträge, Posten o<strong>der</strong> Spielangebote<br />
verlegt. Deshalb unterscheiden wir<br />
zwischen direkter und <strong>in</strong>direkter Führung.<br />
Sobald die Perspektive <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> e<strong>in</strong>genommen<br />
wird, kommen die Wahlmöglichkeiten <strong>in</strong>s<br />
Blickfeld. Exemplarisch lässt sich dies im Vergleich<br />
<strong>der</strong> Unterrichtsformen Werkstatt und<br />
freies Spiel darstellen. In <strong>der</strong> Regel ist Werkstattunterricht<br />
dadurch gekennzeichnet, dass<br />
er aus Pflicht und Wahlangeboten mit unterschiedlichen<br />
Anfor<strong>der</strong>ungsniveaus besteht<br />
und pro Werkstattauftrag Inhalt, Spiel/Lernform,<br />
Material, Sozialform und räumliche<br />
Anordnung gegeben s<strong>in</strong>d. <strong>Die</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> können<br />
die Abfolge <strong>der</strong> Werkstattaufgaben, allenfalls<br />
das Anfor<strong>der</strong>ungsniveau, ihre Partner<strong>in</strong>nen<br />
und Partner sowie Wahlangebote wählen. Von<br />
<strong>der</strong> Anlage her bietet das freie Spiel mehr<br />
Wahlmöglichkeiten. Für die Gestaltung <strong>der</strong><br />
Spielangebote bilden zwar die verschiedenen<br />
Elemente, wie sie <strong>in</strong> <strong>der</strong> Abbildung dargestellt<br />
s<strong>in</strong>d, ebenfalls den Rahmen. In diesem Rahmen<br />
können sich Spiel/Lernprozesse <strong>der</strong><br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong> frei entfalten und überraschende Wendungen<br />
nehmen. Im Spiel ergeben sich verschiedene<br />
Spiel/Lernformen, die sich ablösen<br />
o<strong>der</strong> komb<strong>in</strong>iert werden. Das Spiel kann räumlich<br />
erweitert o<strong>der</strong> verlagert werden. Spielgruppen<br />
verän<strong>der</strong>n sich. Das Material angebot<br />
wird den Spielbedürfnissen angepasst und<br />
kann sich über unterschiedlich lange Zeit entwickeln.<br />
Es ist den K<strong>in</strong><strong>der</strong>n zudem möglich,<br />
eigene Spielideen <strong>in</strong> Form kle<strong>in</strong>er Projekte<br />
umzusetzen, die auch E<strong>in</strong>gang <strong>in</strong> geführte<br />
o<strong>der</strong> offene Sequenzen f<strong>in</strong>den. Sowohl die<br />
Wahl <strong>des</strong> Spielangebots wie auch <strong>der</strong> unbestimmte<br />
Spielverlauf erlauben den K<strong>in</strong><strong>der</strong>n,<br />
eigenen Interessen nachzugehen.<br />
Differenzierung und Individualisierung<br />
Nebst den Wahlmöglichkeiten, die eher e<strong>in</strong><br />
äusseres Merkmal offener Sequenzen s<strong>in</strong>d,<br />
macht Lipowsky (2002) darauf aufmerksam,<br />
dass das Augenmerk viel stärker auf die «<strong>in</strong>neren»<br />
Merkmale, nämlich die Gestaltung <strong>der</strong><br />
Spiel und Lernangebote, gelegt werden müsse,<br />
wenn diese für die <strong>in</strong>nere Differenzierung und<br />
Individualisierung genutzt werden sollen.<br />
In Anlehnung an Feige (2005) wird unter <strong>in</strong>nerer<br />
Differenzierung Folgen<strong>des</strong> verstanden:<br />
– Umfang von Spiel- und Lern<strong>in</strong>halten:<br />
<strong>Die</strong>se quantitative Form <strong>der</strong> Differenzierung<br />
berücksichtigt, dass lernschnellere K<strong>in</strong><strong>der</strong><br />
Zusatzaufgaben erhalten. <strong>Die</strong>se sollen kognitiv<br />
stimulierend se<strong>in</strong> und nicht lediglich <strong>der</strong><br />
Beschäftigung dienen.<br />
13