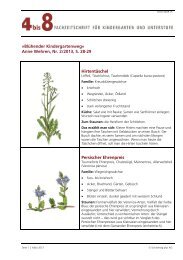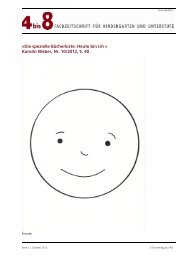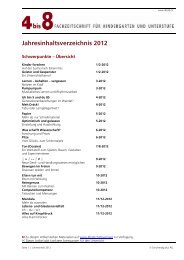Die Bedeutung des freien Spiels in der Kindergartendidaktik - 4bis8
Die Bedeutung des freien Spiels in der Kindergartendidaktik - 4bis8
Die Bedeutung des freien Spiels in der Kindergartendidaktik - 4bis8
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
4 bis 8 | Spezialausgabe | <strong>Die</strong> <strong>Bedeutung</strong> <strong>des</strong> <strong>freien</strong> <strong>Spiels</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>gartendidaktik<br />
Das freie Spiel im K<strong>in</strong><strong>der</strong>garten<br />
Im zweiten Teil dreht sich alles um das freie Spiel. Auf e<strong>in</strong>e begriffliche Klärung folgen<br />
Überlegungen und Anregungen zur päda gogischen, didaktischen und räumlichen<br />
Gestaltung <strong>des</strong> <strong>freien</strong> <strong>Spiels</strong>.<br />
Text: Evelyne Wannack, Ursula Arnaldi, Annalise Schütz<br />
Das Spiel als Phänomen und se<strong>in</strong>e <strong>Bedeutung</strong><br />
für die Bildungsprozesse <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> beschäftigt<br />
verschiedene Wissenschaften seit langem.<br />
Zu def<strong>in</strong>ieren, was Spiel ist, fällt beson<strong>der</strong>s<br />
schwer. Huiz<strong>in</strong>ga (1997) zählt beispielsweise<br />
die Merkmale freies Handeln, Tunalsob sowie<br />
die Bildung e<strong>in</strong>es zeitlichen und räumlichen<br />
Rahmens auf. Scheuerl (1977) verwendet<br />
sechs Merkmale: Ziel und Zweckfreiheit,<br />
Selbstwie<strong>der</strong>holung, Erneuerung <strong>der</strong> Spannung<br />
<strong>in</strong> sich selbst, Sche<strong>in</strong>haftigkeit, <strong>in</strong>nere<br />
Offenheit durch Abgrenzung von aussen und<br />
Gegenwärtigkeit. <strong>Die</strong> funktionsorientierte<br />
Betrachtungsweise rückt die motorischen,<br />
kognitiven, emotionalen und sozialen Funktionen<br />
<strong>des</strong> <strong>Spiels</strong> für die k<strong>in</strong>dliche Entwicklung<br />
<strong>in</strong>s Zentrum (vgl. Schäfer 2005), was sich unter<br />
an<strong>der</strong>em im Auftreten <strong>der</strong> verschiedenen<br />
Spielformen manifestiert.<br />
<strong>Die</strong> beiden Ansätze zeigen die Ambivalenz auf,<br />
ob das pädagogischdidaktisch arrangierte<br />
Spiel noch den genannten Merkmalen entspricht,<br />
wenn gleichzeitig aus <strong>der</strong> funktionsorientierten<br />
Perspektive auf die <strong>Bedeutung</strong> für<br />
die k<strong>in</strong>dliche Entwicklung verwiesen wird. Es ist<br />
wohl nicht zufällig, dass <strong>des</strong>halb die <strong>Bedeutung</strong><br />
<strong>der</strong> Raumgestaltung für das freie Spiel <strong>in</strong><br />
den Vor<strong>der</strong>grund gerückt wird. Der Blick auf<br />
die K<strong>in</strong><strong>der</strong> zeigt, dass sie <strong>in</strong> unterschiedlichen<br />
Situationen, sowohl mit Objekten als auch mit<br />
Personen, e<strong>in</strong>en Spielrahmen herstellen und<br />
das Spiel <strong>in</strong> Gang br<strong>in</strong>gen.<br />
Im K<strong>in</strong><strong>der</strong>garten wird dieses Moment genutzt,<br />
<strong>in</strong>dem die K<strong>in</strong><strong>der</strong> e<strong>in</strong>e pädagogisch gestaltete<br />
Umgebung vorf<strong>in</strong>den. So werden zugleich e<strong>in</strong><br />
Rahmen wie auch Freiräume für das Spiel <strong>der</strong><br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong> geschaffen.<br />
Neue Begrifflichkeiten<br />
E<strong>in</strong> Blick <strong>in</strong> ältere und jüngere Lehrpläne <strong>des</strong><br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>gartens gibt Aufschluss über die unterschiedlichen<br />
Bezeichnungen: Spiel, Freispiel,<br />
freies Spiel, spontanes Spiel, freie Aktivitäten<br />
usw. Nebst <strong>der</strong> begrifflichen Vielfalt kommt<br />
erschwerend h<strong>in</strong>zu, dass die Bezeichnungen<br />
sowohl für die Unterrichtsform wie auch für<br />
die Beschrei bung e<strong>in</strong>es zeitlichen Ab schnitts<br />
während <strong>des</strong> Halbtags verwendet werden.<br />
Im Zuge <strong>der</strong> Reformen machten sich Dozent<strong>in</strong>nen<br />
<strong>der</strong> Stufendidaktik K<strong>in</strong><strong>der</strong>garten Gedanken<br />
zur Begrifflichkeit. Es wurden vier<br />
Formen unterschieden: geführte, angeleitete,<br />
freie und verb<strong>in</strong>dende Sequenz ( Andrist,<br />
Chanson 2003). In <strong>der</strong> Praxis haben sich jedoch<br />
nur die ersten drei Bezeichnungen<br />
durchgesetzt.<br />
Aus zwei Gründen folgen wir <strong>der</strong> vorgeschlagenen<br />
Begrifflichkeit nicht. Zum E<strong>in</strong>en wird<br />
das freie Spiel sowohl <strong>der</strong> angeleiteten als<br />
auch <strong>der</strong> <strong>freien</strong> Sequenz zugeordnet, was zu<br />
e<strong>in</strong>em fortwährenden Klärungsbedarf führt.<br />
Zum An<strong>der</strong>en wird das Spiel als spezifische<br />
Unterrichtsform <strong>des</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> gartens unsichtbar,<br />
wenn auf die Bezeichnung völlig verzichtet<br />
wird. Wir schlagen <strong>des</strong>halb vor, als Ober begriff<br />
für Unterrichtsformen wie das freie Spiel,<br />
Werkstatt, Projektunterricht usw. von offenen<br />
Sequenzen zu sprechen, weil damit e<strong>in</strong><br />
wesentliches Merkmal dieser Unterrichtsformen<br />
benannt wird.<br />
Somit wird auch deutlich, dass wir den Begriff<br />
freies Spiel nicht für die Bezeichnung e<strong>in</strong>es<br />
zeitlichen Abschnitts verwenden, <strong>der</strong> verschiedene<br />
mehr o<strong>der</strong> weniger offene Aktivitäten<br />
umfasst, son<strong>der</strong>n als Bezeichnung e<strong>in</strong>er<br />
k<strong>in</strong><strong>der</strong> garten spezifischen Unterrichtsform.<br />
Gestaltung <strong>des</strong> <strong>freien</strong> <strong>Spiels</strong><br />
<strong>Die</strong> Unterrichtsform freies Spiel hält für die<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong> verschiedene Spielangebote parallel<br />
bereit. <strong>Die</strong> Spielangebote werden mit dem Ziel<br />
<strong>Die</strong> Spielangebote werden mit dem<br />
Ziel <strong>der</strong> Ausgewogenheit bezüglich<br />
Spiel<strong>in</strong>halte, Spielmaterial, Spiel-<br />
und Sozialformen angelegt.<br />
<strong>der</strong> Ausgewogenheit bezüglich Spiel<strong>in</strong>halte,<br />
Spielmaterial, Spiel und Sozialformen angelegt<br />
(s. Abbildung S. 8). Zugleich dienen diese<br />
vier Dimensionen als Orientierung für die<br />
Gestaltung <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen Spielangebote. Ausgangspunkt<br />
bilden die Grobziele <strong>des</strong> Lehrplans,<br />
die sich sowohl auf Entwicklungs als<br />
auch auf Fachbereiche beziehen. <strong>Die</strong> Lehrperson<br />
stellt die Spielangebote so zusammen,<br />
dass die K<strong>in</strong><strong>der</strong> die Möglichkeit erhalten, das<br />
aktuelle Thema zu vertiefen o<strong>der</strong> thematisch<br />
ungebundene Spielangebote zu wählen.<br />
Durch die Wahl <strong>des</strong> Spielmaterials trägt die<br />
Lehrperson nachhaltig zu den Spielmöglichkeiten<br />
e<strong>in</strong>es Spiel angebots bei. In Anlehnung<br />
an Mieskes (1983) unterscheiden wir Spielzeug<br />
und Spielmittel: Spielzeug ist dadurch<br />
7