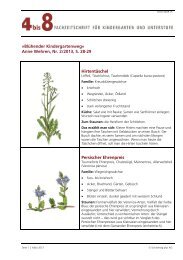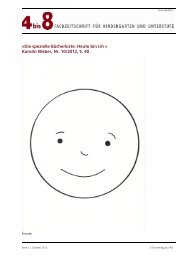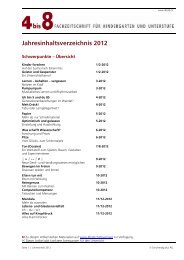Die Bedeutung des freien Spiels in der Kindergartendidaktik - 4bis8
Die Bedeutung des freien Spiels in der Kindergartendidaktik - 4bis8
Die Bedeutung des freien Spiels in der Kindergartendidaktik - 4bis8
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
tetes pädagogischdidaktisches Konzept vor,<br />
das nebst bekannten Elementen auch e<strong>in</strong><br />
neues – das Classroom Management – enthält.<br />
Damit s<strong>in</strong>d zwei weitere Ziel setzungen<br />
verknüpft, die wir als Zugew<strong>in</strong>n betrachten.<br />
Zum E<strong>in</strong>en dient das Konzept als Rahmen, um<br />
das freie Spiel als spezifische Form <strong>des</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>gartens<br />
zu situieren und <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er <strong>Bedeutung</strong><br />
zu stärken. Zum An<strong>der</strong>en schlagen wir e<strong>in</strong>e<br />
Begrifflichkeit vor, welche den didaktischen<br />
Entwicklungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schule<strong>in</strong>gangsstufe im<br />
S<strong>in</strong>ne <strong>der</strong> Anschlussfähigkeit und Weiterentwicklung<br />
Rechnung trägt, denn die Analyse<br />
zeigt, dass sich die didaktischen Kulturen von<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>garten und Unterstufe bereits stark<br />
angenähert haben (Wannack 2004) und sich<br />
weiter an nähern werden.<br />
<strong>Die</strong> drei Ebenen <strong>der</strong> Unterrichtsgestaltung<br />
Zur Beschreibung <strong>der</strong> Unterrichtsgestaltung im<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>garten werden drei Ebenen unterschieden:<br />
Unterrichts sequenzen, Spiel und Lernbegleitung<br />
sowie Classroom Management<br />
(s. Abbildung unten). Den Rahmen für die<br />
Unterrichtsgestaltung bildet die Ebene <strong>der</strong><br />
gesetzlichen Grundlagen, die unter an<strong>der</strong>em<br />
Bildungsauftrag und Bildungsziele enthalten.<br />
Im Lehrplan erfolgt e<strong>in</strong>e Konkretisierung<br />
anhand von Leitideen, Richt und Grobzielen –<br />
künftig allenfalls Kompetenzen. Nebst <strong>in</strong>haltlichen<br />
Aspekten werden durch die gesetzlichen<br />
Grundlagen auch organisatorische und strukturelle<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen vorgegeben,<br />
welche für die Unterrichtsgestaltung konstitutiv<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
Im Zentrum <strong>der</strong> Unterrichtsgestaltung steht<br />
die Ebene <strong>der</strong> Unterrichtssequenzen. Wir<br />
gehen von zwei Grundformen – den geführten<br />
und den offenen Sequenzen – aus. <strong>Die</strong> beiden<br />
Grundformen s<strong>in</strong>d für uns analytische<br />
Kategorien, welche e<strong>in</strong>e Verb<strong>in</strong>dung zwischen<br />
den beiden Polen e<strong>in</strong>es Kont<strong>in</strong>uums markieren.<br />
<strong>Die</strong> geführten Sequenzen weisen auf e<strong>in</strong>e<br />
direkte Führung durch die Lehrperson h<strong>in</strong>,<br />
während sich offene Sequenzen vor allem<br />
durch e<strong>in</strong> von <strong>der</strong> Lehrperson arrangiertes,<br />
vielfältiges Spiel und Lernangebot auszeichnen.<br />
Für die K<strong>in</strong><strong>der</strong> wirkt sich das <strong>in</strong>sofern aus,<br />
dass die Wahlfreiheit von geführten zu offenen<br />
Sequenzen zunimmt. <strong>Die</strong>se qualitativen<br />
Verschiebungen werden anhand <strong>der</strong> Dimensionen<br />
Spiel und Lern <strong>in</strong>halte, Unterrichts und<br />
Sozialformen beschrieben.<br />
4 bis 8 | Spezialausgabe | <strong>Die</strong> <strong>Bedeutung</strong> <strong>des</strong> <strong>freien</strong> <strong>Spiels</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>gartendidaktik<br />
Mit <strong>der</strong> Ebene Spiel und Lernbegleitung br<strong>in</strong>gen<br />
wir zum Ausdruck, dass diese nicht nur <strong>in</strong><br />
offenen, son<strong>der</strong>n auch <strong>in</strong> geführten Sequenzen<br />
zur Anwendung kommt. Nachdem die<br />
Lehrperson e<strong>in</strong>e bestimmte Unterrichtsform<br />
angelegt hat, wendet sie sich e<strong>in</strong>zelnen K<strong>in</strong><strong>der</strong>n<br />
o<strong>der</strong> Gruppen zu, um E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> Lernprozesse<br />
zu erhalten und diese zu unterstützen.<br />
<strong>Die</strong> dritte Ebene <strong>des</strong> Classroom Managements<br />
bedarf als neues Element <strong>der</strong> näheren Erklärung.<br />
In <strong>der</strong> Ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>setzung mit <strong>der</strong><br />
Unterrichtsgestaltung im K<strong>in</strong><strong>der</strong>garten traten<br />
immer wie<strong>der</strong> Themen wie Raumgestaltung,<br />
Rituale, Regeln o<strong>der</strong> Rhythmisierung auf. Es<br />
fiel jedoch schwer, diese konzeptionell zu fassen,<br />
da sie ähnlich wie die Spiel und Lernbegleitung<br />
nicht nur e<strong>in</strong>zelne Unterrichtssequenzen<br />
betreffen, son<strong>der</strong>n e<strong>in</strong>e übergreifende<br />
und notwendige Bed<strong>in</strong>gung für das Gel<strong>in</strong>gen<br />
<strong>des</strong> Unterrichts s<strong>in</strong>d. <strong>Die</strong> Suche nach e<strong>in</strong>em<br />
geeigneten Modell zur Beschreibung dieser<br />
Ebene führte zum Classroom Management,<br />
das im angloamerikanischen Raum weit verbreitet<br />
ist. E<strong>in</strong>es davon ist das Modell von<br />
Evertson, Emmer, Worsham (2003), das<br />
anhand empirischer Erkenntnisse aus K<strong>in</strong><strong>der</strong>garten<br />
und Primarstufe entwickelt wurde.<br />
Zentrale Elemente <strong>des</strong> Classroom<br />
Managements<br />
Das Modell von Evertson, Emmer, Worsham<br />
umfasst die folgenden Elemente:<br />
Bildungsauftrag<br />
Rituale<br />
– Geme<strong>in</strong>schaftsbildung<br />
– Konfliktlösungen<br />
Beobachten<br />
Spiel-, Lern<strong>in</strong>halte<br />
Unterrichtsformen<br />
Sozialformen<br />
Raumgestaltung<br />
– Raumstruktur, -organisation<br />
– E<strong>in</strong>richtung, Mobiliar, Medien<br />
Das neue pädagogische Konzept im Überblick.<br />
Gesetzliche Grundlagen<br />
Unterrichtsgestaltung<br />
Classroom Management<br />
Spiel- und Lernbegleitung<br />
Unterrichtssequenzen<br />
Geführte Sequenzen<br />
– themengebunden<br />
– darbietende Formen<br />
– erarbeitende Formen<br />
– Gruppenunterricht usw.<br />
– Klasse<br />
– Gruppen<br />
– Zweiergruppen<br />
Unterstützen<br />
Lehrplan<br />
– Bei <strong>der</strong> Raumgestaltung geht es um Überlegungen,<br />
auf welche Weise Sitzkreis, Spielund<br />
Lernangebote anzulegen s<strong>in</strong>d und wie<br />
häufig benutzte Materialien zugänglich<br />
gemacht werden, um möglichen Störungen<br />
bei <strong>der</strong> parallelen Nutzung, beim Wechsel<br />
von Spiel und Lernangeboten vorzubeugen.<br />
– Regeln auf allgeme<strong>in</strong>e Verhaltensweisen,<br />
fokussieren wie zum Beispiel die an<strong>der</strong>en<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>, und was ihnen gehört zu respektieren.<br />
Prozeduren beziehen sich auf organisatorische<br />
Aspekte wie die Organisation<br />
<strong>des</strong> Aufräumens am Schluss e<strong>in</strong>er offenen<br />
Sequenz.<br />
– Zu Regeln und Prozeduren gehört, dass die<br />
Lehrperson die K<strong>in</strong><strong>der</strong> beim E<strong>in</strong>halten unterstützt<br />
und Interven tionsstrategien bereithält.<br />
– Damit die K<strong>in</strong><strong>der</strong> selbstständig spielen, und<br />
lernen dafür Verantwortung zu übernehmen,<br />
muss die Lehrperson Aufgaben und<br />
Angebote entsprechend arrangieren. Sie vergewissert<br />
sich, womit die K<strong>in</strong><strong>der</strong> beschäftigt<br />
s<strong>in</strong>d und lässt sich von ihnen zeigen, was sie<br />
alles bearbeitet haben.<br />
– Mit <strong>der</strong> Umschreibung «Schwung behalten»<br />
wird die Aufmerksamkeit auf die Rhythmisierung<br />
<strong>der</strong> Unterrichtssequenzen sowie auf<br />
Übergänge gelegt, die zu e<strong>in</strong>em geschmeidigen<br />
Unterrichtsverlauf und abschluss beitragen.<br />
Nach dem <strong>freien</strong> Spiel folgt beispielsweise<br />
e<strong>in</strong> Schlusskreis, <strong>in</strong> dem das freie Spiel<br />
reflektiert wird und Anliegen <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> für<br />
die weitere Planung aufgenommen werden.<br />
Rhythmisierung<br />
– Zwischen Sequenzen<br />
– Innerhalb Sequenzen<br />
Analysieren<br />
Offene Sequenzen<br />
– themengebunden<br />
– themenungebunden<br />
– freies Spiel<br />
– Tages-, Wochenplan<br />
– Werkstattunterricht usw.<br />
– E<strong>in</strong>zeln<br />
– Zweiergruppe<br />
– Gruppe<br />
Regeln, Prozeduren<br />
– soziale Interaktionen<br />
– organisatorische Abläufe<br />
Bildungsziele<br />
5