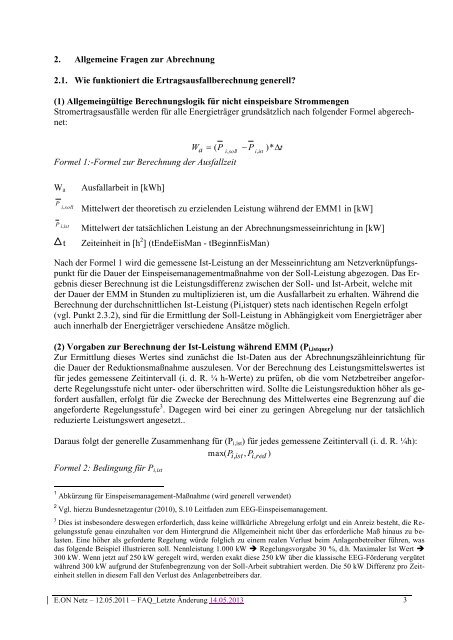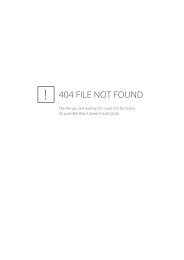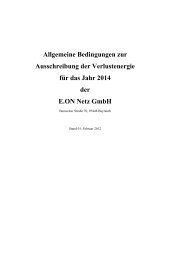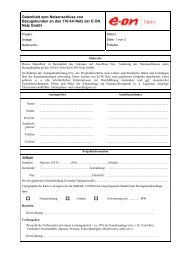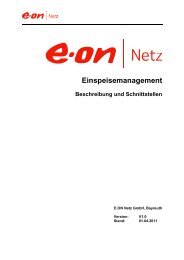FAQ zum Einspeisemanagement 27.09.2012 ... - E.ON Netz GmbH
FAQ zum Einspeisemanagement 27.09.2012 ... - E.ON Netz GmbH
FAQ zum Einspeisemanagement 27.09.2012 ... - E.ON Netz GmbH
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2. Allgemeine Fragen zur Abrechnung2.1. Wie funktioniert die Ertragsausfallberechnung generell?(1) Allgemeingültige Berechnungslogik für nicht einspeisbare StrommengenStromertragsausfälle werden für alle Energieträger grundsätzlich nach folgender Formel abgerechnet:Wa ( P P )*ti,soll i,istFormel 1:-Formel zur Berechnung der AusfallzeitW aAusfallarbeit in [kWh]Pi , sollMittelwert der theoretisch zu erzielenden Leistung während der EMM1 in [kW]P i , ist Mittelwert der tatsächlichen Leistung an der Abrechnungsmesseinrichtung in [kW]tZeiteinheit in [h 2 ] (tEndeEisMan - tBeginnEisMan)Nach der Formel 1 wird die gemessene Ist-Leistung an der Messeinrichtung am <strong>Netz</strong>verknüpfungspunktfür die Dauer der <strong>Einspeisemanagement</strong>maßnahme von der Soll-Leistung abgezogen. Das Ergebnisdieser Berechnung ist die Leistungsdifferenz zwischen der Soll- und Ist-Arbeit, welche mitder Dauer der EMM in Stunden zu multiplizieren ist, um die Ausfallarbeit zu erhalten. Während dieBerechnung der durchschnittlichen Ist-Leistung (Pi,istquer) stets nach identischen Regeln erfolgt(vgl. Punkt 2.3.2), sind für die Ermittlung der Soll-Leistung in Abhängigkeit vom Energieträger aberauch innerhalb der Energieträger verschiedene Ansätze möglich.(2) Vorgaben zur Berechnung der Ist-Leistung während EMM (P i,istquer )Zur Ermittlung dieses Wertes sind zunächst die Ist-Daten aus der Abrechnungszähleinrichtung fürdie Dauer der Reduktionsmaßnahme auszulesen. Vor der Berechnung des Leistungsmittelswertes istfür jedes gemessene Zeitintervall (i. d. R. ¼ h-Werte) zu prüfen, ob die vom <strong>Netz</strong>betreiber angeforderteRegelungsstufe nicht unter- oder überschritten wird. Sollte die Leistungsreduktion höher als gefordertausfallen, erfolgt für die Zwecke der Berechnung des Mittelwertes eine Begrenzung auf dieangeforderte Regelungsstufe 3 . Dagegen wird bei einer zu geringen Abregelung nur der tatsächlichreduzierte Leistungswert angesetzt..Daraus folgt der generelle Zusammenhang für (P i,ist ) für jedes gemessene Zeitintervall (i. d. R. ¼h):max ( P i, ist , Pi, red )Formel 2: Bedingung für P i,ist1 Abkürzung für <strong>Einspeisemanagement</strong>-Maßnahme (wird generell verwendet)2 Vgl. hierzu Bundesnetzagentur (2010), S.10 Leitfaden <strong>zum</strong> EEG-<strong>Einspeisemanagement</strong>.3 Dies ist insbesondere deswegen erforderlich, dass keine willkürliche Abregelung erfolgt und ein Anreiz besteht, die Regelungsstufegenau einzuhalten vor dem Hintergrund die Allgemeinheit nicht über das erforderliche Maß hinaus zu belasten.Eine höher als geforderte Regelung würde folglich zu einem realen Verlust beim Anlagenbetreiber führen, wasdas folgende Beispiel illustrieren soll. Nennleistung 1.000 kW Regelungsvorgabe 30 %, d.h. Maximaler Ist Wert 300 kW. Wenn jetzt auf 250 kW geregelt wird, werden exakt diese 250 kW über die klassische EEG-Förderung vergütetwährend 300 kW aufgrund der Stufenbegrenzung von der Soll-Arbeit subtrahiert werden. Die 50 kW Differenz pro Zeiteinheitstellen in diesem Fall den Verlust des Anlagenbetreibers dar.E.<strong>ON</strong> <strong>Netz</strong> – 12.05.2011 – <strong>FAQ</strong>_Letzte Änderung 14.05.2013 3