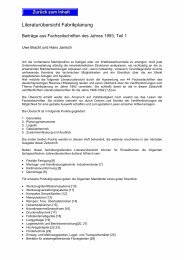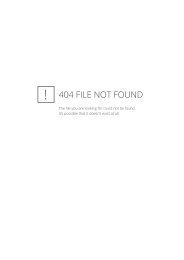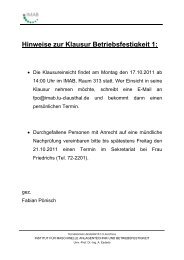Literaturübersicht Fabrikplanung 1980.
Literaturübersicht Fabrikplanung 1980.
Literaturübersicht Fabrikplanung 1980.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Literaturübersicht</strong> <strong>Fabrikplanung</strong><br />
Beiträge aus Fachzeitschriften des Jahres 1980, Teil 1<br />
Zwar scheint die Talsohle der weltweit zu beobachtenden wirtschaftlichen Rezession noch nicht<br />
erreicht zu sein, glaubt man den Angaben der prognostizierenden Fachministerien und<br />
Wirtschaftsinstitute. Gleichwohl lassen sich nach der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung befragte<br />
Aussteller der Hannover-Messe '81 durchaus optimistisch vernehmen. Insbesondere die Daten- und<br />
Informationstechnik verweist zufrieden auf volle Auftragsbücher und festigt damit nach allgemeiner<br />
Einschätzung ihre Rolle als Wachstumsträger der kommenden Jahre. Aber auch Maschinenbau und<br />
Elektrotechnik geben sich zuversichtlich, wenngleich dies an den konjunkturellen Aussichten<br />
zumindest mittelfristig kaum etwas ändern dürfte. Nach wie vor behindert die restriktive Geldpolitik der<br />
Bundesbank nach Meinung vieler Experten eine dringend erforderliche expansive Investitionspolitik.<br />
Die hiermit vorgelegte <strong>Literaturübersicht</strong> zum Thema "<strong>Fabrikplanung</strong>" für das Jahr 1980 hat vor diesem<br />
Hintergrund nichts an ihrer Bedeutung eingebüßt. Vielmehr wird dem interessierten Leser wiederum<br />
die Gelegenheit geboten, sich in Kürze einen umfassenden Überblick über die wichtigsten<br />
Fachveröffentlichungen zu verschaffen. Ausgewertet wurden etwa 40 Fachzeitschriften des<br />
deutschsprachigen Raumes. Damit wird die Reihe der <strong>Literaturübersicht</strong>en der Jahre 1970 bis 1979 [1-<br />
8] fortgesetzt.<br />
Die in den vergangenen Jahren gewählte Gliederung der ausgewählten Literaturfülle in fachlich in sich<br />
geschlossene Schwerpunkte hat sich bewährt und wird beibehalten.<br />
1. Methodik der <strong>Fabrikplanung</strong><br />
2. Planungshilfsmittel<br />
3. Standortplanung und Standortwahl<br />
4. Layoutplanung<br />
5. Materialfluß<br />
6. Lagerplanung<br />
7. Arbeitsplatzgestaltung<br />
8. Energieversorgung und Brandschutz<br />
9. Kosten<br />
10. Zusammenfassung und Ausblick.<br />
Eine Vollständigkeit hinsichtlich der veröffentlichten Fachbeiträge kann nicht gewährleistet werden.<br />
Vielmehr versteht sich diese Übersicht als Anregung zum eigenen Literaturstudium und nicht als<br />
dessen Ersatz.<br />
Im vorliegenden Teil 1 werden die ersten fünf Gliederungspunkte behandelt; der abschließende Teil 2<br />
ist für die nächste Ausgabe dieser Zeitschrift geplant.<br />
1. Methodik der <strong>Fabrikplanung</strong> [9-30]<br />
Die Neu- oder Umplanung einer Fabrik hat sich stets an den realen Gegebenheiten der Produktion zu<br />
orientieren. In Anbetracht des weitgreifenden strukturellen Wandels der Produktionsbedingungen ist<br />
den Bestimmungsfaktoren moderner Produktionskonzepte bereits während des Planungsprozesses<br />
Rechnung zu tragen. Vor diesem Hintergrund entwickeln Wiendahl / Greim [9] wesentliche<br />
Schwerpunkte einer anforderungsgerechten <strong>Fabrikplanung</strong>, die insbesondere die aktuellen<br />
Forderungen nach hoher Produktivität und Flexibilität der Produktionseinrichtungen sowie nach<br />
ausreichender Arbeitsplatzattraktivität berücksichtigen.<br />
Langfristige Investitionsvorhaben erfordern weitsichtige Überlegungen und müssen auf einer langfristig<br />
angelegten unternehmerischen Zielkonzeption beruhen. Nach Aggteleky [10] besteht diese Konzeption<br />
aus kurz-, mittel- und langfristigen Komponenten, die ein in sich geschlossenes Zielsystem bilden<br />
müssen. Die Harmonisierung erfolgt durch die koordinierende Funktion bestimmter grundsätzlicher<br />
unternehmerischer Richtlinien. Die Zielkonzeption kann in Form einer Matrix dargestellt werden, die<br />
durch fünf Sachbereiche und vier Zielebenen aufgespannt wird. Vor Beginn der eigentlichen Planung<br />
sind sowohl die grundsätzlichen Aspekte als auch die strategischen Zielfaktoren und Prioritäten der<br />
Unternehmenspolitik einer Lagebeurteilung und Bereinigung bzw. Aktualisierung zu unterziehen.
Außerdem ist der zeitliche Planungshorizont den Erfordernissen der <strong>Fabrikplanung</strong> anzupassen.<br />
Hierfür schlägt der Verfasser Kriterienpläne in Form von Checklisten vor [11].<br />
Ein weiterer Beitrag des Verfassers befaßt sich mit der Bildung von Betriebsbereichen [12]. Es wird<br />
insbesondere der raschen Entwicklung der Betriebstechnik (Automatisierung, Mechanisierung) und<br />
dem zunehmenden Einsatz der EDV bei der Steuerung betrieblicher Abläufe Rechnung getragen. So<br />
zeigt sich, daß durch eine zunehmende Zentralisierung der Steuerungs- und Führungsfunktionen und<br />
durch die allmähliche Verlagerung derselben auf die EDV die Größe der Betriebsbereiche als<br />
organisatorische Einheit ständig wächst.<br />
An zwei Beispielen realisierter Werksplanungen kann die methodische Vorgehensweise verdeutlicht<br />
werden. Schmitt [13] beschreibt die Planung einer Werkzeugmaschinenfabrik. Im Rahmen der<br />
Optimierungsstudie werden die Ergebnisse der Ist-Analyse im Vergleich mit den vorgegebenen<br />
Unternehmenszielen auf ihre künftige Gültigkeit hin untersucht und entsprechend angepaßt. Es folgt<br />
eine Idealplanung, die nach einer die realen Randbedingungen berücksichtigenden Überarbeitung der<br />
Unternehmensleitung zur Entscheidung vorgelegt wird. Die Feinplanung ist der nächste Schritt. Die<br />
Ausführungsplanung erfolgt unter Zuhilfenahme der Netzplantechnik, die eine genaue Verfolgung von<br />
Terminen und Kosten ermöglicht.<br />
Im konkreten Planungsfall stellt Stawowy [14] eine allgemeingültige Planungsmethodik für<br />
Edelstahlkaltwalzwerke vor. Ausgehend von einer Marktanalyse wird das künftige Erzeugnisprogramm<br />
entwickelt. Anschließend werden die möglichen Arbeitsverfahren analysiert und die geeignetsten<br />
ausgewählt. Nachdem die Arbeitspläne festgelegt sind, kann die Zuordnung der Betriebsbereiche<br />
erfolgen.<br />
Auf die Besonderheiten einer Industriebauplanung im Falle von Rekonstruktionsmaßnahmen gehen<br />
Kluge / Hofmann [15] ein. Zielvorstellung hier ist die optimale Nutzung vorhandener Bausubstanz unter<br />
Berücksichtigung bereits vorhandener Infrastrukturen. An drei Beispielen werden die jeweiligen<br />
Planungsziele konkretisiert.<br />
Für Planungsvorhaben in Entwicklungsländern gelten zumeist andere Kriterien. Zwar kann der<br />
generelle Planungsablauf beibehalten werden. In bestimmten Phasen ist jedoch ein anderer<br />
Feinheitsgrad vonnöten. Dies gilt insbesondere für die einzusetzende Technologie. Mit Blick auf den<br />
Arbeitsmarkt meint Strizik [16], daß Technologie und Produktionsanlage nur ein Minimum an<br />
qualifizierten Facharbeitern erfordern sollten. Die Einrichtungen müssen leistungsfähig und trotzdem<br />
einfach zu bedienen und zu warten sein. Eine besondere Bedeutung kommt demnach der<br />
Personalplanung sowie auch der Organisation zu.<br />
Eine Reihe von Beiträgen befaßt sich mit Steuerung und Management von Projekten. Scheel [17]<br />
untersucht die Vor- und Nachteile des Projekt-Managements. Hierzu zählt er neben der Methode der<br />
Menschenführung und Motivation alle Bereiche, die man unter dem Begriff Systems Engineering<br />
(Systemtechnik) zusammenfassen kann. Damit ist ein weitreichendes Instrumentarium zur Lösung<br />
komplexer Probleme angesprochen, zu dem auch die Netzplantechnik zählt. Wesentlich für den Erfolg<br />
des Projekt-Managements ist die geeignete Aufbau- und Ablauforganisation. Mit dieser<br />
Steuerungsmethode können nach Angaben des Verfassers die Gesamtprojektkosten bis zu 10%<br />
gesenkt werden.<br />
Immer häufiger stellt sich die Forderung nach einem eindeutigen Bewertungskriterium, das für<br />
Planungs- und Ausführungsentscheidungen im Sinne einer Meßgröße den Einfluß auf die<br />
Gesamtprojektentwicklung aufzeigt. Für die Projektsteuerung von Großbauten wird von Greiner [18]<br />
eine entsprechende Problemstellung definiert und ein Lösungsansatz entwickelt. Mit der vorgestellten<br />
Gesamtkonzeption kann die definierte Zielgröße "Betrieblicher Aufwand/ Zeiteinheit" kontinuierlich im<br />
Projektablauf verfolgt werden. Zudem ist auf der Basis von Soll-lst-Analysen eine Kontrolle von<br />
Veränderungen der Zielvorgaben des Gesamtsystems möglich.<br />
Die Problematik bei der Leitung komplexer Bauvorhaben in der Vorbereitungs- und<br />
Projektierungsphase behandeln Knöpfel / Lässker [19]. Mit wachsender Komplexität gewinnt die<br />
organisatorisch-führungstechnische Arbeit rasch an Bedeutung. So ist z. B. bereits in der<br />
Vorprojektphase eine deutliche Strukturierung der verschiedenen betrieblichen Subsysteme,<br />
Arbeitsarten, Kostenstellen, Projektierungs- und Bauausführungsetappen sowie eine Gliederung in<br />
Betriebsbereiche durchaus von Vorteil. Es sollten auch die ersten Groblayouts erstellt werden. Ebenso<br />
sollte bereits frühzeitig die mögliche Wirtschaftlichkeit des Projektes untersucht werden.
Einen oftmals vernachlässigten Aspekt der <strong>Fabrikplanung</strong> zeigt der Beitrag von Gahler [20] auf, der<br />
sich mit den Aufgaben eines Architekten in der Industrieprojektierung befaßt. Der Verfasser macht<br />
deutlich, daß ein Industriebau nicht nur einen Gebrauchswert, sondern zugleich einen Maßstab für die<br />
ästhetischen Qualitäten menschlichen Schaffens darstellt. Es ist deshalb notwendig, neben der rein<br />
auf die Funktion abgestellten Planung auch auf die optische Gestaltung von Industriebauten zu achten.<br />
Da es auch für den versierten Fabrikplaner stets von Interesse ist, wie "es denn andere gemacht<br />
haben", sei abschließend auf einige Veröffentlichungen hingewiesen, die realisierte Planungsvorhaben<br />
bis hin zur detaillierten Ausführung beschreiben.<br />
Konzeption und Gestaltung einer Fabrik für elektronische Geräte werden im Beitrag von Bärmann [21]<br />
vorgestellt. Dieser Werksneubau wurde speziell auf die Erfordernisse des Produktes abgestimmt, für<br />
dessen Herstellung ein neues Fertigungskonzept erforderlich war. Der Bau einer Montagehalle für<br />
Fahrzeugkrane wird in [22] gezeigt. Die Fertigung der Krane erfolgt mit getakteten Fließstraßen. Bei<br />
Planung und Bau einer schweizerischen Maschinenfabrik mit Kleinserienfertigung wurde besonders<br />
auf energietechnische Einzellösungen (Solartechnik) geachtet [23]. Wenzke [24] stellt die<br />
verschiedenen Projektierungs- und Baustufen für die Errichtung eines Zementwerkes vor. Hier wurde<br />
besonders auf eine städtebaulich tragbare Lösung geachtet. Weitere ausgeführte Planungen:<br />
• Aluminium-Umschmelzwerk [25]<br />
• Kaltwalzwerk [26]<br />
• Stranggießanlage [27]<br />
• Eisengießerei [28]<br />
• Möbelfabrik [29]<br />
• Fensterfabrik [30].<br />
2. Planungshilfsmittel [31-42]<br />
Bei der Bearbeitung der vorliegenden Jahresübersicht stellte sich heraus, daß in der Entwicklung<br />
einfacher und auf viele Planungsfälle anwendbarer Hilfsmittel offenbar ein gewisser Stillstand<br />
eingetreten ist. Der fachliche Inhalt dieses Kapitels ist deshalb bewußt auf Randaspekte des<br />
eigentlichen Planungsprozesses ausgedehnt worden, die gleichwohl für den Fabrikplaner von hohem<br />
Interesse sind.<br />
Einer dieser Aspekte zielt auf die letztlich die <strong>Fabrikplanung</strong> bestimmende Unternehmenspolitik ab. Bei<br />
der Bestimmung der Unternehmenspolitik hat die Unternehmensleitung eine Vielzahl politischer,<br />
wirtschaftlicher und sozialer Faktoren zu berücksichtigen. Diese Faktoren werden in der Regel stets<br />
erst kombiniert entscheidend wirksam. Die von Schwab [31] erläuterte strategische Matrix stellt ein<br />
durchaus wirksames Hilfsmittel zur Bildung entscheidungsrelevanter Faktorenkombinationen dar. Die<br />
Attraktivität einer Produkt-Markt-Standort-Kombination wird aufgrund von fünf Kriterien<br />
(Branchenattraktivität, Rohstoffattraktivität, Standortattraktivität, soziale Attraktivität und Attraktivität<br />
des Konkurrenzvorsprunges) in fünf entsprechenden Attraktivitätsschemata untersucht. Die<br />
Beurteilung erfolgt durch die Bildung von Gefahren-, Warn- und Chancenzonen.<br />
Zur Bewertung und Beurteilung von Investitionsentscheidungen beschreibt Dusseiller [32] das<br />
Evaluationsverfahren ICEPS (Interactive Cross Evaluation and Portfolio Selection). Diese Methode<br />
beruht auf dem Zusammenfassen fachlich-objektiver Erkenntnisse und mehr oder weniger subjektiver<br />
Beurteilungen. Das Zusammenführen von objektiven und subjektiven Aspekten in einer einzigen<br />
Beurteilungsmethode bietet nach Ansicht des Verfassers die optimale Voraussetzung für eine<br />
Entscheidungsfindung. ICEPS vollzieht sich in zwei Schritten. Zunächst wird eine Bewertung eines<br />
Projekts oder auch nur einer Projektidee nach den objektiven Gesichtspunkten Technik, Markt,<br />
Vorgaben und Konsequenzen vorgenommen Erst im zweiten Schritt kommen die subjektiven<br />
firmenpolitisch bedingten Gesichtspunkte zum Tragen: Stärken, Gelingen, Risiken, Interesse. Die<br />
Gleichzeitigkeit de Betrachtung objektiver und subjektiver Gesichtspunkte führt zu einer Bewertungsund<br />
Beurteilungsmatrix.<br />
Mit Möglichkeiten der Entscheidungsfindung in einem informationsverarbeitender System für die<br />
Projektierung befaßt sich der Beitrag von Gottschalk / Schenk [33]. Durch eine geeignete<br />
Strukturierung des Problems ergibt sich die Möglichkeit des Einsatzes der EDV. Wesentlich erscheint<br />
den Verfassern insbesondere die Art der zu treffender Entscheidung. Es werden vier grundsätzlich
unterschiedliche Modelle aufgezeigt (Entscheidung unter Sicherheit, unter Risiko unter Ungewißheit,<br />
zur zeitlichen Entwicklung), für die die jeweiligen Vorgehensregeln dargestellt werden.<br />
Eine mittlerweile deutlich verbreitete und akzeptierte Planungshilfe ist die Szenariotechnik. Auch bei<br />
mittleren und kleiner Unternehmen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß die Gewinnung von<br />
Wissen um die künftigen Umweltentwicklungen eine wesentliche Voraussetzung für die eigene<br />
Vorgehensweise ist. Gomez / Escher [34] zeigen auf, wie sich diese junge Planungstechnik sinnvoll in<br />
das Kontroll- und Planungsinstrumentarium eines fortschrittlichen Managements einfügt. Den<br />
erfolgversprechendsten Einsatz sehen sie auf den Gebieten der strategischen Planung und des<br />
prophylaktischen Managements. Es wird jedoch eindringlich darauf hingewiesen, daß von der<br />
Szenariotechnik keine detaillierte Handlungsanweisung erwartet werden darf. Vielmehr erlaubt erst<br />
eine eingehende Interpretation der Szenarien einen Rückschluß auf die eigene künftige<br />
Handlungsweise. An einem Beispiel wird diese moderne Technik vorgestellt.<br />
Die Vorteile der Netzplantechnik besonders für umfangreiche Projekte werden in dem Beitrag von [35]<br />
eindrucksvoll dargestellt. Berichtet wird über das Leipziger Programmpaket Netzplantechnik (LEINET),<br />
bei dessen Aufbau die weitreichende Ähnlichkeit vieler Planungsprojekte berücksichtigt wurde. So<br />
entstanden etwa 30 verschiedene Standardnetzpläne, die lediglich um projektspezifische Daten zu<br />
ergänzen sind. LEINET dient der Terminrechnung und Bilanzierung. In etwa 30 Netzplanrechnungen<br />
zeigte sich, daß der Gesamtplanungsaufwand durchaus reduziert wird. Geplant ist eine Erweiterung<br />
der augenblicklichen Version zur Berechnung von bis zu 5000 Vorgängen in einem Netzplan.<br />
Ein wesentlicher Schritt bei jedem <strong>Fabrikplanung</strong>sprozeß ist die Ermittlung des künftigen Bedarfs an<br />
Fertigungsmitteln. Dieser Planungsvorgang ist aufgrund der Vielzahl der zu verarbeitenden<br />
Informationen und Daten i. d. R. mit einem hohen Kostenaufwand verbunden.<br />
Mit einer Reihe von teilweise einfachen Maßnahmen läßt sich der aufwendigste Teil einer<br />
Fertigungsmittelplanung, nämlich die Datenerfassung, erheblich rationalisieren. Die von Wievelhove<br />
[36] dargestellten Vorgehensweisen führen zu einem reduzierten Zeitaufwand für die<br />
Datenbereitstellung, mindern den Personaleinsatz und tragen zur Kostensenkung bei. Da diese<br />
Planungskomponenten direkt vom Umfang des zu betrachtenden Werkstück-Spektrums abhängig<br />
sind, liegt es nahe, lediglich ein stark reduziertes, aber trotzdem repräsentatives Spektrum zu<br />
erfassen. Beispielsweise kann sich die Planung nur auf belegungszeitintensive Werkstücke<br />
beschränken und dennoch, wie der Verfasser nachweist, eine erforderliche Genauigkeit erreichen.<br />
Ferner sollten alle die Werkstücke von der Untersuchung ausgeschlossen bleiben, die für die im<br />
Vorfeld der Untersuchung klar umrissenen Auswertungsziele nicht relevant sind.<br />
Voraussetzung einer rationellen Datenbereitstellung für den Planungsprozeß ist eine möglichst direkte<br />
Verfügbarkeit der benötigten Daten. Günstig ist eine gut funktionierende betriebliche Datenerfassung.<br />
Einen Uberblick über die z. Z. angebotene Hardware gibt Roschmann [37].<br />
Ein mittlerweile stark verbreitetes Planungshilfsmittel ist die Simulationstechnik. Im folgenden wird über<br />
einige Beiträge berichtet, die sich insbesondere mit der Simulation von Fertigungsabläufen zur<br />
Beurteilung der Effektivität der gewählten Maschinenanordnung beschäftigen. Auf<br />
Simulationsmöglichkeiten im Lager- und Transportbereich wird in Kap. 5 näher eingegangen.<br />
Grundig [38] schildert Strategien und Probleme bei der Modelikonzeption und beschreibt den<br />
gegenwärtigen Erkenntnisstand sowie Analysetendenzen. Der Verfasser stellt fest, daß eine<br />
einheitliche anerkannte Definition der Simulationsmethode nicht vorliegt, so daß je nach<br />
Betrachtungsstandpunkt und Einsatzzweck voneinander abweichende und sich überschneidende<br />
Definitionen angeführt werden. Eine Analyse verschiedener Simulationsuntersuchungen zeigt, daß<br />
diese bezüglich Zielstellung, Modelikonzeption, Versuchsbedingungen, Strategie der<br />
Ergebnisauswertung sowie der Ergebnisaussagefähigkeit äußerst unterschiedlich bzw. teilweise<br />
widersprüchlich sind, so daß die Ubernahme und Verallgemeinerungsfähigkeit der erzielten<br />
Ergebnisse sowohl für die Praxis als auch für Zwecke der Forschungsarbeit sehr problematisch ist. Für<br />
den Verfasser ergibt sich damit die Notwendigkeit eines lediglich punktuellen Einsatzes des<br />
Simulationsinstrumentariums, der auf nur bedingt verallgemeinerungsfähige, sehr spezielle<br />
Fragestellungen beschränkt werden sollte.<br />
Mit der Simulation von verketteten bzw. flexiblen Fertigungssystemen befassen sich die Beiträge von<br />
Veltin [39], Chmielnicki [40] und Rudolph / Stanek [41]. Diesesehrmodernen<br />
Fertigungskonzeptewurden bislang nur selten realisiert, da bei vielen potentiellen Anwendern noch
erhebliche Unsicherheiten bezüglich der Investitionsbeurteilung im Planungsstadium bestehen. Mit<br />
dem von Veltin [39] vorgestellten Simulator MUSIK (Modularer Simulator für verkettete<br />
Fertigungssysteme) läßt sich das dynamische Verhalten eines geplanten Systems ermitteln. Wichtige<br />
Kenngrößen wie Produktionsleistung und Auftragsdurchlaufzeit können in Abhängigkeit von aufbauund<br />
ablauforganisatorischen Parametern festgelegt werden.<br />
Chmielnicki [40] stellt das zeitdiskrete digitale Simulationssystem SIKTAS (Simulation komplexer<br />
technischer Anlagen und Systeme) vor. Es eignet sich speziell für die Planung flexibler<br />
Fertigungssysteme. Dabei werden primär Daten über das Zeitverhalten solcher Anlagen gewonnen,<br />
mit denen eine Auslastungsoptimierungvorgenommenwerden kann.<br />
Das von Rudolph / Stanek [41] beschriebene Simulationsmodell MAOPRO (mathematisch-analytischoptimale<br />
Projektierung) optimiert die zu projektierenden Bearbeitungs-, Transport- und Lagerprozesse<br />
von integrierten Fertigungen. Alle Teilmodelle von MAOPRO sind graphentheoretisch fundiert. Die<br />
Zielfunktionen der verschiedenen Modelle sind der Hauptzielfunktion des<br />
Maschinenbelegungsproblems untergeordnet. Wichtigstes Zielkriterium ist die minimale<br />
Gesamtdurchlaufzeit. Das beschriebene Modell arbeitet in zwölf Einzelschritten. Mehrere Tests führten<br />
u. a. zu einer Durchlaufzeitverkürzung um bis zu 60%.<br />
Einen Ansatz zum Einsatz der Simulationstechnik im Montagebereich stellen Eversheim / Hoeschen /<br />
Peffekoven [42] vor. Es werden verschiedene Möglichkeiten der Montagesimulation aufgezeigt. Neben<br />
der grundsätzlichen Auslegung des Montagesystems eignen sich vor allem die Detaillierung des<br />
Montageablaufs sowie die Optimierung der organisatorischen Abläufe zur Simulation. Das dem Beitrag<br />
zugrunde liegende Programmsystem ist besonders für die Aufgaben einer Montage von komplexen<br />
Produkten ausgelegt.<br />
3. Standortplanung und Standortwahl [43-47]<br />
Jede Standortplanung sollte mit der Ermittlung der Standortfaktoren beginnen. Erst dann wird das<br />
jeweilige Anforderungsprofil gebildet, das auf die speziellen Gegebenheiten des standortsuchenden<br />
Unternehmens abstellt. Bei einer Untersuchung der Vielzahl der möglichen Faktoren stellt sich oftmals<br />
heraus, daß bestimmte Faktoren durchaus in einem engen Zusammenhang zueinander stehen. Dies<br />
gilt beispielsweise für die Faktoren Verkehr und Beschaffungs- bzw. Absatzmarkt.<br />
Ein Verkehrsanschluß besonderer Art ist nach wie vor der eigene Gleisanschluß. Nicht zuletzt wegen<br />
der Kosten schrecken noch viele Unternehmen vor einer derartigen Investition zurück. Immerhin ist<br />
nach Illing [43] mit etwa 400 bis 600 DM je lfd. Meter Schiene zu rechnen. Bei Weichen müssen bis zu<br />
DM 50000 aufgewendet werden. Dennoch hä es der Verfasser für erforderlich, sich immer wieder mit<br />
der Frage nach dem günstigste Verkehrsanschluß zu beschäftigen. So kann sich z. B. mittlerweile das<br />
Produktionsprogramm so gewandelt haben, daß die entsprechenden Güter auf der Schiene<br />
kostengünstiger transportiert werden können. In jedem Fall sollte jedoch bei Werksneuplanungen, die<br />
eine Standortverlagerung bzw. -neuplanung zur Folge haben, auf die Option eine eigenen<br />
Gleisanschlusses geachtet werden.<br />
Im Beitrag von Fraissl [44] werden zahlreiche Hinweise zur praxisgerechten Anordnung der<br />
Gleisanschlußanlage gegeben. So ist z. B. zu unterscheiden, ob die Gleise an einem eigenen<br />
Gleiskörper verlegt oder in vorhandene Verkehrsflächen integriert werden sollen. Insbesondere befaßt<br />
sich Fraissl mit der Gestaltung von Verladerampen. Verschiedene Ausführungstypen werden<br />
diskutiert. Wichtig ist ferner ein ausreichend dimensionierter Rangierbereich sowie das erforderliche<br />
Rangiergerät, sprich Fahrzeuge. Bereits bei der Planung der Werksanlage, müssen die Kriterien einer<br />
problemlosen Verladung und eines störungsfreien Rangierbetriebes Beachtung finden.<br />
Es ist heute üblich, bei Standortüberlegungen auch das Ausland miteinzubeziehen. Immer wieder wird<br />
ja auf günstige Ansiedlungskonditionen, niedrigere Löhne, ein ausreichendes Arbeitskräftepotential<br />
hingewiesen. Dabei sollte man keineswegs sofort an Fernost denken. Auch im europäischem Raum<br />
gibt es attraktive Auslandsstandorte.<br />
In [45] werden Spanien, Irland und Schottland miteinander verglichen. Insbesondere werden die<br />
geographische und verkehrstechnische Lage, die jeweilige Fiskalpolitik die politische und soziale<br />
Stabilität sowie die Qualifikation der Arbeitskräfte analysiert.
Die Risiken und Erfolgschancen des Standortes USA untersucht Hake [46]. Mit Blick auf das<br />
diesbezügliche Engagement vor allem vieler mittelständischer Unternehmen weist er auf eine i. d. R.<br />
recht lange Durststrecke bis zum Erfolg hin und rät zu einer entsprechenden Finanzpolitik. Nach seiner<br />
Meinung bieten selbst hochwertige Erzeugnisse keineswegs Aussicht auf einen raschen Erfolg. Jeder<br />
Interessent sollte zudem seine Produktstrategie an den Bedürfnissen des amerikanischen Kunden<br />
orientieren und eine entsprechende Wertanalyse durchführen. Perfektion ist häufig nicht erforderlich<br />
und erhöht nur unnötig die Kosten. Entscheidend für den "Sprung über den Teich" ist deshalb eine<br />
genaue Analyse des Marktes, eine umfassende Information über die behördlichen Auflagen oder auch<br />
Subventionen (z. B. hinsichtlich der angepaßten Arbeitsmarktsituation) und eine möglichst direkte<br />
Kontaktaufnahme zu den zahlreichen Wirtschaftsfachverbänden, die Hilfestellung für den Neuling<br />
leisten können.<br />
Über Hintergründe und Erfahrungen einer Produktionsverlagerung ins Ausland wird in [47] berichtet.<br />
Nachdem das Unternehmen bereits einige Jahre mit gutem Erfolg eine Absatzorganisation in den USA<br />
betrieb, zeigte sich u. a. aufgrund des rasch wachsenden Konkurrenzdruckes, daß eine Fertigung vor<br />
Ort zu noch besseren Absatzerfolgen führen würde. Aufgrund der im Vergleich zu Europa weitaus<br />
geringeren Land- und Gebäudekosten entschied sich die Unternehmensleitung für einen<br />
Werksneubau. Dabei wurde in Kauf genommen, daß mit hohen Personalkosten insbesondere in der<br />
Anlaufphase deshalb zu rechnen war, da jeder neue Mann erst angelernt werden mußte. Facharbeiter<br />
in unserem Sinne kennt man in USA nicht. Eine weitere Folge der Fertigung vor Ort war eine<br />
umfangreiche und kostenintensive Neuerarbeitung der zahlreichen Dokumentationen,<br />
Betriebsanleitungen, Fertigungsund Montageanweisungen, die speziell für den amerikanischen<br />
Arbeiter zurechtgeschnitten wurden.<br />
4. Layoutplanung [48-52]<br />
Ein wichtiger Grundsatz jeder <strong>Fabrikplanung</strong> lautet, daß, losgelöst von den fallspezifischen<br />
Anforderungen, zunächst ein IdealLayout zu erstellen ist, das die zumeist nach dem Weg-Mengen-<br />
Kriterium optimierte Betriebsmittelanordnung darstellt. Für diese Planungsphase sind zahlreiche EDV-<br />
Optimierungsprogramme bekannt, die in ihrer Mehrzahl einfach zu handhaben sind. Die<br />
Schwierigkeiten beginnen dann häufig mit der Realplanung, bei der der Fabrikplaner bislang<br />
gezwungen war, die vielfältigen Restriktionen manuell in den Planungsprozeß einzuführen. Nur wenige<br />
EDVProgramme konnten z. B. bauliche Restriktionen berücksichtigen.<br />
In [48] wird über ein Computerprogramm berichtet, das sich speziell für die Layoutplanung von<br />
Werkstätten eignet. Zielgröße ist auch hier die kleinste erforderliche Jahrestransportleistung. Das<br />
Programm ist in der Lage, alle wesentlichen Randbedingungen wie Gebäudegrundriß,<br />
Stützenabstände, Stockwerksverbindungen oder versorgungstechnische Fixpunkte in den<br />
Optimierungslauf einfließen zu lassen. Ergebnis ist ein Real-Layout, das sich den tatsächlichen<br />
Erfordernissen der Planung anpaßt und eine manuelle Überarbeitung ausschließt.<br />
Auf die besondere Problematik der Layoutbildung im Falle eines stark schwankenden<br />
Produktionsprogramms machen Rümmler / Schilling / Brandes [49] aufmerksam. In zahlreichen<br />
Betrieben gerade der metallverarbeitenden Industrie müssen die zur Verfügung stehenden Flächen<br />
hochflexibel nutzbar sein. Bei Veränderungen des Art-Mengen-Gerüstes muß durch<br />
Kapazitätsüberprüfungen die Frage beantwortetwerden, ob die vorhandene Fläche zur<br />
Auftragsbearbeitung ausreichend dimensioniert ist. Die Auswirkungen einer schwankenden<br />
Sortimentsstruktur auf den Flächenbedarf sind gerade bei breiten Erzeugnissortimenten mit<br />
hinreichender Genauigkeit bei zugleich vertretbarem Aufwand nur mit EDV bestimmbar. Allerdings<br />
müssen die Programme proportional zur Anzahl der Planungszeiträume mehrfach gestartet werden.<br />
Dieser Nachteil kann durch den von den Verfassern vorgestellten Ansatz zur Berechnung von<br />
Flächenrichtwerten mittels Regressionsrechnung vermieden werden.<br />
Ristow [50] berichtet über eine Untersuchung, die speziell den Flächenbedarf für eine<br />
Werkzeugschleiferei zum Gegenstand hat. Er entwickelt zwei Kennzahlen für die Grobplanung. Die<br />
Betreuungsrate läßt Aussagen darüber zu, welche Mindestausstattung an Maschinen für die<br />
Werkzeugschleiferei bei einer bestimmten Maschinenanzahl in der Hauptproduktion erforderlich ist.<br />
Untersuchungsergebnisse zeigen, daß ab etwa 300 Maschinen die Betreuungsrate näherungsweise<br />
konstant wird. Die Kennzahl "Technisch-technologische Ausstattung" erlaubt Rückschlüsse auf die<br />
Struktur des Maschinenparks. Nach Kenntnis des Maschinenbedarfs können nach einem korrigierten<br />
Flächenzuschlagsverfahren die Flächen bestimmt werden. Der Gesamtzuschlagsfaktor ist um etwa 20<br />
% größer als der vergleichbare Faktor für normale Produktionswerkstätten.
Ein weiterer besonderer Problembereich bei der Layoutplanung ist die Flächenplanung für integrierte<br />
Fertigungen. Bei der Optimierung der Betriebsmittelstandorte sind neue Aspekte der<br />
Optimierungsstrategie und Flächenbestimmung zu beachten. Untersuchungen von Woithe [51] haben<br />
gezeigt, daß bei derartigen Fertigungssystemen die Kriterien transportbedingte Aufwendungen,<br />
Flächen- und Raumbedarf, Aufwand für die Späneentsorgung mit Stetigförderern und Aufwand für die<br />
Fundamentierung einfließen müssen. Primär ist auf die Transportminimierung und auf die<br />
Flächenausnutzung des Fertigungsabschnittes zu achten. Der Verfasser berichtet über die<br />
Entwicklung einer modifizierten Ersatzflächenmethode, die die besondere Flächenstruktur von<br />
Fertigungssystemen und die Flächenunterschiede zwischen den Anordnungsvarianten berücksichtigt.<br />
Basis dieser Methode ist die Aufstellung technischer Kenngrößen der Hauptausrüstungen des<br />
Fertigungssystems.<br />
Entsprechende Methoden zur optimierenden Flächenberechnung von Fertigungszellen sind noch nicht<br />
bekannt. Schmigalla / Rodeck / Hentschel [52] weisen jedoch auf Arbeiten hin, die sich mit der<br />
Ermittlung von Richtwerten zur Flächenvorausberechnung befassen. Dabei werden Erfahrungen mit<br />
bereits ausgeführten Fertigungszellen berücksichtigt.<br />
5. Materialfluß [53-113]<br />
Neben der eigentlichen Fertigung ist der betriebliche Materialfluß zweifellos eines der wichtigsten<br />
Teilsysteme in einem Fertigungsbetrieb, da die Gesamtdurchlaufzeit außer durch die Maßnahmen der<br />
Fertigungssteuerung zu wesentlichen Teilen auch durch die Transportorganisation und -steuerung<br />
sowie die bereitgestellte Fördertechnik beeinflußt wird. Mit steigender Tendenz sind rechnergesteuerte<br />
Transportsysteme zu beobachten. In einem besonders markanten Fall konnte dabei die Durchlaufzeit<br />
um 50 % reduziert werden [53]. Zugleich erhöhte sich die Mitarbeiterproduktivität und verbesserte sich<br />
die Termintreue.<br />
5.1. Materialflußplanung [54-64]<br />
Eine weitere Voraussetzung zur Planung moderner, anforderungsgerechter Materialflußsysteme ist die<br />
integrierende Betrachtungsweise, die gleichermaßen die betroffenen organisatorischen Strukturen, die<br />
technischen Prozesse sowie die relevanten Steuerungsprozesse einer ganzheitlichen Lösung zuführt.<br />
Eine entsprechende Systematik der Materialflußplanung beschreibt Langner [54]. Nach Ermittlung der<br />
Planungsgrundlagen wird die systemtechnische Lösung gesucht. Hierfür steht u. a. eine<br />
Kombinationsmatrix für Lagersysteme zur Verfügung. Als nächster Schritt erfolgt die Festlegung der<br />
Ablauforganisation, die maßgeblich durch systemtechnische Lösung beeinflußt wird. Hier müssen alle<br />
Teilsysteme der Materialwirtschaft berücksichtigt werden. Feinplanung, Ausschreibung, Vergabe und<br />
Realisierung des Materialflußsystems schließen sich an. Die Materialflußplanung endet jedoch erst mit<br />
dem Einfahren des Systems.<br />
Entwicklungstendenzen im innerbetrieblichen Materialfluß aus der Sicht der Praxis zeigt Hesser [55]<br />
auf. Die Anlagen zur Bewältigung der zahlreichen Transportaufgaben werden aufwendiger und<br />
komplexer. Es sind deshalb die Instrumente zur Bestimmung der Kapazität, des Leistungsdurchsatzes<br />
und zur Früherkennung von Störungen weiter auszubauen und zu verbessern. Aufgrund der<br />
zunehmenden Komplexität und Technisierung/Automatisierung wird die EDV - hier besonders die<br />
Kleinrechnertechnologie - einen immer breiteren Raum einnehmen. Der Beitrag geht ferner auf<br />
Entwicklungstendenzen in Teilbereichen des Materialflußwesens (Transportsysteme, Lagerwesen,<br />
Steuerung) ein.<br />
Auf die zahlreichen Mängel insbesondere im Bereich der Organisation und Steuerung macht<br />
Jünemann [56] aufmerksam. Hier sieht der Verfasser einen hohen Nachholbedarf gegenüber der<br />
Fertigung. Die Materialflußsysteme der 80er Jahre werden eindeutig bestimmt durch das Streben nach<br />
hoher Automatisierung. An entsprechenden Lösungsansätzen z. B. für heute noch manuell zu<br />
bedienende Lagertypen wird intensiv gearbeitet. Ein weiteres Problem sind die zahlreichen<br />
Schnittstellen im Transportablauf. Hier werden integrierte, weitgehend mechanisierte und<br />
automatisierte Transportketten angestrebt.<br />
Die Entwicklung moderner Fertigungskonzepte (flexible Fertigungszellen, Fertigungssysteme u. a. m.)<br />
zeigt deutliche Auswirkungen auf die Materialflußtechnik [57]. Über Systeme zur stufenweisen<br />
Realisierung der hohen Anforderungen an zeitgemäße Materialflußsysteme berichtet Rittinghausen<br />
[58]. In Betracht zu ziehen sind durchaus auch konstruktiv unterschiedliche Varianten. Durch einen
Vergleich produktionstechnischer Einflußgrößen lassen sich Transportsysteme ermitteln, die für eine<br />
Automatisierung von innerbetrieblichen Materialflußabläufen geeignet sind. Es ist darauf zu achten,<br />
daß an den Schnittstellen zwischen den Verkettungseinrichtungen und den Fertigungs-, Montage- und<br />
Lagereinrichtungen keine Unterbrechungen im Materialfluß auftreten. Der Verfasser vergleicht<br />
verschiedene Transportsysteme anhand dieser Anforderungen.<br />
An dieser Stelle sei auf den Beitrag von Schiele [59] hingewiesen, der sich mit flexiblen<br />
Fördersystemen speziell für flexible Fertigungssysteme auseinandersetzt. Zwar haben sich<br />
Stetigförderer in Verbindung mit einfachen Handhabungsgeräten bewährt. Grenzen zeigen sich<br />
allerdings bei häufig wechselnden Transportaufgaben insbesondere in der Einzel- und<br />
Kleinserienfertigung. Hier eignet sich z. B. ein frei programmierbarer Stapelkran. Durch die<br />
Beschickung der Übergabeplätze mit Magazinen von oben kann der Einsatz von<br />
Handhabungseinrichtungen optimiert werden.<br />
Am Beispiel einer hochintegrierten, flexiblen Fertigung mit vorwiegend zerspanenden<br />
Werkzeugmaschinen zeigen Handke / Handke [60] die Anforderungen an ein angepaßtes<br />
Materialflußkonzept. Neben dem eigentlichen Werkstück wird auch das Werkzeug in einem eigenen<br />
System automatisch bereitgestellt bzw. wieder an ein Zentrallager abgegeben. Alle zentralen Ver- und<br />
Entsorgungssysteme werden von einem Leitstand mit Prozeßrechner gesteuert. Um das<br />
Gesamtsystem (Fertigung, Transport, Maschinenbeschickung) optimal auszulasten, ist ein hoher<br />
Koordinierungsaufwand erforderlich.<br />
Über die Materialbereitstellung in einer verketteten Fertigung für rotationssymmetrische Werkstücke<br />
berichtet Hörl [61]. Durch eine abgestimmte Gesamtkonzeption mit taktfreien<br />
Verkettungseinrichtungen und Handhabungsautomaten konnte die Schnittstelle Transport vom Lager<br />
an die Maschine / Maschinenbeschickung überbrückt werden. Die magazinierten Scheiben und Wellen<br />
werden von einer Einschienenhängebahn mit freier Wegstreckenkodierung an die<br />
Bereitstellungsplätze vor den Bearbeitungsmaschinen transportiert. Hier übernehmen die frei<br />
programmierbaren Handhabungsautomaten das Material und beschicken die Maschine. Durch<br />
transportable Taktspeicher kann die Flexibilität des Gesamtsystems erhöht werden.<br />
Der Beitrag von Steinhilper [62] befaßt sich eingehend mit den planerischen Überlegungen für eine<br />
verkettete Fertigung, wie Hörl [61] sie beschreibt. Steinhilper kommt in seinen Betrachtungen zu dem<br />
Ergebnis, daß das Innovationsrisiko neu zu entwickelnder Werkstückflußsysteme gering gehalten bzw.<br />
tragbar gemacht werden kann, wenn auf Begrenzung des Innovationssprunges, Beschränkung des<br />
Flexibilitätsanspruches, weitestgehende Integration bereits am Markt erhältlicher Komponenten und<br />
auf eine gestufte Realisierung geachtet wird. Es ist allerdings für die Zukunft zu fordern, daß im<br />
Interesse des Anwenders zwischen den Herstellern der Teilkomponenten (Werkzeugmaschine,<br />
Handhabungs-, Transport- und Speichereinrichtung, Steuersystem) eine wesentlich stärkere<br />
Zusammenarbeit stattfindet.<br />
Während bei der Auslegung von flexiblen Transport- und Handhabungseinrichtungen eine Reihe<br />
beachtlicher Fortschritte erzielt sind, ist die praktische Anwendung von flexiblen Steuerungskonzepten<br />
auf der Basis von Prozeßrechnern im Bereich der Einzel- und Serienfertigung gering. Nach<br />
Rittinghausen [63] ist jedoch eine Automatisierung des Informationsflusses Voraussetzung für ein<br />
automatisiertes Transportwesen, da eine effektive Steuerung von automatisierten Fertigungsabläufen<br />
nur über eine Online-Betriebsdatenerfassung und -verarbeitung möglich ist. Im Bereich der<br />
Materialflußdisposition werden verschiedene Automatisierungsstufen untersucht.<br />
Bei der Planung von Materialflußsystemen müssen begleitend die Auflagen durch die<br />
Arbeitsstättenverordnung berücksichtigt werden. In dem Beitrag von Hesser [64] wird beispielhaft auf<br />
einige Auswirkungen dieser Verordnung, die immerhin Gesetzeskraft hat und deren Nichtbefolgung<br />
eine strafbare Handlung darstellt, auf die Planungsarbeit von Materialflußsystemen eingegangen.<br />
Dabei werden bewußt Schwachstellen aufgezeigt. So wird am Beispiel des § 17 ArbStättV<br />
"Verkehrswege" dargelegt, daß der Gesetzgeber die Wegbreitenauslegung unabhängig von der<br />
Benutzungsfrequenz festlegt, was zu einer Erhöhung der Transportfläche bis zu 10% führen kann.<br />
Ferner stellt der Verfasser fest, daß in einigen Fällen die Befolgung der Arbeitsstättenverordnung<br />
unvertretbar hohe Kostenbelastungen bei nur geringem Zugewinn an Sicherheit für die Mitarbeiter zur<br />
Folge haben kann.<br />
5.2. Methoden und Hilfsmittel der Materialflußplanung [65-80]
Eine neue Planungsmethode mit dem Ziel, die Planungsqualität zu erhöhen, die Planungskosten zu<br />
senken und die Planungszeit zu verkürzen, stellt Heller [65] vor. Diese Methode erfaßt die relevanten<br />
Elemente der Funktionskette, berücksichtigt die Artikel- und Auftragsstruktur und macht die<br />
wirtschaftlichen Arbeitsbereiche sichtbar. Nach Angaben des Verfassers konnten Planungskosten und<br />
Planungszeitraum in konkreten Einsatzfällen um 30 bis 60% reduziert werden. Voraussetzung ist<br />
allerdings der Einsatz der EDV.<br />
Ein Nomogramm zur Bestimmung der optimalen Stapleranzahl in Blocklägern wird in [66] beschrieben.<br />
Das Nomogramm gilt für jedes Blocklager, dessen Flächennutzungsgrad bei etwa 50 % liegt. Bei der<br />
Ermittlung wurde von drei Palettenlagen im Lager ausgegangen. Entsprechend wurden die<br />
Arbeitsspielzeiten festgestellt.<br />
Bei der Realisierung der Werkstücktransporte durch ein Regalbediengerät in einem kombinierten<br />
Lager- und Transportsystem können verschiedene Fahrwegstrategien angewendet werden. Diese<br />
Strategien setzen sich aus Reihenfolgestrategien bei der Abarbeitung der Transportanforderungen und<br />
aus Suchstrategien zum Auffinden eines leeren Regalfaches bei der Einlagerung einer Ladeeinheit<br />
zusammen. Mit einem Simulationsmodell untersuchte Czech [67] sechs verschiedene<br />
Fahrwegstrategien. Gegenüber reinen Zufallsstrategien kann durch eine Fahrwegoptimierung eine<br />
Verbesserung der Umschlagleistung für Regalganglängen zwischen 10 und 70 m von 7 bis 26%<br />
erreicht werden.<br />
Die Grundlagen der Analyse von Transport-, Umschlag- und Lagerprozessen werden in einer<br />
Beitragsreihe von Krampe / Lobse [68 bis 70] behandelt. Die unterschiedlichen Analysebereiche<br />
werden entsprechend den speziellen Anforderungen gegeneinander systematisch abgegrenzt. Es wird<br />
eine Übersicht über verschiedene Methoden und Verfahren zur Prozeßanalyse gezeigt. Im zweiten und<br />
dritten Teil der Veröffentlichung werden zahlreiche Entscheidungstabellen und Aufnahmeformulare<br />
entwickelt, die den Analysevorgang zielorientiert rationalisieren.<br />
Eine sorgfältige Analyse des innerbetrieblichen Transports kann zur Aufdeckung erheblicher<br />
Rationalisierungsreserven führen. Mit mehrdimensionalen Kontingenztafeln analysierte Lautsch [71]<br />
zwei Transportabteilungen eines Großbetriebs. Der Anteil der Leerfahrten betrug teilweise 59 %. Durch<br />
die Kontingenztafeln konnte der Verfasser u. a. einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem<br />
Fahrzeugtyp und den Last- / Leerfahrten herstellen. Großmann / Huhn [72] untersuchten die<br />
Umschlagsprozesse für Stückgut. Die Beurteilung erfolgte durch mehrere Kennzahlen. Die Verfasser<br />
kommen zu dem Ergebnis, daß der Anteil manueller Hilfsoperationen in teilmechanisierten Prozessen<br />
sehr hoch ist. Auch vollständig manuell durchgeführte Operationen wurden beobachtet. Die<br />
Problematik der Rationalisierung wird im Mechanisieren der verschiedenen Einzelvorgänge gesehen.<br />
Die nachfolgenden Beiträge befassen sich mit der Simulation von Transportsystemen. Die<br />
Simulationstechnik versetzt den Materialflußplaner in die Lage, das Zeitverhalten komplexer<br />
automatischer Transportanlagen zu ermitteln. Damit lassen sich bereits in der Vorplanungsphase<br />
wesentliche Kriterien zur Systemauswahl ermitteln. Zudem kann das Planungsrisiko erheblich<br />
vermindert werden.<br />
In einer fünfteiligen Beitragsreihe von Großeschallau / Hoya / Kuhn / Jünemann [73 bis 77] werden die<br />
Aufgaben und Möglichkeiten der Materialflußsimulation aufgezeigt. Die Verfasser haben die bereits<br />
vorliegenden Simulationsmodelle analysiert und stellen fest, daß diese Modelle jeweils auf spezielle<br />
Aufgaben zugeschnitten und kaum auf andere Problemfälle übertragbar sind. Ziel der weiteren Arbeit<br />
an diesem Planungshilfsmittel muß deshalb u. a. eine minimale Allgemeingültigkeit der Modelle sein.<br />
Ferner sollten Simulationsmodelle aus anderen Fachgebieten (z. B. Informatik) auf ihre Anwendbarkeit<br />
hin überprüft werden. Im weiteren Verlauf der Beitragsreihe werden zwei modulare Simulationsmodelle<br />
SIMIS und MODUS (SIMIS = Simulation des Materialflusses innerbetrieblicher Systeme; MODUS =<br />
Modulares Dispositions- und Steuerungssystem) mit ihren hervorstechenden Merkmalen und<br />
Möglichkeiten vorgestellt, die sich insbesondere zur Darstellung der dynamischen Abläufe von<br />
komplexen Fördernetzen sowie zur Simulation der Auftragsabwicklung und Disposition im<br />
innerbetrieblichen Transportbereich eignen.<br />
Klug / Kuhn [78] berichten über den Einsatz von SIMIS zur Projektierung von FTSSystemen (FTS =<br />
Fahrerlose Transportsysteme). Die dabei gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich der prinzipiellen<br />
Gestaltungs- und Planungsrichtlinien lassen sich auch auf andere Transportsysteme übertragen.
Fried / Natus [79] beschreiben ein Simulationsprogramm, das für verschiedene Transportsysteme<br />
eingesetzt werden kann. Das Programm kann auf einem Tischcomputer mit Bildschirm und<br />
graphischem Subsystem gerechnet werden. Durch die bildliche Darstellung des<br />
Simulationsergebnisses in jeder Zwischenstufe kann die Entwicklung des Transportsystems einfach<br />
verfolgt werden. Spezialkenntnisse von problemorientierten Simulationssprachen sind nicht<br />
erforderlich. Das Programm ist in BASIC geschrieben. Aufgrund der geringen Zeit für den<br />
Modellentwurf halten die Verfasser die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes dieser Simulation bereits in der<br />
Projektphase für gegeben.<br />
Über die Simulation eines Hängebahnsystems mit Einzelfahrwerken berichtet Utz [80]. Begonnen wird<br />
mit der Simulation bereits in der Vorplanungsphase. Damit ist die Möglichkeit gegeben, eine fundierte<br />
Vergleichsanalyse der verschiedenen Fördersysteme als wesentliche Entscheidungshilfe<br />
durchzuführen. In der Ausführungsphase wird mittels der Simulation der Leistungsnachweis der<br />
ausgewählten Förderanlage unter Einbezug des gewählten Organisations- und Betriebskonzeptes<br />
erbracht.<br />
5.3. Auswahl und Einsatz von Fördermitteln und Förderhilfsmitteln [81-113]<br />
Zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben, die heute an die Fördertechnik herangetragen werden,<br />
werden fast täglich neue oder zumindest stark verbesserte Lösungen vorgestellt. Die Wachstumsraten<br />
in diesem Industriezweig werden einer amerikanischen Studie zufolge günstig bewertet [81]. Für die<br />
Bundesrepublik kann mit einer durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate von etwa 9,5 % gerechnet<br />
werden.<br />
Eine besonders expansionsorientierte Zukunft wird den Hängefördersystemen und Power-and-free-<br />
Systemen eingeräumt. Ihren Vorteil gegenüber bodengebundenen Fördersystemen sieht Behrens [82]<br />
in der Nutzung des freien Raumes unter der Hallen decke, der Bodenfreiheit bei Förder- und<br />
Montagestrecken, der Anpassungsfreundlichkeit der Transportgehänge an das Fördergut sowie in der<br />
geringen Verschmutzungsgefahr insbesondere bei Anlagen der Oberflächenbehandlung.<br />
In dem Beitrag von Hanke [83] werden verschiedene Hängebahnsysteme beschrieben und an<br />
praktischen Einsatzfällen vorgestellt. Der Verfasser macht auf die hohe Flexibilität dieser Systeme<br />
aufmerksam, die in der dem jeweiligen Materialfluß angepaßten Linienführung, dem Förderrhythmus<br />
und der Fördergeschwindigkeit zu sehen ist.<br />
Eine universelle Systemkonstruktion ist nach Hiller / Kroll [84] aufgrund des breiten<br />
Anforderungsspektrums nicht möglich. Vielmehr bestimmt die Transportaufgabe das jeweilige System.<br />
Genannt und diskutiert werden Innenläufer-, Außenläufer- und Unterflanschsysteme.<br />
Ein prozeßrechnergesteuertes Elektrohängebahnsystem für eine Spritzlackiererei wird in [85]<br />
beschrieben. Die Forderung nach hoher Verfügbarkeit, geringem Wartungsaufwand und niedrigen<br />
Laufgeräuschen konnte erfüllt werden. Die Transportkonzeption in einem Automobilwerk, in dem<br />
komplette Motorenblöcke (max. 550 kg/Einheit) bewegt werden, zeigt [86]. Mit Hängeförderern speziell<br />
für Gießereibetriebe befaßt sich der Beitrag von Haas [87]. Weitere Beispiele aus der Praxis werden in<br />
[88] beschrieben. Über neue Förderanlagen auf der Basis der Einschienenbahn wird in [81-89]<br />
berichtet. Die dargestellte Gruppe fördertechnischer Anlagen arbeitet entlang fester Linien oder<br />
Schleifen sowie in Netzen. Das Grundkonzept zeichnet sich dadurch aus, daß diese drei<br />
strukturbildenden Systemeinheiten sowohl an der Hallendecke als auch im Boden installiert werden<br />
können. Damit wird eine hohe Flexibilität und Mobilität sichergestellt.<br />
Hohe Transportgewichte lassen den Einsatz einer flurfreien Transportanlage i. d. R. nicht zu. Den<br />
Ausführungen von Dietz [90] zufolge kann jedoch auch ein Flurfördersystem die geforderte<br />
Anpassungsfähigkeit an die Transportaufgabe erfüllen. Der Verfasser berichtet über die Installation<br />
einer derartigen Anlage im Montagebereich einer Vergaserfertigung.<br />
Neke [91] beschreibt zwei Unterflurfördersysteme, die speziell für sperrige Güter auszulegen waren. In<br />
beiden Einsatzfällen konnte der Materialfluß erheblich verbessert werden. Weitere Beispiele sind in<br />
[92-93] dargestellt.<br />
Durch die rasche Entwicklung der Mikroprozessortechnologie gewinnen die induktiv gelenkten<br />
Flurfördersysteme ständig an Bedeutung. Voraussetzung für die Einführung in einen Betrieb ist eine<br />
auf die Umwelt abgestimmte Gesamtkonzeption. Dies gilt im besonderen Maße für eine
echnergeführte Fertigung. Über typische Beispiele wird in [94-95] berichtet. Der Beitrag von Freissl<br />
[96] zeigt u. a. die Anforderungen an die für die Funktionssicherheit dieser Systeme maßgeblichen<br />
Bodenverhältnisse auf. Daneben geht der Verfasser auf die besonderen Probleme beim Fahrbetrieb<br />
im Freien ein.<br />
Bei der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit induktiv gesteuerter Transportsysteme stehen die<br />
Investitionskosten, die Betriebskosten und die Wartungskosten im Vordergrund. Daneben müssen, wie<br />
Klug [97] ausführt, auch die nicht quantifizierbaren Faktoren wie z. B. die Vorteile eines organisierten<br />
Materialflusses berücksichtigt werden. Der Beitrag zeigt ferner mögliche künftige Anwendungsgebiete<br />
auf.<br />
Im folgenden wird auf einige interessante Transportkonzepte im Bereich der Stetigförderer<br />
hingewiesen. Die Realisierung von zwei Anlagen für den Transport von großvolumigen Papierrollen<br />
wird in [98] beschrieben. Die Rollenpackmaschinen wurden in beiden Fällen in den Materialfluß<br />
integriert. Am Beispiel einer Meßgerätefabrik wird der Einsatz einer Direktbeschickungsanlage<br />
dargestellt, die bei kleineren und mittleren Fertigungsserien optimale Lösungen für eine Vielzahl von<br />
unterschiedlichen Montage- und Transportaufgaben ermöglicht [99]. Den Einfluß des Transportgutes<br />
auf die Bauweise eines Plattenbandförderers zeigt Monsberger [100]. Als grundsätzliche Konzeptionen<br />
nennt er den Gliederbandförderer und die Wandertische. Fraissl [101] berichtet über neue<br />
Entwicklungen bei Staurollenbahnen und geht insbesondere auf das Prinzip der Friktionsrollenbahn<br />
ein. Das System ist praktisch wartungsfrei und zeichnet sich u. a. durch die sehr geringen<br />
Laufgeräusche aus. Der Einbau von Zusatzeinrichtungen wie Stopper, Ausschleuser, Hub- und<br />
Drehstationen in die Friktionsrollenbahn ist jederzeit möglich. Für insbesondere kleine und leichte Teile<br />
eignet sich der Einsatz von Luftkissen-Bahnen [102]. Im Gegensatz zu konventionellen Band- und<br />
Rollenförderern sind sämtliche Kurven und Krümmungen angetrieben.<br />
Auch im hochautomatisiertem Betrieb ist der konventionelle Gabelstapler nicht wegzudenken. Bei der<br />
Mehrzahl der eingesetzten Stapler überwiegen noch die Aufgaben zum horizontalen Lastentransport<br />
gegenüber den vertikalen Stapelaufgaben. Insbesondere im Lagerbereich ist jedoch ein Trend zum<br />
vertikalen Einsatz deutlich erkennbar. Frohmann [103] gibt einen Überblick über die gebräuchlichsten<br />
Staplertypen. Der Report behandelt allerdings nicht die an bestimmte Regalsysteme gebundenen<br />
Stapler (RFZ). Die besonderen Merkmale von Vierwegestaplern werden in dem Beitrag von Wöhr [104]<br />
aufgezeigt. Dieses Fördermittel ist besonders für Stabmaterial, Bleche, Rohre, sperrige<br />
Maschinenteile, Profilbretter oder Spanplatten geeignet. Im Gegensatz zum herkömmlichen<br />
Gabelstapler ist der Vierwegestapler auf seitlichen Transport ausgelegt. Dadurch kann die<br />
Transportfläche reduziert werden. Der Beitrag von Mooren [105] geht umfassend auf Vorsatzgeräte für<br />
Stapler zum palettenlosen Transport ein. Durch diese Förderhilfsmittel können eine Reihe von<br />
Transportaufgaben (z. B. Ballen- oder Kartonagetransporte) ohne die doch recht kostenintensive<br />
Holzpalette durchgeführt werden.<br />
Unabhängig von der Branche und der Art des Produktes besteht in fast allen Betrieben, in denen<br />
Produkte aus Rohmaterialien erzeugt, verarbeitet oder montiert werden, ein Bedarf an<br />
Transporthilfsmitteln. Die Teile müssen jedoch nicht nur transportiert, sondern auch bereitgestellt bzw.<br />
gepuffert und gelagert werden. Das Ziel ist Transporteinheit = Lagereinheit = Fertigungseinheit. In den<br />
Beiträgen [106-111] werden diesbezügliche Überlegungen angestellt und Behältersysteme vorgestellt.<br />
Auf die besondere Problematik beim Bereitstellen von Vorrichtungen, Werkzeugen und Prüfmitteln<br />
gehen Kind / Sampe/ Rudolf [112] ein. Die Verfasser entwickeln Gestaltungsgrundsätze für diese<br />
spezifischen Transporthilfsmittel und schlagen mehrere konstruktive Varianten vor.<br />
Abschließend sei der Beitrag von Fink [113] erwähnt, der sich eingehend mit den besonderen<br />
Transportaufgaben in einem Hüttenwerk befaßt. Ausgehend von einer systematischen<br />
Zusammenstellung der verschiedenen möglichen Transportsysteme werden technische<br />
Fahrzeugkonzeptionen diskutiert.
<strong>Literaturübersicht</strong> <strong>Fabrikplanung</strong><br />
Beiträge aus Fachzeitschriften des Jahres 1980, Teil 2<br />
Der erste Teil dieser behandelte die Teilgebiete:<br />
1. Methodik der <strong>Fabrikplanung</strong><br />
2. Planungshilfsmittel<br />
3. Standortwahl<br />
4. Layoutplanung<br />
5. Materialfluß.<br />
Im vorliegenden zweiten und letzten Teil wird ein Überblick über Veröffentlichungen der Bereiche<br />
6. Lager<br />
7. Arbeitsplatzgestaltung<br />
8. Energieversorgung und Brandschutz<br />
9. Kosten<br />
gegeben.<br />
Eine Zusammenfassung und ein Ausblick auf künftige Entwicklungen schließen die <strong>Literaturübersicht</strong><br />
"<strong>Fabrikplanung</strong>" des Jahres 1980 ab.<br />
6. Lager [114-160]<br />
Waren es in den 60er und frühen 70er Jahren Vertriebs- und Fertigwaren- sowie Zentrallager, die<br />
Planer und Anlagenbauer beschäftigten, so sind es heute häufig die Produktionslager. Wie der Name<br />
schon sagt, war die Funktion und Aufgabe der ersten Kategorie markt- und vertriebsorientiert; d. h.,<br />
das Lager hatte die Aufgabe, die produzierten Einheiten aufzunehmen, zu speichern und entsprechend<br />
dem - oft saisonal schwankenden - Marktbedarf abzugeben. Ganz anders Funktion und Aufgabe des<br />
Produktionslagers.<br />
Es ist in den Fertigungsprozeß direkt integriert und stellt üblicherweise den Puffer zwischen<br />
Teilefertigung und Endmontage dar. Der Trend der Lagertechnik geht ziemlich eindeutig in Richtung<br />
Produktionslager. Diese Aussage gilt in besonderem Maße für die Automobilindustrie, deren<br />
Zulieferbetriebe und ganz allgemein den Maschinenbau. Vischer [114] zeigt die Anforderungen durch<br />
Teile, Gebinde, Funktion, Organisation, Bau und Peripherie auf und führt Lösungsbeispiele an.<br />
Welches Lager man für welche Ware benötigt, ist weitgehend von dieser selbst abhängig: Ballen,<br />
Coils, Langgüter oder schwere Maschinenteile wird man nicht zusammen mit palettierten Fertigwaren<br />
lagern. Auch für Kleinteile kann dieses zutreffen. In den Abmessungen und Gewichten wird die<br />
Lagerkonzeption auch von den Eigenschaften der zu lagernden Ware (Temperaturempfindlichkeit,<br />
Feuergefährlichkeit) beeinflußt. Der Beitrag [115] gibt einen Überblick über die aktuellen Lagerarten.<br />
Mit einem flexibel überwachten Materialfluß lassen sich innerbetriebliche Kosten einsparen. Es gilt<br />
auch hier das Motto: Nur wer dauernd rationalisiert, schafft optimale Leistungen. Köckmann [116]<br />
erläutert- neben den Zusammenhängen, die das Controlling im Materialwesen ausmachen- vor allem<br />
für kleinere und mittelgroße Betriebe Lösungsansätze zur Verbesserung der Lager- und<br />
Materialwirtschaft.<br />
Ein interessantes Zwischenlagerkonzept für Reste (Überlängen) mit Rationalisierungseffekt stellt<br />
Hoyer [117] vor. Anfallende Fertigungsminderlängen, Rüstkosten und Materialflüsse will der Betrieb<br />
aus der Kabelbranche mit diesem Lagerkonzept reduzieren.<br />
In allen Betrieben, wo täglich mindestens 100 Aufträge, bestehend aus mehreren Positionen,<br />
zusammengestellt und versandt werden, ist es unrationell, die Zusammenstellung - Kommissionierung<br />
- der Aufträge im Hauptlager vorzunehmen, besonders dann, wenn das Warensortiment mehr als 100<br />
verschiedene Artikel umfaßt. Ganz abgesehen davon, wie Artikel im Hauptlager gelagert sind, auf<br />
Paletten oder in Behältern in Regalen, wird die Kommissionierung der Aufträge am wirtschaftlichsten
durch Einrichtung eines Kommissonierungslagers durchgeführt. Achtner [118] führt Beispiele an und<br />
fordert die Abstimmung auf den jeweiligen Durchsatz.<br />
6.1. Lagerplanung [119-129]<br />
Im Verlauf der letzten Jahre hat die Bedeutung von Hochregallagern zugenommen. Hohe<br />
Lieferbereitschaft, hohe Umschlagswerte, übersichtliche Lagerorganisation, ein Minimum an<br />
Personalaufwendungen sprechen für solche Lager.<br />
Bei der Planung einer großen Ventilatorenfabrik im Irak [119] wurde zur Lagerung von Packmaterial,<br />
Rohmaterial, Hebezeuge und Fertigwaren ein Hochregallager vorgesehen.<br />
Lagern innerhalb eines Produktionsprozesses oder als letzte Produktionsstufe vor der Auslieferung<br />
erfordert eine jeweils individuelle Abstimmung zwischen den Erfordernissen des<br />
Produktionsverfahrens und denen der Lagerhaltung. Ein Beitrag [120] bringt Beispiele für<br />
Hochregallager als Bindeglieder im Produktionsprozeß.<br />
Nicht alltäglich war die Aufgabe, in einer seit mehreren Jahren bestehenden Traglufthalle anstelle<br />
eines mit Gabelstaplern bedienten Regallagers eine Hochregalanlage mit über 5000 Plätzen zu<br />
errichten. In diesem Bereich sollen Vormaterialien, Halbfertig- und Zulieferteile in Gitterbox- und auf<br />
Holzpaletten, 800 x 1200 mm, mit einem max. Gewicht von 1000 kg gelagert werden. Balcke [121]<br />
zeigt auf, wie die bei der Funktionsplanung aufgestellten Ziele mit dem ausgeführten System erfüllt<br />
werden konnten.<br />
Den Neubau eines Hochregallagers in Mischbauweise, d. h. als Gleitbetonbau mit Fachbodenriegeln<br />
aus Stahl, stellt Walther [122] für einen Gießereibetrieb in der DDR vor. Aufgrund der sehr hohen<br />
Brandlast und aus der Bemühung, im Regalhausbau eine Weiterentwicklung zu erzielen, entschied<br />
man sich für eine Stahlbetonkonstruktion.<br />
In der Vergangenheit wurde einer Verlagerung der Ein- und Auslager-Bereitstellplätze in<br />
Hochregallagern nur eine geringe praktische Bedeutung beigemessen. Untersuchungen von Knepper<br />
[123] zeigen jedoch, daß die hierdurch erzielbaren Leistungsverbesserungen vielfach weit höher sind<br />
als bisher angenommen wurde. Der Beitrag geht auf die Frage der Anordnung der Ein- und<br />
Auslagerpunkte im Hochregallager umfassend ein.<br />
Mit der Optimierung der Lagerhöhe von Hochregallagern befaßt sich Fröhlich l124]. Bei gegebener<br />
Lagerkapazität und gegebener Umschlaghäufigkeit bietet das beschriebene Verfahren einen einfachen<br />
Weg zur Bestimmung der kostenminimalen Lagerhöhe. Schätzfehler in den Kostenansätzen für<br />
Gebäude und Einrichtungen wirken sich dabei nur geringfügig aus, dagegen muß die Abhängigkeit der<br />
Regal- und RFZ-Kosten von der Höhe sehr genau bekannt sein. Die optimalen Lagerhöhen liegen in<br />
einem Bereich zwischen 17 und 23 m.<br />
Eines der größten und modernsten Hochregal-Lager Europas ist das Kernstück des neuen<br />
Ersatzteilzentrums eines Automobilherstellers in Köln. Nach der Brand-Katastrophe vom Oktober 1977<br />
steht mit dem nun abgeschlossenen Wiederaufbau eine Gesamt-Lagerfläche von 122000 m2<br />
Nutzfläche zur Verfügung. Der Bericht [125] gibt einen Einblick in das neue Ersatzteil-Zentrum mit<br />
besonderer Berücksichtigung des nach nur 14 Monaten Planungs- und Bauzeitfertiggestellten<br />
Hochregallagers, der technischen Einrichtungen, der Lagerbedienung und der aufgrund böser<br />
Erfahrungen getroffenen Brandschutzmaßnahmen.<br />
Ein weiteres Beispiel bezieht sich auf die Neuplanung eines Vertriebszentrums für einen Kfz-Ausrüster<br />
in Karlsruhe [126]. Der Entscheidung für das beschriebene Lagerkonzept gingen umfangreiche<br />
Untersuchungen und Berechnungen voraus. Konventionellen Techniken wurden<br />
Hochregalkonzeptionen gegenübergestellt, Transportbelastung, Wegstrecken, Zeiten, Flächen und<br />
technische Möglichkeiten miteinander verglichen. Das Ergebnis war eine Kombination aus einem<br />
zentralen Hochregallager mit umliegenden eingeschossigen Hallen für Wareneingang, Vorzone,<br />
Greiflager und Versand. Alle Bauteile sind unabhängig voneinander erweiterbar.<br />
Ein Beitrag [127] stellt insbesondere die architektonische und bautechnische Konzeption eines<br />
Hochraumlagers für Fasern vor.<br />
Die Sicherstellung einer kontinuierlichen Produktion durch flexible Lagerung von Leer- und Vollgut in<br />
einem Hochregallager einer Brauerei beschreibt [128].
Daß ein 25 Mio-Mark-Neubau nicht zwangsläufig ein Hochlager sein muß, zeigt [129]. Eine<br />
Handelsgruppe für Spiel und Freizeit beliefert ihre 500 Mitgliedskunden aus einem sechsgeschossigen<br />
Etagenlager mit 15000 verschiedenen Artikeln.<br />
6.2. Methoden und Hilfsmittel der Lagerplanung [130-138]<br />
Rupper [130] gibt einen Einblick in die Arbeitsmethode des spezialisierten Lagerplaners. Insbesondere<br />
wird gezeigt, welche Planungsphasen nebst der eigentlichen Bauplanung im Betriebsbereich nötig<br />
sind, um eine größtmögliche Leistungssteigerung zu erzielen.<br />
Ein Vorgehenskonzept für Lagerplanungen beschreibt Rupp [131]. Über den gesamten Projektablauf<br />
hinweg werden die Aufgaben des Betriebsplaners kurz geschildert und Hinweise auf seine<br />
Zusammenarbeit mit Bauherr, Benutzer, Architekt und Fachingenieuren sowie Lieferanten der<br />
Betriebseinrichtungen gegeben.<br />
Lienert / Reck [132] schlagen eine Vorgehensweise zur Auswahl von Lagerprinzipien für Stückgutlager<br />
vor, bei der im Sinne einer "top-down-Planung" zunächst, ausgehend von der gestellten Aufgabe, alle<br />
technisch möglichen Lösungen aufgeführt werden. In einem mehrstufigen Auswahlprozeß werden<br />
dann Lösungsmöglichkeiten bis auf eine oder sehr wenige ausgeschieden. Um den Aufwand zur<br />
Ermittlung der möglichen Lösungen und für den mehrstufigen Auswahlprozeß niedrig zu halten,<br />
werden für die einzelnen Stufen konkrete Hilfsmittel vorgestellt.<br />
Rationalisierung im Warenfluß setzt das konsequente Neuüberdenken der gesamten Logistik eines<br />
Betriebes voraus. Im Rahmen dieser Systemüberlegungen spielt das Lager eine zentrale Rolle, weil<br />
fast alle Warenbewegungen einmal über ein Lager laufen. Die Ausführungen von Fröhlich [133] sollen<br />
zeigen, welche Kriterien den Ablauf einer Lagerplanung bestimmen und wie man mit Hilfe der<br />
Systemplanung zu technisch und wirtschaftlich optimalen Lösungen kommt. Die Lager- und<br />
Fördertechnik bietet heute eine faszinierende Vielfalt von Lösungsmöglichkeiten für die Probleme der<br />
Logistik. Pörsch [134] stellt die Methode der "Nutzwertanalysen" als eine wertvolle Hilfe bei der<br />
Auswahl von Systemtypen und technischen Varianten vor. Mit Recht wird oft die Subjektivität bei der<br />
Gewichtung und Bewertung sowie die Manipulationsmöglichkeit bei der Aufstellung des<br />
Kriterienkatalogs kritisiert. Dennoch erscheint es besser, bei rationalem Entscheidungsverhalten den<br />
Wirtschaftlichkeitsvergleich zu ergänzen. Dazu sind auch nur qualitativ formulierte Bewertungskriterien<br />
- in Form einer Nutzwertanalyse - sicher nützlicher als ein rein gefühlsmäßiges Auswählen.<br />
Kleinteilelager benötigt man als Handlager in Fertigung und Montage, als Zwischenlager,<br />
Ersatzteillager, Werkzeugausgabe, Fertigwaren-Versandlager und Verkaufslager. Eine<br />
morphologische Ordnung [135] zeigt die vielfältigen Systeme solcher Kleinlager.<br />
Verschiedene Bauweisen und Bedienungsmöglichkeiten vergrößern die Anzahl der Varianten noch.<br />
Das Anforderungsprofil an solche Lager enthält technische, organisatorische und wirtschaftliche<br />
Kriterien, Randbedingungen kommen hinzu. Welches Lagersystem im Einzelfall am zweckmäßigsten<br />
ist, kann nur ein Vergleich von Anforderungsprofil und Leistungsprofil aufzeigen.<br />
Wiederverwendungsfähige rechnergestützte Projektierungsunterlagen für Hochregallager wurden in<br />
der DDR [136] erarbeitet. Mit diesen Unterlagen soll den Projektbearbeitern des eigenen Betriebs, aber<br />
auch Kollegen anderer Betriebe und Institutionen, die mit der Vorbereitung von Investitionen auf dem<br />
Gebiet der Stückgutlager beauftragt sind, Hilfe und Unterstützung bei der Durchführung ihrer Arbeit<br />
gegeben werden.<br />
Mit Hilfe eines Simulationsmodells wurde von einem weiteren Autor [137] aus der DDR das Problem<br />
der Fahrwegstrategien von Regalbediengeräten in kombinierten Lagerund Transportsystemen<br />
untersucht.<br />
Die Aspekte der Zuverlässigkeit im Bereich der Logistik stellt Neubaus [138] heraus. Die<br />
Zuverlässigkeitsanalyse ermöglicht bereits in der Planungsphase die Berechnung der<br />
Zuverlässigkeitskenngrößen komplexer logistischer Prozesse, wenn die Zuverlässigkeit aller am<br />
Prozeß beteiligten Arbeitsmittel ermittelbar ist. Die Vorgehensweise wird an einem Anwendungsfall<br />
aufgezeigt.<br />
6.3. Lagertechnik und -organisation [139-160]
Auf der Suche nach neuen - sogenannten integrierten - Lösungen muß das Lager wohl noch betonter<br />
als Bindeglied zwischen Lieferant und Abnehmer gesehen werden. Im Kleinteilelager liegen bei vielen<br />
Unternehmen noch Rationalisierungsreserven. Im Bereich der Förderzeuge ist ein weiterer Vormarsch<br />
der Elektronik zu erwarten.<br />
Neue Entwicklungen und Tendenzen auf dem Gebiet der Transport- und Lagertechnik sowie<br />
Rationalisierungsschwerpunkte für die nächste Zukunft zeigt Rupper [139] auf.<br />
Das Gesicht der Kommissioniertechnik hat sich in den letzten zehn Jahren gewandelt. Zwar blieb das<br />
Ziel, die rationelle Zusammenstellung von Waren nach vorgegebenen Aufträgen, unverändert. Doch<br />
aus der Entwicklung neuer Denkrichtungen formt sich deutlich der Trend, immer teurer und<br />
anspruchsvoller werdende Arbeitsplätze so gering wie möglich zu halten. Wie schnell es gelingen mag,<br />
die Hand des Kommissionierers durch den Greifarm des Roboters zu ersetzen, wird mehr vom<br />
technischen Vermögen als von der Arbeitsmarktlage bestimmt werden. Miebach [140] betrachtet<br />
diesen Problemkreis insbesondere unter dem Aspekt der sich ständig miniaturisierenden Computer.<br />
Regalbediengeräte haben in den letzten 20 Jahren nicht nur einen schnellen Umbruch in der<br />
Lagertechnik, sondern auch in der Fördertechnik und bei der Erstellung von Regaleinrichtungen<br />
eingeleitet. Sie eröffneten Möglichkeiten, die konventionellen Hebezeugen und Fördermitteln bis dahin<br />
verschlossen waren. Dieses gilt insbesondere für die Lagerhöhe, den Automatisierungsgrad von<br />
Lager- und Fördereinrichtungen und die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Podswyna [141]<br />
beschreibt den Aufbau wirtschaftlicher Lager- und Transportsysteme durch die Kombination von<br />
Bausteinen.<br />
Neue Lösungen für die Kommissionierung stellt Müller [142] am Beispiel eines komplexen Lager- und<br />
Warenverteilzentrums vor. Insgesamt handelt es sich um eine der größten und modernsten Anlagen<br />
dieser Art. Neben vollautomatischem rechnergesteuerten Lagerbetrieb - 48000 Palettenplätze wurde<br />
die gesamte Warenverteilung neu konzipiert.<br />
Profilstahl, Rohre, Stangen wirtschaftlich zu lagern, ist für viele Betriebe nach wie vor eine schwierige<br />
Aufgabe. Vielfach wird in großen Hallen auf dem Boden gelagert, und das Material wird zwischen<br />
Rungen entsprechend den Abmessungen abgelegt. Damit ist die Kapazität begrenzt, kostbarer Raum<br />
wird verschenkt, außerdem ist der Personalaufwand sehr hoch. Zwei Beiträge [143 u. 144] geben<br />
Verbesserungsvorschläge für eine wirtschaftliche Lagerung und Handhabung von Langgut.<br />
Ein Hersteller von Diesel- und Gasmotoren mußte das bestehende Stahllager- Stab- und<br />
Profilmaterial, Rohre und Bleche wegen des guten Geschäftsverlaufs und zum Erhalt der<br />
Wettbewerbsfähigkeit automatisieren. Der Autor dieses Beitrages [145] war an der Planung des<br />
Projektes beteiligt. Er beschreibt die aufgetretenen Probleme und wie sie gelöst wurden.<br />
Zwei weitere Beiträge beschreiben ein automatisiertes Lager für Aluminiumprofile [146] und ein<br />
Kassetten-Lagersystem für Stabmaterial [147].<br />
Die heutigen Möglichkeiten der Lagerbewirtschaftung für Kleinteile im Vertriebs-, Ersatzteil-,<br />
Produktions- und Zwischenlager, die sich besonders aufgrund der Fortschritte in der<br />
Mikroprozessortechnik ergeben, zeigt Blattmann [148]. Dazu wird das sog. Mini-Load-System als<br />
Baustein für integrierte Materialfluß-Systeme vorgestellt.<br />
Euro-Paletten, Gitterbox-Paletten mit Füßen und verschiedene Behälter für kleine Teile auf dem Wege<br />
zum und vom Lager unter einen Hut zu bringen, bereitet den Logistikern immer wieder<br />
Kopfzerbrechen. Ein Hersteller hat im Kleinmotorenwerk eines Elektrokonzerns jetzt eine Kombination<br />
aus Standardelementen und Sonderkonstruktionen installiert, die für ähnliche Situationen als<br />
Musterlösung herhalten kann [149].<br />
Rittinghausen / Viehweger [150] bringen eine systematische Betrachtung der Regalförderzeuge.<br />
Bauarten von regalunabhängigen und regalabhängigen Gerüsten sowie von Lastaufnahmemitteln<br />
werden ausführlich dargestellt. Eine umfangreiche Liste von Herstellern schließt den Beitrag ab.<br />
Bei der Konzeption eines Zentrallagers für einen Kraftfahrzeugausrüster [151] fiel die Entscheidung<br />
hinsichtlich der Regalausstattung zugunsten eines Durchlauflagers. Das Durchlauflager konnte die
Zielvorgaben voll erfüllen und erwies sich durch seine Systembauweise auch als vorteilhaft im Preis.<br />
Die robuste, anpassungsfähige Konstruktion war außerdem bereits in der Praxis bewährt.<br />
Schnelle Lieferbereitschaft, Flexibilität, geringe Fehlerquoten, maximale Ausnutzung des knappen<br />
Lagerraumes, optimale Auslastung der Fördersysteme und niedrige Verwaltungskosten sind<br />
Forderungen, die heute an ein modernes Lager- und Warenverteilsystem gestellt werden. Eine<br />
Realisierung dieser Ziele ist ohne elektronische Datenverarbeitung kaum denkbar. Englisch / Voßberg<br />
[152] berichten über grundsätzliche Steuerungskonzepte des zentralen Lagers der Fertigung als Teil<br />
der Neuorganisation des innerbetrieblichen Warenflusses.<br />
Organisiert ein Hersteller von Fernschreib- und Datengeräten sein Ersatzteillager neu, verspricht das<br />
besondere Lösungen [153]. Der Autor, Spezialist für Operations- und Logistikfragen, schildert<br />
Probleme und Erfahrungen bei der Freiplatzlagerung mit einem Kleinrechnersystem.<br />
Berichte über moderne Fördersysteme in Fertigungsstraßen beweisen, daß sich die<br />
unterschiedlichsten Fördergüter rationell und stetig transportieren lassen. Wendorff [154] stellt ein<br />
rechnergesteuertes Pufferlager für die typgebundene Fertigung eines Automobilherstellers vor.<br />
Die Problematik des Lagerbetriebs ohne Bediener hat in jüngerer Vergangenheit zunehmend an<br />
Bedeutung gewonnen. Im Verbund mit hochentwickelten Systemen zurAuftragsabwicklung,<br />
Fertigungsplanung und -steuerung bildet die Rechnersteuerung von komplexen Lagerbereichen eine<br />
Möglichkeit zur Effektivitätssteigerung. Mucks [155] beschreibt hierzu ein neuentwickeltes<br />
Programmsystem zur Steuerung von Hochregallagern.<br />
In einem Beitrag [156] werden die wichtigsten Planungsphasen eines automatischen Stückgutiagers<br />
für 20000 Artikel skizziert und die Besonderheiten des Projektes diskutiert. Die Fallstudie befaßt sich<br />
insbesondere mit Grundlagenbeschaffung, Datenstrukturanalyse, Lösungskonzept, Pflichtenheft,<br />
Rechnerkonfiguration und Verfügbarkeit.<br />
Saisonale Sortimente bringen im Lagerbereich erhebliche Schwierigkeiten und sind sofort nur durch<br />
umfassende Umsortierarbeiten zu beheben. Eine weitere Fallstudie [157] zeigt für den Großhandel<br />
einen völlig neuartigen Weg der Lagerreorganisation und der saisonalen Einflüsse auf. Die<br />
bestehenden Probleme werden entschärft, der rationale Materialfluß sichert Wirtschaftlichkeit.<br />
Für das lose Lagern von Schüttgütern, die nicht im Freien bleiben dürfen, bieten sich grundsätzlich drei<br />
Arten an: das Lagern in vertikalen Silozellen, in Horizontalsilos oder in Flachhallen. Welche<br />
Lagerungsart am vorteilhaftesten ist, läßt sich konkret meist nur im Einzelfall entscheiden. Meissner<br />
[158] nennt Voraussetzungen und führt Beispiele an. Lassig [159] gibt Hinweise für ein platzsparendes<br />
Lagern leerer Fässer im Faßsilo. Ein Beitrag [160] über die sicherheitstechnischen Erfordernisse in der<br />
Lager- und Fördertechnik, insbesondere bei Regalbediengeräten, schließt das Kapitel „Lager“ ab.<br />
7. Arbeitsplatzgestaltung [161-190]<br />
Viel Raum für arbeitsplatzgestalterische Maßnahmen bietet nach wie vor die Montage. Bei Klein- und<br />
Mittelserien-orientierten Betrieben ist sie häufig noch eine regelrechte Schwachstelle. Dabei bemühen<br />
sich die Beschäftigten zwar nach besten Kräften, gute Leistungen zu erbringen, aber die<br />
Arbeitsplatzvoraussetzu ngen setzen ihnen enge Grenzen.<br />
Ein Beitrag [161] stellt die systematische Einführung MTM-optimierter Arbeitsplätze vor, die leichtere<br />
und leistungsbezogenere Arbeit ermöglichen.<br />
Ein weiterer Trend ist die Zunahme von Bildschirmgeräten. Die Belastung der Bediener ist von der<br />
Gestaltung des gesamten Arbeitssystems abhängig. Unter Arbeitssystem sind die Arbeitsumgebung,<br />
die Arbeitsmittel und der Arbeitsablauf zu verstehen. Bei Anwendung ergonomischer Erkenntnisse<br />
führt die Arbeit am Bildschirmarbeitsplatz zu keiner höheren Beanspruchung als bei vergleichbaren<br />
Verwaltungstätigkeiten [162].<br />
7.1. Arbeitsplatzanalyse und- gestaltung [163-170]<br />
Von der Gestaltung des Arbeitsplatzes hängt es wesentlich ab, welche Leistung erbracht wird.<br />
Dasselbe gilt für die Abläufe im Betrieb, gleich, ob es sich um Transporte oder Arbeitsgänge handelt.
Wie ist aber eine derartige Bestgestaltung zu erreichen? Eine mögliche Hilfe dazu ist die 6-Stufen-<br />
Methode nach REFA [163], mit der man Systeme neu- und umgestalten kann.<br />
Haller [164] berichtet über ein neuentwickeltes Instrumentarium zur Feinplanung von<br />
Montagearbeitsplätzen. Man verwendet dazu die EDV. Ausgehend vom Planungsablauf, beschreibt<br />
der Autor die Konzeption des Programmsystems und zeigt, welche Vorteile der Einsatz eines solchen<br />
Planungshilfsmittels der Praxis bringt.<br />
Im Rahmen der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung für körperlich Behinderte wurde eine<br />
Systematik zur Erfassung und Beschreibung möglicher Beeinträchtigungen bei der Erfüllung von<br />
Arbeitsanforderungen durch körperbehinderte Arbeitspersonen entwickelt. Ein Beitrag [165] stellt<br />
Grundlagen und Systematiken dar.<br />
Für die ergonomische Bewertung von Umwelteinflüssen schlägt Bubb [166] ein allgemeingültiges<br />
Konzept vor, das auf der Anwendung des Potenzgesetzes der Psychophysik beruht. Danach würden<br />
sich in einer logarithmischen Darstellung der physikalisch meßbaren Belastungshöhe und<br />
Belastungsdauer Bewertungsgrenzen in Form paralleler Geraden ergeben. An einigen Beispielen wird<br />
das vorgeschlagene Konzept verifiziert.<br />
Eine weitere Humanisierung der Arbeitsbedingungen bedeutet nicht notwendigerweise Verzicht auf<br />
Wirtschaftlichkeit. Auch in der Schwerindustrie lassen sich die Arbeitsverhältnisse oft mit<br />
verhältnismäßig einfachen Mitteln verbessern und damit ein positiver Einfluß auf die Leistung eines<br />
Betriebs erzielen. Doliwa [167] nennt mögliche Vorgehensweisen und führt Beispiele an.<br />
Ein Regelkreismodell „Arbeitssystem“ stellt Hagenkötter [168] vor. Er weist auf die Bedeutung des<br />
Arbeitsschutzes hin und betont, daß von der Arbeit mehr und mehr erwartet wird, sie als positiv<br />
empfundenen Lebensanteil im Sinne menschlicher Verwirklichung erleben zu können.<br />
Der Fachausschuß 8 „Unfallverhütung in Wärmebehandlungsbetrieben“ der Arbeitsgemeinschaft<br />
Wärmebehandlung und Werkstofftechnik (AWT) hat für den Betrieb von Salzbadhärtereien<br />
sicherheitstechnische Empfehlungen [169] ausgearbeitet. An der Erstellung dieser Empfehlung haben<br />
Hersteller und Betreiber, hierzu tangierende Firmen, unabhängige Verbände, Fachinstitute und<br />
öffentlich-rechtliche Institutionen mitgearbeitet.<br />
Der Sicherheit beim Betreiben von Industrierobotern wird nicht immer die nötige Aufmerksamkeit<br />
geschenkt. Nicolaisen [170] weist auf die Gefahren und ihre Ursachen hin, die zu Unfällen oder<br />
Sachschäden führen können. Abschließend gibt er Hinweise, welche Sicherheitsvorkehrungen<br />
getroffen werden, und er stelIt eine neuentwickelte Sicherheitseinrichtung für den<br />
industrieroboternahen Bereich vor.<br />
7.2. Beleuchtung [171-176]<br />
Die Leistungsfähigkeit arbeitender Menschen ist sehr stark abhängig von der Beleuchtung der<br />
Arbeitsplätze. Nicht allein Lichtquantität, sondern auch Lichtqualität entscheiden über das<br />
Sehempfinden. Nach Eberbach [171] erlauben nur ausreichende Kenntnisse über die<br />
Lichtzusammensetzung sowie ihre psychologische und physiologische Wirkung das Ausstatten des<br />
Arbeitsplatzes nach ergonomischen Gesichtspunkten. Von Bedeutung ist unter anderem die spektrale<br />
und zeitliche Zusammensetzung des Lichtes.<br />
Bange [172] beschreibt in einem ausführlichen Artikel die Planung der künstlichen Beleuchtung von<br />
Arbeitsstätten und zeigt ebenfalls auf, wie die Verbesserung der Sehbedingungen zu<br />
Leistungssteigerungen führt.<br />
Die unterschiedlichen Sehaufgaben in gemischten Fertigungshallen erfordern unterschiedliche<br />
Beleuchtungssysteme [173]. Die Allgemeinbeleuchtung sollte nur mit einem Grundanteil an der<br />
Gesamtbeleuchtung beteiligt sein. Stützende Maßnahmen an den jeweiligen Arbeitsplätzen können<br />
sein: Arbeitsplatzorientierte Allgemeinbeleuchtung, zusätzliche Einzelplatzbeleuchtung oder besonders<br />
an das Sehobjekt angepaßte Zusatzbeleuchtungen.<br />
Eine sinnvolle, den Arbeitsbedingungen angepaßte Farbauswahl, wirkt motivierend auf den<br />
arbeitenden Menschen. Eine sich ergebende und auch erwartete Leistungssteigerung ist in den<br />
meisten Fällen jedoch nicht meßbar. Dies liegt daran, daß die Leistungssteigerung nicht spontan,
sondern allmählich eintritt und diese andererseits noch von zusätzlichen Parametern abhängt. Frieling<br />
[174] stellt fest: Farbe allein genügt nicht, auch die zusätzlichen Randbedingungen müssen stimmen.<br />
Mit geeigneten Notbeleuchtungssystemen läßt sich die Sicherheit in Industriebetrieben merklich<br />
erhöhen. Das Installieren derartiger Notbeleuchtungssysteme ist abhängig von der Größe und der<br />
Funktion infrage kommender Arbeitsräume. Abhängig von der jeweiligen Energiequelle kann man<br />
zwischen batteriebetriebenen und netzbetriebenen Beleuchtungssystemen unterscheiden. Weis [175]<br />
zeigt auf, daß bei Industriebetrieben das sogenannte Einzelbatteriesystem an Bedeutung gewinnt.<br />
Den Zusammenhang zwischen Lichtschutzund Lufttechnik stellen Daniels / Bartenbach [176] heraus.<br />
Bei der Planung haustechnischer Anlagen in Bürogebäuden spielt neben vielen Einzelfaktoren in<br />
bezug auf zu erwartende Investitions- und Betriebskosten und in bezug auf das gewünschte<br />
Raummilieu der Zusammenhang zwischen Tageslichttechnik- Kunstlichttechnik und Klimatechnik eine<br />
wesentliche Rolle. Es werden modellhafte Entscheidungshilfen gegeben, die das gesamte Thema<br />
Licht- und Lufttechnik abstützen.<br />
7.3. Lärm [177-182]<br />
In der DDR stellt die lärmbedingte Schwerhörigkeit z. Z. die Berufskrankheit mit dem größten<br />
jährlichen Zugang von rd. 40% an der Gesamtzahl der Berufskrankheiten dar. Deshalb fordert man in<br />
der DDR, neue und bessere Methoden bei der Gestaltung der Arbeitsumweltbedingungen. Haack [177]<br />
berichtet hierzu über ein neues Programmsystem zur Vorausbestimmung der Lärmsituationen in<br />
Arbeitsstätten.<br />
Schulz [178] zeigt die Bedeutung der technischen Lärmminderung in der Bundesrepublik Deutschland<br />
auf und schätzt die Größenordnung der Investitionen der Gesamtindustrie in diesem Bereich von 0,5<br />
bis 1 Mrd. DM/Jahr. Er propagiert ein kostengünstigeres Ablaufschema einer akustischen Grob- und<br />
Feinplanung bei der Projektierung von Fertigungsanlagen.<br />
Aufgrund allgemeiner theoretischer Überlegungen ist man bisher der Meinung, daß durch<br />
schallschluckende Verkleidungen in Fertigungshallen keine nennenswerte Schallpegelminderung<br />
unmittelbar an den einzelnen Maschinen, d. h. am Arbeitsplatz, zu erreichen ist, da hier das<br />
Direktschallfeld des von der jeweiligen Maschine abgestrahlten Schalls dominiert. Beim Nachmessen<br />
in Betrieben, in denen hochgradig absorbierende Kompakt-Absorber installiert worden waren, konnte<br />
Schmidt [179] große Pegelreduzierungen (bis 5 dB) feststellen.<br />
Die praktischen Möglichkeiten des betrieblichen Schallschutzes mit Absorbern und Stellwänden<br />
behandelt ein weiterer Beitrag [180].<br />
Für ein Elektrostahlwerk [181] werden anhand von sieben einfachen Modellbeispielen die durch einen<br />
Hochleistungslichtbogenofen, den Schrottplatz, die Entstaubungsanlage und die Anlagen der<br />
Wasserwirtschaft verursachte Geräuschimmission in verschiedenen Entfernungen berechnet. Ohne<br />
besondere Lärmminderungsmaßnahmen wird in 500 m Abstand ein Gesamtlmmissionspegel aller<br />
Anlagen des Elektrostahlwerkes von 64 dB (A) erreicht, der bei günstigster Aufstellung der Anlagen<br />
und Durchführung praktikabler Lärmminderungsmaßnahmen auf 39 dB (A) verringert werden kann.<br />
Die Voraussetzungen (Schallimmissionsprognosen) der Ausbreitung von Schallemissionen im Freien<br />
aus einem Kraftwerk, einer Anlage, Raffinerie, Fabrik etc. bzw. für die Optimierung der notwendigen<br />
Schallschutzmaßnahmen stellt Theodorescu [182] im Computerprogramm "Schall" vor. Die<br />
durchgeführten Schalluntersuchungen sollen gezeigt haben, daß die Abweichungen zwischen<br />
Berechnungs- und Meßergebnissen auch für komplexe Anlagen wie Kernkraftwerke nicht größer als<br />
2,5 dB (A) sind.<br />
7.4. Luftreinhaltung [183-190]<br />
Der Stand der Entstaubungstechnik hat heute grundsätzlich ein Stadium erreicht, bei dem eine<br />
Weiterverbesserung hinsichtlich Abscheidewirksamkeit und Kosten mit erheblichen Aufwendungen in<br />
Forschung und Entwicklung verbunden ist. Neue Einsatzgebiete für Staubabscheider zeichnen sich<br />
nach Weber [183] unter anderem im Bereich der Hochtemperatur- und Hochdruckgasreinigung, d. h.<br />
einer energiesparenden Hochtemperaturentstaubung, und der kombinierten Gasfeststoffniederschlagung<br />
in einem Aggregat ab.
Gefährliche und gesundheitsschädigende Konzentrationen von Schad- und Giftstoffen am Arbeitsplatz<br />
müssen möglichst schnell abgebaut oder überhaupt vermieden werden. Wie das geschehen kann,<br />
stellt Grupinski [184] am Beispiel der industriellen Behandlung von Teilen mit Chlorwasserstoffen dar.<br />
In Schweißbetrieben ist es nicht leicht, für eine wirksame Lüftung und Luftreinigung zu sorgen. Nur wo<br />
es nicht anders geht, beispielsweise in Doppelböden oder Kesseln, ist die Einzelabsaugung von<br />
Vorteil. Für den Massenbetrieb jedoch bietet sich die Raumabluftanlage an. Zur Entlüftung hoher<br />
Räume nützt man heute die Düsenstrahltechnik [185, 186]. Mit kleinen Düsenstrahlen wird Zu- und<br />
Abluft an den richtigen Ort dirigiert-sowohl in horizontalerwievertikaler Richtung, entsprechend dem<br />
Bedarf.<br />
Die Staubabführung an Handschleifplätzen in Gußputzereien kann zwar mit Hilfe großer Luftmengen<br />
sichergestellt werden. Für die Arbeitskräfte angenehmer wie auch technisch und wirtschaftlich<br />
günstiger ist die Aufgabe zu lösen, wenn der Staub unmittelbar an der Entstehungsstelle erfaßt werden<br />
kann. Einen vorteilhaften Weg dazu bietet die Punktabsaugung [187], die inzwischen mit einer Vielzahl<br />
von Schleifgeräten auch unter schwierigen Bedingungen verbunden werden kann.<br />
Um in Gießereien Arbeitsplätze in den Bereichen Kernmacherei, Formerei und Abgießen im Hinblick<br />
auf gesundheitsgefährliche Gase und Dämpfe beurteilen zu können, wurden von Schütz / Wolf [188]<br />
umfangreiche Messungen durchgeführt. Ziele der Untersuchungen waren die Identifikation der<br />
gasförmigen Schadstoffe, die Feststellung der Höhe der Schadstoffkonzentrationen die Suche nach<br />
arbeitsplatztypischen Leitkomponenten, die Erarbeitung von Empfehlungen für die Beurteilung der<br />
Arbeitsplätze und Vorschläge für Schutzmaßnahmen.<br />
Mit der Erfassung und Reinigung der Primärund Sekundäremissionen von Lichtbogenöfen befaßt sich<br />
ein weiterer Beitrag [189].<br />
Barten [190] stellt Luftreinigungssysteme als integralen Bestandteil moderner Walzwerke vor.<br />
8. Energieversorgung und Brandschutz<br />
8.1. Energieversorgung [191-202]<br />
Die allgemeine Energielage macht ein Energiemanagement im Betrieb notwendig. Leimer [191] zeigt<br />
einen praxiserprobten Lösungsweg für ein betriebliches Energiesparprogramm auf. Ausgehend von<br />
der Schilderung der heutigen Situation, wo viel über punktuelle Energiesparmaßnahmen diskutiert<br />
wird, zeigt er, wie eine Energiebilanz des Betriebes aufgestellt und beurteilt werden kann. Sodann wird<br />
die Systematik für das Aufstellen eines daraus abgeleiteten Maßnahmenkatalogs erläutert und durch<br />
ausgewählte Beispiele illustriert.<br />
Ritter [192] fordert, den Einsatzvon Energie im Betrieb - und natürlich nicht nur dort - so zu behandeln,<br />
wie den Einsatz irgend eines anderen teuren, weil raren Gutes, nämlich sparsam. Bekannte Prinzipien<br />
des rationellen Mittelei nsatzes gilt es auf die betriebliche Energiewirtschaft zu übertragen. Er meint:<br />
Wir brauchen den REFA-lngenieur für den Bereich Energie.<br />
Ebersbach [193] nennt Schwerpunkte der Energie-Einsparung in der Industrie. Er weist auf unnötigen<br />
Verbrauch hin und betont Möglichkeiten der Rückgewinnung.<br />
Ein Beitrag [194] zum Thema Raumheizung und Gebäudeausrüstung wurde als Vortrag anläßlich der<br />
VDI-Tagung "Energieeinsparung in der klein- und mittelständischen Industrie" gehalten. Es werden<br />
Möglichkeiten zur Energieeinsparung bei der Beleuchtung, Heizung, Be- und Entlüftung sowie der<br />
Klimatisierung von Verwaltungsgebäuden und von Industriehallen aufgezeigt. Die Wirtschaftlichkeit<br />
von Energiesparmaßnahmen, die anhand von Beispielen erläutert werden, steht im Mittelpunkt der<br />
Ausführungen.<br />
Der Einsatz von Wärmerückgewinnungsund Kälterückgewinnungsanlagen ist bereits Stand der<br />
Technik und ist dafür maßgebend, daß der Anteil der Wärme- und Kälteenergie nur noch max.14-18 %<br />
des Gesamtenergiebedarfs ausmacht.<br />
In den Bereichen Belichtung und Belüftung weitere Energiereduzierungen vorzunehmen, gilt das<br />
besondere Interesse von Reuter [195].
Die stark gestiegenen Energiekosten und die Sorge um mögliche Energieengpässe haben im<br />
Verwaltungsbau zur Abkehr vom Prinzip voliklimatisierter großer Räume geführt. Damit wurde eine<br />
Bauform, das bisher kaum entwickelte Gruppenbüro, wieder aufgegriffen und ein Raumkonzept<br />
entwickelt, das unteranderemGrundlagefürzurZeitiaufende Wettbewerbsverfahren geworden ist und<br />
dessen Konzeption und Konsequenz Gottschalk [196] näher beschreibt.<br />
Vier Beiträge [197,198,199 und 200] behandeln den Einsatz von Strahlungsheizungen. Gas-lnfrarot-<br />
Strahlungsheizungen haben sehr oft erhebliche Vorteile gegenüber Warmluftheizungen, besonders in<br />
Hallen über acht Meter Raumhöhe. Einsparungen beim Heizen bis 35 % - teilweise auch mehr bringen<br />
wesentliche Energiekostenersparnisse. Bei der Strahlungsheizung wird die Wärme direkt auf den<br />
bestrahlten Gegenstand übertragen - das entspricht dem Prinzip der Sonne. Zuerst wird der Körper<br />
erwärmt, dann die Luft.<br />
Eiteneyer [201] erläutert grundsätzliche Uberlegungen zur externen Industrie-Abwärmenutzung und<br />
beschreibt die Wärmeversorgung eines Schul- und Sportzentrums durch Abwärmeverbund mit einem<br />
Textilbetrieb als wirtschaftlich interessante Lösung. Die Substitution bzw. Ergänzung fossiler<br />
Brennstoffe ist, wie im Beitrag [202] erläutert wird, in unserer Klimazone durch Solarenergie allein nicht<br />
möglich; vielmehr sind kombinierte technische Systeme unter Einbeziehung von Wärmepumpen zur<br />
Nutzung der in der Umwelt vorhandenen Energiereserven in Betracht zu ziehen. Der Autor skizziert<br />
aufgrund einschlägiger Marktstudien die Kosten- / Nutzenverhältnisse sowie das zur Zeit bestehende<br />
Angebots- und Nachfragepotential.<br />
In den vergangenen 10 Jahren ist der Preis für mineralisches Leichtöl um das 6-fache gestiegen. Allein<br />
in den letzten 10 Monaten hat sich der Preis für diesen Brennstoff verdoppelt. Für alle Betreiber<br />
leichtölbeheizter Dampferzeuger stellt sich deshalb die Frage nach kostensenkenden Maßnahmen für<br />
die Dampferzeugung. Die Ausführungen von Ernst [203] sollen derartige Möglichkeiten aufzeigen und<br />
der Anregung dienen.<br />
8.2. Brandschutz [204-212]<br />
In kaum einem anderen Bereich des Arbeitsschutzes gibt es so viele Gesetze, Vorschriften,<br />
Verordnungen, Regeln, Richtlinien und Merkblätter wie im Brandschutz. Sicherlich kann und muß man<br />
das auch als verantwortlicher Mann für die Sicherheit im Betrieb nicht alles auswendig lernen. Aber es<br />
ist gut, wenn man weiß, wo dies alles nachzulesen ist. In diesem Sinne sollte der Beitrag von Jäger<br />
[204] mit seiner vielleicht etwas trokkenen Aufzählung der einzelnen Vorschriften gesehen und gelesen<br />
werden.<br />
Es entstand in der Baupraxis das Bedürfnis, Gebäude in Abhängigkeit vom vorhandenen Brandrisiko<br />
und der vorgesehenen Bauweise rechnerisch zu bemessen.<br />
Ein solches Rechenverfahren wurde in den letzten Jahren entwickelt und dem Normenentwurf DIN<br />
18230 - Brandschutz im Industriebau - zugrunde gelegt. Diese Norm soll eine einheitliche<br />
brandschutztechnische Beurteilung von Industriebauten mit festgelegter Brandbelastung ermöglichen.<br />
Pohl [205] erläutert die Grundgedanken und schlägt zusätzlich vor, Mindestanforderungen an Bauteile<br />
zu stellen, Brandabschnittsgrößen zu begrenzen und Brandlasten zu begrenzen.<br />
Erstmalig wurde in der Neuausgabe der DIN 1986 eine Einstufung des Brandverhaltens von<br />
Abwasserrohren vorgenommen [206]. Maßnahmen gegen eine Beeinträchtigung der<br />
Feuerbeständigkeit von Brandwänden und Decken bei Rohrdurchführungen bestehen in der Wahl<br />
nichtbrennbarer Baustoffe für die Rohrleitungen und in der Abmauerung oder Abspannung mit<br />
nichtbrennbaren Baustoffen.<br />
Das Brandverhalten von Dachdeckungen haben Hildebrand / Rüde [207] näher untersucht und ein<br />
verbessertes Prüfverfahren zur Ermittlung der Feuerausbreitung entwickelt und erprobt.<br />
Die folgenden drei Beiträge befassen sich mit dem Brandschutz im Lagerbereich. Der Artikel [208] gibt<br />
allgemeine Hinweise und regt Vorgehensweisen für Schutzmaßnahmen bei Großlagern an. [209]<br />
beschreibt ein Brandschutzsystem durch wassergefüllte Hohlprofile für Hochregallager. Eine<br />
Dokumentation [210] geht noch einmal auf den Großbrand in Köln ein, beschreibt die Ursachen und<br />
die Auswirkungen auf die neue Lagerplanung.
Da Gefahren sehr unterschiedliche Ursachen und Erscheinungsformen haben können, ergaben sich<br />
im Laufe der Entwicklung von Alarmanlagen zahlreiche Spezialisierungen, so daß heute der Nutzer für<br />
jeden Einsatzschwerpunkt über ein entsprechend spezialisiertes System verfügen kann [211]. Die<br />
meistverbreiteten automatischen stationären Feuerlöschanlagen sind Sprinkleranlagen. Bredow [212]<br />
zeigt Funktionsschema und Bauarten auf.<br />
9. Kosten [213-217]<br />
Investitionen werden im allgemeinen mit Hilfe von Wirtschaftlichkeitsrechnungen und<br />
Rentabilitätsuntersuchungen rechnerisch abgesichert. Bei einer Investitionsentscheidung müssen aber<br />
auch nicht oder nur schwer quantifizierbare und nicht in Geldwert zu beziffernde Einflüsse<br />
berücksichtigt werden. Dies wird in einer Investitionsplanung zusammengefaßt. Schmolz [213] gibt<br />
Hilfen zurAufstellung und Durchführung der Investitionsplanung.<br />
Durch eine Vorkalkulation prognostizierte Kostenwerte für Bauleistungen werden bekanntlich bei der<br />
Ausführung nicht exakt und in jedem Fall bestätigt. Die mögliche Größenordnung der Abweichungen<br />
aber kann eine Bauunternehmung durchaus in Schwierigkeiten bringen. Thurner [214] stellt die<br />
Problematik der Unsicherheit von Kostenprognosen heraus und versucht über<br />
Wahrscheinlichkeitsverteilungen genauere Aussagen über die Arbeitskosten zu gewinnen.<br />
Ein interessanter Ansatz zur genaueren Baukostenplanung ist die Kostengliederung und -planung nach<br />
Gebäudeelementen [215]. Sie ordnet die Kosten des Gebäudes solchen Elementen zu, die bestimmte<br />
Funktionen im Bauwerk erfüllen: Gründen - Tragen Ausbauen - Installieren. Aus Planungs- und<br />
Kostendaten fertiggestellter Baumaßnahmen werden Kennwerte abgeleitet, die der Kostenplanung<br />
neuer Baumaßnahmen dann zur Verfügung stehen.<br />
Ein Autor aus der DDR [216] beschreibt die Möglichkeiten der Erarbeitung und Anwendung von<br />
Richtwerten, Kennzahlen und Normativen bei der Ermittlung der Kosten für Ausrüstungen im<br />
Chemieanlagenbau.<br />
Neben der grundsätzlichen Schwierigkeit, die Lagerkosten eines Betriebes den einzelnen<br />
Lagerfunktionen verursachungsgerecht zuzuordnen, erschweren die von Betrieb zu Betrieb<br />
variierenden Praktiken der Rechnungslegung den Nachweis von Abhängigkeiten zwischen den Sachund<br />
Personalkosten und der Organisation von Großhandelslagern erheblich. Aussagefähige<br />
Ergebnisse zeigt [217] anhand von detalllierten Fallstudien auf.<br />
Ein Vergleich der Größenordnung der Personalkosten und der Betriebskosten von Förderzeugen zeigt<br />
einmal mehr, wie entscheidend Kontrolle und Steuerung der Personalleistung gegenüber dem<br />
Sachmitteleinsatz sind.<br />
10. Zusammenfassung und Ausblick<br />
Ähnlich wie die Unternehmensplanung läßt sich auch die Planung von Fabrikanlagen in die kurzfristige<br />
Jahres- oder Budgetplanung, die mittelfristige Planung und die Langfristplanung einteilen. Bisher<br />
erfolgte die <strong>Fabrikplanung</strong> - auf der Grundlage kurzoder mittelfristiger Daten - für ein oder mehrere<br />
gleichzeitig herzustellende Produkte. Heute ist die technische Lebensdauer von Gebäuden und<br />
Anlagen erheblich höher als die Produktlebensdauer.<br />
Die sich ständig verändernden Bedingungen im Umfeld eines Unternehmens zwingen aber zur<br />
stetigen Planung der Zukunftssicherung. Es gilt, laufend und systematisch die Trends auf den<br />
heimischen und internationalen Märkten, der Rohstoff- und Energielage, der Gesetzgebung und der<br />
gesellschaftlichen Entwicklung zu erfassen und möglichst früh bei der langfristigen<br />
Unternehmensplanung zu berücksichtigen. Nur so wird es möglich sein, den nationalen und<br />
internationalen Wettbewerb zu bestehen.<br />
In der Produktionstechnik sind in den letzten 10 bis 20 Jahren wesentliche Veränderungen eingetreten.<br />
Neue Fertigungsverfahren, ein hoher Automatisierungsgrad der Fertigungsprozesse und das immer<br />
stärkere Verketten einzelner Fertigungsstufen sind die wichtigsten Kennzeichen dieser<br />
fortschreitenden Entwicklung.<br />
Viele Unternehmen haben erkannt, daß neben einem hohen technischen Niveau ihrer Produkte ein<br />
entsprechendes Niveau der Produktionstechnik erforderlich ist, um in der Zukunft überleben zu
können. Eine Möglichkeit ist die konsequente Anpassung der Produktionseinrichtungen an die<br />
Anforderungen der Weltmärkte.<br />
Es sind deshalb ständig Möglichkeiten und Wege zu überprüfen, in welcher Weise eine Umplanung<br />
der Fabrik als Rationalisierungsquelle dienen kann. Die technische Infrastruktur des Betriebs - meist<br />
als Hilfsund Nebenbetriebe bezeichnet - darf in dieser Hinsicht nicht vernachlässigt werden.<br />
Im Zuge steigender Kosten wird der richtige Materialfluß immer wichtiger. Untersuchungen zeigen, daß<br />
in Fertigungsbetrieben im Umiaufkapital häufig doppelt soviel Kapital gebunden ist wie im<br />
Anlagevermögen.<br />
Neben diesen mehr struktur- und ablaufbezogenen Überlegungen gewinnt ein energiebewußter<br />
Fabrikbetrieb zunehmend an Bedeutung. Schließlich sind neue Kommunikationstechniken verfügbar,<br />
die als Instrument einer leistungsorientierten Betriebsführung einsetzbar sind.<br />
Die Aufgaben des Fabrikplaners und des Betriebsingenieurs werden immer komplexer. An dieser<br />
Stelle soll deshalb auf die erstmalige Veranstaltung eines Kongresses speziell zu diesem<br />
Themenkreis, verbunden mit einer Messe, hingewiesen werden. Die von der VDI-Gesellschaft<br />
Produktionstechnikinitiierte Tagung „Fabrik '81“ findet vom 1. bis 4. Dezember 1981 in Köln statt.
Jahr Lit.<br />
st.<br />
<strong>Literaturübersicht</strong> <strong>Fabrikplanung</strong> <strong>1980.</strong>xls<br />
Autoren Titel Zeitschrift Stichworte<br />
1980 [9] Wiendahl, H.-P. und H.- Technische Investitionsplanung in Zeiten industrieller VDI-Z 122 (1980) 8, S. 295/301 Methodik der <strong>Fabrikplanung</strong><br />
R. Greim:<br />
Umstrukturierung.<br />
1980 [10] Aggteleky, B.: Unternehmerisches Zielkonzept als Grundlage langfristiger Teil l: R 31 (1980) 2, S. 55/58, Teil Methodik der <strong>Fabrikplanung</strong><br />
Werksentwicklung. Teil 1 und 2<br />
2: R 31 (1980) 3/4, S. 95/98<br />
1980 [12] Aggteleky, B.: Neue Wege der Betriebsgestaltung. Zfl 26 (1980) 5, S. 315/21 Methodik der <strong>Fabrikplanung</strong><br />
1980 [13] Schmitt, B.: <strong>Fabrikplanung</strong>: Fallbeispiel Werkzeugmaschinenfabrik. Zfl 26 (1980) 3, S. 170/74 Methodik der <strong>Fabrikplanung</strong><br />
1980 [14] Stawowy, H.: Technische Planungsaufgaben beim Bau neuer Werke. S+E 100 (1980) 15, S. 833/43 Methodik der <strong>Fabrikplanung</strong><br />
1980 [15] Kluge, P. und M.<br />
Hofmann:<br />
Industriebauplanung von Rekonstruktionsmaßnahmen. BB 34 (1980) 5, S. 215/17 Methodik der <strong>Fabrikplanung</strong><br />
1980 [16] Strizik, P.: Kriterien der Gießereiplanung in Entwicklungsländern. G 67 (1980) 8, S. 195/200 Methodik der <strong>Fabrikplanung</strong><br />
1980 [17] Scheel, J.: Projekt-Management: Aufgaben, Kosten, Nutzen. VDI-Z 122 (1980) 14, S. 567/75 Methodik der <strong>Fabrikplanung</strong><br />
1980 [18] Greiner: Projektsteuerung bei Großbauten. DBZ (1980) 9, S. 1373/78 Methodik der <strong>Fabrikplanung</strong><br />
1980 [19] Knöpfel, H. und A. J. Leitung von komplexen Bauvorhaben in der Vorbereitungs- SchBZ 98 (1980) 7, S. 121/24 Methodik der <strong>Fabrikplanung</strong><br />
Lässker:<br />
und Projektierungsphase.<br />
1980 [20] Gabler, E.: Die Aufgaben eines Chefarchitekten in der<br />
Industrieprojektierung.<br />
AD 29 (1980) 9, S. 535/39 Methodik der <strong>Fabrikplanung</strong><br />
1980 [21] Bärmann, D.: Fertigungsablauf in einer neuen Fabrik für elektronische<br />
Geräte.<br />
wt 70 (1980) 6, S. 383/86 Methodik der <strong>Fabrikplanung</strong><br />
1980 [22] NN: Neubau einer Montagehalle für Fahrzeugkrane. Zfl 26 (1980) 6, S. 354/56 Methodik der <strong>Fabrikplanung</strong><br />
1980 [23] NN: Maschinenfabrik in Zürich. DBZ (1980) 6, S. 883/86 Methodik der <strong>Fabrikplanung</strong><br />
1980 [24] Wenzke, J.: VEB Eichsfelder Zementwerke Deuna, Baustufe I und II. AD 29 (1980) 12, S. 722/26 Methodik der <strong>Fabrikplanung</strong><br />
1980 [25] Schug, K.: Das neue Aluminium-Umschmelzwerk Raushofen. M 36 (1980) 11, S. 1052/53 Methodik der <strong>Fabrikplanung</strong><br />
1980 [26] Siltari, O.: Ein neues Kaltwalzwerk auf der grünen Wiese. S+E 100 (1980) 15, S. 844/55 Methodik der <strong>Fabrikplanung</strong><br />
1980 [27] Busch, W.: Die Stranggießanlage, Bruckhausen der Thyssen AG in<br />
Duisburg-Hamborn.<br />
Zfl 26 (1980) 2, S. 74/79 Methodik der <strong>Fabrikplanung</strong><br />
1980 [28] Braun, J. D.: Planung und Bau der Eisengießerei Verto, Amiens<br />
(Frankreich).<br />
G 67 (1980) 6, S. 137/40 Methodik der <strong>Fabrikplanung</strong><br />
1980 [29] NN: Möbelfabrik in Staadskanaal. Zfl 26 (1980) 1, S. 1/7 Methodik der <strong>Fabrikplanung</strong><br />
1980 [30] NN: Wern-Fensterfabrik in Rudersberg. TAB 11 (1980) 11, S. 951/60 Methodik der <strong>Fabrikplanung</strong><br />
1980 [31] Schwab,K.: DiestrategischeMatrix-einHilfsmittel zur Bestimmung der<br />
Unternehmenspolitik.<br />
IO 49 (1980) 1, S. 24/26 Planungshilfsmittel<br />
1980 [32] Dusseiller, B.: ICEPS, ein Verfahren zum Bewerten und Beurteilen von<br />
Innovationen, Methode und Erfahrungen.<br />
VDI-Z 122 (1980) 5, S. 155/58 Planungshilfsmittel<br />
1980 [33] Gottschalk, E. und M. Zur Entscheidungsfindung im informationsverarbeitenden WZTHM 24 (1980) 1, S. 83/87 Planungshilfsmittel<br />
Schenk:<br />
System der Projektierung.<br />
Seite 1 von 12
Jahr Lit.<br />
st.<br />
<strong>Literaturübersicht</strong> <strong>Fabrikplanung</strong> <strong>1980.</strong>xls<br />
Autoren Titel Zeitschrift Stichworte<br />
1980 [34] Gomex, P. und F.<br />
Escher:<br />
Szenarien als Planungshilfen. I0 49 (1980) 9, S. 416/20 Planungshilfsmittel<br />
1980 [35] Schallehn, W.: Ablaufplanung mit LEINET-Erfahrungen und Einschätzungen. BB 34 (1980) 2, S. 63/65 Planungshilfsmittel<br />
1980 [36] Wiewelhove, W.: Rationelle Investitionsplanung durch systematische<br />
VDI-Z 122 (1980) 15/16, S. Planungshilfsmittel<br />
Datenbereitstellung.<br />
647/54<br />
1980 [37] Roschmann, K.: Betriebsdatenerfassung. FB/IE 29 (1980) 4, S. 226/44 Planungshilfsmittel<br />
1980 [38] Grundig, C.-G.: Einsatz der Simulationsmethode zur Verhaltensanalyse von<br />
Fertigungsprozessen Stand, Probleme, Tendenzen.<br />
WZTHM 24 (1980) 2, S. 89/97 Planungshilfsmittel<br />
1980 [39] Vettin, G.: Simulation von Ablaufsystemen in der verketteten Fertigung. MM 86 (1980) 9, S. 147/50 Planungshilfsmittel<br />
1980 [40] Chmielnicki, S. : Simulation - ein Hilfsmittel bei der Auslegung des<br />
Werkzeugflusses in flexiblen Fertigungssystemen.<br />
IA 102 (1980) 20, S. 28/29 Planungshilfsmittel<br />
1980 [41] Rudolph, K. und W. Simulationsprogramme der Fertigungssteuerung -<br />
ZwF 75 (1980) 4, S. 157/61 Planungshilfsmittel<br />
Stanek:<br />
wesentliches Arbeitsmittel der Technologen im<br />
Fertigungsprozeß.<br />
1980 [42] Eversheim, W.,<br />
Hoeschen, R.-D. und K.<br />
H. Peffekoven:<br />
Rechnerunterstützte Montageplanung für komplexe Produkte. wt 70 (1980) 6, S. 387/91 Planungshilfsmittel<br />
1980 [43] Ißing, W.: Ein Gleisanschluß gehört dazu. P (1980) 29/30, S. 8 Standortplanung und Standortwahl<br />
1980 [44] Fraissl, H.-J.: Anschluß ans internationale Strekkennetz. Planung von<br />
Rangier- und Verladebetrieb.<br />
MF (1980) 2, S. 28/30 Standortplanung und Standortwahl<br />
1980 [45] NN: Spanien, Irland, Schottland: Standortvergleich. SchMM 80 (1980) 43, S. 40/41 Standortplanung und Standortwahl<br />
1980 [46] Hake, B.: Auf Standortsuche in den USA? IO 49 (1980) 7/8, S. 352/53 Standortplanung und Standortwahl<br />
1980 [47] NN: Warum geht ein deutscher Werkzeugmaschinenhersteller<br />
nach USA?<br />
Mfe (1980) 3, S. 48/50 Standortplanung und Standortwahl<br />
1980 [48] NN: Auf kurzem Weg zu kurzen Wegen. MF (1980) 11, S. 16/17 Layoutplanung<br />
1980 [49] Rümmier, G., Schilling, Vorbestimmung des Montagellächenbedarfs mit der FB 30 (1980) 10, S. 619/20 Layoutplanung<br />
W. und H. Brandes: Mehrfachregression.<br />
1980 [50] Ristow, B.: Projektierung und Rekonstruktion der Werkzeugschleiferei im FB 30 (1980) 4, S. 219/21<br />
Maschinenbaubetrieb Erkenntnisse zur Betriebsgestaltung.<br />
Layoutplanung<br />
1980 [51] Woithe, S.: Entwicklung und rationelle Projektierung von IGFA in der<br />
metallverarbeitenden Industrie.<br />
1980 [52] Schmigalla, H., Rodeck, Dimensionierung und Strukturierung von Fertigungszellen mit<br />
W. und B. Hentschel: Industrierobotern.<br />
Seite 2 von 12<br />
FB 30 (1980) 8, S. 455/59 Layoutplanung<br />
FB 30 (1980) 8, S. 463/66 Layoutplanung
Jahr Lit.<br />
st.<br />
<strong>Literaturübersicht</strong> <strong>Fabrikplanung</strong> <strong>1980.</strong>xls<br />
Autoren Titel Zeitschrift Stichworte<br />
1980 [53] Bauernfeind, U.: RechnergesteuertesTransportsystem zur Verbesserung des<br />
Materialflusses. Beispiel aus einer Kleinserienfertigung.<br />
ZwF 75 (1980) 3, S. 105/08 Materialfluß, Materialflußplanung<br />
1980 [54] Langner, D.: Die steuerbare Fabrik beginnt bei der Logistik. MF (1980) Sonderausg., S. 21/23 Materialfluß, Materialflußplanung<br />
1980 [55] Hesser, P.: Entwicklungstendenzen im innerbetrieblichen Materialfluß. f+h 30 (1980) 12, S. 1070/74 Materialfluß, Materialflußplanung<br />
1980 [56] Jünemann, R.: Lernen im System zu denken. Materialfluß in den 80 Jahren. MF (1980) 2, S. 21/ 25 Materialfluß, Materialflußplanung<br />
1980 [57] NN : Neue Arbeitsstrukturen bedingen neue Lösungen des<br />
Transports.<br />
IA 102 (1980) 72, S. 25 Materialfluß, Materialflußplanung<br />
1980 [58] Rittinghausen, H.: Innerbetriebliche Materialflußstrukturen in der Einzel- und<br />
Serienfertigung.<br />
IA 102 (1980) 92, S. 39/40 Materialfluß, Materialflußplanung<br />
1980 [59] Schiele, G. : Flexible Verkettung von Werkzeugmaschinen. IA 102 (1980) 65, S. 27/28 Materialfluß, Materialflußplanung<br />
1980 [60] Handke, E. und G.<br />
Handke:<br />
Flexible Fertigungssysteme ändern Materialflußkonzepte. MF (1980) | Sonderausg. S. 52/56 Materialfluß, Materialflußplanung<br />
1980 [61] Hörl, A.: Auf die richtige Verkettung kommt es an. P (1980) 6, S. 3 Materialfluß, Materialflußplanung<br />
1980 [62] Steinhilper, R.: Planung des Werkstückflusses in einer neustrukturierten<br />
Verzahnteilefertigung.<br />
VDIZ 122 (1980) 22, S. 997/1005 Materialfluß, Materialflußplanung<br />
1980 [63] Rittinghausen, H.: Konzept eines integrierten Materialflußsteuerungssystems für IA 102 (1980) 99, S. 31/32<br />
die Einzel- und Serienfertigung.<br />
Materialfluß, Materialflußplanung<br />
1980 [64] Hesser, P.: Auswirkungen der Arbeitsstättenverordnung auf<br />
Fördersysteme.<br />
IA 102 (1980) 90, S. 24/27 Materialfluß, Materialflußplanung<br />
1980 [65] Heller, K.-H.: Rechnergestützte Materialflußplanung führt zum<br />
VDI-Z 122 (1980) 23/24, S. Materialfluß, Methoden und<br />
kostenminimierten Konzept.<br />
1093/96<br />
Hilfsmittel der Materialflußplanung<br />
1980 [66] NN: Länge + Breite = Stapleranzahl. MF (1980) 10, S. 48/50 Materialfluß, Methoden und<br />
Hilfsmittel der Materialflußplanung<br />
1980 [67] Czech, F.: Fahrwegstrategien von Regalbediengeräten in kombinierten HuF 20 (1980) 3, S. 86/89 Materialfluß, Methoden und<br />
Lager- und Transportsystemen.<br />
Hilfsmittel der Materialflußplanung<br />
1980 [68] Krampe, H. und G. Grundlagen der TUL-Analyse. HuF 20 (1980) 8, S. 240/43 Materialfluß, Methoden und<br />
Lohse:<br />
Hilfsmittel der Materialflußplanung<br />
1980 [69] Lohse, G. : Methoden und Verfahren der TUL-Prozeßanalyse. Teil 1. HuF 20 (1980) 11, S. Materialfluß, Methoden und<br />
336/39<br />
Hilfsmittel der Materialflußplanung<br />
1980 [70] Lohse, G. : Methoden und Verfahren der TUL-Prozeßanalyse. Teil 2. HuF 20 (1980) 12, S. Materialfluß, Methoden und<br />
366/70<br />
Hilfsmittel der Materialflußplanung<br />
1980 [71] Lautsch, H.: Rationalisierung des innerbetrieblichen Transports - Ergebnis HuF 20 (1980) 4, S. 108/10 Materialfluß, Methoden und<br />
sorgfaltiger Analyse.<br />
Hilfsmittel der Materialflußplanung<br />
1980 [72] Grossmann, G. und W. Analyse von Umschlagprozessen für Stückgut. HuF 20 (1980) 6, S. 164/168 Materialfluß, Methoden und<br />
Huhn :<br />
Hilfsmittel der Materialflußplanung<br />
Seite 3 von 12
Jahr Lit.<br />
st.<br />
1980 [73] Großeschallau, W.,<br />
Kuhn, A. und R.<br />
Junemann:<br />
<strong>Literaturübersicht</strong> <strong>Fabrikplanung</strong> <strong>1980.</strong>xls<br />
Autoren Titel Zeitschrift Stichworte<br />
Simulation von Materialflußsystemen. Teil l: "Einführung in die<br />
Aufgaben und Möglichkeiten der Materialflußsimulation."<br />
1980 [74] Kuhn, A.: Simulation von Materialflußsystemen. Teil ll: "Die Simulation<br />
des Materialtlusses innerbetrieblicher Systeme - Modell und<br />
Grundlagen."<br />
1980 [75] Kuhn, A.: Simulation von Materialfluß-Systemen. Teil lll: "Die Planung<br />
mit Hilfe des Simulationssystems SIMIS - Methodik und<br />
Beispiele."<br />
1980 [76] Großeschallau, W.: Simulation von MaterialflußSystemen. Teil IV: "Das<br />
Simulationsmodell MODUS - Modulares Dispositions- und<br />
Steuerungssystem für den innerwerklichen Transportbereich."<br />
1980 [77] Großeschallau, W. und<br />
U. Hoya:<br />
Simulation von Materialfluß-Systemen. Teil V: "Anwendung<br />
des Simulationssystems MODUS: Methodik und Beispiele."<br />
f+h 30 (1980) 2, S. 101/07 Materialfluß, Methoden und<br />
Hilfsmittel der Materialflußplanung<br />
f+h 30 (1980) 3, S. 203/07 Materialfluß, Methoden und<br />
Hilfsmittel der Materialflußplanung<br />
dhf 26 (1980) 5, S. 406/10 Materialfluß, Methoden und<br />
Hilfsmittel der Materialflußplanung<br />
f+h 30 (1980) 6, S. 497/03 Materialfluß, Methoden und<br />
Hilfsmittel der Materialflußplanung<br />
f+h 30 (1980) 8, S. 619/96 Materialfluß, Methoden und<br />
Hilfsmittel der Materialflußplanung<br />
1980 [78] Klug, H. und A. Kuhn: Die Projektierung von FTS-Systemen mit Hilfe der Simulation. dhf 26 (1980) 4, S. 21/30 Materialfluß, Methoden und<br />
Hilfsmittel der Materialflußplanung<br />
1980 [79] Fried, J. und G. Natus: Praxisnahe Simulation von Transportsystemen. f+h 30 (1980) 2, S. 107/09 Materialfluß, Methoden und<br />
Hilfsmittel der Materialflußplanung<br />
1980 [80] Utz, K.: KomplexeTransportsysteme: "Computersimulation vermindert MM 86 (1980) 84, S. 1594/97 Materialfluß, Methoden und<br />
Planungsrisiko."<br />
Hilfsmittel der Materialflußplanung<br />
1980 [81] NN: Entwicklungstendenzen in der Fördertechnik. SchMM 80 (1980) 52, S. 40/43 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
Förderhilfsmitteln<br />
1980 [82] Behrens, U.: Transport, Montage und Lager hängen am Förderer. MF (1980) Sonderausg., S. 68/73 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
1980 [83] Hanke, F.: Mechanisiertes und automatisiertes Fördern mit<br />
Hängebahnsystemen.<br />
1980 [84] Hiller, G. und W. Kroll: Elektrohängebahnen: Anlagen für anspruchsvolle<br />
Materialflußaufgaben.<br />
Förderhilfsmitteln<br />
SchMM 80 (1980) 9, S. 43/47 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
Förderhilfsmitteln<br />
SchMM 80 (1980) 47, S. 38/43 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
Förderhilfsmitteln<br />
1980 [85] NN: Transportsystem und Puffer zugleich. P (1980) 49, S. 4 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
Förderhilfsmitteln<br />
Seite 4 von 12
Jahr Lit.<br />
st.<br />
<strong>Literaturübersicht</strong> <strong>Fabrikplanung</strong> <strong>1980.</strong>xls<br />
Autoren Titel Zeitschrift Stichworte<br />
1980 [86] NN: Elektrohängebahn in einem Fertigungsbetrieb. IA 102 (1980) 65, S. 24 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
Förderhilfsmitteln<br />
1980 [87] Haas, H.: Hängeförderer in Gießereien. ZwF 75 (1980), 3, S. 113/20 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
Förderhilfsmitteln<br />
1980 [88] NN: Kreisförderer mit automatischer Be- und Entladung. dhf 26 (1980) 3, S. 36/40 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
Förderhilfsmitteln<br />
1980 [89] Becker, K.: Neue Förderanlagen auf Basis der Einschienenbahn. dhf 26 (1980) 12, S. 23/24 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
Förderhilfsmitteln<br />
1980 [90] Dietz, M.: Motorenteile- Montage in einem Automobilwerk. ZwF 75 (1980) 11, S. 509/611 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
1980 [91] Neke, G.: Unterflurförderer als Bindeglied zwischen Fertigung und<br />
Lackiererei.<br />
Förderhilfsmitteln<br />
ZwF 75 (1980) 3, S. 121/23 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
Förderhilfsmitteln<br />
1980 [92] NN: Verfahrbare Arbeitsplätze. IA 102 (1980) 69, S. 20 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
1980 [93] Beckert, R.: Alternative zum Montage-Fließband: Selbstfahrende<br />
Werkstückträger.<br />
1980 [94] Elbracht, D.: Induktiv gesteuerte Flurförderzeuge als Verkettungsglieder in<br />
der rechnergeführten Fertigung.<br />
Förderhilfsmitteln<br />
f+h 30 (1980) 12, S. 1082/84 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
Förderhilfsmitteln<br />
ZwF 75 (1980) 11, S. 512/16 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
Förderhilfsmitteln<br />
1980 [95] NN : Für Staplereinsatz war der Lärm zu groß. P (1980) 14, S. 14/15 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
1980 [96] Fraissl, H.-J.: Kopflose Planung steht dem FTS im Wege (FTS = Fahrerlose<br />
Transportsysteme).<br />
Förderhilfsmitteln<br />
MF (1980) 3, S. 37/39 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
Förderhilfsmitteln<br />
1980 [97] Klug, H. G.: Mikros machen FTS zu Robotern. MF (1980) 10, S. 23/26 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
Förderhilfsmitteln<br />
Seite 5 von 12
Jahr Lit.<br />
st.<br />
<strong>Literaturübersicht</strong> <strong>Fabrikplanung</strong> <strong>1980.</strong>xls<br />
Autoren Titel Zeitschrift Stichworte<br />
1980 [98] NN: Transport und Verpackung von Rollen und Paletten in der<br />
Papierindustrie.<br />
1980 [99] NN: DieDirektbeschickungsanlage-einHilfsmittel zur<br />
Rationalisierung.<br />
1980 [100] Monsberger, J.: Die unterschiedlichen Bauweisen von Plattenbandförderern<br />
hängen vom Transportgut ab.<br />
dhf 26 (1980) 4, S. 63/65 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
Förderhilfsmitteln<br />
IA 102 (1980) 96, S. 22/23 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
Förderhilfsmitteln<br />
MM 86 (1980) 12, S. 206/09 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
Förderhilfsmitteln<br />
1980 [101] Fraissl, H.-J.: Stau ohne Ärger, Bauelement Staurollenbahn. MF (1980) 11, S. 38/43 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
1980 [102] NN: Transportgerät Luft - Kleinstteiletransport auf<br />
Luftkissenbahnen.<br />
Förderhilfsmitteln<br />
MF (1980) 2, S. 32/34 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
Förderhilfsmitteln<br />
1980 [103] Frohmann, D.: Innerbetrieblicher Transport mit Gabelstaplern. R 31 (1980) 1, S. 11/17 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
Förderhilfsmitteln<br />
1980 [104] Wöhr, B.: Vierwegestapler sind mehr als normale Stapler. dhf 26 (1980) 1, S. 17/18 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
Förderhilfsmitteln<br />
1980 [105] Mooren, J. G. L.: Palettenloser Transport kann Kostenvorteile bieten. dhf 26 (1980) 1, S. 19/22 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
1980 [106] NN: Überlegungen zur Auswahl eines wirtschaftlichen<br />
Behältersystems für Transport und Lagerung von Teilen in der<br />
industriellen Fertigung.<br />
Förderhilfsmitteln<br />
dhf 26 (1980) 2, S. 29/31 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
Förderhilfsmitteln<br />
1980 [107] Weinert, U.: Transportbehälter - Von der Stange oder Maßkonfektion. f+h 30 (1980) 4, S. 350/51 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
1980 [108] NN: Nicht nur Materialflußaufgabe bestimmt die Geometrie von<br />
Behältern aus Kunststoff.<br />
1980 [109] Sterling, W. K.: Innerbetriebliche Produktförderung rationell und<br />
kostenbewußt gestalten.<br />
Seite 6 von 12<br />
Förderhilfsmitteln<br />
MM 86 (1980) 12, S. 210 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
Förderhilfsmitteln<br />
dhf 26 (1980) 9, S. 26/28 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
Förderhilfsmitteln
Jahr Lit.<br />
st.<br />
<strong>Literaturübersicht</strong> <strong>Fabrikplanung</strong> <strong>1980.</strong>xls<br />
Autoren Titel Zeitschrift Stichworte<br />
1980 [110] NN: Kunststoffbehälter - ein wirtschaftliches Arbeitsmittel im<br />
ganzen Betrieb.<br />
1980 [111] NN: Kisten mit Pfiff. Kunststoffbehälter: variierbare, vielseitige und<br />
kombinierbare Transport- und Lagerhilfen.<br />
1980 [112] Kind, U., Sampe, D. und<br />
K. Rudolf:<br />
Rationelle TUL-Mittel für die Bereitstellung von Vorrichtungen,<br />
Werkzeugen und Prüfmitteln.<br />
1980 [113] Fink, E.: Sonderfahrzeuge im Hüttenwerk: Bauformen passen sich<br />
allen Transportaufgaben an.<br />
ZwF 75 (1980) 2, S. 89/90 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
Förderhilfsmitteln<br />
MF (1980) 3, S. 45/48 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
Förderhilfsmitteln<br />
FB 30 (1980) 12, S. 719/22 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
Förderhilfsmitteln<br />
MM 86 (1980) 21, S. 378/82 Materialfluß, Auswahl und Einsatz<br />
von Fördermitteln und<br />
Förderhilfsmitteln<br />
1980 [114] Vischer, H.: Produktionslager-Reserve der Fertigung. MF (1980) Sonderausg., S. 25/26 Lager<br />
1980 [115] NN: So klein wie möglich, so groß wie nötig. BT 20 (1980) 8, S. 54/56 Lager<br />
1980 [116] Köckmann, P. Logistisch lagern im Materialfluß. IO 49 (1980) 6, S. 332/336 Lager<br />
1980 [117] Hoyer,V.: Zwischenlagerung spart Kosten. P(1980) 8, S. 12/13 Lager<br />
1980 [118] Achtner, W.: Welches Lager für welche Menge? BT 20 (1980) 10, S. 108/110 Lager<br />
1980 [119] NN : Hochregallager einer Ventilatorenfabrik im Irak. dhf 26 (1980) 5, S. 36/38 Lager, Lagerplanung<br />
1980 [120] NN: Hochregallager-Bindeglieder im Produktionsprozeß. f+h 30 (1980) 8, S. 672/674 Lager, Lagerplanung<br />
1980 [121] Balcke, J.: Ein Hochregallager auf gewachsenem Boden. f+h 30 (1980) 7, S. 587/589 Lager, Lagerplanung<br />
1980 [122] Walther, D.: Hochregallager in Sonderbauweisen. HuF 20 (1980) 9, S. 279/281 Lager, Lagerplanung<br />
1980 [123] Knepper, L.: Leistungsverbesserung in Hochregallagern durch optimale f+h 30 (1980) 12, S. 1096/1099 Lager, Lagerplanung<br />
Anordnung der Ein und Auslager-Bereitstellplatze.<br />
1980 [124] Fröhlich, G.: Optimierung der Lagerhöhe eines Hochregallagers. f+h 30 (1980) 8, S. 670/671 Lager, Lagerplanung<br />
1980 [125] NN: Neu entstanden: Das Ersatzteilzentrum von Ford. f+h 30 (1980) 7, S. 590/594 Lager, Lagerplanung<br />
1980 [126] NN: Vertriebszentrum Karisruhe der Robert Bosch GmbH. Zfl 26 (1980) 2, S. 64/73 Lager, Lagerplanung<br />
1980 [127] Heene, G.V.: Faserlager der Carl Freudenberg in Weinheim. Zfl 26 (1980) 6, S. 346/349 Lager, Lagerplanung<br />
1980 [128] NN: Kontinuierliche Produktion durch flexible Lagerung. MF (1980) 11, S. 19/23 Lager, Lagerplanung<br />
1980 [129] NN: Etagenlager contra Hochregallager. MF (1980) 4, S. 19/22 Lager, Lagerplanung<br />
1980 [130] Rupper, P.: Lagerplanung: Vom Groben zum Feinen. I0 49 (1980) 12, S. 574/575 Lager, Methoden und Hilfsmittel der<br />
Lagerplanung<br />
1980 [131] Rupp, M.: Das BMI-Vorgehenskonzept für Lagerplanungen. dhf 26 (1980) 2, S. 20/25 Lager, Methoden und Hilfsmittel der<br />
Lagerplanung<br />
1980 [132] Lienert, J. und Reck, K.: Auswahl des Lagerprinzips für Stückgut-Lager. f+h 30 (1980) 7, S. 583/587 Lager, Methoden und Hilfsmittel der<br />
Lagerplanung<br />
Seite 7 von 12
Jahr Lit.<br />
st.<br />
<strong>Literaturübersicht</strong> <strong>Fabrikplanung</strong> <strong>1980.</strong>xls<br />
Autoren Titel Zeitschrift Stichworte<br />
1980 [133] Fröhlich, G.: Lagersystemplanung. dhf 26 (1980) 11, S. 21/24 Lager, Methoden und Hilfsmittel der<br />
Lagerplanung<br />
1980 [134] Pörsch, M.: Lagertypen im Nutzwertvergleich. Teil 1: IO 49 (1980) 3, S. 131/138; Lager, Methoden und Hilfsmittel der<br />
Teil 2: IO 49 (1980)4, S. 214/220 Lagerplanung<br />
1980 [135] Haag, W. F.: Leistungsvergleich entscheidet über die Wahl des richtigen MM 86 (1980) 2, S. 19/22 Lager, Methoden und Hilfsmittel der<br />
Kleinteilelagers.<br />
Lagerplanung<br />
1980 [136] Richter, K. und Schubert, Rechnergestutzte Projektierung -Wiederverwendungsfähige HuF 20 (1980) 4, S. 100/104 Lager, Methoden und Hilfsmittel der<br />
P.:<br />
Projektierungsunterlagen für Hochregallager.<br />
Lagerplanung<br />
1980 [137] Goch, F.: Fahrwegstrategien von Regalbediengeräten in kombinierten HuF 20 (1980) 3, S. 86/89 Lager, Methoden und Hilfsmittel der<br />
Lager- und Transportsystemen.<br />
Lagerplanung<br />
1980 [138] Neuhaus, W. A.: Prognose der Zuverlassigkeit logistischer Systeme in der dhf 26 (1980) S. 19/25 Lager, Methoden und Hilfsmittel der<br />
Planungsphase.<br />
Lagerplanung<br />
1980 [139] Rupper, P.: Forder- und Lagertechnik: Stand und Entwicklungstrends. lO 49 (1980) 3, S. 124/125 Lager, Lagertechnik und -<br />
organisation<br />
1980 [140] Miebach, J.: Das Kommissionieren wartet auf die Automation. MF (1980) Sonderausg., S. 28/31 Lager, Lagertechnik und -<br />
organisation<br />
1980 [141] Podswyna, F.: Wirtschaftliche Lager- und Transportsysteme durch die dhf 26 (1980) 1, S. 24/31 Lager, Lagertechnik und -<br />
Kombination von Bausteinen.<br />
organisation<br />
1980 [142] Müller, W.: Neue Lösungen für die Kommissionierung. dhf 26 (1980) 6, S. 21/22 Lager, Lagertechnik und -<br />
organisation<br />
1980 [143] Semmelroggen, H. G.: Langgut wirtschaftlich lagern und handhaben. f+h 30 (1980) 5, S. 442/448 Lager, Lagertechnik und -<br />
organisation<br />
1980 [144] NN: Schwer- und Langgut wirtschaftlich lagern in stufenlos dhf 26 (1980) 6, S. 23/24 Lager, Lagertechnik und -<br />
verstellbaren Regalen.<br />
organisation<br />
1980 [145] Ruiner, H.: Langgut-Lagermaschine versorgt die Produktion. f+h 30 (1980) 8, S. 667/670 Lager, Lagertechnik und -<br />
organisation<br />
1980 [146] Haupt, H.: Automatisiertes Lager für Aiuminiumprofile. ZwF 75 (1980) 11, S. 517/521 Lager, Lagertechnik und -<br />
organisation<br />
1980 [147] NN: Vier Sägen- ein Lager- ein Mann. P(1980)20, S. 8 Lager, Lagertechnik und -<br />
organisation<br />
1980 [148] Blattmann, R.: Automatisierung von Kleinteilelagern. f+h 30 (1980) 2, S. 132/135 Lager, Lagertechnik und -<br />
organisation<br />
1980 [149] Müller. T.: Im Vorhof des Lagers. Duales Fördersystem für An- und MF (1980) 4, S. 28/30 Lager, Lagertechnik und -<br />
Auslieferung.<br />
organisation<br />
1980 [150] Rittinghausen, H. und Regalförderzeuge. ZwF 75 (1980) 3, S. 124/133 Lager, Lagertechnik und -<br />
Viehweger, B.:<br />
organisation<br />
Seite 8 von 12
Jahr Lit.<br />
st.<br />
<strong>Literaturübersicht</strong> <strong>Fabrikplanung</strong> <strong>1980.</strong>xls<br />
Autoren Titel Zeitschrift Stichworte<br />
1980 [151] NN: Rechnergesteuertes Greiflager für Ersatzteile. f+h 30 (1980) 2, S. 123/125 Lager, Lagertechnik und -<br />
organisation<br />
1980 [152] Englisch, D. und Lagersteuerung. IBM 30 (1980) 252, S. 27/31 Lager, Lagertechnik und -<br />
Voßberg, P.:<br />
organisation<br />
1980 [153] Schneider, H.: EDV im EDV-Ersatzteillager. MF (1980) 12, S. 31/33 Lager, Lagertechnik und -<br />
organisation<br />
1980 [154] Wendorff, R.: Rechnergesteuertes Pufferlager für typgebundene Fertigung. f+h 30 (8980) 4, S. 345/348 Lager, Lagertechnik und -<br />
organisation<br />
1980 [155] Mucks, R.: Programmsystem zur Steuerung von Hochregallagern. ZwF 75 (1980) 10, S. 499/501 Lager, Lagertechnik und -<br />
organisation<br />
1980 [156] Covo, J. und Kottler, L.: Elektroniklager - ein vollautomatisch arbeitendes Lager- und I0 49 (1980) 7/8, S. 384/388 Lager, Lagertechnik und -<br />
Warenverteilsystem.<br />
organisation<br />
1980 [157] Budde, R.: Ein Schuhgroßvertrieb rationalisiert. lO 49 (1980) 3, S. 128/130 Lager, Lagertechnik und -<br />
organisation<br />
1980 [158] Meissner, W.: Schüttgüter in Horizontalsilos oder Flachhallen lagern? MM 86 (1980) 2, S. 18/19 Lager, Lagertechnik und -<br />
organisation<br />
1980 [159] Lässig, A.: Platzsparendes Lagern leerer Fässer im Faßsilo. dhf 26 (1980) 10, S. 44 Lager, Lagertechnik und -<br />
organisation<br />
1980 [160] Podswyna, F.: Sicherheitstechnische Erfordernisse in der Lager- und dhf 26 (1980) 10, S. 15/21 Lager, Lagertechnik und -<br />
Fördertechnik.<br />
organisation<br />
1980 [161] NN.: In der Montage ist noch etwas drin. BT 20 (1980) 2, S. 32/35 Arbeitsplatzgestaltung<br />
1980 [162] Nolle, F. K.: Ergonomische Gesichtspunkte bei der Gestaltung von<br />
Bildschirmarbeitsplätzen.<br />
ZwF 75 (1980) 10, S. 489/490 Arbeitsplatzgestaltung<br />
1980 [163] Dittrich, H.: Arbeitsplätze und -abläufe besser gestalten. SchMM 80 (1980) 51, S. 29/31 Arbeitsplatzgestaltung,<br />
Arbeitsplatzanalyse und<br />
Arbeitsplatzgestaltung<br />
1980 [164] Haller, E.: So planen wie Arbeitsplätze mit dem Computer. I0 49 (1980) 7/8, S. 376/379 Arbeitsplatzgestaltung,<br />
Arbeitsplatzanalyse und<br />
Arbeitsplatzgestaltung<br />
1980 [165] Laurig, W.,<br />
Zur Entwicklung einer Systematik als Vorabssetzung einer ZfA (1980) 4, S. 232/237 Arbeitsplatzgestaltung,<br />
Sonnenschein, O., methodischen Arbeitsplatzgestaltung für körperlich<br />
Arbeitsplatzanalyse und<br />
Wettstein, A. und<br />
Wieland, K.:<br />
Behinderte.<br />
Arbeitsplatzgestaltung<br />
1980 Arbeitsplatzgestaltung,<br />
Arbeitsplatzanalyse und<br />
Arbeitsplatzgestaltung<br />
Seite 9 von 12
Jahr Lit.<br />
st.<br />
<strong>Literaturübersicht</strong> <strong>Fabrikplanung</strong> <strong>1980.</strong>xls<br />
Autoren Titel Zeitschrift Stichworte<br />
1980 [166] Bubb, H.: Ergonomische Bewertung von Umwelteinflüssen. ZfA 34 (1980) S. 26/30 Arbeitsplatzgestaltung,<br />
Arbeitsplatzanalyse und<br />
1980 [167] Doliwa, H.-U.: Bessere Arbeitsbedingungen in der Schwerindustrie nach<br />
konstruktiven Maßnahmen.<br />
Arbeitsplatzgestaltung<br />
MM 86 (1980) 3, S. 39/42 Arbeitsplatzgestaltung,<br />
Arbeitsplatzanalyse und<br />
Arbeitsplatzgestaltung<br />
1980 [168] Hagenkötter, M.: Sicherheit am Arbeitsplatz. wt 70 (1980) 1, S. 1/7 Arbeitsplatzgestaltung,<br />
Arbeitsplatzanalyse und<br />
1980 [169] NN: Sicherheitstechnische Empfehlungen für<br />
Salzbadhärteanlagen.<br />
1980 [170] Nicolaisen. P.: Probleme der Arbeitssicherheit beim Einsatz von<br />
Industrierobotern.<br />
Arbeitsplatzgestaltung<br />
ZwF 75 (1980) 3, S. 134/143 Arbeitsplatzgestaltung,<br />
Arbeitsplatzanalyse und<br />
Arbeitsplatzgestaltung<br />
wt 70 (1980) 1, S. 15/19 Arbeitsplatzgestaltung,<br />
Arbeitsplatzanalyse und<br />
Arbeitsplatzgestaltung<br />
MM 86 (1980) 19, S. 351/353 Arbeitsplatzgestaltung, Beleuchtung<br />
1980 [171] Eberbach, K.: Grundlegende Bedingungen fur optimales Sehen an<br />
Industriearbeitsplätzen.<br />
1980 [172] Range, H. D.: Die künstliche Beleuchtung von Arbeitsstätten. DBZ (1980) 3, S. 421/424 Arbeitsplatzgestaltung, Beleuchtung<br />
1980 [173] Eberbach, K.: Angepaßte Beleuchtungsarten vereinfachen Sehaufgaben an<br />
industriellen Arbeitsplatzen.<br />
MM 86 (1980) 57, S. 1117/1120 Arbeitsplatzgestaltung, Beleuchtung<br />
1980 [174] Frieling, H.: Farbliches Gestalten von Industriearbeitsplätzen wirkt<br />
leistungssteigernd.<br />
MM 86 (1980) 38, S. 748/750 Arbeitsplatzgestaltung, Beleuchtung<br />
1980 [175] Weis, B.: Industrielle Notbeleuchtungen sind auch ein Beitrag zur<br />
Sicherheit am Arbeitsplatz.<br />
MM 86 (1980) 102, S. 2017/2019 Arbeitsplatzgestaltung, Beleuchtung<br />
1980 [176] Daniels, K. und Modellhafte Entscheidungshilfen im licht- und lufttechnischen BW 71 (1980) 27, S. 1185/1188 Arbeitsplatzgestaltung, Beleuchtung<br />
Bartenbach, L.: Bereich.<br />
1980 [177] Haack, G.: Vorausbestimmung von Lärmsituationen in Arbeitsstätten. FB 30 (1980) 9, S. 555/557 Arbeitsplatzgestaltung, Lärm<br />
1980 [178] Schulz, G.: Die vielfältigen Belastungen der Industrie durch technische<br />
Lärmminderung und Wege zur Abhilfe.<br />
S+E 100 (1980) 11, S. 581/587 Arbeitsplatzgestaltung, Lärm<br />
1980 [179] Schmidt, H.: Schallpegelminderung am Arbeitsplatz. wb 113 (1980) 10, S. 695/699 Arbeitsplatzgestaltung, Lärm<br />
1980 [180] Schmidt, H.: Schallschutz mit Absorbern und Stellwänden. wt 70 (1980) 7, S. 465/468 Arbeitsplatzgestaltung, Lärm<br />
1980 [181] Haering, H.-U., Polthier, Lärmminderung in Elektrostahlwerken und Hinweise für die S+E 100 (1980) 2, S. 53/58 Arbeitsplatzgestaltung, Lärm<br />
K. und Schmitz, J.: Projektplanung.<br />
1980 [182] Teodorescu, P.: Anwendung des Programms Schall" zur Berechnung von<br />
Lärmprognosen und zur Optimierung von<br />
Schallschutzmaßnahmen bei Kraftwerken."<br />
ZfL 27 (1980) 2, S. 68/72 Arbeitsplatzgestaltung, Lärm<br />
Seite 10 von 12
Jahr Lit.<br />
st.<br />
<strong>Literaturübersicht</strong> <strong>Fabrikplanung</strong> <strong>1980.</strong>xls<br />
Autoren Titel Zeitschrift Stichworte<br />
1980 [183] Weber, E.: Grundlagen zur Abscheidung von Stäuben. TUM (1980) 1, S. 46/48 Arbeitsplatzgestaltung,<br />
Luftreinhaltung<br />
1980 [184] Grupinski, L.: Gegen Schadstoffe am Arbeitsplatz. TUM (1980) 3, S. 34/35 Arbeitsplatzgestaltung,<br />
Luftreinhaltung<br />
1980 [185] NN: Ohne Zuluft keine Abluft und keine Luftreinigung. P (1980) 7, S. 11/12 Arbeitsplatzgestaltung,<br />
Luftreinhaltung<br />
1980 [186] Schmieder, W.: Lüftung hoher Industrieräume nach dem Düsenstrahlprinzip. TAB 11 (1980) 4, S. 333/334 Arbeitsplatzgestaltung,<br />
Luftreinhaltung<br />
1980 [187] Rüskamp, B.: Punktabsaugung staubhaltiger Luft beim Schleifen in G 67 (1980) 13, S. 414/418 Arbeitsplatzgestaltung,<br />
Großputzereien.<br />
Luftreinhaltung<br />
1980 [188] Schütz, A. und Wolf, D.: Gase und Dämpfe an Gießerelarbeitsplätzen - Messung, G 67 (1980) 3, S. 68/73 Arbeitsplatzgestaltung,<br />
Beurteilung, Schutzmaßnahmen.<br />
Luftreinhaltung<br />
1980 [189] Marchand, D. und Umweltschutz in Elektrostahlwerken. S+E 100 (1980) 11, S. 569/ 574 Arbeitsplatzgestaltung,<br />
Polthier, K.:<br />
Luftreinhaltung<br />
1980 [190] Barten, A.: Luftreinigungssysteme als integraler Bestandteil moderner M 34 (1980) 4, S. 369/371 Arbeitsplatzgestaltung,<br />
Walzwerke.<br />
Luftreinhaltung<br />
1980 [191] Leimer, H. J.: Energiemanagement im Betrieb. IO 49 (1980) 9, S. 430/433 Energieversorgung und<br />
Brandschutz, Energieversorgung<br />
1980 [192] Ritter, C. F.: Ein optimales Energiekonzept. BT 20 (1980) 7, S. 11/14 Energieversorgung und<br />
Brandschutz, Energieversorgung<br />
1980 [193] Ebersbach, K. F.: Schwerpunkte der Energieeinsparung in der Industrie. R 31 (1980) 7/8, S. 168/ 171 Energieversorgung und<br />
Brandschutz, Energieversorgung<br />
1980 [194] Müller, H.: Energieeinsparung in Verwaltungs- und Industriegebäuden. TAB 11 (1980) 8, S. 671/674 Energieversorgung und<br />
Brandschutz, Energieversorgung<br />
1980 [195] Reuter, F.: Luft- und Lichttechnik-energiesparende Konzepte für Industrie- Zfl 26 (1980) 4, S. 237/243 Energieversorgung und<br />
und Verwaltungsbauten.<br />
Brandschutz, Energieversorgung<br />
1980 [196] Gottschalk, O.: Energiebewußte Verwaltungsbauplanung. BW 71 (1980) 27, S. 1170/1173 Energieversorgung und<br />
Brandschutz, Energieversorgung<br />
1980 [197] Vogel, W.: Industrielle Raumheizung mit Infrarotstrahlern. MM 86 (1980) 93, S. 1846/1847 Energieversorgung und<br />
Brandschutz, Energieversorgung<br />
1980 [198] NN: Große Hallen günstig heizen. BT 20 (1980) 1, S. 20/23 Energieversorgung und<br />
Brandschutz, Energieversorgung<br />
1980 [199] Vogel, W.: Gas-lnfrarot-Strahler: Zielgenaue Hallenheizung. MF (1980) 5, S. 38/41 Energieversorgung und<br />
Brandschutz, Energieversorgung<br />
1980 [200] Vogel, W.: Energiekosten halbieren durch zielgenaue Heizsysteme. P (1980) 3, S. 18 Energieversorgung und<br />
Brandschutz, Energieversorgung<br />
Seite 11 von 12
Jahr Lit.<br />
st.<br />
<strong>Literaturübersicht</strong> <strong>Fabrikplanung</strong> <strong>1980.</strong>xls<br />
Autoren Titel Zeitschrift Stichworte<br />
1980 [201] Eiteneyer, H.: Wärmepumpen zur Raumheizung durch industrielle<br />
R 31 (1980) 7/8, S. 176/178, Energieversorgung und<br />
Abwärmenutzung.<br />
199/200<br />
Brandschutz, Energieversorgung<br />
1980 [202] Eichler, L.: Energiedach und Energiefassade zur rationellen<br />
R 31 (1980) 7/8, S. 201/203 Energieversorgung und<br />
Wärmeerzeugung.<br />
Brandschutz, Energieversorgung<br />
1980 [203] Ernst, H.: Maßnahmen zur Verminderung der Dampferzeugungskosten. SH 45 (1980) 4, S. 302/ 304 Energieversorgung und<br />
Brandschutz, Energieversorgung<br />
1980 [204] Jäger, W.: Expedition durch den ParagraphenDschungel. BT 20 (1980) 9, S. 65/67 Energieversorgung und<br />
Brandschutz, Brandschutz<br />
1980 [205] Pohl,R.: Brandsicherheit von Gebäuden. DB(1980) 1, S. 48/55 Energieversorgung und<br />
Brandschutz, Brandschutz<br />
1980 [206] Feurich, H.: Bauliche Maßnahmen und Löscheinrichtungen für den SH 45 (1980) 4, S. 311/314 Energieversorgung und<br />
Brandschutz.<br />
Brandschutz, Brandschutz<br />
1980 [207] Hildebrand, C., Rüde, J., Beurteilung des Brandverhaltens von Dachdeckungen. BB 34 (1980) 2, S. 73/76 Energieversorgung und<br />
Pogovzelski, J. A. und<br />
Sawelski, A.:<br />
Brandschutz, Brandschutz<br />
1980 [208] NN: Brandgefahr - ein besonderes Lagerrisiko. P (1980) 40, S. 3/4 Energieversorgung und<br />
Brandschutz, Brandschutz<br />
1980 [209] Maurer, A.: Wenn alles brennt - das Lager steht. MF (1980) 7/8, S. 48/53 Energieversorgung und<br />
Brandschutz, Brandschutz<br />
1980 [210] NN: Zentrales Ersatzteillager der Ford Werke AG in Köln- Zfl 26 (1980) 1, S. 14/19 Energieversorgung und<br />
Merkenich.<br />
Brandschutz, Brandschutz<br />
1980 [211] Mutze, W.: Alarmanlagen. TAB 11 (1980) 6, S. 521/522 Energieversorgung und<br />
Brandschutz, Brandschutz<br />
1980 [212] Bredow, L.: Sprinkleranlagen verhindern Feuer. Zfl 26 (1980) 6, S. 376/380 Energieversorgung und<br />
Brandschutz, Brandschutz<br />
1980 [213] Schmolz, R.: Investitionsplanung. wb 113 (1980) 1, S. 53/56 Kosten<br />
1980 [214] Thurner,G.: Unsicherheiten in der Kostenvorkalkulation von<br />
Bauleistungen.<br />
DBZ (1980) 7, S. 1103/ 1107 Kosten<br />
1980 [215] Ruf, H.-U.: Baukostenplanung - Anwendung der<br />
Gebäudeelementgliederung.<br />
DBZ (1980) 2, S. 233/ 241 Kosten<br />
1980 [216] Schnau, J.: Möglichkeiten der Erarbeitung und Anwendung von<br />
Richtwerten, Kennzahlen und Normativen bei der Ermittlung<br />
der Kosten für Ausrüstungen im Chemieanlagenbau.<br />
WZ THM 24 (1980) 2, S. 47/49 Kosten<br />
1980 [217] NN: Betriebs- und Unterhaltungskosten von Großhandelslagern. f+h 30 (1980) 7, S. 599/601 Kosten<br />
Seite 12 von 12