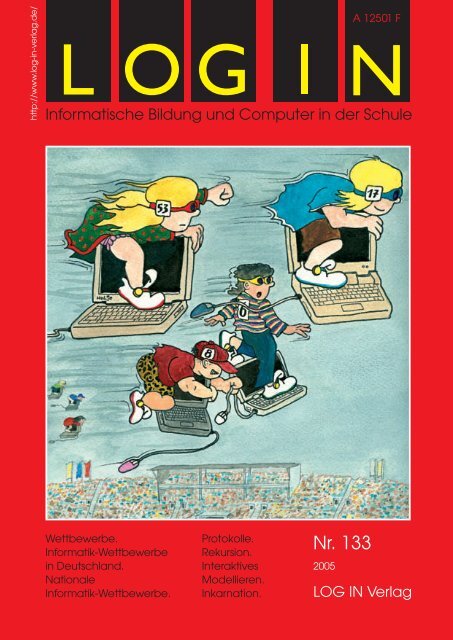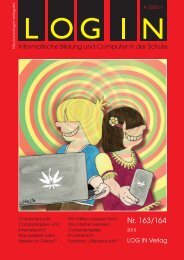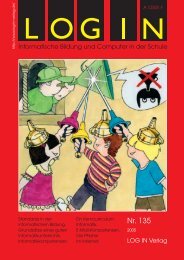Nr. 133
Nr. 133
Nr. 133
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
http://www.log-in-verlag.de/<br />
Informatische Bildung und Computer in der Schule<br />
Wettbewerbe.<br />
Informatik-Wettbewerbe<br />
in Deutschland.<br />
Nationale<br />
Informatik-Wettbewerbe.<br />
Protokolle.<br />
Rekursion.<br />
Interaktives<br />
Modellieren.<br />
Inkarnation.<br />
<strong>Nr</strong>. <strong>133</strong><br />
2005<br />
A 12501 F<br />
LOG IN Verlag
Suchen<br />
oder<br />
vermissen Sie<br />
ein Themenheft<br />
von LOG IN?<br />
j Heft 6’99 (nur geringer Restbestand)<br />
Moderne Medienwelten – u. a.: Lernen<br />
mit neuen Medien. Vom Megaprint<br />
zum Kilobild.<br />
u … Expl. Heft 5’99:<br />
Recht und Informatik – u. a.: Datenschutz<br />
und Sicherheit im Internet.<br />
Computerkriminalität.<br />
u … Expl. Heft 3/4’99:<br />
Telearbeit und Telekooperation –<br />
u. a.: Wie wir morgen arbeiten. Multimedia<br />
und Telearbeit.<br />
u … Expl. Heft 2’99:<br />
Informatik und Philosophie – u. a.:<br />
Virtuelle Faszination. Können Computer<br />
denken? Digitale Unterschrift.<br />
j Heft 1’99 (nur geringer Restbestand)<br />
Intranet – Aufbau und Nutzen in der<br />
Schule – u. a.: Schulalltag im Intranet.<br />
Offline in die Online-Welt.<br />
u … Expl. Heft 6’98:<br />
Virtuelle Realität – u. a.: Spracherwerb<br />
in virtueller Umgebung. Lernen<br />
im Cyberspace. VRML.<br />
u … Expl. Heft 5’98:<br />
Automatisierung – u. a.: Mobile Rechner<br />
in Industrie, Wirtschaft und Unterricht.<br />
u … Expl. Heft 3/4’98:<br />
Suchen und Finden im Internet – u. a.:<br />
Suchwerkzeuge. Informationen im<br />
Web erschließen.<br />
u … Expl. Heft 2’98:<br />
Informatik und Mathematik – u. a.:<br />
Projekte im Mathematikunterricht.<br />
Funktionales Programmieren.<br />
u … Expl. Heft 1’98:<br />
Multimediale Autorensysteme – u. a.:<br />
Lehrer lernen mit und von ihren Schülern.<br />
Binnendifferenzierung.<br />
u … Expl. Heft 6’97:<br />
Informatische Bildung und Internet –<br />
u. a.: Internet und Informatik. Lernen<br />
mit Netzen. JAVA jetzt.<br />
u … Expl. Heft 5’97:<br />
Programmieren weltweit – u. a.: JAVA<br />
im Internet und im Informatikunterricht.<br />
HTML im Unterricht.<br />
u … Expl. Heft 3/4’97:<br />
Programmiersysteme – u. a.: Programmierumgebungen.<br />
Datenbanken im<br />
World Wide Web.<br />
u … Expl. Heft 2’97:<br />
Lokale Netze in Schulen – u. a.: Netzwerk-Strukturierung.<br />
Internet im<br />
LAN. Vom LAN zum WAN.<br />
j Heft 1’97 (nur geringer Restbestand)<br />
Multimedia in der Schule<br />
j Heft 5/6’96 (nur geringer Restbestand)<br />
Kryptographie und Sicherheit<br />
in Netzen<br />
j Heft 4’96 (nur geringer Restbestand)<br />
PCs und weltweite Netze als Arbeitshilfe<br />
für Lehrkräfte<br />
j Heft 3’96 (vergriffen)<br />
j Heft 2’96 (nur geringer Restbestand)<br />
Computereinsatz in der Medizin<br />
j Heft 1’96 (nur geringer Restbestand)<br />
Lehrerbildung – u. a.: Fachdidaktik.<br />
Informatische Bildung für Nicht-Informatiklehrer.<br />
u … Expl. Heft 5/6’95:<br />
Fuzzy-Logik – u. a.: Von der klassischen<br />
Logik zur Fuzzy-Logik. Etwas<br />
Fuzzy-Logik gefällig?<br />
j Heft 4’95 (nur geringer Restbestand)<br />
Computer, Kreativität und<br />
Ästhetik – u. a.: Computerlyrik.<br />
Algorithmisches Komponieren.<br />
u … Expl. Heft 3’95:<br />
Computereinsatz bei Behinderten –<br />
u. a.: Computer als technische Hilfe.<br />
Sprechende Computer.<br />
u … Expl. Heft 2’95:<br />
Bildbearbeitung – u. a.: Grafische Datenverarbeitung.<br />
Grundlagen der 3-D-<br />
Der LOG IN Verlag bietet Ihnen die Möglichkeit,<br />
aus Restbeständen einzelne LOG IN-<br />
Hefte von 1993 bis 1999 verbilligt zu erstehen.<br />
Wählen Sie unter den noch lieferbaren Titeln.<br />
x Einzelheft: 3,75 Euro<br />
x Doppelheft: 7,50 Euro<br />
(zusätzlich Versandkosten – bei Bestellungen<br />
ab 40,- Euro versandkostenfrei)<br />
Senden Sie Ihre Bestellung entweder an die<br />
Fax-Nummer der Redaktion:<br />
x (030) 83 85 67 22<br />
oder per Post an den Verlag:<br />
x LOG IN Verlag GmbH<br />
Postfach 33 07 09<br />
14177 Berlin<br />
Computergrafik. Grafiksysteme und<br />
Grafikformate<br />
u … Expl. Heft 1’95:<br />
Anfangsunterricht – u. a.: Probleme<br />
des Anfangsunterrichts. Die Kurszeitung.<br />
Komplexe Systeme.<br />
j Heft 5/6’94 (nur geringer Restbestand)<br />
Datenfernübertragung und informatische<br />
Bildung<br />
u … Expl. Heft 4’94:<br />
Algorithmen und Datenstrukturen<br />
für den Unterricht – u. a.:<br />
Praktisch unlösbare Probleme. Graphen<br />
und Algorithmen.<br />
u … Expl. Heft 3’94:<br />
EDV in der Landwirtschaft – u. a.:<br />
EDV an landwirtsch. berufsbildenden<br />
Schulen. Biobauern am Computer.<br />
u … Expl. Heft 2’94:<br />
Datenbanken in der Schule – u. a.: Objektorientierte<br />
Datenbanksysteme.<br />
Datenbanken – (k)ein Thema?<br />
u … Expl. Heft 1’94:<br />
Planung und Durchführung von Unterricht<br />
(Teil II) – u. a.: Der Weg vom<br />
Konkreten zum Abstrakten. Von der<br />
ITG zum Informatikunterricht. Was<br />
passiert mit meinen Daten?<br />
j Heft 6’93 (vergriffen)<br />
u … Expl. Heft 5’93:<br />
Parallelverarbeitung – u. a.: Parallele<br />
Algorithmen – Ein Überblick. Architekturen<br />
für Parallelrechner. Das Philosophenproblem.<br />
j Heft 4’93 (vergriffen)<br />
u … Expl. Heft 3’93:<br />
Datenfernübertragung in Schulen –<br />
u. a.: Computervermittelte Kommunikation.<br />
Internationale Schulprojekte.<br />
Prädikative Denk- und Programmiermethoden.<br />
j Heft 1/2’93 (nur geringer Restbestand)<br />
Multimedia im Unterricht<br />
Absender:<br />
Name, Vorname: ________________________________ Datum: ____________________<br />
Straße: ________________________________<br />
PLZ und Ort: ________________________________ Unterschrift: ____________________
Impressum 2<br />
Editorial 3<br />
Berichte 4<br />
THEMA<br />
Informatik-Wettbewerbe in Deutschland –<br />
Eine Übersicht<br />
von Wolfgang Pohl 10<br />
Nationale Informatik-Wettbewerbe im Ausland<br />
von Wolfgang Pohl<br />
und der LOG-IN-Redaktion 24<br />
Multimedia als Herausforderung<br />
von Bernhard Koerber 30<br />
PRAXIS & METHODIK<br />
Protokolle – Ein forschender Zugang<br />
zur Entwicklung von Erklärungsmodellen<br />
für die Kommunikation in Rechnernetzen (Teil 1)<br />
von Daniel Jonietz 33<br />
Rekursion – Ein Thema für den Informatikunterricht<br />
von Michael Fothe 46<br />
Interaktives Modellieren im virtuellen Raum<br />
von Heinz Schumann 55<br />
Werkstatt:<br />
Komponentenbasierte Entwicklung<br />
dynamischer HTML-Seiten – Ein Schwarzes Brett<br />
als Gästebuch im World Wide Web (Teil 1)<br />
von Alfred Hermes 62<br />
LOG IN Heft <strong>Nr</strong>. <strong>133</strong> (2005)<br />
I N H A L T<br />
ZUM THEMA<br />
Wettbewerbe<br />
Wird der Begriff ,,Wettbewerb“ heutzutage benutzt,<br />
so steht er im Allgemeinen in ökonomischen Zusammenhängen.<br />
Wird dazu auch noch der Begriff ,,Globalisierung“<br />
genannt, dann gewinnt das Wort ,,Wettbewerb“<br />
mehr und mehr eine bedrohliche, eine negative<br />
Bedeutung. Doch Wettbewerb hat nicht nur mit Ökonomie<br />
zu tun – es gibt auch Wettbewerbe im Sinne von<br />
sportlichem Wettkampf. Diese Wettkämpfe unterliegen<br />
fairen Regeln, die niemanden bevorzugen oder benachteiligen.<br />
Es geht dann nur darum, die Fähigkeiten der<br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem solchen<br />
Wettkampf untereinander zu vergleichen und – wie bei<br />
olympischen Spielen – diejenigen, die die gestellte Aufgabe<br />
am besten gelöst haben, entsprechend zu würdigen.<br />
Aus dieser sportlichen Idee haben sich auch Wettbewerbe<br />
entwickelt, die sich auf informatische Kompetenzen<br />
gründen. Sie werden in diesem Heft vorgestellt.<br />
Das Titelbild zum Thema wurde von Jens-Helge Dahmen, Berlin, für LOG IN gestaltet.<br />
COLLEG<br />
Unterricht mit StarOffice 7 –<br />
Teil 3.1: Die Schuldenfalle<br />
von Ingo-Rüdiger Peters 67<br />
COMPUTER & ANWENDUNGEN<br />
Aktuelles Lexikon: Inkarnation 71<br />
Geschichte: Vom Rechnen mit Stäbchen –<br />
John Napier und seine Rechenstäbchen 73<br />
FORUM<br />
Rezension:<br />
Wagenknecht, Chr.: Algorithmen und Komplexität 76<br />
Hinweise auf Bücher 77<br />
Hinweise auf Zeitschriften 77<br />
Medien 78<br />
Info-Markt:<br />
LOG-IN-Newsletter 78<br />
Am Rande bemerkt …:<br />
Moore’sches Gesetz und kein Ende 79<br />
Veranstaltungskalender 80<br />
Vorschau 80<br />
LOG OUT 80<br />
1
Herausgeber<br />
Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie<br />
der Freien Universität Berlin,<br />
zusammen mit<br />
der Gesellschaft für Informatik (GI) e. V., Bonn,<br />
dem FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht<br />
gemeinnützige GmbH, München,<br />
dem Arbeitsbereich Prozesstechnik und berufliche Bildung der<br />
Technischen Universität Hamburg-Harburg,<br />
dem Fachbereich Informatik der Universität Dortmund,<br />
dem Fachbereich Informatik und Elektrotechnik der Universität<br />
Siegen,<br />
der Fakultät Informatik der Technischen Universität Dresden,<br />
dem Institut für Informatik der Universität Stuttgart,<br />
dem Institut für Informatik der Universität Zürich und<br />
dem Institut für Statistik, Operations-Research und Computerverfahren<br />
der Universität Wien.<br />
LOG IN wurde 1981 als Fachzeitschrift aus den Informationsschriften ,,INFO – ein Informationsblatt<br />
zur Integration der Informatik in Berliner Schulen“ (1975–1979) des<br />
Instituts für Datenverarbeitung in den Unterrichtswissenschaften, Berlin, und ,,log in –<br />
Mitteilungen zur Informatik in der Schule“ (1979–1980) des Instituts für die Pädagogik<br />
der Naturwissenschaften, Kiel, begründet.<br />
Redaktionsleitung<br />
Bernhard Koerber (verantwortlich).<br />
Freie Universität Berlin, FB Erziehungswissenschaft u. Psychologie<br />
GEDIB – Redaktion LOG IN<br />
Habelschwerdter Allee 45, D-14195 Berlin<br />
Telefon: (030) 83 85 63 39 – Telefax: (030) 83 85 67 22<br />
E-Mail: redaktion@log-in-verlag.de<br />
URL: http://www.log-in-verlag.de/wwwredlogin/index.html<br />
Bitte senden Sie Manuskripte für Beiträge, Anfragen zum LOG-IN-Service und sonstige<br />
Korrespondenz an die Redaktionsleitung.<br />
Redaktion<br />
Rüdeger Baumann, Celle; Jens-Helge Dahmen, Berlin (Grafik);<br />
Heinz Faatz, Berlin (Layout); Roland Günther, Oberthulba; Hannes<br />
Gutzer, Halle/Saale; Gabriele Kohse, Berlin (Redaktionssekretariat);<br />
Jürgen Müller, Gera; Ernst Payerl, Erlensee; Ingo-Rüdiger<br />
Peters, Berlin (stellv. Redaktionsleitung); Achim Sahr, Berlin; Herbert<br />
Voss, Berlin.<br />
Ständige Mitarbeit<br />
Werner Arnhold, Berlin (Colleg); Norbert Baumgarten, Berlin<br />
(DV & Schulorganisation); Günther Cyranek, Zürich (Berichte:<br />
Schweiz); Jens Fleischhut, Berlin (DV in Beruf & Alltag); Annemarie<br />
Hauf-Tulodziecki, Soest (Praxis & Methodik: Informatische Bildung<br />
in der Sekundarstufe I); Hanns-Wilhelm Heibey, Berlin (Datenschutz);<br />
Alfred Hermes, Jülich (Praxis & Methodik: Werkstatt);<br />
Ingmar Lehmann, Berlin (Praxis & Methodik: Informatik im Mathematikunterricht);<br />
Sigrid Schubert, Siegen (Fachliche Grundlagen<br />
des Informatikunterrichts); Andreas Schwill, Potsdam (Aktuelles<br />
Lexikon); Mario Spengler, Hermeskeil (Praxis & Methodik:<br />
Informatikunterricht in der Sekundarstufe II); Martin Viering,<br />
München (Medien); Joachim Wedekind, Tübingen (Praxis & Methodik:<br />
Informatik in naturwissenschaftlichen Fächern); Helmut<br />
Witten, Berlin (Grundbildung).<br />
Verantwortlich für die Mitteilungen des Fachausschusses ,,Informatische<br />
Bildung in Schulen“ (FA IBS) der Gesellschaft für Informatik<br />
(GI) e. V. ist der Sprecher des Fachausschusses, Norbert<br />
Breier (Hamburg).<br />
2<br />
I M P R E S S U M<br />
Wissenschaftlicher Beirat<br />
Wolfgang Arlt, Berlin; Peter Diepold, Göttingen; Steffen Friedrich,<br />
Dresden; Peter Gorny, Oldenburg; Rul Gunzenhäuser, Stuttgart;<br />
Uwe Haass, München; Immo O. Kerner, Nienhagen; Wolf Martin,<br />
Hamburg; Helmut Schauer, Zürich; Sigrid Schubert, Siegen; Peter<br />
Widmayer, Zürich.<br />
Mitarbeit an dieser Ausgabe<br />
Rainer Fabianski, Michael Fothe, Steffi Heinicke, Daniel Jonietz,<br />
Wolfgang Pohl, Dietrich Pohlmann, Heinz Schumann.<br />
Koordination des Themenschwerpunkts in diesem Heft:<br />
Wolfgang Pohl.<br />
Bezugsbedingungen<br />
LOG IN erscheint fünfmal jährlich (4 Einzelhefte, 1 Doppelheft).<br />
Abonnementpreis (4 Einzelhefte zu je 72 Seiten, 1 Doppelheft): Inland<br />
54,00 EUR, Ausland 60,00 EUR, jeweils inkl. Versandspesen.<br />
Ausbildungsabonnement: 20 % Ermäßigung des Abonnementpreises<br />
(nach Vorlage einer Studien- oder Referendariatsbescheinigung).<br />
Einzelheft: 14,00 EUR, Doppelheft: 28,00 EUR, jeweils inkl. Versandspesen.<br />
Die Preise enthalten bei Lieferung in EU-Staaten die Mehrwertsteuer,<br />
für das übrige Ausland sind sie Nettopreise.<br />
Bestellungen nehmen der Verlag, die Redaktion oder jede Buchhandlung<br />
an. Die Kündigung von Abonnements ist mit einer Frist<br />
von 8 Wochen zum Ende jedes Kalenderjahres möglich.<br />
Mitglieder der Gesellschaft für Informatik, die als Lehrer an allgemein-<br />
oder berufsbildenden Schulen oder als Dozenten tätig sind,<br />
können die Zeitschrift im Rahmen ihrer Mitgliedschaft beziehen.<br />
Verlag<br />
LOG IN Verlag GmbH<br />
Postfach 33 07 09, D-14177 Berlin<br />
Friedrichshaller Straße 41, D-14199 Berlin<br />
Telefon: (030) 8 23 23 39 – Telefax: (030) 8 62 16 45<br />
E-Mail: verlagsmail@log-in-verlag.de<br />
URL: http://www.log-in-verlag.de/<br />
Verantwortlich für den Anzeigenteil: Ingo-Rüdiger Peters,<br />
Telefon: (030) 83 85 63 36 (Anschrift siehe Redaktionsleitung).<br />
Anzeigenverkauf: Hagen Döhner Media-Service,<br />
Telefon: (0511) 55 23 25 – Telefax: (0511) 55 12 34.<br />
Zurzeit gilt die Anzeigenpreisliste <strong>Nr</strong>. 22 vom 1. Januar 2005.<br />
© 1993 LOG IN Verlag GmbH<br />
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen<br />
sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich<br />
zugelassenen Fälle – insbesondere für Unterrichtszwecke – ist eine<br />
Verwertung ohne Einwilligung des Verlags strafbar.<br />
Satz/DTP: FU Berlin – FB ErzWiss./Psych. – GEDIB, Berlin.<br />
Belichtung: MediaBogen, Berlin.<br />
Druck: Druckhaus Berlin-Mitte GmbH, Berlin.<br />
Versand: DKS-Integra gemeinnützige GmbH, Berlin.<br />
LOG IN erscheint 2005 im 25. Jahrgang.<br />
ISSN: 0720-8642<br />
LOG IN Heft <strong>Nr</strong>. <strong>133</strong> (2005)
,,Wir leben in einem System,<br />
in dem man entweder Rad sein muß<br />
oder unter die Räder gerät.“<br />
Wettbewerb<br />
als Anreizsystem<br />
Friedrich Nietzsche (1844–1900)<br />
Deutschland – so muss mit Nietzsche<br />
festgestellt werden – kommt<br />
zurzeit mehr und mehr unter die Räder.<br />
Die Forderung der Gesellschaft<br />
für Informatik, dass Deutschland<br />
wieder erstklassig werden müsse<br />
(siehe LOG IN, Heft 131–132/2004,<br />
S. 9), ist bei genauer Betrachtung der<br />
Ergebnisse von TIMSS und PISA<br />
vollauf berechtigt. Zu lange sind die<br />
Probleme im deutschen Bildungssystem<br />
ausgesessen worden. Nun ist von<br />
,,Exzellenz“ die Rede, aber gemeint<br />
ist nicht eine Anrede im diplomatischen<br />
Verkehr, sondern eine Substantivierung<br />
der Eigenschaft exzellent<br />
im Sinne von hervorragend:<br />
,,Leistung und Exzellenz müssen den<br />
Vorrang haben!“ lautet eine zurzeit<br />
häufig wiederkehrende Forderung<br />
aus den Bildungsministerien.<br />
Dass ,,Exzellenz“ in den Schulen<br />
schon lange den Vorrang hat, zeigt<br />
die Fülle an Wettbewerben, an denen<br />
Schülerinnen und Schüler teilnehmen.<br />
Hier werden vielfach Leistungen<br />
gezeigt, die selbst Fachleute<br />
zum Staunen bringen. Zahlreiche<br />
mathematische, naturwissenschaftliche,<br />
sprachliche und bildnerische<br />
Wettbewerbe sowie Wettbewerbe<br />
zur Zeitgeschichte werden – zum Teil<br />
bereits seit vielen Jahren – jedes Jahr<br />
neu ausgeschrieben und ergänzen<br />
den Unterricht. Häufig gewinnt der<br />
Unterricht erst an Leben dadurch,<br />
dass sich eine Lehrkraft und die<br />
Schülerinnen und Schüler entschließen,<br />
an einem Wettbewerb teilzunehmen.<br />
Solch ein Wettbewerb stellt für<br />
alle Teilnehmenden stets eine Herausforderung<br />
dar. Eine Wettbewerbssituation<br />
ist auch immer zugleich<br />
eine Lernsituation. Einerseits<br />
LOG IN Heft <strong>Nr</strong>. <strong>133</strong> (2005)<br />
E D I T O R I A L<br />
gilt es, sich mit neuen, bislang mehr<br />
oder weniger unbekannten Inhalten<br />
auseinanderzusetzen oder sie intensiv<br />
zu vertiefen, andererseits ist von<br />
allen Beteiligten ein erhöhtes Maß<br />
an Eigenmotivation aufzubringen,<br />
um bis zum Ende durchzuhalten.<br />
Aber alle diejenigen, die das Wettbewerbsziel<br />
erreicht haben, gehen mit<br />
einem gestärkten Selbstbewusstsein<br />
hervor – ähnlich allen Marathonläuferinnen<br />
und -läufern, denen es vor<br />
allem wichtig ist, ins Ziel zu kommen,<br />
und nicht so wichtig, in welcher<br />
Zeit sie’s geschafft haben.<br />
In der Tat gehört das Leistungsmotiv<br />
zu den am besten erforschten<br />
sekundären Motiven menschlicher<br />
Persönlichkeitseigenschaften. Dieses<br />
Motiv wird als ein Bedürfnis definiert,<br />
sich mit einem Gütemaßstab<br />
auseinanderzusetzen, sodass die erbrachte<br />
Leistung – im Vergleich mit<br />
diesem Maßstab oder mit anderen<br />
Personen – bewertet werden kann.<br />
In einem Standardwerk, dem Handbuch<br />
der Psychologie, wird von<br />
Heinz Heckhausen das Leistungsmotiv<br />
als ein Bestreben aufgefasst,<br />
,,die eigene Tüchtigkeit zu steigern<br />
oder möglichst hochzuhalten“ (1965,<br />
S. 604). Doch die beliebten – sogar<br />
motivierend gemeinten – Aufgaben<br />
im Unterricht, die mit der Aufforderung<br />
verbunden werden, zu zeigen,<br />
wer sie denn am schnellsten und besten<br />
lösen könne, können ohne inhaltliche<br />
Reflexion durchaus zu nicht gewünschten<br />
Nebeneffekten führen.<br />
Nach traditioneller psychologischer<br />
Auffassung wird ein Motiv bei<br />
einem Menschen durch entsprechende<br />
Anreize in der Umwelt ,,angeregt“.<br />
So wird beispielsweise das<br />
Leistungsmotiv etwa dann angeregt,<br />
wenn die betreffende Person die<br />
Aussicht hat, sich – wie oben festgestellt<br />
– mit einem Gütemaßstab messen<br />
zu können. Wettbewerbe, an denen<br />
Schülerinnen und Schüler teilnehmen<br />
können, bieten mittlerweile<br />
auch aufgrund der damit verbundenen<br />
Auszeichnungen und Preise einen<br />
hohen Anreiz. Solche Schülerwettbewerbe<br />
stellen besondere Anforderungen,<br />
die im Allgemeinen<br />
über die zu vermittelnden Unterrichtsinhalte<br />
hinausreichen. Interessante<br />
Wettbewerbe fordern die Jugendlichen<br />
dazu heraus, problembezogen<br />
zu denken, eigenverantwortlich<br />
und in Gemeinschaft zu arbeiten<br />
sowie die eigenen Fähigkeiten zu erkennen,<br />
sie anzuwenden und zu erweitern.<br />
Damit dienen sie zugleich<br />
auch der Entdeckung und der Förderung<br />
besonderer Begabungen, der<br />
anfangs bereits erwähnten ,,Exzellenz“.<br />
Für solche exzellenten Leistungen<br />
wurde im Jahr 1980 der Bundeswettbewerb<br />
Informatik zum ersten Mal<br />
ausgeschrieben. Damals hatte er zunächst<br />
die Bezeichnung ,,Jugendwettbewerb<br />
über Computer-Programmierung“.<br />
Der internationale<br />
Informatik-Dachverband International<br />
Federation for Information<br />
Processing (IFIP) hatte ein Jahr zuvor<br />
alle nationalen Gesellschaften<br />
für Informatik aufgefordert, einen<br />
landesweiten Jugendwettbewerb in<br />
Computer-Programmierung auszuschreiben.<br />
Als Programmiersprachen<br />
waren ALGOL, APL, BASIC, COBOL,<br />
FORTRAN, PASCAL oder PL/1 zugelassen.<br />
Von 113 Teilnehmern gab es<br />
119 Einsendungen – ein Beitrag über<br />
das Zweikörperproblem der Astronomie<br />
erhielt den 1. Preis und wurde<br />
sogar 1981 auf der Weltkonferenz<br />
über Ausbildungsfragen in Informatik<br />
(WCCE) in Lausanne vorgestellt<br />
(vgl. LOG IN, Heft 2/1981, S. 4 f.).<br />
Welche Möglichkeiten sich heutzutage<br />
bieten, den Unterricht mit den<br />
Anreizen zu erweitern, die Wettbewerbe<br />
bieten, soll im vorliegenden<br />
Heft aufgezeigt werden.<br />
Bernhard Koerber<br />
Wolfgang Pohl<br />
3
Informatik<br />
in der DDR –<br />
eine Bilanz<br />
Genau zu diesem Thema fand<br />
vom 7. bis 9. Oktober 2004 ein Symposium<br />
an der Technischen Universität<br />
Chemnitz statt. Eingeladen<br />
hatten neben der TU Chemnitz die<br />
Fachhochschule Erfurt und die Gesellschaft<br />
für Informatik. Professor<br />
Friedrich Naumann (TU Chemnitz)<br />
und Frau Professor Gabriele Schade<br />
(FH Erfurt) organisierten das<br />
Symposium, mit dem die Geschichte<br />
der Informatik in der DDR<br />
durch zahlreiche Referenten aus<br />
unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet<br />
wurde. Schwerpunkte waren<br />
unter anderem Forschung, Entwicklung<br />
und Produktion von<br />
Hard- und Software, die Informatikausbildung<br />
an Hoch- und Fachschulen,<br />
die Rolle der Akademie<br />
der Wissenschaften der DDR sowie<br />
internationale Kooperationen und<br />
Beziehungen in Forschung und Wissenschaft<br />
im Rahmen des Rates für<br />
gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW;<br />
engl. COMECON).<br />
Sachsen als Ausgangspunkt<br />
Nicht ohne Grund hatten die<br />
Veranstalter nach Chemnitz eingeladen,<br />
denn diese Stadt war damals<br />
ein wichtiger Standort im Rechenmaschinenbau<br />
und der Computertechnik.<br />
Die serienmäßige Produktion<br />
von mechanischen Rechenmaschinen<br />
begann in Sachsen bereits<br />
am Ende des 19. Jahrhunderts.<br />
Glashütte machte den Anfang, es<br />
folgten Dresden, Chemnitz und<br />
Leipzig. Nach Ende des Zweiten<br />
Weltkriegs bestanden deshalb –<br />
trotz großer Schäden und reparationsbedingter<br />
Demontagen – relativ<br />
gute Voraussetzungen für die Wiederaufnahme<br />
der Produktion. Besonders<br />
die Chemnitzer Astra-Werke,<br />
später unter Ascota und Buchungsmaschinenwerke<br />
bzw. Robotron<br />
firmierend, machten wieder<br />
von sich reden und erlangten vor<br />
allem als Produzenten von Buchungsmaschinen<br />
internationale<br />
Wertschätzung.<br />
4<br />
Foto: I. O. Kerner<br />
B E R I C H T E<br />
Nachdem Nikolaus Joachim Lehmann<br />
(1921–1998) in Dresden<br />
schon um 1948 durch erste Arbeiten<br />
zur digitalen, elektronischen<br />
Rechentechnik und dann mit den<br />
Modellen D1 (fertiggestellt 1956),<br />
D2 (fertiggestellt 1959) auf sich<br />
aufmerksam gemacht hatte, legte<br />
1957 der VEB ELREMA Karl-<br />
Marx-Stadt (heute wieder Chemnitz)<br />
die Basis für eine leistungsfähigere<br />
Rechen- bzw. Computertechnik.<br />
Dies geschah mit den Maschinen<br />
R12, R100 (ein programmgesteuerter<br />
Lochkartenrechner)<br />
und schließlich 1967 durch den<br />
R300. Letzterer entsprach in den<br />
Leistungsparametern etwa der IBM<br />
1401 und brach für diese Klasse das<br />
vom Westen verhängte Embargo.<br />
Gebaut und ausschließlich in der<br />
DDR eingesetzt wurden 350 Exemplare.<br />
Letztlich sollte die Einbindung<br />
in das ESER (Einheitliches<br />
System Elektronischer Rechentechnik<br />
des RGW) von 1970 und die<br />
Eingliederung in das Kombinat Robotron<br />
(gegründet um 1965), jenen<br />
entscheidenden Schub erbringen,<br />
der aus volkswirtschaftlicher Sicht<br />
dringend geboten war.<br />
Nachdem 1963 in Dresden durch<br />
N. J. Lehmann mit dem D4a Voraussetzungen<br />
für die industrielle Produktion<br />
von Kleinrechnern geschaffen<br />
worden waren, wurde dieser als<br />
C8205 ab 1969 in Zella-Mehlis mit<br />
ca. 3000 Stück gefertigt.<br />
Professor Friedrich Naumann,<br />
Inhaber des Lehrstuhls für Wissenschafts-,<br />
Technik- und Hochschulgeschichte<br />
der TU Chemnitz, hielt<br />
das Eröffnungsreferat.<br />
Thüringen zog nach<br />
Etwa parallel zu dieser ,,sächsischen“<br />
Linie gab es die ,,thüringische“<br />
in Jena beim VEB Carl Zeiss.<br />
Im Jahre 1954 kamen Wilhelm<br />
Kämmerer, Herbert Kortum und<br />
Fritz Straube nach neunjähriger Arbeitsverpflichtung<br />
aus der Sowjetunion<br />
nach Jena zurück. Sofort wurde<br />
unter ihrer Leitung bis 1955 die<br />
OPREMA (Optikrechenmaschine)<br />
und bis 1960 der ZRA 1 (Zeiss Rechen-Automat)<br />
entwickelt. Von<br />
letzterem wurden 31 Stück gefertigt<br />
und bis zur Ablösung durch den<br />
R300 (ab 1966 bis zum Beginn der<br />
ESER-Periode 1970) in Industrie<br />
und Hochschulen eingesetzt.<br />
Einblick in die Zeitgeschichte<br />
Während des Symposiums wurden<br />
insgesamt 27 Vorträge gehalten.<br />
Etwa 120 Personen nahmen<br />
teil. Darunter gab es immerhin<br />
zehn Interessenten aus den alten<br />
Bundesländern. Naturgemäß waren<br />
viele der zum Thema berichtenden<br />
Personen als Zeit- und Sachzeugen<br />
infolge des zeitlichen Abstandes<br />
nunmehr bereits in fortgeschrittenem<br />
Alter, wodurch die Qualität<br />
mancher Beiträge leider gelitten<br />
hat. Aber die mitgeteilten Tatsachen<br />
drohten (und drohen noch) in<br />
ein Loch des Vergessens zu fallen.<br />
Das war allen Teilnehmern sehr bewusst.<br />
Deshalb ist allen Vortragenden<br />
ohne Ausnahme besonders dafür<br />
zu danken, dass sie sich verfügbar<br />
hielten. Niemand kann wissen,<br />
wie weit die momentanen Darstellungen<br />
im Laufe der Zeit das Bild<br />
verzerrt hätten, das sich die Nachwelt<br />
von der Informatik in der<br />
DDR machen würde. Die Leichtgläubigkeit<br />
der Menschen kennt<br />
keine Grenzen, die seltsamsten Anspielungen,<br />
die ausgefallensten Gerüchte<br />
finden Anerkennung, wenn<br />
nicht jemand, der sein Handwerk<br />
versteht, sie widerlegt und das Beweismaterial<br />
überprüft, bevor es<br />
verschwindet. Somit war das Symposium<br />
für die Geschichtsschreibung<br />
inhaltlich von großem Wert,<br />
seine Organisation und Durchführung<br />
verdienstvoll und der Mühe<br />
wert.<br />
In den Vorträgen selbst wurde einerseits<br />
des Öfteren von falschen<br />
LOG IN Heft <strong>Nr</strong>. <strong>133</strong> (2005)
http://waste.informatik.hu-berlin.de/robotron/studienarbeit/<br />
files/hardware/d1/d1_01.jpg<br />
und engstirnigen Eingriffen der damaligen<br />
Machtinhaber ,,aus Partei<br />
(SED) und Regierung“ berichtet,<br />
die den Rückstand der DDR-Computertechnik<br />
mit verursachten bzw.<br />
den Abbau desselben verzögerten<br />
oder behinderten. Der ideologische<br />
Anschluss an die Sowjetunion<br />
(,,Kybernetik und Computertechnik<br />
sind kapitalistische Fehlwege“) war<br />
oft die Ursache. Der spätere Beschluss<br />
zur forcierten Entwicklung<br />
der Datenverarbeitung konnte sich<br />
dann auch nur langsamer als gewünscht<br />
realisieren lassen – und<br />
tatsächlich wurde er in seiner vollen<br />
Zielstellung nicht realisiert.<br />
Eine größere Anzahl der Vorträge<br />
befasste sich damit, wie unter diesen<br />
Bedingungen von wirklichkeitsnah<br />
denkenden Wissenschaftlern und Ingenieuren<br />
doch Beachtliches geleistet<br />
wurde. Andererseits gab es aber<br />
auch Berichte über Computerbetriebe,<br />
die im Anschluss an derartige<br />
Leistungen auf einem guten Weg waren,<br />
nach der Wende schon begannen,<br />
sich zu festigen, mit ihren Hardund<br />
Softwareprodukten bereits auf<br />
dem Markt in Erscheinung traten<br />
und doch als Konkurrenten ,,abgewickelt“<br />
wurden oder in Insolvenz<br />
geraten mussten. Besonders Referenten<br />
zur zweiten Gruppe, die die<br />
Wendezeit in einem Alter erlebten,<br />
das noch etliche Jahre produktiver<br />
Berufsarbeit hätte erwarten lassen<br />
können, konnten ihre Enttäuschung<br />
bzw. ihren Zorn kaum verbergen.<br />
Nur wenige Vortragende konnten<br />
über gelungene Fortsetzungen ihrer<br />
Arbeiten im geeinten Deutschland<br />
berichten, meistens freilich unter einem<br />
anderen Dach. Zu dieser Gruppe<br />
gehörte der Bericht über das<br />
LOG IN Heft <strong>Nr</strong>. <strong>133</strong> (2005)<br />
B E R I C H T E<br />
Zentrum für grafische Datenverarbeitung,<br />
nach wie vor an der Universität<br />
Rostock (Fakultät für Elektrotechnik<br />
und Informatik) in Zusammenarbeit<br />
mit der Fraunhofer-Gesellschaft<br />
Zweigstelle Rostock.<br />
Einige der Vorträge sind im Heft<br />
1/2005 der FIfF-Kommunikation<br />
dokumentiert worden (siehe auch<br />
Seite 77 f. im vorliegenden LOG-<br />
IN-Heft).<br />
Ein erstes Fazit<br />
Der erste<br />
Elektronenrechner<br />
der<br />
DDR, die 1953<br />
entworfene<br />
und 1956 fertig<br />
gestellte D 1<br />
(Dresden 1),<br />
hatte einen<br />
Platzbedarf<br />
von 25 m 2 . und<br />
eine maximale<br />
Speicherkapazität<br />
von<br />
20 KByte.<br />
Man wird lernen müssen, dass<br />
keineswegs der verdienstvolle und<br />
verehrenswerte Professor N. J. Lehmann<br />
allein die Rechentechnik,<br />
Datenverarbeitung und schließlich<br />
die Informatik in der DDR begründete<br />
und entwickelte. Es gab außer<br />
ihm eine erfreulich größere Anzahl<br />
von Persönlichkeiten, die sich seinerzeit<br />
erfolgreich und mit durchaus<br />
guten Ideen dafür einsetzten<br />
(vgl. dazu die kleine Liste der einschlägigen<br />
Literatur).<br />
Es ist vorgesehen, eine Anschlusstagung<br />
im Frühjahr 2006 in Erfurt<br />
durchzuführen. Dann wird sicherlich<br />
auch das Thema der Vorbereitung<br />
des Informatikunterrichts an allgemeinbildenden<br />
Schulen (Erweiterte<br />
Oberschule EOS) der DDR behandelt<br />
werden, das diesmal in Chemnitz<br />
noch kaum bzw. überhaupt nicht<br />
anklang. Lehrkräfte und Lehrerbildner<br />
werden sich bestimmt an diese<br />
mehrjährige Phase in den 80er-Jahren<br />
recht kurz vor der Wende erinnern.<br />
Es existieren ganz bestimmt<br />
viele Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen<br />
und Schüler als Zeitzeugen<br />
und auch noch Lehr- und Studien-<br />
pläne, Unterrichtshilfen, Lehr- und<br />
Schulbücher u. Ä. aus den verschiedenen<br />
Etappen dieses Prozesses. Bitte<br />
nehmen Sie ggf. Kontakt auf zu<br />
den o. g. Veranstaltern des Symposiums<br />
in Chemnitz oder aber über<br />
LOG IN bzw. direkt zum Autor dieses<br />
Berichts (kerner@informatik<br />
.uni-rostock.de).<br />
Immo O. Kerner<br />
Literatur und Internetquellen<br />
Hellige, H. D. (Hrsg.): Geschichten der Informatik<br />
– Visionen, Paradigmen, Leitmotive.<br />
Berlin u. a.: Springer, 2004.<br />
Horn, Chr.; Kerner, I. O. (Hrsg.): Praktische<br />
Informatik. Reihe ,,Lehr- und Übungsbuch Informatik“,<br />
Band 3. München; Leipzig: Fachbuchverlag<br />
Leipzig im Carl Hanser Verlag,<br />
1997. Insbesondere: Kerner, I. O.: Kapitel 8 –<br />
Informatik und Gesellschaft.<br />
Horn, Chr.; Kerner, I. O.; Forbrig, P. (Hrsg.):<br />
Grundlagen und Überblick. Reihe,,Lehr- und<br />
Übungsbuch Informatik“, Band 1. München;<br />
Leipzig: Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser<br />
Verlag, 32003. Insbesondere: Kerner, I. O.:<br />
Kapitel 1 – Wissenschaftliche und historische<br />
Grundlagen; mit Ergänzungsseiten im Internet:<br />
http://www.inf.tu-dresden.de/~fachbuch/<br />
Naumann, F.: Vom Abakus zum Internet – Die<br />
Geschichte der Informatik. Darmstadt: Primus<br />
Verlag, 2001.<br />
Wilhelm-Schickard-<br />
Förderpreis für<br />
Informatik 2005<br />
Der Wilhelm-Schickard-Förderpreis<br />
für Informatik wird seit 2001<br />
alle zwei Jahre während des Kongresses<br />
des Fördervereins MNU<br />
verliehen. Der Preis wurde von der<br />
IBM Deutschland gestiftet und soll<br />
Lehrkräfte für ein verdienstvolles<br />
Engagement im Schulfach Informatik<br />
ehren.<br />
Auf dem diesjährigen 96. MNU-<br />
Kongress in Kiel wurde der Wilhelm-Schickard-Förderpreis<br />
zum<br />
dritten Male verliehen. Im Rahmen<br />
der feierlichen Eröffnung wurde er<br />
am 21. März 2005 Gerhard Röhner<br />
5
http://de.geocities.com/luo2000de/bilder/infolk/roehner1.jpg<br />
Der Preisträger Gerhard Röhner.<br />
für seinen langjährigen und unermüdlichen<br />
Einsatz um die Weiterentwicklung<br />
und Verbesserung des<br />
Informatikunterrichts überreicht.<br />
Gerhard Röhner, der Studiendirektor<br />
und den Leserinnen und Lesern<br />
von LOG IN kein Unbekannter<br />
ist – zuletzt schrieb er über<br />
Suchbaum-Modellierung im Heft<br />
131/132 –, dürfte auch vielen Informatiklehrkräften<br />
als Autor des Buches<br />
,,Informatik mit PROLOG“, das<br />
in vielen Bundesländern erfolgreich<br />
im Unterricht eingesetzt wird,<br />
bekannt sein. Abgestimmt darauf<br />
entwickelte er den SWI-PROLOG-<br />
Editor als schülergeeignete Entwicklungsumgebung.<br />
Ferner hat er<br />
an dem Buch ,,Datenbanken – Informatik<br />
für die Sekundarstufe II“<br />
mitgearbeitet.<br />
Beruflich hat Gerhard Röhner<br />
nach seinem Lehramtsstudium der<br />
Mathematik und Physik an der<br />
Technischen Hochschule Darmstadt<br />
zunächst an der Lichtenbergschule<br />
in Darmstadt unterrichtet.<br />
Durch Teilnahme an der Pilot-LehrerweiterbildungsmaßnahmeInformatik<br />
erwarb er die Fakultas für Informatik.<br />
Seitdem ist er Fachsprecher<br />
Informatik an der Schule und<br />
Referent für Fort- und Weiterbildung<br />
Informatik in Hessen. Anfang<br />
der 90er-Jahre leitete er zwei Weiterbildungsmaßnahmen<br />
zur Schul-<br />
Informatik in Zusammenarbeit mit<br />
der TH Darmstadt und nahm dort<br />
auch Lehraufträge zur Didaktik der<br />
Informatik wahr. Dabei entwickelte<br />
er mit Studenten Unterrichtssoftware<br />
mit dem Schwerpunkt Visuali-<br />
6<br />
B E R I C H T E<br />
sierung: SWING-PROLOG, ProVisor<br />
(Visualisierung von PROLOG),<br />
Visis – Visualisierung eines Intel-<br />
Systems, PaVi – PASCAL-Visualisierung,<br />
VVN – Visualisierung von<br />
Netzwerken und ELWIS – ein Warenwirtschaftssystem.<br />
Seit 1995 ist Gerhard Röhner<br />
Fachleiter für Informatik am Studienseminar<br />
für Gymnasien in<br />
Darmstadt. Er organisierte 2004 die<br />
3. bundesweite Fachleitertagung Informatik<br />
in Hessen. Daneben hat er<br />
außer vielen Fortbildungsveranstaltungen<br />
zur Informatik in Hessen<br />
auch einige in den benachbarten<br />
Bundesländern Thüringen und<br />
Rheinland-Pfalz durchgeführt.<br />
Darüber hinaus arbeitet Gerhard<br />
Röhner in den Lehrplankommissionen<br />
Informatik des Landes Hessen<br />
mit, in den letzten Jahren als federführendes<br />
Mitglied, und ebenfalls<br />
in der Fachkommission für das<br />
Landesabitur Informatik. Als Referent<br />
beim Amt für Lehrerbildung<br />
ist er auch für den Aufbau und die<br />
Pflege des Informatikangebots auf<br />
dem Hessischen Bildungsserver mit<br />
vielen unterrichtspraktischen Vorschlägen<br />
für einen zeitgemäßen Informatikunterricht<br />
verantwortlich.<br />
Dabei entwickelte er schulgeeignete<br />
Software weiter – insbesondere<br />
den JAVA-Editor, den SWI-PRO-<br />
LOG-Editor und das interaktive<br />
SQL-Tutorial für und von Schülern.<br />
Sehr viel Anerkennung brachte ihm<br />
auch die Entwicklung und Umsetzung<br />
einer landesweiten Initiative<br />
zur Entlastung der Systembetreuer<br />
an hessischen Schulen. Das hessische<br />
Kultusministerium entsandte<br />
ihn zudem in die KMK-Kommission<br />
zur Novellierung der EPA-Informatik.<br />
Gerhard Röhner hielt viele Vorträge<br />
auf Bundes- und Landesebene<br />
der MNU und arbeitete bei der<br />
Vorbereitung der MNU-Bundeskongresse<br />
in Darmstadt und Frankfurt<br />
aktiv mit. Darüber hinaus ist er<br />
seit langem auch Mitglied der Gesellschaft<br />
für Informatik und arbeitete<br />
im Fachausschuss ,,Informatische<br />
Bildung in Schulen“ an etlichen<br />
Empfehlungen mit. Auf den<br />
GI-Fachtagungen ,,Informatik und<br />
Schule“ hielt er bislang regelmäßig<br />
Vorträge und beteiligte sich auch<br />
an einer Reihe anderer Veröffentlichungen.<br />
Dietrich Pohlmann<br />
Es ist fast schon<br />
Tradition …<br />
… dass die GI Fachgruppe ,,Informatische<br />
Bildung in Sachsen“ im<br />
Anschluss an ihre Mitgliederversammlung<br />
alle aktiven sächsischen<br />
Informatiklehrkräfte im Herbst zur<br />
Jahrestagung einlädt – nun bereits<br />
zum neunten Mal. In die Reihe der<br />
Veranstaltungsorte trug sich für<br />
den 13. November 2004 die Technische<br />
Universität Bergakademie<br />
Freiberg ein.<br />
Informatikunterricht in Sachsen<br />
Vor allem, da der Informatikunterricht<br />
in Sachsen deutlich erweitert<br />
worden ist, besteht am Gedanken-<br />
und Erfahrungsaustausch mit<br />
Kolleginnen und Kollegen ein nennenswert<br />
gewachsenes Interesse.<br />
Bisher beschränkte sich die Informatik-Ausbildung<br />
an sächsischen Gymnasien<br />
auf ein (!) Pflichtjahr und<br />
eine Reihe fakultativer Veranstaltungen<br />
bzw. Wahlgrundkurse. Die<br />
neue Lehrplangeneration, die seit<br />
dem Schuljahr 2004/2005 – beginnend<br />
mit den Klassenstufen 5 bis 7 – eingeführt<br />
worden ist, sieht für die sächsischen<br />
Gymnasien Folgendes vor:<br />
x Klassen 5 und 6: Fach Technik<br />
und Computer (1 Wochenstunde)<br />
x Klassen 7 und 8: Fach Informatik<br />
(1 Wochenstunde)<br />
x Klassen 9 und 10: Vermittlung informatischer<br />
Inhalte innerhalb<br />
der Profilbereiche (1 Wochenstunde,<br />
aber nicht im sprachlichen<br />
Profil)<br />
x Klassen 11 und 12: Grundkurs Informatik<br />
mit Möglichkeit der<br />
mündlichen Abiturprüfung (2<br />
Wochenstunden).<br />
Vollständig neu ist die Anwendungsunabhängigkeit<br />
der Lehrpläne.<br />
So heißen die Lernbereiche in<br />
der 7. Klassenstufe beispielsweise<br />
,,Computer verstehen – Prinzipien<br />
und Strukturen“, ,,Computer benutzen<br />
– Elemente und Strategien“<br />
und ,,Computer verwenden – Komplexe<br />
Aufgabe“.<br />
An sächsischen Mittelschulen gibt<br />
es dagegen deutlich mehr Erfahrun-<br />
LOG IN Heft <strong>Nr</strong>. <strong>133</strong> (2005)
gen mit dem Informatikunterricht:<br />
Dort wird seit längerem nach einem<br />
Orientierungsrahmen durchgängig<br />
von Klasse 7 bis 10 Informatik unterrichtet.<br />
Doch auch für die Mittelschule<br />
gelten seit dem Schuljahr<br />
2004/2005 neue Lehrpläne mit neuen<br />
Herausforderungen:<br />
x Klassen 5 und 6: Fach Technik<br />
und Computer (1 Wochenstunde)<br />
x Klassen 7 bis 10: Fach Informatik<br />
(1 Wochenstunde).<br />
Auch hier gibt es neue Schwerpunktsetzungen<br />
und Inhalte. Nachzulesen<br />
sind alle Lehrpläne unter:<br />
http://www.sn.schule.de/~ci/1024/<br />
bg_lp_abs.html<br />
Neue Aufgaben der Fachgruppe<br />
Fortbildung ist notwendig<br />
Die Mitgliederversammlung der<br />
GI-Fachgruppe ,,Informatische Bildung<br />
in Sachsen – IBSn“ (http://<br />
www.sn.schule.de/~gi/) befasste sich<br />
deshalb vor allem mit den neuen<br />
Aufgaben, die alle sächsischen Lehrerinnen<br />
und Lehrer nunmehr zu bewältigen<br />
haben: Zwingend notwendig<br />
sind Fortbildungsveranstaltungen<br />
zu den Inhalten dieser neuen<br />
Lehrpläne und den damit verbundenen<br />
didaktischen Herausforderungen.<br />
Einige Teilbereiche der Arbeit<br />
mit Anwendersystemen wurden in<br />
andere Fächer ausgelagert (z. B. Mathematik<br />
und Deutsch); auch diese<br />
Kollegen benötigen Unterstützung.<br />
Deshalb bringen sich nunmehr Fachgruppenmitglieder<br />
verstärkt in die<br />
regionale Fortbildung ein; Absprachen<br />
mit verantwortlichen Regionalschulämtern<br />
wurden von Fachgruppenmitgliedern<br />
bereits getroffen.<br />
Vom PONK zum PITKo<br />
Sachsens Antwort auf den brandenburgischen<br />
PONK (vgl. LOG IN,<br />
Heft 3–4/2001, S. 34 ff.) heißt PITKo<br />
– Pädagogischer IT-Koordinator –<br />
und befindet sich auf dem Weg zum<br />
Erfolg. Eine ganze Serie von Fortbildungskursen<br />
hat begonnen, um die<br />
Kolleginnen und Kollegen auf ihre<br />
Aufgaben vorzubereiten. Das eigentliche<br />
Problem dabei ist, dass diese<br />
laut ihrer Aufgabenbeschreibung<br />
zwar ,,nur“ pädagogische Aufgaben<br />
LOG IN Heft <strong>Nr</strong>. <strong>133</strong> (2005)<br />
http://www.infos05.de/<br />
B E R I C H T E<br />
INFOS 2005 in Dresden.<br />
wahrzunehmen haben (Beratung der<br />
Kollegen bei Softwarebeschaffung,<br />
Planung der lokalen IT, …), in der<br />
Praxis jedoch die Schulträger wohl<br />
davon ausgehen, dass sich die Software<br />
selbsttätig installiert – mit anderen<br />
Worten: Der technische Systembetreuer<br />
fehlt!<br />
Vorbereitung der INFOS 2005<br />
Schwerpunkt der Arbeit in diesem<br />
Jahr ist ohne Zweifel die<br />
Durchführung der INFOS 2005 in<br />
Dresden (vgl. auch LOG IN, Heft<br />
130/2004, S. 7). Unter<br />
http://www.infos05.de/<br />
sind alle aktuellen Informationen<br />
zu finden (siehe Bild oben).<br />
Unterrichtsbeispiele<br />
Ein – sicherlich auch überregional<br />
interessierendes – Projekt der<br />
Fachgruppe ist der Aufbau einer<br />
Datenbank für Unterrichtsbeispiele<br />
zum Informatikunterricht:<br />
http://www.sn.schule.de/~dbub/<br />
Die Dateien werden dort nicht<br />
nur angeboten, sondern können<br />
auch diskutiert und bewertet werden.<br />
Bei den dort eingestellten Beiträgen<br />
handelt es sich um Materialien,<br />
Unterrichtsvorbereitungen und<br />
Beispielsammlungen zu verschiedenen<br />
Themengebieten des Informatikunterrichts<br />
an Schulen aller<br />
Schularten. Allerdings ist der Zugang<br />
zur Datenbank nur einem begrenzten<br />
Nutzerkreis gestattet: für<br />
alle Mitglieder der GI-Fachgruppe<br />
IBSn unbefristet und für andere Interessenten<br />
nur als Autoren von<br />
Beiträgen für zwei Jahre jeweils<br />
nach Überlassung eines Beitrags.<br />
Die 9. Informatiklehrerkonferenz<br />
Das Thema<br />
Während der Informatiklehrerkonferenz<br />
in Freiberg hörten etwa<br />
achtzig Kolleginnen und Kollegen<br />
(siehe Bild unten) den einführenden<br />
Vortrag von Professor Bernd<br />
Steinbach zum Thema ,,Boole’sche<br />
Funktionen und Gleichungen:<br />
Theorie – Anwendungen – praktische<br />
Berechnungen“. Der Hauptteil<br />
brachte alle Zuhörenden mathematisch<br />
auf ,,Vordermann“, und alle<br />
sahen mit Freude, dass alte Probleme<br />
– wie beispielsweise die Überfahrt<br />
eines Fährmanns mit Ziege,<br />
Kohlkopf und Wolf – auch auf besondere<br />
Weise gelöst werden können<br />
(siehe http://www.sn.schule.de/<br />
~gi/konf9/bfg.pdf). Höhepunkt war<br />
jedoch die Aufklärung einer Straftat<br />
mittels Boole’scher Gleichungen.<br />
Aus einer Vielzahl von Aussagen<br />
über fünf Herren wurde herausgefunden,<br />
wer in einer Bar auf<br />
einem bestimmten Stuhl saß und<br />
der Täter war.<br />
Die Workshops<br />
Wie schon mehrfach in solchen<br />
Veranstaltungen sächsischer Informatiklehrkräfte<br />
,,erprobt“, trafen<br />
sich die Teilnehmenden in drei<br />
Gruppen zu Diskussionen spezieller<br />
Themen.<br />
Der Workshop ,,Informatik Kl. 7<br />
am Gymnasium“ funktionierte<br />
nach dem ersten Jahr mit neuem<br />
Lehrplan als Erfahrungsaustausch<br />
und gab etliche wertvolle Denkanstöße.<br />
Zwei Ideen sollen vor allem<br />
weiter verfolgt werden: der Aufbau<br />
einer Vergleichsarbeit als Online-<br />
Das Auditorium verfolgt die Aufklärung<br />
einer Straftat.<br />
7
Test und eine Materialbörse während<br />
der nächsten Konferenz.<br />
Im Workshop Nummer zwei –<br />
,,Steganografie“ – wurde dieses<br />
kryptologische Verfahren in Bezug<br />
zum Unterricht erörtert. Neben<br />
theoretischen Grundlagen und geschichtlichen<br />
Hintergründen wurde<br />
auch praktisch mit verschiedenen<br />
Werkzeugen gearbeitet. Besonders<br />
gelungen war der Bezug zum Unterricht,<br />
da alles am Beispiel konkreter<br />
Schülerarbeiten dargestellt<br />
wurde. Die Teilnehmer konnten<br />
viele neue Ideen und Anregungen<br />
für ihren Unterricht mitnehmen.<br />
Ebensolche anwendungsbezogenen<br />
Ideen warteten auf die Teilnehmer<br />
des dritten Workshops ,,Programmieren<br />
mit LOGO“. Insbesondere<br />
ist für sächsische Mittelschulen<br />
das Thema ,,Programmierung“<br />
aufgrund der neuen Lehrpläne nahezu<br />
völlig neu.<br />
Rainer Fabianski<br />
Schule direkt<br />
Das Schülerrechenzentrum<br />
Dresden<br />
wurde 20<br />
Zwanzig Jahre sind für Institutionen<br />
im IT-Bereich schon ein langes<br />
Leben. Und auf diese Lebensspanne<br />
kann mittlerweile das Schülerrechenzentrum<br />
Dresden zurückblicken.<br />
Im Dezember 2004 feierte das<br />
Schülerrechenzentrum (SRZ) der<br />
Technischen Universität Dresden<br />
sein 20-jähriges Bestehen. Im Rahmen<br />
dieses SRZ-,,Geburtstagsfestes“<br />
übergaben die Firmen IBM<br />
Deutschland<br />
GmbH als<br />
Spende ein<br />
komplettes<br />
PC-Kabinett<br />
mit 13 Arbeitsplätzen<br />
sowie AMD<br />
Saxony LLC<br />
8<br />
B E R I C H T E<br />
& Co. KG einen Server mit einem<br />
AMD Opteron als Prozessor sowie<br />
Rechentechnik für ein weiteres Kabinett.<br />
Ebenso beteiligte sich die<br />
ThyssenKrupp AG an der Neuausstattung.<br />
Bereits im Jahr 2001 hatte<br />
die Firma Infineon Technologies AG<br />
150000 Mark (rund 76700 Euro)<br />
für die Fortführung des Schülerrechenzentrums<br />
gespendet.<br />
Ein wenig Geschichte<br />
In LOG IN ist die Geschichte des<br />
SRZ Dresden bereits vorgestellt<br />
worden (vgl. LOG IN, Heft 1/1996,<br />
S. 6–7). Im Folgenden sollen noch<br />
einmal einige wesentliche Eckdaten<br />
dieser bundesweit einmaligen Initiative<br />
vorgestellt werden.<br />
Im Oktober 1984 nach einjährigem<br />
Probebetrieb als ,,Schülerrechenzentrum<br />
Robotron“ im Pionierpalast<br />
gegründet, entwickelte<br />
sich das SRZ seither trotz einiger<br />
Hindernisse zu einem erfolgreichen<br />
Bildungs- und Fachkommunikationszentrum<br />
für begabte junge<br />
Nachwuchsfachleute auf dem Sektor<br />
der Informatik und Elektronik.<br />
Die damalige computertechnische<br />
Ausstattung wurde bis 1990<br />
vom Kombinat Robotron gewartet,<br />
ergänzt und modernisiert. Weitere<br />
Partner waren schon zu jener Zeit<br />
die TU Dresden und die damalige<br />
Pädagogische Hochschule Dresden,<br />
von denen vor allem Studenten als<br />
Arbeitsgemeinschaftsleiter tätig<br />
waren.<br />
Im Januar 1990 wurde das SRZ<br />
vom Pionierpalast getrennt und als<br />
Einrichtung der Stadt Dresden weitergeführt.<br />
Am 25. Juni 1991 erfolgte<br />
der erste wichtige Schritt in<br />
IBM spendet dem SRZ Dresden<br />
ein komplettes PC-Kabinett.<br />
AMD spendet dem SRZ 13 PC<br />
und 8 TFT-Flachbildschirme und einen<br />
neuen Server.<br />
Richtung moderner PC-Technik –<br />
das erste SRZ-Kabinett wurde mit<br />
PCs ausgestattet, die auf Intel-<br />
80286-Prozessoren basierten.<br />
Schuljahr für Schuljahr lernten<br />
und arbeiteten von Beginn an zwischen<br />
60 und weit über 100 Schülerinnen<br />
und Schüler – frühestens ab<br />
der sechsten Klasse – in ihrem Rechenzentrum,<br />
eigneten sich erste<br />
Schritte für die Konzipierung von<br />
Algorithmen, die Praxis verschiedener<br />
Programmiersprachen, die Geheimnisse<br />
der Softwareentwicklung,<br />
die Architektur von Schaltkreisen,<br />
die Strukturierung von Datenbanken<br />
oder auch von Computernetzwerken<br />
an. Bis heute durchliefen inklusive<br />
der Vorkurse schätzungsweise<br />
tausend Schülerinnen und Schüler<br />
das SRZ. Im Durchschnitt wird das<br />
Schülerrechenzentrum zwei bis drei<br />
Schuljahre lang von ihnen besucht.<br />
Wer im Schülerrechenzentrum aktiv<br />
war, entscheidet sich später mit<br />
hoher Wahrscheinlichkeit für ein<br />
Studium an der TU Dresden. Wer<br />
mehrere Jahre SRZ-Schüler war,<br />
studiert dann meist an den Fakultäten<br />
Informatik, Elektrotechnik und<br />
Informationstechnik oder Mathematik<br />
und Naturwissenschaften.<br />
Die<br />
Infineon<br />
Technologies<br />
AG<br />
unterstützte<br />
das SRZ<br />
im Jahr<br />
2001 sehr.<br />
LOG IN Heft <strong>Nr</strong>. <strong>133</strong> (2005)
Als die Stadt Dresden 1998 die<br />
Gelder für das Schülerrechenzentrum<br />
streichen wollte, drohte das<br />
Aus. Doch durch das Engagement<br />
der Technischen Universität Dresden,<br />
die zunächst die weiter anfallenden<br />
Kosten übernahm, und des 1994<br />
gegründeten SRZ-Fördervereins<br />
konnte gemeinsam mit dem Freistaat<br />
Sachsen und der Stadt Dresden<br />
ein Rettungskonzept entwickelt werden.<br />
Schließlich übernahm am 1. Februar<br />
2001 die TU Dresden die Trägerschaft<br />
für das Schülerrechenzentrum.<br />
Das SRZ wurde eine Betriebseinheit<br />
der Fakultät Informatik.<br />
Alle an der Rettung des SRZ Beteiligten<br />
waren sich darin einig,<br />
dass gerade in einer Situation, in<br />
der ein gravierender Fachkräftemangel<br />
im IT-Bereich besteht, begabte<br />
Schülerinnen und Schüler auf<br />
diesem Gebiet unbedingt weiterhin<br />
gefördert werden müssen.<br />
Seit dieser Zeit wird die interessierte<br />
Öffentlichkeit, werden Schüler,<br />
Eltern und Lehrer mit einem jährlichen<br />
,,Tag der Offene Tür“ über das<br />
Lernen und Lehren im Schülerrechenzentrum<br />
anschaulich informiert.<br />
Mittlerweile hat sich die Zusammenarbeit<br />
des Schülerrechenzentrums<br />
mit der TU Dresden und der<br />
regionalen Wirtschaft als bedeutender<br />
Faktor für den Technologie-<br />
Standort Dresden erwiesen, und zunehmend<br />
spielt dabei die Universität<br />
nicht nur die Rolle des Gebenden,<br />
sondern auch des Nehmenden,<br />
schließlich profitiert sie vom hohen<br />
Niveau der im SRZ ausgebildeten<br />
Bewerber für die IT-Studiengänge.<br />
Wer sich über das SRZ noch eingehender<br />
informieren möchte, sollte<br />
einen Blick auf die Internetseiten<br />
werfen:<br />
http://www.srz-dresden.de/index.html<br />
Stimmen von Schülern<br />
und Mitarbeitern des SRZ<br />
Jöran Zeisler (18), Schüler des<br />
Gymnasiums Coswig, macht sich seit<br />
fast fünf Jahren einmal die Woche<br />
auf den langen Weg ins SRZ. Für ihn<br />
steht fest, dass sich die Mühe lohnt.<br />
,,Ich bekam bereits mit zehn Jahren<br />
meinen ersten PC“, erklärt er seine<br />
ursprüngliche Motivation. ,,Aber<br />
schon bald wurden mir die üblichen<br />
Computerspiele zu langweilig. Ich<br />
wollte wissen, was dahinter steckt,<br />
LOG IN Heft <strong>Nr</strong>. <strong>133</strong> (2005)<br />
B E R I C H T E<br />
Jedes Jahr wird<br />
ein ,,Tag der<br />
Offenen Tür“<br />
im SRZ durchgeführt.<br />
und da reichte mir der Informatikunterricht<br />
in der Schule nicht aus.“<br />
Heute kann Jöran seine eigenen<br />
Spiele programmieren. Seine letzte<br />
Jahresarbeit will er als ,,Besondere<br />
Lernleistung“ in die Abiturwertung<br />
einbringen. ,,Das hilft mir beim Abi,<br />
denn dadurch wird das Fach Informatik<br />
höher bewertet.“ Wie die meisten<br />
Absolventen, will er nach dem<br />
Abitur ,,irgendwas mit Informatik“<br />
machen.<br />
Diese Entscheidung hat René Haberland,<br />
Informatikstudent im 5. Semester,<br />
bereits hinter sich. Von 1995<br />
bis 1999 war er Schüler des SRZ. Im<br />
Jahr 2001 ,,wechselte er die Seiten“<br />
und leitet seitdem eine AG. ,,Während<br />
meiner Schulzeit hatte ich mich<br />
bereits entschieden, einmal Informatiker<br />
zu werden. Ich bin einfach meinen<br />
Interessen weiter nachgegangen<br />
und habe mein Hobby zur Ausbildung<br />
gemacht. Diesen Schritt habe<br />
ich bis heute nicht bereut. Die Zeit<br />
im SRZ hat mir während meines<br />
Grundstudiums an der TUD wirklich<br />
geholfen.“<br />
Jürgen Wagner war von 1986 bis<br />
1991 Leiter des Schülerrechenzentrums.<br />
,,Wenn ich an meine Tätigkeit<br />
beim SRZ zurückdenke, dann fallen<br />
mir als Erstes die ausgesprochen positiven<br />
Erfahrungen mit den Schülern<br />
ein“, erinnert sich Wagner. ,,Das<br />
Interesse an Fragen der Informatik,<br />
Mathematik und Technik, die Ausdauer<br />
und der Ideenreichtum bei der<br />
Lösung von Problemen sowie der<br />
auf gegenseitiger Achtung beruhende<br />
höfliche Umgang miteinander<br />
faszinierten mich immer wieder. Als<br />
gelernter und praktizierender Lehrer<br />
für Physik und Mathematik waren<br />
solche Erfahrungen in meiner<br />
vorangegangenen Unterrichtspraxis<br />
keine Selbstverständlichkeit.“<br />
Bettina Westfeld erinnert sich<br />
noch gut daran, wie sie in der Klasse<br />
von Jürgen Wagner lernte, einen Taschenrechner<br />
zu programmieren. Sie<br />
war von 1988 bis 1992 Schülerin am<br />
SRZ und ist in zweierlei Hinsicht<br />
eine Ausnahme: Zum einen gehörte<br />
sie damals zu den wenigen Mädchen<br />
am SRZ (an diesem Tatbestand hat<br />
sich bis heute – leider – nichts geändert),<br />
zum anderen schlug sie nicht<br />
den ,,üblichen“ Berufsweg ein, sondern<br />
studierte Geschichte und Philosophie.<br />
,,Auch wenn das vielleicht<br />
nicht die gewünschte Studienrichtung<br />
für Absolventen des SRZ war,<br />
habe ich die Zeit in guter Erinnerung.<br />
Die Leichtigkeit im Umgang<br />
mit dem Computer, die ich hier gelernt<br />
habe, hilft mir bis heute.“<br />
Ähnliche Erfahrungen hat auch<br />
Johannes Gramatté gemacht. Er besuchte<br />
das SRZ im Schuljahr 1998/<br />
1999 und studiert nun im dritten<br />
Semester Medizin: ,,Für mich war<br />
der Umgang mit dem Computer,<br />
das Programmieren und Zusammenbauen<br />
von Hardware, immer<br />
ein Hobby, und ich wollte Informatik<br />
nie studieren. Aber es war mir<br />
nicht genug, was ich mir allein erarbeiten<br />
konnte. Im SRZ gab es –<br />
ohne höhere Voraussetzungen – immer<br />
eine sehr gute Grundlagenvermittlung.<br />
Die Kurse dort sind ist<br />
also nicht nur für Fachidioten, sie<br />
sind an verschiedenen Anforderungen<br />
und Schwierigkeiten orientiert.<br />
Kurz: Das SRZ ist auch für Schüler,<br />
die nicht in die Informatik wollen,<br />
sehr empfehlenswert.“<br />
Steffi Heinicke<br />
9
Unterricht<br />
mit StarOffice 7<br />
Das Handy-Schulden-Problem<br />
Das Handy ist inzwischen ein Standard-Gebrauchsartikel<br />
geworden. In jedem vierten Haushalt von unter<br />
25-Jährigen gibt es keinen festen Telefonanschluss<br />
mehr – er ist durch das Mobiltelefon ersetzt, wie die<br />
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen<br />
Bundesamtes bereits im vergangenen Jahr ergeben<br />
hat (Statistisches Bundesamt, 2004).<br />
Das Handy gehört auch für viele Kinder längst zum<br />
Alltag. Laut einer Studie des Münchner Instituts für<br />
Jugendforschung telefoniert bereits jedes zweite Kind<br />
im Alter von elf und zwölf Jahren mobil. Doch nicht allein<br />
das Telefonieren ist das Wesentliche, sondern vor<br />
allem Handy-Accessoires sind begehrte Zusatzartikel,<br />
auf die ein Jugendlicher kaum verzichten kann. So kosten<br />
nicht nur die Gesprächsminuten<br />
Geld, sondern in viel stärkerem<br />
Maße die scheinbar so kleinen Dinge<br />
wie beispielsweise Klingeltöne<br />
oder so genannte Bilderlogos auf<br />
dem Handy-Display. Marktführer in<br />
dem lukrativen Geschäft mit Klingeltönen<br />
und Logos ist die Firma<br />
Jamba! (http://www.jamba.de/). Die<br />
Berliner Firma wirbt für ihre Produkte<br />
sehr aggressiv im Fernsehen,<br />
besonders auf den beliebten Musikkanälen,<br />
und spricht damit gezielt<br />
Kinder und Jugendliche an. So tappen<br />
viele Jugendliche dabei in eine<br />
Kostenfalle, aus der sie später nur<br />
schwer wieder herauskommen. Kinder<br />
und Jugendliche lassen sich unter<br />
anderem mit so genannten Monats-Spar-Abos<br />
für 4,99 Euro dazu<br />
Bild 1: Grundlegender Aufbau der<br />
Tabellenkalkulation StarCalc.<br />
LOG IN Heft <strong>Nr</strong>. <strong>133</strong> (2005)<br />
C O L L E G<br />
Teil 3.1: Die Schuldenfalle<br />
von Ingo-Rüdiger Peters<br />
verführen, ihr Taschengeld aus dem Fenster zu werfen.<br />
Bereits zwölf Prozent der 13- bis 24-Jährigen in<br />
Deutschland sind verschuldet. Das benötigte Geld wird<br />
zunächst von den Eltern geborgt. Diese sind es auch,<br />
die bei den Jugendlichen für deren ,,Handymanie“ haften.<br />
,,Jugendliche unter 18 Jahren können nur mit Einwilligung<br />
ihrer Eltern einen Handyvertrag abschließen“,<br />
hob Claudia Kurzbuch, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft<br />
Schuldnerberatung e. V. (BAG-SB),<br />
kürzlich hervor. Doch angesichts 2,8 Millionen verschuldeter<br />
Haushalte beruhigt das kaum. Die Folge:<br />
Immer mehr Menschen landen schon in jungen Jahren<br />
bei der Schuldnerberatung. ,,Vor sechs Jahren war der<br />
junge Erwachsene bei uns eine Ausnahme, heute ist er<br />
ein gewohntes Bild“, betonte Frau Kurzbuch.<br />
Es gilt also, dagegen etwas zu tun, und die Schule ist<br />
aufgerufen, handelnd einzugreifen! Die Schülerinnen<br />
und Schüler sollten entsprechende Kompetenzen erlan-<br />
67
gen, um ihre eigenen Ausgaben für diesen Kommunikationsbereich<br />
zu kontrollieren und entsprechende Werkzeuge<br />
hierfür zu benutzen.<br />
Ein Werkzeug<br />
für Berechnungen jeder Art<br />
Bei der Kalkulation von Kosten bietet sich ein Tabellenkalkulationsprogramm<br />
an (siehe Kasten ,,Tabellenkalkulationsprogramme“,<br />
Seite 69). StarOffice enthält<br />
mit seinem Modul StarCalc ein solches Kalkulationssystem.<br />
Der grundlegende Aufbau dieses Programms<br />
wird in Bild 1 (siehe vorige Seite) gezeigt.<br />
Eine Kalkulationstabelle gliedert sich in Zeilen und<br />
Spalten, deren einzelnes Element eine Zelle darstellt.<br />
Das Besondere einer Kalkulationstabelle ist, dass jede<br />
Zelle einzeln durch ihre Bezeichnung anzusprechen ist.<br />
Die Identifikation einer Zelle ergibt sich aus ihrer Position<br />
in der Gesamttabelle. So ist die allererste Zelle<br />
einer Tabelle, die in der Spalte A und der Zeile 1 positioniert<br />
ist, mit ,,A1“ eindeutig gekennzeichnet. Diese<br />
genaue Bezeichnung jeder Zelle ist wichtig für automatische<br />
Berechnungen.<br />
Der Taschengeldbestand – automatisch berechnet<br />
Für einen Unterricht, der die Schulden Jugendlicher<br />
zum Thema hat, soll zuerst einmal die Ausgabenstruktur<br />
des Taschengelds im Verlauf eines Monats transparent<br />
gemacht werden. Als Beispiel dient zunächst eine<br />
Tabelle, in der die Ausgaben aufgelistet und vom monatlich<br />
erhaltenen Taschengeld, das hier auf 25 Euro<br />
festgelegt wird, abgezogen werden.<br />
Dazu wird eine Überschrift über die Tabelle gesetzt,<br />
und es werden die Köpfe der einzelnen Tabellenspalten<br />
benannt (siehe Bild 2).<br />
Nun müssen die einzelnen Spalten formatiert werden.<br />
Das heißt, es werden die Attribute festgelegt, die<br />
alle Zellen jeder einzelnen Spalte besitzen sollen. In<br />
die erste Spalte wird unter der Überschrift ,,Art der<br />
Ausgabe“ sicherlich nur Text geschrieben, also wird die<br />
Spalte als ,,Text“ formatiert, nachdem die gesamte<br />
Spalte nach der Überschrift markiert wurde. Das Formatieren<br />
erfolgt unter ,,Format“ in der Menüleiste mit<br />
der Option ,,Zelle…“ (siehe Bild 3).<br />
In der nächsten Spalte soll die Geldmenge eingetragen<br />
werden können, die für ein Produkt ausgegeben<br />
wird – es wird in einer Währung bezahlt. So wird diese<br />
Bild 2: Beispiel für einen Tabellenkopf.<br />
68<br />
C O L L E G<br />
Bild 3:<br />
Mit diesem<br />
Fenster<br />
können<br />
Zellenformatefestgelegtwerden.<br />
Bild 4: Das Zellenformat ,,Währung“ wird bestimmt.<br />
Spalte – wie die erste Spalte – markiert, und die Zellen<br />
werden mit dem Format ,,Währung“ versehen, und<br />
zwar mit der Euro-Währung (siehe Bild 4).<br />
In gleicher Weise – mit dem Format ,,Währung“ –<br />
wird die dritte Spalte formatiert.<br />
Wenn nun laufend der Taschengeldbestand im Blick<br />
behalten werden soll, dann muss der Wert, der in der<br />
Spalte ,,Ausgabe“ steht, vom momentanen Bestand abgezogen<br />
werden. Die erste Ausgabe, deren Wert in der<br />
Zelle B3 steht, muss vom Wert des Anfangsbestands,<br />
der den Wert 25 Euro hat, abgezogen werden. Dazu<br />
wird in die Zelle C3 kein Wert eingefügt, sondern eine<br />
Berechnungsformel. Damit das System merkt, dass nun<br />
eine Berechnungsformel folgt, wird sie stets mit einem<br />
Gleichheitszeichen begonnen. Wenn die Maus auf Zelle<br />
C3 positioniert ist, die dadurch umrahmt wird, muss in<br />
der Einga-<br />
Bild 5: Die erste Berechnung wird eingegeben.<br />
bezeilezuerst ein<br />
,,=“ eingegeben<br />
werden<br />
und danach<br />
das<br />
Berechnungsziel<br />
– in Zelle<br />
LOG IN Heft <strong>Nr</strong>. <strong>133</strong> (2005)
Tabellenkalkulationsprogramme<br />
Ein Tabellenkalkulationsprogramm ist eine Software<br />
für die tabellarische, interaktive Eingabe, für die Verarbeitung<br />
und die grafische Darstellung von numerischen<br />
und alphanumerischen Daten. Der Bildschirm wird dabei<br />
– wie bei einer Tabelle – in Zeilen und Spalten eingeteilt.<br />
Je nach Programm heißt dieser Bereich dann Arbeitsblatt,<br />
Worksheet oder Spreadsheet. Jede Zelle dieser<br />
Tabelle kann eine numerische oder alphanumerische<br />
Konstante oder eine Formel enthalten. Die Formeln sind<br />
in der Tabelle nicht sichtbar, können aber Werte aus anderen<br />
Zellen in Beziehung zueinander setzen, wobei<br />
vom Programm dann nur das Resultat in der Zelle angezeigt<br />
wird.<br />
Die erste Software zur Tabellenkalkulation wurde<br />
1979 unter dem Namen VisiCalc für den Apple II auf<br />
den Markt gebracht. Dies machte aus dem bis dahin eher<br />
von Bastlern und zum Hobby verwendeten Apple-Computer,<br />
einen Computer für Geschäftsanwendungen.<br />
VisiCalc war das, was als ,,Killer-Applikation“ bezeichnet<br />
wird: eine Anwendung, die allein den Kauf eines<br />
Computers rechtfertigt, weil sie Kosten spart bzw. sparen<br />
soll. Sie revolutionierte die Buchhaltung und die Kostenrechnung<br />
in kleinen und mittleren Betrieben. Die hierfür<br />
notwendigen Berechnungen sind im Prinzip nichts anderes<br />
als das Aufsummieren von Beträgen auf Konten – etwas,<br />
was gut an Computer delegiert werden kann. Mit VisiCalc<br />
gab es ein Programm, das solche kaufmännischen<br />
Berechnungen erstmals für Nutzer ohne Programmierkenntnisse<br />
unterstützte. Sonst stundenlang dauernde<br />
Kalkulationen konnten nunmehr radikal beschleunigt<br />
durchgeführt werden. Waren einmal die Formeln eingegeben,<br />
so waren beispielsweise für eine neue Analyse<br />
nur die Anfangswerte zu ändern. Allein, wenn ein Buchhalter<br />
nur 10 % seiner Arbeitszeit durch einen PC einsparte,<br />
so hatten sich bereits damals Gerät und Software<br />
in einem Jahr amortisiert.<br />
VisiCalc wurde 1978 von Daniel Bricklin in Zusammenarbeit<br />
mit Bob Frankston an der Harvard Business<br />
School entwickelt. Sie gründeten 1979 die Firma Software<br />
Arts, Inc. und ließen noch im selben Jahr VisiCalc<br />
über die Firma Personal Software, Inc. (später umbenannt<br />
in VisiCorp) vertreiben. Bricklin und Frankston<br />
unterließen es jedoch, die Ideen, die hinter VisiCalc standen,<br />
zu patentieren. Andere Softwareentwickler – wie<br />
beispielsweise Bill Gates – konnten sich daher besser finanziell<br />
absichern. Denn zahlreiche Firmen übernahmen<br />
die erfolgreiche Idee: Lotus mit dem Programm Lotus<br />
123 und letztlich Microsoft zuerst mit Multiplan unter<br />
DOS, dann mit Excel unter Windows. Auch OpenOffice.org<br />
und nicht zuletzt StarOffice enthalten eine Tabellenkalkulation.<br />
Internetquellen<br />
Bricklin, D.: VisiCalc – Information from its creators, Dan Bricklin<br />
and Bob Frankston.<br />
http://www.danbricklin.com/visicalc.htm [Stand: April 2005]<br />
Frankston, B.: Implementing VisiCalc.<br />
http://www.frankston.com/?name=ImplementingVisiCalc<br />
[Stand: April 2005]<br />
LOG IN Heft <strong>Nr</strong>. <strong>133</strong> (2005)<br />
C O L L E G<br />
C3 wird<br />
also<br />
,,=25–B3“<br />
eingetragen<br />
(siehe<br />
Bild 5, vorigeSeite).<br />
Wird<br />
die Zelle<br />
mit der<br />
Tabulator-<br />
Taste verlassen,<br />
so<br />
wird so-<br />
Bild 6: Die jeweils aktuellen Werte von<br />
Zellen werden durch Angabe der Zellenbezeichnungen<br />
in Beziehung zueinander<br />
gesetzt.<br />
fort der erste Bestand des Taschengelds aktualisiert.<br />
In der nächsten Zeile, d. h. in der Zelle C4, kann nun<br />
selbstverständlich nicht mehr vom Anfangsbestand in<br />
Höhe von 25 Euro ausgegangen werden, sondern nur<br />
noch von dem Betrag, der in der Zelle C3 steht, nämlich<br />
dem aktualisierten Taschengeldbestand. Deshalb wird in<br />
Zelle C4 eingetragen, dass der Wert, der in der Zelle B4<br />
steht von dem aktuellen Bestand, der als Wert in der Zelle<br />
C3 steht, abgezogen werden muss. Die Formel, die nun<br />
in die Eingabezeile der Zelle C4 eingegeben wird, lautet<br />
deshalb ,,=C3–B4“ (siehe Bild 6). Die Formel, die eingegeben<br />
worden ist, erscheint nicht in der Zelle, sondern es<br />
erscheint nur der aus der Formel berechnete Wert, sobald<br />
die Zelle wieder mit der Tabulator-Taste verlassen wird.<br />
Bei einem weiteren Eintrag müsste in der Spalte<br />
,,Bestand“ wieder die Formel eingegeben werden, nur<br />
aktualisiert auf die neuen Adressen der jeweiligen Zellen.<br />
Dies kann glücklicherweise vereinfacht werden. Es<br />
wird eine Zelle mit der Formel im Hintergrund angeklickt<br />
(im vorliegenden Beispiel die Zelle C4), und es<br />
wird die folgende Zelle der Spalte nach unten markiert.<br />
In dem Menüpunkt ,,Bearbeiten“ findet sich ein<br />
Untermenü ,,Ausfüllen“. Sofern hier die Option ,,Unten“<br />
gewählt wird (siehe Bild 7), wird die markierte<br />
Zelle mit der an die geltenden Adressen angepassten<br />
Bild 7:<br />
Jeder<br />
markierten<br />
Zelle<br />
in der<br />
Spalte<br />
wird<br />
eine<br />
entsprechendangepasste<br />
Formel<br />
zugewiesen.<br />
69
Formel ausgefüllt und die Berechnung erfolgt entsprechend<br />
automatisch nach den eingegebenen Werten. Natürlich<br />
kann dies auch über mehrere Zellen nach unten<br />
ausgeführt werden, sofern schon weitere Ausgaben eingetragen<br />
wurden, aber der Bestand noch nicht mit Formeln<br />
erfasst wurde. Ansonsten füllt StarCalc alle Zellen<br />
derjenigen Zeilen, in der keine Ausgaben eingetragen<br />
wurden, mit dem letzten Wert des Bestands aus.<br />
Diese erste Tabelle ist jetzt schon recht hilfreich, um<br />
den Bestand des Taschengelds nach jeder Ausgabe im<br />
Blick halten zu können.<br />
Das Handy – eine Kostenfaktor<br />
Dass Telefonieren Geld kostet, ist seit langer Zeit<br />
bekannt. Aber im Zeitalter mobiler Kommunikation<br />
kann das Handy eben zu wesentlich mehr verwendet<br />
werden als nur zum Sprechen: SMS senden – oder<br />
,,simsen“ –, Fotos versenden, unterschiedliche Klingeltöne<br />
aufs Handy laden, flotte Logos auf dem Display<br />
anzeigen lassen, Spiele herunterladen und spielen und<br />
vieles, vieles mehr – es gibt kaum Grenzen, um das<br />
Handy mit völlig unterschiedlichen Funktionen auszustatten.<br />
Doch jeder Dienst und jedes Produkt kosten<br />
Geld – und das Angebot ist schier unendlich. Nur sollte<br />
jeder den Überblick über die anfallenden Kosten behalten.<br />
70<br />
C O L L E G<br />
In der nächsten Folge soll der Kostendschungel bei<br />
Handys durchforstet werden, um einen transparenten<br />
Überblick über unterschiedliche Angebote zu erhalten.<br />
Ingo-Rüdiger Peters<br />
Redaktion LOG IN<br />
Postfach 33 07 09<br />
14177 Berlin<br />
E-Mail: petersir@log-in-verlag.de<br />
Internetquellen<br />
Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e. V.:<br />
http://www.bag-schuldnerberatung.de/ [Stand: April 2005]<br />
(wird fortgesetzt)<br />
Rund ums Taschengeld:<br />
http://www.ifs.at/html-texte/taschengeld.htm [Stand: April 2005]<br />
Statistisches Bundesamt: In jedem vierten jungen Haushalt ersetzen<br />
Handys das feste Telefon – Pressemitteilung vom 14. Mai 2004.<br />
http://www.destatis.de/presse/deutsch/pm2004/p2210024.htm<br />
[Stand: April 2005]<br />
Taschengeldratgeber / Taschengeld-Information:<br />
http://www.kreis-ploen.de/k_verwaltung/amt22/taschengeld.htm<br />
[Stand: April 2005]<br />
Anzeige<br />
LOG IN Heft <strong>Nr</strong>. <strong>133</strong> (2005)
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/BigPictures/Napier_3.jpeg<br />
Geschichte<br />
Vom Rechnen<br />
mit Stäbchen<br />
John Napier<br />
und seine Rechenstäbchen<br />
Er war ein Zeitgenosse William<br />
Shakespeares, der bekanntlich von<br />
1564 bis 1616 lebte: John Napier<br />
wurde 1550 in Merchiston Castle<br />
bei Edinburgh geboren und verstarb<br />
dort am 3. April 1617. Als<br />
schottischer Edelmann trug er den<br />
Titel ,,Laird of Merchiston“. Doch<br />
nicht unbedingt die Dramen Shakespeares<br />
waren seine Welt, sondern<br />
vielmehr die Mathematik. Mit seinen<br />
Ideen beeinflusste er sogar<br />
Wilhelm Schickard (1592–1635),<br />
der die erste mechanische Rechenmaschine<br />
baute.<br />
Neue Rechenverfahren gesucht<br />
Die Zeit der Entdeckungen im<br />
16. Jahrhundert brachte eine Fülle<br />
neuer Anforderungen an die Mathematik<br />
mit sich: Seefahrer, Kaufleute,<br />
Landvermesser und Wissenschaftler<br />
benötigten neue Rechenverfahren,<br />
da die herkömmlichen<br />
zu ungenau und zu langsam gewor-<br />
Bild 1: John Napier, Laird of Merchiston<br />
(1550–1617).<br />
LOG IN Heft <strong>Nr</strong>. <strong>133</strong> (2005)<br />
C O M P U T E R & A N W E N D U N G E N<br />
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/Bookpages/Napier10.jpeg<br />
http://www.guenther-s.de/rechentechn/napiers3.jpg<br />
Bild 2: Im Jahr 1614 erschien das<br />
erste Buch über Logarithmen –<br />
es ist von John Napier verfasst<br />
worden.<br />
den waren. Der Abakus (vgl. LOG<br />
IN 5–6/1996, S. 105 f.) war in Vergessenheit<br />
geraten, und auch das<br />
Rechenbrett von Adam Ries (1492–<br />
1559) half in diesen Fällen nicht<br />
weiter (vgl. LOG IN 3–4/2001, S. 48<br />
ff.). Denn während Addition und<br />
Subtraktion mit dem Rechenbrett<br />
leicht durchgeführt werden konnten,<br />
gab es damit keine Möglichkeit,<br />
problemlos zu multiplizieren<br />
oder zu dividieren.<br />
Unabhängig voneinander arbeiteten<br />
John Napier in Schottland<br />
und Jost Bürgi (1552–1632), ein u. a.<br />
in Kassel lebender Schweizer Uhrmacher<br />
und Astronom, als erste<br />
Menschen an der Idee, das Multiplizieren,<br />
Dividieren, Potenzieren und<br />
Radizieren mit Logarithmen durchzuführen.<br />
Die Multiplikation konnte<br />
somit auf eine einfache Addition,<br />
die Division auf eine Subtraktion<br />
und das Potenzieren auf eine Multiplikation<br />
und die wiederum auf<br />
eine Addition zurückgeführt werden;<br />
entsprechend war sogar das<br />
Radizieren möglich. Während Bürgi<br />
seine Erkenntnis nicht selbst publizierte,<br />
schrieb Napier ein Buch über<br />
Logarithmen, das 1614 unter dem<br />
Titel ,,Mirifici – Logarithmorum<br />
Canonis descriptio“ erschien (siehe<br />
Bild 2). Sein Name wurde ebenfalls<br />
latinisiert und als Ioanne Nepero<br />
angegeben, was später auf einige<br />
Bezeichnungen, die ihm zu Ehren<br />
eingeführt wurden, entsprechende<br />
Auswirkungen hatte (siehe Abschnitt<br />
,,Ehrungen“).<br />
Für das Logarithmieren mussten<br />
allerdings umfangreiche Rechentafeln<br />
erstellt werden, wofür wiederum<br />
eine Fülle an Multiplikationen<br />
durchzuführen war. John Napier<br />
untersuchte deshalb die Rechenvorgänge<br />
beim Multiplizieren genauer<br />
und erkannte, dass jede Multiplikation<br />
einerseits auf das kleine<br />
Einmaleins und dies andererseits<br />
wieder auf Addition zurückgeführt<br />
werden kann.<br />
In dem 1617 erschienenen Buch<br />
,,Rabdologiæ“ (vom Griechischen<br />
rabdos – deutsch: Stange bzw. Stab<br />
– und logos – deutsch: sinnvolle<br />
Rede bzw. Wort) beschrieb Napier<br />
seine Erkenntnisse und stellte den<br />
Umgang mit den von ihm entwickelten<br />
Rechenstäbchen (siehe<br />
Bild 3) vor.<br />
Ein Satz Rechenstäbchen (siehe<br />
Bild 4, nächste<br />
Seite) besteht<br />
aus zwölf Holzstäbchen,<br />
elf davon<br />
mit quadratischemQuerschnitt.<br />
Zehn<br />
dieser Stäbchen<br />
erhalten auf ih-<br />
Bild 3:<br />
Die Rechenstäbchen<br />
von<br />
John Napier<br />
aus dem Jahre<br />
1617.<br />
73
Bild 4 (unten): Ein Satz Rechenstäbchen<br />
von Napier zur Multiplikation<br />
(links der Leitstab).<br />
rer Oberseite Multiplikationstabellen<br />
für die Ziffern 0<br />
bis 9. Das 11. Stäbchen<br />
wird als<br />
Leitstab bezeichnet;<br />
es trägt nur die<br />
Ziffern 1 bis 9<br />
(oder I bis IX).<br />
Das 12. Stäbchen<br />
ist ein flacher Stab<br />
und enthält die ersten<br />
9 Quadratzahlen.<br />
Das Multiplizieren<br />
von zwei einstelligen<br />
Faktoren ist sehr einfach.<br />
Der Leitstab als einer der Faktoren<br />
und der zweite Stab mit dem zweiten<br />
Faktor werden nur nebeneinander<br />
gelegt (siehe Bild 5).<br />
Bei der Multiplikation mit einem<br />
Faktor, der mehrstellig ist, wird der<br />
Sinn der schrägen Anordnung der<br />
Ziffern deutlich. Rechts vom<br />
Leitstab mit dem einstelligen Faktor<br />
werden die Stäbchen angelegt,<br />
deren oberste Ziffern die mehrstellige<br />
Zahl des zweiten Faktors bil-<br />
74<br />
C O M P U T E R & A N W E N D U N G E N<br />
Bild 5 (links): Multiplikationsergebnisse<br />
von<br />
1x3 bis 9x3 – hier wird<br />
das Ergebnis nur abgelesen.<br />
Bild 6 (unten): Mithilfe<br />
der Rechenstäbchen ist<br />
8x479 = 3832 leicht zu<br />
berechnen (siehe Erklärung<br />
im Text).<br />
den. Der Leitstab gibt die Zeile vor,<br />
in der abgelesen wird. Schräg gegenüberliegende<br />
Werte werden addiert<br />
und ergeben jeweils eine Ziffer<br />
des Ergebnisses. Der Übertrag<br />
(maximal 1) wird der nächsten,<br />
links davon stehenden Ziffer zugeschlagen<br />
(siehe Bild 6).<br />
Um das Ergebnis der Multiplikation<br />
aus Bild 6 zu erhalten, müssen<br />
nur die von rechts oben nach links<br />
unten schräg benachbarten Ziffern<br />
des mehrstelligen Faktors in der<br />
Reihe des einstelligen Faktors addiert<br />
werden:<br />
ablesbare<br />
Teilprodukte:<br />
Addition: 3 5 7<br />
2 6 2<br />
____________<br />
Ergebnis: 3 8 3 2<br />
Weiterentwicklungen<br />
Rechenschieber<br />
Erst aufgrund der Entdeckung<br />
der Logarithmen durch Napier<br />
(und Bürgi) war die Erfindung des<br />
Rechenschiebers möglich. Und<br />
eben diese Rechenschieber verdrängten<br />
Napiers Rechenstäbchen<br />
relativ rasch. Denn die Rechenregeln<br />
für das Rechnen mit Logarithmen<br />
reduzieren auf einem Rechenschieber<br />
die Rechenoperation auf<br />
die nächst niedrigere Stufe, ähnlich<br />
wie es die Rechenstäbchen ermöglichen<br />
– aus einer Multiplikation<br />
wird eine Addition, aus der Division<br />
eine Subtraktion. Dies machte<br />
sich William Oughtred (1574–1660)<br />
zunutze, indem er 1622 den ersten<br />
Rechenschieber mit zwei aneinander<br />
gleitenden, identischen logarithmischen<br />
Skalen vorstellte. Dieser<br />
Doppelstab bekam schließlich<br />
nach 1650 durch Edmund Wingate<br />
(1593–1656) und Seth Partridge<br />
(1603–1686) die noch heutige übliche<br />
Gestalt mit einem ,,Körper“,<br />
auf dem mehrere Reihen Skalen<br />
angebracht sind, einen dagegen verschiebbaren<br />
,,Läufer“ mit weiteren<br />
Zahlen sowie eine gegen diese Skalen<br />
bewegliche ,,Zunge“ (siehe Bild<br />
7). Durch Verschieben der Skalen<br />
gegeneinander kann über eine<br />
Markierung auf der Zunge der zu<br />
berechnende Wert abgelesen wer-<br />
den. Vor der Erfindung des elektronischen<br />
Taschenrechners war der<br />
Rechenschieber bis in die 1970er-<br />
Jahre vor allem im technischen Bereich<br />
eines der wichtigsten Rechenhilfsmittel.<br />
Rechenmaschine<br />
Die erste mechanische Rechenmaschine<br />
konstruierte und baute<br />
1623 Wilhelm Schickard, der Professor<br />
an der Universität Tübingen<br />
war (vgl. LOG IN 1/1997, S. 75).<br />
Seine Maschine sollte vor allem das<br />
Multiplizieren und Dividieren erleichtern.<br />
Schickard benutzte dazu<br />
das Prinzip der Rechenstäbchen<br />
von Napier, von denen er sechs<br />
vollständige Sätze auf Zylinder<br />
schrieb. Auch benutzte er erstmals<br />
ein dekadisches Zählrad für die<br />
Addition und Subtraktion: Es besaß<br />
10 Zähne, erlaubte also 10 Winkelstellungen<br />
pro Umdrehung und<br />
damit das Zählen im dekadischen<br />
System. Nach einer ganzen Umdrehung<br />
schaltete ein zusätzlicher<br />
Übertragungszahn das Zählrad der<br />
höherwertigen Stelle um einen<br />
Schritt weiter (z. B.: 10 Einer = 1<br />
Zehner). Damit war der erste<br />
selbsttätige Zehnerübertrag realisiert.<br />
Schickard vervollständigte<br />
seine Maschine durch eine Merkvorrichtung<br />
für Zahlen, u. a. für<br />
den Multiplikator, die man heute<br />
als Register bezeichnet.<br />
Von Schickards Rechenmaschine<br />
wurden zwei Exemplare gebaut,<br />
eine war für Johannes Kepler gedacht,<br />
die zweite für Schickard<br />
selbst. Doch leider sind nur schriftliche<br />
Aufzeichnungen über diese<br />
Maschinen erhalten geblieben (sie-<br />
Bild 7: Verschiedene Rechenschieber,<br />
die bis in die 70er-Jahre des<br />
vorigen Jahrhunderts im Einsatz<br />
waren.<br />
LOG IN Heft <strong>Nr</strong>. <strong>133</strong> (2005)
http://homepages.fh-regensburg.de/~wah39067/crnm/Rechner/1623-schickard.jpg<br />
he Bild 8). Die Kepler zugedachte<br />
Maschine fiel einem Brand in Tübingen<br />
zum Opfer, und Wilhelm<br />
Schickards Maschine ist wohl in<br />
den Wirren des Dreißigjährigen<br />
Krieges untergegangen. In den späten<br />
1950er-Jahren gelang es jedoch<br />
Professor Bruno Baron von Freytag<br />
Löringhoff (1912–1996), die Maschine<br />
zu rekonstruieren, die<br />
schließlich im Januar 1960 im Auditorium<br />
Maximum der Universität<br />
Tübingen vorgestellt wurde (siehe<br />
Bild 9).<br />
Weitere Arbeiten Napiers<br />
Neben der Erfindung der Logarithmen,<br />
Logarithmentafeln und<br />
der Rechenstäbchen gilt John Napier<br />
auch als derjenige, der den Dezimalpunkt<br />
eingeführt hat. (Im<br />
deutschsprachigen Raum und in anderen<br />
Teilen Europas wird dagegen<br />
das Dezimalkomma als übliches<br />
Dezimaltrennzeichen benutzt.)<br />
Auch beschäftigte er sich mit<br />
schiefwinkligen sphärischen Dreiecken.<br />
Die nach ihm benannten Napierschen<br />
Regeln, die in englisch<br />
sprechenden Ländern als Nepers’s<br />
pentagon bzw. Neper’s circle bekannt<br />
sind, sollen eine mnemonische<br />
Hilfe sein, alle Beziehungen<br />
zwischen den Winkeln in einem solchen<br />
Dreieck aufzufinden. Allerdings<br />
wurden diese Regeln von ihm<br />
nur unvollkommen in seinem 1619<br />
LOG IN Heft <strong>Nr</strong>. <strong>133</strong> (2005)<br />
C O M P U T E R & A N W E N D U N G E N<br />
posthum erschienenen Buch ,,Mirifici<br />
– Logarithmorum Canonis constructio“<br />
aufgeführt.<br />
Ehrungen<br />
Bild 8:<br />
Skizze Wilhelm<br />
Schickards mit<br />
Anmerkungen<br />
zu der von ihm<br />
entwickelten<br />
Rechenmaschine<br />
in seinem<br />
Brief an Johannes<br />
Kepler aus<br />
dem Jahr 1623.<br />
Zu Ehren John Napiers wurde<br />
eine Maßeinheit der Dämpfung bei<br />
elektrischen und akustischen<br />
Schwingungen Neper (Einheitszeichen:<br />
Np; Formelzeichen: N) genannt.<br />
Sie ist eine dimensionslose<br />
Hilfsmaßeinheit, die als natürlicher<br />
Logarithmus des Verhältnisses<br />
Bild 9: Rechenmaschine (1623)<br />
von Wilhelm Schickard, gebaut für<br />
seinen Freund Johannes Kepler,<br />
auf einer Briefmarke der Bundesrepublik<br />
Deutschland aus dem<br />
Jahr 1973 – ,,350 Jahre Rechenmaschine“.<br />
zweier Amplituden A1 und A2 gemessen<br />
wird:<br />
n = ln A1<br />
A 2<br />
Mittlerweile ist die Einheit Neper<br />
weitgehend durch Bel bzw. Dezibel<br />
(dB) ersetzt worden.<br />
Darüber hinaus wurde mit Nit<br />
(Abkürzung von: Naperian Digit)<br />
bzw. nepit eine dimensionslose Einheit<br />
von Datenmengen geschaffen.<br />
Im Gegensatz zum Bit hat das Nit<br />
den natürlichen und nicht den dualen<br />
Logarithmus als Grundlage,<br />
d. h. es hat die Basis e und nicht die<br />
Basis 2. Es gilt dabei:<br />
ln(p) nit = log2(p) bit<br />
Das bedeutet, dass 1 nit ungefähr<br />
1,44 bit entspricht:<br />
p nit = log2(p)<br />
ln(p)<br />
p<br />
bit = bit ≈ 1,44 ⋅ p bit<br />
ln 2<br />
Aber auch die Einheit Nit ist mittlerweile<br />
nicht mehr gebräuchlich.<br />
Dagegen ist das Andenken an<br />
John Napier in Edinburgh noch lebendig:<br />
Die Napier University (http://<br />
www.napier.ac.uk/), eine technischnaturwissenschaftlich<br />
orientierte<br />
Universität mit vier Fakultäten, besitzt<br />
unter anderem einen Campus<br />
bei Merchiston Castle, dem Geburtsund<br />
Sterbeort John Napiers. Das<br />
Grab John Napiers existiert immer<br />
noch und kann in der St. Cuthbert’s<br />
Church in Edinburgh besucht werden.<br />
Bernhard Koerber<br />
Literatur und Internetquellen<br />
Hempel, T.: John Napier – Rechnen mit den<br />
Rechenstäbchen.<br />
http://www.tinohempel.de/info/mathe/napier/<br />
napier.htm [Stand: April 2005]<br />
History of Napier University:<br />
http://www.news.napier.ac.uk/background/<br />
bkInfo6.htm [Stand: April 2005]<br />
O’Connor, J. J.; Robertson, E. F.: John Napier.<br />
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/<br />
Mathematicians/Napier.html<br />
[Stand: April 2005]<br />
Topolewski, P.: Mathematische Zahlen und<br />
Rechenhilfen – Mein Beitrag zu Jugend<br />
forscht / Schüler experimentieren 2003.<br />
http://www.topolewski.de/pascal/<br />
jufo2003/index.htm<br />
[Stand: April 2005 – dies ist die Arbeit eines<br />
damals 9-jährigen Schülers!]<br />
Vorndran, E. P.: Entwicklungsgeschichte des<br />
Computers. Berlin; Offenbach: VDE-Verlag,<br />
21986, S. 23–25.<br />
75
Rezension<br />
Wagenknecht, Christian: Algorithmen<br />
und Komplexität. Reihe ,,Informatik<br />
Interaktiv“. München<br />
u. a.: Fachbuchverlag Leipzig im<br />
Carl-Hanser-Verlag, 2003. ISBN 3-<br />
446-22314-2. 180 S.; EUR 14,90.<br />
Um es vorweg<br />
zu nehmen:<br />
Das Buch<br />
ist für Informatiklehrerinnen<br />
und -lehrer gut<br />
geeignet, die<br />
sich über Problemlösungsstrategien,Algorithmen<br />
und<br />
deren Zeitund<br />
Speicherkomplexität informieren<br />
möchten – unabhängig davon,<br />
welche Programmiersprachen sie<br />
im eigenen Unterricht einsetzen.<br />
Von besonderem Gewinn dürfte<br />
das Buch für diejenigen Informatik-Lehrkräfte<br />
sein, die funktionale<br />
Modellierung – eine der grundlegenden<br />
Modellierungstechniken<br />
nach den Einheitlichen Prüfungsanforderungen<br />
in der Abiturprüfung<br />
Informatik der KMK – in ihrem<br />
Unterricht thematisieren, da die<br />
Programmbeispiele in SCHEME formuliert<br />
sind. Zahlreiche Anregungen<br />
– auch zum didaktisch-methodischen<br />
Herangehen – können dem<br />
Buch und der Website des Autors<br />
zum Buch entnommen werden und<br />
den eigenen Unterricht bereichern.<br />
Im ersten Abschnitt geht es um<br />
Grundbegriffe und -verfahren im<br />
Zusammenhang mit dem Zeit- und<br />
Speicheraufwand von Algorithmen.<br />
Dabei wird herausgearbeitet, dass<br />
der funktionale Zusammenhang<br />
zwischen der Problemgröße und<br />
dem Aufwand zu ermitteln ist und<br />
nicht einzelne Rechenzeiten.<br />
Im zweiten Abschnitt wird erläutert,<br />
was ein effizienter Algorithmus<br />
ist. Polynomialer und exponentieller<br />
Aufwand werden verglichen,<br />
konkrete Algorithmen werden analysiert<br />
sowie die Groß-O-Notation<br />
und andere asymptotische Aufwandsordnungen<br />
definiert. Hier<br />
und an vielen anderen Stellen empfiehlt<br />
der Autor, Sachverhalte aus-<br />
76<br />
F O R U M<br />
zuprobieren und zu experimentieren<br />
(z. B. unter Verwendung eines<br />
Tabellenkalkulationssystems oder<br />
eines Computeralgebrasystems).<br />
Das Bild 2.1 ,,Vergleich von Aufwänden“<br />
(S. 31) dürfte bei einer<br />
Nachauflage verzichtbar sein, da<br />
mehrere Funktionen nur für sehr<br />
kleine x verglichen werden, was bei<br />
Aufwandsbetrachtungen eine eher<br />
uninteressante Angelegenheit ist.<br />
Im dritten Abschnitt werden mathematische<br />
Hilfsmittel zur Approximation<br />
von Funktionen und<br />
zum Lösen von Rekursionsgleichungen<br />
bereitgestellt, die in den<br />
nachfolgenden Abschnitten genutzt<br />
werden.<br />
Im vierten Abschnitt geht es um<br />
das Teile-und-herrsche-Verfahren<br />
(Divide-and-conquer-Verfahren),<br />
eine der fundamentalen Ideen der<br />
Informatik. Der Autor arbeitet heraus,<br />
dass das Befolgen von Entwurfsmethoden<br />
für Algorithmen<br />
das Ableiten von Aufwandsaussagen<br />
unterstützt. Quicksort, Mergesort,<br />
binäres Suchen, Multiplikation<br />
großer ganzer Zahlen und schnelle<br />
Matrixmultiplikation werden genauer<br />
untersucht. Der Zusammenhang<br />
zwischen dem Teile-und-herrsche-Verfahren<br />
und der Rekursion<br />
wird dargestellt.<br />
Im fünften und sechsten Abschnitt<br />
wird das Suchen anhand des Rucksack-<br />
und des Rundreiseproblems,<br />
für die es sehr praktische Anwendungen<br />
gibt, thematisiert. Vor- und<br />
Nachteile der einzelnen Ansätze<br />
werden dargestellt und begründet.<br />
Eine nichtdeterministische Lösung<br />
wird skizziert und damit der zehnte<br />
Abschnitt vorbereitet. Dabei zeigt<br />
sich, dass der Vorteil der Integration<br />
des Nichtdeterminismus in der Verbesserung<br />
der kognitiven Effizienz<br />
und nicht in einer verbesserten Zeiteffizienz<br />
der Lösungsalgorithmen<br />
liegt. Zur kognitiven Effizienz hätte<br />
sich der Rezensent weitergehende<br />
Ausführungen gewünscht.<br />
Im siebten und achten Abschnitt<br />
werden mit dem dynamischen Programmieren<br />
und den Greedy-Algorithmen<br />
interessante und wichtige<br />
Problemlösungsmethoden vorgestellt,<br />
untersucht und angewandt.<br />
Viele Ideen, z. B. memoizing, können<br />
im Informatikunterricht an<br />
Schulen aufgegriffen werden.<br />
(Beim Memoizing wird, bevor eine<br />
bestimmte Berechnung durchge-<br />
führt wird, überprüft, ob der zu ermittelnde<br />
Wert schon vorhanden<br />
ist. Ist dies der Fall, wird er genommen,<br />
andernfalls wird er berechnet<br />
und für eventuellen späteren Bedarf<br />
gespeichert. Dieses Verfahren<br />
ist – wie im Buch gezeigt – sowohl<br />
für einfache Berechnungen als auch<br />
bei komplexen Problemlösungen<br />
anwendbar.)<br />
Im neunten Abschnitt wird das<br />
Anwenden von Zufall zum Problemlösen<br />
dargestellt. Ein Zufallsgenerator<br />
wird beschrieben, und damit werden<br />
zugleich die in vielen Programmiersprachen<br />
vorhandenen Funktionen<br />
für Pseudozufallszahlen transparent<br />
gemacht. Die dann bearbeiteten<br />
Beispiele sind p-Berechnung durch<br />
,,Zufallsregen“, probabilistischer<br />
Quicksort (wobei die dort gemachte<br />
Aussage zum schlechtesten Fall unvollständig<br />
ist), Äquivalenz zweier<br />
Multimengen und Primzahltests.<br />
Im zehnten Abschnitt wird das P-<br />
NP-Problem beleuchtet. Denjenigen,<br />
die sich dazu sachkundig machen<br />
möchten, kann die anschauliche<br />
Darstellung entlang eines ,,roten<br />
Fadens“ sehr empfohlen werden.<br />
Falls die Gleichung P = NP wider<br />
Erwarten doch bewiesen werden<br />
kann, so hätte die Welt der<br />
Wissenschaft eine Sensation und<br />
die Schule ein Thema, das sie nicht<br />
ignorieren dürfte.<br />
Im elften Abschnitt werden als<br />
Ausblick effiziente Näherungsalgorithmen<br />
vorgestellt. Diese Algorithmen<br />
können dann eingesetzt werden,<br />
wenn es zur exakten Lösung<br />
eines bestimmten Problems nur<br />
hinsichtlich ihres Aufwands<br />
schlechte Algorithmen gibt. Zu den<br />
Näherungsalgorithmen gehören das<br />
Nutzen von Heuristiken, der Sintflut-Algorithmus,<br />
das so genannte<br />
DNA computing, evolutionäre Algorithmen<br />
und neuronale Netze.<br />
Das lesenswerte Buch gibt einen<br />
guten Überblick über ein theoretisches<br />
Thema mit Praxisrelevanz. Es<br />
regt zum Nachdenken und zur Arbeit<br />
am Computer an. Die Kombination<br />
von Buch und Website zum<br />
Buch (http://www.inf.hs-zigr.de/<br />
~wagenkn/AuK-Buch/) hat dabei<br />
ihren besonderen Reiz.<br />
Michael Fothe<br />
LOG IN Heft <strong>Nr</strong>. <strong>133</strong> (2005)
Hinweise auf<br />
Bücher<br />
Bibliografien, Lexika<br />
Computerworld (Hrsg.): Lexikon<br />
der aktuellen Fachbegriffe aus Informatik<br />
und Telekommunikation.<br />
Zürich: vdf Hochschulverlag an der<br />
ETH Zürich, 8 2005. ISBN 3-7281-<br />
2994-1. 509 S.; EUR 19,20.<br />
Wer weiß<br />
schon sofort,<br />
was beispielsweise<br />
ICAP<br />
bedeutet oder<br />
was Scorm ist?<br />
In solchen Fällen<br />
sind Lexika<br />
als Hilfe gefragt,<br />
die aktuell<br />
sind und regelmäßigfortgeschrieben<br />
werden. Das hier vorliegende<br />
Lexikon gehört zu diesen<br />
sinnvollen Hilfen, mit denen sich<br />
alle Interessierten schnell und zuverlässig<br />
informieren können. Auf<br />
509 Seiten werden rund 650 aktuelle<br />
Begriffe aus Informatik, Telekommunikation<br />
und angrenzenden<br />
Gebieten ausführlich und übersichtlich<br />
besprochen. Die Redaktion<br />
der wöchentlich erscheinenden<br />
Zeitung Computerworld hat seit<br />
1991 in jeder Ausgabe entsprechende<br />
Begriffe erklärt, die bereits sieben<br />
Mal auch in Buchform herausgegeben<br />
wurden. Für die nun vorliegende<br />
8. Auflage wurden sämtliche<br />
Begriffe grundlegend überarbeitet,<br />
etliche veraltete Einträge<br />
eliminiert und rund 200 neue Stichwörter<br />
einschließlich ihrer Erklärungen<br />
hinzugefügt. Darüber hinaus<br />
bietet die Redaktion unter<br />
http://www.computerworld.ch/<br />
lexikon/begriffe.php<br />
weitere aktuelle Fachbegriffe an.<br />
Nicht nur die handliche Form des<br />
Lexikons, sondern eben auch sein<br />
Inhalt machen es eigentlich auf keinem<br />
Schreibtisch entbehrlich!<br />
(Übrigens: ICAP bedeutet Internet<br />
Content Adaptation Protocol<br />
und ist ein offenes Protokoll, mit<br />
dem – kurz gesagt – die Kommuni-<br />
LOG IN Heft <strong>Nr</strong>. <strong>133</strong> (2005)<br />
F O R U M<br />
kation zwischen Inhaltsträgern und<br />
den Internet-Zugangsgeräten vereinfacht<br />
und sicherer gestaltet werden<br />
soll. Und Scorm ist die Abkürzung<br />
von Sharable Content Object<br />
Reference Model, ein Standard, mit<br />
dem die Erstellung und der Aufbau<br />
von E-Learning-Kursen vereinheitlicht<br />
werden soll.)<br />
Weiterführende Literatur<br />
Nölle, J.: Voice over IP – Grundlagen,<br />
Protokolle, Migration. Berlin;<br />
Offenbach: VDE Verlag, 2 2005.<br />
ISBN 3-8007-2850-8. 241 S.; EUR<br />
24,00.<br />
Daten- und<br />
Telefonienetze<br />
wachsen schon<br />
seit geraumer<br />
Zeit zusammen.<br />
Zugleich<br />
beginnen auch<br />
die Grenzen<br />
zwischen der<br />
Hardware von<br />
Computer- und<br />
Telefoniesystemen<br />
zu verschwimmen.<br />
Deshalb liegt der Gedanke<br />
nahe, die Telefoniedienste<br />
vollständig in Computernetze zu integrieren.<br />
Vor allem sind durch die<br />
Sprachübertragung über IP-Netzwerke,<br />
vor allem übers Internet, bei<br />
den Gesprächskosten große Einsparpotenziale<br />
vorhanden. Die so<br />
genannte Sprach-Daten-Konvergenz<br />
bietet neue Chancen, stellt<br />
aber auch neue Anforderungen an<br />
das Wissen über den Einsatz und<br />
den technologischen Hintergrund.<br />
In dem vorliegenden Buch werden<br />
hierzu die Grundlagen vorgestellt.<br />
Darüber hinaus behandelt der Autor<br />
Themen wie beispielsweise<br />
Sprachcodierung, Protokolle, Standards<br />
oder die Anbindung an öffentliche<br />
Telefonnetze. Außerdem<br />
werden u. a. alternative Technologien,<br />
Sicherheitsverfahren und Firewalls<br />
sowie Qualitätsanforderungen<br />
vorgestellt. Das Buch ergänzende<br />
Informationen sind unter<br />
http://www.voip-info.de/<br />
zu finden.<br />
Fazit: Wer sich über das aktuelle<br />
Thema Voice over IP gründlich informieren<br />
möchte, ist mit der Lektüre<br />
dieses Buchs gut beraten.<br />
koe<br />
Hinweise auf<br />
Zeitschriften<br />
Weiterführende Zeitschriften<br />
FIfF-Kommunikation. Herausgeber:<br />
Forum InformatikerInnen für<br />
Frieden und gesellschaftliche Verantwortung<br />
e. V. (FIfF). Erscheinungsweise:<br />
vierteljährlich. Seitenumfang:<br />
64 Seiten. ISSN 0938-<br />
3476. Heftpreis: EUR 5,00.<br />
URL: http://rayserv.upb.de/fiff/<br />
veroeffentlichungen/<br />
fiffko-themen.html<br />
Die Beiträge der Zeitschrift<br />
FIfF-Kommunikation, die seit 1983<br />
besteht, sollen die Diskussion über<br />
die Verantwortung von Informatikerinnen<br />
und Informatikern anregen<br />
und die interessierte Öffentlichkeit<br />
darüber informieren. Jedes<br />
Heft ist einem Thema gewidmet. So<br />
wurden beispielsweise schon Themen<br />
wie ,,Computer und Demokratie“<br />
(Heft 4/1996), ,,Verletzlichkeit<br />
der Informationsgesellschaft“ (Heft<br />
3/2000) oder ,,Software Patente“<br />
(Heft 4/2003) behandelt.<br />
Das aktuelle Heft <strong>Nr</strong>. 1/2005<br />
steht unter dem Thema ,,Informatik<br />
im Osten“ und enthält wesentliche<br />
Beiträge der Tagung ,,Informatik in<br />
der DDR – eine Bilanz“ (siehe<br />
auch S. 4–5 in diesem Heft).<br />
Das Heft enthält<br />
unter anderem<br />
das Einführungsreferat<br />
von Professor<br />
Friedrich Naumann,,,Rechenkunst‘<br />
und<br />
Rechenmaschinen<br />
in früher<br />
sächsischer<br />
Zeit“ (Seiten<br />
26–34), in dem<br />
ein Bogen vom Mittelalter bis zu den<br />
1960er-Jahren geschlagen wird, wobei<br />
dieser Beitrag mit zwölf instruktiven<br />
historischen Bildern versehen<br />
worden ist. In einem weiteren Beitrag<br />
zeigen Christine Krause und<br />
Dieter Jacobs auf, welche Entwicklung<br />
die Rechentechnik nach dem<br />
Zweiten Weltkrieg in der DDR ge-<br />
77
nommen hat (Seiten 35–41). Diese<br />
Entwicklung hatte bereits Tradition,<br />
denn schon im Jahr 1938 waren drei<br />
Viertel der Büromaschinenindustrie<br />
Deutschlands auf dem Gebiet der<br />
heutigen neuen Bundesländer konzentriert!<br />
Weitere Beiträge in FIfF-Kommunikation<br />
1/2005 sind ,,Informatik<br />
an DDR-Hochschulen“ von Franz<br />
Stuchlik, ,,Rahmenbedingungen für<br />
Computerentwicklungen im Bereich<br />
des RGW“ von Gerhard Merkel,<br />
,,Rechentechnik in der DDR“<br />
von Simon Donig und ,,Die<br />
Schreib- und Rechentechnik im Industriemuseum<br />
Chemnitz“ von<br />
Jörg Feldkamp.<br />
Insgesamt bietet dieses Heft eine<br />
Sichtweise von Aktivitäten in der<br />
ehemaligen DDR, die den meisten<br />
Interessierten aus den alten Bundesländern<br />
immer noch unbekannt<br />
sein dürfte. Allein schon deshalb ist<br />
dieses Heft allen zu empfehlen, die<br />
auch den Leistungen der Menschen<br />
in der DDR ohne Vorurteile begegnen<br />
möchten.<br />
koe<br />
Medien<br />
Das Wissen der Welt<br />
In einem Beitrag für LOG IN<br />
schrieb Peter Diepold bereits 1994,<br />
dass das Internet so etwas wie ein<br />
,,Weltgehirn“ sei (Heft 5–6/1994, S.<br />
13–18) und mit ihm das Wissen der<br />
Welt repäsentiert würde. Wer allerdings<br />
die Entwicklung in den letzten<br />
zehn Jahren verfolgt hat, der kann<br />
auch durchaus zu dem Schluss kommen,<br />
das Internet repräsentiere den<br />
Datenmüll der Welt. Doch – und das<br />
ist unbestreitbar – es gibt auch glänzende<br />
Perlen in diesem Datenmüll,<br />
und dazu gehört Wikipedia.<br />
Die Online-Enzyklopädie Wikipedia<br />
in LOG IN erneut vorzustellen,<br />
hieße, alle Leserinnen und Leser<br />
zu langweilen, denn dieses Lexikon<br />
wurde hier schon wiederholt<br />
besprochen (z. B. in LOG IN Heft<br />
125/2003, S. 73 und Heft 127/2004, S.<br />
67). In Wikipedia repräsentiert sich<br />
78<br />
F O R U M<br />
mittlerweile<br />
tatsächlich das<br />
Wissen der<br />
Welt. Ende<br />
April 2005 wies<br />
die deutsche<br />
Version (http://<br />
de.wikipedia<br />
.org/) über<br />
220000 Artikel<br />
auf, die englische<br />
(http://en<br />
.wikipedia.org/) sogar über 540000<br />
Beiträge.<br />
Nachdem im Herbst 2004 die erste<br />
CD-ROM mit den Inhalten der Wikipedia<br />
im Rahmen der Digitalen Bibliothek<br />
herausgebracht wurde (siehe<br />
LOG IN Heft 131–132/2004, S.<br />
109), liegt nun eine Ausgabe vom<br />
Frühjahr 2005 zum Preis von 9,90<br />
Euro vor (ISBN 3-89853-020-5).<br />
Die neue Ausgabe besteht aus einer<br />
DVD und einer CD-ROM, wobei<br />
Windows, Mac OS X, Linux oder<br />
LAMPPIX genutzt werden können.<br />
Darüber hinaus liegen die Daten<br />
von Wikipedia auch in PDA-Formaten<br />
(Mobipocket und TomeRaider)<br />
vor. Die Vorteile gegenüber der Online-Version<br />
liegen auf der Hand:<br />
keine Online-Kosten, höhere Geschwindigkeit,<br />
komplexe Volltextsuche<br />
mit Wildcards über den gesamten<br />
Datenbestand, Sortieren und Filtern<br />
z. B. von rund 35000 Personendaten,<br />
Verwalten eigener Anmerkungen,<br />
besseres Layout im Ausdruck<br />
u. v. a. m.<br />
koe<br />
Info-Markt<br />
LOG-IN-Newsletter<br />
Seit April 2005 steht für alle Personen,<br />
die an der informatischen<br />
Bildung interessiert sind, der online<br />
zu bestellende LOG-IN-Newsletter<br />
zu Verfügung.<br />
Der Newsletter wird kostenfrei<br />
angeboten und kann über die Internetpräsenz<br />
des LOG IN Verlags unter<br />
folgender Adresse abonniert<br />
werden:<br />
http://www.log-in-verlag.de/<br />
newsletter.htm<br />
Unterstützt wird die Redaktion<br />
bei der Gestaltung des Newsletters<br />
von der Arbeitsgruppe ,,Didaktik<br />
der Informatik und E-Learning“<br />
des Fachbereichs Elektrotechnik<br />
und Informatik der Universität Siegen.<br />
Monatlich stellt die LOG-IN-Redaktion<br />
Neuigkeiten rund um die<br />
Schulinformatik zusammen und<br />
gibt Ausblicke auf die nächsten<br />
LOG-IN-Hefte. Ergänzend zu den<br />
LOG-IN-Heften wird von Zeit zu<br />
Zeit ein interessantes Unterrichtsbeispiel<br />
vorgestellt. Hinweise auf<br />
unterrichtsrelevante Software runden<br />
die Inhalte des Newsletters ab.<br />
jm<br />
LOG IN Heft <strong>Nr</strong>. <strong>133</strong> (2005)
Wettbewerb für Unterrichtsbeispiele<br />
anlässlich der 11. GI-Tagung ,,Informatik und Schule 2005“<br />
vom 28. bis 30. September 2005 an der TU Dresden<br />
Gesucht werden Unterrichtsbeispiele<br />
zum Informatikunterricht<br />
der Sekundarstufe I<br />
(Klassen 5 bis 10)<br />
allgemeinbildender Schulen. Darin<br />
müssen informatische Fachkonzepte<br />
explizit thematisiert<br />
werden. Die Beschreibung eines<br />
Werkzeugs oder eines Mediums<br />
genügt nicht; ausschließlich zitierte<br />
Literatur oder angegebene<br />
Internetseiten können ebenso<br />
nicht in die Bewertung einbezogen<br />
werden.<br />
x Im Beitrag soll über die<br />
Durchführung des dargestellten<br />
Unterrichtsbeispiels in einer<br />
Lerngruppe berichtet werden,<br />
wobei auch die Darstellung<br />
von Unterrichtsmisserfolgen<br />
bei entsprechender Analyse<br />
zu preiswürdigen Arbeiten<br />
führen kann. Darüber hinaus<br />
soll der Kontext, für den der<br />
Vorschlag gedacht ist, mög-<br />
Moore’sches Gesetz<br />
und kein Ende<br />
Vor 40 Jahren, am 19. April<br />
1965, erschien in der US-amerikanischen<br />
Fachzeitschrift Electronics<br />
ein Artikel, in dem der Intel-<br />
Mitbegründer Gordon E. Moore<br />
LOG IN Heft <strong>Nr</strong>. <strong>133</strong> (2005)<br />
F O R U M<br />
lichst genau beschrieben werden<br />
(Schulart, Jahrgangsstufe,<br />
Unterrichtsfach etc.).<br />
Die besten drei Arbeiten werden<br />
prämiiert!<br />
Die Einreichung der Wettbewerbsbeiträge<br />
muss<br />
bis zum 1. Juni 2005<br />
in elektronischer Form erfolgen.<br />
Eingereichte Arbeiten können<br />
außerdem zur Tagung als Poster<br />
vorgestellt werden. Ist dies beabsichtigt,<br />
bitte über das entsprechende<br />
Anmeldeformular ankündigen.<br />
Einreichung per E-Mail an:<br />
infos05@inf.tu-dresden.de<br />
Einreichung per Post an:<br />
TU Dresden<br />
Fakultät Informatik<br />
– INFOS’05 –<br />
01062 Dresden StF<br />
Am Rande bemerkt …<br />
eine Aufsehen erregende These formulierte:<br />
Etwa alle 24 Monate wird<br />
sich die Zahl der Transistoren auf<br />
einem Chip verdoppeln und gleichzeitig<br />
werden die Kosten sinken.<br />
In diesem Jahr, vier Dekaden später,<br />
ist Moores These längst bewiesen<br />
und steht als Moore’sches Gesetz<br />
LOG-IN-Service<br />
Mit dem LOG-IN-Service bietet die<br />
Redaktion seit dem Heft 4/1991 regelmäßig<br />
Software, Unterrichtsmaterialien<br />
bzw. besondere Informationen kostenfrei<br />
für alle Abonnenten an.<br />
LOG-IN-Service im Internet<br />
Der LOG-IN-Service ist auf der Internetpräsenz<br />
des Verlags zu finden:<br />
http://www.log-in-verlag.de/<br />
Der Service ist über die Schaltfläche<br />
,,Service“ zu erreichen. Klicken Sie in<br />
der Jahrgangszeile einen Jahrgang an,<br />
um die Dateiliste des Angebots zu sehen.<br />
Wenn Sie dann beispielsweise mit der<br />
rechten Maustaste die von Ihnen ausgewählte<br />
Datei anklicken, können Sie die<br />
Datei unter der Option ,,Ziel speichern<br />
unter …“ auf Ihren Rechner laden.<br />
Die Internetquellen, auf die in jedem<br />
Heft verwiesen wird, finden Sie ebenfalls<br />
unter dem ,,Service“.<br />
Service zum Heft <strong>133</strong><br />
Im LOG-IN-Service dieses Hefts sind<br />
verfügbar:<br />
x Zum Beitrag ,,Interaktives Modellieren<br />
im virtuellen Raum“ (S. 55–61)<br />
die Abbildungen als Arbeitsblätter.<br />
x Zum Beitrag ,,Komponentenbasierte<br />
Entwicklung dynamischer HTML-<br />
Seiten“ (S. 62–66) die vorgestellten<br />
Programmteile.<br />
Computer-Knobelei<br />
Aus redaktionellen Gründen<br />
muss leider die Computer-Knobelei<br />
in diesem Heft entfallen.<br />
Wir bitten um Verständnis!<br />
Red.<br />
synonym für die Entwicklung der<br />
Computer. So wurden aus den<br />
2300 Transistoren des ersten Mikroprozessors<br />
der Welt, dem Intel<br />
4004 aus dem Jahr 1971, mittlerweile<br />
592000000 elektronische<br />
Schalter, die auf einem einzigen<br />
Chip (Itanium 2) Platz finden. koe<br />
79
LOG OUT<br />
Von der Wiege<br />
bis zum Grabe:<br />
Multimedia<br />
Medienpädagogen haben Grund<br />
zum Jubeln: Endlich besteht die<br />
Möglichkeit, nicht nur schon Föten<br />
an das multimediale Leben mit<br />
Computern zu gewöhnen, sondern<br />
es gibt auch seit vorigem Jahr für<br />
alle Toten die Gelegenheit, sich<br />
multimedial aus dem Jenseits zu<br />
präsentieren.<br />
Heft 134 – 25. Jg. (2005)<br />
Thema: Autonome intelligente<br />
Systeme<br />
Koordination: Monika Müllerburg<br />
und Gabi Theidig<br />
Thema von Heft 135:<br />
x Standards in der informatischen<br />
Bildung<br />
Thema von Heft 136/137:<br />
x Gesellschaftliche Themen im<br />
Unterricht<br />
80<br />
Vorschau<br />
F O R U M<br />
Mitte 2004 wurde dem kalifornischen<br />
Erfinder und Werbefachmann<br />
Richard M. Barrows das US-<br />
Patent 2004/85337 zur Herstellung<br />
multimedialer Grabsteine erteilt.<br />
Die Grabsteine sind jeweils mit einem<br />
Flachbildschirm und einem<br />
Computer versehen. Der Computer<br />
enthält Videobotschaften, durch die<br />
ein Verstorbener zu Friedhofsbesucher<br />
sprechen kann. Wie bei einem<br />
Fahrkartenautomaten können auf<br />
dem berührungsempfindlichen Monitor<br />
die Botschaften gesteuert bzw.<br />
abgerufen werden. Die Stromversorgung<br />
der elektronischen Grabsteine<br />
erfolgt über das Lichtnetz<br />
des Friedhofs. Damit sich die Präsentationen<br />
der Toten nicht gegenseitig<br />
stören, können drahtlose Kopfhörer<br />
verwendet werden. koe<br />
Multimediale<br />
Grabsteine –<br />
hier sind sie zu<br />
erhalten!<br />
http://www.talkingtombstone.com/<br />
Mitarbeit der Leserinnen<br />
und Leser<br />
Manuskripte von Leserinnen<br />
und Lesern sind willkommen<br />
und sind an die Redaktionsleitung<br />
in Berlin –<br />
am besten als Anhang per E-<br />
Mail – zu senden. Auch unverlangt<br />
eingesandte Manuskripte<br />
werden sorgfältig geprüft.<br />
Autorenhinweise werden<br />
auf Anforderung gern<br />
zugesandt.<br />
Veranstaltungskalender<br />
4. bis 7. Juli 2005:<br />
WCCE 2005 – 8 th IFIP World Conference<br />
on Computers in Education<br />
Kapstadt (Republik Südafrika)<br />
Information:<br />
http://www.sbs.co.za/wcce2005/<br />
Die letzte WCCE fand 2001 statt;<br />
die nunmehr angekündigte bietet<br />
Gelegenheit, sich mit den neuen<br />
weltweiten Entwicklungen auseinanderzusetzen.<br />
19. bis 21. September 2005:<br />
35. Jahrestagung der Gesellschaft<br />
für Informatik e.V. (GI)<br />
an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität<br />
Bonn<br />
Information:<br />
http://www.informatik2005.de/<br />
Die in diesem Jahr unter dem<br />
Motto ,,Informatik LIVE!“ stehende<br />
Jahrestagung der Gesellschaft<br />
für Informatik präsentiert traditionell<br />
das breite Spektrum aktueller<br />
Entwicklungen in der Informatik.<br />
Angesprochen sind Fachleute aus<br />
Wissenschaft und Praxis, die sich einen<br />
fundierten Überblick über die<br />
wichtigsten aktuellen Trends in der<br />
Informatik verschaffen möchten.<br />
Die Tagung besteht aus Plenarveranstaltungen<br />
und Workshops.<br />
Darüber hinaus ist im Rahmen dieser<br />
Tagung ein attraktives Rahmenprogramm<br />
für Studierende geplant,<br />
das sich auch an Auszubildende des<br />
IT-Sektors wendet.<br />
28. bis 30. September 2005:<br />
INFOS 2005<br />
an der Technischen Universität<br />
Dresden<br />
Information:<br />
http://www.infos05.de/<br />
Ziele, Schwerpunkte und Struktur<br />
der Tagung sind bereits ausführlich<br />
in LOG IN, <strong>Nr</strong>. 130 (2004), S. 7,<br />
vorgestellt worden.<br />
LOG IN Heft <strong>Nr</strong>. <strong>133</strong> (2005)
Michael Kerres<br />
Multimediale und<br />
telemediale<br />
Lernumgebungen<br />
Konzeption und Entwicklung<br />
2., vollständig überarbeitete<br />
Auflage 2001<br />
412 Seiten<br />
€ 39,80<br />
ISBN 3-486-25055-8<br />
Die Neuauflage wurde komplett<br />
überarbeitet und trägt<br />
besonders der aktuellen<br />
Entwicklung im Bereich des<br />
internetgestützten Lernens<br />
Rechnung.<br />
Rolf Schulmeister<br />
Grundlagen hypermedialer<br />
Lernsysteme<br />
Theorie – Didaktik – Design<br />
3., korrigierte Auflage 2002<br />
504 Seiten<br />
€ 44,80<br />
ISBN 3-486-25864-8<br />
„... überdurchschnittlich gut<br />
und kompetent.“<br />
Prof. Dr. W. F. Finke, Universität<br />
Konstanz<br />
Ullrich Dittler (Hrsg.)<br />
E-Learning<br />
Einsatzkonzepte und<br />
Erfolgsfaktoren des Lernens mit<br />
interaktiven Medien<br />
2., überarbeitete<br />
und ergänzte Auflage 2003<br />
382 Seiten. Mit CD-ROM<br />
€ 44,80<br />
ISBN 3-486-27398-1<br />
Nahezu alle Beiträge des erfolgreichen<br />
Buches wurden für die<br />
zweite Auflage von den Autoren<br />
kritisch geprüft und überarbeitet.<br />
U. Dittler (Hrsg.)<br />
E-Learning<br />
Einsatzkonzepte und Erfolgsfaktoren des<br />
Lernens mit interaktiven Medien<br />
2. Auflage<br />
Oldenbourg<br />
Wissenschaftsverlag<br />
Rosenheimer Straße 145<br />
D-81671 München<br />
Telefon 0 89 / 4 50 51-0, Fax 0 89 / 4 50 51-204<br />
Weitere Informationen: www.oldenbourg-verlag.de<br />
Oldenbourg<br />
Oldenbourg<br />
Neuerscheinung<br />
Oldenbourg!<br />
Neuerscheinung<br />
Rolf Schulmeister<br />
Lernplattformen für<br />
das virtuelle Lernen<br />
Evaluation und Didaktik<br />
2003. 295 Seiten<br />
€ 49,80<br />
ISBN 3-486-27250-0<br />
Das neue Buch von<br />
Schulmeister kombiniert die<br />
aktuelle Forschung zur<br />
Evaluation von<br />
Lernplattformen mit didaktischen<br />
Reflexionen zu deren<br />
Einsatz in der virtuellen<br />
Lehre und eignet sich so<br />
auch als praktischer<br />
Leitfaden.<br />
Rolf Schulmeister<br />
Virtuelle Universität –<br />
Virtuelles Lernen<br />
mit einem Kapitel von<br />
Martin Wessner<br />
2001. 480 Seiten<br />
€ 59,80<br />
ISBN 3-486-25742-0<br />
Das Buch zu einem hochacktuellen<br />
Thema, dessen<br />
Stellenwert in der<br />
Gesellschaft täglich<br />
zunimmt.<br />
Jürgen Handke<br />
Multimedia im<br />
Internet<br />
Konzeption und<br />
Implementierung<br />
2003. 394 Seiten<br />
€ 44,80<br />
ISBN 3-486-27217-9<br />
„Multimedia im Internet“<br />
richtet sich an Internet-Entwickler:<br />
programmierende<br />
Entwickler und Projektmanager,<br />
die über die verschiedenen<br />
multimedialen<br />
Elemente verfügen und sie<br />
nun zu komplexen Systemen<br />
zusammenstellen.
Brockhaus-Qualität bei Inhalt und Technik<br />
Das Medium Computer eröffnet völlig neue und faszinierende Möglichkeiten der Informationsbeschaffung.<br />
Deshalb ist die gesamte Substanz der Brockhaus Enzyklopädie ent sprechend<br />
aufbereitet und in eine Software gebettet, die diese neuen Möglichkeiten<br />
voll erschließt.<br />
Lesen am Bildschirm<br />
Der Bildschirmaufbau ist sehr übersichtlich und macht das Navigieren<br />
zum Kinderspiel. Die Artikel sind lesefreundlich aufbereitet und<br />
lange Artikel sind gegliedert. Ist Ihnen ein Begriff unbekannt, genügt<br />
ein Doppelklick auf das Wort und Sie erhalten den entsprechenden<br />
Artikel.<br />
Bequeme Suche<br />
Die professionellen und sehr benutzerfreundlichen Suchmöglichkeiten<br />
lassen keine Wünsche offen und fi nden alle Artikel zu<br />
einem Thema, auch wenn Ihr Suchbegriff nur<br />
am Rande erwähnt wird. Treffer können Sie<br />
sich z.B. alphabetisch oder nach Relevanz<br />
bewertet anzeigen lassen.<br />
Sehen, hören, erleben<br />
Vielfältige multimediale Elemente machen<br />
das Nachschlagen zum Erlebnis. Viele<br />
Videos und Animationen veranschaulichen<br />
Vorgänge und Prozesse oder zeigen historische<br />
Ereignisse. Ein besonderer Leckerbissen<br />
sind die 360°-Panoramen von 82<br />
bedeutenden Stätten. Insgesamt 13 Stunden<br />
Ton lassen keine Langeweile aufkommen. 1)<br />
1) Multimedia-Elemente nur im Medienpaket<br />
System: Pentium II 350 MHz, WIN 98/ME/2000/XP, 64 MB RAM, 16_Bit-Soundkarte, Grafi kkarte 800x600 bei 65.000 Farben, 20fach CD-ROM- bzw. DVD-Laufwerk<br />
Vor- und Nachname<br />
Senden Sie mir folgende Artikel. Schulen, staatl. Institutionen, Lehrer (Schul-<br />
Ja! nachweis) werden gegen Rechnung beliefert; Gewerbe, Schüler, Studenten,<br />
Schule<br />
Privatpersonen gegen Nachnahme (jeweils Warenwert + Versandkosten)<br />
Unsere exklusiven Mehrplatz-Lizenzen für Schulen<br />
Straße<br />
Menge - Produkt 4-Platz-Lizenz Netz<br />
__ Brockhaus Enzyklopädie digital - Basispaket (Text-Bild*) MP 4<br />
MP 4<br />
999,00<br />
PLZ / Ort<br />
Für Schulen. Ohne Medienpaket - bitte separat bestellen<br />
Menge - Produkt 8-Platz-Lizenz Netz MP 8<br />
Telefon-<strong>Nr</strong>. Kunden-<strong>Nr</strong>. (falls bekannt)<br />
__ Brockhaus Enzyklopädie digital - Basispaket (Text-Bild*) MP 8<br />
Für Schulen. Inklusive Medienpaket.<br />
1499,00<br />
Datum und Unterschrift , �<br />
Menge - Produkt 15-Platz-Lizenz Netz<br />
__ Brockhaus Enzyklopädie digital - Basispaket (Text-Bild*) MP 15<br />
MP 15<br />
1999,00<br />
Bestellschein obige Adresse ist Privat Schule<br />
Für Schulen. Inklusive Medienpaket sowie zehnmal (10 x !) kostenlos den<br />
"Brockhaus multimedial 2004 Premium" im Wert von € 995,50.<br />
coTec GmbH<br />
Traberhofstr. 12<br />
83026 Rosenheim<br />
Ihre Daten sind bei coTec streng vertraulich - Siehe auch: AGB<br />
Preise in Euro inkl. gültiger MwSt. Irrtümer vorbehalten. Händleranfragen erwünscht.<br />
Das Wissen der Welt<br />
zum exklusiven Schulpreis<br />
Brockhaus Enzyklopädie digital: Mit Schulnachweis sparen Sie über 58%<br />
Der Name Brockhaus ist das Synonym für das gesammelte Wissen der Welt. Von Natur<br />
bis Kultur, von Sport bis Technik, von Geschichte bis Medizin enthält der Brockhaus alles,<br />
was wissens wert ist. Über 260.000 Artikel helfen, Zusammenhänge und Hintergründe zu<br />
verstehen. Als elektronisches Nachschlagewerk bietet die Brockhaus Enzyklopädie<br />
faszinierenden Möglichkeiten, die Ihnen einen völlig neuen Zugang zum<br />
Wissen der Welt eröffnen. Thematisch verwandte Stichwörter, Literaturhinweise,<br />
Quellentexte und Web-Links vertiefen die Lexikoneinträge. Mithilfe<br />
von ausgefeilten, benutzer freund lichen Suchfunktionen fi nden Sie<br />
ganz einfach alle Einträge, die zu Ihrem Suchbegriff passen – Recherchemöglichkeiten,<br />
die kein gedrucktes Werk bieten kann. Oder Sie nutzen<br />
das Wissensnetz als Navigationshilfe und erschließen sich neue<br />
Aspekte Ihres Themas. Videos, Animationen, Musikbeispiele, ein interaktiver<br />
Atlas und vieles mehr machen das Nachschlagen lebendig. 1)<br />
Textsubstanz<br />
26 Millionen Wörter<br />
260.000 Artikel mit 330.000 Stichwörtern<br />
zahlreiche Quellen- und Zusatztexte<br />
Brockhaus von 1906 mit 82.000 Wörtern<br />
Suche/Navigation<br />
Schnell- und Profi -Suche<br />
Web-Suche<br />
Trefferliste nach Alphabet/ Relevanz<br />
Querverweise<br />
Wissensnetz<br />
Tel.: 08031/2635-0<br />
Fax: 08031/2635-29<br />
Mail: info@cotec.de<br />
2<br />
Medium: CD, DVD<br />
Medien<br />
rund 14.500 Fotos und Illustrationen<br />
250 Videos und Animationen<br />
120 Aktivfotos und Habitate<br />
10 Hörfi lme<br />
73 Interaktivitäten<br />
360°-Panoramen<br />
300 z.T. animierte historische Karten<br />
ca. 13 Stunden Ton<br />
Web:<br />
über 19.000 kommentierte Weblinks<br />
Direktsuche auch im Internet<br />
Unsere exklusive Einzellizenz für Schulen, Lehrer und Dozenten<br />
Menge - Produkt Einzellizenz EL SV<br />
__ Brockhaus Enzyklopädie digital - Basispaket (Text-Bild*) (CD) EL SV 409,00<br />
Für Schulen, Lehrer und Dozenten mit Schulnachweis (eMail Adresse angeben!)<br />
__ Brockhaus Enzyklopädie digital - Medienpaket (DVD) 89,00<br />
Nur lauffähig mit der "Brockhaus Enzyklopädie digital"<br />
* Die Ansprüche an ein elektronisches Nachschlagewerk sind sehr verschieden – die einen fühlen sich<br />
durch multimediale Elemente gestört, für die anderen gehören sie unbedingt zum neuen Medium da-