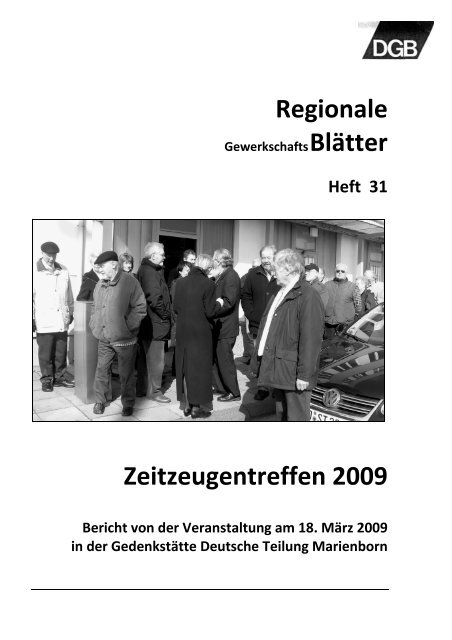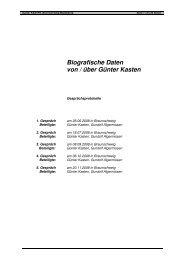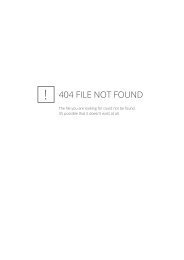Heft 31 - DGB Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt
Heft 31 - DGB Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt
Heft 31 - DGB Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
RegionaleGewerkschafts Blätter<strong>Heft</strong> <strong>31</strong>Zeitzeugentreffen 2009Bericht von der Veranstaltung am 18. März 2009in der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn
INHALTSVERZEICHNISZum Geleit Seite 2Hartmut Tölle, Hannover - <strong>DGB</strong>-BezirksvorsitzenderBezirk <strong>Niedersachsen</strong> – <strong>Bremen</strong> – <strong>Sachsen</strong>-<strong>Anhalt</strong>Einladung zur Veranstaltung Seite 3Teilnehmerliste Seite 5„Über die Wichtigkeit von Zeitzeugen“ Seite 7Professor Dr. h.c. Gerd Biegel, BraunschweigDie Abbildungen im Beitrag von Professor Biegelwurden vonKarl Bergmann, Braunschweig undSiegbert Pfeifer, Asse, fotografiert.BIOGRAFIENStellvertretend für die Arbeitsbiografien werdendie Beiträge von/überUdo Ahlers, Braunschweig und Seite 19Otto Weis, Magdeburg/Meisdorf abgedruckt. Seite <strong>31</strong>GEGEN DAS VERGESSENIm Braunschweiger Land 1933: Seite 57NS-Terror (!) und Widerstand (?)Professor Dr. h.c. Gerd Biegel, BraunschweigUmschlagfoto:Teilnehmer des Zeitzeugentreffen am 18. März 2009an der Gedenkstätte „Deutsche Teilung Marienborn“
Zum GeleitAls Lehre aus dem Faschismus hatte sich die Arbeiterbewegungnach dem Zweiten Weltkrieg geschworen, in Zukunft eineZersplitterung konsequent zu verhindern. Die Einheit derArbeiterbewegung sollte auf jeden Fall erhalten bleiben.Aufgrund der politischen Spaltung in die BundesrepublikDeutschland und die Deutsche Demokratische Republik musstensich die Gewerkschaften in Ost und West jedoch unterschiedlichentwickeln.In unserem Juni 2007 gestarteten Projekt haben wir Biografienvon vierzig Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern aus<strong>Niedersachsen</strong>, <strong>Bremen</strong> und <strong>Sachsen</strong>-<strong>Anhalt</strong> zusammengestellt.Das Ziel: Wichtige Erinnerungen von Zeitzeugen zu dokumentierenund gleichzeitig den Dialog zwischen Ost und West zufördern. Umfangreiche Arbeitsbiografien wurden in ausführlichenGesprächen erfasst. Die Auswahl der Gesprächspartnererfolgte durch Empfehlungen der Mitgliedsgewerkschaften oderergab sich im Laufe der Recherche aufgrund neuer Kontakte. DasErgebnis erhebt nicht den Anspruch, die Geschichte komplettabzubilden. Erinnerungen sind immer auch subjektiv.Die Arbeitsbiografien beschreiben den beruflichen und gewerkschaftlichenWerdegang der Befragten in der Zeit von etwa 1940bis zur jeweiligen Verrentung. Das Spektrum der unterschiedlichenEntwicklungen spiegelt sich in der Gesamtdarstellung.Während der Einzelgespräche entstand bei vielen Teilnehmerinnenund Teilnehmern ein großes Interesse, sich gegenseitigkennenzulernen und auszutauschen. Dieser Wunsch wurde am18. März 2009 in die Tat umgesetzt – und zwar an einemhistorischen Ort, der "Gedenkstätte Deutsche TeilungMarienborn". Nach der Vorstellung und einem Einstiegsreferatvon Professor Dr. h.c. Gerd Biegel über die Wichtigkeit vonZeitzeugen gab es regen Austausch der Teilnehmerinnen undTeilnehmer.Mit dieser Dokumentation wollen wir dazu beitragen, die Ergebnissedes Projekts dauerhaft festzuhalten. Sie soll ein Anstoßsein, die Diskussion und die Erinnerung nicht abreißen zu lassen.Die fertiggestellten Arbeitsbiografiensind unter folgenderE-Mail-Adresse einzusehen:www.niedersachsen.dgb.de/themen/arbeitergeschichte/biografien/Im Namen des Deutschen Gewerkschaftsbundes möchte ichallen Kolleginnen und Kollegen danken, die durch ihrevorurteilsfreie Teilnahme dieses Experiment zu einem vollenErfolg geführt haben. Herzlichen Dank Euch Allen!Hartmut Tölle<strong>DGB</strong>-Vorsitzender im Bezirk<strong>Niedersachsen</strong> – <strong>Bremen</strong> – <strong>Sachsen</strong>-<strong>Anhalt</strong>
Verlust derGeschichte –Zeitzeugenals QuellenImpulsreferatProf. Dr.h.c. Gerd BiegelDirektor des Institutsfür BraunschweigischeRegionalgeschichte»Nur wer die Vergangenheit kennt,hat eine Zukunft«(Wilhelm von Humboldt)Liebe Tagungsteilnehmerinnen und Tagungsteilnehmer,liebe Zeitzeugen.Unüberhörbar sind die zunehmenden Klagen unserer Zeit übereine geschichtslose Gesellschaft. Dabei gehen die Wortführerdavon aus, dass sich die Gesellschaft ihrer Geschichte nicht bzw.nicht mehr bewusst ist. Man ist jedoch der grundlegendenMeinung, dass nur derjenige weiß, wohin die Reise gesellschaftlicherEntwicklung gehen soll, der auch nachvollziehenkann, woher wir kommen und wie alles wurde, was ist: »DasBedürfnis nach Gedächtnis ist ein Bedürfnis nach Geschichte«,meint der französische Historiker Pierre Nora. Gedächtnis undGeschichte sind also unabdingbar miteinander verknüpft. DasBedürfnis nach Gedächtnis beruht nicht zuletzt auf der Erkenntnis,dass Erinnerung und Geschichte unsere Gegenwart erstzukunftsfähig machen. Warum aber Geschichte und Erinnerung,wenn es um die Zukunft geht?Fragt man überhaupt noch Historiker, wenn Zukunftsproblemeauf der Tagesordnung stehen, interessiert irgend jemanden derBlick in die Vergangenheit, wenn Klimawandel, Pandemien oderUmweltprobleme neben wachsenden Katastrophenszenarien dieMenschen zunehmend bedrängen? Ich meine, ja, und es sollteso sein, denn grundsätzlich gilt festzuhalten: Geschichte istzunächst eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart.Sie endet aber keineswegs im Nichts dieser Gegenwart, sondernsie führt weiter in die Zukunft. Geschichte und ihre Vermittlungist daher auch Zukunftswissenschaft und als solche von elementarerBedeutung für unsere Gesellschaft. Tatsächlich scheintjedoch die aktuelle Debatte um Zukunftsperspektiven modernerGesellschaften im Globalisierungsprozess zunehmend vomVerständnis geprägt zu sein, dass die Zukunftsfähigkeit einerGesellschaft eher davon abhängt, »ob und inwieweit sie sich vonihrer Vergangenheit lösen kann«. Dabei wird aber leichtfertigübersehen, dass gerade eine derartige Vergangenheitsblindheitder Zukunftsplaner mit dazu beitragen wird, überhaupt erstZukunftsunfähigkeit zu erzeugen. Menschliches Leben orientiertsich fast immer im Wechselspiel von Erwartung und Erinnerung,womit schließlich auch Identität gestiftet wird. Ohne geschichtlicheErinnerung fehlt der Zukunft aber unsere Identität, wirdZukunft somit jeglichen Sinnes entleert.Also: ohne eine Erinnerung, mit der wir uns selbst in die Zukunftmitnehmen können, haben wir keine mehr. Nur aus derErinnerung ist Zukunft lebensfähig und motivierendes undmobilisierendes Element unserer Gegenwart. Dabei wird bei den
technokratisch-ökonomischen Vordenkern unserer Gesellschaftleicht übersehen, dass in weiten Kreisen der Bevölkerung ernsthaftesInteresse und echter Bedarf an Geschichte sowieGeschichtsvermittlung bestehen. In Zeiten egoistisch-ökonomischerZukunftsorientierung werden nämlich Möglichkeiten derSelbstorientierung in der Historie gesucht. Historische Filme undDokumentationen, historische Romane und besonders Biographienund Autobiographien finden ein rasch zunehmendes Publikumund auch Zeitzeugenberichte zählen aktuell vermehrt dazu.Ganz offenbar ist es so, dass in der Begegnung mit einem fremdenLeben ein Abbild des eigenen Lebens gesucht wird. Der Betrachteroder Leser taucht ein in jenen Strom der Zeit, der Vergangenheit,Gegenwart und Zukunft verbindet. Der berühmteSchweizer Kulturhistoriker Jacob Burckhardt hat dies bereits im19. Jahrhundert postuliert: »Nur aus der Betrachtung derVergangenheit gewinnen wir einen Maßstab der Geschwindigkeitund Kraft der Bewegung, in welcher wir selber leben«.Burckhardt hatte dabei dem historischen Denken die Kraftzugetraut, den Jammer der Vergangenheit in eine befreiendehistorische Einsicht zu übertragen, »denn was einst Jubel undJammer war, muss nun Erkenntnis werden«.Mit dieser Erkenntnis verbindet der heutige Betrachter gern seineigenes Leben als Teil der Geschichte und bestimmt seinenStandort im Vergleich zu anderen Lebensberichten. Damit siehter sein Leben als sinnstiftendes Element der Geschichte. Wasaber ist oder kann dieser Sinn sein? Es ist eine der wichtigstenAufgaben der Geschichtswissenschaft bei der Beantwortungdieser Frage Hilfestellung zu leisten, den Sinn zu hinterfragenund in kritischer Betrachtung der historischen Mythenbildungentgegenzuwirken.Das Zeitzeugentreffenwird eröffnet(rechts Professor Biegel,daneben GundolfAlgermissen)
Letztere ist durch die unterhaltungsorientierte Kulturindustriezwischen lebensnaher Nachvollziehbarkeit im Freizeit- oderArchäologiepark sowie rührseliger Verkitschung in Film undFernsehserien leicht konsumierbar und damit gefährlich angewachsen.Die dabei vermittelten alten und neuen Mythen mussdie, - eben nicht »zeitgeistorientierte« - Geschichtswissenschaftentlarven, wobei dies populär geschehen kann ohne »quotenorientiert«populistisch werden zu müssen. Und wir werdengleich sehen, inwieweit dies auch für Zeitzeugen bedeutsam ist.In gelungenen historischen Ausstellungen der Geschichtsmuseenoder der Lektüre wissenschaftlich (und literarisch-künstlerisch)gelungener Werke findet sich die Voraussetzung einer sachlichselbstbewußtenIdentitätsstiftung, die den festgestellten Verlustan Geschichtskenntnis durch Wissenszuwachs überwinden hilft.Mit einer kritischen und sachbezogenen Geschichtswissenschaftunserer Universitäten und einer nicht eventorientiertenGeschichtsvermittlung an historischen Museen (was jedochAbwehr von populistischen Erwartungshaltungen der Museumsträgererfordert, die zunehmend in die fachliche Arbeit eingreifenund Inhalte bestimmen) und im (noch vorhandenen)Geschichtsunterricht –dem aber gute Lehrbücher zugrundeliegen müssen- wird sinnvoll an einer sinnstiftenden Grundlageunserer Gesellschaft gewirkt. Es ist dies eine Grundlage, die nichtauf dem Allgemeinen, sondern auf dem Besonderen beruht, umdie Zukunft zu sichern. Gebraucht wird der offene und ehrlicheUmgang mit der Geschichte. Rankes Forderung nach Fakten stattFiktionen gewinnt bei unserem aktuellen Erscheinungsbild einermedienorientierten populistischen Geschichtsdarstellung einebeklemmende aber zugleich notwendige Aktualität, ohne dasseine populäre bzw. populärwissenschaftliche Vermittlungsstrategieausgeschlossen wäre. Auszuschließen aber ist – und daherbedarf es sorgfältiger historischer Forschung – eine populistischeInstrumentalisierung von Geschichte zum bloßen Unterhaltungszweck,bei der schließlich auch Geschichtsklitterung billigend inKauf genommen wird, wenn nur die »Einschaltquoten« bzw.Besucherzahlen stimmen. Nicht mehr der Historiker bestimmtdas zu vermittelnde Bild, sondern Verwaltungsbürokratie mitMarketingfachleuten geben den Erlebnisfaktor vor, dem dieHistoriker die Inhalte anzupassen haben. »Brot und Spiele«bieten Unterhaltung mit Geschichte, eine Grundlage fürZukunftsorientierung schaffen sie nicht, obwohl dies dringenderals je zuvor notwendig wäre.Das gegenwärtige Verständnis der Mehrheit der Bevölkerungbewertet aber Zukunft eher als Anpassung an vordergründigeZwänge der Globalisierung, worauf sich zunehmend Zukunftsängstegründen. Historische Erinnerung und geschichtlichesBewusstsein aber tragen dazu bei, der Zukunftsfähigkeit unserer
Gesellschaft eine tragfähige Grundlage durch Ökonomie undKultur (Wertevorstellungen) zu ermöglichen. Eine Frage ist, wiekönnte und sollte historisch gedacht und argumentiert, daskulturelle Gedächtnis gestaltet und die historische Orientierungunserer Gesellschaft ausgerichtet werden, damit sich unseremHandeln und Denken eine Zukunft öffnet, die wir als unsereeigene akzeptieren können?Ich meine, in die Zukunft hinein muss durch bewusste historischeErinnerung Bewährtes, d.h. die errungene Substanz dereigenen Lebensform, erneuert werden. Nehmen wir ein Beispiel,das dies verdeutlichen kann: die Tradition menschen- undbürgerrechtlicher Regelung politischer Herrschaft und die Standardssozialer Sicherung menschenwürdiger Existenzbedingungen,die vor allem durch die Arbeiterbewegung errungenwurden. Von alleine halten sich solche Traditionen nicht, solcheTraditionen müssen bewusst lebendig erhalten und im Kontextgesellschaftlicher Entwicklung zukunftsfähig gemacht werden.Dabei muss uns stets bewusst sein, dass ohne solche tragfähigenTraditionen die Zukunft gefährdet ist. Das Beispiel der Errungenschaftender Menschen- und Bürgerrechte und des langenpolitischen Kampfes um deren Durchsetzung gegen politischeHerrschaft und Willkür sowie die Erfolge im Kampf um menschenwürdigeLebensverhältnisse durch die Arbeiterbewegungmacht deutlich, wie mühsam erkämpfte Lebensweisen des 19.Jahrhunderts trotz vielfältiger Bedrohungsszenarien (z.B. in derNS-Zeit) überhaupt überdauert haben. Solche Traditionen undErkenntnisse können nicht als überholt gelten und in die Aktender Vergangenheit abgelegt werden. An sie muss ständigerinnert werden und sie bedürfen mit dem Wissen um dieVergangenheit steter Erneuerung als Fundament der Zukunft.Sie sind zugleich Vorbilder dafür, wie Geschichte Grundlagen füreine humane Gesellschaft der Gegenwart und für die ZukunftBewahrenswertes geschaffen hat.Momentaufnahmewährend einer Pause
»Alte Bekannte treffensich nach Jahren …«(rechts RosemarieDreibrodt,links Siegbert Pfeifer)Das kritische Betrachten der Vergangenheit ermöglicht daher inder Gegenwart, Grundlagen für zukünftige Veränderungen imInteresse der Menschen zu bilden. Betrachten wir als weiteresBeispiel die Klimaproblematik und die aktuellen Diskussionen umUmweltprobleme. Sie lassen erkennen, dass nur mit einem kritischenUmgang mit dem traditionellen Fortschrittsbegriff aus derVergangenheit eine Katastrophe in der Zukunft vermieden werdenkann. War in der Vergangenheit der unbegrenzte Fortschrittsglaubeder Menschheit mit der Ausbeutung der Naturund der kritiklosen Verseuchung der Umwelt verbunden, somüssen wir heute aus diesen Erfahrungen lernen, welcheGefahren und Gefährdungen für den Menschen und die Zukunftder Erde (Erderwärmung) verbunden waren und sind. Aus derErkenntnis des Historikers bedarf es dabei der Weiterentwicklungunserer Vorstellungen von politischem Selbstverständnisgegenüber der Ausbeutung der Natur und dem Schutz derUmwelt. Und abschließend dazu: Auch die historischeKatastrophenforschung bietet ein geeignetes Beispiel, dennlängst versteht man »Katastrophen nicht als rein physikalischesGeschehen, das technische Lösungen erfordert, sondern in
erster Linie als Ergebnis menschlichen Handelns.« Daher sollenaus der Betrachtung und Erforschung der VergangenheitErkenntnisse gewonnen werden, die bei der Vorbeugungkommender Katastrophen hilfreich genutzt werden können. Esgilt in diesem Falle ebenfalls: Wir können durch den Blick zurückdie Geschichte zur Zukunftswissenschaft machen. DerartigeZukunftsvisionen können nur aus historischer Erfahrunggewonnen werden. Dazu jedoch gilt es in allen Fällen ausreichendesWissen zu vermitteln und der Geschichte den notwendigenRaum ihrer Erforschung und Darstellung im Rahmender Bildungs- und Wissenschaftspolitik zu ermöglichen, sie nichtals Beitrag zu einer unterhaltenden Wellnesskultur zu missbrauchen.In Deutschland aber werden Kultur und Bildung (und damit auchdie Geschichtswissenschaft) zunehmend eingeschränkt, ihreBedeutung oder gar Zukunftsfähigkeit nur noch an ökonomischerNützlichkeit gemessen. Anwendungsorientierung derForschung und ökonomische Verwertbarkeit stehen in deraktuellen Wissenschaftspolitik im Vordergrund. Die Wissenschaftsoll zum Zulieferbetrieb der Industrie degenerieren und wasnicht in die Produktion fließen kann, wird als nutzloses Wissenverächtlich gemacht. Kultur und Geschichte verkommen zueinem bloßen Wirtschaftsfaktor. ABER: Geschichte kann mannicht in das Prokrustesbett von Angebot und Nachfrage zwingen,will man nicht der Oberflächlichkeit einer eventorientiertenSpaßkultur mit Erinnerungslosigkeit das Wort reden.Diese Erkenntnis wird übrigens in den Sonntagsreden der Politikerstereotyp wiederholt und betont, indem sie ihre Reden miteinem Rückgriff auf Geschichte beginnen, um dann festzustellen:Auf der Grundlage des Wissens um die Vergangenheit lassen sichdie Probleme der Zukunft unseres Staates besser bewältigen.Geschichte als Fundament unserer Gesellschaft und ihrerZukunft, so sollte man also meinen, ist allgemeiner gesellschaftlicherKonsens. Doch dieses gesellschaftliche Fundament derGeschichte ist zunehmend unsicher geworden. Die Diskussionenum die Opfer- und Täterrolle der Deutschen, die Auseinandersetzungenum ein Zentrum für Vertreibung oder aktuelle Streichungengeisteswissenschaftlicher Fachbereiche, wie an derUniversität Stuttgart belegen dies eindringlich. Was Geschichtesein darf und was nicht, muss daher stets sorgfältig weitererforscht und fortschreitend neu definiert werden. Als bloßesArgument tagespolitischer Beliebigkeit taugt Geschichte ebensowenig, wie für das Entertainment einer Einschaltquotenabhängigkeitvon Fernsehprofessoren. Die gegenwärtige Konjunkturdes Historischen erscheint eher als eine Konjunktur derGeschichtslosigkeit, denn sie entsteht als Popularisierung vonkritikloser Oberflächlichkeit.
Zukunft mit GeschichteImmer wieder lässt sich in der öffentlichen Diskussion überGeschichte feststellen, dass Erforschung und Vermittlung derjüngeren Geschichte trotz der intensiven Nachkriegsdiskussionnach wie vor ein großes Defizit darstellen. Dies gilt auch für dieZeitgeschichte in unserer Region, obwohl herausragendeForschungen, z.B. am Historischen Seminar der TechnischenUniversität Braunschweig, stattfinden und zahlreiche neueDetailstudien zu relevanten Themen vorgelegt wurden. DieseTatsache gilt aber nicht nur für die Forschungen an der Universität,sondern ebenso für alle die Kultur und Geschichte unsererStadt und Region vermittelnden Einrichtungen, ob dies dieArchive, Bibliotheken, Volkshochschulen, Geschichtsvereine,Heimatvereine oder Museen sind. Die Lücken in der Erschließungund Vermittlung wichtiger Themenbereiche der jüngstenGeschichte sind nach wie vor zu groß, als dass man sich mit dembisher erreichten Wissensstand zufrieden geben kann oder darf.Warum aber erscheint dieses mahnende Drängen nach Erforschungund Vermittlung der Zeitgeschichte so bedeutsam? Zumeinen ist es die Erkenntnis um die tatsächlich vorhandenenLücken, die nicht zuletzt auf das Verdrängen dieser zeitgeschichtlichenErfahrungswelten zurückzuführen sind. Zumanderen muss daran erinnert werden, dass die Deutung derjüngsten Vergangenheit für das Selbstverständnis der Gegenwarteine weitaus größere Rolle spielt als die Rekonstruktion ihrerweiter zurückliegenden Vorgeschichte. Zunehmend häufen sichdie Klagen über den wachsenden Verlust des Wissens von undum die Geschichte. Der Bielefelder Historiker Hans-UlrichWehler hatte schon 1991 berichtet, dass Schüler ernsthaft fragten,ob Hitler »vor Asterix oder danach« war. Und die jüngstenUmfragen zu Kenntnissen über die Geschichte der DDR sprechenBände!Der scheinbar beruhigende Hinweis auf das vielfältige undbesucherreiche Angebot von historischen Ausstellungen undMuseen, den Erfolg historischer Sachbücher oder den soerfolgreichen »Geschichtsunterricht« im Fernsehen ändert anden aufgezeigten Erfahrungen und Problemen wenig. Es ist diesein unterhaltsames Treiben an der Oberfläche, kein Eindringenin eine von fröhlichem Unwissen oder dumpferVorurteilshaftigkeit geprägten geistigen Tiefe. Die Manifestationder Erinnerung als ständig beschworene »Gedenkkultur« lässtaußerdem die Beschäftigung mit der Vergangenheit zum bloßenRitual ohne Gehalt und Wirkung verkommen.Gerade die aktuellen Ereignisse, die Erscheinungsformen imUmgang mit dem aktiven Terrorismus, das Vordringenneonazistischer Kreise in Kommunal- und Kreisparlamente sowiedie Geschichtsvergessenheit in der Ausdeutung der Triebkräfte»DDR-Diktatur« müssten Warnung genug sein, um alle Kräfte zu
mobilisieren, damit geschichtliche Erfahrungen Eingang in dasgegenwärtige Bewusstsein der Menschen finden.Eine neuere Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung wartet dazu miteiner Reihe erschreckender Ergebnisse auf. So stimmten 36,9Prozent der Befragten dem Satz »Die Ausländer kommen nurhierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen« zu. 34,9 Prozentkonnten sich für den Vorschlag »Wenn Arbeitsplätze knappwerden, sollte man die Ausländer wieder in ihre Heimat zurückschicken«begeistern. Und 39,1 Prozent fühlten sich von derBehauptung »Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländerin einem gefährlichen Maß überfremdet« angesprochen. DerAnteil derjenigen, die eine Diktatur befürworten, chauvinistischeoder sozialdarwinistische Einstellungen hegen, ausländerfeindlichenund antisemitischen Parolen zustimmen oder die Zeit desNationalsozialismus und der DDR-Diktatur verharmlosen, liegtoffenbar weit höher als es Jahrzehnte mehr oder weniger engagierterAufarbeitung der NS-Vergangenheit vermuten lassen.Wir dürfen uns aber nicht resigniert mit der Erkenntnis abfinden,dass Geschichte allmählich in der Geschichte versinkt und keineZukunft mehr hat. Die Bedeutung des Wissens um die Vergangenheitmag uns scheinbar selbstverständlich sein. Einer jungenGeneration, die am ökonomischen Wettbewerb orientiert ist,bedeutet Geschichte und Vergangenheit aber schlichtweg nichts.Dennoch ist dies kein Grund zur Resignation, sondern Anspornund zwingende Notwendigkeit zum vermittelnden Handeln.Jacob Burckhardt hat bereits in seinen »WeltgeschichtlichenBetrachtungen« am Ende des 19. Jahrhunderts die notwendigeRichtung dafür angegeben: »Unser Ausgangspunkt ist der vomeinzig verbleibenden und uns möglichen Zentrum, vom duldenden,strebenden und handelnden Menschen, wie es ist undEine kurze Einführung zuraktuellen Situation von HerrnDr. Stucke, stv. Leiter derGedenkstätte (ganz rechts)
immer war und sein wird«. Dies heißt, dass es Grundlage desMenschen ist, Geschichte zu haben, aber sie ist nicht seine einzigeexistenzielle Bestimmung. Daher gilt es, das Exemplarischein der Geschichte auszuwählen und so spannend zu erzählen,dass die Menschen feststellen: davon sind auch wir betroffen,dies geht uns alle an!Zunehmend sollen die Menschen erkennen, dass die Beschäftigungmit und die Vermittlung von Geschichte keine nostalgischeRückwärtsgewandtheit ist, sondern eine ernsthafte Auseinandersetzungmit Gegenwart und Zukunft, jedoch auf einem solidenFundament des Wissens um die Vergangenheit. Nach wievor hat das Dictum von Jacob Burckhardt »Geschichte ist diejenigeVergangenheit, welche deutlich mit Gegenwart undZukunft zusammenhängt« Gültigkeit für den Umgang und dieWirkungsmächtigkeit von Geschichte.Aber es muss berichtet werden, von dem woher wir kommenund wie es war und in der Zeitgeschichte am besten von denjenigen,die als Zeitzeugen noch dabei waren, daher authentischvermitteln und berichten können: »Das habe ich getan, sagtmein Gedächtnis. »Das kann ich nicht getan haben, sagt meinStolz und bleibt unerbittlich. Endlich - gibt das Gedächtnis nach.«Dieser bekannte Aphorismus von Friedrich Nietzsche (Jenseitsvon Gut und Böse) beschreibt präzise die allerdings auch damitverbundene Problematik. Zeitzeugen überliefern nämlich allesandere als eine »wahre«, »objektive« Sicht auf das von ihnenErlebte. Ihre Erinnerungen sind durchaus subjektiver Natur.Dabei werden ihre Erinnerungen mit zunehmender Distanz mehrund mehr zu einem standardisierten Erzählbild, das möglicherweiseweit von der tatsächlich gelebten Realität entfernt ist.Diese Erkenntnis ist – siehe Nietzsche – nicht neu und giltgrundsätzlich für alle historischen Disziplinen. Dennoch sindWährend der Führung über dasGelände der Gedenkstätte
Zeitzeugen unentbehrlich, ihre Schilderungen aber müssen vonHistorikern hinterfragt, kritisch geprüft, ihre Wertungengedeutet und gewichtet werden. Auch Althistoriker, die ihreZeitzeugen nur noch aus sekundären Quellen kennen, könnenetwa bei der Beschreibung des Gallischen Krieges nicht kritiklosauf den »Zeitzeugen« Caesar vertrauen, sie müssen dessenSchilderungen ständig in Frage stellen und sorgfältig prüfendanalysieren. Die Zeithistoriker stehen hierbei allerdings voreinem massiven Problem: ihre Quellen leben und sprechen nochund können sich gegen ihre Infragestellung zu Wehr setzen. DieZeitzeugen treten durchaus in eine unmittelbare Deutungskonkurrenzzu den Forschern und Historiographen – und diesemüssen bangen, in ihrem Bemühen um eine differenzierteInterpretation der Geschichte an die Wand gedrängt zu werdenvon jenen, die doch »dabei« waren und scheinbar wissenmüssen, »wie es eigentlich gewesen ist.« Die Popularität derPerson eines Zeitzeugen darf dem Historiker in der öffentlichenGeschichtsvermittlung nicht den Rang ablaufen.Dies aber scheint gegenwärtig zunehmend der Fall zu sein,beobachten wir in den Medien das Erscheinungsbild und dasInstrumentalisieren von Zeitzeugen genauer und vor allemkritisch. Seine Geschehenswelt ist beim Zeitzeugen vor allem vonder Emotionalität seiner Erzählung getragen. Er deutet nicht alswertender Beobachter von außen, sondern vermittelt Erfahrungengleichsam von innen und gilt für den Empfänger seiner Aussagenals Träger von »wirklicher Erfahrung«, was seine Sichtweisezu autorisieren scheint. Dabei wird übersehen, dass derZeitzeuge durchaus auch von den Erfahrungen bzw. Erwartungenseiner Umwelt beeinflusst ist. Der Zeitzeuge passt seineAussage und seine Haltung, ja seine Erinnerung letztlich demErinnerungskonsens unserer Gegenwart an, er belegt in seinerPerson das »Lernen aus der Geschichte«. In der Folge wird dasder Gegenwart »Angepasste« zunehmend als das »Authentische«vermittelt und kann in eine schwierige Konkurrenz zurkritischen Darstellung des Historikers geraten, wobei derLetztere schnell als »unverständlich«, weil »wissenschaftlich« inden Hintergrund gedrängt wird.Diese Entwicklung konnte man bei der Popularisierung der»Geschichtserzähler« im Fernsehen nachvollziehen, wo sehr baldaus der Dokumentation erzählender Zeitzeugen mit demAnspruch »wie es gewesen war« eine illustrierende Untermalung»wie es empfunden wurde« geworden war und die historischeDeutungshoheit dem moderierenden Fernsehprofessor zufiel,dem die Zeitzeugen nur noch zur emotionalen Illustrationdienen. Spannung und Unterhaltung sind Ziele der Medienpraktiker,kritische Bewertung und Analyse von Zeitzeugenberichtenals historischer Quelle dabei eher lästig und letztlichüberflüssig.
Aber genau darin liegt die Bedeutung für den Historiker, für dendie kritische Hinterfragung einer Quelle und damit auch derZeitzeugenbericht ein wesentlicher Bestandteil seines täglichenHandwerks ist.Gerade in der Quellenfunktion aber liegt die Bedeutung derZeitzeugen nach wie vor begründet. Deren Aussage ist jabestimmt von Zeit und Nähe des Erlebten, vom Zugang im Verständnisdes Geschehens und vom persönlichen Interesse an derInterpretation des Erlebten. Je größer die innere Distanz zumGeschehen, desto glaubwürdiger kann dabei die Aussage tatsächlichsein. Dies zu beurteilen aber ist eine wichtige Aufgabefür den Historiker ebenso wie er den Vergleich mit weiterenQuellen oder Zeitzeugen benötigt und sucht, um seine »Quelle«so tragfähig wie möglich zu bewerten und zu bestimmen.Die Thematik, der wir uns in unserem Zusammenhang zuwendenwollen, sind zunächst nicht allgemeine geschichtliche Abläufeüber Erlebtes der letzten 70 – 75 Jahre und Erfahrungenallgemein mit der NS-Zeit oder der DDR-Diktatur. Dies kann ineinzelnen Fällen ein zusätzliches »Abfallprodukt« sein, dem ichmich als Historiker dann im Einzelfall nochmals extra widmenmöchte und werde. Unser Ziel ist im Rahmen des von Institut fürBraunschweigische Regionalgeschichte und <strong>DGB</strong> getragenenProjektes eine Vielzahl von persönlich geprägten Arbeitsbiographienzu sammeln, die als Ergänzungen der »klassischen«Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Region dienen. Darüberhinaus geht es um Berichte zu den gewerkschaftlichen Aktivitätenund Erfahrungen, denn gerade der regionalen Gewerkschaftsgeschichtein Süd-Ost-Niedersachen und <strong>Sachsen</strong>-<strong>Anhalt</strong>ist bisher nur wenig Beachtung geschenkt worden.Unsere Zeitzeugenauf dem Überwachungsturmder Gedenkstätte
Einen Blickin das Tunnelsystemunter der GedenkstätteHierzu aus primären, nicht-schriftlichen Quellen eine möglichstbreit gefächerte Quellenbasis zu schaffen, von der aus diehistorische Forschung weiter arbeiten, bewerten, auswählen undErgebnisse vermitteln kann, ist das erklärte Ziel unseresProjektes.Um die Bedeutung dieses Projektes und den Wert Ihrer aktivenTeilnahme deutlich zu machen, wollte ich mit diesemImpulsreferat einige Gedanken zum drohenden Verlust derGeschichte und damit heraufbeschworenen Gefahren in unserergegenwärtigen Gesellschaft darstellen und auch vor dieserEntwicklung warnen. Ebenso möchte ich Ihnen, und allen, diedarüber hinaus zur Zusammenarbeit mit uns, nämlich GundolfAlgermissen vom <strong>DGB</strong> und mir vom IBR, bereit sind, die großeBedeutung Ihrer Erinnerungsleistung und die Wichtigkeit IhrerDarlegungen als Quellenmaterial der Zeitgeschichte eindrücklichaufzeigen und vermitteln. Natürlich gäbe es noch manches zumSinn und Zweck, zum Methodischen und Didaktischen, zuErkenntnissen sowie positiven und negativen Beispielfällen zusagen. Dies mag der endgültigen Publikation unsererProjektergebnisse vorbehalten bleiben. Nun sollen Sie, dieZeitzeugen, zu Wort kommen, denn um Sie und IhreErlebnisberichte geht es bei dem heutigen und den zukünftigenTreffen unserer Projektgruppe.Vielen Dank für die Geduld und Aufmerksamkeit.