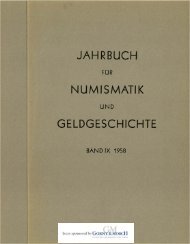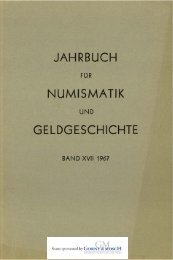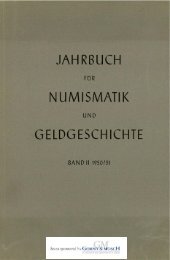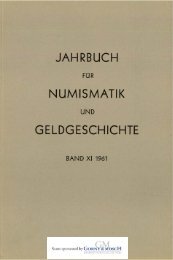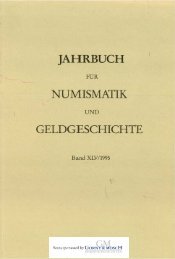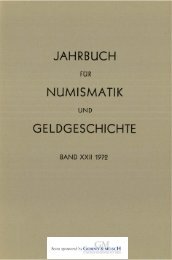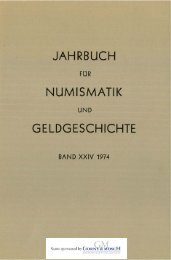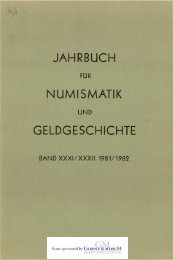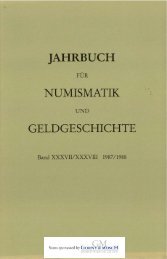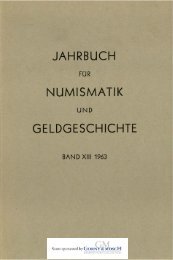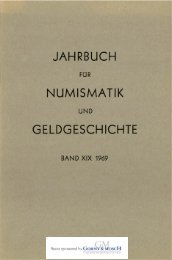jahrbuch numismatik geldgeschichte - Bayerische Numismatische ...
jahrbuch numismatik geldgeschichte - Bayerische Numismatische ...
jahrbuch numismatik geldgeschichte - Bayerische Numismatische ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die keltischen Münzen von Augsburg-Oberhausen 25wenig wie die für diesen Typ zu postulierende Inschrift. Colbert de Beaulieuführt in seinem Catalogue des collections archeologiques de Besancon,IV. Les monnaies gauloises (1959) Nr. 90-92 einige Exemplare des Typs„au cavalier" auf, die wenig Ähnlichkeit mit unserem Stück zu zeigen scheinen.Dagegen findet sich im gleichen Katalog unter Nr. 133 bei den „incertainesde l'Est" (Kaletaeduer-Typen), die eigentlich immer den Romakopfnach links zeigen, ein Exemplar mit Romakopf rechts. Jeweils ein ganzähnliches Gepräge bilden ab S. W. Vischer, Celtische Münzen gefunden beiNunningen im Canton Solothurn. Mitth. d. Ges. f. vaterländ. Alterthümer4, Basel 1852, Taf. II, 8 = H. Meyer Nr. 52 und S. Scheers 1969, Taf. I, 7(mit Winkel über dem Pferderücken!). Bei diesem Typ eher als bei denStücken aus dem Rhonetal ist unser Exemplar einzuordnen. Vgl. auchK. Kraft FMRD I 7011, 321.8. Silberquinar (?)Vs. und Rs. unkenntlich.Gew. 1,510 g. — Dicker Schrötling, Gewichtsverlust durch scharfes Reinigen. —FMRD I 7011, 369. (Taf. 2, 8)Bei dem Stück läßt sich weder auf Vorder-, noch auf Rückseite etwas erkennen.Dem Schrötling nach muß es sich um die Anima eines gefüttertenSilberquinars handeln, dessen Typ jetzt unbestimmbar ist. Ohlenroth, derdie Stücke ja zur Zeit ihrer Auffindung gesehen hat, hatte die Münze als„bojisch" angesprochen.9. SilberquinarVs. und Rs. unkenntlich.Gew. 1,075 g. — Gewichtsverlust durch starke Reinigung, wohl verbrannt. —FMRD I 7011, 328. (Nicht abgebildet, da völlig unkenntlich.)Auf einer Seite des Stückes waren am Rand noch Reste von 1-2 verschmolzenenBuchstaben zu erkennen, die jedoch nicht mehr entziffert werdenkonnten. Es ist damit die Möglichkeit, daß es sich um einen römischenQuinar handelt, nicht auszuschließen.Alle Stücke waren, wie auch das sonstige Fundmaterial aus Oberhausen,wohl schon vor dem 1. Weltkrieg elektrolytisch stark gereinigt worden,worunter sowohl das Gewicht als auch die bis dahin noch erhaltene Oberflächeerheblich gelitten hatten.Die Deutung des Fundkomplexes von Augsburg-Oberhausen wurde in letzterZeit heftig diskutiert"; von der früheren Annahme eines Legionslagersfür 1 oder 2 Legionen' ist man heute abgerückt, da im Gelände keinerlei4 Einen Überblick über die Diskussion bei H.-J. Kellner, Augsburg, ProvinzhauptstadtRaetiens. Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II 5, 2 (1976) 697-699.5 K. Kraft, Zum Legionslager Augsburg-Oberhausen. Aus Bayerns Frühzeit, Festschrift