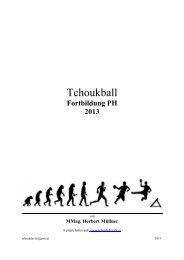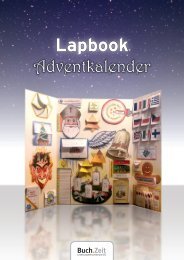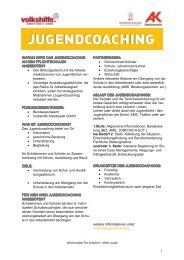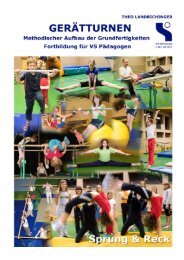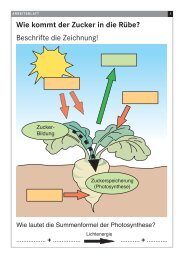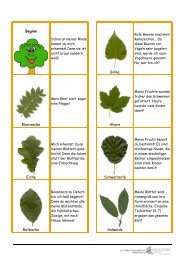Die Verfassung als Rahmen der Politik [pdf, 220KB
Die Verfassung als Rahmen der Politik [pdf, 220KB
Die Verfassung als Rahmen der Politik [pdf, 220KB
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
MEDIENPAKET<br />
Politische Bildung<br />
verflochten wegen politischer<br />
Verantwortlichkeit - Misstrauensvotum<br />
(Mehrheit kann Regierung stürzen)<br />
P a r l a m e n t<br />
Nationalrat Bundesrat Bundespräsident<br />
wählt direkt wählt direkt<br />
wählt indirekt<br />
Das präsidentielle Korrektiv ist auch <strong>als</strong> Konkurrenz zum<br />
parlamentarischen Grundzug des politischen Systems zu<br />
verstehen. In <strong>der</strong> <strong>Verfassung</strong>swirklichkeit ist freilich deutlich,<br />
dass die Rolle des Bundespräsidenten kein volles<br />
Gegengewicht zum Grundgedanken Parlamentarischen<br />
Regierens bedeutet. Denn die Bildung <strong>der</strong> Bundesregierung<br />
erfolgte immer <strong>als</strong> Konsequenz <strong>der</strong> Wahl des Nationalrates –<br />
und nie <strong>als</strong> Konsequenz <strong>der</strong> Wahl des Bundespräsidenten.<br />
Zwar kann <strong>der</strong> Bundespräsident – durchaus im Sinne<br />
eines Korrektivs – bei <strong>der</strong> Bildung <strong>der</strong> Bundesregierung<br />
eigenständig mitwirken, er kann aber gegen eine<br />
entschlossene Parlamentsmehrheit sich nicht durchsetzen.<br />
Beispiele für die eigenständige Mitwirkung und damit für das<br />
Funktionieren des präsidentiellen Korrektivs sind:<br />
1953 erklärte Bundespräsident Theodor Körner, dass er<br />
einer Einbeziehung des VDU <strong>als</strong> dritten Partner in die von<br />
ÖVP und SPÖ gebildete Bundesregierung nicht<br />
zustimmen würde. <strong>Die</strong> bis dahin (von <strong>der</strong> ÖVP) nur<br />
informell geäußerten Pläne einer solchen Einbeziehung<br />
wurden dann nicht weiterverfolgt.<br />
2000 akzeptierte Bundespräsident Thomas Klestil die<br />
Bestellung <strong>der</strong> ursprünglich für die Ämter des Finanz- und<br />
Bevölkerung<br />
ernennt<br />
Kapitel 2<br />
Struktur des politischen Systems Österreichs Abb. 2<br />
FOLIE 3<br />
des Landesverteidigungsministers vorgesehenen<br />
Personen nicht und zwang so die FPÖ an<strong>der</strong>e<br />
Kandidaten zu nominieren – die dann von Klestil<br />
akzeptiert wurden.<br />
Das wichtigste Beispiel dafür, dass das präsidentielle<br />
Element gegenüber dem parlamentarischen das<br />
Schwächere ist, liefert die Regierungsbildung 1999/2000.<br />
Bundespräsident Thomas Klestil hatte klargemacht, dass er<br />
eine Koalition zwischen SPÖ und ÖVP wünsche. Als diese<br />
scheiterte und ÖVP und FPÖ ein Koalitionsabkommen<br />
vereinbarten, sah Klestil keinen an<strong>der</strong>en Ausweg, <strong>als</strong> diese<br />
von ihm nicht gewollte Bundesregierung zu akzeptieren –<br />
d.h. sie zu bestellen.<br />
Der Grund für dieses Nachgeben liegt eben darin, dass <strong>der</strong><br />
Bundespräsident zwar grundsätzlich jede Regierung bestellen<br />
kann, dass aber diese nur handlungs- und überlebensfähig<br />
ist, wenn sie nicht gegen den Willen <strong>der</strong> Mehrheit des<br />
Nationalrates bestellt wird. Als klar wurde, dass die von ÖVP<br />
und FPÖ gebildete Mehrheit des Nationalrates jede an<strong>der</strong>e<br />
Regierung <strong>als</strong> eine ÖVP/FPÖ-Koalition sofort „stürzen“ würde,<br />
sah Klestil keine Alternative.<br />
7