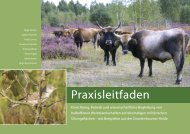TAGUNGSBAND CONFERENCE PROCEEDINGS - Offenlandinfo
TAGUNGSBAND CONFERENCE PROCEEDINGS - Offenlandinfo
TAGUNGSBAND CONFERENCE PROCEEDINGS - Offenlandinfo
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Freiwillige Naturschutzleistungen auf<br />
Grünland – Eine Zustandsanalyse<br />
Katja Eis, Sandra Dullau, Sabine Tischew<br />
Hochschule Anhalt, Fachbereich Landwirtschaft, Ökotrophologie<br />
und Landschaftsentwicklung, Bernburg, Deutschland<br />
Ergebnisse für die FFH-Lebensraumtypen 6440 (Brenndolden-Auenwiesen),<br />
6510 (Magere Flachland-Mähwiesen)<br />
und 6520 (Berg-Mähwiesen) in Sachsen-Anhalt<br />
Seit 2007 können Flächennutzer in Sachsen-Anhalt auf das<br />
Agrarumweltprogramm „Freiwillige Naturschutzleistungen“<br />
(FNL) zurückgreifen. FNL dienen der Sicherung und Verbesserung<br />
des Zustandes und der Vielfalt an natürlichen sowie<br />
schutzwürdigen Lebensräumen und heimischen Tier- und<br />
Pflanzenarten (Biodiversität) sowie dem Wasser-, Klimaund<br />
Bodenschutz. Sie sind ausschließlich auf FFH-Gebiete<br />
und § 37-Biotope beschränkt. Um den Erfolg sowie Defizite<br />
von Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes und der<br />
Freiwilligen Naturschutzleistungen aufzuzeigen, wurden<br />
2010 erstmals 60 Grünlandflächen der Lebensraumtypen<br />
6440 (Brenndolen-Auenwiesen), 6510 (Magere Flachland-<br />
Mähwiesen) und 6520 (Berg-Mähwiesen) im mittleren<br />
und südlichen Sachsen-Anhalt evaluiert. Auf der Grundlage<br />
der Ergebnisse dieser Evaluierung können zum einen<br />
Agrarumweltprogramme in Sachsen-Anhalt angepasst und<br />
weiterentwickelt werden. Zum anderen fließen die Ergebnisse<br />
in einen Leitfaden für das Grünlandmanagement der<br />
Lebensraumtypen 6440, 6510 und 6520 ein. Die Evaluierungsmethode<br />
wurde aus der für Thüringen bestehenden<br />
Evaluierung von Agrarumweltmaßnahmen des Kultur- und<br />
Landschaftsprogramms übernommen und für Sachsen-<br />
Anhalt modifiziert. Zur Erfolgskontrolle werden alle Arten<br />
einer Fläche erfasst und deren Ertragsanteil geschätzt. Die<br />
Bewertung der Maßnahmen erfolgt mittels der Kriterien<br />
Pflanzenzusammensetzung (G-Wert), Beeinträchtigungen<br />
und Habitatstruktur (Schichtungsindex, Kräuteranteil).<br />
Die Wertung der Habitatstruktur wurde unverändert aus<br />
der Thüringer Methode übernommen. Die Einstufung des<br />
G-Wertes wurde neu entwickelt und die Grenzwerte für Beeinträchtigungen<br />
modifiziert. Im Gegensatz zur Thüringer<br />
Methode, bei der ein Vorher-Nachher-Vergleich durchgeführt<br />
wird, stellt die Gesamtbewertung einer Fläche einen<br />
Soll-Ist-Vergleich dar.<br />
Die Ergebnisse zeigen, dass alle drei betrachteten Lebensraumtypen<br />
überwiegend suboptimal ausgeprägt sind. Den<br />
besten Zustand verzeichnen die Berg-Mähwiesen (6520)<br />
und am schlechtesten schneiden die erfassten Brenndolden-Auenwiesen<br />
(6440) ab. Bei dem G-Wert weisen die<br />
Bergmähwiesen stets den Soll-Zustand auf. Das Kriterium<br />
Beeinträchtigungen fällt für alle Lebensraumtypen positiv<br />
aus. Dagegen dominieren bei der Habitatstruktur der<br />
Brenndolden-Auenwiesen (6440) und mageren Flachland-<br />
Mähwiesen (6510) schlechte Zustände. Die Berg-Mähwiesen<br />
(6520) wiesen dagegen eine deutlich bessere Habitatstruktur<br />
auf. Diese wurde jedoch beim Schichtungsindex<br />
hauptsächlich durch suboptimale Bewertungen gebildet,<br />
der Kräuteranteil dagegen befand sich auf 50 % in optimalem<br />
Zustand.<br />
26<br />
Stellwand-Nr.<br />
Poster Panel No.<br />
5<br />
Ziegenbeweidung im Unteren Saaletal<br />
- Analyse des Verbiss- und Raumverhaltens<br />
auf Standweiden<br />
Daniel Elias 1 , Sandra Mann², Viktor Gretz 1 ,<br />
Sabine Tischew²<br />
1Prof. Hellriegel Institut e.V. Bernburg an der Hochschule<br />
Anhalt, Bernburg, Deutschland<br />
²Hochschule Anhalt, Fachbereich Landwirtschaft, Ökotrophologie<br />
und Landschaftsentwicklung, Bernburg, Deutschland<br />
Im Rahmen des Projektes „Management von Offenland-<br />
Lebensräumen an pflegeproblematischen Steilhängen<br />
durch Ziegenstandweiden“ wurden Untersuchungen zum<br />
Fraß- und Raumverhalten der Weidetiere durchgeführt.<br />
Diese Tierbeobachtungen konnten belegen, dass von den<br />
Ziegen weitestgehend alle Gehölzarten verbissen werden,<br />
insbesondere auch Arten mit Stacheln oder Dornen (z. B.<br />
Berberis vulgaris, Crataegus-Arten, Rosa-Arten). Die Tiere<br />
fressen sowohl die Blätter, Blüten und Früchte der Gehölze<br />
als auch die Rinde und ganze Triebe. Der Verbiss von Gehölzen<br />
erfolgt besonders konzentriert und intensiv in den<br />
stärker verbuschten Bereichen.<br />
Die Ziegen verbeißen jedoch nicht nur Gehölze sehr effektiv,<br />
sondern fressen auch Gräser und Kräuter und tragen<br />
somit auch sehr erfolgreich zur Pflege der weniger stark<br />
verbuschten, jedoch zum Teil stark vergrasten Offenlandflächen<br />
bei. Die Anteile der einzelnen Futtergruppen (Gräser/<br />
Kräuter/Gehölze) und Arten variieren je nach Jahreszeit,<br />
Verfügbarkeit der Gehölze auf den Flächen sowie der Dauer<br />
der Weideperiode. Zum Teil ergeben sich auch Unterschiede<br />
je nach der Zusammensetzung der Ziegenherden<br />
(Geschlecht, Alter).<br />
Stellwand-Nr.<br />
Poster Panel No.<br />
6