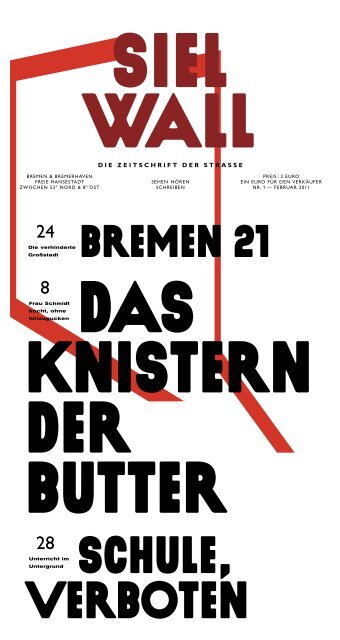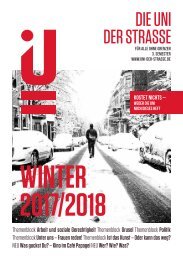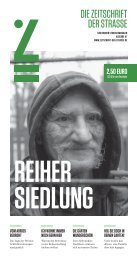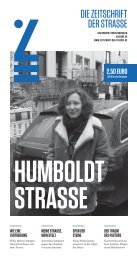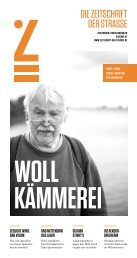Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
SIEL<br />
WALL<br />
D i e Z e i t s c h r i f t D e r S t r a s s e<br />
Bremen & Bremerhaven<br />
FREIE HANSESTADT<br />
ZWISCHEN 53° NORD & 8° OST<br />
SEHEN HÖREN<br />
SCHREIBEN<br />
Preis : 2 euro<br />
ein euro Für den Verkäufer<br />
Nr. 1 — februar 2011<br />
bremen 21<br />
Das<br />
Knistern<br />
der<br />
butter<br />
SCHULE,<br />
VERBOTEN
S I E L W A L L<br />
E d i t o r i a l 5<br />
H i s t o r i e<br />
1861 / 2011 6<br />
S i e l w a l l i n Z a h l e n 7<br />
F o t o s t r e c k e<br />
Hinter den Wänden 16<br />
I m p r e s s u m 46<br />
V o r s c h a u<br />
Bahnhofsplatz 47<br />
53° NORD & 8° OST<br />
F o t o :<br />
P r i s c a K r a n z<br />
I n h a l t<br />
d a s k n i s t e r n<br />
d e r b u t t e r<br />
Frau Schmidt kann nichts mehr sehen.<br />
Jetzt bringt sie anderen das Kochen<br />
bei. Ein Besuch zwischen sich bräunendem<br />
Wirsing und einer sprechenden<br />
Küchenwaage<br />
b r e m e n 2 1<br />
Eine Bürgerinitiative stoppte 1973 den<br />
Komplettabriss des Viertels. Um<br />
ein Haar wäre Bremen zur Großstadt<br />
geworden. Ein Rückblick<br />
8<br />
12<br />
i m l e i c h e n -<br />
s c h a u h a u s<br />
Früher gab es Parolen, Tags, Graffiti und<br />
Plakate – Sachbeschädigung und Ärgernis.<br />
Heute gibt es „Street Art“: zur Kunst<br />
geadelt, beliebt, aber tot<br />
24<br />
s c h u l e ,<br />
v e r b o t e n<br />
Sie wollten anders lernen, selbstorganisiert.<br />
Der Staat verbot es. Unterricht<br />
gabs trotzdem jahrzehntelang – versteckt<br />
in einem Wohnhaus, getarnt als<br />
Kindergarten. Ein Besuch in Bremens<br />
ehemals geheimster Lehranstalt<br />
28<br />
33<br />
36<br />
p e t e r s b u r g e r<br />
h ä n g u n g<br />
Hat er sein Bild noch selber angebracht<br />
im letzten Jahr?<br />
h e r o i n , j a<br />
k l a r<br />
Am Sielwalleck ist – oder war – fast<br />
alles zu haben. Er verkauft es, immer<br />
noch. Ein Gespräch über Sucht,<br />
Geld, Dealerei und bigotte Politik
S I E L W A L L<br />
D i e Z e i t s c h r i f t d e r S t r a ß e<br />
Ein Projekt der Hochschule für Künste<br />
Bremen und der Hochschule Bremerhaven<br />
in Zusammenarbeit mit<br />
der Inneren Mission und der GISBU<br />
Bremerhaven.<br />
D i e S t r a ß e d e r Z e i t s c h r i f t<br />
Jede Ausgabe findet ihre Geschichten<br />
an einem Ort in Bremen / Bremerhaven.<br />
S e h e n – H ö r e n – S c h r e i b e n<br />
Jedem Artikel geht eine Beobachtung<br />
voraus – im oberen Seitenabschnitt.<br />
A b r e i ß e n o d e r d r a n l a s s e n ?<br />
Gute Frage. Probieren Sie’s aus!<br />
K a u f e n<br />
Die Zeitschrift der Straße gibt<br />
es nur auf der Straße. Von Verkäufer-<br />
Innen, die keine Wohnung haben<br />
oder in anderen Schwierigkeiten sind.<br />
Die Hälfte des Verkaufspreises ist<br />
für sie. Zum Start springen ausnahmsweise<br />
auch Studierende als VerkäuferInnen<br />
ein.<br />
W i e w e i t e r ?<br />
Die Zeitschrift der Straße erscheint<br />
alle sechs Wochen. Die nächste<br />
Ausgabe Mitte März.<br />
E D I T O R I A L<br />
5<br />
53° NORD & 8° OST<br />
F o t o :<br />
K o l j a B u r m e s t e r<br />
S e h e n h ö r e n<br />
S c h r e i b e n<br />
Liebe Leserinnen und Leser!<br />
Dies ist die Zeitschrift der Straße. Die erste Bremer Straßenzeitung.<br />
Ein Magazin und eine gemeinsame Arbeit von Studierenden, Wohnungslosen,<br />
SozialarbeiterInnen, Hochschullehrenden und JournalistInnen<br />
aus Bremen und Bremerhaven.<br />
Zeitschrift der Straße ist sie auf gleich zweifache Weise. Weil sie erstens<br />
auf der Straße – und nur dort! – verkauft wird. Von Menschen,<br />
die bisweilen auch auf der Straße leben. Und weil sie zweitens die<br />
Straße, genauer: jeweils eine Straße, einen Ort aus Bremen oder Bremerhaven,<br />
zum Thema macht. In dieser Ausgabe den Sielwall.<br />
Sehen, hören, schreiben. Das bedeutet: Unsere Autorinnen und Autoren<br />
sind mit wachen Augen und Ohren durch diese Straße gezogen.<br />
Sie haben beobachtet und gelauscht, entdeckt und hinterfragt. Was<br />
passiert hier? Was versteckt sich? Was ist hier zu sehen?<br />
Und denken Sie jetzt bloß nicht nur an Autos, Kaugummis und eilige<br />
Passanten! Wir haben weit mehr gefunden: blinde Köche, geheime<br />
Schulen, desillusionierte Dealer, gelangweilte Berliner, verschüttete<br />
Gräben und aberwitzige Hochhauspläne. Außerdem seltsame Zeichen<br />
an der Wand und verirrte Gestalten zwischen Wirklichkeit und<br />
Fiktion. Wir sind sicher: So haben auch Sie das Eck und den Sielwall<br />
noch nie gesehen.<br />
Armin Simon<br />
für das Team der Zeitschrift der Straße<br />
P.S.<br />
Ihre Meinung interessiert uns – schreiben Sie an:<br />
post@zeitschrift-der-strasse.de
S I E L W A L L<br />
H i s t o r i e<br />
1861<br />
2011<br />
Z A H L E N<br />
6 7<br />
sielwall<br />
Nord-Süd-Verbindung ( 170° )<br />
vom Ostertorsteinweg zum Osterdeich,<br />
trennt Ostertor- und<br />
Steintorviertel. 450 Meter lang.<br />
Ausbau zur Straße ab ca. 1850<br />
R e c h e r c h e : T i m o R o b b e n , M e i k e<br />
D ö s c h e r - M e h r t e n s , K o l j a B u r m e s t e r<br />
T e x t : J e n s K a u l b a r s<br />
F o t o : P r i s c a K r a n z<br />
Nicht immer war die Kreuzung, an der die Straßen Am<br />
Dobben, Sielwall, Ostertorsteinweg und Vor dem Steintor<br />
zusammentreffen, die geographische und kulturelle<br />
Mitte des Viertels. Vor der großflächigen Bebauung des<br />
Steintors dümpelte hier ein Wassergraben Richtung Weser.<br />
Wer stadtein- oder stadtauswärts wollte, musste<br />
die Brücke passieren.<br />
So idyllisch, wie es der Bremer Landschaftsmaler<br />
Carl Georg Köster 1861 darstellt, sah es am Eck damals<br />
allerdings keineswegs aus. Der Pfad auf der Böschung<br />
westlich des Grabens, der Sielwall – benannt nach dem<br />
verschließbaren Deichdurchlass vorne an der Weser<br />
( Siel ) – war längst zur Straße ausgebaut, der Graben<br />
selbst, der Dobben, zum stinkenden Abwassersammler<br />
verkommen. So sehr stank er, dass die Bürgerschaft<br />
1860 beschloss, einen Kanal zu bauen und den Graben<br />
zuzuschütten. Die Arbeiten begannen im Jahr darauf,<br />
finanziert durch den Verkauf der dabei neugewonnenen<br />
Baugrundstücke.<br />
Der ursprüngliche Plan, den Wasserlauf zu erhalten,<br />
auch auf der östlichen Seite mit einer Allee zu versehen<br />
und ihn so zu einer großzügigen Nord-Süd-Promenade<br />
auszubauen, war damit vom Tisch. Kösters Winter-Bild<br />
vom lieblichen Flüsschen, schreibt die Bremer<br />
Sozialhistorikerin Wiltrud Drechsel, sei wohl als eher<br />
romantischer Bürgerprotest zu verstehen – gegen die<br />
Verstädterung.<br />
Gemälde: Brücke über den Dobbengraben ( Sielwall )<br />
„ Am Steintor im Winter “ , Carl Georg Köster, 1861,<br />
Bremer Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte<br />
( Focke-Museum ). Maße: 62 x 86 cm.<br />
Überfahrten der Sielwallfähre pro Jahr,<br />
einfache Fahrt: 30.000<br />
Passagiere pro Fahrt, im Schnitt: 20<br />
Beratungsgespräche der AIDS-Hilfe, pro Tag: 15<br />
Kosten eines HIV-Tests dort, in Euro: 25<br />
Am Sielwalleck verkaufte Skateboards,<br />
pro Jahr: ca. 1.000<br />
Am Sielwalleck verkaufte Wasserpfeifen,<br />
pro Monat: 500<br />
Letztes Feuer auf der Sielwallkreuzung: 4. 6. 2010<br />
Letztes Fußballspiel ebendort: 3. 4. 2010<br />
Kinobesucher im „Cinema am Ostertor“,<br />
pro Monat: fast 6.000<br />
SchülerInnen der Moks-Theaterschule,<br />
pro Jahr: ca. 200<br />
Dönerfleisch, das an einem Samstagabend am<br />
Sielwall über den Tresen geht, in Kilogramm: 140<br />
Von den Friseuren am Sielwalleck in einer Woche<br />
abgeschnittene Haare, in Kilogramm: 20<br />
Grundstückspreis im Bereich Sielwall,<br />
in Euro pro Quadratmeter: 530<br />
Anteil der ledigen EinwohnerInnen im Steintor,<br />
in Prozent: 80<br />
Preis einer Kugel Koks am Sielwall, in Euro: 50<br />
Koks-Inhalt einer Kugel, in Gramm: 0,8<br />
Stimmenanteil „Die Linke“ im Wahlbezirk Steintor<br />
bei der Bundestagswahl 2009, in Prozent: 21,3<br />
Wahlergebnis der CDU im selben Wahlbezirk<br />
bei derselben Wahl, in Prozent: 10,7<br />
Autos auf der Sielwallkreuzung, pro Tag: 13.000<br />
Straßenbahnen ebendort, pro Tag: 600<br />
Sperrung der Sielwallkreuzung für die Dreharbeiten<br />
des Films „Neue Vahr Süd“, in Stunden: 52<br />
Espresso-Konsum in einem der Cafés<br />
am Eck, in Tassen pro Tag: 30<br />
Cappuccino-Konsum im selben<br />
Café, in Tassen pro Tag: 50<br />
Verkaufte Latte macchiato im selben<br />
Café, in Gläsern pro Tag: 180<br />
Bierverkauf in einem Shop am Eck an einem<br />
durchschnittlichen Samstag im Jahr 2007, in Kisten: 25<br />
Bierverkauf im selben Shop im Jahr 2010,<br />
nach Freigabe des Ladenschlusses, in Kisten: 6<br />
Nicht weggeräumte Hundehaufen<br />
entlang des Sielwalls: 138
S I E L W A L L<br />
M i , 1 2 . 0 3 U h r , z w i s c h e n<br />
K ö r n e r w a l l u n d L u i s e n s t r a ß e<br />
Zwei Handwerker laufen<br />
rauchend vorüber<br />
1 2 . 0 4 U h r<br />
Eine Frau auf einem Lastenfahrrad<br />
fährt vorüber<br />
×<br />
1 2 . 0 6 U h r<br />
Ein Mann mit Langstock kommt<br />
rasch auf Haus Nr. 27 zu, er<br />
scheint den Weg zu kennen und<br />
geht so schnell wie ein Sehender<br />
gehen würde. Er schließt<br />
die Tür auf und verschwindet im<br />
Haus. An einem Klingelschild<br />
steht rechts „Verein für Blinde“<br />
und links ein Aufkleber mit<br />
Brailleschrift.<br />
8<br />
r e p o r t a g e<br />
×<br />
An einem<br />
Klingelschild<br />
steht rechts<br />
„Verein für<br />
Blinde“ und<br />
links ein Aufkleber<br />
mit<br />
Brailleschrift.<br />
9<br />
Das<br />
Knistern<br />
der Butter<br />
Frau Schmidt kann nichts mehr<br />
sehen. Jetzt bringt sie anderen das<br />
Kochen bei. Ein Besuch zwischen<br />
sich bräunendem Wirsing und<br />
einer sprechenden Küchenwaage<br />
T e x t : F r i e d e r i k e G r ä f f<br />
F o t o s : C a r o l i n K l a p p<br />
Es gehe darum, etwas anzubieten, hat<br />
Frau Kunert am Telefon gesagt. Deswegen<br />
der Kochkurs, denn dadurch könnten<br />
die Blinden Gastgeber sein und nicht immer<br />
nur diejenigen, die etwas empfingen.<br />
Frau Kunert ist Geschäftsführerin des<br />
Vereins für Blinde, sie taucht im Kochkurs<br />
gar nicht auf, aber wichtig ist sie<br />
doch, denn sie war es, die Angelika<br />
Schmidt ermuntert hat, den Kurs zu geben.<br />
Angelika Schmidt trägt eine dunkle<br />
Brille, Jeans, und beim Begrüßen merkt<br />
sie, dass sie das T-Shirt falsch herum anhat,<br />
weil sie die Nähte an der Seite spürt,<br />
also verabschiedet sie sich ins Bad und<br />
kommt mit gewendetem T-Shirt zurück.<br />
Sie bewegt sich schnell durch die Räume,<br />
links das Büro, rechts die Küche und daneben<br />
der große Gemeinschaftssaal. Zum<br />
Kochkurs am Mittwoch kommen immer<br />
nur zwei Leute, die Küche wäre für mehr<br />
zu klein, und es wäre viel zu anstrengend,<br />
mehr als zwei Leute anzuleiten, aber das<br />
versteht man erst später.<br />
Heute sind Herr Schwitters und Frau<br />
Plump gekommen. Herr Schwitters ist 71<br />
Jahre alt, er sieht auf einem Auge noch<br />
zu 20 Prozent und macht Scherze, dass<br />
Frau Schmidt ihn zu sehr scheuche. Es<br />
sind Jungsscherze, die Frau Schmidt pariert<br />
oder auch überhört. Frau Schmidt<br />
siezt Herrn Schwitters, der seit sechs<br />
Jahren zum Kochen an den Sielwall<br />
kommt, und sie duzt Frau Plump, die seit<br />
elf Jahren kommt und nach einer Star-<br />
Operation nur noch von den Rändern der<br />
Augen her sehen kann. Das sind dann etwa<br />
drei Prozent pro Auge und die Sonnenblumen<br />
auf den Papierservietten, die<br />
auf den Tischen ausliegen, sind für sie nur<br />
Flecken. „Wenn mir jemand sagt, wieviel<br />
Finger halte ich hier hoch, dann könnte<br />
ich böse werden“, sagt sie, und das will<br />
etwas heißen, denn Frau Plump hat einen
S I E L W A L L<br />
D a s<br />
K n i s t e r n d e r<br />
B u t t e r<br />
10<br />
r e p o r t a g e<br />
11<br />
H i e r s t e h t e i n b e g l e i t e n d e r T e x t z u m F o t o . M e n t a u d a m r e s t ,<br />
v o l e s t i b e a q u i s i n i m v e l e n d a n d i p i e t a u t e .<br />
mädchenhaften Liebreiz an sich, dem man<br />
nicht widerstehen kann.<br />
Frau Plump ist 81 Jahre alt, Frau Schmidt<br />
ist 50. Als sie das das erste Mal an den<br />
Sielwall kam, waren die meisten Besucher<br />
jenseits der 70 – jetzt gibt es auch Mittvierziger<br />
– und sie war eigentlich auf der<br />
Suche nach jungen Leuten. Aber das Töpfern<br />
hat ihr Spaß gemacht, dann hat sie die<br />
Kinderbetreuung übernommen und allmählich<br />
ist sie hineingerutscht in die Mitarbeit.<br />
70 Prozent der Blinden sind über<br />
60 Jahre alt, meist sind es Unfälle oder Alterskrankheiten,<br />
die ihnen die Sehkraft genommen<br />
haben. Angebote speziell für junge<br />
Leute sind schwer zu finden. Viele<br />
Schülerinnen und Schüler der Bremer<br />
Schule für Sehbehinderte kommen aus<br />
ganz Niedersachsen und haben nachmittags<br />
noch einen langen Heimweg vor sich.<br />
Der Verein für Blinde sitzt seit über 100<br />
Jahren am Sielwall, gegründet mit dem<br />
Geld dreier Stifter, und ursprünglich standen<br />
dort auch Werkstätten, aber die Zeit,<br />
in der die Blinden hier Besen banden, ist<br />
lange vorbei. Heute finanziert sich der<br />
Verein vor allem über Mieteinnahmen aus<br />
seinen Häusern und über Spenden, der<br />
Senat schießt jährlich 23.500 Euro zu. Am<br />
Sielwall versteht man sich in erster Linie<br />
als Begegnungsstätte. Es ist nicht der einzige<br />
Anlaufpunkt für die etwa 2.000 Blinden<br />
und Sehbehinderten in Bremen: Im<br />
Blinden- und Sehbehindertenverein Bremen<br />
haben sich Betroffene – mit Unterstützung<br />
des Vereins für Blinde – selbst<br />
organisiert, um ihre Interessen zu vertreten.<br />
Es gibt Stimmen, die das für zeitgemäßer<br />
halten als eine Organisation, in der<br />
vor allem Sehende für Blinde tätig sind.<br />
Falsch verstandene<br />
Zeichen<br />
Den Ausschlag dafür, dass Frau<br />
Schmidt beim Verein für Blinde arbeitet,<br />
hat Frau Kunert gegeben, die ihr sagte:<br />
„Mach’ langsam, wir sind hier nicht auf der<br />
Flucht!“, und so konnte sie es sich vorstellen:<br />
langsam, nach ihrem Tempo. Sie<br />
kommt eineinhalb Stunden vor Kursbeginn<br />
an den Sielwall, dann muss sie sich<br />
nicht hetzen. „Eben noch mal über die<br />
Straße, das ist vorbei“, sagt sie.<br />
Verkehr, das ist für sie Hochkonzentration.<br />
Angelika Schmidt hat beim Mobilitätstraining<br />
gelernt, die Geräusche zu deuten,<br />
und bevor sie eine Straße überquert,<br />
wartet sie, bis sie nichts mehr hört. Das<br />
kann dauern. Frau Plump hat bislang kein<br />
Training besucht, drei Ampeln kann sie<br />
beim Einkaufen zu Hause benutzen, viele<br />
Leute helfen. Sie hat lange versucht,<br />
das schlechte Sehen zu vertuschen, mittlerweile<br />
hat sie keine Lust mehr dazu.<br />
Jetzt fragt sie manchmal sogar, wer sie da<br />
wohl gegrüßt hat, wenn sie die Stimme<br />
nicht erkennt. „Aber es bleibt schwierig,<br />
wenn man so selbstständig war“, sagt sie,<br />
Frau Schmidt und Herrn Schwitters geht<br />
es ähnlich. Frau Schmidt hat heute morgen<br />
versehentlich eine Teekanne vom<br />
Tisch gefegt, danach war sie erst einmal<br />
bedient. Die Sehenden, sagt sie, müsse<br />
man sich erziehen. Ihren Mann zum Beispiel,<br />
damit er ihr sagt, ob er den Tisch<br />
bereits abgewischt hat, damit sie es nicht<br />
zum zweiten Mal tut. Man müsse den Se-<br />
henden klar machen, wie wichtig es ist,<br />
Dinge an ihren alten Ort zurückzustellen.<br />
Manchmal sind aber auch die Nicht-gut-<br />
Sehenden ein bisschen begriffsstutzig: Als<br />
Frau Plump eine Frau mit Rollator mit<br />
Blindenplakette an jeder Seite sah, die einen<br />
Fahrplan las, da dachte sie „Ich falle<br />
vom Glauben ab“.<br />
Auch die Sache mit den Kennzeichen ordnen<br />
viele falsch ein: Die gelbe Armbinde<br />
ist ein Zeichen für eine Behinderung –<br />
aber ein Gehörloser kann sie ebenso tragen<br />
wie ein Blinder. Es gibt zwar ein spezifisches<br />
Zeichen für Blinde, nämlich eine<br />
weiße Figur mit Stock vor grünem Hintergrund,<br />
aber das kennen nur wenige. Einmal<br />
hat ein Mann Frau Plump darauf angesprochen<br />
und gesagt, wie sehr er sich<br />
freue, dass jemand im Wanderverein sei.<br />
Sie hat ihm erklärt, dass es für Blindheit<br />
stehe, und es war ihm sehr peinlich.<br />
Zum Kochkurs kommt Frau Plump, um<br />
am Ball zu bleiben, so sagt sie, und weil<br />
ihr Kopf sonst einroste. Früher ist sie<br />
dienstags zum Blindenschrift-Kurs gekommen,<br />
aber wegen der Altersdiabetes<br />
ist das Gefühl in ihren Händen geschwunden,<br />
nun kocht sie stattdessen. „Bevor<br />
ich gekommen bin, hat meine Frau gesagt:<br />
‚Mein Mann kann essen.‘ Jetzt sagt sie: ‚Er<br />
kann essen und kochen.‘“, sagt Herr<br />
Schwitters. Und dann sagt er noch, dass<br />
er früher viel gearbeitet habe, bis er nach<br />
einem geplatzten Blutgefäß operiert wurde<br />
und die Frau vom Arbeitsamt ihm sagte:<br />
„Ihre Arbeitskraft ist nicht mehr von<br />
wirtschaftlichem Wert.“<br />
Die Sonnenblumen<br />
auf den<br />
Papierservietten<br />
sind für<br />
sie nur Flecken<br />
Er erzählt es nebenbei und doch nicht nebenbei,<br />
so wie Frau Schmidt nebenbei und<br />
nicht nebenbei erzählt, dass sie auf keinen<br />
Fall Cliquenwirtschaft in ihrem Kochkurs<br />
haben wolle, also keine Leute, die sagen<br />
„Nee, mit der will ich nicht zusammen kochen!“,<br />
weil sie selbst keine guten Erfahrungen<br />
mit Gruppen gemacht habe. Oder<br />
die Geschichte von den Freunden ihres<br />
Mannes, die sie vor der Hochzeit zu sich<br />
einluden und dann den Fernseher einschalteten.<br />
Nach dem Abend hätten sie zu ihrem<br />
Mann gesagt: Mit deiner Freundin<br />
lässt sich nichts anfangen, du musst dich<br />
zwischen ihr und uns entscheiden.<br />
Kürbisbrot<br />
und Wirsingeintopf<br />
Frau Schmidts Sehnerven sind kaputt,<br />
sie werden nicht wieder heilen, und<br />
nun möchte sie anderen Blinden zeigen,<br />
dass das Leben dennoch weitergeht. Sie<br />
zeigt es sehr praktisch, mit Kürbisbrot<br />
und Wirsingeintopf. Die Rezepte sind<br />
sehr sehr groß gedruckt, trotzdem beugt<br />
Frau Plump den Kopf tief übers Papier.<br />
„Wie merke ich denn, dass der Wirsing<br />
bräunt?“, fragt Herr Schwitters, während<br />
Frau Plump vorliest. „Psst“, macht Frau<br />
Schmidt, aber nachher erklärt sie, dass<br />
man es merke, weil der Wirsing dann ein<br />
wenig am Topf haften bleibe.<br />
Es gibt ein paar Tricks und einige Hilfsmittel<br />
in der Küche, in der die Schubladen<br />
und Knöpfe mit Brailleschrift beschriftet<br />
sind. Die Hilfsmittel sind teuer. Die sprechende<br />
Waage zum Beispiel kostet 100<br />
Euro. Es war eines der ersten Hilfsmittel,<br />
das sich Frau Plump anschaffte, und dann<br />
gab die Waage nur Unverständliches von<br />
sich. „Zero“, sagte sie, und Frau Plump<br />
fragte ihre Schwiegertochter, was das bedeuten<br />
solle. „Null“, sagte die Schwiegertochter.<br />
„Auf Englisch.“ „Ich kann kein<br />
Englisch“, sagte Frau Plump, und dann haben<br />
sie die Waage zurückgebracht, es war<br />
ein falscher Chip darin, und nun spricht<br />
sie deutsch. „Guten Tag“, sagt die Waage<br />
im Sielwall zu Herrn Schwitters, „guten<br />
Tag“, sagt Herr Schwitters. Frau Schmidt<br />
erklärt, dass man am Knistern höre, wann<br />
die Butter heiß ist, und sie zeigt Frau<br />
Plump, wie man den praktischen Gemüseschneider<br />
zusammensetzt. Frau Plump<br />
versucht alles, was auf den Boden fällt, sofort<br />
wieder aufzusammeln, weil man<br />
sonst so leicht fällt.<br />
Vor der Tür liegt Salomon, ein Hütehund,<br />
genauer ein Australian Shepard. Ihn ein<br />
Hilfsmittel zu nennen, trifft es nicht. Salomon<br />
war eine der Etappen auf Frau<br />
Schmidts Weg zurück in das Leben, das<br />
weiterging, auch ohne Sehnerven. Frau<br />
Schmidt kann die Schule, die Salomon ausgebildet<br />
hat, nicht genug loben. Der Trainer<br />
hat sie auch noch gemeinsam geschult<br />
und nun führt Salomon Frau Schmidt nicht<br />
nur zum richtigen Lift, sondern auch zu einem<br />
freien Platz im Zug. Frau Plump findet,<br />
dass sie selbst zu alt sei für Hund und<br />
Ausbildung, aber sie kann gar nicht fassen,<br />
was Salomon alles kann. „Ich muss mich<br />
100-prozentig auf ihn verlassen können,<br />
sonst hat es keinen Sinn“, sagt Frau<br />
Schmidt, und dann sagt sie noch, dass sie<br />
Salomons bestes Schaf sei.<br />
Nach der Blindenschule hat Frau Schmidt<br />
eine Ausbildung zur Korb- und Stuhlflechterin<br />
gemacht, inzwischen gibt sie<br />
Kurse für Blinde und für Sehende. Bei einem<br />
der Kurse hat ein Teilnehmer, ein<br />
Sehender, gefragt: „Wo ist denn die Kursleiterin?<br />
Sie können doch gar nicht sehen.“<br />
„Ich bin die Kursleiterin“, hat Frau<br />
Schmidt ihm geantwortet und gesagt,<br />
dass sie nicht unterrichten würde, wenn<br />
sie nicht wüsste, dass sie es könne. Vermutlich<br />
hat der Schüler dann nichts mehr<br />
gesagt, auf jeden Fall ist er nach dem Ende<br />
des Kurses zu Frau Schmidt gegangen,<br />
hat ihr Blumen geschenkt und sich bedankt.<br />
Frau Schmidt ist sehr befriedigt,<br />
wenn sie sich daran erinnert.<br />
Jetzt zeigt sie Frau Plump, wie man die<br />
250 Milliliter Gemüsebrühe abmisst. Es<br />
gibt eine Schaufel, die genau so viel fasst.<br />
Aber wie merkt man, dass sie voll ist?<br />
„Man hört es“, sagt Frau Schmidt. Es gibt<br />
aber auch einen elektrischen Piepser, den<br />
man an einen Becher anhängen kann. Der<br />
schlägt Alarm, sobald das Gefäß voll ist.<br />
Herr Schwitters bemerkt, dass er vergessen<br />
hat, die Sonnenblumenkerne in sein<br />
Kürbisbrot zu tun. „Sie sind wohl blind“,<br />
sagt Frau Schmidt.
S I E L W A L L<br />
D o , 1 4 . 3 0 U h r<br />
Die Sonne scheint.<br />
Auffallend viele Hunde.<br />
×<br />
1 4 . 4 0 U h r , v o r m S i e l w a l l h a u s<br />
Ein Polizist schiebt einen<br />
leeren Kinderwagen Richtung<br />
Deich. Street Art im Sinne<br />
von Performance?<br />
1 5 . 0 5 U h r , S i e l w a l l k r e u z u n g<br />
Ein alter Mann verklebt Plakate<br />
für die Uni Nacht XL: Main-Area,<br />
Rock-Area und 60s-Area – Bier<br />
für Studenten nur 2 €! Retro-Trend<br />
oder schon Post-Street Art?<br />
12<br />
E s s a y<br />
13<br />
×<br />
Ein Polizist<br />
schiebt einen<br />
leeren Kinderwagen<br />
Richtung<br />
Deich.<br />
Street Art im<br />
Sinne von<br />
Performance?<br />
Im Leichen<br />
schauhaus<br />
Früher gab es Parolen, Tags, Graffiti<br />
und Plakate – Sachbeschädigung und<br />
Ärgernis. Heute gibt es „Street Art“,<br />
zur Kunst geadelt, beliebt, aber tot<br />
T e x t : R a d e k K r o l c z y k<br />
F o t o : M a r i o W e z e l<br />
Es ist eine Modeerscheinung, die vor lauter Mode gerade wieder aus<br />
der Mode kommt: im urbanen Raum angebrachte Bilder, Schriften<br />
und Objekte. Nicht irgendwelche, sondern solche mit einem gewissen<br />
Anspruch, gekonnt ausgeführt, inhaltlich „sinnvoll“. Wand- und<br />
Schablonenbilder, ausgeschnittene Plakate und Wandmosaike sind<br />
ihre häufigsten Formen. Sie trägt einen Namen, der sie adelt: „Street<br />
Art“, Straßen-Kunst.<br />
Der popularisierende Begriff schafft einen Unterschied zwischen<br />
der schlechten Schmiererei und Plakatiererei auf der einen<br />
und der guten, ästhetischen Zierde auf der anderen Seite. Er scheidet<br />
Illegitimes von Legitimem. Bevor es „Street Art“ gab, gab es Parolen,<br />
Tags, Graffiti und Plakate. Sachbeschädigung und Ärgernis,<br />
einzigartig und provisorisch. Gattungslos waren die Werke, bar einer<br />
größeren Funktion, Individuen und Störenfriede. Kunst sollten<br />
und wollten sie nie sein – und zogen genau daraus ihre Stärke. Manches,<br />
was heute an den Mauern entsteht, vermittelt noch eine Ahnung<br />
davon. Sprüche wie jener an der Schule Ecke Sielwall / Osterdeich:<br />
„We are young, we are gifted, we are useless“. Bilder wie die<br />
der Bremer Künstlergruppe Marnic Circus: seltsame, fantastische
S I E L W A L L<br />
I m<br />
L e i c h e n s c h a u -<br />
H a u s<br />
14<br />
E s s a y<br />
15<br />
Tiere, die sich mit langen, disfunktionalen Körpern und viel zu vielen<br />
Beinen nicht nur im Viertel über die Wände schlängeln.<br />
Den aktuellen Zustand der sogenannten Street Art in Bremen<br />
wie anderswo zu beschreiben, gleicht einer Autopsie. Zwar<br />
werden, wie schon im Sommer 2009 im Rahmen der Ausstellung<br />
„Urban Art“ des Neuen Museum Weserburg, noch immer regelmäßig<br />
Führungen zur „Straßen-Kunst“ angeboten. Neue Plakate, Cutouts,<br />
Schablonenbilder und so weiter tauchen jedoch so gut wie keine<br />
mehr auf. Zu betrachten sind nur noch Reste. Das ist nicht weiter<br />
schlimm, beruhte doch der Hype um „Street Art“ vor allem auf<br />
einem doppelten Irrtum: Es handele sich – erstens – bei den im öffentlichen<br />
Raum angebrachten Bildern und Objekten um Kunst<br />
und – zweitens – um eine subversive oder gar revolutionäre Praxis.<br />
Die Hochphase der „Street Art“ ist im Grunde auf den Beginn<br />
des Jahrtausends zu datieren. Ihr tendenzielles Verschwinden<br />
hängt sicherlich mit dem Einzug in etablierte Museen, der Selbstverwurstung<br />
ihrer bekanntesten Protagonistinnen und Protagonisten<br />
im Kino und der Produktion einer schier unüberschaubaren Menge<br />
an Büchern, Postkarten und vielen anderen Merchandise-Artikeln<br />
mehr zusammen. Auch ihre offensichtliche Rolle innerhalb von<br />
Stadtteilaufwertungsprozessen wird eine Rolle gespielt haben: Die<br />
dekorierten Hausfassaden treten nicht zufällig als Begleiterscheinung<br />
steigender Wohnungsmieten und der Ansiedlung von Luxusläden<br />
in ehemals eher heruntergekommenen Quartieren auf: „Street<br />
Art“ macht das Viertel schick. Derweil geht ein Anwaltsbüro gegen<br />
Wildplakatierer vor. Es wäre jedoch falsch, von Ausverkauf oder gar<br />
Verrat zu sprechen: „Street Art“ ist zu sich selbst gekommen, sich<br />
treu geblieben. Man sollte endlich eine ihrer Leichen suchen und mit<br />
der Untersuchung loslegen.<br />
Etwa in der Mitte des Sielwalls, gegenüber dem Körnerwall,<br />
steht das Sielwallhaus. Eine Art autonomes Zentrum, glücklicher<br />
Treffpunkt der linksradikalen Szene. An seiner Fassade sieht man die<br />
zuplakatierten Reste eines Murals, wie Wandbilder im „Street Art“-<br />
Jargon in beinahe sakraler Verklärung genannt werden. Eine Konferenz<br />
fragt, wie scheiße Deutschland wohl ist, „Mörser“ spielt im Jugendfreizeitheim<br />
Friesenstraße, die Castor-Strecke soll geschottert<br />
werden. Dazwischen ein Wandbild des Streetartisten Armsrock. Es<br />
entstand vor ein paar Jahren und hat als prägendes Vorbild für die<br />
Entwicklung der „Street Art“ im Bremer Stadtraum eine zentrale<br />
Bedeutung. Seine Grundfarbe ist himmelblau optimistisch; ein paar<br />
Gestalten schauen freudig mit erhobenen Armen in die Höhe, als erwarteten<br />
sie den Messias. Eine Figur im Kapuzenpullover hält eine<br />
Handvoll Vögel an Fäden. Eine andere zerschneidet die Fäden und<br />
schenkt den Vögeln die Freiheit. Es ist schlimm: Das Haus, das ehemals<br />
mit seiner schmutzigen Fassade, seinen Parolen und Plakaten<br />
einer in Grundzügen feindlichen Welt trotzte, ist zum netten Nachbarn<br />
degradiert. Es wird noch etwas brauchen, um sich zu erholen.<br />
In den Seitenstraßen des Viertels sowie an anderen Orten<br />
der Stadt findet man noch eine ganze Reihe unglücklicher, sozial deklassierter,<br />
lebensgroßer Papierfiguren. Sie stammen aus demselben<br />
Atelier wie besagtes Wandbild; für die Bremer „Street Art“-Szene<br />
sind sie stilbildend. Es gibt keinen Streit um sie. Einfach, weil sie sich<br />
nicht zum Streiten eignen. Sie provozieren nicht, im Gegenteil: Sie<br />
ästhetisieren das Elend und stellen es bloß, machen es – unter dem<br />
Label politisch ambitionierter Kunst im öffentlichen Raum – sogar<br />
annehmbar und verdoppeln es auf romantische Weise. Die Papierfiguren<br />
dienten einmal einer Modeboutique am Dobben als Ladendekoration.<br />
Einfach, weil sie sich zum Dekorieren eignen. Sie sind<br />
Wohlfühltapeten für den öffentlichen Raum.<br />
„Street Art“ ist everybody’s darling, und das sein zu dürfen,<br />
bezahlt sie mit Belanglosigkeit. Je schöner, gekonnter und kunstvoller,<br />
desto langweiliger. Alle Äußerungen im öffentlichen Raum, die<br />
man ihr zuschlägt, indem man sie zur „Kunst“ adelt, fallen in ihrer<br />
ganzen Harmlosigkeit weder auf noch sonst wie ins Gewicht.<br />
Man kann heute Touristinnen und Touristen dabei beobachten,<br />
wie sie im Viertel Plakate, Schablonenbilder und Ähnliches fotografieren,<br />
das sie seit der Popularisierung von „Street Art“ gelernt<br />
haben, für Kunst zu halten. Ortsansässige kann man dabei beobachten,<br />
wie sie ihre Hausfassaden neu streichen, sie von dem ganzen<br />
Geschmiere reinigen, aber übrig lassen, was sie seit der<br />
Popularisierung von „Street Art“ gelernt haben, für Kunst zu halten.<br />
Wer so beliebt ist, dem bleibt nur noch der Tod.
S I E L W A L L<br />
F O T O S T R E C K E<br />
16 17<br />
hinter<br />
den<br />
wänden<br />
F o t o s : C a r o l i n N o w i c k i
S I E L W A L L<br />
F O T O S T R E C K E<br />
18 19
S I E L W A L L<br />
20<br />
F O T O S T R E C K E<br />
21
S I E L W A L L<br />
22<br />
F O T O S T R E C K E<br />
23
S I E L W A L L<br />
D o , 1 6 . 0 5 U h r , S i e l w a l l e c k<br />
Ein asiatisches Pärchen steht<br />
an der Ampel. Beide in Werder-Jacke,<br />
Werder-Mütze, Werder-Tasche,<br />
Werder-Handschuhen. Sie unterhalten<br />
sich aufgeregt.<br />
1 6 . 0 9 U h r<br />
Ein Mann mit Gehwagen schafft es<br />
nicht in der grünen Ampelphase über<br />
die Straße. Die Autofahrer warten.<br />
Er zieht das linke Bein nach, wirkt<br />
gehetzt.<br />
×<br />
1 6 . 1 0 U h r<br />
Zwei Männer auf der anderen<br />
Straßenseite unterhalten sich angeregt.<br />
Ihre Einkaufstaschen<br />
sind voll und schwer. Zu den beiden<br />
sich unterhaltenden Männern<br />
gesellt sich ein dritter, nun reden<br />
sie zu dritt. Es scheint, als<br />
tauschten sie die Neuigkeiten<br />
des Viertels aus. Es wirkt wie auf<br />
dem Dorfplatz meines<br />
Heimatortes.<br />
1 6 . 1 7 U h r<br />
Ein Mann steht an der Ampel.<br />
Als es Grün wird, zögert er. Er geht<br />
los, bleibt stehen, kehrt um.<br />
24<br />
F e a t u r e<br />
×<br />
Es wirkt<br />
wie auf dem<br />
Dorfplatz<br />
meines<br />
Heimatortes<br />
25<br />
Bremen 21<br />
Eine Bürgerinitiative stoppte<br />
1973 den Komplettabriss des Viertels.<br />
Um ein Haar wäre Bremen zur<br />
Großstadt geworden. Ein Rückblick<br />
T e x t : K o l j a B u r m e s t e r<br />
F o t o : M a r i o n K l i e s c h<br />
Neulich war mal wieder Besuch da. Aus<br />
Berlin. Ehemalige Bremer. Das ist immer<br />
besonders schlimm.<br />
Zusammen saß man – Samstagmittag – im<br />
Café an der Sielwallkreuzung, schaute<br />
durch die Fenster auf das Treiben. Fahrräder,<br />
Kinder, Omas mit Rollwägen. Einigermaßen<br />
rücksichtsvolle Autofahrer, die<br />
junge Familien, voll bepackt vom Ökomarkt<br />
zum Spielplatz strebend, geduldig<br />
über die Straße ziehen lassen. Viele kleine<br />
Gespräche auf dem Bürgersteig. Jeder<br />
scheint jeden zu kennen, und man selber<br />
fragt sich, warum man eigentlich noch immer<br />
auf dem Dorf wohnt. Diesem Dorf.<br />
Die Berliner schwärmen: „Mein Gott, ist<br />
das schön hier. Und so friedlich. Wann<br />
ziehst Du endlich nach Berlin? Oder zumindest<br />
New York? Das hält man ja nur<br />
’n paar Tage hier aus. Das ist ja ’n Riesendorf.<br />
Und die Häuser so klein!“<br />
Es ist schon wahr. Das Viertel ist ein Dorf.<br />
Ein riesengroßes zwar. Aber ein Dorf. Ein<br />
Dorf mit Straßenbahn. Immerhin.<br />
Es hat nicht viel gefehlt, und das betuliche<br />
Bremer Viertel hätte sich mit der<br />
Frankfurter Skyline messen können. Bremen-Tenever<br />
stünde im Ostertor. Das<br />
Kottbusser Tor in Kreuzberg wäre nichts<br />
gegen den Sielwall.<br />
Am Abend des 4. Dezember 1973, ein<br />
Dienstag, ist die Sache durch. In einer hitzigen<br />
Sitzung beschließt die SPD-Bürgerschaftsfraktion<br />
mit der knappen Mehrheit<br />
von 26:24 Stimmen, das Quartier<br />
niederzureißen und fast vollständig neu<br />
zu gestalten. Die SPD regiert allein. CDU<br />
und FDP sind eh dafür.<br />
Multifunktionale<br />
Stadtgroßform<br />
Die vierspurige „Mozarttrasse“<br />
vom Rembertikreisel bis zum Flughafen<br />
ist dabei nur der kleinste Teil des ambitionierten<br />
Megaplans. Es geht um die<br />
neue Stadt, um Sachlichkeit, Rationalität,<br />
Moderne. Gleich mehrere Städteplaner<br />
sind auf das Projekt angesetzt. Sie wollen<br />
Leben und Freizeit und Arbeit im Stadtkonzept<br />
voneinander trennen und die<br />
einzelnen Bereiche durch Autotrassen<br />
miteinander verbinden. Vorbild sind, wie<br />
der damalige Bürgermeister Hans Koschnick<br />
( SPD ) herausstellt, die Ideen von<br />
Le Corbusier, Übervater des Städtebaus<br />
der 60er Jahre.<br />
Neubaupläne gibt es viele, besonders vorangetrieben<br />
von der „Bremer Treuhand“<br />
und der „Neuen Heimat“ – zwei Wohnungsbaugesellschaften,<br />
die nach dem<br />
Krieg anfangen, das Viertel aufzukaufen<br />
und unter sich aufzuteilen. Alte Filmaufnahmen<br />
zeigen, wie Beamte des Bonner<br />
Bundesministeriums für Raumordnung,<br />
Bauwesen und Städteplanung in Bussen<br />
wie Touristen den Ostertorsteinweg entlangchauffiert<br />
werden. Ludwig Gregord,<br />
Chefplaner der Bremer Treuhand, gibt<br />
am Mikrofon den Fremdenführer: „Sie sehen<br />
hier links und rechts, das ist nicht<br />
mehr zu halten, das wird alles dem Erdboden<br />
gleichgemacht.“<br />
Wir stapfen durch das Milchquartier. Die<br />
Berliner lästern über die hohen Bremer
S I E L W A L L<br />
B r e m e n 2 1<br />
F e a t u r e<br />
26 27<br />
Kaffeepreise und erfreuen sich an einem Das Bremen der 60er Jahre ist eine aufstrebende<br />
Stadt. Die Werften pumpen<br />
Kätzchen, das seelenruhig auf dem Pflaster<br />
einer Fußgängerstraße zwischen Löwenzahn<br />
und Vergissmeinnicht döst. Hil-<br />
könnte sich verdoppeln, glaubt man, Bre-<br />
Geld in die Kassen. Die Einwohnerzahl<br />
de, die seit ein paar Jahren nicht mehr in men sich zur norddeutschen Metropole<br />
Hastedt, sondern in einer Prenzelberger entwickeln, mit Platz für mindestens<br />
Atelierwohung lebt, schaut entzückt 800.000 Menschen. Hierfür braucht es<br />
durch die Fenster des Wiener Hof Cafés. Wohnraum, am besten innenstadtnah,<br />
Drinnen hat sich seit 1973 nichts mehr modern und hochgeschossig – zumal die<br />
verändert. Jedes Bild hängt noch an derselben<br />
Stelle. Wie Fische in einem Aquanungsnot<br />
sorgen. Schon in den 30ern gilt<br />
Kriegsschäden noch immer für Wohrium<br />
steuern die immergleichen Figuren<br />
durch den hell erleuchteten Gastraum.<br />
Die Treuhand hätte damit Schluss gemacht.<br />
Weg mit den holperigen Gässchen,<br />
den handtuchbreiten Häuschen,<br />
den feuchten Hinterhöfen. Stattdessen:<br />
eine Asphaltpiste vom Rembertikreisel<br />
stracks nach Süden, vierspurig über die<br />
Weser, links und rechts davon bis zu<br />
30-geschossige Türme, eine Hochhauslandschaft<br />
von der Schleifmühle bis zum<br />
Osterdeich, von den Wallanlagen bis zur<br />
Lüneburger Straße. „Multifunktionale<br />
Stadtgroßform“ betitelt das Städtebauinstitut<br />
Nürnberg sein Konzept, hinter<br />
der – „nur für den Dienstgebrauch“ –<br />
skizzierten imposanten Silhouette ragen<br />
gerade noch die Domtürme empor. Als<br />
Ost-West-Verbindung, zur Entlastung<br />
des Osterdeichs, schlagen die Planer eine<br />
weitere Straße durch das dicht bebaute<br />
Quartier, die sich über den Körnerwall<br />
bis zur Lüneburger Straße zieht.<br />
Was dafür alles weichen muss, hat das<br />
Stadtplanungsamt im Zuge einer Ortsbegehung<br />
bereits penibel kartiert.<br />
Es wird kein Zufall gewesen sein, dass<br />
die Grundlage für das große Abräumen<br />
aus Hannover kommt, der Stadt, die bis<br />
heute als Musterbeispiel für städtebaulichen<br />
Kahlschlag gilt. Professor Wilhelm<br />
Wortmann, dort ansässiger Stadtplaner,<br />
liefert im Auftrag der Treuhand ein „Gesamtkonzept“<br />
fürs Bremer Viertel. Ergebnis:<br />
Große Teile des Ostertors und<br />
Steintors seien nicht mehr zu halten und<br />
müssten komplett erneuert werden.<br />
Wer heute von der Kreuzung Dobbenweg<br />
/ Bismarckstraße zum Rembertikreisel<br />
geht, kann die ersten Umsetzungen<br />
dieser Pläne bewundern.<br />
das von Einzelhandel und engen Gassen<br />
geprägte Viertel als überplanbarer Bereich,<br />
als Spielwiese für Stadtplaner. Kurz<br />
nach Kriegsende verhängt der Senat einen<br />
Sanierungsstopp für das gesamte Ostertor<br />
/ Steintor und gibt das Quartier damit<br />
bewusst dem Verfall preis. Die Alteingesessenen<br />
finden sich mehr oder weniger<br />
mit dem bevorstehenden Abriss ab.<br />
Das wird<br />
alles dem Erdboden<br />
gleichgemacht<br />
Filmaufnahmen zeigen traurige Bilder von<br />
alten Bewohnern, die sich für wenig Geld<br />
haben enteignen lassen, etwas wehmütig<br />
in die Umzugswagen steigen und zum Abschied<br />
in die Kamera winken. Der Wert<br />
ihrer ehemaligen Häuser, am Rande bemerkt,<br />
vervielfacht sich in den Folgejahren.<br />
Faktisch sind die Immobilien damals<br />
für ’n Appel und ’n Ei zu haben. Mancher<br />
ihrer heutigen Besitzer ist erstaunlich<br />
hellsichtig gewesen.<br />
Die Berliner und ich stehen an der trüben<br />
Weser. Wer hier, mitten in der Stadt,<br />
mit dem Rücken zum Viertel auf den<br />
Stadtwerder guckt, könnte ebenso gut irgendwo<br />
in der niedersächsischen Provinz<br />
auf das andere Flussufer schauen. „Das<br />
da drüben ist die wahre Bremer City“,<br />
stichelt Markus, der schon Anfang der<br />
90er nach Berlin geflüchtet ist: „Eine<br />
Kleingartensiedlung mit Holzhäusern und<br />
Vereinsheimen.“<br />
Ich bin zu müde, um dem seltsamen Impuls<br />
nachzugeben, die Kleingartenanlage,<br />
in der eine befreundete Studenten-WG<br />
neuerdings auch eine Parzelle mietet, zu<br />
verteidigen. Hilde springt mir bei. „Im<br />
Sommer ist es dort sehr schön“, sagt sie:<br />
„Und außerdem leben da angeblich seltene<br />
Vogelarten.“ Dass ich da nicht selbst<br />
drauf gekommen bin! Wir trotten flussaufwärts<br />
zurück zum Sielwall.<br />
Borgward geht bald nach dem Krieg pleite.<br />
Der Motorisierung tut das keinen<br />
Abbruch. Bremens Antwort darauf ist<br />
die Trassentangente: eine Autobahn<br />
rings um die Innenstadt. Anfang der 70er<br />
steht die Hochstraße am Hauptbahnhof<br />
vor ihrer Vollendung. Im Westen schließt<br />
sie mit dem monströsen Nordwestknoten<br />
an die neubetonierte Weserquerung<br />
an. Im Süden sorgt die mehrspurige<br />
Neuenlander Straße für freie Fahrt. Was<br />
fehlt, ist die Spange im Osten. Da ist das<br />
Viertel im Weg.<br />
Immerhin: Mit dem Rembertikreisel sind<br />
auch hier die ersten Schritte getan. Wo<br />
heute Autos ebenso lustig wie sinnlos um<br />
eine riesige Wiese im Kreis fahren, leben<br />
in den 60er Jahren noch Menschen. Dann<br />
rollen die Bagger an, fressen sich durch<br />
die Häuser. Ganze Straßenzüge fallen ihnen,<br />
wie die Wilhelmstraße, vollständig<br />
zum Opfer, andere, wie die Bohnenstraße,<br />
in Teilen. Von der Sonnenstraße stehen<br />
bloß noch Reste. An der Meinkenstraße<br />
reißen die Planer im hinteren Teil<br />
die komplette westliche Häuserfront weg.<br />
Den Bewohnern der östlichen Straßenseite,<br />
heute Eduard-Grunow-Straße, asphaltieren<br />
sie eine Autobahn vor die<br />
Wohnzimmerfenster. Diese Fakten zeigen<br />
jedem, was im Viertel nun folgen soll.<br />
Niedrige Mieten und die Nähe zur Innenstadt<br />
machen das Ostertor zunehmend interessant<br />
für junge Leute. Ein Vergnügungsviertel<br />
entwickelt sich. Die Stadt<br />
schaut skeptisch auf ein sich langsam etablierendes<br />
Rotlichtmilieu und auf ein aufkeimendes<br />
Lebensgefühl, das später einmal<br />
die 68er-Bewegung genannt werden<br />
wird und das hier anfängt, sich eine neue<br />
Heimat aufzubauen. Rudi Dutschke spricht<br />
in der Lila Eule, die Fahrpreiserhöhung der<br />
Straßenbahn eskaliert zum Straßenkampf<br />
und macht bundesweit Schlagzeilen. Junge<br />
Bremer Genossen um Olaf Dinné fangen<br />
an, die Kommunalpolitik für sich zu entdecken.<br />
„Sollten wir weiterhin Demos gegen<br />
die Amis in Vietnam, die Russen in der<br />
CSSR oder die Notstandsgesetze machen?“,<br />
fragt Dinné im Rückblick: „Es zeigte<br />
sich, dass wir uns im eigenen Viertel mal<br />
genauer umsehen sollten!“<br />
Vom Vietnam - Krieg<br />
zum Trassenkampf<br />
Und sie sehen sich um. Als erstes<br />
unterwandern sie den für das Viertel zuständigen<br />
SPD-Ortsverein Altstadt und<br />
machen Front gegen das Stadtumbauprojekt.<br />
Zwar sitzt kein Heiner Geißler mit<br />
am Küchentisch der Mozartstraße 5 –<br />
hier hat der Ortsverein seinen Sitz –, es<br />
gibt weder Wasserwerfereinsatz noch<br />
Großdemonstrationen. Die Parallelen zu<br />
Stuttgart 21 sind dennoch offenkundig.<br />
Hier wie dort weisen die Befürworter<br />
auf die demokratische Legitimation der<br />
seit langem verfolgten Planungen hin. Sie<br />
führen infrastrukturelle Notwendigkeiten<br />
ins Feld. Nicht zuletzt wird offenbar,<br />
wie viel Geld schon geflossen ist und<br />
wer welche Gewinne einberechnet hat.<br />
Wie beim Konflikt um Stuttgart 21 sind<br />
große Teile der Bevölkerung gegen das<br />
Projekt. Ludwig Gregor von der Treuhand<br />
bringt dies in einer Fernsehdebatte<br />
auf den Punkt, als er die Unwilligkeit<br />
der Eigentümer beklagt: „Das Grundproblem<br />
im Ostertor ist doch zweifellos:<br />
Wir müssen in den Besitz der Grundstücke<br />
kommen.“<br />
Die Stimmung im Viertel kippt. Mehr und<br />
mehr gehen die Anwohner auf Konfrontationskurs.<br />
Nach einer Umfrage des Arbeitskreises<br />
Ostertor sind 95 Prozent<br />
von ihnen gegen das Projekt. Ein Umbau-<br />
Plan folgt auf den nächsten, begleitet jeweils<br />
von Widerstandsaktionen seitens<br />
der Gegner. Jahrelang geht das so. Legendär<br />
eine Bürgerversammlung im Chorprobensaal<br />
des Goethe-Theaters im Juli<br />
1973 mit über 800 Teilnehmern: Spätestens<br />
jetzt ist klar, dass die Bewohner des<br />
Viertels keines der Großbauvorhaben akzeptieren.<br />
Dessen ungeachtet bestätigt<br />
die SPD-Fraktion das Projekt – an ebenjenem<br />
Dienstagabend, dem 4. Dezember<br />
1973. Das Viertel ist geschockt.<br />
Es gibt viele Theorien darüber, was in<br />
der Nacht nach diesem Beschluss geschieht.<br />
Die populärste besagt, dass der<br />
damalige Fraktionsvorsitzende Walter<br />
Franke zuhause beim Abendbrot von seiner<br />
Frau dermaßen zusammengefaltet<br />
wird, dass er am nächsten Tag seine Fraktion<br />
ein weiteres Mal einberuft und zur<br />
Umkehr zwingt. Die wahrscheinlichere<br />
ist, dass die Abgeordneten und der Senat<br />
noch in der Nacht realisieren, dass<br />
sie diesen Beschluss gegen die Bevölkerung<br />
nicht durchhalten können, und kalte<br />
Füße bekommen. Wie auch immer: Jedenfalls<br />
tagt die Fraktion am Mittwoch<br />
erneut. Um 15 Uhr hat sie das erst am<br />
Vorabend beschlossene Projekt wieder<br />
vollständig gekippt – einstimmig, bei elf<br />
Enthaltungen.<br />
Offiziell behaupten die Abgeordneten,<br />
die Kosten hätten sich über Nacht verdoppelt,<br />
womit sich eine neue Beschlussgrundlage<br />
ergeben habe. Den Wohnungsbaugesellschaften<br />
stellt der Senat<br />
unbürokratisch die Wiesen in Tenever<br />
zur Verfügung – wo diese sich umgehend<br />
an die Umsetzung ihrer Ideen machen.<br />
Die Party in dieser Nacht im Ortsverein<br />
in der Mozartstraße 5 endet in einem<br />
grandiosen Besäufnis. Das Viertel ist<br />
gerettet.<br />
Nicht so die SPD. 1979 zieht Dinné mit<br />
der Grünen Liste in die Bürgerschaft<br />
ein – das erste Landesparlament der Grünen<br />
–, macht der SPD die Macht streitig<br />
und fällt mit zum Teil überraschend konservativer<br />
Politik auf – bestrebt, das Viertel<br />
zu dem Hort der Ruhe und des Friedens<br />
zu machen, das es schlussendlich geworden<br />
ist: ganz ohne Hochhäuser, mit<br />
kleinen Läden, verkehrsberuhigten Spielstraßen,<br />
schicken Geschäften, Einkaufsgenossenschaften<br />
und Biosupermärkten.<br />
Aneinander geraten die Viertel-Schützer<br />
immer wieder mit Punks, McDonalds,<br />
Autonomen, Junkies und anderen, die<br />
nun ihrerseits versuchen, sich das Ostertor<br />
zu eigen zu machen.<br />
Seit jeher gibt es im Viertel unterschiedliche<br />
Meinungen über die Gestaltung des<br />
öffentlichen Raumes. Ende 2010 startet<br />
eine neue Initiative mit dem richtungsweisenden<br />
Namen „Business Improvement<br />
District“. Initiatoren sind Geschäftsinhaber,<br />
die das Quartier in ihrem Sinne aufwerten<br />
wollen. Unter anderem ziehen sie<br />
gegen Graffiti zu Feld, wollen das Viertel<br />
sauber und attraktiv für auswärtige Kunden<br />
machen: Das Dorf soll sich rausputzen,<br />
um konkurrenzfähig zu bleiben. Die<br />
Mieten steigen. Wer sie nicht zahlen kann,<br />
flüchtet nach Walle oder in die Neustadt.<br />
Mit dem „Planet Boy“ schließt im Sommer<br />
2009 das letzte alternative Café. Das<br />
subkulturelle Image des Viertels ist endgültig<br />
nur noch Legende.<br />
Einzig der Gründungsmythos lebt weiter:<br />
Der Widerstand gegen die Mozarttrasse<br />
ist nach wie vor identitätsstiftend. Das<br />
Viertel versteht sich noch heute als gallisches<br />
Dorf gegen ein übermächtiges Rom.<br />
Wo sonst in Bremen kippen Bürger einen<br />
Drive-In und spielen nachts auf einer<br />
Straßenkreuzung Fußball?<br />
Wir sitzen wieder im selben Lokal und<br />
trinken den zweiten Kaffee. Draußen<br />
laufen immer noch alte Bekannte vorüber.<br />
Es fängt an zu regnen. Die Lichter<br />
der Geschäfte spiegeln sich in den<br />
schmutzigen Pfützen. Der Sielwall leert<br />
sich. Wir reden über Werder und das<br />
Wetter und darüber, dass ein paar<br />
30-stöckige Hochhäuser vielleicht doch<br />
so schlecht nicht wären. Denn vielleicht<br />
wäre Bremen dann eine richtige Großstadt<br />
geworden. Und nicht ein großes<br />
Dorf mit Straßenbahn.
S I E L W A L L<br />
F r , 8 . 0 0 U h r , S i e l w a l l k u r z<br />
v o r m O s t e r d e i c h<br />
Reger Betrieb am Eingang Gesamtschule<br />
Mitte/Standort Brokstraße.<br />
SchülerInnen eilen zum Unterricht.<br />
Es ist noch dunkel. Eine Clique<br />
wartet vor dem Tor. Gedämpfte<br />
Gespräche.<br />
8 . 0 1 U h r<br />
Von links und rechts strömen<br />
weitere SchülerInnen im Halb dunkel<br />
herbei, allein und in Pärchen. Die<br />
meisten tragen eine Umhängetasche<br />
über der Schulter, wenige<br />
einen Rucksack.<br />
8 . 0 2 U h r , S i e l w a l l / K ö r n e r w a l l<br />
Keine SchülerInnen, keine Kinder:<br />
Im Kindergarten „Piccobello“<br />
sind noch Ferien.<br />
×<br />
8 . 0 6 U h r , S i e l w a l l k u r z<br />
v o r m O s t e r d e i c h<br />
Ein Schüler mit schwarzer Umhängetasche<br />
fährt mit dem Rad eilig in<br />
Richtung Weser. Er muss zur Schule.<br />
Den Körnerwall lässt er<br />
rechts liegen.<br />
8 . 0 9 U h r , S i e l w a l l a u f<br />
H ö h e K ö r n e r w a l l<br />
Am Schulgebäude Brokstraße steht<br />
niemand mehr vor der Tür. Die<br />
Klassenzimmer sind hell erleuchtet.<br />
N A M E D E R<br />
R E P O R T A G E<br />
3 Z e i l e n<br />
28<br />
F e a t u r e<br />
×<br />
Der Schüler<br />
muss zur<br />
Schule. Den<br />
Körnerwall<br />
lässt er rechts<br />
liegen.<br />
29<br />
Schule,<br />
verboten<br />
Sie wollten anders lernen, selbstorganisiert.<br />
Der Staat verbot es.<br />
Unterricht gabs trotzdem jahrzehntelang<br />
– versteckt in einem Wohnhaus,<br />
getarnt als Kindergarten.<br />
Ein Besuch in Bremens ehemals<br />
geheimster Lehranstalt<br />
T e x t : A r m i n S i m o n<br />
F o t o s : J u l i a H e r m e s m e y e r<br />
Vielleicht kann man sie doch noch einmal<br />
wieder brauchen. Deswegen sind<br />
sie nur eingelagert, unten im Keller,<br />
links eine Holztür, der Lack schon etwas<br />
angegilbt. Dahinter Kisten über Kisten,<br />
und, im Halbdunkeln obenauf gestapelt,<br />
die Bänke. Mobiliar einer Schule,<br />
die es nicht mehr gibt. Weil es sie nie<br />
geben durfte.<br />
Gabriele Dühren schließt die Tür. Nebenan,<br />
im Ausgang zum Garten, stehen bunte<br />
kleine Schuhe, an der Wand Jacken<br />
und Anoraks. Kindergetrappel im Hochparterre.<br />
Das ist, was blieb: Ein Kindergarten<br />
in Eigenregie. Ein Keller voll Gerümpel.<br />
Und ein paar Dutzend neue<br />
Eltern, die eine Freie Schule gründen wollen,<br />
basisdemokratisch wie einst jene im<br />
Untergrund. Auch über die Art des Unterrichts<br />
wollen die Eltern selbst entscheiden.<br />
Der Senat sträubt sich, immer<br />
noch. Der Antrag liegt zum wiederholten<br />
Male vor Gericht. Dühren, die Erzieherin,<br />
muss jetzt wieder nach oben.<br />
Selbstorganisiertes<br />
Lernen<br />
Das Café an der Ecke hat Scheiben<br />
bis zum Boden. Unverstellter Blick auf<br />
den Körnerwall: ein U-förmiges Sträßchen<br />
um einen Rasenfleck, in der Mitte eine<br />
stattliche Platane. Meredith sitzt am Fenster,<br />
da draußen ist sie jahrelang vorbeigelaufen.<br />
Es war ihr Schulweg, von dem niemand<br />
wissen durfte. Einen Ranzen trug<br />
sie nicht. In die elfte Klasse geht sie heute,<br />
im Schulzentrum Rübekamp, demnächst<br />
will sie Abitur machen. Vor ein<br />
paar Jahren noch gab sie auf Fragen zum<br />
Thema Schule nur sehr ausweichende<br />
Antworten. Welche Klasse?, wollten etwa<br />
ihre TurnkameradInnen und die Trainerin<br />
im Zirkusunterricht von der Grundschülerin<br />
wissen. „Bei uns gibt’s nur<br />
Gruppen“, erwiderte die. „Und in welcher<br />
Gruppe bist Du?“ Meredith zuckte<br />
dann bloß mit den Achseln. „Die konnten<br />
sich da nichts drunter vorstellen“, sagt sie,<br />
„aber nachgehakt haben sie nicht.“ Eine<br />
Untergrund-Schule? „Wenn irgend etwas<br />
so undenkbar ist, kann es ganz leicht existieren<br />
in der Öffentlichkeit“, drückt es eine<br />
Mutter aus, deren Sohn ebenfalls auf<br />
die geheime Schule ging.<br />
Merediths vier Grundschuljahre verstreichen<br />
unbehelligt. Dass es Kinder im<br />
schulpflichtigen Alter gibt, die zwar in<br />
Bremen gemeldet, aber an an keiner<br />
Schule angemeldet sind, fällt niemandem<br />
auf. Erst mit dem Schulwechsel wird’s<br />
brenzlig. Denn Zeugnisse können die Kinder<br />
vom Körnerwall keine vorweisen.
S I E L W A L L<br />
S c h u l e ,<br />
v e r b o t e n<br />
F e a t u r e<br />
30 31<br />
Manche wechseln kurz vor Ende der vierten<br />
Klasse auf eine offizielle Schule – Umzug<br />
nach Bremen, sozusagen. Meredith<br />
kommt ihre zweite Muttersprache zugute.<br />
„Ich hab gesagt, ich war in Frankreich<br />
auf der Schule.“ „Wo?“, will ihre neue<br />
Lehrerin wissen. „Im Perigord.“ Das ist<br />
schön weit weg.<br />
Und die Schulen dort müssen ziemlich<br />
sonderbar sein. Meredith jedenfalls kann<br />
die ihre in den buntesten Details beschreiben.<br />
„Ich habe einfach erzählt, wie<br />
es hier war“, sagt sie und kann sich das<br />
Lachen nicht verkneifen. Sie denkt gern<br />
an ihre Zeit am Körnerwall zurück.<br />
An ihre Schule, die so „anders“ ist als alle<br />
anderen, „ungewöhnlich“ und „einzigartig“,<br />
wie Beteiligte schwärmen. In der<br />
die älteren den jüngeren Kindern das<br />
Rechnen beibringen. In der im Klassenzimmer,<br />
wenn man den Raum unterm<br />
Dach mit der Tafel an der Wand so nennen<br />
kann, ein dicker Ordner auf dem Pult<br />
liegt, aus dem sich morgens jede SchülerIn<br />
selbst ihre Aufgaben und Themen<br />
raussucht. Eine Schule, die das Miteinander<br />
großschreibt, ganztags. Die ihre SchülerInnen<br />
vor allem lehrt, die Dinge zu suchen,<br />
die sie interessieren. Eine Schule,<br />
die Spaß macht.<br />
Wenn irgend‐<br />
etwas so<br />
undenkbar ist,<br />
kann es ganz<br />
leicht existieren<br />
in der<br />
Öffentlichkeit<br />
„Freie Kinderschule“, haben sie sie getauft,<br />
kurz: „Kischu“. Team- und Projektarbeit<br />
sind hier Standard, Lehrerinnen und Lehrer<br />
assistieren eher. Die jahrgangsübergreifende<br />
Gruppe zählt selbst zu Hochzeiten<br />
gerade mal zwei Dutzend<br />
SchülerInnen. Lehrpläne gibt es, wenn<br />
überhaupt, nur rudimentär, Noten gar<br />
nicht. Dafür einen Toberaum im Keller.<br />
Frontalunterricht sucht man vergeblich,<br />
und keine Klingel brüllt im 45-Minuten-<br />
Takt. Andere Kinder, lernt Meredith, als<br />
sie zu Beginn der fünften Klasse auf die<br />
Gesamtschule wechselt, müssen sich<br />
nachmittags extra treffen, wenn sie etwas<br />
zusammen unternehmen wollen.<br />
„Wir konnten sowas in der Schule machen“,<br />
sagt sie. Und Hausaufgaben gibt’s<br />
am Körnerwall erst gegen Ende des vierten<br />
Schuljahrs – zur Vorbereitung auf die<br />
Staatsschulwelt.<br />
Ein offenes<br />
Geheimnis<br />
„Nischen“ habe man genutzt, sagt eine<br />
der Erwachsenen, die das Schulprojekt<br />
damals mit organisiert hat, Nischen<br />
im System. Freiräume, auf die der Staat<br />
keinen Zugriff hat. Sie bedauert, dass es<br />
davon immer weniger gibt. Dabei ist das<br />
Projekt, das 1979 mit den ersten SchülerInnen<br />
startet und bis zur offiziellen Enttarnung<br />
28 Jahre läuft, längst nicht so geheim,<br />
wie viele im Nachhinein behaupten.<br />
Im Gegenteil. Ganz offen habe man die<br />
selbstorganisierte Schule anfangs beworben,<br />
und das jahrelang, berichten deren<br />
GründerInnen. Es gibt Infostände und<br />
Werbung, die Initiative tritt öffentlich auf<br />
und präsentiert ihr Konzept. „Alle wussten<br />
davon“, sagen sie.<br />
Sogar einen offiziellen Antrag beim Bildungssenator<br />
stellt die Initiative damals:<br />
auf Anerkennung einer privaten Erstschule<br />
im Grundschulbereich. Er wird<br />
nie behandelt. In Berlin, Frankfurt, Kassel,<br />
Bochum und anderswo entstehen<br />
Freie Schulen, mit Billigung der Behörden.<br />
Die SPD in Bremen aber hat kein<br />
Interesse, das staatliche Grundschulmonopol<br />
aufzubrechen.<br />
Andererseits: Allzuviel Aufsehen will die<br />
Bildungsbehörde um die Schulrebellen<br />
auch nicht machen. 1988 schickt sie einen<br />
blauen Brief. Der Schulbetrieb am<br />
Körnerwall sei umgehend einzustellen,<br />
verfügt sie darin. Man wolle keine „Freie<br />
Republik Ostertor“, begründet Bildungssenator<br />
Horst-Werner Franke.<br />
Offiziell ist das Problem damit erledigt.<br />
De facto ändert sich gar nichts. Unter die<br />
vielen Kinder, die tagtäglich am Körnerwall<br />
in den Kindergarten gehen, mischen<br />
sich weiterhin auch ältere, die hier unterrichtet<br />
werden. Einzelne laut Zeitungsberichten<br />
bis zur zehnten Klasse. Der Morgenkreis<br />
ist gemeinsam. Anschließend<br />
gehen die einen zum Spielen, die anderen<br />
zum Lernen – wobei die Übergänge fließend<br />
sind. Das Wohnhaus, dessen<br />
Schriftzug „Kaffé Körnerwall“ manch<br />
Touristen irritiert, ist groß genug.<br />
„Das Leben fand nicht im Untergrund<br />
statt!“, unterstreicht eine Mutter: „Wir<br />
waren ja da.“ Umstellen muss sich nach<br />
dem Brief aus der Behörde vor allem die<br />
Öffentlichkeitsarbeit der Initiative. Mundzu-Mund-Propaganda<br />
ersetzt die Vorträge.<br />
Aus dem Schul-Geheimtipp wird eine<br />
geheime Schule. Die Kinder lernen, deren<br />
Adresse in Gesprächen lieber nicht<br />
zu erwähnen. Und was sie im Fall einer<br />
Kontrolle sagen sollen: „Wir sind ’ne<br />
Klasse, die ein Praktikum macht, und sich<br />
’nen Kindergarten anguckt.“ „Ich dachte<br />
manchmal schon: ‚Ätsch, ich bin geheim,<br />
ich bin nicht öffentlich‘“, erinnert sich<br />
Meredith: „Das war lustig.“ Ideal war es<br />
nicht: „Manchmal will man ja gar nicht underground<br />
sein.“<br />
Die Schlinge<br />
zieht sich zu<br />
Es gibt einige, die überzeugt sind,<br />
dass die Kischu auch im Bildungsressort<br />
UnterstützerInnen hatte. Mit der Schließungsverfügung<br />
habe sich die Behörde lediglich<br />
„den Rücken freihalten“ wollen,<br />
sind sie überzeugt. Eines Mittags stehen<br />
auf einmal trotzdem zwei Kontrolleure in<br />
der Tür. „Das war immer ein offenes<br />
Haus“, berichtet eine Erzieherin. Bis heute<br />
fehlt die Klingel. Das Gros der Kinder,<br />
Glück oder Zufall, ist gerade ausgeflogen<br />
– Schwimmunterricht. Nur zwei sind zufällig<br />
noch da. „Wo gehst du denn zur<br />
Schule?“, will der Beamte von einem der<br />
„ I c h d a c h t e m a n c h m a l s c h o n : ‚ Ä t s c h , i c h b i n g e h e i m ‘ “ ,<br />
e r i n n e r t s i c h M e r e d i t h . N u r m a n c h m a l , d a w o l l t e s i e g a r<br />
n i c h t u n d e r g r o u n d s e i n<br />
Mädchen wissen. „Das sag ich nicht!“, erwidert<br />
dieses keck. Ende der Kontrolle.<br />
Die Anerkennung der „Kinderschule“<br />
als staatliche Modellschule, die „das Lernen<br />
vom Kinde aus als wesentlichstes<br />
Element definiert“ und 1994 in die Lothringer<br />
Straße nach Schwachhausen umzieht,<br />
spaltet das Do-it-yourself-Projekt.<br />
Viele nutzen die Gelegenheit und wechseln<br />
in die Legalität. Einige aber lehnen<br />
eine größere Schule – wie die Behörde<br />
sie verlangt – ab. Sie machen heimlich<br />
weiter. „Kinderschule“ und „Kischu“ bezeichnen<br />
fortan zwei unterschiedliche<br />
Einrichtungen. Und wer das nicht so genau<br />
wissen will, dem fällt es erst einmal<br />
nicht auf. Die Kischu am Körnerwall,<br />
drücken Beteiligte es aus, bleibt „ein offenes<br />
Geheimnis“.<br />
Die Nischen aber werden enger. Weiterführende<br />
Schulen wollen Zeugnisse sehen.<br />
Die Behörde startet systematische<br />
Melderegisterabfragen, gleicht diese mit<br />
den Schulanmeldungen ab. Die Schlinge<br />
zieht sich zu. Wer dem entgehen will,<br />
muss sein Kind anderswo anmelden, in<br />
Niedersachsen etwa, oder gleich einen<br />
Auslandsaufenthalt vortäuschen. KriminalistInnen<br />
würden sagen: Der Verfolgungsdruck<br />
steigt.<br />
„Es war abzusehen, dass das über kurz<br />
oder lang auffliegen würde“, schildert eine<br />
Mutter im Rückblick die Situation.<br />
Die Eltern nehmen Kontakt zu Politiker-<br />
Innen auf, suchen nach Auswegen für<br />
ihre Kinder, die im Körnerwall unterrichtet<br />
werden. In den Gesprächen ist die<br />
Rede von einer Freien Grundschule. „Es<br />
war klar, dass es nicht um eine Neugründung<br />
ging“, erinnert sich die Mutter. Und<br />
dass man damals leider „mit den Falschen<br />
Tacheles geredet“ habe. Das war im<br />
Frühjahr 2007.<br />
Die Behörde, jetzt offiziell in Kenntnis<br />
von der Untergrund-Schule, reagiert<br />
erbost. Zwar bezweifelt auch hier niemand,<br />
dass die Kischu die Kinder gut ausbildet.<br />
Und viele der pädagogischen Ansätze,<br />
die sie in den 80er Jahren<br />
modellhaft einführte, haben auch staatliche<br />
Schulen inzwischen übernommen.<br />
Den Zorn der StaatsvertreterInnen erregt<br />
vielmehr die Dreistigkeit der Eltern,<br />
die jahrzehntelang ihre eigene Schule betreiben<br />
– über die Jahre zählt das Körnerwall-Projekt<br />
wohl deutlich mehr als 200<br />
SchülerInnen. Wie viele es tatsächlich<br />
waren, weiß noch immer niemand. Von<br />
„Lügen“ und „Betrug“ ist die Rede, vom<br />
Hintergehen der Behörden und „Verletzung<br />
der Schulpflicht“. Zivilpolizei<br />
schleicht ums Haus, die Feuerwehr inspiziert<br />
die Räume. Wie „Staatsfeinde“ habe<br />
man sie angeschaut, berichtet eine<br />
Mutter. Die neue Schließungsverfügung<br />
der Behörde kommt postwendend.<br />
Noten gibt es<br />
nicht. Dafür<br />
einen Toberaum<br />
im Keller<br />
Bis zu den Sommerferien, das handeln die<br />
Eltern aus, darf der Schulbetrieb noch<br />
weiterlaufen. Dann müssen alle Kischu-<br />
Kinder auf offizielle Schulen wechseln, ih-
S I E L W A L L<br />
F r , 1 7 . 2 6 U h r , S i e l w a l l e c k<br />
Ein Polizeibulli sperrt die Kreuzung.<br />
Blaulichter spiegeln sich in Pfützen.<br />
1 7 . 3 1 U h r<br />
Aus dem Steintor nähert sich ein<br />
Demonstrationszug. Auf dem Transparent<br />
steht : „Laye Condé, am<br />
27.12 . 2004 in Bremen durch Brechmitteleinsatz<br />
ermordet“.<br />
1 7 . 3 2 U h r<br />
Die Demo erreicht die Kreuzung.<br />
Ein Sylvesterknaller zündet.<br />
1 7 : 3 7 U h r<br />
Eine Rednerin erinnert daran, dass<br />
Polizeibeamte Condé vor sechs<br />
Jahren hier aufgegriffen hatten, weil<br />
sie ihn verdächtigten, Koks-Kügelchen<br />
verschluckt zu haben. Sie<br />
zitiert den damaligen Innensenator<br />
Thomas Röwekamp ( CDU ) , der<br />
es als „völlig gerechtfertigt“ bezeichnete,<br />
„mit unnachgiebiger Härte<br />
gegen solche Leute vorzugehen“.<br />
×<br />
1 7 . 4 1 U h r<br />
Die Rednerin kritisiert : „Drogen als<br />
Bedrohung von außen und Dealer als<br />
die großen Verführer zu sehen, geht<br />
völlig an der Realität vorbei.“ Drogengebrauch<br />
sei vielmehr für viele<br />
„ein recht alltägliches Verlangen“.<br />
1 7 . 4 9 U h r<br />
DemonstrantInnen enthüllen ein<br />
Denkmal für Condé. Schweigeminute.<br />
1 7 . 5 4 U h r<br />
Die Kreuzung ist wieder frei.<br />
S c h u l e ,<br />
v e r b o t e n<br />
re Eltern eine Geldbuße zahlen. Der Abschied<br />
ist traurig. Die Bänke wandern in<br />
den Keller, der Morgenkreis wird klein.<br />
Die Schule im Wohnhaus, ganz und gar<br />
selbstorganisiert, Lebensraum, soziales<br />
Netzwerk und Treffpunkt für Kinder wie<br />
Eltern, es gibt sie nicht mehr. „Das haben<br />
sie zerstört“, sagt eine Mutter.<br />
Soziale<br />
Spaltung?<br />
Bremen ist das einzige Bundesland,<br />
das, von kirchlichen und Waldorf-Schulen<br />
abgesehen, bis heute keine Freien<br />
Grundschulen duldet. Zuletzt sprachen<br />
sich SPD, Linke und Grüne in der Bürgerschaft<br />
gegen deren Zulassung aus. Erlaubt<br />
sind nur Modellschulen unter staatlichem<br />
Schirm. Kippe das staatliche<br />
Schulmonopol, drohe eine soziale Segregation,<br />
argumentierten die rot-grün-roten<br />
Abgeordneten. Außerhalb des Parlaments<br />
dagegen räumen auch Grüne sowie<br />
manch’ SPD-VertreterInnen ein,<br />
nichts gegen eine Freie Schule zu haben.<br />
32<br />
I N T E R V I E W<br />
33<br />
Den Vorwurf, am Körnerwall die soziale<br />
Spaltung vergrößert zu haben, weisen<br />
die ehemals in der Kischu Engagierten<br />
vehement zurück. „Wir waren keine rein<br />
weiße, deutsche Bio-BildungsbürgerInnen-Schule“,<br />
stellen sie klar. Die Kosten<br />
des Schulprojekts habe man schon immer<br />
solidarisch getragen.<br />
Die neue Freischul-Initiative, organisiert<br />
im Verein „Freie Schule Bremen“ mit Sitz<br />
im Fesenfeld, gegründet 2007, plant ein<br />
ähnliches Finanzmodell. Und, fügt Sprecherin<br />
Karen Knöppler hinzu: Wenn Freie<br />
Schulen auch nur annähernd so viel Geld<br />
vom Staat bekämen wie ihre staatlichen<br />
Pendants, dann bräuchten sie gar kein<br />
Schulgeld zu erheben.<br />
Knöppler hat zwei Kinder, die beide den<br />
Kindergarten im Körnerwall besuchen.<br />
Denselben, aus dem einst auch die Kischu<br />
hervorging. Geht es nach Knöppler,<br />
sollen sie anschließend eine Freie Schule<br />
besuchen. Ihr Verein hat einen neuen Genehmigungsantrag<br />
gestellt. Ein Gutachten<br />
bescheinigt dem Konzept das gesetzlich<br />
geforderte besondere pädagogische Interesse.<br />
Die Bildungsbehörde hat den Antrag<br />
abgelehnt – und in erster Instanz vor<br />
dem Bremer Verwaltungsgericht eine<br />
Niederlage erlitten.<br />
Knöppler hofft, dass das Oberverwaltungsgericht<br />
der Initiative demnächst<br />
ebenfalls Recht gibt. Die erste offiziell anerkannte<br />
Freie Schule Bremens könnte<br />
dann im Prinzip loslegen – vorausgesetzt,<br />
sie findet rechtzeitig Räume. Am Körnerwall<br />
nämlich kann das neue Projekt nicht<br />
starten. Nicht nur, weil die ehemaligen<br />
Klassenzimmer dort inzwischen umgebaut<br />
sind und als Wohnung genutzt werden.<br />
Sondern auch, weil der Verein, wie<br />
Vorstand Sven Golchert unterstreicht, alle<br />
Anforderungen der Schulaufsicht an<br />
das Schulgebäude einhalten will: „Dazu<br />
gehört, eine solche Schule nicht in Räumen<br />
einzurichten, in denen jahrzehntelang<br />
ohne staatliche Genehmigung gearbeitet<br />
wurde.“<br />
×<br />
Die Rednerin<br />
kritisiert :<br />
„Drogen als<br />
Bedrohung von<br />
außen und<br />
Dealer als die<br />
großen Verführer<br />
zu sehen,<br />
geht völlig an<br />
der Realität<br />
vorbei.“<br />
heroin,<br />
ja klar<br />
Am Sielwalleck ist – oder war –<br />
fast alles zu haben. Er verkauft es,<br />
immer noch. Ein Gespräch<br />
über Sucht, Geld, Dealerei und<br />
bigotte Politik<br />
I n t e r v i e w : A r m i n S i m o n<br />
D a s i s t , w a s b l i e b : e i n K i n d e r g a r t e n i n E i g e n r e g i e .<br />
U n d e i n p a a r D u t z e n d n e u e E l t e r n , d i e e i n e F r e i e S c h u l e<br />
g r ü n d e n w o l l e n<br />
E i n l e i t u n g : Er ist so um die 50, einheimisch.<br />
Hat mal als Landschaftsgärtner<br />
gearbeitet. Heroinabhängig<br />
seit Jahrzehnten, mit kleinen<br />
Unterbrechungen. Lebt in Bremen,<br />
derzeit auf der Straße. Stand früher<br />
öfter am Eck. Nennen wir ihn<br />
Andreas. Seinen richtigen Namen<br />
dürfen wir nicht schreiben. Sonst<br />
kriegt er Ärger mit der Polizei. Und<br />
vielleicht auch mit anderen.<br />
Z D S Früher war hier noch mehr los, am Eck.<br />
A N D R E A S Vor zehn Jahren, ja, da ging da echt<br />
noch der Bär. Rund um die Uhr, egal was du<br />
haben wolltest: Schore [ Heroin ], Hasch, Koks,<br />
egal – da gabs alles.<br />
Z D S Und heute?<br />
A N D R E A S ( n a m e g e ä n d e r t ) Da siehste<br />
noch’n paar Schwarze rumspringen, und jeder<br />
weiß: Die verticken da ihr Koks.<br />
Z D S Heroin gibt’s nicht mehr?<br />
A N D R E A S Kaum noch. Die Szene hat sich gesplittet.<br />
Bahnhof, Piepe, Walle – alles bunt verteilt.<br />
Das Steintor ist relativ tot, im Vergleich zu<br />
früher. Das ist heute mehr oder weniger so ’ne<br />
Schicki-Micki-Szene dort.<br />
Z D S Wer kauft da?<br />
A N D R E A S Alle möglichen Leute. Diskogänger<br />
vor allem. Koks ist ’ne teure Sache.<br />
Z D S Wie teuer?<br />
A N D R E A S Die haben Kugeln für zehn Euro, aber<br />
da ist nix drin. 20, 25 Euro musste schon<br />
hinlegen. Für die meisten geht es so ab 50 Euro<br />
los – damit sie ein bisschen was haben. Die<br />
verballern da manchmal ihre 300, 400 Euro am
S I E L W A L L<br />
h e r o i n ,<br />
j a k l a r<br />
34<br />
I N T E R V I E W<br />
35<br />
Abend. Tut mir leid – das hab ich nicht über.<br />
Z D S Was verkaufst du denn?<br />
A N D R E A S Braun [ Heroin ]. Aber ich hab’ schon<br />
beides vercheckt, weiß [Koks] und braun.<br />
Z D S Ist das so was wie ein richtiger Job?<br />
A N D R E A S Anders geht das gar nicht. Die Käufer<br />
wissen genau, um die und die Zeit kommt<br />
der und der, der hat was Besseres, und das bei<br />
dem taugt nichts. Ich würde auch nicht von jedem<br />
kaufen.<br />
Z D S Du hast einen festen Platz?<br />
A N D R E A S Ja. Da gibt’s manchmal richtig Hauerei,<br />
wer wo stehen darf. Es wollen ja alle was<br />
verdienen. Manche machen damit ihre Sucht klar,<br />
wie ich: Da musst du was verdienen, sonst kommste<br />
selbst nicht klar.<br />
Z D S Es sind aber nicht alle, die da Zeugs verchecken,<br />
selbst drauf.<br />
A N D R E A S Die meisten von den Schwarzen zum<br />
Beispiel sind nicht süchtig. Die machen das so<br />
zum Geldverdienen. Viele von denen haben<br />
gerade mal eine Aufenthaltserlaubnis, dürfen<br />
nicht arbeiten. Aber die Klamotten, die die anhaben,<br />
da musste schon ’n bisschen Kohle für<br />
hinlegen. Oder kuck dir die Türken an, die da<br />
rumfahren: Gerade 18 und ’nen dicken Daimler.<br />
Wie lange muss man dafür malochen? Das geht<br />
doch gar nicht.<br />
Z D S Sind Preise Verhandlungssache?<br />
A N D R E A S Klar. Das ist ein normales Geschäft<br />
wie jedes andere auch. Ein Päcken zum Beispiel<br />
kostet so um die acht Euro. Aber jeder versucht,<br />
für so wenig Geld so viel wie möglich zu kriegen.<br />
Z D S Ist denn immer gleich viel drin?<br />
A N D R E A S 0,25 Gramm ungefähr. Kann man sich<br />
kaum vorstellen, dass so ’ne geringe Menge so<br />
viel Geld bringt, ne?<br />
Z D S Und wie viel braucht man davon?<br />
A N D R E A S Die meisten, wenn se richtig drauf<br />
sind, schon zwei.<br />
Z D S Pro Tag?<br />
A N D R E A S Pro Mal. Am Tag brauchen die sechs<br />
bis acht. Was meinste, warum die alle klauen<br />
gehen oder irgendwelche komischen Dinger<br />
machen?<br />
Z D S Du selbst bist auf diese Weise zum Dealer<br />
geworden. Wie war das?<br />
A N D R E A S Erstmal ungewohnt. Aber irgendwie<br />
musste ich das ja finanzieren. Und meine Frau<br />
war auch drauf. Ich musste schon mal nur alleine<br />
für Schore 500 Mark auftreiben. An 365 Tagen<br />
im Jahr. Das mach’ mal! Und koksen willste<br />
auch noch, und Trinken und Rauchen. Da biste<br />
von morgens bis abends am Rödeln.<br />
Z D S Und heute?<br />
A N D R E A S Heutzutage ist der ganze Kram viel<br />
billiger. Trotzdem: Wenn du einigermaßen durchkommen<br />
willst, alleine, musst du schon 30 Päcken<br />
an die Wand schieben.<br />
Z D S Die du erstmal selbst erstehen musst.<br />
A N D R E A S Ja. Wenn du einigermaßen Qualität<br />
haben willst, musst du schon 100 Euro für ’nen<br />
Beutel hinlegen. Für 30 Päcken sind also 150 Euro<br />
weg. Rein kriegste, sagen wir, 240, macht 90<br />
Euro Gewinn. Die brauchste schon. Und da haste<br />
noch kein Tabak, noch kein gar nichts.<br />
Z D S Und wie lange dauert das Verkaufen?<br />
A N D R E A S Du kannst Glück haben und in anderthalb<br />
bis zwei Stunden durch sein. Oder du<br />
stehst vier, fünf Stunden. Je nachdem, was für<br />
Qualität du inner Tasche hast. Und dann kommen<br />
noch die anderen Kameraden, die dich ja<br />
auch gerne haben möchten.<br />
Z D S Die Polizei.<br />
A N D R E A S Ja. Das ist ein Katz- und Maus-Spiel.<br />
Jeder weiß, was läuft. Du passt natürlich ein bisschen<br />
auf, dass es keiner sieht – das geht so von<br />
Hand zu Hand.<br />
Z D S Und wenn die doch eingreifen?<br />
A N D R E A S Das ist nicht so einfach. Haste nur<br />
ein bisschen Zeugs bei Dir, sagste: „Das ist meins.“<br />
Da kann der nix machen. Der muss mich schon<br />
direkt beim Verkaufen erwischen. Oder mit ’ner<br />
großen Menge.<br />
Z D S … die niemand bei sich hat.<br />
A N D R E A S Ne, so verrückt ist man eigentlich<br />
nicht. Auch die Schwarzen, die Gras und so verkaufen,<br />
bunkern das irgendwo. Da gibt es richtige<br />
Lager. Und natürlich auch so’n paar Leutchen,<br />
die davon leben, von einem Bunker zum<br />
nächsten zu rennen … Wenn die anderen die<br />
dann erwischen, dann gibt es richtig Ärger.<br />
Z D S Bist Du selbst mal hopsgenommen worden?<br />
A N D R E A S Einmal, das reicht. Abtransportiert,<br />
U-Haft, verurteilt zu 14 Monaten. Das wars.<br />
Zwei Drittel davon saß ich im Knast, den Rest<br />
gabs auf Bewährung. Ich hatte 86 Gramm dabei<br />
– das ist dann doch ein bisschen zu viel.<br />
Z D S Hast du manchmal ein schlechtes Gewissen?<br />
A N D R E A S Ne. Ich hätte eins, wenn da irgendwelche<br />
Blagen kommen, die 13, 14 sind und von<br />
mir Schore haben wollen. Dann sag ich auch:<br />
Haut ab. Aber wenn einer schon seit 20 Jahren<br />
drauf ist: Ob der das von mir kauft oder von jemand<br />
anderem, ist doch egal. Kaufen tut er es<br />
auf jeden Fall. Ich bin ja selber drauf, ich weiß<br />
genau, wie das ist.<br />
Z D S Angeblich ist der Drogenmarkt fest aufgeteilt<br />
in Bremen.<br />
A N D R E A S Die Schwarzen machen Koks, die<br />
Kurden und Türken machen Schore, grob gesagt.<br />
Das ist so organisiert.<br />
Z D S Und Leute wie du?<br />
A N D R E A S Wir sind Freiberufler. Die Großen<br />
brauchen uns. Wie kommt das Zeugs denn sonst<br />
auf die Straße? Was gut ist, ist, dass sie hier die<br />
Crack-Scheiße weglassen. Wenn du nach Hannover<br />
oder Hamburg fährst, da sitzen sie an jeder<br />
Ecke und hauen sich ihre Glaspfeife rein. Hier<br />
läuft das nicht.<br />
Z D S Weil die Kunden zu anspruchsvoll sind?<br />
A N D R E A S Ne, weil die Clans das hier nicht haben<br />
wollen. Weil die genau wissen, was dann<br />
hier abgeht. Das Zeugs macht dich Banane im<br />
Kopf, die Leute drehen mehr durch, brauchen<br />
mehr Geld. Dementsprechend geht dann die Post<br />
ab. Und da haben die keinen Bock drauf.<br />
Z D S Manche fordern ein härteres Vorgehen gegen<br />
Dealer und Drogen.<br />
A N D R E A S In den Griff kriegen werden sie das<br />
Problem so nie. Die Nachfrage ist da. Und wer<br />
süchtig ist, der scheißt doch drauf, ob das verboten<br />
ist oder nicht. Die größten Dealer, die wir<br />
haben, sind im Übrigen unsere Ärzte. Wenn so<br />
’ne Oma aus der Apotheke kommt, da freut sich<br />
jeder Junkie drüber, was die in der Tüte hat. Und<br />
dann das Methadonprogramm: Eigentlich ist es<br />
ja dafür gedacht, dass die Leute langsam runterkommen.<br />
Daran haben die meisten Ärzte aber<br />
gar kein Interesse. „Was, du brauchst noch zwei<br />
Milliliter? Du kannst auch vier haben!“ Im Grunde<br />
dreht sich doch im Leben fast alles nur<br />
um Kohle.<br />
Z D S Sollte man alle Drogen einfach freigeben?<br />
A N D R E A S In den Staaten haben sie mal den Alkohol<br />
verboten. Und was hat das bewirkt? Es<br />
hat die Mafia reich gemacht. Guck dir die Schweiz<br />
an, Holland, mit ihren Heroin-Programmen. Die<br />
haben Ruhe. Bei uns hat der Bundestag das zwar<br />
genehmigt, aber wo gibt’s das? Hier in Bremen<br />
jedenfalls noch nicht. Selbst Polizeipräsidenten<br />
sagen doch schon: Gebt den Scheiß frei, dann<br />
kriegen wir das auch in den Griff. Die ganze Kriminalität<br />
fiele schon mal weg.<br />
Z D S Aber würde denn die Zahl der Abhängigen<br />
so sinken?<br />
A N D R E A S Es würden weniger einsteigen. Alles,<br />
was verboten ist, reizt doch. Außerdem wären<br />
dann auch bedeutend weniger Dealer auf der<br />
Straße unterwegs.<br />
Z D S Du wärst deinen Job los!<br />
A N D R E A S Wenn ich mein Zeug auf Rezept kriegen<br />
würde, dann brauch’ ich das nicht mehr.<br />
Z D S Was ist mit ’ner Entgiftung: Würdest du<br />
das machen?<br />
A N D R E A S Würd’ ich schon. Was meinst Du,<br />
wie oft ich hier sitze und Frust schiebe: Das ist<br />
doch kein Leben! Aber ’ne Entgiftungsstelle kannst<br />
du frühestens in zehn bis 12 Wochen kriegen.<br />
Und ich brauch’ erstmal’n Dach überm Kopf.<br />
Sonst bringt das nämlich gar nix.<br />
Z D S Halten staatliche Methadon- oder gar Heroin-Programme<br />
Süchtige nicht davon ab, eine<br />
Entgiftung zu machen?<br />
A N D R E A S Man muss ehrlich sein: Die meisten<br />
wollen gar keine. Die machen das aus irgendwelchen<br />
Gründen, weil die Bagis Theater macht oder<br />
das Gericht. Guck mal, wie viele Leute danach<br />
wieder drauf sind –. Und das kostet ein Heidenmoos!<br />
Wenn einer das wirklich machen will, okay.<br />
Aber von 100 Leuten sind das vielleicht zehn.<br />
Dem Rest sollte man das Zeugs geben.<br />
Z D S Auf Dauer macht das aber auch kaputt.<br />
A N D R E A S Jeder, der trinkt, macht sich kaputt.<br />
Das ist legal, da meckert keiner rum. Ändern<br />
kannst’es eh nicht: Wenn ich saufen will, sauf’<br />
ich. Der Mensch ist so. Guck dir die ganze Prominenz<br />
an, die kokst: Die haben halt die Kohle<br />
dafür. Im Bundestag haben sie mal auf den Toiletten<br />
gewischt: alles voll mit Koks. Aber uns<br />
wollen s’es verbieten! – Ich hab sogar schon an<br />
Bullen verkauft!<br />
Z D S Aber nicht an die gleichen …<br />
A N D R E A S Doch! Tagsüber wollt’ er mich schnappen,<br />
abends hat er bei mir gekauft.<br />
Z D S Er wollte Dich überführen.<br />
A N D R E A S Ne ne. Das gibt’s zwar auch. Aber<br />
das war eindeutig, dass er das nicht wollte. Der<br />
war schlicht und ergreifend abhängig. Der brauchte<br />
was. Und er hat es bei mir gekauft. Heroin,<br />
ja klar! Es gibt auch genug Bullen, die drauf sind.<br />
Z D S Ein Zivilfahnder, der dem Tag über da<br />
rumläuft …<br />
A N D R E A S … und wohl nichts schnappen konnte.<br />
Da musste er was kaufen. Du glaubst doch<br />
nicht, dass alles, was die beschlagnahmen, in der<br />
Asservatenkammer landet? – Ich hab’ auch schon<br />
in betreutem Wohnen gewohnt. Die erzählen<br />
mir den ganzen Tag, nein, ich soll keine Drogen<br />
nehmen. Und nachmittags steht die gleiche Person<br />
bei mir in der Bude und sagt: „Verkaufst du<br />
mir ’nen Beutel? Aber sag’ den andern nix!“ –<br />
Na, schönen Tag auch!
S I E L W A L L<br />
D o , 1 3 . 1 1 U h r , F e n s t e r p l a t z i m<br />
a s i a t i s c h e n R e s t a u r a n t<br />
Warte auf Tofu in scharfer Soße,<br />
ohne Glutamat. Draußen Regen,<br />
Kälte zieht rein.<br />
1 3 . 1 2 U h r<br />
Am Haus direkt gegenüber ( hinter<br />
dem Glas und auf der anderen<br />
Seite der Straße ) Plakat an Plakat,<br />
Gekritzel und Schablone, Street<br />
Art auf Postern, Schwarz-Weiß-<br />
Kopien, diverse Materialien: Petersburger<br />
Hängung.<br />
1 3 . 2 0 U h r<br />
Der Koch braucht lange. Ich<br />
zähle Strukturen und gehe Augenblicken<br />
nach.<br />
×<br />
1 3 . 2 1 U h r<br />
Zwei lächeln selbstzufrieden ihre<br />
Aura zu mir rüber, durch das Grau:<br />
der Marken-Haushaltsreiniger und<br />
die auferstandene Sonne. Hat er sein<br />
Bild noch selber angebracht im<br />
letzten Jahr …?<br />
36<br />
P R O S A<br />
×<br />
Zwei lächeln<br />
selbstzufrieden<br />
ihre<br />
Aura zu mir<br />
rüber, durch<br />
das Grau:<br />
der Marken-<br />
Haushaltsreiniger<br />
und<br />
die auferstandene<br />
Sonne.<br />
37<br />
Peters<br />
burger<br />
Hängung<br />
T e x t : J a n i n e L a n c k e r<br />
I l l u s t r a t i o n : A n n a H u h n<br />
Schaufel,<br />
Spritze, Zange<br />
Die größten Freisetzungen radioaktiver Stoffe fanden während des<br />
Zeitraums von zehn Tagen nach der Explosion statt. Aufgrund der<br />
großen Hitze gelangten gasförmige und leichtflüchtige Stoffe in Höhen<br />
von 1.500 bis 10.000 Meter. Die Wolken mit dem radioaktiven<br />
Fallout verteilten sich zunächst über weite Teile Europas und schließlich<br />
über die gesamte nördliche Halbkugel.<br />
Den Sand, den hat der Regen giftig gemacht; der Regen kam<br />
von da, wo alles in die Luft geflogen ist. Wir schaufeln den verseuchten<br />
Dreck in Plastikeimer, tragen die ganze Masse ab. Dann kommt<br />
der neue, reine Sand. Schaufel um Schaufel. Die anderen Kinder<br />
wundern sich, dass mir so konsequent die Arbeit von der Hand geht.<br />
„Am Wochenende helfe ich öfter meinem Opa im Garten, hinter<br />
der Erdbeerbrücke.“<br />
Später holt mich meine Mutter ab. Junkies krümmen sich auf<br />
dem Bürgersteig, halten sich an Ampelsäulen fest, hängen auf Trep-
S I E L W A L L<br />
P e t e r s -<br />
b u r g e r<br />
38<br />
P R O S A<br />
39<br />
H ä n g u n g<br />
penstufen. Meine Mutter und ich tänzeln zügig hindurch, ich erzähle<br />
ihr von meinem Einsatz. Und dass mich wieder alle kämmen wollten.<br />
Die Leute an der Ecke stören mich nicht. Es ist nicht traurig<br />
für mich, sie zu sehen. Sie machen mir keine Angst. Es ist einfach alles<br />
– hier hat jeder seinen Platz.<br />
Noch kurz in den Bonbonladen rein. Heute kommt Sanne zu<br />
Besuch. Aus hohen Glasgefäßen greifen wir mit einer langen Zange<br />
nach diversen Keksen. Eine alte Frau hält uns die Deckel auf. Und<br />
packt das Mischgebäck in Zellophan. Draußen wieder Slalom. Atomkraft?<br />
Nein danke. Die rote Fratze gefällt mir gut. Ich pule an einem<br />
Pfahl dran rum. Möchte selber so ’ne Sonne haben. Sie reißt entzwei.<br />
Meine Mutter hat goldbraune Augen, die alles zusammenhalten.<br />
Blechanstecker, rund,<br />
Meinungsmotive<br />
„Er stand auf seines Daches Zinnen, / Er schaute mit vergnügten Sinnen<br />
/ Auf das beherrschte Samos hin.“ Verse, wenn ich auf die Kreuzung<br />
runter schau. Bin bei K. über’m Taco. Das erste Mal, K. ist neu<br />
hier in der Stadt. Gegenüber baumeln Beine aus dem „Lonely Planet<br />
Boy“, da drin am Geländer steht ein Mädchen mit rotem Kleid und einer<br />
gelben Mütze. Und der Typ, zu dem am besten Johnny passen würde,<br />
trinkt Cortado.<br />
K. wird meine Texte illustrieren. Nicht illustrieren, sorry:<br />
weiterspinnen. Wir kauen harte, saure Beeren. K. zeichnet feine Linien<br />
auf ein angeschlagenes Blatt Papier. Aus den Wirren schält sich<br />
eine schrullige Gestalt mit frechem Blick.<br />
„Ich mag deine Märchen gerne.“ Hat er neulich mal gesagt.<br />
Meister Propper geht den Dobben hoch. Kippt leicht über, seine Augen<br />
ein paar Meter vor, in der Hand ein Jutebeutel, aus dem eine Plakatrolle<br />
lugt. Über den Dingen, Verortung im Detail. K. fragt nach.<br />
Bitte alles, aber kein Zynismus. Ich verspreche, da ist viel Hoffnung<br />
drin. „Ich mag deine Märchen gerne.“ Hat er nochmal gesagt.<br />
Ich steh vorm Planet unten in der Nacht. Er händigt mir einen<br />
Vereinsausweis aus. Ein schwarzer Streifen mit ’ner pinken Rakete<br />
drauf. Ein Euro. Und gibt mir einen Blechanstecker: ein „Ich<br />
war das nicht!“ auf Silber. Nun kommt er kurz zurück. Hat Hella gesehen,<br />
sie reden laut. Ich hör’ sie nicht, aber ihre Münder ziehen große<br />
Bögen. Es war einmal …<br />
In einem halben Jahr erscheint mein erstes Buch, auch Märchen<br />
drin, das werde ich ihm schenken. Denk’ ich, kaue und schaue.<br />
Ein schwarzer Riese geht beflissen seinen Geschäften nach, er lächelt<br />
und winkt einen anderen zu sich her. K. gießt Tee nach. Bitterlich.<br />
Günther stirbt zwei Wochen vor Premiere.<br />
Das seh ich jetzt noch nicht. Auch nicht, wie der Zug Betroffener<br />
an meinem Dreißigsten hier am Sielwall abbiegt. Ich ängstige<br />
mich, dass niemand mehr aus der Falle rollt. Meine Mutter, A.<br />
und ich sammeln Filmstreifen von der Straße auf. Alles ist voll Film<br />
und deutschem Slam-Hip-Hop. Um die Ecke, ein kleiner grüner Park<br />
mit einem schwarzen Stein. Später werden wir die Streifen sorgfältig<br />
glätten. Das seh ich grad’ noch nicht.<br />
30 mal 300: Bin etwa 9.000 Male hier, dort, da vorn, entlanggekommen.<br />
Da vorn geht B., mit dem red’ ich schon lang nicht mehr.<br />
Auf seines Daches Zinnen. Der Sprung folgt dem Entschluss in<br />
einem zweifelhaften, lang anhaltenden Moment. Oder wie darf ich<br />
das verstehen --
S I E L W A L L<br />
40<br />
A N Z E I G E<br />
41<br />
zweitbestes bier
S I E L W A L L<br />
42<br />
A N Z E I G E<br />
43<br />
Armut ist in unserer Gesellschaft offensichtlich. Der<br />
Verlust des Arbeitsplatzes geht oft einher mit dem<br />
Ausschluss von kulturellen und sozialen Kontakten.<br />
Meistens ist es eine Verkettung von unterschiedlichen<br />
Problemen, die schlimmstenfalls zur Wohnungslosigkeit<br />
führt. Eine scheinbar ausweglose<br />
Situation, die gerade in eisiger Kälte schnell hoffnungslos<br />
macht. Lassen Sie uns etwas tun<br />
Helfen Sie mit! Unterstützen Sie unsere Arbeit mit<br />
einer Spende, die zu 100% ankommt. Sie gibt uns<br />
Spielraum, im Einzelfall spontan und unbürokratisch<br />
reagieren zu können. Herzlichen Dank dafür.<br />
Die Liga<br />
der außergewöhnlichen Drucker<br />
www.inneremission-bremen.de<br />
UWE VANDREIER DIETMAR KOLLOSCHÉ ALEXANDRA WILKE UND ANDRÉ APPEL<br />
BERLINDRUCK UND GSG BERLIN PRÄSENTIEREN IN ZUSAMMENARBEIT MIT A1/BREMER KREUZ/A27 OSKAR-SCHULZE-STR. 12<br />
EINE CO-PRODUKTION MIT 28832 ACHIM EINE BERLINDRUCK PRODUKTION<br />
Spendenkonto<br />
1 077 700<br />
Sparkasse in Bremen<br />
BLZ 290 501 01<br />
EIN FILM VON REINHARD BERLIN FRANK RÜTER CASTING HEDDA BERLIN ANKE HOLSTE HERSTELLUNGSLEITER WALTER SCHWENN KOSTÜMDESIGNER BJÖRN GERLACH VOLKER KAHLERT MARCUS LATTERMANN<br />
HANS-H. LILIENTHAL ANDREAS MINDERMANN MIKE REIMERS JOCHEN RUSTEDT THOMAS VIERKE ERHARD VOSSMEYER JENS WETZEL IN ZUSAMMENARBEIT MIT CHRISTIAN EWERT MARIAN KACYNA<br />
MAKE-UP IRIS KAISER-BANDMANN SCHNITT JÖRG WORTMANN PRODUKTIONSDESIGNER THOMAS BARTELS MELAHAT HALTERMANN THOMAS HARTUNG LARS JANSSEN RANDERS KÄRBER<br />
MONIKA PLOTTKE DENNY QUEDNAU MARLIES WELLBROCK FOTOGRAFIE-DIREKTOR CARSTEN HEIDMANN PRODUKTIONSLEITUNG KATJA LINDEMANN BEST GIRLS/BOYS JENS BECKEFELDT TIM BUSCHBAUM<br />
CHEVY ORLANDO FRITSCH HARIS NURCOVIC DELIA WEBER AUSFÜHRENDE PRODUZENTEN DAGMAR BAUMGARTEN SONJA CORDES HANS-JÜRGEN KULKE ECKARDT SCHULZ<br />
PRODUZENTEN KIRSTEN HINRICHS ROLF MAMMEN ANNE SWIERCZYNSKI DREHBUCH HENRIKE OTT NACH EINER IDEE VON PATRICK CALANDRUCCIO PETRA GRASHOFF REGIE ECKARD CHRISTIANI<br />
www.berlindruck.de
S I E L W A L L<br />
44<br />
A N Z E I G E<br />
45<br />
Zusammenhalt stärken -<br />
Ausgrenzung verhindern<br />
„Mit unserem hohen ehrenamtlichen Einsatz<br />
wollen wir einen spürbaren Beitrag dazu<br />
leisten, dass den Menschen am Rande der<br />
Gesellschaft wieder eine Perspektive; dass wir<br />
ihnen Teilhabe wieder ermöglichen!“<br />
Wilhelm Schmidt<br />
Vorsitzender des Präsidiums<br />
des AWO Bundesverbandes e.V.<br />
AWO Bremerhaven<br />
Tel.: 0471 9547-0<br />
www.awo-bremerhaven.de
S I E L W A L L<br />
I M P R E S S U M<br />
46<br />
V o r s c h a u<br />
47<br />
R e d a k t i o n<br />
Kolja Burmester<br />
Jens Kaulbars<br />
Mareike Piper<br />
L e i t u n g :<br />
Armin Simon<br />
redaktion@zeitschrift-der-strasse.de<br />
M a r k e t i n g &<br />
O r g a n i s a t i o n<br />
Insa Beckmann<br />
Michael Hrusovsky<br />
Konstantin Noeres<br />
Elena Nunn<br />
Linda Pieszek<br />
Fiete Seyer<br />
Lisa Weihermüller<br />
G e s t a l t u n g<br />
Kolja Burmester<br />
Alper Cavus<br />
Prisca Kranz<br />
Bernd Krönker<br />
Eunjung Kwak<br />
Christina Wangler<br />
Volker Weise<br />
BAHNHOFS<br />
PLATZ<br />
M i t a r b e i t :<br />
Meike Döscher-Mehrtens<br />
Friederike Gräff<br />
Radek Krolczyk<br />
Janine Lancker<br />
Timo Robben<br />
L e i t u n g :<br />
Prof. Dr. Michael Vogel<br />
mvogel@hs-bremerhaven.de<br />
V e r t r i e b<br />
Willi Albers<br />
Conny Eybe<br />
Alexander Liske<br />
Jonas Pot d’Or<br />
Reinhard „Cäsar“ Spoering<br />
Axel Brase-Wenzell<br />
Gimmy Wesemann<br />
und viele wohnungslose Menschen<br />
L e i t u n g :<br />
Gregor Schreiter<br />
A r t D i r e c t i o n :<br />
Prof. Andrea Rauschenbusch<br />
a.rauschenbusch@hfk-bremen.de<br />
K o n z e p t e n t w i c k l u n g :<br />
Ludovic Balland<br />
www.ludovic-balland.ch<br />
Eilen und Weilen – ein Platz,<br />
den jeder nutzt und keiner haben will.<br />
Wir werfen einen Blick darauf,<br />
nicht nur von oben. In der nächsten<br />
Ausgabe der „Zeitschrift der Straße“.<br />
Ab Mitte März beim<br />
L e i t u n g :<br />
Bertold Reetz<br />
reetz@inneremission-bremen.de<br />
Straßenverkäufer Ihres Vertrauens.<br />
H e r a u s g e b e r — Verein für Innere Mission in Bremen, Blumenthalstraße 10,<br />
28209 Bremen / P a r t n e r — Gisbu, Gesellschaft für Integrative Soziale Beratung und<br />
Unterstützung mbH, Bremerhaven / Hochschule für Künste Bremen / Hochschule Bremerhaven<br />
/ I n t e r n e t — www.zeitschrift-der-strasse.de / K o n t a k t — post@zeitschrift-der-strasse.de<br />
/ V . I . S . D . P . — Armin Simon, JournalistInnen-Etage Bremen, Fedelhören 8,28203 Bremen /<br />
Anzeigen: Michael Vogel, An der Karlstadt 8, 27568 Bremerhaven / T y p o g r a f i e — Krana:<br />
Lauri Toikka, Finnland, ltoikka@gmail.com / Gill Sans Mt Pro, Akzidenz Grotesk Pro: Linotype Gmbh,<br />
Deutschland / P a p i e r — Igepa, Profisilk, Fsc, 115 g / m 2 / D r u c k — Berlindruck GmbH & Co KG,<br />
Oskar-Schulze-Str. 12, 28832 Achim, www.berlindruck.de / G e r i c h t s s t a n d &<br />
E r f ü l l u n g s o r t — Bremen / E r s c h e i n u n g s w e i s e — acht mal jährlich<br />
/ A u f l a g e — 14.000 / A n z e i g e n v e r k a u f — a n z e i g e n @ z e i t s c h r i f t - d e r-<br />
s t r a s s e . d e / A n z e i g e n p r e i s e — Preisliste 01, gültig ab 01.10.2010<br />
Die Redaktion übernimmt keine Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und Illustrationen. Die Zeitschrift<br />
der Straße und alle in ihr enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälle<br />
ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Herausgebers strafbar. Alle Anbieter von Beiträgen, Fotos und Illustrationen<br />
stimmen der Nutzung in den Ausgaben der Zeitschrift der Straße im Internet, auf Dvd sowie in Datenbanken zu.
aucht<br />
Ihre Unterstützung<br />
S p e n d e n k o n t o :<br />
V e r e i n f ü r I n n e r e M i s s i o n i n B r e m e n<br />
Ko n to n u m m e r : 1 0 7 7 7 0 0<br />
b a n k l e i t z a h l : 2 9 0 5 0 1 0 1<br />
S pa r k a s s e B r e m e n<br />
V e rw e n d u n g s z w e c k ( w i c h t i g ! ) : Z e i t s c h r i f t d e r S t r a S S e<br />
S p e n d e n s i n d s t e u e r l i c h a b s e t z b a r .<br />
E i n F ö r d e r v e r e i n i s t i n G r ü n d u n g .<br />
I n t e r e s s e ? S c h r e i b e n S i e a n :<br />
f v @ z e i t s c h r i f t- d e r - s t r a s s e . d e