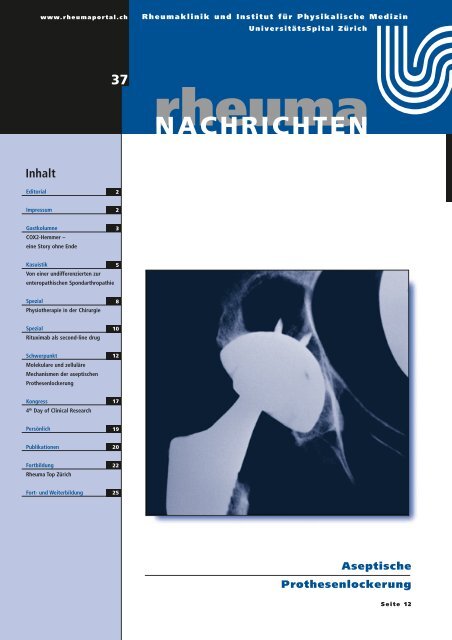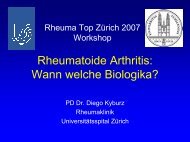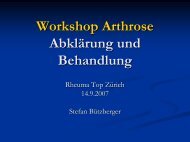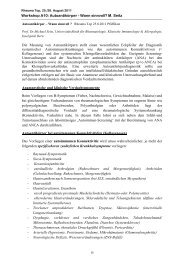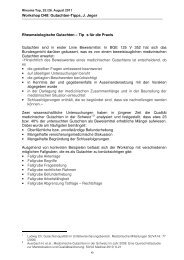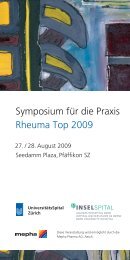Fort- und Weiterbildung in Rheumatologie und ... - Rheuma Schweiz
Fort- und Weiterbildung in Rheumatologie und ... - Rheuma Schweiz
Fort- und Weiterbildung in Rheumatologie und ... - Rheuma Schweiz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Editorial<br />
Impressum<br />
Gastkolumne<br />
COX2-Hemmer –<br />
e<strong>in</strong>e Story ohne Ende<br />
Kasuistik<br />
5<br />
Von e<strong>in</strong>er <strong>und</strong>ifferenzierten zur<br />
enteropathischen Spondarthropathie<br />
Spezial<br />
Physiotherapie <strong>in</strong> der Chirurgie<br />
Spezial<br />
Rituximab als second-l<strong>in</strong>e drug<br />
Schwerpunkt<br />
Molekulare <strong>und</strong> zelluläre<br />
Mechanismen der aseptischen<br />
Prothesenlockerung<br />
Kongress<br />
4th Day of Cl<strong>in</strong>ical Research<br />
Persönlich<br />
www.rheumaportal.ch<br />
Inhalt<br />
Publikationen<br />
<strong>Fort</strong>bildung<br />
<strong>Rheuma</strong> Top Zürich<br />
<strong>Fort</strong>- <strong>und</strong> <strong>Weiterbildung</strong><br />
<strong>Rheuma</strong>kl<strong>in</strong>ik <strong>und</strong> Institut für Physikalische Mediz<strong>in</strong><br />
37<br />
XXXXX<br />
2<br />
2<br />
3<br />
8<br />
10<br />
12<br />
17<br />
19<br />
20<br />
22<br />
25<br />
UniversitätsSpital Zürich<br />
rheuma<br />
NACHRICHTEN<br />
Aseptische<br />
Prothesenlockerung<br />
Seite 12<br />
37–2004
2<br />
editorial<br />
Liebe Kolleg<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Kollegen<br />
Wieder e<strong>in</strong> neuer Sponsor werden Sie denken, ne<strong>in</strong>, aber im Rahmen des<br />
Schulterschlusses von SANOFI Synthélabor (Suisse) SA <strong>und</strong> Aventis hat sich die<br />
Namensgebung entsprechend angepasst. Auch unter den neuen Besitzverhältnissen<br />
wird das Sponsor<strong>in</strong>g unserer <strong>Rheuma</strong>-Nachrichten fortgeführt, wofür wir uns auch im<br />
Namen der Leser<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Leser ganz herzlich bedanken.<br />
Seit dem Rückzug von Rofecoxib (Vioxx) im September 2004 vergeht kaum e<strong>in</strong>e<br />
Woche, ohne dass wir von Seiten der Zulassungsbehörden, der Pharma-Firmen <strong>und</strong><br />
nicht zuletzt durch die verschiedensten Medien mit teilweise wiedersprechenden<br />
Informationen e<strong>in</strong>gedeckt werden. Ins Schussfeld der Kritik gerieten nicht nur die<br />
COX2-Hemmer, sondern auch die schon lange e<strong>in</strong>gesetzten klassischen nichtsteroidalen<br />
Antirheumatika. Aus aktuellem Anlass beleuchtet Professor Beat A. Michel den<br />
heutigen Stand des (Un)-Wissens anstelle der üblichen Gastkolumne. Selbstverständlich<br />
werden wir Sie auch <strong>in</strong> Zukunft <strong>in</strong> diesem Rahmen über die Entwicklungen dieser<br />
für uns <strong>Rheuma</strong>tologen sehr wichtigen Medikamentengruppe <strong>in</strong>formieren, noch<br />
aktueller ist die Berichterstattung auf unserem <strong>Rheuma</strong>portal (www.rheumaportal.ch).<br />
Zum zweiten Mal f<strong>in</strong>det das <strong>Rheuma</strong> Top Zürich-Symposium am 25. <strong>und</strong> 26. August<br />
2005 für Allgeme<strong>in</strong>mediz<strong>in</strong>er/Internisten mit e<strong>in</strong>er grossen Auswahl an Workshops<br />
<strong>und</strong> Präsentationen statt. Parallel dazu wird für die <strong>Rheuma</strong>tologen/Physikalische<br />
Mediz<strong>in</strong> e<strong>in</strong> Programm mit erfahrenen nationalen <strong>und</strong> <strong>in</strong>ternationalen Referenten<br />
angeboten, welche über neuste Entwicklungen bei verschiedenen Arthritiden <strong>und</strong><br />
Kollagenosen berichten. E<strong>in</strong>e kurze Programmübersicht f<strong>in</strong>den Sie <strong>in</strong> dieser Nummer,<br />
aber auch auf www.rheumaportal.ch <strong>und</strong> www.mepha.ch, wo Sie sich onl<strong>in</strong>e anmelden<br />
können.<br />
Viel Vergnügen bei der Lektüre.<br />
Ihr<br />
PIUS BRÜHLMANN<br />
Pius Brühlmann<br />
Impressum<br />
<strong>Rheuma</strong>-Nachrichten<br />
❙ 13. Jahrgang – Ausgabe Nr. 37<br />
❙ Auflage: 1’000<br />
❙ Ersche<strong>in</strong>t dreimal pro Jahr<br />
❙ Ersche<strong>in</strong>ungsdatum: April 2005<br />
Redaktion<br />
❙ Beat A. Michel (Kl<strong>in</strong>ikdirektor)<br />
❙ Pius Brühlmann (Kl<strong>in</strong>ik)<br />
❙ Steffen Gay (Basisforschung)<br />
❙ Daniel Uebelhart (Physik. Mediz<strong>in</strong>)<br />
Autoren dieser Ausgabe<br />
❙ Michael Andor, Dr. med., Assistenzarzt<br />
❙ Pius Brühlmann, Dr. med.<br />
Leitender Arzt, <strong>Rheuma</strong>polikl<strong>in</strong>ik<br />
❙ Philipp Drees, Dr. med., Postdoktorant<br />
❙ Lars C. Huber, Dr. med., Postdoktorant<br />
❙ Diego Kyburz, PD Dr. med., Oberarzt<br />
❙ Beat A. Michel, Prof. Dr. med.<br />
Kl<strong>in</strong>ikdirektor<br />
❙ Barbara Sax, executive MHSA<br />
Chef-Physiotherapeut<strong>in</strong><br />
❙ Hans Zwahlen, Cl<strong>in</strong>ical Manager<br />
Gestaltung <strong>und</strong> Druck<br />
Pomcany’s Market<strong>in</strong>g AG<br />
Aargauerstrasse 250, 8048 Zürich<br />
Telefon 044 496 10 10<br />
Fotos<br />
Bruno Baumann, <strong>Rheuma</strong>kl<strong>in</strong>ik <strong>und</strong> Institut<br />
für Physikalische Mediz<strong>in</strong><br />
Sponsor<strong>in</strong>g<br />
Sanofi Synthélabo (Suisse) SA<br />
11, rue de Veyrot<br />
1217 Meyr<strong>in</strong><br />
Abonnemente<br />
Die <strong>Rheuma</strong>-Nachrichten können kostenlos<br />
abonniert werden bei:<br />
<strong>Rheuma</strong>kl<strong>in</strong>ik <strong>und</strong> Institut für Physikalische<br />
Mediz<strong>in</strong>, Gloriastrasse 25, 8091 Zürich<br />
Telefon 01 255 29 96<br />
Telefax 01 255 89 78<br />
e-Mail ruz<strong>in</strong>fo@usz.ch<br />
Internet<br />
www.rheumaportal.ch<br />
Nächste Ausgabe: August 2005
COX2-Hemmer – e<strong>in</strong>e Story ohne Ende<br />
Anfänglich als Superaspir<strong>in</strong> lanciert, wurden COX2-Hemmer vom Markt zurückgezogen bzw. der Verkauf<br />
e<strong>in</strong>gestellt. E<strong>in</strong>e Chronik der COX2-Hemmer von Prof. Dr. med. Beat A. Michel.<br />
Vorgeschichte<br />
1897<br />
Acetylsalizylsäure wird e<strong>in</strong>geführt. In der Folge Entwicklung<br />
zahlreicher traditioneller Antirheumatika, welche teilweise<br />
über Jahrzehnte von Patienten hoch geschätzt wurden (als<br />
berühmteste Vertreter Diclofenac, Ibuprofen <strong>und</strong> Naproxen).<br />
1999<br />
Food and Drug Adm<strong>in</strong>istration (FDA) bewilligt Markte<strong>in</strong>führung<br />
von Rofecoxib (Vioxx ® ), <strong>in</strong> der Folge weltweite Vermarktung.<br />
Es folgt die E<strong>in</strong>führung von Celecoxib (Celebrex<br />
® ) sowie Valdecoxib (Bextra ® ). Die COX2-Hemmer werden<br />
als «Superaspir<strong>in</strong>e» lanciert.<br />
September 2004<br />
Rückzug von Rofecoxib wegen kardiovaskulären Nebenwirkungen.<br />
7. April 2005<br />
Verkauf von Valdecoxib (Bextra ® ) wird e<strong>in</strong>gestellt, dies auf<br />
Empfehlung der Medikamentenzulassungsbehörden <strong>in</strong> den<br />
USA <strong>und</strong> Europa.<br />
H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong><br />
BEAT A. MICHEL<br />
Rofecoxib wurde zurückgezogen, nachdem e<strong>in</strong>e Präventionsstudie<br />
für adematöse Polypen wegen erhöhtem kardiovaskulärem<br />
Risiko gestoppt werden musste (APPROVE trial, Lit.<br />
1). Die nachträgliche Aufarbeitung früherer Daten bestätigte<br />
dieses Risiko.<br />
Aufgeschreckt durch diese Resultate wurden auch die anderen<br />
COX2-Hemmer überprüft. E<strong>in</strong>e ähnliche Studie mit<br />
Celecoxib, durchgeführt zur Überprüfung der Prävention vor<br />
Adenomen, zeigte auch für diese Substanz e<strong>in</strong> erhöhtes<br />
kardiovaskuläres Risiko (2). E<strong>in</strong>e weitere Kurzzeitstudie,<br />
durchgeführt mit Valdecoxib beziehungsweise Parecoxib<br />
(parenterale Substanz), deckte bei Patienten unmittelbar<br />
nach koronarer Bypass-Operation e<strong>in</strong> erhöhtes kardiovaskuläres<br />
Risiko auf (3). Für die ersten beiden Medikamente wurde<br />
e<strong>in</strong> erhöhtes Risiko erst erkennbar nach 1 1 ⁄2 bis 2 Jahren,<br />
die letzte Studie dauerte lediglich zehn Tage. Kardiovaskuläre<br />
Ereignisse sche<strong>in</strong>en bei COX2-Hemmern gehäuft zu se<strong>in</strong>.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der vorliegenden Daten dürfte der Zusammenhang<br />
zu e<strong>in</strong>em Teil substanzabhängig, zum anderen auch<br />
dosisabhängig se<strong>in</strong>. Weitere Studien, zum Teil noch unveröffentlicht,<br />
konnten angeblich ke<strong>in</strong> erhöhtes kardiovaskuläres<br />
Risiko für Celecoxib nachweisen. Dieses Medikament bleibt<br />
– zum<strong>in</strong>dest vorerst – auf dem Markt.<br />
Für Valdecoxib ist die kardiovaskuläre Sicherheit <strong>in</strong> der<br />
Langzeitanwendung unzureichend belegt. Da dieses Medikament<br />
aber schwere <strong>und</strong> lebensbedrohliche Hautreaktionen,<br />
mitunter auch mit letalem Ausgang, bei Patienten mit <strong>und</strong><br />
ohne Sulfanamid-Allergie auslösen kann, wurde das Medikament<br />
von den Zulassungsbehörden zur Rücknahme empfohlen.<br />
Die heutige Datenlage lässt ke<strong>in</strong>en Zweifel, dass COX2-<br />
Hemmer mit e<strong>in</strong>em kardiovaskulären Risiko, wenn auch<br />
unterschiedlichen Ausmasses, verb<strong>und</strong>en s<strong>in</strong>d. Dies mag<br />
darauf beruhen, dass e<strong>in</strong>e Störung des Prostagland<strong>in</strong>-Gleichgewichtes<br />
bei Patienten mit entsprechenden Risikofaktoren<br />
zu Herz<strong>in</strong>farkt oder Schlaganfall führen kann: Prostazykl<strong>in</strong>,<br />
als Gegenspieler von Thromboxan A2, wird hauptsächlich<br />
über Cyclooxygenase 2 gebildet. Wird nun dieses Enzym<br />
gehemmt, s<strong>in</strong>kt die Konzentration von Prostazykl<strong>in</strong> <strong>und</strong> es<br />
kommt dadurch zu e<strong>in</strong>em Übergewicht des proaggregatorisch<br />
wirkenden Thromboxan A2.<br />
37–2004<br />
3<br />
GASTKOLUMNE
4<br />
Wie steht es mit den klassischen Antirheumatika?<br />
E<strong>in</strong>e Präventionsstudie für die Alzheimererkrankung wurde<br />
kürzlich gestoppt, da unter Naproxen 50% mehr kardiovaskuläre<br />
Nebenwirkungen aufgetreten waren. Zum Zeitpunkt<br />
des Abbruchs lief die Studie bereits drei Jahre mit E<strong>in</strong>schluss<br />
von 2400 Teilnehmern.<br />
E<strong>in</strong>e kürzliche, gross angelegte Fallkontrollstudie fand, dass<br />
das Risiko e<strong>in</strong>es Herz<strong>in</strong>farktes <strong>in</strong> den paar Wochen nach<br />
Abbruch e<strong>in</strong>er NSAR-Therapie signifikant erhöht ist (4). Die<br />
untersuchten Substanzen betrafen Diclofenac, Ibuprofen,<br />
Indometac<strong>in</strong>, Ketoprofen, Naproxen <strong>und</strong> Piroxicam.<br />
Solche Daten legen nahe, dass das kardiovaskuläre Risiko<br />
nicht nur e<strong>in</strong> Problem der COX2-Hemmer ist, sondern auch<br />
bei traditionellen NSAR (komb<strong>in</strong>ierte COX1- <strong>und</strong> COX2-<br />
Hemmern) vorliegen dürfte.<br />
Unmittelbare Konsequenz<br />
Die Wirksamkeit der COX2-Hemmer ist jener der traditionellen<br />
NSAR ähnlich. Das Risikoprofil sche<strong>in</strong>t sich jedoch zu<br />
unterscheiden: Während das gastro<strong>in</strong>test<strong>in</strong>ale Risiko bei<br />
COX2-Hemmern gegenüber traditionellen NSAR zum Teil<br />
deutlich verm<strong>in</strong>dert ist, ist e<strong>in</strong> vergleichender Schluss bezüglich<br />
kardiovaskulärem Risiko heute aufgr<strong>und</strong> der vorliegenden<br />
Daten nicht möglich.<br />
Die Zulassungsbehörden haben strenge Richtl<strong>in</strong>ien aufgestellt:<br />
Sowohl für den verbleibenden COX2-Hemmer Celecoxib<br />
wie auch für sämtliche traditionellen NSAR <strong>in</strong>klusive<br />
jene, welche ohne Rezept gekauft werden können, muss der<br />
Beipackzettel e<strong>in</strong>e ausdrückliche Warnung für kardiovaskuläre<br />
<strong>und</strong> gastro<strong>in</strong>test<strong>in</strong>ale Risiken enthalten. Bei beiden<br />
Stoffklassen wird e<strong>in</strong>e Kontra<strong>in</strong>dikation für den E<strong>in</strong>satz bei<br />
Patienten mit kürzlich zurückliegender koronarer Bypass-<br />
Operation vorgeschrieben. Im Weiteren werden umfassende<br />
Langzeitstudien beziehungsweise Metaanalysen für die vorliegenden<br />
Daten gefordert (5).<br />
Ausblick<br />
Viele Patienten mit chronischen Schmerzen s<strong>in</strong>d auf NSAR<br />
beziehungsweise COX2-Hemmer angewiesen. Die exakte<br />
Datenlage für jede e<strong>in</strong>zelne Substanz wird nie abschliessend<br />
geklärt werden können. Immer wird e<strong>in</strong>e gewisse Unsicherheit<br />
bestehen bleiben. Arzt <strong>und</strong> Patient werden nicht darum<br />
herumkommen, bei jedem Antirheumatikum, soweit möglich,<br />
das <strong>in</strong>dividuelle Verhältnis zwischen Nutzen <strong>und</strong> Nebenwirkungspotenzial<br />
abzuschätzen. Schlussendlich wird der<br />
<strong>in</strong>formierte Patient entscheiden müssen, welche Substanz er<br />
wie <strong>und</strong> wann e<strong>in</strong>nimmt. Die Aufgabe der Ärzte wird es se<strong>in</strong>,<br />
die bestmöglichen Informationen zur Verfügung zu stellen.<br />
Wie wird sich der Markt entwickeln?<br />
Wie immer ist dies schwierig e<strong>in</strong>zuschätzen. Folgende Fragen<br />
stehen vorerst offen: Wird Rofecoxib, wie vom Hersteller<br />
geplant, allenfalls wieder e<strong>in</strong>geführt? Wird Novartis ihr<br />
bereit stehendes neues COX2-Präparat Lumiracoxib bald<br />
lancieren? Werden neue Daten mehr Klarheit schaffen?<br />
Mit Sicherheit wird diese Geschichte e<strong>in</strong>e <strong>Fort</strong>setzung<br />
haben…<br />
Literaturverzeichnis<br />
1 Bresalier RS, Sandler RS, Quan H, et al.<br />
Cardiovascular events associated with rofecoxib <strong>in</strong> a<br />
colorectal adenoma chemoprevention trial. N Engl J<br />
Med 2005; 352: 1092-1102.<br />
2 Solomon SD, McMurray JJV, Pfeffer MA, et al.<br />
Cardiovascular risk associated with celecoxib <strong>in</strong> a<br />
cl<strong>in</strong>ical trial for colorectal adenoma prevention. N<br />
Engl J Med 2005;352: 1071-80.<br />
3 Nussmeier NA, Whelton AA, Brown MT, et al.<br />
Complications of the COX-2 <strong>in</strong>hibitors parecoxib<br />
and valdecoxib after cardiac surgery. N Engl J Med<br />
2005; 352: 1081-91.<br />
4 Fischer LM, Schlienger RG, Matter CM, et al.<br />
Discont<strong>in</strong>uation of nonsteroidal anti-<strong>in</strong>flammatory<br />
drug therapy and risk of acute myocardial <strong>in</strong>farction.<br />
Arch Intern Med 2004; 164: 2472-76.<br />
5 FDA News 2005 (http://www.fda.gov/bbs/topics/<br />
news/2005/NEW01171.html)
Von e<strong>in</strong>er <strong>und</strong>ifferenzierten zur<br />
enteropathischen Spondarthropathie<br />
MICHAEL ANDOR<br />
Bei Patienten mit typischen Beschwerden <strong>und</strong> Symptomen e<strong>in</strong>er Spondarthropathie, welche die diagnostischen<br />
Kriterien für e<strong>in</strong>e spezifische Spondarthropathie, wie zum Beispiel e<strong>in</strong>e Spondylitis ankylosans oder e<strong>in</strong>e Arthritis<br />
psoriatica, nicht erfüllen, wird die Diagnose e<strong>in</strong>er <strong>und</strong>ifferenzierten Spondarthropathie gestellt. Wie der Name<br />
impliziert, kann sich im weiteren Verlauf e<strong>in</strong>e spezifische Spondarthropathie entwickeln.<br />
Fallbeschreibung<br />
Der 64-jährige Patient wurde wegen seit wenigen Wochen<br />
bestehenden Polyarthralgien sowohl der grossen Extremitätengelenke<br />
als auch der Metacarpophalangeal- (MCP) <strong>und</strong><br />
e<strong>in</strong>zelner proximaler Interphalangealgelenke (PIP) zugewiesen.<br />
Die Beschwerden mit Nachtschmerzen waren von e<strong>in</strong>er<br />
über e<strong>in</strong>e St<strong>und</strong>e dauernden Morgensteifigkeit begleitet.<br />
NSAR brachten nur ungenügende Besserung. In der Systemanamnese<br />
berichtete der Patient über dünnflüssige Durchfälle<br />
seit Jahrzehnten. Enorale Ulzerationen oder ophthalmologische<br />
Beschwerden wurden verne<strong>in</strong>t.<br />
Im Vorfeld der Hospitalisation wurde das beschwerdeführende<br />
l<strong>in</strong>ke Hüftgelenk wegen <strong>in</strong>validisierender Leistenschmerzen<br />
mit konventionell radiologisch beidseitiger<br />
Coxarthrose dreimalig mit Steroiden <strong>in</strong>filtriert. Die Wirkung<br />
war jeweils gut, aber nur wenige Tage anhaltend. E<strong>in</strong>e<br />
Femurkopfnekrose wurde vorgängig mittels MRI ausgeschlossen.<br />
Kl<strong>in</strong>isch imponierten Synovitiden der Handgelenke beidseits<br />
sowie Druckdolenzen der MCP- <strong>und</strong> vere<strong>in</strong>zelter PIP-Gelenke,<br />
e<strong>in</strong>e schmerzhaft e<strong>in</strong>geschränkte Schulterbeweglichkeit<br />
rechts sowie e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>geschränkte Hüftbeweglichkeit beidseits.<br />
Daneben fanden sich Polyenthesiopathien mit Druck-<br />
650 MBq 99mTc-DPD 3h p.i.<br />
R PALMAR L<br />
Abb. 1: Sz<strong>in</strong>tigraphie der Hände<br />
Abb. 2: Konventionelles Röntgen LWS/ISG<br />
dolenzen an den Ellbogen, Kniegelenken <strong>und</strong> am Beckengürtel.<br />
Labormässig bestand e<strong>in</strong>e humorale Aktivität (BSR 42<br />
mm/h, CRP 45 mg/l) ohne Leukozytose oder L<strong>in</strong>ksverschiebung,<br />
begleitet von e<strong>in</strong>er langjährigen normozytären Anämie.<br />
Die Thrombozyten waren normal. <strong>Rheuma</strong>faktoren,<br />
anti-CCP sowie ant<strong>in</strong>ative DNS-Auto-Antikörper waren<br />
normal, die ANA mit 1:160 leicht erhöht.<br />
Die bildgebenden Abklärungen zeigten zusammenfassend<br />
e<strong>in</strong>en diskreten Hüftgelenkerguss l<strong>in</strong>ks <strong>in</strong> Sonographie <strong>und</strong><br />
MRI, e<strong>in</strong>en leichten Gelenkerguss des rechten Schultergelenks<br />
sowie <strong>in</strong> der Skelettsz<strong>in</strong>tigraphie e<strong>in</strong>e Radionuklid-<br />
Mehrbelegung vor allem der Handgelenke (Abb. 1), weniger<br />
der Schulter- <strong>und</strong> Ellbogengelenke. Die konventionellen<br />
Röntgenbilder der Hände <strong>und</strong> Füsse zeigten ke<strong>in</strong>e erosiven<br />
Veränderungen.<br />
37–2004<br />
KASUISTIK<br />
5
6<br />
Bei vorliegender seronegativer, anerosiver asymmetrischer<br />
Polyarthritis mit Beteiligung grosser <strong>und</strong> kle<strong>in</strong>er Extremitätengelenke,<br />
begleitet von Polyenthesiopathien <strong>und</strong> humoraler<br />
Aktivität, g<strong>in</strong>gen wir von e<strong>in</strong>er Spondarthropathie aus.<br />
Für e<strong>in</strong>e axiale Beteiligung bei schmerzhaft e<strong>in</strong>geschränkter<br />
Wirbelsäulenbeweglichkeit bestand weder im MRI der ISG<br />
noch <strong>in</strong> den konventionellen Aufnahmen der HWS, BWS <strong>und</strong><br />
LWS e<strong>in</strong> Verdacht (Abb. 2).<br />
Bei der Anamnese mit chronischer Diarrhoe kam am ehesten<br />
e<strong>in</strong>e enteropathische Spondarthropathie <strong>in</strong> Frage, wobei sich<br />
weder <strong>in</strong> der Gastro- noch <strong>in</strong> der Koloskopie makroskopisch/mikroskopisch<br />
e<strong>in</strong> Anhaltspunkt dafür fand (Abb. 3).<br />
Gleichzeitig konnten e<strong>in</strong> differentialdiagnostisch erwogener<br />
Morbus Whipple sowie e<strong>in</strong>e Sprue ausgeschlossen werden.<br />
Es wurde die Diagnose e<strong>in</strong>er <strong>und</strong>ifferenzierten Spondarthropathie<br />
gestellt <strong>und</strong> therapeutisch neben NSAR e<strong>in</strong>e Basistherapie<br />
mit Salazopyr<strong>in</strong> verschrieben.<br />
Im weiteren Verlauf kam es bei schlechter Compliance<br />
bezüglich der Salazopyr<strong>in</strong>-E<strong>in</strong>nahme zu e<strong>in</strong>er neuerlichen<br />
notfallmässigen Hospitalisation mit passager deutlich erhöhter<br />
humoraler Aktivität aber nur diskreten Synovitiden. E<strong>in</strong><br />
<strong>in</strong>fektiöses Geschehen wurde ausgeschlossen <strong>und</strong> der Patient<br />
bei spontaner Besserung wieder entlassen.<br />
Es folgte dann e<strong>in</strong>e neuerliche notfallmässige Hospitalisation<br />
mit massiver humoraler Aktivität, nun aber von starker wässriger<br />
Diarrhoe begleitet. Stuhlkulturen waren negativ. Man<br />
entschloss sich für e<strong>in</strong>e neuerliche Gastro-/Koloskopie<br />
(weniger als zwei Monate nach der letzten Endoskopie),<br />
wobei sich nun bereits makroskopisch, später auch mikroskopisch,<br />
e<strong>in</strong>e schwere Ileokolitis mit Verdacht auf M. Crohn<br />
fand (Abb. 4).<br />
Abschliessend konnte die Diagnose e<strong>in</strong>er enterogenen<br />
Spondarthropathie mit peripherer Arthritis bei chronischentzündlicher<br />
Darmerkrankung (wahrsche<strong>in</strong>lich M. Crohn)<br />
gestellt werden.<br />
Abb. 3: Blande Koloskopie 12/04<br />
Abb. 4: Koloskopie mit erosiven Veränderungen 01/05
Kommentar<br />
Zwischen den Spondarthropathien <strong>und</strong> entzündlichen Darmerkrankungen<br />
besteht e<strong>in</strong>e deutlich höhere Assoziation<br />
(44%) als bei anderen Arthritiden (6%). Bei der Ileokoloskopie<br />
f<strong>in</strong>den sich makroskopisch entzündliche Mukosaveränderungen<br />
<strong>in</strong> 30% der Patienten mit seronegativer Spondarthropathie,<br />
mikroskopisch <strong>in</strong> etwa 60%. In zirka 30% der<br />
Fälle entsprachen die entzündlichen Darmwandveränderungen<br />
e<strong>in</strong>em M. Crohn, oder es fanden sich Crohn-ähnliche<br />
Veränderungen (1, 2).<br />
Bei diagnostizierter enterogener Spondarthropathie kommen<br />
sowohl e<strong>in</strong> axialer Befall als auch periphere Arthritiden<br />
vor. Gewöhnlich f<strong>in</strong>det sich dabei e<strong>in</strong>e parallele kl<strong>in</strong>ische<br />
Aktivität der peripheren Arthritis <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e histologische<br />
Aktivität der Darmentzündung. Die periphere Arthritis tritt<br />
im Verlauf meist gleichzeitig oder nach Beg<strong>in</strong>n der gastro<strong>in</strong>test<strong>in</strong>alen<br />
Symptomatik auf <strong>und</strong> spricht auf die Behandlung<br />
der Darmentzündung an. Demgegenüber verläuft der axiale<br />
Befall unabhängig von der Aktivität der Darmentzündung<br />
oder Behandlung <strong>und</strong> ist bei HLA-B27-positiven Patienten<br />
häufiger (3).<br />
Im vorliegenden Fall bestand bei chronischer Diarrhoe<br />
bereits <strong>in</strong>itial die Verdachtsdiagnose e<strong>in</strong>er enterogenen<br />
Spondarthropathie mit peripherem Gelenkbefall, wobei bei<br />
blander Endoskopie <strong>und</strong> Histologie die Diagnose <strong>in</strong>itial<br />
nicht gestellt werden konnte. Dafür war e<strong>in</strong>e zweite Koloskopie<br />
nach zwei Monaten, bei damals Exazerbation mit<br />
schwerer Diarrhoe, notwendig. Diese Parallelität der Aktivität<br />
an Darm <strong>und</strong> Gelenken ist bei peripherem Gelenkbefall<br />
typisch, wobei die Koloskopie im Intervall häufig e<strong>in</strong>en<br />
Normalbef<strong>und</strong> zeigt, <strong>und</strong> dann nicht diagnostisch ist (3, 4, 5).<br />
Zudem können im Frühstadium e<strong>in</strong>er <strong>und</strong>ifferenzierten<br />
Spondarthropathie histologische Darmwandveränderungen<br />
noch fehlen <strong>und</strong> erst im weiteren Verlauf, meistens als<br />
M. Crohn, auftreten (6). So wurde auch im vorliegenden Fall<br />
die erste (blande) Koloskopie bei bereits spontan weitgehend<br />
regredienter Arthritis <strong>und</strong> kaum gastro<strong>in</strong>test<strong>in</strong>alen<br />
Symptomen durchgeführt.<br />
Bezüglich e<strong>in</strong>er <strong>und</strong>ifferenzierten Spondarthropathie oder<br />
vermuteten enterogenen Spondarthropathie mit bisher blander<br />
Koloskopie <strong>und</strong> Histologie macht es, damit unabhängig<br />
vom Zeitpunkt e<strong>in</strong>er vorgängigen Endoskopie, unter<br />
Umständen S<strong>in</strong>n, die Untersuchung zu wiederholen. Die entscheidenden<br />
kl<strong>in</strong>ischen Indikatoren dafür s<strong>in</strong>d Aktivität von<br />
Seiten der peripheren Arthritis oder aber der Darmentzündung.<br />
Literaturverzeichnis<br />
1 Leirisalo-Repo M, Turunen U, Stenman S, Helenius P,<br />
Seppala K: High frequency of silent <strong>in</strong>flammatory<br />
bowel disease <strong>in</strong> spondylarthropathy. Arthritis<br />
Rheum 37:23-31, 1994.<br />
2 De Vos M, Cuvelier C, Mielants H, Veys E, Barbier F,<br />
Elewaut A. Ileocolonoscopy <strong>in</strong> seronegative spondylarthropathy.<br />
Department of Gastroenterology, State<br />
University of Ghent, Belgium. Gastroenterology<br />
98:1105-6, 1990.<br />
3 Schorr-Lesnick B, Brandt LJ: Selected rheumatologic<br />
and dermatologic manifestations of <strong>in</strong>flammatory<br />
bowel disease. Am J Gastroenterol 83:216-23, 1988.<br />
4 Mielants H, Veys EM, Cuvelier C, De Vos M: Course<br />
of gut <strong>in</strong>flammation <strong>in</strong> spondylarthropathies and therapeutic<br />
consequences. Department of<br />
<strong>Rheuma</strong>tology, University Hospital, Ghent, Belgium.<br />
Baillieres Cl<strong>in</strong> <strong>Rheuma</strong>tol 10:147-64, 1996.<br />
5 Mielants H, Veys EM, Cuvelier C, De Vos M,<br />
Goemaere S, De Clercq L, Schatteman L,<br />
Gyselbrecht L, Elewaut D: The evolution of spondyloarthropathies<br />
<strong>in</strong> relation to gut histology. III.<br />
Relation between gut and jo<strong>in</strong>t. Department of<br />
<strong>Rheuma</strong>tology, Ghent University Hospital, Belgium.<br />
J <strong>Rheuma</strong>tol. 22:2279-84, 1995.<br />
6 Mielants H, Veys EM, De Vos M, Cuvelier C,<br />
Goemaere S, De Clercq L, Schatteman L, Elewaut D:<br />
The evolution of spondyloarthropathies <strong>in</strong> relation to<br />
gut histology. I. Cl<strong>in</strong>ical aspects. Department of<br />
<strong>Rheuma</strong>tology, Ghent University Hospital, Belgium.<br />
J <strong>Rheuma</strong>tol. 22:2279-84, 1995.<br />
37–2004<br />
7
8<br />
SPEZIAL<br />
Physiotherapie <strong>in</strong> der Chirurgie<br />
E<strong>in</strong>e vielseitige <strong>und</strong> abwechslungsreiche Arbeit<br />
Das Therapie-Team Chirurgie des Instituts für Physikalische Mediz<strong>in</strong> (IPM) am UniversitätsSpital Zürich arbeitet <strong>in</strong> folgenden<br />
Bereichen: Unfall- <strong>und</strong> Wiederherstellungschirurgie, Herz- <strong>und</strong> Gefässchirurgie, Viszeral- <strong>und</strong> Thoraxchirurgie, Kieferchirurgie<br />
sowie <strong>in</strong> der Intensivstation für Brandverletzte. Dieses vielseitige Tätigkeitsgebiet erfordert spezialisiertes Fachwissen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e<br />
grosse Flexibilität <strong>und</strong> Belastbarkeit der Team-Mitglieder.<br />
Im Therapie-Team arbeiten 14 diplomierte Physiotherapeut<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Physiotherapeuten zusammen mit vier Studierenden<br />
der Schule für Physiotherapie. Es werden hauptsächlich<br />
stationäre Patient<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Patienten behandelt, die<br />
teilweise nach Spitalaustritt ambulant weiter behandelt werden.<br />
Die Vielfalt des Tätigkeitsbereichs verlangt e<strong>in</strong> breit gefächertes<br />
Fachwissen, welches durch Berufserfahrung <strong>und</strong><br />
gezielte <strong>Weiterbildung</strong> erreicht wird. Diesbezüglich haben<br />
die Therapeut<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Therapeuten <strong>in</strong>dividuell <strong>in</strong> diversen<br />
Spezialgebieten zusätzliches Fachwissen erworben: <strong>in</strong> der<br />
Mediz<strong>in</strong>ischen Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gstherapie (MTT), der Manualtherapie,<br />
der Lymphologischen Physiotherapie, <strong>in</strong> der Neurologischen<br />
Physiotherapie (Bobathkonzept), <strong>in</strong> der Handtherapie,<br />
<strong>in</strong> der Therapie des faciooralen Traktes (FOTT) sowie <strong>in</strong> der<br />
Behandlung von Kieferbeschwerden.<br />
E<strong>in</strong>e weitere wichtige Aufgabe besteht <strong>in</strong> der Ausbildung von<br />
angehenden Physiotherapeut<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Physiotherapeuten.<br />
Diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen spezifisch<br />
ausgebildete <strong>und</strong> besonders qualifizierte Team-Mitglieder.<br />
Messen der Kniegelenkbeweglichkeit mit dem Goniometer<br />
Bef<strong>und</strong> / Behandlung / Verlauf<br />
BARBARA SAX<br />
Um die Bedürfnisse <strong>und</strong> Probleme der Patient<strong>in</strong>nen <strong>und</strong><br />
Patienten optimal zu erfassen, wird e<strong>in</strong>e ausführliche <strong>und</strong><br />
standardisierte Bef<strong>und</strong>aufnahme durchgeführt. Diese basiert<br />
auf der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit,<br />
Beh<strong>in</strong>derung <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit (ICF) der Weltges<strong>und</strong>heitsorganisation<br />
(WHO). E<strong>in</strong> weiteres Mittel, die Probleme<br />
der Patient<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Patienten ganzheitlich zu erfassen <strong>und</strong><br />
darzustellen, ist das Erstellen von sogenannten «Cases».<br />
Anhand der schriftlichen Patientenbefragung, der Bef<strong>und</strong>aufnahme<br />
<strong>und</strong> des E<strong>in</strong>satzes von standardisierten <strong>und</strong> validierten<br />
Messmethoden wird es möglich, den Therapie-Erfolg<br />
über e<strong>in</strong>en längeren Zeitraum festzuhalten <strong>und</strong> das weitere<br />
Vorgehen entsprechend zu planen beziehungsweise anzupassen.<br />
Unfallchirurgische Abteilung<br />
Die Patient<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Patienten <strong>in</strong> der Unfallchirurgischen<br />
Abteilung haben sehr unterschiedliche Verletzungen <strong>in</strong> allen<br />
Schweregraden. Ziele der physiotherapeutischen Behandlung<br />
s<strong>in</strong>d: prophylaktische Massnahmen bei bettlägrigen Personen,<br />
Wiedererarbeitung der Mobilität <strong>und</strong> Verbesserung<br />
der Funktion von Gelenken <strong>und</strong> Muskulatur. Die Unterschiede<br />
<strong>und</strong> die Komplexität der Verletzungen erfordern bei<br />
der Behandlung e<strong>in</strong> hohes Fachwissen. Zudem verlangen<br />
schnell wechselnde Procedere bei variierender Nachbehandlung<br />
aktives Mitdenken, hohe Flexibilität <strong>und</strong> Belastbarkeit<br />
sowie e<strong>in</strong> effizientes Zeitmanagement seitens der Team-Mitglieder.<br />
Die therapeutische Leistung umfasst auch das Organisieren<br />
<strong>und</strong> Anpassen von Hilfsmitteln sowie der ambulanten<br />
Therapie. Wird e<strong>in</strong>e Patient<strong>in</strong> oder e<strong>in</strong> Patient <strong>in</strong> die Rehabilitation<br />
weitergeleitet, werden Verlegungsberichte erstellt,<br />
um e<strong>in</strong>e optimale weiterführende Behandlung zu gewährleisten.<br />
Die enge Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal<br />
sowie mit den Ärzt<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ärzten ist für e<strong>in</strong>e vollumfängliche<br />
Betreuung der Patient<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Patienten unerlässlich.
Abteilung für Herz-, Gefäss-, Viszeral- <strong>und</strong><br />
Thoraxchirurgie<br />
E<strong>in</strong> weiterer grosser E<strong>in</strong>satzbereich folgt aus der Herz-,<br />
Gefäss-, Viszeral- <strong>und</strong> Thoraxchirurgie. Hier stehen vor<br />
allem die Atemtherapie <strong>und</strong> die Verbesserung der Mobilität<br />
bei postoperativen Patient<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Patienten im Vordergr<strong>und</strong>.<br />
E<strong>in</strong>e differenzierte kl<strong>in</strong>ische Untersuchung steht<br />
auch hier am Anfang jeder Therapie. Sie ermöglicht die richtige<br />
Auswahl der Behandlungstechniken. Die Behandlung<br />
fokussiert sich sowohl auf die Instruktion <strong>und</strong> die Ausführung<br />
verschiedener Atemtechniken als auch auf den adäquaten<br />
E<strong>in</strong>satz der verschiedenen Atemhilfsgeräte <strong>und</strong> anderer<br />
Hilfsmittel.<br />
Besonders zu erwähnen s<strong>in</strong>d die lungen- <strong>und</strong> herztransplantierten<br />
Patient<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Patienten. Diese benötigen neben<br />
e<strong>in</strong>er klaren Patienten<strong>in</strong>struktion (Patient Education) <strong>und</strong><br />
e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>tensiven Atemtherapie weitere physiotherapeutische<br />
Massnahmen wie zum Beispiel e<strong>in</strong> angepasstes Ausdauertra<strong>in</strong><strong>in</strong>g<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>en gezielten Aufbau der Muskulatur.<br />
Kieferchirurgische Abteilung<br />
Die Kieferchirurgie umfasst e<strong>in</strong> breites Spektrum von Diagnosen.<br />
Dazu gehören sowohl traumatische Krankheitsbilder<br />
als auch Infektionen <strong>und</strong> Tumore im Kiefer- <strong>und</strong> M<strong>und</strong>bereich.<br />
Patient<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Patienten der Kieferchirurgie werden<br />
sowohl stationär als auch ambulant physiotherapeutisch<br />
behandelt. Das Hauptproblem bei dieser Patientengruppe<br />
liegt, nach grossen operativen E<strong>in</strong>griffen, häufig <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er ausgeprägten<br />
lymphatischen Schwellung im Gesicht <strong>und</strong> im<br />
Halsbereich (oft bed<strong>in</strong>gt durch die Entfernung von Lymphknoten).<br />
Lymphologische Physiotherapie ermöglicht schnell<br />
<strong>und</strong> nachhaltig solche Schwellungen zu reduzieren. Bei Kiefergelenkbeschwerden,<br />
M<strong>und</strong>öffnungsstörungen <strong>und</strong> Dysfunktion<br />
der Kaumuskulatur wird die Manualtherapie sowie<br />
Triggerpunkttherapie angewendet.<br />
Üben der Standbe<strong>in</strong>phase im Gehbarren Auskultation der Lunge nach e<strong>in</strong>er Herzoperation<br />
37–2004<br />
9
10<br />
SPEZIAL<br />
Abteilung für Wiederherstellungschirurgie <strong>und</strong><br />
Intensivstation für Brandverletzte<br />
Die Wiederherstellungschirurgie umfasst sowohl die Handals<br />
auch die plastische <strong>und</strong> rekonstruktive Chirurgie. Sie bietet<br />
dem Therapie-Team e<strong>in</strong> weiteres vielfältiges Tätigkeitsfeld.<br />
Spezielle Bedeutung kommt der Intensivstation für Brandverletzte<br />
zu. In dieser hochspezialisierten Kl<strong>in</strong>ik wird e<strong>in</strong><br />
sehr komplexes Patientengut behandelt. Zum e<strong>in</strong>en s<strong>in</strong>d Verbrennungen<br />
schwerwiegende Verletzungen, welche gravierende<br />
Komplikationen <strong>in</strong> den verschiedensten Organen mit<br />
sich ziehen können. Zum andern werden die betroffenen<br />
Personen meist psychisch erheblich belastet. Die unterschiedlichen<br />
Stadien des Krankheitsverlaufs verlangen<br />
jeweils verschiedene Therapieschwerpunkte. Atemtherapie<br />
<strong>und</strong> Mobilisation der Gelenke stehen dabei im Vordergr<strong>und</strong>.<br />
Die Mobilisation der Gelenke <strong>und</strong> der Narbengebiete ist zur<br />
Wiedererlangung der Beweglichkeit notwendig. Die Behandlung<br />
ist für die Betroffenen meist mit Schmerzen verb<strong>und</strong>en<br />
<strong>und</strong> fordert von den behandelnden Physiotherapeut<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Physiotherapeuten e<strong>in</strong> hohes Mass an E<strong>in</strong>fühlungsvermögen.<br />
Ausdauertra<strong>in</strong><strong>in</strong>g <strong>und</strong> lokaler Kraftaufbau s<strong>in</strong>d Voraussetzung<br />
für die Wiedererlangung der durch die lange<br />
Immobilisation verlorenen Selbstständigkeit. Diese wird<br />
auch <strong>in</strong> Zusammenarbeit mit der Ergotherapie erarbeitet.<br />
Die oft sehr lange Aufenthaltsdauer brandverletzter Patient<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Patienten <strong>in</strong> der Station bedeutet für das Therapie-Team<br />
e<strong>in</strong>e besondere menschliche Herausforderung.<br />
Zusammenfassung<br />
Rituximab als second-l<strong>in</strong>e drug<br />
bei <strong>Rheuma</strong>toider Arthritis<br />
Die tägliche Arbeit des Therapie-Teams erfordert e<strong>in</strong> hohes<br />
Mass an Fachwissen <strong>in</strong> verschiedenen Kl<strong>in</strong>ikbereichen. Individuelle<br />
Organisation, offene Kommunikation, grosse Flexibilität<br />
<strong>und</strong> gegenseitiges Vertrauen gewährleisten sowohl den<br />
therapeutischen Erfolg als auch e<strong>in</strong>e harmonische Teamarbeit.<br />
E<strong>in</strong> guter Teamgeist <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Prise Humor helfen die<br />
manchmal hektischen <strong>und</strong> zugleich schwierigen Alltagssituationen<br />
geme<strong>in</strong>sam zu bewältigen.<br />
In der Tat ist die Physiotherapie <strong>in</strong> der Chirurgie e<strong>in</strong> vielseitiges<br />
<strong>und</strong> abwechslungsreiches Arbeitsfeld!<br />
Kürzlich wurde <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Artikel <strong>in</strong> der Zeitschrift New England Journal of Medic<strong>in</strong>e über die Anwendung<br />
von Rituximab bei <strong>Rheuma</strong>toider Arthritis berichtet1 . Dabei konnte mit diesem gegen B-Lymphozyten gerichteten Antikörper<br />
bei der Mehrzahl der Patienten e<strong>in</strong>e signifikante Verm<strong>in</strong>derung der Krankheitsaktivität erreicht werden,<br />
die über viele Monate anhielt.<br />
Seit der Entdeckung der <strong>Rheuma</strong>faktor-Autoantikörper<br />
wurde den B-Lymphozyten e<strong>in</strong>e wichtige Rolle <strong>in</strong> der Pathogenese<br />
der <strong>Rheuma</strong>toiden Arthritis zugeschrieben. Der<br />
Nachweis e<strong>in</strong>er kausalen Wirkung der <strong>Rheuma</strong>faktoren<br />
konnte jedoch nicht erbracht werden, sodass die Aktivierung<br />
von B-Lymphozyten eher als sek<strong>und</strong>äres Phänomen betrachtet<br />
wurde. Diese Sichtweise muss nun spätestens seit e<strong>in</strong>er<br />
Publikation von Edwards et al. im New England Journal of<br />
Medic<strong>in</strong>e 2004 revidiert werden 1 .<br />
1 Edwards et al.: N Engl J Med 350:2572-81, 2004.<br />
DIEGO KYBURZ<br />
In e<strong>in</strong>er randomisierten doppelbl<strong>in</strong>den kontrollierten Studie<br />
wurde der Effekt e<strong>in</strong>er gegen B-Lymphozyten gerichteten<br />
Therapie bei Patienten mit <strong>Rheuma</strong>toider Arthritis untersucht.<br />
Es wurde dabei Rituximab (MabThera ® ) e<strong>in</strong>gesetzt,<br />
e<strong>in</strong> monoklonaler Antikörper gegen CD20, e<strong>in</strong> Oberflächenprote<strong>in</strong><br />
auf B-Lymphozyten. Die B<strong>in</strong>dung von Rituximab an<br />
CD20 führt zum Tod der B-Zellen. Dieser Effekt wird seit<br />
e<strong>in</strong>igen Jahren für die Behandlung von B-Zell-Lymphomen<br />
ausgenutzt, <strong>in</strong> dieser Indikation ist Rituximab <strong>in</strong> der <strong>Schweiz</strong><br />
zugelassen.
In der Studie wurden <strong>in</strong>sgesamt 161 Patienten randomisiert<br />
e<strong>in</strong>er von vier Behandlungsgruppen zugeteilt: Rituximab 2 x<br />
1000 mg; Rituximab plus Cyclophosphamid (2 x 750 mg);<br />
Rituximab plus Methotrexat; Methotrexat (Kontrollgruppe).<br />
Die Wirksamkeit der Therapie wurde anschliessend gemäss<br />
den ACR- <strong>und</strong> EULAR-Kriterien nach 24 <strong>und</strong> 48 Wochen<br />
evaluiert. E<strong>in</strong>geschlossen wurden Patienten mit aktiver<br />
Arthritis trotz Behandlung mit Methotrexat. Die e<strong>in</strong>malige<br />
Verabreichung von zwei Infusionen Rituximab <strong>in</strong>nerhalb von<br />
zwei Wochen resultierte <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er signifikanten Verm<strong>in</strong>derung<br />
der Krankheitsaktivität gegenüber der Kontrollgruppe mit<br />
Methotrexat Monotherapie. Die Verbesserung wurde <strong>in</strong> allen<br />
mit Rituximab behandelten Patienten gef<strong>und</strong>en, jedoch<br />
waren die Komb<strong>in</strong>ationstherapien der Rituximab Monotherapie<br />
überlegen. In den mit Rituximab plus Methotrexat<br />
behandelten Patienten wurden Ansprechraten für ACR20<br />
nach 24 Wochen von über 70% <strong>und</strong> ACR50 von über 40%<br />
festgestellt. Bemerkenswert war, dass auch nach 48 Wochen<br />
65% der Patienten e<strong>in</strong> ACR20 <strong>und</strong> 35% e<strong>in</strong> ACR50 erreichten.<br />
Die <strong>in</strong>itiale Behandlung mit Rituximab hatte somit e<strong>in</strong>en<br />
über fast e<strong>in</strong> Jahr andauernden Effekt.<br />
Wie <strong>in</strong> anderen Studien nachgewiesen werden konnte, korreliert<br />
die kl<strong>in</strong>ische Wirkung von Rituximab mit e<strong>in</strong>em Verschw<strong>in</strong>den<br />
der B-Lymphozyten aus dem peripheren Blut <strong>und</strong><br />
e<strong>in</strong>em Abs<strong>in</strong>ken der <strong>Rheuma</strong>faktor-Titer. Aus diesen Ergebnissen<br />
folgt, dass B-Lymphozyten aktiv an der Unterhaltung<br />
der Gelenkentzündung bei <strong>Rheuma</strong>toider Arthritis beteiligt<br />
CD20 Prote<strong>in</strong><br />
Rituximab<br />
s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> deren Ausschaltung e<strong>in</strong>e markante Reduktion der<br />
entzündlichen Aktivität zur Folge hat. Interessanterweise<br />
sche<strong>in</strong>en die Titer von protektiven Antikörpern gegen virale<br />
oder bakterielle Antigene durch die Behandlung mit Rituximab<br />
nicht bee<strong>in</strong>flusst zu werden. Entsprechend waren auch<br />
Infektkomplikationen bei mit Rituximab behandelten<br />
Patienten gegenüber der Kontrollgruppe nicht gehäuft. Die<br />
häufigsten Nebenwirkungen waren Infusionsreaktionen<br />
während der ersten Infusion.<br />
Bei welchen Patienten kommt e<strong>in</strong>e Behandlung mit<br />
Rituximab <strong>in</strong> Frage?<br />
Rituximab ist <strong>in</strong> der <strong>Schweiz</strong> für die Indikation <strong>Rheuma</strong>toide<br />
Arthritis noch nicht zugelassen. Aktuell kommt e<strong>in</strong> E<strong>in</strong>satz<br />
von Rituximab deshalb nur <strong>in</strong> Ausnahmesituationen <strong>in</strong><br />
Frage, <strong>in</strong>sbesondere bei Patienten mit hoher Krankheitsaktivität<br />
trotz E<strong>in</strong>satzes von TNF-Hemmern. Vorgängig muss auf<br />
jeden Fall e<strong>in</strong> Kostengutsprachegesuch an den Vertrauensarzt<br />
der Krankenkasse gerichtet werden. Die Behandlungskosten<br />
belaufen sich auf zirka 10 000 Fr. für die Standarddosis<br />
von 2 x 1000 mg.<br />
Vor e<strong>in</strong>em breiteren E<strong>in</strong>satz dieses Medikamentes müssen<br />
weitere Studien Aufschluss über die optimale Dosierung, die<br />
Dosierungs<strong>in</strong>tervalle, mögliche Komb<strong>in</strong>ationstherapien <strong>und</strong><br />
Nebenwirkungen geben. Die bisherigen Studienresultate<br />
sowie unsere Erfahrungen <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen lassen hoffen, dass<br />
mit Rituximab <strong>in</strong> absehbarer Zukunft e<strong>in</strong> potentes neues<br />
Medikament zur Behandlung der <strong>Rheuma</strong>toiden Arthritis<br />
zur Verfügung stehen wird.<br />
B<strong>in</strong>dung von Rituximab<br />
an das Oberflächenmolekül CD20<br />
auf e<strong>in</strong>em B-Lymphozyten<br />
37–2004<br />
11
12<br />
SCHWERPUNKT<br />
Molekulare <strong>und</strong> zelluläre Mechanismen<br />
der aseptischen Prothesenlockerung<br />
Jährlich werden weltweit zirka 1’300’000 Endoprothesen implantiert. Die Endoprothesenimplantation ist e<strong>in</strong><br />
grosser Erfolg der jüngeren Mediz<strong>in</strong>geschichte <strong>und</strong> hat stark zur Verbesserung der Lebensqualität der betroffenen Patienten<br />
beigetragen. Dennoch s<strong>in</strong>d die e<strong>in</strong>mal implantierten Prothesen nicht von lebenslanger Dauer. Trotz immer neuer<br />
Entwicklungen müssen <strong>in</strong>nerhalb der ersten 15 Jahre 10 bis 15 Prozent der Implantate aufgr<strong>und</strong> vorzeitiger Prothesenlockerung<br />
gewechselt werden1 . Bei vorzeitiger Lockerung ohne Infekt oder Trauma spricht man von aseptischer Lockerung.<br />
Aseptische Lockerungsmechanismen<br />
Die vorzeitige aseptische Lockerung ist die Hauptkomplikation<br />
implantierter Prothesen. Die aseptische Lockerung<br />
basiert auf unterschiedlichen Mechanismen. E<strong>in</strong>e wichtige<br />
Ursache liegt <strong>in</strong> der Prothese selbst, wenn es aufgr<strong>und</strong> mangelnder<br />
Primärstabilität des Implantates nicht zu e<strong>in</strong>er ausreichenden<br />
Osteo<strong>in</strong>tegration der Prothese kommt <strong>und</strong> damit<br />
zu Mikrobewegungen des Implantates 2 . Weiterh<strong>in</strong> wird der<br />
Flüssigkeitsfluss <strong>und</strong> -druck für die Entstehung von periartikulären<br />
Zysten e<strong>in</strong>es arthrotisch veränderten Gelenkes verantwortlich<br />
gemacht. Als Reaktion hierauf kommt es zu<br />
e<strong>in</strong>em Zytok<strong>in</strong>anstieg. Weiterh<strong>in</strong> unterstützt vermehrter<br />
Flüssigkeitsfluss den Transport von Abriebpartikeln. Diese<br />
Abriebpartikel des Implantates (Polyethylen, Inlay, Zement,<br />
Keramik, Metall) <strong>und</strong> die daraus resultierende Entzündung<br />
spielen den entscheidenden Faktor 3 .<br />
Charakteristisch für die Lockerung ist histopathologisch die<br />
periprothetische Membran (Abb. 1 <strong>und</strong> 2) <strong>und</strong> das Ausbilden<br />
von Osteolysen (Abb. 3 <strong>und</strong> 4), <strong>in</strong> denen sich ebenfalls e<strong>in</strong>e<br />
periprothetische Membran bef<strong>in</strong>det 4 . Diese Membran<br />
schwankt <strong>in</strong> ihrer Dicke stark (im Schaftbereich zwischen 0,1<br />
<strong>und</strong> 0,3 mm <strong>und</strong> im Pfannenbereich bis zu 1,0 mm).<br />
Abb. 1: Periprothetische Membran<br />
PHILIPP DREES / LARS C. HUBER<br />
Abb. 2: Periprothetische abrieb<strong>in</strong>duzierte Membran<br />
Betrachtet man die periprothetische Membran histopathologisch,<br />
so besteht sie grösstenteils aus Makrophagen, Prothesenlockerungs-spezifischen<br />
Fibroblasten <strong>und</strong> mult<strong>in</strong>ukleären<br />
Riesenzellen. Grössere Abriebpartikel (beispielsweise Polyethylen<br />
> 5µm) f<strong>in</strong>den sich vor allem <strong>in</strong> mult<strong>in</strong>ukleären Riesenzellen,<br />
während kle<strong>in</strong>ere PE Partikel (< 2µm) vor allem<br />
von Makrophagen aufgenommen werden. Ganz vere<strong>in</strong>zelt<br />
f<strong>in</strong>den sich Lymphozyten <strong>und</strong> zuweilen auch nekrotische<br />
Areale. Selbstverständlich s<strong>in</strong>d auch die ursächlich verantwortlichen<br />
Abriebpartikel aus Polyethylen, Keramik, Metall<br />
oder Zement (je nach Prothesentyp) darstellbar.
Abb. 3: Osteolyse im Bereich des Acetabulum im konventionellen<br />
Röntgenbild<br />
Neben der Histologie ist natürlich die Molekularbiologie von<br />
grösster Bedeutung. Die zellulären <strong>und</strong> enzymatischen Prozesse<br />
<strong>in</strong> der Membran s<strong>in</strong>d für die Entstehung der Osteolysen<br />
verantwortlich. Die Entzündungsreaktion ist dabei der<br />
entscheidende Faktor für die periprothetische Knochenresorption<br />
<strong>und</strong> damit Voraussetzung für die Prothesenlockerung<br />
5 . Der Ablauf der Prothesenlockerung verläuft <strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnen<br />
Schritten, die nachfolgend erklärt werden.<br />
Abrieb<br />
Die Herkunft des Abriebmaterials ist, wie oben beschrieben,<br />
abhängig vom Prothesenmodell. Es kann sich hierbei um<br />
Polyethylen aus dem Pfannen<strong>in</strong>lay (Abb. 5), um Metall aus<br />
der Gleitpaarung oder um die Oberflächenbeschichtung des<br />
Femurschaftes, um Keramik vom Gelenkkopf oder um<br />
Zement handeln. Ke<strong>in</strong>e Gleitpaarung <strong>und</strong> ke<strong>in</strong> Implantatmodell<br />
ist bisher abriebfrei. Die Menge an Abrieb zeigt hierbei<br />
e<strong>in</strong>e gute Korrelation zur Prothesenlockerung sowie zu<br />
Grösse <strong>und</strong> Anzahl der Osteolysen, wie zahlreiche Studien<br />
belegt haben 6 . So f<strong>in</strong>det man bei Patienten, die ke<strong>in</strong>e<br />
Prothesenlockerung aufwiesen, <strong>und</strong> die man autoptisch auf<br />
Abriebpartikel untersuchte, zwar auch e<strong>in</strong>zelne Partikel im<br />
umgebenden Gewebe, jedoch deutlich weniger als im Gewebe<br />
von Patienten mit aseptisch gelockerten Prothesen 7 .<br />
Partikelmigration <strong>und</strong> Opsonisation<br />
(«Markierung»)<br />
Die Abriebpartikel müssen <strong>in</strong> das Gewebe gelangen, um Knochenresorption<br />
zu <strong>in</strong>duzieren. Diese «Partikelwanderung»<br />
wird von unterschiedlichen Faktoren wie Flüssigkeitsfluss,<br />
Implantatdesign, Anatomie des Gelenkes usw. bee<strong>in</strong>flusst.<br />
Während dieser Wanderung b<strong>in</strong>den verschiedene Prote<strong>in</strong>e an<br />
die Oberfläche der Partikel, darunter Album<strong>in</strong>, Kollagen,<br />
Fibronekt<strong>in</strong> <strong>und</strong> verschiedene Antikörper. Grösse, Form <strong>und</strong><br />
Anzahl der Partikel bee<strong>in</strong>flussen dabei die Opsonisation <strong>und</strong><br />
die zelluläre Reaktion. Nicht jeder Abriebpartikel <strong>in</strong>duziert<br />
die gleiche zelluläre Reaktion. So werden beispielsweise<br />
unterschiedliche Zytok<strong>in</strong>e oder Matrix-degradierende Enzyme<br />
<strong>in</strong> Abhängigkeit der Partikelgrösse <strong>und</strong> -form exprimiert 8 .<br />
Neben den Molekülen des Patienten b<strong>in</strong>den auch bakterielle<br />
Substanzen (zum Beispiel Endotox<strong>in</strong>) an das Abriebmaterial.<br />
In vitro-Versuche haben gezeigt, dass endotox<strong>in</strong>freie Abriebpartikel<br />
weniger Zytok<strong>in</strong>e aus Makrophagen freisetzen. Die<br />
kl<strong>in</strong>ische Bedeutung von an Implantaten adhärentem Endotox<strong>in</strong><br />
<strong>und</strong> anderen bakteriellen Produkten könnte zu e<strong>in</strong>er<br />
mangelnden Osteo<strong>in</strong>tegration führen 9 .<br />
Knochenresorption durch Phagozytose, Rezeptoraktivierung<br />
oder Komb<strong>in</strong>ation beider Prozesse<br />
Abriebpartikel <strong>in</strong>teragieren an der Knochen-Implantat-<br />
Grenze mit unterschiedlichen Zelltypen <strong>und</strong> können die<br />
Funktion von Makrophagen, Osteoblasten, Osteoklasten <strong>und</strong><br />
Fibroblasten durch Phagozytose oder Oberflächenaktivierung<br />
verändern. Die für die Knochenresorption wichtigsten<br />
Zellen s<strong>in</strong>d Makrophagen, Osteoklasten <strong>und</strong> die Prothesenlockerungs-spezifischen<br />
Fibroblasten (PLF). Je kle<strong>in</strong>er der<br />
Partikelabrieb ist (< 1�m), desto eher ist Phagozytose möglich<br />
<strong>und</strong> umso höher ist die biologische Aktivität 10 . Da die<br />
phagozytierten Partikel nicht verdaut werden können, führt<br />
Abb. 4: Nachweis der Osteolyse mittels CT<br />
37–2004<br />
13
14<br />
dies zu e<strong>in</strong>er vermehrten aber frustranen Sekretion von<br />
Mediatoren <strong>und</strong> Zytok<strong>in</strong>en durch stimulierte Makrophagen.<br />
Zudem gibt es H<strong>in</strong>weise, dass PLF Knochengewebe unabhängig<br />
von Osteoklasten resorbieren können <strong>und</strong> ebenfalls<br />
Mediatoren <strong>und</strong> Matrix-degradierende Enzyme freisetzen<br />
können 4 . Dieser konzentrierte Angriff auf die Abriebpartikel<br />
führt zu e<strong>in</strong>em dramatischen Anstieg von knochenresorbierenden<br />
Faktoren <strong>und</strong> schliesslich zur Osteolyse.<br />
Osteoklasten <strong>und</strong> aktivierte Makrophagen s<strong>in</strong>d für die Knochenresorption<br />
gleichsam bedeutend. Da die Makrophagen<br />
den Hauptzelltyp <strong>in</strong> der periprothetischen Membran bilden,<br />
werden sie für die direkte Knochenresorption verantwortlich<br />
gemacht. Während die Makrophagen vor allem an der Knochenoberfläche<br />
<strong>und</strong> an kle<strong>in</strong>eren Osteolysen beteiligt s<strong>in</strong>d,<br />
werden die Osteoklasten für e<strong>in</strong>e aussergewöhnlich schnelle<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong>tensive Knochenresorption sowie für größere Lakunen<br />
verantwortlich gemacht.<br />
Verschiedene Autoren haben gezeigt, dass, unabhängig von<br />
phagozytotischen Prozessen, alle<strong>in</strong> das B<strong>in</strong>den von Abriebpartikeln<br />
an die Zelloberfläche ausreichend ist, Entzündungsmediatoren<br />
wie TNFα, IL-1-α/β freizusetzen. Höchstwahrsche<strong>in</strong>lich<br />
aktivieren hierbei Abriebpartikel als exogene<br />
Liganden membranständige Rezeptoren, um e<strong>in</strong>e Makrophagenantwort<br />
zu <strong>in</strong>duzieren. Dies geschieht entweder<br />
<strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Phagosoms oder auf der Zelloberfläche. Ob<br />
diese Rezeptoren für die opsonierten Abriebpartikel spezifisch<br />
s<strong>in</strong>d oder e<strong>in</strong>e unspezifische B<strong>in</strong>dung erfolgt, ist noch<br />
unklar 3 .<br />
Intrazelluläre Signalwege<br />
Das Freisetzen von Prostagland<strong>in</strong> E 2, Zytok<strong>in</strong>en, Chemok<strong>in</strong>en,<br />
Matrixmetalloprote<strong>in</strong>asen <strong>und</strong> Wachstumsfaktoren<br />
durch partikelstimulierte Zellen ist sowohl von der Form,<br />
Grösse <strong>und</strong> Zusammensetzung der Partikel als auch von der<br />
Funktion der Zielzelle abhängig 8 . Unterschiedliche Liganden,<br />
die an «nichtverwandte» Rezeptoren b<strong>in</strong>den, <strong>in</strong>itiieren<br />
Abb. 5: Abgeriebenes Inlay<br />
wahrsche<strong>in</strong>lich e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>samen Signal-Transduktions-<br />
Mechanismus, der zur Aktivierung spezifischer Gene führt.<br />
Diese Schritte benötigen Transkriptionsfaktoren, die <strong>in</strong> der<br />
Lage s<strong>in</strong>d, <strong>in</strong> den Zellkern e<strong>in</strong>zudr<strong>in</strong>gen, an die Promoterregion<br />
der DNA zu b<strong>in</strong>den <strong>und</strong> so entsprechende Zielgene zu<br />
aktivieren. E<strong>in</strong>er dieser Transkriptionsfaktoren ist NF-κB<br />
(nuclear factor-κB). NF-κB ist als Heterodimer im Zytoplasma<br />
an das <strong>in</strong>hibitorische I-κB geb<strong>und</strong>en. Unter E<strong>in</strong>fluss von<br />
TNFα <strong>und</strong> anderer Stressoren kommt es zu e<strong>in</strong>er ganzen<br />
Kaskade zellulärer Ereignisse, die letztlich zum Abbau von<br />
I-κB <strong>und</strong> zur nukleären Translokation von NF-κB führen 11 .<br />
Im Zellkern b<strong>in</strong>det NF-κB an die Promoterregion se<strong>in</strong>er<br />
Zielgene (<strong>in</strong>sbesondere pro<strong>in</strong>flammatorische Zytok<strong>in</strong>e, Chemok<strong>in</strong>e,<br />
Adhäsionsmoleküle <strong>und</strong> Matrix-degradierende<br />
Enzyme).<br />
TNFα<br />
Die wichtigste Folge der Aktivierung von NF-κB durch<br />
Abriebpartikel ist die Freisetzung von TNFα durch Makrophagen.<br />
Nachdem TNF sezerniert wird, b<strong>in</strong>det es an Rezeptoren<br />
auf Makrophagen <strong>und</strong> führt so zu e<strong>in</strong>er autokr<strong>in</strong>en Stimulation.<br />
In der periprothetischen Membran sche<strong>in</strong>t TNFα<br />
mit mehreren Zelltypen zu <strong>in</strong>teragieren <strong>und</strong> b<strong>in</strong>det <strong>in</strong>sbesondere<br />
an Rezeptoren der Osteoklastenvorläuferzellen 12 .Im<br />
weiteren reduziert TNFα die Expression von TIMP (human<br />
tissue <strong>in</strong>hibitors of metalloprote<strong>in</strong>ase), dem natürlichen<br />
Gegenspieler der Matrixmetalloprote<strong>in</strong>asen, was e<strong>in</strong>e verstärkte<br />
Knochenresorption zur Folge hat. Ebenso werden<br />
Fibroblasten stimuliert, Matrix-degradierende Enzyme <strong>und</strong><br />
Osteoklasten-stimulierende Faktoren freizusetzen.<br />
Schließlich reguliert TNFα die Genexpression des Rezeptoraktivator<br />
des NF-κB Liganden (RANKL) <strong>und</strong> dessen Antagonist,<br />
Osteoproteger<strong>in</strong> (OPG).<br />
Merkel et al. zeigten, dass Knochenmarkzellen aus TNF-<br />
Rezeptor Knockout-Mäusen unfähig s<strong>in</strong>d, sich <strong>in</strong> knochenresorbierende<br />
Osteoklasten zu differenzieren, <strong>und</strong> dass diese<br />
Mäuse trotz Zement-Partikel-Implantation vor Osteolysen<br />
geschützt s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong> weiteres Tiermodell von Schwarz et al.<br />
unterstreicht die Bedeutung von TNFα. Mäuse, denen der<br />
TNF-Rezeptor fehlte, zeigten nur e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>ge entzündliche<br />
<strong>und</strong> resorptive Reaktion auf Abriebpartikel. Da der Transkriptionsfaktor<br />
NF-κB für die Knochenresorption unerlässlich<br />
ist, kreuzten Schwarz et al. Mäuse, denen dieser Transkriptionsfaktor<br />
fehlte, mit Mäusen, die TNFα überexprimierten.<br />
Die Reaktion auf Partikelstimulation zeigte sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
erhöhten Freisetzung von Entzündungsmediatoren jedoch<br />
ohne Knochenresorption. Dies unterstreicht die herausragende<br />
Bedeutung des TNFα / NF-κB-Signalweges für die<br />
Knochenresorption.
RANK/RANKL<br />
E<strong>in</strong>e wichtige Rolle <strong>in</strong> der Differenzierung von Osteoklasten<br />
aus zirkulierenden hämatopoetischen Vorläuferzellen spielen<br />
M-CSF (macrophage-colony stimulat<strong>in</strong>g factor) <strong>und</strong><br />
RANKL, RANK <strong>und</strong> OPG. RANKL ist e<strong>in</strong> Mitglied der<br />
TNF-Familie <strong>und</strong> wird von Osteoblasten <strong>und</strong> anderen Stromazellen<br />
exprimiert. Se<strong>in</strong> entsprechender Rezeptor, RANK,<br />
ist auf Monozyten <strong>und</strong> Gewebsmakrophagen e<strong>in</strong>schließlich<br />
Abriebpartikel-aktivierter Makrophagen vorhanden.<br />
RANKL stimuliert direkt die Differenzierung <strong>und</strong> Aktivierung<br />
der Osteoklasten. Die biologische Aktivität von<br />
RANKL (<strong>und</strong> damit die Knochenresorptionsaktivität der<br />
Osteoklasten) wird durch den Rezeptorantagonisten OPG<br />
gesteuert. OPG ist e<strong>in</strong> neueres Mitglied der TNF-Rezeptor-<br />
Familie. Im Gegensatz zu den anderen Mitgliedern der TNF-<br />
Rezeptor-Familie liegt OPG nur <strong>in</strong> löslicher Form vor. Das<br />
Expressionsverhältnis von RANKL zu OPG ist entschei-<br />
PLF<br />
Vorläuferzelle<br />
Osteolyse<br />
Osteoklast<br />
dend für die Knochenresorption 13 . Je nach Lage des Gleichgewichtes<br />
zwischen den beiden molekularen Gegenspielern<br />
ist die Knochenresorption gesteigert oder verm<strong>in</strong>dert. So<br />
konnte von Masui et al. kürzlich gezeigt werden, dass nach<br />
Implantation von Polyethylenpartikeln <strong>in</strong> Mäusekalvarien<br />
die Expression von RANKL deutlich zunahm. Damit verschob<br />
sich der RANKL/OPG-Komplex zu Gunsten der<br />
Osteoklastogenese, wodurch letztlich die Knochenresorption<br />
gesteigert wurde.<br />
Man muss jedoch davon ausgehen, dass auch andere Zelltypen<br />
RANKL produzieren. Ausserdem sche<strong>in</strong>en Abriebpartikel<br />
Makrophagen nicht nur direkt zur Freisetzung von<br />
RANKL zu stimulieren, sondern auch zur Sekretion von<br />
RANK, was e<strong>in</strong>e neue Möglichkeit für therapeutische Ansätze<br />
wäre 12 .<br />
RANK<br />
M-CSF RANKL/OPG<br />
MMPs/Catheps<strong>in</strong> K<br />
Endoprothese<br />
Makrophage<br />
Phagocytosis<br />
Abrieb-Partikel<br />
TNF-α<br />
Abb. 6: Zell<strong>in</strong>teraktionen bei aseptischer Prothesenlockerung<br />
37–2004<br />
15
16<br />
Zusammenfassung<br />
Die aseptische Lockerung von Endoprothesen ist e<strong>in</strong> wichtiges<br />
<strong>und</strong> noch weitgehend ungelöstes Problem der orthopädischen<br />
Mediz<strong>in</strong>. Mit der Identifizierung zellulärer Mechanismen<br />
<strong>und</strong> molekularen Signalwegen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den letzten Jahren<br />
entscheidende Schritte zur ursächlichen Behandlung<br />
dieser häufigen Komplikation erreicht worden.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich sche<strong>in</strong>t der Materialabrieb aus den Prothesen<br />
dabei die zelluläre Antwort des Körpers zu überfordern. Die<br />
Überladung von Makrophagen führt so zu e<strong>in</strong>er pro-<strong>in</strong>flammatorischen<br />
Reaktion <strong>und</strong> vor allem zur Rekrutierung <strong>und</strong><br />
Differenzierung osteolytisch wirksamer Zellen, <strong>in</strong>sbesondere<br />
von Osteoklasten <strong>und</strong> Prothesen-spezifischen Fibroblasten<br />
(Abb. 6). Die weitere Verfolgung von molekularbiologischen<br />
Zell<strong>in</strong>teraktionen <strong>in</strong>nerhalb der periprothetischen<br />
Membran wird uns dabei helfen, die aseptische Prothesenlockerung<br />
zu verstehen <strong>und</strong> kausale therapeutische Ansätze<br />
zu entwickeln.<br />
Literaturverzeichnis<br />
1 Fender D, Harper WM, Gregg PJ: The Trent regional<br />
arthroplasty study. Experiences with a hip register. J<br />
Bone Jo<strong>in</strong>t Surg Br 2000, 82:944-947<br />
2 Karrholm J, Borssen B, Lowenhielm G, Snorrason F:<br />
Does early micromotion of femoral stem prostheses<br />
matter? 4-7-year stereoradiographic follow-up of 84<br />
cemented prostheses. J Bone Jo<strong>in</strong>t Surg Br 1994,<br />
76:912-917<br />
3 Bauer TW: Particles and periimplant bone resorption.<br />
Cl<strong>in</strong> Orthop Relat Res 2002:138-143<br />
4 Pap T, Claus A, Ohtsu S, Hummel KM, Schwartz P,<br />
Drynda S, Pap G, Machner A, Ste<strong>in</strong> B, George M,<br />
Gay RE, Neumann W, Gay S, Aicher WK: Osteoclast<strong>in</strong>dependent<br />
bone resorption by fibroblast-like cells.<br />
Arthritis Res Ther 2003, 5:R163-173<br />
5 Morawietz L, Gehrke T, Classen RA, Barden B, Otto<br />
M, Hansen T, Aigner T, Stiehl P, Neidel J, Schroder<br />
JH, Frommelt L, Schubert T, Meyer-Scholten C,<br />
Konig A, Strobel P, Rader Ch P, Kirschner S, L<strong>in</strong>tner<br />
F, Ruther W, Skwara A, Bos I, Kriegsmann J, Krenn<br />
V: [Proposal for the classification of the periprosthetic<br />
membrane from loosened hip and knee endoprostheses].<br />
Pathologe 2004, 25:375-384<br />
6 Barrack RL, Castro FP, Jr., Szuszczewicz ES,<br />
Schmalzried TP: Analysis of retrieved uncemented<br />
porous-coated acetabular components <strong>in</strong> patients<br />
with and without pelvic osteolysis. Orthopedics 2002,<br />
25:1373-1378; discussion 1378<br />
7 Sychterz CJ, Moon KH, Hashimoto Y, Terefenko KM,<br />
Engh CA, Jr., Bauer TW: Wear of polyethylene cups<br />
<strong>in</strong> total hip arthroplasty. A study of specimens retrieved<br />
post mortem. J Bone Jo<strong>in</strong>t Surg Am 1996,<br />
78:1193-1200<br />
8 Green TR, Fisher J, Matthews JB, Stone MH, Ingham<br />
E: Effect of size and dose on bone resorption activity<br />
of macrophages by <strong>in</strong> vitro cl<strong>in</strong>ically relevant ultra<br />
high molecular weight polyethylene particles. J<br />
Biomed Mater Res 2000, 53:490-497<br />
9 Greenfield EM, Bi Y, Ragab AA, Goldberg VM,<br />
Nalepka JL, Seabold JM: Does endotox<strong>in</strong> contribute<br />
to aseptic loosen<strong>in</strong>g of orthopedic implants? J Biomed<br />
Mater Res B Appl Biomater 2005, 72:179-185<br />
10 von Knoch M, Buchhorn G, von Knoch F, Koster G,<br />
Willert HG: Intracellular measurement of polyethylene<br />
particles. A histomorphometric study. Arch<br />
Orthop Trauma Surg 2001, 121:399-402<br />
11 Huber LC, Pap T, Muller-Ladner U, Gay RE, Gay S:<br />
Gene target<strong>in</strong>g: roadmap to future therapies. Curr<br />
<strong>Rheuma</strong>tol Rep 2004, 6:323-325<br />
12 Crotti TN, Smith MD, F<strong>in</strong>dlay DM, Zreiqat H, Ahern<br />
MJ, Weedon H, Hatz<strong>in</strong>ikolous G, Capone M, Hold<strong>in</strong>g<br />
C, Haynes DR: Factors regulat<strong>in</strong>g osteoclast formation<br />
<strong>in</strong> human tissues adjacent to peri-implant bone<br />
loss: expression of receptor activator NFkappaB,<br />
RANK ligand and osteoproteger<strong>in</strong>. Biomaterials<br />
2004, 25:565-573<br />
13 Sabokbar A, Kudo O, Athanasou NA: Two dist<strong>in</strong>ct<br />
cellular mechanisms of osteoclast formation and<br />
bone resorption <strong>in</strong> periprosthetic osteolysis. J Orthop<br />
Res 2003, 21:73-80
Abstracts<br />
4 th Day of Cl<strong>in</strong>ical Research<br />
Am dieses Jahr zum vierten Mal stattf<strong>in</strong>denden jährlichen Symposium des Zentrums für Kl<strong>in</strong>ische Forschung (ZKF) des<br />
UniversitätsSpitals Zürich «4th Day of Cl<strong>in</strong>ical Research» wurden von den Mitarbeitern der <strong>Rheuma</strong>kl<strong>in</strong>ik <strong>und</strong> des Institutes<br />
für Physikalische Mediz<strong>in</strong> die nachstehenden Abstracts präsentiert. Dabei wurde der Vortrag von Dr. Carol<strong>in</strong>e Ospelt<br />
mit e<strong>in</strong>em Preis für ihre Präsentation ausgezeichnet.<br />
01<br />
ACTIVE OVER 45 – INTRODUCTION OF A MOVEMENT PROMOTION<br />
PROGRAMME FOR INACTVE WOMAN OVER 45 – A FEASIBILITY<br />
STUDY<br />
P Baschung1 , K Niedermann1 , GA Reiss1 , J Swanenburg1 , D Uebelhart1 and E<br />
Zemp2 1Department of <strong>Rheuma</strong>tology and Institute of Physical Medic<strong>in</strong>e, University Hospital Zurich;<br />
2Institute of Social and Preventative Medic<strong>in</strong>e, Basle University; pierrette.baschung@usz.ch<br />
Purpose: At the University Hospital Zurich, we <strong>in</strong>troduced a programme to promote<br />
physical activity <strong>in</strong> <strong>in</strong>active postmenopausal women. We utilized this feasibility<br />
study to test atta<strong>in</strong>ment of the target population, practicability and acceptance<br />
of the programme.<br />
Methods: 1249 female employees over the age of 45 were sent a questionnaire to<br />
determ<strong>in</strong>e their physical activity. Those that described themselves as <strong>in</strong>active and<br />
<strong>in</strong>terested <strong>in</strong> a movement promotion programme were sent a concrete offer. The<br />
target population was exam<strong>in</strong>ed us<strong>in</strong>g the transtheoretical model and their physical<br />
performance.<br />
Results: 510 women (41%) responded to the first questionnaire. Of these 250 were<br />
<strong>in</strong>active and <strong>in</strong>terested <strong>in</strong> a movement promotion programme. 68 women participated<br />
<strong>in</strong> the tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g programme, 47 women completed the tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g. This group<br />
showed a significant improvement <strong>in</strong> physical performance. 47 of all <strong>in</strong>active<br />
women who responded <strong>in</strong>dicated that they would like a less exertive movement<br />
programme type.<br />
Conclusion: In spite of the <strong>in</strong>tensity of the programme, a quarter of the <strong>in</strong>terested<br />
<strong>in</strong>active women participated. The acceptance and practicability was very good. To<br />
reach more women, the content and <strong>in</strong>tensity of the programme would need to be<br />
adjusted.<br />
Keywords: Physical Activity, movement promotion programme, postmenopausal<br />
women<br />
1 Lamprecht M, Stamm HP, Sport <strong>Schweiz</strong> 2000, 2001<br />
2 2. Kahn EB, Ramsey LT, Brownson RC, Heath GH, Howze EH, Powell KE,<br />
Stone EJ, Rajab MW, Am J Prev Med, 22(4S):73-1072002<br />
02<br />
ARE «STRUCTURAL ABNORMALITIES» OF THE LUMBAR SPINE,<br />
OBSERVED ON MRI, A CONTRAINDICATION TO THE SUCCESSFUL<br />
CONSERVATIVE TREATMENT OF NON-SPECIFIC CHRONIC LOW<br />
BACK PAIN?<br />
AF Mannion#*, F Kle<strong>in</strong>stück*, Müntener M‡, J Dvorak*<br />
#Dept <strong>Rheuma</strong>tology and Institute of Physical Medic<strong>in</strong>e, University Hospital Zürich; *Schulthess<br />
Kl<strong>in</strong>ik, Zürich, ‡Institute of Anatomy, University of Zürich; anne.mannion@usz.ch<br />
Purpose: Certa<strong>in</strong> structural ‘abnormalities’, <strong>in</strong>dicative of degenerative disease of<br />
the lumbar sp<strong>in</strong>e, are as common <strong>in</strong> asymptomatic <strong>in</strong>dividuals as <strong>in</strong> people with<br />
chronic low back pa<strong>in</strong> (cLBP) and thus cannot be held responsible for the symptoms<br />
1 . However, whether the presence of such «abnormalities» <strong>in</strong>fluences the<br />
response to gold-standard conservative treatment for non-specific cLBP has not<br />
been <strong>in</strong>vestigated.<br />
Methods: T2-weighted, 4mm sp<strong>in</strong>-echo MRI sequences of the lumbar sp<strong>in</strong>e were<br />
obta<strong>in</strong>ed from 53 patients with cLBP before 3-months’ exercise therapy. Disc<br />
degeneration (DD), disc bulg<strong>in</strong>g (DB), high <strong>in</strong>tensity zones (HIZ), and endplate<br />
changes (EP) were assessed for each lumbar segment. The proportions of<br />
patients show<strong>in</strong>g cl<strong>in</strong>ically relevant reductions <strong>in</strong> pa<strong>in</strong> (>30%) or disability<br />
(>35%) 12-months after therapy were determ<strong>in</strong>ed.<br />
Results: Only 10% patients showed no abnormalities <strong>in</strong> any segment. There<br />
were no significant associations between outcome and the presence of either<br />
severe DD or EP; the presence of HIZ and the absence of DB were each associated<br />
with a greater likelihood (p
18<br />
04<br />
INFLUENCE OF SELF-PERCEIVED BACK PAIN AND BACK<br />
PAIN-RELATED FEAR AVOIDANCE BELIEFS ON HEALTH CARE<br />
PROVIDER ADVICE AND TREATMENT OF BACK PAIN PATIENTS<br />
S. Hoffmann 1 ,D.Uebelhart 1 and R. de Bie 2<br />
1Department of <strong>Rheuma</strong>tology and Institute of Physical Medic<strong>in</strong>e, University Hospital Zurich;<br />
2Department of Epidemiology, Maastricht University; The Netherlands, sven.hoffmann@usz.ch<br />
Purpose: To assess the association of self-perceived back pa<strong>in</strong> and back pa<strong>in</strong>related<br />
fear avoidance beliefs and further covariables of health care provider’s<br />
(HCP) on advice and treatment of back pa<strong>in</strong> patients.<br />
Methods: 694 HCP’s were <strong>in</strong>terviewed (postal questionnaire), consist<strong>in</strong>g of the<br />
Fear Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ), Health Care Provider Back<br />
Pa<strong>in</strong> Beliefs Questionnaire (HCBB), and 8 items address<strong>in</strong>g sociodemographics<br />
and self-perceived back pa<strong>in</strong>. 502 <strong>in</strong>terviews were available for analysis. The<br />
FABQ and HCBB were evaluated with regard to reliability and <strong>in</strong>ternal consistency.<br />
Kruskal-Wallis-H-test was performed for group differences. Factor analysis<br />
was performed to check for red<strong>und</strong>ancies. Logistic regression analysis was<br />
performed to assess the <strong>in</strong>fluence of relevant factors.<br />
Results: Good <strong>in</strong>ternal consistency and reliability was fo<strong>und</strong> <strong>in</strong> FABQ and<br />
HCBB. Factor analysis revealed no red<strong>und</strong>ancies. Significant differences were<br />
fo<strong>und</strong> <strong>in</strong> self-perceived low back pa<strong>in</strong> (LBP), vocational tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g and occupation.<br />
Regression analysis revealed professional and vocational tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g and work<strong>in</strong>g<br />
experience as important associated factors to item responses.<br />
Conclusion: A high association was fo<strong>und</strong> between HCP currently experienc<strong>in</strong>g<br />
back pa<strong>in</strong> and those never hav<strong>in</strong>g experienced back pa<strong>in</strong> and their advice/treatment<br />
for LBP patients. Work<strong>in</strong>g experience and vocational tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g were fo<strong>und</strong><br />
as cofactors to self-perceived LBP, while gender and age were fo<strong>und</strong> to be m<strong>in</strong>or<br />
cofactors.<br />
05<br />
RNA RELEASED FROM NECROTIC SYNOVIAL FLUID CELLS<br />
ACTIVATES RHEUMATOID ARTHRITIS SYNOVIAL FIBROBLASTS<br />
VIA TLR3<br />
Fabia Brentano, Olivier Schorr, Renate E. Gay, Steffen Gay, Diego Kyburz<br />
Center of Experimental <strong>Rheuma</strong>tology, Department of <strong>Rheuma</strong>tology, University Hospital of<br />
Zurich, Switzerland<br />
Purpose: To <strong>in</strong>vestigate the functional role of TLR3 <strong>in</strong> rheumatoid arthritis<br />
(RA) by analyz<strong>in</strong>g TLR3 expression <strong>in</strong> RA and osteoarthritis (OA) synovial tissues<br />
and on RA cultured synovial fibroblasts (RASF).<br />
Methods: Expression of TLR3 was determ<strong>in</strong>ed <strong>in</strong> synovial tissues by immunohistochemistry<br />
and on cultured RASF by FACS and real-time PCR. TLR3 signal<strong>in</strong>g<br />
was assessed by stimulation of RASF with poly(I:C), LPS, Pam3CSK4 or<br />
with RA necrotic synovial fluid cells (SFC). Chemok<strong>in</strong>es and cytok<strong>in</strong>es were<br />
measured by ELISA.<br />
Results: TLR3 prote<strong>in</strong> expression was fo<strong>und</strong> to be higher <strong>in</strong> RA synovial tissues<br />
as compared to OA. A pronounced expression of TLR3 was fo<strong>und</strong> <strong>in</strong> the synovial<br />
l<strong>in</strong><strong>in</strong>g thereby the majority of TLR3 express<strong>in</strong>g cells were synovial fibroblasts.<br />
Stimulation of cultured RASF with the TLR3 ligand poly(I:C) or with<br />
necrotic RA-SFC resulted <strong>in</strong> the production of high levels of IFN-beta,<br />
CXCL10, CCL5 and IL-6 prote<strong>in</strong> <strong>in</strong> a TLR3 dependent manner.<br />
Conclusion: Based on the fact that TLR3 is expressed <strong>in</strong> RA synovial tissue and<br />
that TLR3 can be activated <strong>in</strong> RASF by respective TLR3 ligands, which results<br />
<strong>in</strong> the enhanced expression of pro<strong>in</strong>flammatory genes <strong>in</strong> RASF, the data show<br />
that the synovial fibroblast is not only a responder to <strong>in</strong>flammatory stimuli, but<br />
also a promoter of <strong>in</strong>flammation.<br />
Keywords: TLR, rheumatoid arthritis, synovial fibroblast<br />
06<br />
LICOFELONE, A CYCLOOXYGENASE/5-LIPOXYGENASE INHIBITOR<br />
REDUCES EXPRESSION OF CXCR3 LIGANDS IN RHEUMATOID<br />
ARTHRITIS SYNOVIAL FIBROBLASTS<br />
C. Ospelt 1 , M. Kurowska-Stolarska 1 , M. Neidhart 1 ,B.A.Michel 1 ,B.R.Simmen 2 ,<br />
R. E. Gay 1 and S. Gay 1<br />
1Center of Experimental <strong>Rheuma</strong>tology, University Hospital of Zurich; carol<strong>in</strong>e.ospelt@usz.ch<br />
2Schulthess Cl<strong>in</strong>ic, Zurich<br />
Purpose: Licofelone is a competitive <strong>in</strong>hibitor of cyclooxygenase-1 (COX-1),<br />
COX-2 and 5-lipoxygenase (5-LOX). To elucidate its downstream signal<strong>in</strong>g<br />
effects, we treated rheumatoid arthritis synovial fibroblasts (RASF) with Licofelone<br />
and studied their gene expression profile.<br />
Methods: RASF were stimulated for 72h with TNF-alpha (10ng/ml) and, after<br />
24h of stimulation, treated for 48h with Licofelone. Dose-dependent regulation<br />
of genes <strong>in</strong> RASF treated with 1 or 10_g/ml Licofelone was identified with Affymetrix<br />
gene chip analysis. Real-time PCR and ELISA were used to validate<br />
microarray data <strong>in</strong> RASF treated with 1, 3 or 9_g/ml Licofelone.<br />
Results: Affymetrix gene chip analysis showed the strongest, dose-dependent<br />
down regulation <strong>in</strong> the expression of CXCL10 (1). Us<strong>in</strong>g Real-time PCR we<br />
could confirm, that mRNA expression of the chemok<strong>in</strong>es CXCL10, CXCL9 and<br />
CXCL11 triggered by TNF-alpha were significantly downregulated by treatment<br />
with Licofelone. In addition, dose dependent downregulation of CXCL10<br />
prote<strong>in</strong> levels were measured after treatment with Licofelone.<br />
Conclusions: We show that a dual <strong>in</strong>hibitor of 5-LOX and COX-1/2 <strong>in</strong>hibits the<br />
production the CXCR3 ligands CXCL10, CXCL9 and CXCL11 <strong>in</strong> RASF. S<strong>in</strong>ce<br />
CXCR3 and its ligands are <strong>in</strong>volved <strong>in</strong> the selective chemoattraction of TH1<br />
cells, these results suggest that Licofelone could <strong>in</strong>hibit T-cell mediated pathways<br />
<strong>in</strong> RA (2).<br />
Disclosure: Supported by Merckle GmbH, Ulm, Germany<br />
1 C. Ospelt, M. Kurowska, M. Neidhart, B. Michel, B. Simmen, R. Gay, and<br />
S. Gay, ACR/ARHP Annual Scientific Meet<strong>in</strong>g, 2004<br />
2 R. Bonecchi, G. Bianchi, P. P. Bordignon, D. D'Ambrosio, R. Lang, A. Borsatti,<br />
S. Sozzani, P. Allavena, P. A. Gray, A. Mantovani, and F. S<strong>in</strong>igaglia, J Exp Med,<br />
187:129-34, 1998<br />
Keywords: Licofelone, rheumatoid arthritis synovial fibroblasts, TH1<br />
Gratulation<br />
Dr. med. Carol<strong>in</strong>e Ospelt hat mit ihren molekularbiologischen<br />
Untersuchungen vollkommen<br />
neue Effekte e<strong>in</strong>es dualen 5-LOX/COX-Inhibitors<br />
beschreiben können. Dieser Inhibitor,<br />
genannt Licofelone, ist <strong>in</strong> der Lage, <strong>in</strong> Zytok<strong>in</strong><br />
stimulierten synovialen Fibroblasten die Expression von<br />
bestimmten Chemok<strong>in</strong>e-CXCR3-Liganden nach unten zu regulieren.<br />
Für ihre e<strong>in</strong>drucksvoll dargestellten neuen Ergebnisse<br />
beim 4. Tag der Kl<strong>in</strong>ischen Forschung (ZKF) erhielt sie e<strong>in</strong>en<br />
Preis für ihre Präsentation.
Gratulationen <strong>und</strong> Abschied<br />
Adrian Forster verlässt die <strong>Rheuma</strong>kl<strong>in</strong>ik, um e<strong>in</strong>e neue Herausforderung <strong>in</strong> der Thurgauer Kl<strong>in</strong>ik St. Kathar<strong>in</strong>ental<br />
anzunehmen. Christ<strong>in</strong>e Meier, Barbara Aegler <strong>und</strong> Kathr<strong>in</strong> Meyer freuen sich über ihre neuen Funktionen,<br />
Kar<strong>in</strong> Niedermann wurde zur Beirät<strong>in</strong>/Reviewer<strong>in</strong> ernannt, Annette Kurre hat ihre Ausbildung abgeschlossen <strong>und</strong><br />
Diego Kyburz erlangte die Venia legendi.<br />
Gratulationen<br />
Christ<strong>in</strong>e Meier, ET, zert. Handtherapeut<strong>in</strong><br />
SGHR, langjährige Mitarbeiter<strong>in</strong> des Teams<br />
der Ergotherapie <strong>und</strong> stv. Leiter<strong>in</strong> der Ergotherapie<br />
hat am 1. Mai 2004 die Funktion «Cheftherapeut<strong>in</strong><br />
Handtherapie» übernommen.<br />
Barbara Aegler, MSc, ET, langjährige Mitarbeiter<strong>in</strong><br />
im Team der Therapie 2 (Ambulatorium,<br />
Schwerpunkt Schmerz) hat am 1. September<br />
2004 die neugeschaffene Funktion «Koord<strong>in</strong>ator<strong>in</strong><br />
Ergotherapie» übernommen.<br />
Kathr<strong>in</strong> Meyer, MSc, PT, langjährige Mitarbeiter<strong>in</strong><br />
im Team der Therapie 3 (Ambulatorium,<br />
Schwerpunkt Arbeit/Ergonomie) <strong>und</strong> stv.<br />
Cheftherapeut<strong>in</strong> hat am 1. Oktober 2004 die<br />
neugeschaffene Funktion «Cheftherapeut<strong>in</strong><br />
Therapie 3» übernommen.<br />
Wir gratulieren allen drei Mitarbeiter<strong>in</strong>nen (mit etwas Verspätung)<br />
herzlich zu diesen neuen Herausforderungen <strong>und</strong> wünschen<br />
ihnen viel Erfolg <strong>in</strong> ihren neuen Tätigkeiten.<br />
Annette Kurre, PT, Cheftherapeut<strong>in</strong> der Neurologischen<br />
Kl<strong>in</strong>ik hat ihre Ausbildung zur<br />
«Bobath-Instruktor<strong>in</strong> IBITA» erfolgreich<br />
abgeschlossen. Diese sich über mehrere Jahre<br />
h<strong>in</strong>ziehende berufsbegleitende Ausbildung<br />
erfordert e<strong>in</strong> grosses Engagement seitens der KandidatInnen.<br />
Wir gratulieren Annette Kurre herzlich zu diesem Abschluss.<br />
Wir freuen uns, dass die Patient<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Patienten sowie die<br />
Mitarbeitenden von den Kenntnissen <strong>und</strong> Erfahrungen von<br />
Annette Kurre weiterh<strong>in</strong> <strong>in</strong> hohem Masse profitieren können.<br />
Kar<strong>in</strong> Niedermann, MPH, wissenschaftliche<br />
Mitarbeiter<strong>in</strong> <strong>und</strong> Physiotherapeut<strong>in</strong>, wurde<br />
zur wissenschaftlichen Beirät<strong>in</strong>/Reviewer<strong>in</strong><br />
von physioscience ernannt.<br />
physioscience (Thieme Verlag) wird im Mai<br />
2005 lanciert <strong>und</strong> ist die erste wissenschaftliche Physiotherapie-<br />
Zeitschrift im deutschsprachigen Raum. Herzliche Gratulation.<br />
Aufgr<strong>und</strong> se<strong>in</strong>er Habilitationsarbeit «Induktion<br />
von T- <strong>und</strong> B-Zelltoleranz zur Behandlung<br />
von Autoimmunerkrankungen» erlangte<br />
Diego Kyburz die Venia legendi der Mediz<strong>in</strong>ischen<br />
Fakultät der Universität Zürich. Herzliche<br />
Gratulation zur Habilitation <strong>und</strong> viel Erfolg bei der künftigen<br />
Lehrtätigkeit.<br />
Abschied<br />
Dr. med. Adrian Forster wurde vom Verwaltungsrat<br />
der Spital Thurgau AG ab 1. April<br />
2005 zum Co-Chefarzt <strong>und</strong> ab 1. Oktober<br />
2005 zum Ärztlichen Direktor der Thurgauer<br />
Kl<strong>in</strong>ik St. Kathar<strong>in</strong>ental <strong>und</strong> zum<br />
Mitglied der Geschäftsleitung der Spital Thurgau AG gewählt.<br />
Dr. med. Adrian Forster war während der letzten sechs Jahre<br />
als Oberarzt an unserer Kl<strong>in</strong>ik tätig <strong>und</strong> war verantwortlich<br />
für die Schwerpunkte rheumatoide Arthritis <strong>und</strong> die <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äre<br />
Kollagenose-Sprechst<strong>und</strong>e. Durch se<strong>in</strong> organisatorisches<br />
<strong>und</strong> fachliches Engagement haben sich diese<br />
Schwerpunkte rasch etabliert <strong>und</strong> stossen sowohl bei den<br />
Zuweisern als auch bei den Assistenten auf reges Interesse.<br />
Bei der E<strong>in</strong>führung der neuen Biologica <strong>in</strong> der Therapie der<br />
rheumatoiden Arthritis war Adrian Forster an vorderster<br />
Front mit dabei <strong>und</strong> hat se<strong>in</strong>e grosse praktische Erfahrung an<br />
verschiedenen <strong>Fort</strong>bildungen <strong>und</strong> Workshops den praktizierenden<br />
Kollegen vermittelt.<br />
Wir danken Adrian Forster für se<strong>in</strong>en langjährigen grossen<br />
E<strong>in</strong>satz <strong>und</strong> die loyale <strong>und</strong> kollegiale Zusammenarbeit <strong>und</strong><br />
wünschen ihm für die neue Herausforderung viel Glück <strong>und</strong><br />
Erfolg.<br />
Die Leitung der Schwerpunkte rheumatoide Arthritis <strong>und</strong><br />
Kollagenose werden von PD Dr. med. Diego Kyburz <strong>und</strong><br />
Dr. med.Adrian Ciurea übernommen <strong>und</strong> die Sprechst<strong>und</strong>en<br />
im bisherigen Rahmen fortgeführt.<br />
37–2004<br />
PERSÖNLICH<br />
19
20<br />
PUBLIKATIONEN<br />
Orig<strong>in</strong>al- <strong>und</strong> Übersichtsartikel<br />
November 2004 bis März 2005<br />
Orig<strong>in</strong>alartikel<br />
1. Milos G, Sp<strong>in</strong>dler A, Rüegsegger P, Seifert B, Mühlebach<br />
S, Uebelhart D, Häuselmann HJ. Cortical and trabecular<br />
bone density and structure <strong>in</strong> anorexia nervosa. Osteoporosis<br />
International Onl<strong>in</strong>e First: DOI 10.1007/s00198-<br />
004-1759-2, 2004.<br />
2. Stoll T, Huber E, Bachmann S, Baumeler HR, Mariacher<br />
S, Rutz M, Schneider W, Spr<strong>in</strong>g H, Aeschlimann A, Stucki<br />
G, Ste<strong>in</strong>er W. Validity and sensitivity to change of the<br />
NASS questionnaire for patients with cervical sp<strong>in</strong>e<br />
disorders. Sp<strong>in</strong>e 29(24): 2851-5, 2004.<br />
3. Baumann F, Brühlmann P, Andreisek G, Michel BA,<br />
Mar<strong>in</strong>cek B, Weishaupt D: MRI for diagnosis and monitor<strong>in</strong>g<br />
of patients with eos<strong>in</strong>ophilic fasciitis.AJR 184:169-<br />
174, 2005.<br />
4. Morf S, Amann-Vesti B, Forster A, Franzeck UK, Koppenste<strong>in</strong>er<br />
R, Uebelhart D, Sprott H: Microcirculation<br />
abnormalities <strong>in</strong> patients with fibromyalgia - measured<br />
by capillary microscopy and laser fluxmetry. Arthritis<br />
Res Ther 7:R209-216, 2005.<br />
5. Wieser C, Stumpf D, Grillhösl C, Lengenfelder D, Gay S,<br />
Fleckenste<strong>in</strong> B, Ensser A: Regulated and constitutive<br />
expression of anti-<strong>in</strong>flammatory cytok<strong>in</strong>es by nontransform<strong>in</strong>g<br />
herpesvirus saimiri vectors. Gene Therapy:1-12,<br />
2005.<br />
6. Hermann F, Forster A, Chenevard R, Enseleit F, Hürlimann<br />
D, Corti R, Spieker LE, Frey D, Hermann M, Riesen<br />
W, Neidhart M, Michel BA, Hellermann JP, Gay RE,<br />
Lüscher TF, Gay S, Noll G, Ruschitzka F: Simvastat<strong>in</strong><br />
improves endothelial function <strong>in</strong> patients with rheumatoid<br />
arthritis. JACC 45:460-469, 2005.<br />
7. Distler JHW, Jüngel A, Huber LC, Seemayer CA, Reich<br />
III CF, Gay RE, Michel BA, Fontana A, Gay S, Pisetsky<br />
DS, Distler O: The <strong>in</strong>duction of matrix metalloprote<strong>in</strong>ase<br />
and cytok<strong>in</strong>e expression <strong>in</strong> synovial fibroblasts stimulated<br />
with immune cell microparticles. PNAS 102:2892-<br />
2897, 2005.<br />
8. Michel BA, Stucki G, Frey D, De Vathaire F, Vignon E:<br />
Chondroit<strong>in</strong>s 4 <strong>und</strong> 6 sulfate <strong>in</strong> osteoarthritis of the knee.<br />
Arthritis Rheum 52:779-786, 2005.<br />
9. Maier W, Altwegg LA, Corti R, Gay S, Hersberger M,<br />
Maly FE, Sütsch G, Roffi M, Neidhart M, Eberli FR, Tanner<br />
FC, Gobbi S, von Eckardste<strong>in</strong> A, Lüscher TF: Inflammatory<br />
markers at the site of ruptured plaque <strong>in</strong> acute<br />
myocardial <strong>in</strong>farction. Locally <strong>in</strong>creased <strong>in</strong>terleuk<strong>in</strong>-6<br />
and serum amyloid A but decreased C-reactive prote<strong>in</strong>.<br />
Circulation 111:1355-1361, 2005.<br />
10. Distler JHW, Jüngel A, Kowal-Bielecka O, Michel BA,<br />
Gay RE, Sprott H, Matucci-Cer<strong>in</strong>ic M, Chilla M, Reich<br />
K, Kalden JR, Müller-Ladner U, Lorenz HM, Gay S,<br />
Distler O: Expression of <strong>in</strong>terleuk<strong>in</strong> 21 receptor <strong>in</strong> epidemris<br />
from patients with systemic sclerosis. Arthritis<br />
Rheum 52:856-864, 2005.<br />
11. Del Rosso A, Distler O, Milia AF, Emanueli C, Ibba-<br />
Manneschi L, Guiducci S, Conforti ML, Gener<strong>in</strong>i S, Pignone<br />
A, Gay S, Madeddu P, Matucci-Cer<strong>in</strong>ic M: Increased<br />
circulat<strong>in</strong>g levels of tissue kallikre<strong>in</strong> <strong>in</strong> systemic sclerosis<br />
correlate with microvascular <strong>in</strong>volvement. Ann Rheum<br />
Dis 64:382-387, 2005.<br />
12. Neidhart M, Zaucke F, Von Knoch R, Jungel A, Michel<br />
BA, Gay RE: Galect<strong>in</strong>-3 is <strong>in</strong>duced <strong>in</strong> rheumatoid arthritis<br />
synovial fibroblasts after adhesion to cartilage oligomeric<br />
matrix prote<strong>in</strong>. Ann Rheum Dis 64:419-424, 2005.<br />
13. Angst F, John M, Pap G, Mannion AF, Herren DB, Flury<br />
M, Aeschlimann A, Schwyzer HK, Simmen BR. Comprehensive<br />
assessment of cl<strong>in</strong>ical outcome and quality of life<br />
after total elbow arthroplasty. Arthritis Rheum 53:73-82,<br />
2005.<br />
14. Grob D, Ben<strong>in</strong>i A, Junge A, Mannion AF Cl<strong>in</strong>ical experience<br />
with the Dynesys semirigid fixation system for the<br />
lumbar sp<strong>in</strong>e: surgical and patient-orientated outcome <strong>in</strong><br />
50 cases after an average of 2 years. Sp<strong>in</strong>e 30:234.31,<br />
2005.<br />
15. Distler JHW, Jüngel A, Kurowska-Stolarska M, Michel<br />
BA, Gay RE, Gay S, Distler O: Nucleofection: a new,<br />
highly efficient transfection method for primary human<br />
kerat<strong>in</strong>ocytes. Exp Dermatol 14:315-320, 2005.
Übersichtsartikel<br />
16. Koelz HR, Michel BA: Nichtsteroidale Antirheumatika:<br />
Magenschutztherapie oder COX- 2-Hemmer? Deutsches<br />
Ärzteblatt 45:3041-3046, 2004.<br />
17. Me<strong>in</strong>ecke I, Rutkauskaite E, Gay S, Pap T: The role of<br />
synovial fibroblasts <strong>in</strong> mediat<strong>in</strong>g jo<strong>in</strong>t destruction <strong>in</strong><br />
rheumatoid arthritis. Curr Pharm Des 11:563-568, 2005.<br />
Andere<br />
18. Kyburz D: TNF-Blocker für Spondarthropathien. Med<br />
Spektrum 1:5-6, 2005.<br />
19. Uebelhart D: Osteoporose: Bewährtes <strong>und</strong> Neues. Med<br />
Spektrum 1:8-9, 2005.<br />
20. Forster A: <strong>Rheuma</strong>toide Arthritis: Was folgt nach den<br />
TNF-Blockern? Med Spektrum 1:10-12, 2005.<br />
21. Sprott H: Muskelerkrankungen: praxisorientierte Abklärung.<br />
Med Spektrum 1:13-14, 2005.<br />
22. Distler O: Systemische Sklerose: Update zur Therapie.<br />
Med Spektrum 1:16-17, 2005.<br />
23. Aeschbach A: Schmerztherapie: Was br<strong>in</strong>gt die Radiofreqenztherapie?<br />
Med Spektrum 1:18-20, 2005.<br />
24. Brühlmann P: Highlights von EULAR- <strong>und</strong> ACR-Kongress<br />
2004. Med Spektrum 1:22, 2005.<br />
25. Klipste<strong>in</strong> A: Riskant s<strong>in</strong>d schwache Muskeln <strong>und</strong> ger<strong>in</strong>ge<br />
Kondition. Ges<strong>und</strong>heit Sprechst<strong>und</strong>e – <strong>Rheuma</strong>-Spezial<br />
6:7, 2005.<br />
26. Kyburz D, Forster A: Das Wichtigste ist frühes Erkennen<br />
<strong>und</strong> Behandeln. Ges<strong>und</strong>heit Sprechst<strong>und</strong>e – <strong>Rheuma</strong>-<br />
Spezial 6:28-30, 2005.<br />
27. Bär A: Akupunktur ist e<strong>in</strong>e gute Ergänzung. Ges<strong>und</strong>heit<br />
Sprechst<strong>und</strong>e - <strong>Rheuma</strong>-Spezial 6:40-41, 2005.<br />
28. Theiler R, Berz S, Mart<strong>in</strong> U, Uebelhart D. Oxycodon bei<br />
Patienten mit chronischen nichttumorbed<strong>in</strong>gten Schmerzen.<br />
Ars Medici 1:34-42, 2005.<br />
37–2004<br />
21
22<br />
FORTBILDUNG<br />
Vorträge <strong>und</strong> Workshops zu häufigen rheumatischen Erkrankungen<br />
<strong>Rheuma</strong> Top Zürich, 25./26. August 2005<br />
Seedamm Plaza, Pfäffikon SZ<br />
Unter dem Titel «<strong>Rheuma</strong> Top Zürich» f<strong>in</strong>det am Donnerstag <strong>und</strong> Freitag, 25./26. August 2005, während e<strong>in</strong>e<strong>in</strong>halb Tagen e<strong>in</strong>e<br />
<strong>in</strong>teraktive <strong>Fort</strong>bildung statt. Im Zentrum des breit gefächerten <strong>Fort</strong>bildungsprogramms stehen neben e<strong>in</strong>em Podiumsgespräch 13 Vorträge<br />
<strong>und</strong> 52 Workshops (zum Teil doppelt geführt) betreffend Diagnostik <strong>und</strong> Therapie von häufigen rheumatischen Erkrankungen.<br />
Anmeldungen über www.rheumaportal.ch oder www.mepha.ch.<br />
Programm Allgeme<strong>in</strong>mediz<strong>in</strong>er/Internisten<br />
Donnerstag, 25. August 2005<br />
Zeit Bez. Thema Referent<br />
13.00 – 13.45 Uhr E<strong>in</strong>treffen der TeilnehmerInnen<br />
13.45 – 14.00 Uhr E<strong>in</strong>führung Prof. Dr. med. B.A. Michel<br />
14.00 – 14.30 Uhr V1A Mediz<strong>in</strong> aus elektronischen Medien Prof. Dr. med. J. Steurer<br />
14.30 – 15.00 Uhr V2A <strong>Rheuma</strong> <strong>und</strong> Herz Prof. Dr. med. T. Lüscher<br />
15.00 – 15.15 Uhr Pause<br />
15.15 – 15.45 Uhr V3H Rückenerkrankungen bei Senioren Prof. Dr. med. G. Stucki<br />
15.45 – 16.15 Uhr V5H Arthrosetherapie PD Dr. med. D. Uebelhart<br />
16.15 – 16.45 Uhr Pause<br />
16.45 – 17.45 Uhr WS1H Weichteilprobleme bei Sportlern Dr. med. W. Frey<br />
WS2H Antikörper bei <strong>Rheuma</strong> Prof. Dr. med. A. Fontana<br />
WS3H Osteoporosetherapie PD Dr. med. H.J. Häuselmann<br />
WS4H Ergonomie Dr. med. A. Klipste<strong>in</strong><br />
WS5H Reha von Hüfte <strong>und</strong> Knie Dr. med. S. Mariacher <strong>und</strong> PT<br />
WS6H Schulter aus orthopädischer Sicht Prof. Dr. med. Chr. Gerber<br />
WS7H Schuhe <strong>und</strong> E<strong>in</strong>lagen Dr. med. T. Böni<br />
WS8H Drei Lebensabschnitte des Rückens Prof. Dr. med. G. Stucki<br />
WS9H Röntgen bei <strong>Rheuma</strong> PD Dr. med. D. Weishaupt<br />
WS10H Manuelle Therapie Dr. med. J. Ryser<br />
WS11H Manuelle Therapie Dr. med. B. Kle<strong>in</strong>ert<br />
WS12H Herz <strong>und</strong> <strong>Rheuma</strong> – häufige Therapieprobleme Prof. Dr. med. T. Lüscher<br />
17.45 – 18.00 Uhr Pause<br />
18.00 – 19.00 Uhr WS13H Osteoporosetherapie PD Dr. med. M. Felder<br />
WS14H Antikörper bei <strong>Rheuma</strong> Prof. Dr. med. A. Fontana<br />
WS15H Spondarthropathien PD Dr. med. D. Kyburz<br />
WS16H Reha von Hüfte <strong>und</strong> Knie Dr. med. S. Mariacher <strong>und</strong> PT<br />
WS17H Handrheuma aus orthopädischer Sicht Dr. med. D. Herren<br />
WS18H Mediz<strong>in</strong>ische Infos aus dem Internet Prof. Dr. med. J. Steurer<br />
WS19H Manuelle Therapie Dr. med. J. Ryser<br />
WS20H Manuelle Therapie Dr. med. B. Kle<strong>in</strong>ert<br />
WS21H <strong>Rheuma</strong>tologische Untersuchung Dr. med. S. Enderl<strong>in</strong><br />
WS22H Schuhe <strong>und</strong> E<strong>in</strong>lagen Dr. med. T. Böni<br />
WS23H Arthrose PD Dr. med. D. Uebelhart<br />
WS24H Reha der Schulter PD Dr. med. T. Stoll <strong>und</strong> PT<br />
19.00 – 20.30 Apéro riche<br />
Moderation Vorträge: • Prof. Dr. med. B.A. Michel • Dr. med. P. Brühlmann<br />
V = Vortrag / WS = Workshop / R = <strong>Rheuma</strong>tologIn / H = Innere Mediz<strong>in</strong>er/Allgeme<strong>in</strong>praktiker / A = Alle / PG = Podiumsgepräch
Programm Allgeme<strong>in</strong>mediz<strong>in</strong>er/Internisten<br />
Freitag, 26. August 2005<br />
Zeit Bez. Thema Referent<br />
08.15 – 09.00 Uhr V7A Der <strong>Rheuma</strong>-Magen Prof. Dr. med. Chr. Begl<strong>in</strong>ger<br />
09.00 – 09.45 Uhr V8A S<strong>in</strong>d NSAR out? Prof. Dr. med. H. Koelz<br />
09.45 – 10.15 Uhr Pause<br />
10.15 – 10.45 Uhr V9H <strong>Rheuma</strong> bei Jugendlichen Dr. med. R. Hirsbrunner<br />
10.45 – 11.15 Uhr V11H HWS-Distorsion Prof. Dr. med. T. Ettl<strong>in</strong><br />
11.15 – 11.30 Uhr Pause<br />
11.30 – 12.30 Uhr WS28H Nackenprobleme Dr. med. H. Spr<strong>in</strong>g <strong>und</strong> PT<br />
WS29H Rückenrehabilitation Prof. Dr. med. A. Aeschlimann <strong>und</strong> PT<br />
WS30H Basistherapien Prof. Dr. med. M. Seitz<br />
WS31H Abklärung von Kollagenosen Prof. Dr. med. P. Villiger<br />
WS32H Dyspepsie <strong>und</strong> Ulkus Prof. Dr. med. Chr. Begl<strong>in</strong>ger<br />
WS33H Magenprobleme Prof. Dr. med. H. Koelz<br />
WS34H Gelenksprobleme im Schulalter Dr. med. R. Hirsbrunner<br />
WS35H Kristallarthritis Dr. med. A. Krebs<br />
WS36H Indikationen für Rückenoperationen Prof. Dr. med. F. Porchet<br />
WS37H Fussprobleme aus orthopädischer Sicht PD Dr. med. P. Rippste<strong>in</strong><br />
WS38H <strong>Rheuma</strong>tologische Untersuchung Dr. med. P. Brühlmann<br />
WS39H <strong>Rheuma</strong>tologische Untersuchung Dr. med. S. Enderl<strong>in</strong><br />
12.30 – 13.45 Uhr Mittagessen<br />
13.45 – 14.45 Uhr V12A Future therapies of rheumatic diseases Prof. L. Moreland, MD<br />
14.45 – 15.00 Uhr Pause<br />
15.00 – 16.00 Uhr PG1A Fälle mit <strong>Rheuma</strong> Prof. Dr. med. B.A. Michel<br />
Dr. med. P. Brühlmann<br />
WS43H Bechterew & Co. Dr. med. A. Forster<br />
WS44H <strong>Rheuma</strong>tologische Untersuchung Dr. med. S. Enderl<strong>in</strong><br />
WS45H HWS-Probleme Prof. Dr. med. T. Ettl<strong>in</strong><br />
WS46H Rückenrehabilitation Prof. Dr. med. A. Aeschlimann <strong>und</strong> PT<br />
WS47H Basistherapien Prof. Dr. med. M. Seitz<br />
WS48H Abklärungen von Kollagenosen Prof. Dr. med. P. Villiger<br />
WS49H Fussprobleme aus orthopädischer Sicht PD Dr. med. P. Rippste<strong>in</strong><br />
16.00 – 16.15 Uhr Pause<br />
16.15 – 16.50 Uhr V13A Lyme Arthritis Prof. Dr. med. G. Burmester<br />
16.50 – 17.00 Uhr Ausblick Prof. Dr. med. B.A. Michel<br />
Moderation Vorträge: • Prof. Dr. med. B.A. Michel • Prof. Dr. med. S. Gay • PD Dr. med. D. Uebelhart<br />
V = Vortrag / WS = Workshop / R = <strong>Rheuma</strong>tologIn / H = Innere Mediz<strong>in</strong>er/Allgeme<strong>in</strong>praktiker / A = Alle / PG = Podiumsgepräch<br />
37–2004<br />
23
24<br />
Programm <strong>Rheuma</strong>tologen/Physikalische Mediz<strong>in</strong>er<br />
Donnerstag, 25. August 2005<br />
Zeit Bez. Thema Referent<br />
13.00 – 13.45 Uhr E<strong>in</strong>treffen<br />
13.45 – 14.00 Uhr E<strong>in</strong>führung Prof. Dr. med. B.A. Michel<br />
14.00 – 14.30 Uhr V1A Mediz<strong>in</strong> aus elektronischen Medien Prof. Dr. med. J. Steurer<br />
14.30 – 15.00 Uhr V2A <strong>Rheuma</strong> <strong>und</strong> Herz Prof. Dr. med. T. Lüscher<br />
15.00 – 15.15 Uhr Pause<br />
15.15 – 16.15 Uhr V4R From cl<strong>in</strong>ical trials to the practise Prof. M. Boers, MD<br />
16.15 – 16.45 Uhr Pause<br />
16.45 – 17.45 Uhr V6R Update on SLE Prof. M. Petri, MD<br />
17.45 – 18.00 Uhr Pause<br />
18.00 – 19.00 Uhr WS25R Treatment of SLE Prof. M. Petri, MD<br />
WS26R MRI für <strong>Rheuma</strong>tologen PD Prof. Dr. med. D. Weishaupt<br />
WS27R Glucocorticosteroids <strong>in</strong> RA Prof. M. Boers, MD<br />
19.00 – 20.30 Uhr Apéro riche<br />
Moderation Vorträge: • Prof. Dr. med. B.A. Michel • Prof. Dr. med. S. Gay<br />
Freitag, 26. August 2005<br />
08.15 – 09.00 Uhr V7A Der <strong>Rheuma</strong>-Magen Prof. Dr. med. Chr. Begl<strong>in</strong>ger<br />
09.00 – 09.45 Uhr V8A S<strong>in</strong>d NSAR out? Prof. Dr. med. H. Koelz<br />
09.45 – 10.15 Uhr Pause<br />
10.15 – 11.15 Uhr V10R Early Arthritis Prof. P. Emery, MD<br />
11.15 – 11.30 Uhr Pause<br />
11.30 – 12.30 Uhr WS40R Early arthritis Prof P. Emery, MD<br />
WS41R Infektassoziierte Arthritis Prof. G. Burmester, MD<br />
WS42R Optimiz<strong>in</strong>g therapy Prof. L. Moreland, MD<br />
12.30 – 13.45 Uhr Mittagessen<br />
13.45 – 14.45 Uhr V12A Future therapies of rheumatic diseases Prof. L. Moreland, MD<br />
14.45 – 15.00 Uhr Pause<br />
15.00 – 16.00 Uhr PG1A Fälle mit <strong>Rheuma</strong> Prof. Dr. med. B.A. Michel<br />
Dr. med. P. Brühlmann<br />
WS50R Systematische Sklerose Dr. med. O. Distler<br />
WS51R <strong>Rheuma</strong> <strong>und</strong> Auge PD Dr. med. W. Bernauer<br />
WS52R Cl<strong>in</strong>ical Trials Dr. med. D. Frey<br />
16.00 – 16.15 Uhr Pause<br />
16.15 – 16.50 Uhr V13A Lyme Arthritis Prof. G. Burmester, MD<br />
16.50 – 17.00 Uhr Ausblick Prof. Dr. med. B.A. Michel<br />
Moderation Vorträge: • Prof. Dr. med. B.A. Michel<br />
V = Vortrag / WS = Workshop / R = <strong>Rheuma</strong>tologIn / H = Innere Mediz<strong>in</strong>er/Allgeme<strong>in</strong>praktiker / A = Alle / PG = Podiumsgepräch
<strong>Fort</strong>- <strong>und</strong> <strong>Weiterbildung</strong> <strong>in</strong><br />
<strong><strong>Rheuma</strong>tologie</strong> <strong>und</strong> Physikalischer Mediz<strong>in</strong> (USZ)<br />
19. Mai bis 26. August 2005<br />
Datum Thema Zeit Ort<br />
Donnerstag Kolloquium Differential Diagnosis <strong>in</strong> Arthritis 15.00 bis Kle<strong>in</strong>er Hörsaal B Ost<br />
19. Mai 2005 Prof. Dr. Henn<strong>in</strong>g K. Zeidler, Mediz<strong>in</strong>ische Hochschule Hannover, D<br />
Differential diagnosis and therapy of <strong>und</strong>ifferentiated and reactive arthritis<br />
Prof. Dr. Douglas Veale, St. V<strong>in</strong>cents University Hospital, Dubl<strong>in</strong>, IRL<br />
The role of needle arthroscopy <strong>in</strong> diagnosis and research<br />
17.00 Uhr Gloriastrasse 29<br />
Freitag Experimentelle <strong><strong>Rheuma</strong>tologie</strong> 08.30 bis Kursraum U Ost 157<br />
20. Mai 2005 Dr. Eliana Lucch<strong>in</strong>etti Zaugg, Cardiovascular Research,<br />
Institute of Pharmacology and Toxicology Univeristät Zürich<br />
Ischemia and L1<br />
09.15 Uhr Gloriastrasse 25<br />
Donnerstag <strong>Weiterbildung</strong> 15.00 bis Kursraum U Ost 157<br />
26. Mai 2005 Grenzgebiete<br />
Prof. Dr. Claus Buddeberg, Abteilung Psychosoziale Mediz<strong>in</strong>, USZ<br />
Die Bedeutung von Persönlichkeitsstörungen für die Abklärung <strong>und</strong> Behandlung<br />
chronischer Schmerzpatienten.<br />
16.00 Uhr Gloriastrasse 25<br />
Freitag Experimentelle <strong><strong>Rheuma</strong>tologie</strong> 08.30 bis Kursraum U Ost 157<br />
27. Mai 2005 Prof. Mart<strong>in</strong> Fussenegger, Institut für Chemie-/Bio<strong>in</strong>genieurwissenschaft, ETH-ZH<br />
Therapeutic transgene expression control <strong>in</strong> mammalian cells<br />
09.15 Uhr Gloriastrasse 25<br />
Mittwoch EULAR 16.30 bis Wien (A)<br />
8. Juni 2005 IBSA-Satellitensymposium<br />
Weitere Informationen unter: www.eular.org<br />
18.00 Uhr<br />
Donnerstag EULAR 18.00 bis Wien (A)<br />
9. Juni 2005 Satellitensymposium AstraZeneca/Wyeth<br />
Weitere Informationen unter: www.eular.org<br />
19.30 Uhr<br />
Donnerstag <strong>Weiterbildung</strong> 15.00 bis Kursraum U Ost 157<br />
16. Juni 2005 <strong><strong>Rheuma</strong>tologie</strong><br />
Prof. Dr. Adriano Aguzzi, Institute of Neuropathology, University Hospital of Zürich<br />
Kl<strong>in</strong>isch diagnostisches Vorgehen bei V.a. Myositis<br />
16.00 Uhr Gloriastrasse 25<br />
37–2004<br />
25<br />
FORT- UND<br />
WEITERBILDUNG
26<br />
Datum Thema Zeit Ort<br />
Freitag Experimentelle <strong><strong>Rheuma</strong>tologie</strong> 08.30 bis Kursraum U Ost 157<br />
17. Juni 2005 Prof. Dr. Stefan Meuer, Institut für Immunologie,<br />
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, D<br />
Natural mechanisms of anti-<strong>in</strong>flammation: lessons from studies<br />
on the mucosal immunsystem<br />
09.15 Uhr Gloriastrasse 25<br />
Freitag Experimentelle <strong><strong>Rheuma</strong>tologie</strong> 08.30 bis Kursraum U Ost 157<br />
24. Juni 2005 Prof. Annette Oxenius, Institute for Microbiology, ETH Zürich<br />
Effector functions of cytotoxic T lymphocytes<br />
09.15 Uhr Gloriastrasse 25<br />
Donnerstag <strong>Rheuma</strong>-Highlights 2005 14.00 bis WTC Oerlikon<br />
30. Juni 2005 Detailliertes Programm wird auf der Homepage<br />
http://www.rheumaportal.ch/?site=fachwelt&menu=fortbildungskalender&sub=ruz<br />
bekanntgegeben<br />
17.00 Uhr<br />
Freitag Experimentelle <strong><strong>Rheuma</strong>tologie</strong> 08.30 bis Kursraum U Ost 157<br />
1. Juli 2005 Prof. Dr. Holger Moch, Institut für Pathologie, USZ<br />
Tissue microarray for cancer research and drug development<br />
09.15 Uhr Gloriastrasse 25<br />
Donnerstag Zürcher Schmerzgespräche 14.00 bis Hörsaal Nord<br />
7. Juli 2005 Thema: Invasive Schmerzdiagnostik <strong>und</strong> -therapie<br />
Prof. Thomas Pasch, Direktor des Institutes für Anästhesiologie <strong>und</strong><br />
17.00 Uhr Frauenkl<strong>in</strong>ikstrasse<br />
Schirmherr der Veranstaltung, USZ 14.00 bis<br />
E<strong>in</strong>führung 14.10 Uhr<br />
Prof. Dr. Dietrich H.W. Grönemeyer, Universität Witten/Herdecke, D 14.10 bis<br />
Der Stellenwert der Mikrotherapie <strong>in</strong> der Schmerztherapie<br />
Prof. Dr. Henn<strong>in</strong>g Harke, Kl<strong>in</strong>ikum Krefeld, D<br />
14.50 Uhr<br />
Möglichkeiten <strong>in</strong>vasiver Schmerztherapie <strong>und</strong> ihre diagnostischen 14.50 bis<br />
Gr<strong>und</strong>lagen 15.30 Uhr<br />
Kaffee-Pause<br />
15.30 bis<br />
16.00 Uhr<br />
Dr. Arm<strong>in</strong> Aeschbach, Schmerzpraxis Wirbelsäulen-Schmerz-Cl<strong>in</strong>ic Zürich,<br />
Konsiliarius für <strong>in</strong>terventionelle Schmerztherapie an den Universitätskl<strong>in</strong>iken<br />
Zürich <strong>und</strong> Basel<br />
Radiofrequenztherapie zur Behandlung chronischer Schmerzen – 16.00 bis<br />
zwischen Facts <strong>und</strong> Voodoo 16.30 Uhr<br />
Dr. P. Felleiter/PD Dr. H. Sprott, Paraplegikerzentrum Nottwil /<br />
<strong>Rheuma</strong>kl<strong>in</strong>ik <strong>und</strong> Institut für Physikalische Mediz<strong>in</strong>, USZ 16.30 bis<br />
Fallvorstellung 17.00 Uhr<br />
Apéro ab 17.15 Uhr
Datum Thema Zeit Ort<br />
Donnerstag/ <strong>Rheuma</strong> Top Zürich<br />
Freitag Separate <strong>Fort</strong>bildung für Allgeme<strong>in</strong>mediz<strong>in</strong>er, Internisten <strong>und</strong> <strong>Rheuma</strong>tologen mit Seedammcenter<br />
25./26. August 13 Vorträgen, 52 parallelen Workshops <strong>und</strong> Fallvorstellungen<br />
Detailliertes Programm wird auf der Homepage: http://www.rheumaportal.ch/<br />
?site=fachwelt&menu=fortbildungskalender&sub=ruz bekanntgegeben<br />
Pfäffikon<br />
Weitere Informationen f<strong>in</strong>den Sie auf der Website http://www.rheumaportal.ch/?site=fachwelt&menu=fortbildungskalender&sub=ruz<br />
Sponsoren «<strong>Fort</strong>- <strong>und</strong> <strong>Weiterbildung</strong>»<br />
Folgende Firmen haben unsere <strong>Weiterbildung</strong>sveranstaltungen unterstützt, wofür wir uns herzlich bedanken!<br />
Essex Chemie AG<br />
37–2004<br />
27
Risedronate<br />
Für Ihre Patienten:<br />
Entscheidend ist die Erhaltung<br />
der Knochenqualität<br />
Fraktur-Risikoreduktion<br />
als Ziel der Behandlung<br />
Frakturschutz bereits<br />
nach 6 Monaten 1<br />
Erhaltung der<br />
Mikroarchitektur 2<br />
Schneller Schutz vor<br />
Wirbelfrakturen <strong>und</strong><br />
Frakturen ausserhalb des<br />
Wirbelsäulenbereichs 3<br />
Gute gastro<strong>in</strong>test<strong>in</strong>ale<br />
Verträglichkeit 4<br />
Referenzen:<br />
1 Roux C. et al,. Efficacy of Risedronate on Cl<strong>in</strong>ical Vertebral Fractures with<strong>in</strong> Six Months, Curr. Med. Res. Op<strong>in</strong>. 2004; Vol.20(4):433-439<br />
2 Dufresne T.E. et al., Risedronate Preserves Bone Architecture <strong>in</strong> Early Postmenopausal Women In 1 Year as Measured by Three-Dimensional Microcomputed Tomography, Calcif. Tissue Int. 2003; 73:423-432<br />
3 Harr<strong>in</strong>gton J.T. et al., Risedronate Rapidly Reduces the Risk for Nonvertebral Fractures <strong>in</strong> Women with Postmenopausal Osteoporosis, Calc. Tiss. Int. 2004; Vol.74: 129-135<br />
4 Taggart H. et al., Upper Gastro<strong>in</strong>test<strong>in</strong>al Tract Safety of Risedronate: A Pooled Analysis of 9 Cl<strong>in</strong>ical Trials, Mayo Cl<strong>in</strong> Proc. 2002; 77:262-270<br />
Kurz<strong>in</strong>formation Actonel ® : 5 mg, 30 mg Tabletten, 35 mg Wochentabletten<br />
Zusammensetzung: Na-Risedronat, Filmtabl. 5mg, 30mg, 35mg. Liste B. Indikationen: Behandlung <strong>und</strong> Prävention der Osteoporose bei Frauen nach der Menopause; Behandlung <strong>und</strong> Prävention der kortikosteroid<strong>in</strong>duzierten<br />
Osteoporose bei Männern <strong>und</strong> Frauen; Behandlung der Paget-Krankheit. Dosierung: Osteoporose: 1 Tabl. 5 mg/Tag oder 1 Tabl. 35mg jede Woche; Paget: 1 Tabl. 30 mg/Tag während 2 Mt. Absorption wird durch<br />
Nahrungsaufnahme bee<strong>in</strong>flusst. Kontra<strong>in</strong>dikationen: Überempf<strong>in</strong>dlichkeit; Hypokalzämie; Unvermögen während 30 M<strong>in</strong>uten e<strong>in</strong>e aufrechte Körperhaltung e<strong>in</strong>zunehmen; schwere Nieren<strong>in</strong>suffizienz. Vorsichtsmassnahmen:<br />
Bei Oesophagusreaktionen Actonel absetzen <strong>und</strong> sich an den Arzt wenden; Störungen des Knochen- <strong>und</strong> M<strong>in</strong>eralstoffwechsels müssen behandelt werden. Unerwünschte Wirkungen: Schmerzen im Bereich der Gelenke,<br />
Knochen <strong>und</strong> Muskeln; selten Duodenitis, Glossitis <strong>und</strong> Iritis; Verm<strong>in</strong>derung der Ca-, Mg- <strong>und</strong> P-Spiegel; selten abnorme Leberfunktionswerte. Interaktionen: Die Absorption wird durch z.B. Ca, Mg, Fe, Al reduziert.<br />
Packungen: 5mg 28 <strong>und</strong> 84 Tabl.; 30mg 28 Tabl.; 35mg 4 <strong>und</strong> 12 Tabl. Kassenzulässig. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Arzneimittel-Kompendium der <strong>Schweiz</strong>.<br />
Vertrieb: Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich<br />
Sanofi-Synthélabo (<strong>Schweiz</strong>) AG – e<strong>in</strong> Unternehmen der Gruppe sanofi-aventis, 11 rue de Veyrot, 1217 Meyr<strong>in</strong><br />
CH-RIS.05.04.01