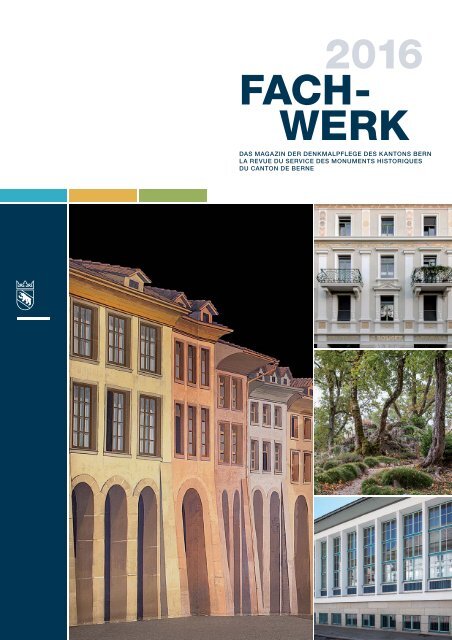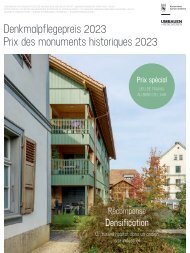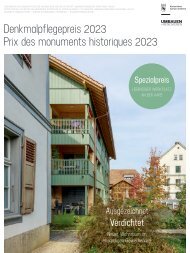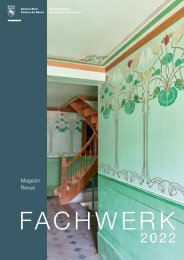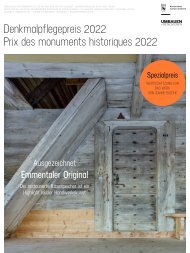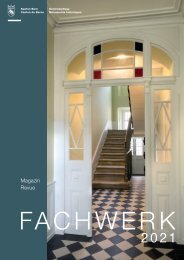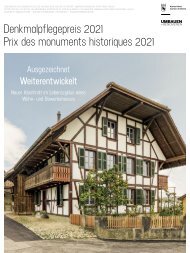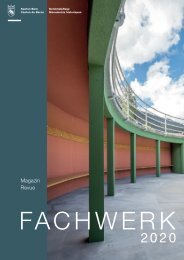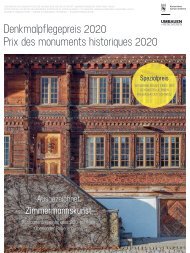Fachwerk 2016
Das Magazin der Denkmalpflege des Kantons Bern
Das Magazin der Denkmalpflege des Kantons Bern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>2016</strong><br />
FACH-<br />
WERK<br />
DAS MAGAZIN DER DENKMALPFLEGE DES KANTONS BERN<br />
LA REVUE DU SERVICE DES MONUMENTS HISTORIQUES<br />
DU CANTON DE BERNE
2 EDITORIAL<br />
<strong>Fachwerk</strong> <strong>2016</strong><br />
Michael Gerber<br />
Liebe Leserin, lieber Leser<br />
«Die Menschen mögen vielleicht<br />
den ganzen Tag mit ihren Smartphones<br />
verbringen, aber die Umgebung<br />
bestimmt weiterhin unterschwellig<br />
ihren emotionalen und<br />
physischen Gesundheitszustand».<br />
Diese Aussage des griechischen<br />
Architektur- und Designtheoretikers<br />
Nikos Salingaros bringt auf den<br />
Punkt, was bei der aktuellen Verdichtungsdiskussion<br />
häufig vernachlässigt<br />
wird: der Mensch.<br />
Dichte bedeutet oft maximale Baumassenziffer,<br />
vorbehaltloser Ersatz<br />
von Altbauten durch Neubauten<br />
oder massstabloses Auffüllen von<br />
Freiflächen. Dabei wird die durch<br />
Salingaros angesprochene Gesundheit<br />
des Menschen in einer gesunden<br />
Umgebung ausgeblendet.<br />
Verdichten ist also auch eine Frage<br />
des Wohlbefindens des Menschen<br />
in seinem vertrauten Lebensraum.<br />
Für die Denkmalpflege ist verdichtetes<br />
Bauen keine Bedrohung,<br />
sondern eine Aufgabe. Sie verhindert<br />
Verdichtung nicht, sondern sie<br />
muss dafür besorgt sein, dass<br />
Projektverfasser angemessen an<br />
Denkmäler und Ortsbilder, also an<br />
die vorhandene Substanz, herangehen<br />
und respektvoll damit umgehen.<br />
Das Schwerpunktthema des<br />
diesjährigen <strong>Fachwerk</strong>s handelt<br />
von der Rolle der Denkmalpflege in<br />
diesem Prozess.<br />
Daneben nehmen wir Sie wie gewohnt<br />
mit auf eine qualitätsvoll verdichtete<br />
Reise zu den Bauschätzen<br />
unseres Kantons.<br />
Michael Gerber<br />
Kantonaler Denkmalpfleger<br />
Chère lectrice, cher lecteur,<br />
« Les gens peuvent bien manipuler<br />
leur Smartphone à longueur de<br />
journée, mais l’environnement<br />
continue à déterminer inconsciemment<br />
leur état de santé émotionnel<br />
et physique. » Par cette observation,<br />
Nikos Salingaros, théoricien de l’architecture<br />
et du design, nous rappelle<br />
un élément trop négligé dans<br />
le débat actuel sur la densification :<br />
l’être humain. Densité signifie souvent<br />
coefficient maximal d’utilisation<br />
du sol, démolition pure et simple<br />
d’anciens bâtiments au profit<br />
de nouveaux, empressement sans<br />
mesure à combler les surfaces<br />
vides. Il n’y a plus de place ici pour<br />
le bien-être de l’homme dans un<br />
environnement sain.<br />
Car la densification a aussi à voir<br />
avec le bien-être dans un environnement<br />
familier. La densité n’est pas<br />
une menace, mais une tâche de la<br />
conservation des monuments historiques.<br />
Celle-ci n’entrave pas la densification,<br />
mais doit veiller à ce que<br />
les auteurs des projets abordent<br />
les bâtiments ou les sites construits<br />
anciens, c’est-à-dire la substance<br />
existante, avec le soin et le respect<br />
adéquats. Cette année, <strong>Fachwerk</strong><br />
consacre son dossier au rôle de la<br />
conservation des monuments historiques<br />
dans ce processus.<br />
Mais ce numéro est aussi une<br />
nouvelle invitation à découvrir des<br />
trésors du patrimoine architectural<br />
de notre canton.<br />
Michael Gerber<br />
Chef du Service des monuments<br />
historiques
INHALT | SOMMAIRE<br />
3<br />
Inhalt | Sommaire<br />
Twann am Bielersee<br />
Theaterkulissen in Langenthal<br />
Chorgewölbe in der Kirche Münsingen<br />
4<br />
4<br />
6<br />
8<br />
11<br />
15<br />
18<br />
22<br />
26<br />
28<br />
28<br />
32<br />
32<br />
36<br />
38<br />
40<br />
42<br />
44<br />
55<br />
56<br />
58<br />
59<br />
60<br />
62<br />
64<br />
66<br />
AKTUELL | ACTUEL<br />
Verdichtung | Densification<br />
Siedlungsentwicklung und Verdichtung: Einleitung<br />
Glossar Raumplanung und Ortsbildpflege<br />
Ortsbilder stiften Identität: die Verdichtungsdiskussion<br />
Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder ISOS<br />
Die Beispiele Köniz, Langenthal und Port<br />
Ausblick: Instrumente und Vorgehensstrategien<br />
Denkmalpflege ist Teamarbeit<br />
Die Überarbeitung des Bauinventars<br />
IM GESPRÄCH | DIALOGUE<br />
Gleichgewicht zwischen Schutz und Nutzung –<br />
Heinrich Hafner, Raumplaner<br />
BERICHTE | RAPPORTS<br />
Wiederentdeckte Kulissen im Theater Langenthal<br />
Massgeschneiderte Zukunft für ein Bauernhaus in Thun<br />
Erhaltung der Originalsubstanz: zwei Brücken bei Biel<br />
Der Apfelschuss in Gsteig bei Gstaad<br />
Sous le lierre… une rocaille à La Neuveville<br />
OBJEKTE | OBJETS<br />
Entdeckung | Découverte<br />
Auswahl | Sélection<br />
Verluste | Pertes<br />
EINBLICKE | APERÇUS<br />
ZAHLEN | CHIFFRES<br />
PUBLIKATIONEN | PUBLICATIONS<br />
TERMINE | CALENDRIER<br />
PERSONELLES | PERSONNEL
4 AKTUELL: VERDICHTUNG | ACTUEL: DENSIFICATION<br />
Siedlungsentwicklung und Verdichtung:<br />
Einleitung<br />
Die Forderung nach der inneren Verdichtung stellt alle, die sich mit Raumplanung<br />
und Siedlungsentwicklung befassen, vor neue Herausforderungen.<br />
Die Umgebung eines Baudenkmals,<br />
in der es wirkt und wahrgenommen<br />
wird, ist Teil des Denkmals und wesentlich<br />
für seine Unterschutzstellung.<br />
Dieser räumliche Kontext unterliegt<br />
einer grösseren Dynamik und<br />
wandelt sich schneller als das Denkmal<br />
selber. Die kantonale Denkmalpflege<br />
setzt sich schon seit mehreren<br />
Jahren mit geschützten Ortsbildern<br />
auseinander. Sie berät Gemeinden<br />
und Raumplaner im Umgang mit<br />
Weiterentwicklungen und Neuplanungen<br />
in sensiblen Ortsbildern, die sich<br />
in einer Baugruppe, einem Ortsbildschutzperimeter<br />
oder im Inventar<br />
der schützenswerten Ortsbilder der<br />
Schweiz (ISOS) befinden. Die Fachstelle<br />
unterstützt die Planenden, indem<br />
sie auf bestehende Qualitäten<br />
von Ortsbildern hinweist. Sie formuliert<br />
Empfehlungen und mögliche<br />
Schutzziele unter Berücksichtigung<br />
des Charakters eines Ortsbildes, so<br />
dass der geplante Eingriff weder das<br />
Schutzobjekt noch den geschützten<br />
Perimeter beeinträchtigt.<br />
Qualitätsvolle Siedlungsentwicklungen<br />
und Verdichtung innerhalb von<br />
sensiblen Ortsbildern sind Themen,<br />
die Raumplaner, Gemeinden, Kanton,<br />
Bund und Ortsplanungsstellen<br />
zunehmend fordern. Im aktuellen<br />
<strong>Fachwerk</strong> gibt die kantonale Denkmalpflege<br />
Einblick in die laufende<br />
Diskussion und in ihren Auftrag im<br />
Bereich der Ortsbildpflege.<br />
01<br />
Grundlage für die verschiedenen<br />
Artikel zum Thema Siedlungsentwicklung<br />
und Verdichtung sind zwei<br />
Gespräche, welche das Planungs-<br />
Team der Denkmalpflege mit Raumplaner<br />
Heinrich Hafner, BHP Raumplan<br />
AG, Bern, und mit dem Landschaftsarchitekten<br />
Daniel Moeri,<br />
Moeri + Partner AG, Bern, führte.<br />
Das Gespräch mit Heinrich Hafner<br />
befindet sich auf Seite 28. Einzelne<br />
Aussagen von Daniel Moeri und<br />
Heinrich Hafner wurden als Kurzkommentare<br />
in die Artikel eingebaut.<br />
Zunehmender Druck auf die historischen<br />
Ortskerne<br />
Die kontinuierliche Bevölkerungszunahme,<br />
der wirtschaftlich und gesellschaftlich<br />
wachsende Wohlstand, der<br />
Wandel sozialer und demografischer<br />
Strukturen und die Kapazitätssteigerung<br />
der Mobilität und des Individualverkehrs<br />
mit gleichzeitigem Ausbau<br />
des öffentlichen Verkehrs lassen<br />
den Flächenbedarf jährlich ungehindert<br />
steigen. Folge davon sind nebst<br />
massiv zunehmendem Energie- und<br />
Ressourcenverbrauch unsorgfältige<br />
Stadtreparaturen und -ergänzungen,<br />
welche die Qualität der Landschaftsund<br />
Ortsbilder bedrohen. Die Teilrevision<br />
des Raumplanungsgesetzes,<br />
welche 2014 in Kraft trat, hat einen<br />
Systemwandel eingeleitet. Die Siedlungsentwicklung<br />
soll sich in Zukunft<br />
vermehrt nach innen richten. Damit<br />
wird der Druck auf die historischen
AKTUELL: VERDICHTUNG | ACTUEL: DENSIFICATION<br />
5<br />
02<br />
Verdichten heisst<br />
primär, dass wir<br />
Menschen näher<br />
zusammenleben.<br />
Daniel Moeri<br />
Ortskerne und auf das umliegende<br />
Siedlungsgebiet zunehmen. Dem baukulturellen<br />
Erbe mit seinen gewachsenen<br />
Strukturen steht die Beeinträchtigung<br />
durch Verdichtung bevor.<br />
Raumplanung ist auch Ortsbildpflege<br />
Bis vor kurzem war Raumplanung<br />
mit dem unbegrenzten Wachstum in<br />
die Fläche gleichzusetzen. Die Ausdehnung<br />
der Städte und Dörfer erfolgte<br />
am Siedlungsrand in dafür eigens<br />
ausgeschiedenen Neubau- und<br />
Gewerbezonen, welche sich meist<br />
unabhängig und ohne Bezug zum<br />
Dorf- oder Stadtzentrum weiterentwickelten.<br />
Gemäss den Vorgaben im<br />
teilrevidierten Raumplanungsgesetz<br />
sind zukünftig weder Bauzonenerweiterungen<br />
noch die Nutzung von Kulturland<br />
erwünscht. Eine Konsequenz<br />
davon ist die Siedlungsentwicklung<br />
nach innen, in bestehenden Siedlungen<br />
und historischen Ortskernen.<br />
Diese ist komplex und erfordert hohe<br />
Fachkompetenz, das Zusammenspielen<br />
von Politik und Bevölkerung und<br />
die Akzeptanz, dass im besiedelten<br />
Gebiet weiter gebaut und damit verdichtet<br />
werden muss.<br />
Neue Instrumente und Strategien<br />
sind notwendig<br />
Nebst vielen anderen, zwingenden<br />
Voraussetzungen für eine qualitativ<br />
hochwertige Verdichtung ist die Erhaltung<br />
des Siedlungscharakters und<br />
des historisch gewachsenen Ortsbilds<br />
wohl nicht der wichtigste Anspruch,<br />
aber einer der grundlegendsten.<br />
Die Ortsbildpflege ist jedoch auf<br />
die Unterstützung der Raumplanung<br />
angewiesen; gemeinsam müssen die<br />
nötigen zielgerichteten Entwicklungsund<br />
Verdichtungsstrategien in der<br />
Planungspraxis gefordert und gefördert<br />
werden. Es braucht dringend<br />
griffigere Instrumente und die Unterstützung<br />
durch den Bund und den<br />
Kanton, um das baukulturelle Erbe<br />
unserer Städte und Dörfer zu erhalten<br />
oder erst ins allgemeine Bewusstsein<br />
zu tragen. Alle an der Weiterentwicklung<br />
des Siedlungsgebietes Beteiligten<br />
müssen bereit sein, die gegebenen<br />
Strukturen und den Baubestand<br />
weiter zu denken und Lösungen zu ermöglichen,<br />
aus denen auch zukünftig<br />
qualitätsvolle und lebenswerte Stadtund<br />
Landschaftsbilder bestehen bleiben<br />
oder erst entstehen können.<br />
01 Unterschiedliche Siedlungsformen<br />
im Kanton Bern:<br />
01 Weiler Elisried, Schwarzenburg.<br />
02 Blick auf das Bälliz, Thun.<br />
Tatiana Lori
6<br />
AKTUELL: VERDICHTUNG | ACTUEL: DENSIFICATION<br />
Glossar Raumplanung und Ortsbildpflege<br />
Institutionen, Begriffe und Abkürzungen<br />
Amt für Gemeinden und Raumordnung<br />
(AGR)<br />
Das Amt für Gemeinden und Raumordnung<br />
ist zuständig für die kantonale<br />
Raumentwicklung, übt die<br />
Aufsicht über die regionale und kommunale<br />
Raumplanung aus und beurteilt<br />
Bauvorhaben ausserhalb der<br />
Bauzonen.<br />
Baubewilligung<br />
Wer bauen will, braucht eine Baubewilligung.<br />
Meist ist dafür die Gemeinde<br />
zuständig. Sie prüft, ob ein<br />
Bauvorhaben den Vorschriften der jeweiligen<br />
Zone entspricht und ob die<br />
Umweltvorschriften eingehalten werden.<br />
Baugesuche müssen publiziert<br />
werden, damit Betroffene dagegen<br />
Einsprache erheben können.<br />
Baugruppe<br />
«Baugruppen» sind Ensembles von<br />
Häusern, welche sich durch einen<br />
räumlichen oder historischen Zusammenhang<br />
auszeichnen. Sie sind Teil<br />
des kantonalen Bauinventars.<br />
Bauinventar des Kantons Bern<br />
Das kantonale Bauinventar erfasst,<br />
beschreibt und bewertet Baudenkmäler.<br />
Es bildet eine fundierte Grundlage<br />
für die praktische Arbeit der<br />
Denkmalpflege und für die wissenschaftliche<br />
Forschung. Mit dem Bauinventar<br />
stellt die Denkmalpflege<br />
nicht nur Gemeinden und Grundeigentümern,<br />
sondern auch der breiten<br />
Öffentlichkeit eine qualifizierte<br />
Gesamtschau des historischen Baubestandes<br />
im Kanton zur Verfügung.<br />
Baumassenziffer<br />
Die Baumassenziffer BMZ bezeichnet<br />
das Verhältnis des oberirdischen<br />
Bauvolumens zur anrechenbaren<br />
Grundstücksfläche. Als oberirdisches<br />
Bauvolumen gilt das über dem massgebenden<br />
Terrain liegende Volumen<br />
eines Baukörpers in seinen Aussenmassen,<br />
abzüglich offener Gebäudeteile.<br />
Die Baumassenziffer wird als<br />
Mass für die Volumendichte verwendet<br />
und dient als Element zur Festlegung<br />
der zonencharakteristischen<br />
Bauweise.<br />
Baureglement<br />
Im Baureglement legt die Gemeinde<br />
Bau- und Nutzungsvorschriften<br />
grundeigentümerverbindlich fest. Aufgrund<br />
der Vorschriften im Baureglement<br />
werden Baugesuche beurteilt<br />
und Baubewilligungen erteilt.<br />
Bundesgerichtsentscheid Rüti<br />
(BGE 135 II 209)<br />
Mit dem Bundesgerichtsentscheid<br />
Rüti ZH vom 1. April 2009 wurde die<br />
grosse Bedeutung der Bundesinventare<br />
nach Artikel 5 NHG bestätigt und<br />
klargemacht, dass für die Kantone<br />
und Gemeinden auch bei der Erfüllung<br />
von kantonalen und kommunalen<br />
Aufgaben eine Pflicht zur Berücksichtigung<br />
dieser Bundesinventare besteht.<br />
Bundesgesetz über den Naturund<br />
Heimatschutz (NHG)<br />
Gemäss Artikel 78 der Bundesverfassung<br />
(SR 101) ist der Bund verpflichtet,<br />
bei der Erfüllung seiner Aufgaben<br />
Rücksicht auf die Anliegen des Naturund<br />
Heimatschutzes zu nehmen: «Er<br />
schont Landschaften, Ortsbilder, geschichtliche<br />
Stätten sowie Natur- und<br />
Kulturdenkmäler; er erhält sie ungeschmälert,<br />
wenn das öffentliche Interesse<br />
es gebietet.» Um diese Pflicht<br />
sachgerecht wahrnehmen zu können,<br />
werden als Entscheidungsgrundlage<br />
Bundesinventare erarbeitet, bspw.<br />
das Bundesinventar der schützenswerten<br />
Ortsbilder der Schweiz (ISOS).
AKTUELL: VERDICHTUNG | ACTUEL: DENSIFICATION<br />
7<br />
Bundesinventar der schützenswerten<br />
Ortsbilder der Schweiz (ISOS)<br />
Das ISOS analysiert die architektonischen<br />
und räumlichen Zusammenhänge<br />
von Weilern, Dörfern und Städten.<br />
Es dient Fachleuten aus den<br />
Bereichen Planung und Denkmalpflege<br />
sowie Politikern als Entscheidungsgrundlage.<br />
Durch die Aufnahme<br />
eines Ortsbilds ins ISOS wird dargetan,<br />
dass es in besonderem Masse<br />
die ungeschmälerte Erhaltung verdient.<br />
Raumplanungsgesetz (RPG)<br />
Das Bundesgesetz über die Raumplanung<br />
vom 22. Juni 1979 gibt die<br />
Ziele und Grundsätze der Raumplanung<br />
in der Schweiz vor. Es weist<br />
dem Bund, den Kantonen und den<br />
Gemeinden ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten<br />
im Bereich der<br />
Raumplanung zu.<br />
Überbauungsordnung<br />
(UeO, Sondernutzungsplan)<br />
Sondernutzungspläne konkretisieren<br />
für bestimmte Gebiete, in denen die<br />
bau- und nutzungsrechtliche Grundordnung<br />
nicht ausreicht, die Nutzung<br />
und legen Grundsätze der Gestaltung<br />
fest. Im Siedlungsgebiet haben Sondernutzungspläne<br />
häufig den Zweck,<br />
städtebauliche und architektonische<br />
Qualität zu sichern.<br />
Kantonaler Richtplan<br />
Mit seiner Richtplanung legt der<br />
Kanton die zur Verwirklichung der<br />
angestrebten räumlichen Ordnung<br />
erforderlichen Tätigkeiten und den<br />
Rahmen zu deren gegenseitigen Abstimmung<br />
behördenverbindlich fest.<br />
Der kantonale Richtplan umfasst Karten<br />
und Textteile mit Aussagen zur zukünftigen<br />
Entwicklung in den Bereichen<br />
Siedlung, Landschaft, Verkehr,<br />
kantonale öffentliche Anlagen und<br />
Bauten. Die Vorgaben zum Umgang<br />
mit den Bundesinventaren sind im<br />
Massnahmenblatt E_09 definiert.<br />
Ortsbildpflege<br />
Zum Aufgabengebiet der Denkmalpflege<br />
des Kantons Bern gehört zum<br />
einen die Beratung von Bauherrschaften<br />
bei der Weiterentwicklung von<br />
Baudenkmälern, zum andern berät<br />
sie bei ortsbildrelevanten Veränderungen.<br />
Ortsbildschutzgebiet<br />
Das eidgenössische Raumplanungsgesetz<br />
verlangt von den Kantonen,<br />
Schutzzonen auszuscheiden oder<br />
Schutzmassnahmen zu definieren.<br />
Der Kanton Bern überträgt diese<br />
Kompetenz an die Gemeinden. Diese<br />
scheiden in ihrer Nutzungsplanung<br />
Ortsbildschutzgebiete aus. Grundlage<br />
dafür bilden die Baugruppen<br />
des Bauinventars.<br />
Zone mit Planungspflicht (ZPP)<br />
Die Zonen mit Planungspflicht enthalten<br />
Bestimmungen, die ergänzend<br />
zu den Bestimmungen im Zonenplan<br />
gelten. Solche Zonen kommen in Gebieten<br />
zur Anwendung, wo eine feinere<br />
Regelung, als dies in der Nutzungsplanung<br />
möglich ist, erforderlich<br />
ist oder wo in einem Planungsprozess<br />
unter Beteiligung aller Akteure die Details<br />
erarbeitet werden sollen.<br />
Nutzungsplanung<br />
Im Rahmen der Nutzungsplanung<br />
wird die raumplanerische Nutzungsordnung<br />
für ein bestimmtes funktional<br />
zusammenhängendes Gebiet erarbeitet.<br />
Mit ihr wird die zulässige Bodennutzung<br />
bezüglich Zweck, Ort und<br />
Mass parzellenscharf und grundeigentümerverbindlich<br />
festgelegt.<br />
Zonenplan<br />
Der Zonenplan bezeichnet für das<br />
Gebiet einer Gemeinde Bauzonen,<br />
Landwirtschaftszonen und Schutzzonen.<br />
Er bewirkt die klare Trennung<br />
von Baugebiet und Nichtbaugebiet.<br />
Die Bauzone wird weiter aufgeteilt<br />
in Wohn-, Arbeits- und gemischte<br />
Zonen sowie Zonen für öffentliche<br />
Bauten und Anlagen. Die Zonenfestlegungen<br />
sind parzellenscharf und<br />
grundeigentümerverbindlich.
8<br />
AKTUELL: VERDICHTUNG | ACTUEL: DENSIFICATION<br />
Ortsbilder stiften Identität:<br />
die Verdichtungsdiskussion<br />
Einmalige Landschafts- und Stadtbilder tragen zur unverwechselbaren Identität<br />
einer Region bei. Durch die Forderung nach Verdichtung geraten sie unter Druck.<br />
Die Qualitäten<br />
unserer historischen<br />
Siedlungen<br />
müssen erkannt,<br />
gewürdigt und erhalten<br />
werden.<br />
Daniel Moeri<br />
01<br />
01 Breitenegg, Gemeinde Wynigen,<br />
schützenswertes Ortsbild von<br />
nationaler Bedeutung.<br />
02 Twann, Blick vom Rebhang auf die<br />
Hinterhäuser.<br />
03 Dorfgasse Twann, schützenswertes<br />
Ortsbild von nationaler Bedeutung.<br />
Prägenden Bauten samt ihrer Umgebung<br />
– unsere Baukultur – sind wesentliche<br />
identitätsstiftende Aspekte<br />
für einen Ort. Sie führen dazu, dass<br />
sich Menschen an einem Ort wohl<br />
fühlen. Markante Bauten und ein über<br />
längere Zeit entstandenes Konglomerat<br />
von gebauter Struktur mit<br />
natürlicher Abfolge von offenen und<br />
geschlossenen Räumen, von Grünräumen<br />
und gestalteten Plätzen zeichnen<br />
historisch gewachsene Zentren<br />
aus. Diese Merkmale bilden das Rückgrat<br />
einer Stadt oder eines Dorfes<br />
und schaffen Identität und Wohlgefühl,<br />
tragen zur Unverwechselbarkeit<br />
eines Ortes bei. Sie tragen dazu bei,<br />
dass sich die Menschen in der globalisierten,<br />
überall gleich gestalteten<br />
Welt orientieren können und verbinden<br />
uns mit unserer Vergangenheit.<br />
Das rasante Siedlungswachstum in<br />
der Schweiz in den vergangenen Jahren<br />
und die kontinuierliche Erweiterung<br />
des Siedlungsgebiets führte zur<br />
Einsicht, dass die Zersiedelung gestoppt<br />
und das Kulturland geschont<br />
werden sollen. Die Neuausrichtung<br />
wurde mit der Revision des Raumplanungsgesetzes<br />
gestartet. Die daraus<br />
resultierende Forderung nach der<br />
Weiterentwicklung im Bestand erhöht<br />
unweigerlich den Druck auf unser<br />
baukulturelles Erbe und unsere Ortsbilder.<br />
Tiefgreifende bauliche Veränderungen<br />
sind irreversibel, meist für<br />
lange Zeit. Unsere Ortsbilder laufen<br />
Gefahr, ihren identitätstiftenden Charakter<br />
zu verlieren.<br />
Qualitäten erhalten und weiterentwickeln<br />
Das Projektieren innerhalb von sensiblen<br />
Ortsbildern und bestehenden,<br />
gewachsenen Strukturen ist anspruchsvoll<br />
und setzt hohe fachliche<br />
Kompetenzen im Bereich der Ortsbildgestaltung<br />
und Städteplanung vo-
AKTUELL: VERDICHTUNG | ACTUEL: DENSIFICATION<br />
9<br />
02 03<br />
Verdichten hat Grenzen. Nicht zuletzt, weil<br />
das höchste Gut in der Schweiz immer noch<br />
der Besitzstand ist.<br />
Daniel Moeri<br />
04 Ittigen, Wohnanlage Atria mit insgesamt<br />
36 Wohnungen im weiträumigen Park<br />
des Pflegezentrums Tilia. Schär Buri<br />
Architekten AG, Bern, 2012.<br />
05 Ittigen, Wohnanlage Atria. Das ehemalige<br />
Asyl Gottesgnad, heute Pflegezentrum<br />
Tilia, entstand 1930–31 in der<br />
Formensprache der Moderne.<br />
raus. Mit dem Inventar der Schweizerischen<br />
Ortsbilder ISOS und dem<br />
kantonalen Bauinventar stehen<br />
Grundlagen zur Geschichte und Siedlungsentwicklung<br />
unserer Städte,<br />
Ortschaften und Baudenkmäler zur<br />
Verfügung.<br />
Ziel der Siedlungsentwicklung muss<br />
es sein, bestehende Qualitäten zu erhalten,<br />
weiterzuentwickeln und neu<br />
zu beleben und so zu einer hohen<br />
Lebensqualität im bestehenden Siedlungsgebiet<br />
beizutragen. Der sorgfältige<br />
Umgang mit unserer Baukultur<br />
trägt zur Erreichung dieses Ziels bei.<br />
Denn gerade im Erneuerungsprozess<br />
ist das Bestehende wichtig. Städtebau,<br />
Ortsbildpflege und Raumplanung<br />
müssen ein Gleichgewicht zwischen<br />
Bewahrung und Erneuerung<br />
anstreben. Will man dies erreichen,<br />
sind gesamtheitliche, massgeschneiderte<br />
Konzepte und die vertiefte<br />
analytische Auseinandersetzung mit<br />
dem Ort wichtig. Indem die Besonderheiten,<br />
die einen Ort prägen, gezielt<br />
genutzt werden, kann nachhaltiger<br />
Mehrwert geschaffen werden.<br />
Auseinandersetzung mit dem eigenen<br />
Ort<br />
Das Thema Siedlungsentwicklung<br />
nach innen betrifft uns alle: Bauen im<br />
bewohnten Gebiet bedeutet auch,<br />
dass die Nachbarschaft näher rückt.<br />
Veränderungen in der eigenen Umgebung<br />
gegenüber begegnen Menschen<br />
mit verschiedenen Emotionen – sei<br />
dies mit Akzeptanz, Begeisterung<br />
oder Verweigerung. Das gilt auch für<br />
Veränderungen, die sich im Zusammenhang<br />
mit der inneren Verdichtung<br />
ergeben: Verdichtung ist gut, solange<br />
sie nicht die eigene Aussicht verbaut.
10<br />
AKTUELL: VERDICHTUNG | ACTUEL: DENSIFICATION<br />
04 05<br />
Die Leute freuen sich riesig, wenn sie begreifen,<br />
wo sie wohnen. Wenn ihnen bewusst<br />
wird, dass ihre Landschaft ein Kulturgut ist,<br />
das über Jahrhunderte gewachsen ist.<br />
Daniel Moeri<br />
Es ist daher wichtig, die betroffenen<br />
Menschen nach Möglichkeit in Entwicklungsprojekte<br />
einzubeziehen.<br />
Will sich eine Gemeinde qualitätsvoll<br />
weiterentwickeln, ist die Auseinandersetzung<br />
mit dem eigenen Ort, mit<br />
seiner Identität und mit den Bedürfnissen<br />
seiner Bewohnerinnen und Bewohner<br />
unabkömmlich. Es geht zum<br />
einen darum, die Stärken und Schwächen<br />
eines Ortes auszumachen, zum<br />
andern um die spezifischen Eigenschaften,<br />
die den Ort charakterisieren<br />
und welche es zu fördern und weiterzuentwickeln<br />
gilt. Gemeinden, die<br />
die Richtung ihres Entwicklungspotenzials<br />
selbst bestimmen und ihre<br />
Planungsrolle aktiv wahrnehmen, gewinnen<br />
an Profil und stärken ihre<br />
Identität.<br />
Verdichten als Chance: die aktuelle<br />
Diskussion<br />
Verdichten fordert nicht nur heraus,<br />
sondern bietet auch die grosse<br />
Chance, auf die Entwicklung der gebauten<br />
Umwelt und deren Qualität<br />
und damit auf identitätsstiftende Faktoren<br />
verstärkt Einfluss nehmen zu<br />
können. Diese gilt es zu nutzen. Dass<br />
es möglich ist, moderne Architektur<br />
im Bestand zu integrieren, ohne dabei<br />
die Identität eines Ortes zu verleugnen,<br />
zeigen bereits heute viele Beispiele.<br />
Drei aktuelle Planungsprojekte<br />
in Köniz, Port und Langenthal, mit<br />
denen sich die Denkmalpflege im Moment<br />
beschäftigt, sind im Artikel auf<br />
S. 15–17 beschrieben.<br />
Soeben erschienen ist der Bericht<br />
«Siedlungsentwicklung nach innen –<br />
ISOS und Verdichtung». 2014 liess der<br />
Bundesrat eine breit zusammengesetzte<br />
Arbeitsgruppe unter der Leitung<br />
des Bundesamts für Raumentwicklung<br />
(ARE) aufstellen. Die<br />
Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit<br />
der Frage, ob das Bundesinventar<br />
der schützenswerten Ortsbilder der<br />
Schweiz (ISOS) die vom revidierten<br />
Raumplanungsgesetz (RPG) geforderte<br />
Siedlungsentwicklung nach innen<br />
allenfalls erschweren oder gar<br />
verunmöglichen könnte. Den Ausschlag<br />
für die Untersuchung gab die<br />
Besorgnis des Baudirektors des Kantons<br />
Zürich über mögliche Schwierigkeiten<br />
bei der Aktualisierung des<br />
ISOS im Kanton Zürich. Der Bericht<br />
der Arbeitsgruppe vertieft diese Fragen<br />
anhand konkreter Beispiele und<br />
zeigt mögliche Lösungswege auf. Die<br />
gewonnenen Erkenntnisse dienen als<br />
Umsetzungshilfe auch anderen Kantonen,<br />
Städten und Gemeinden. Die<br />
Denkmalpflege des Kantons Bern war<br />
durch die Ortsbildpflege in der Arbeitsgruppe<br />
vertreten.<br />
LITERATURHINWEISE<br />
Tatiana Lori, Lukas Auf der Maur<br />
Siedlungsentwicklung nach innen.<br />
ISOS und Verdichtung. Bericht<br />
der Arbeitsgruppe. Bundesamt für<br />
Raumentwicklung (Hrsg.), <strong>2016</strong>.<br />
www.are.admin.ch<br />
Siedlungsentwicklung nach innen.<br />
Gute Beispiele aus Berner Gemeinden.<br />
Justiz-, Gemeinden- und<br />
Kirchendirektion des Kantons Bern,<br />
Amt für Gemeinden und Raumordnung<br />
(AGR) (Hrsg.), 2014.<br />
www.jgk.be.ch
AKTUELL: VERDICHTUNG | ACTUEL: DENSIFICATION<br />
11<br />
Das Bundesinventar der schützenswerten<br />
Ortsbilder der Schweiz ISOS in der Praxis<br />
Das ISOS würdigt die topografische, räumliche und historische Beschaffenheit<br />
der Ortsbilder der Schweiz und ist eine Grundlage für künftige Entwicklungen.<br />
Umgebung. Die Aufnahme eines<br />
Ortsbilds ins ISOS zeigt auf, dass es<br />
die ungeschmälerte Erhaltung verdient.<br />
Das Inventar versteht sich als<br />
Grundlage und Leitfaden für künftige<br />
Planungen und Entwicklungen. Ziel<br />
des ISOS ist es, das bauliche Erbe mit<br />
seinen prägenden Merkmalen trotz<br />
ständiger Weiterentwicklung in der<br />
Grundsubstanz zu erhalten und zu<br />
vermeiden, dass ihm irreversibler<br />
Schaden zugefügt wird. Es geht dabei<br />
nicht um das Verhindern von Entwicklungen<br />
im Ort, sondern vor allem um<br />
das Herausschälen von besonderen<br />
Charakteristiken.<br />
01<br />
01 La Neuveville, schützenswertes Ortsbild<br />
von nationaler Bedeutung, Aufnahmeplan<br />
ISOS.<br />
Während früher vorwiegend Schlösser,<br />
Kirchen oder ein Stadttor – und<br />
als Ortsbild nur ein mittelalterlicher<br />
Stadtkern – als Denkmäler oder Kulturgüter<br />
verstanden wurden, besteht<br />
heute mit dem ISOS ein umfassendes<br />
Werk über die bedeutenden Ortsbilder<br />
der Schweiz. Das Inventar ist<br />
nicht als Verzeichnis von Einzelobjekten<br />
zu verstehen, sondern es betrachtet<br />
das Ortsbild aus einer ganzheitlichen<br />
Perspektive. Für die nationale<br />
Bedeutung der Ortsbilder sind topografische,<br />
räumliche und architekturhistorische<br />
Qualitäten ausschlaggebend:<br />
Das ISOS beurteilt die Ortsbilder<br />
in ihrer Gesamtheit bzw. nach<br />
dem Verhältnis der Bauten untereinander,<br />
nach der Qualität der Räume<br />
zwischen den Häusern und nach dem<br />
Verhältnis der Bebauung zu seiner<br />
Der Bundesgerichtsentscheid Rüti<br />
2009<br />
Das Bundesinventar ISOS wurde bis<br />
vor kurzem in der Raumplanung nicht<br />
als zwingend zu beachtende Grundlage<br />
beurteilt. Schweizweit war auf<br />
Verordnungsebene umstritten, ob das<br />
ISOS ausschliesslich bei der Erfüllung<br />
von Bundesaufgaben beachtet und<br />
in welcher Form es von Kantonen und<br />
Gemeinden berücksichtigt werden<br />
muss. Dies hatte zur Folge, dass die<br />
Auseinandersetzung mit dem ISOS<br />
häufig erst zum Zeitpunkt einer<br />
konkreten Anfrage zu einer Überbauungsordnung<br />
(UeO) oder im Zusammenhang<br />
mit einer Zonenplanänderung<br />
mit Planungspflicht (ZPP) auf<br />
kommunaler Ebene erfolgte. Zu einem<br />
Zeitpunkt also, wenn es baureife<br />
Projekte zu beurteilen galt.<br />
Mit dem Bundesgerichtsentscheid<br />
Rüti (BGE 135 II 209) wird die Umset-
12<br />
AKTUELL: VERDICHTUNG | ACTUEL: DENSIFICATION<br />
02 03<br />
Die bauliche Verdichtung nach innen ist<br />
sicher eine gute Sache, aber nicht um jeden<br />
Preis. Bestehende Qualitäten im Siedlungs-,<br />
Architektur- und Aussenraum sind zu erhalten<br />
oder zu verbessern.<br />
Daniel Moeri<br />
zung der Empfehlungen aus dem<br />
ISOS gestärkt. Der Entscheid bestätigt<br />
die grosse Bedeutung der Bundesinventare<br />
nach Artikel 5 des<br />
Bundesgesetzes über Natur- und Heimatschutz<br />
(NHG). Die entsprechende<br />
Ergänzung der Verordnung über das<br />
Bundesinventar ISOS macht klar,<br />
dass für die Kantone und Gemeinden<br />
auch bei der Erfüllung von kantonalen<br />
und kommunalen Aufgaben eine<br />
Pflicht zur Berücksichtigung dieser<br />
Bundesinventare besteht. Das ISOS<br />
wirkt bei Richt- und Nutzungsplanungen<br />
ähnlich wie Konzepte und Sachpläne<br />
des Bundes.<br />
Die Akzeptanz der ortsbildpflegerischen<br />
Anliegen für die Raumplanung<br />
hat sich seither verbessert, die Mitsprache<br />
der Ortsbildpflege wird aber<br />
nach wie vor zuweilen als unnötiges<br />
Eingreifen in die Selbstbestimmung<br />
der Baubehörden missverstanden.<br />
Die gesetzlichen Regelungen im<br />
Kanton Bern<br />
Im Kanton Bern ist das ISOS in der<br />
Bauverordnung verankert (Art. 13e<br />
BauV). Ausserdem bestehen Regierungsratsbeschlüsse<br />
zum ISOS, welche<br />
die Behörden verpflichten, die Inventare<br />
des Bundes und des Kantons<br />
bei Tätigkeiten, die den Ortsbildschutz<br />
oder die Ortsbildgestaltung<br />
betreffen, zu berücksichtigen. Das<br />
ISOS muss bei raumplanerischen<br />
Massnahmen im Umfeld von inventarisierten<br />
Ortsbildern systematisch<br />
als Entscheidungsgrundlage beigezogen<br />
werden. Hinweise und Empfehlungen<br />
im ISOS müssen in gebührender<br />
Qualität reflektiert werden. Dies<br />
gilt nicht nur für Ortsbilder und Einzelbauten,<br />
sondern auch für Freihaltezonen<br />
und für die Umgebung von<br />
Baudenkmälern.<br />
Das ISOS im kantonalen Richtplan<br />
Der kantonale Richtplan orientiert die<br />
Akteure der Raumplanung über das
AKTUELL: VERDICHTUNG | ACTUEL: DENSIFICATION<br />
13<br />
04 05<br />
Bei den Siedlungen, die vor 100 Jahren<br />
oder früher entstanden sind, hat es schlicht<br />
Superqualität. Und die sind dicht.<br />
Daniel Moeri<br />
02 La Neuveville, Rue du Marché.<br />
03 La Neuveville, Altstadt von Westen.<br />
04 Diemtigen, schützenswertes Ortsbild<br />
von nationaler Bedeutung, Aufnahmeplan<br />
ISOS.<br />
05 Diemtigen, Blick auf das Dorf<br />
von Westen.<br />
ISOS und die Umsetzung der Erhaltungsziele.<br />
Kanton und Gemeinden<br />
haben in der Interessenabwägung bei<br />
Planungen und bei der Realisierung<br />
von raumwirksamen Vorhaben die Erhaltungsziele<br />
des ISOS zu berücksichtigen.<br />
Das Bundesinventar verhindert<br />
nicht die Ortsentwicklung,<br />
sondern fördert eine nachhaltige<br />
Planung. Ein Abweichen darf nur in<br />
Erwägung gezogen werden, wenn<br />
gleich- oder höherwertige Interessen<br />
von ebenfalls nationaler Bedeutung<br />
entgegenstehen. Die Denkmalpflege<br />
ist für die Interpretation des ISOS<br />
mitverantwortlich. Die Umsetzung erfolgt<br />
unter der Federführung des Amtes<br />
für Gemeinden und Raumordnung<br />
(AGR) der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion.<br />
Lückenhafte Berücksichtigung des<br />
ISOS in kommunalen Planungen<br />
Da die Verankerung der Schutzanliegen<br />
in den kommunalen Nutzungsplanungen<br />
verschieden ist, bestehen<br />
heute zahlreiche rechtskräftige Planungsinstrumente<br />
(bspw. Überbauungsordnungen<br />
UeO, Zonen mit Planungspflicht<br />
ZPP, Richtplanungen,<br />
Zonenpläne, Baureglemente, Entwicklungskonzepte<br />
etc.), die eine<br />
echte Interessensabwägung mit dem<br />
ISOS noch nicht durchlaufen haben.<br />
Das heisst, es bestehen rechtsgültige<br />
Planungsinstrumente, welche die<br />
ISOS-Erhaltungsziele nicht genügend<br />
berücksichtigen. Bei solchen Bauvorhaben<br />
muss das Bundesinventar direkt<br />
für das Einzelprojekt berücksichtigt<br />
werden, was seine Wirksamkeit<br />
vermindert.<br />
Definition von Schutzzielen als<br />
Aufgabe der Denkmalpflege<br />
Die Schutzinteressen werden von der<br />
Ortsbildpflege der kantonalen Denkmalpflege<br />
in Form von Schutzzielen<br />
erarbeitet. Der Stellenwert des betroffenen<br />
ISOS-Gebietes (Baugruppe<br />
oder Umgebungsschutz) für das
14<br />
AKTUELL: VERDICHTUNG | ACTUEL: DENSIFICATION<br />
Entwicklungsräume<br />
Urbane Kerngebiete der<br />
Agglomerationen:<br />
als Entwicklungsmotoren stärken<br />
Agglomerationsgürtel und<br />
Entwicklungsachsen:<br />
fokussiert verdichten<br />
Zentrumsnahe ländliche Gebiete:<br />
Siedlung konzentrieren<br />
Hügel- und Berggebiete:<br />
als Lebens- und Wirtschaftsraum<br />
erhalten<br />
Hochgebirgslandschaften:<br />
schützen und sanft nutzen<br />
Überlagernde Raumtypen<br />
Intensiv touristisch genutzte<br />
Gebiete: Infrastrukturen<br />
konzentrieren<br />
National bzw. kantonal geschützte<br />
Gebiete beachten<br />
Naturpärke und Weltnaturerbe<br />
nachhaltig in Wert setzen<br />
06<br />
06 Richtplan 2030 Kanton Bern:<br />
Ziele für Entwicklungsräume und<br />
überlagernde Raumtypen.<br />
Ortsbild wird in einem Fachbericht<br />
festgehalten. Anhand einer Ortsanalyse<br />
wird geprüft, ob die vom ISOS<br />
umschriebenen Qualitäten und Erhaltungsziele<br />
noch vorhanden und sinnvoll<br />
sind. Aus diesen Überlegungen<br />
heraus lassen sich detaillierte Schutzziele<br />
definieren, die die generellen<br />
ISOS-Erhaltungsziele konkretisieren.<br />
Erst dann kann geprüft werden, wie<br />
sich eine geplante Bebauung auf<br />
die ISOS-Erhaltungsziele auswirkt. Ist<br />
eine Beeinträchtigung des Ortsbildes<br />
auszumachen, so werden die Massnahmen<br />
bestimmt, mit denen diese<br />
reduziert wird. Daraus kann die Forderung<br />
eines qualifizierten Verfahrens<br />
formuliert werden (Wettbewerb oder<br />
wettbewerbsähnliche Verfahren). Im<br />
Extremfall kann es bedeuten, dass<br />
die Freihaltung der Ortsbildumgebung<br />
angestrebt werden muss, was<br />
konkret einem Bauverbot gleichkommt.<br />
Es ist jedoch festzuhalten,<br />
dass das ISOS mit den daraus erarbeiteten<br />
Schutzzielen erst eine Grundlage<br />
für die Interessensabwägung<br />
darstellt. Sie ist nicht bereits das Resultat<br />
der Interessensabwägung.<br />
Zukünftige Berücksichtigung des<br />
ISOS in der Ortsplanung<br />
Das ISOS wurde bisher nur in wenigen<br />
Gemeinden in den gültigen Ortsplanungen<br />
berücksichtigt, da die Umsetzung<br />
auf kommunaler Stufe bis<br />
anhin nicht klar geregelt war. Planungen<br />
in den Gemeinden Köniz, Langenthal<br />
und Port zeigen jedoch beispielhaft<br />
auf, wie der Einbezug des<br />
ISOS gelöst werden kann (siehe Seite<br />
15–17). Im Hinblick auf die Siedlungsentwicklung<br />
nach innen kommt die<br />
Forderung nach Berücksichtigung<br />
der Bundesinventare zum richtigen<br />
Zeitpunkt. Die Ortsplanungen werden<br />
künftig eine wichtige Rolle spielen.<br />
Denn die entscheidenden Weichen<br />
bezüglich Ortsbildpflege und Siedlungsverdichtung<br />
werden im Verlauf<br />
von Ortsplanungen gestellt. Eine<br />
sorgfältige Ortsplanung mit ganzheitlichem<br />
Blick auf die künftige Siedlungsentwicklung<br />
fordert Gemeinden<br />
und Planer gleichermassen heraus.<br />
Adrian Stäheli
AKTUELL: VERDICHTUNG | ACTUEL: DENSIFICATION<br />
15<br />
Die Beispiele Köniz, Langenthal und Port<br />
Drei verschiedene Ansätze für den Umgang mit der inneren Verdichtung<br />
01<br />
01 Gurtendorf, Gemeinde Köniz.<br />
Drei aktuelle Planungsprojekte in<br />
Köniz, Langenthal und Port zeigen<br />
exemplarisch unterschiedliche Wege<br />
auf, die spezifischen Problemstellungen<br />
im Bereich der Raumplanung anzugehen.<br />
Köniz bezeichnete im Rahmen<br />
der Ortsplanungsrevision seine<br />
Siedlungen von besonderer Schönheit.<br />
In Langenthal entwickelte man<br />
für die Kernzone im Altstadtbereich<br />
konzentrierte Workshopverfahren und<br />
in Port stand eine sorgfältige Quartieranalyse<br />
im Zentrum.<br />
Ortplanungsrevision Köniz<br />
Die Gemeinde Köniz nimmt in der laufenden<br />
Ortsplanungsrevision ihre Aufgabe<br />
wahr, nebst den Baudenkmälern<br />
auch die Siedlungen von besonderer<br />
Schönheit, Eigenart, geschichtlichem<br />
und kulturellem Wert zu bezeichnen<br />
und die dem Schutzzweck dienenden<br />
Bau- und Nutzungsbeschränkungen<br />
zu erlassen.<br />
Ein intaktes Ortsbild zeichnet sich<br />
nicht nur durch seine räumliche Struktur<br />
aus. Ein wesentlicher Bestandteil<br />
eines qualitätsvollen Ortsbildes sind<br />
auch die angrenzenden Frei- und<br />
Aussenräume. Das ISOS unterscheidet<br />
in seinen Erhaltungszielen deshalb<br />
auch zwischen bebauten Gebieten<br />
und zu erhaltenden Umgebungen.<br />
In den Ortsplanungen soll der Fokus<br />
der Schutzanliegen nicht nur auf das<br />
Siedlungsgebiet, sondern auch auf<br />
seine Umgebungen gelenkt werden.<br />
Am Beispiel der Ortsplanung in Köniz<br />
kann aufgezeigt werden, wie die Anliegen<br />
des Ortsbildes planerisch umgesetzt<br />
werden können.<br />
Das Bundesinventar ISOS bezeichnet<br />
in der Gemeinde Köniz vier Weiler als<br />
Ortsbilder von nationaler Bedeutung,<br />
nämlich Gurtendorf, Herzwil, Liebewil<br />
und Mengestorf. Die in eine intakte<br />
Landschaft eingebetteten Weiler sind<br />
im kantonalen Bauinventar als Baugruppen<br />
ausgeschieden. Entsprechend<br />
wurde der grundeigentümerverbindliche<br />
Ortsbildschutzperimeter<br />
der Gemeinde über den Weiler mitsamt<br />
den Nahumgebungen festgesetzt.<br />
Für die vier Könizer Ortsbilder<br />
ist die angrenzende, landwirtschaftlich<br />
genutzte intakte Landschaft von<br />
zentraler Bedeutung. Deshalb wurde<br />
ausserhalb des Ortsbildschutzperimeters<br />
ein Landschaftsschongebiet<br />
ausgeschieden. Die Festsetzung des<br />
Ortsbildschutzes in der Nutzungspla-
16<br />
AKTUELL: VERDICHTUNG | ACTUEL: DENSIFICATION<br />
02 03<br />
02 Ortsplanungsrevision Köniz,<br />
baurechtliche Grundordnung bGo,<br />
Auszug Schutzplan, Stand Vorprüfung,<br />
11. Februar 2015.<br />
03 Gurtendorf, schützenswertes Ortsbild<br />
von nationaler Bedeutung, Aufnahmeplan<br />
ISOS.<br />
04 Ortsplanungsrevision Port, Quartieranalyse<br />
2014. BHP Raumplan AG, Bern.<br />
05 Port, Luftansicht.<br />
nung erfolgt also mit zwei grundeigentümerverbindlichen<br />
Schutzkategorien<br />
«Ortsbildschutzgebiete» und<br />
«Landschaftsschongebiete». Die Ortsbildschutzgebiete<br />
umfassen Siedlungen<br />
und Siedlungsteile mit ihren<br />
näheren Umgebungen, während die<br />
Landschaftsschongebiete im Bereich<br />
der Ortsbildschutzgebiete der grossräumigen<br />
Erhaltung der wertvollen<br />
Ortsansichten und dem qualitätsvollen<br />
Umgang mit den wichtigen Landschaftsbildern<br />
dienen. Bei den Landschaftsschongebieten<br />
wurde zudem<br />
unterschieden, ob generell ein Bauverbot<br />
gilt, da eine hohe ästhetische<br />
Empfindlichkeit besteht, welche<br />
durch landwirtschaftliche Bauten und<br />
Anlagen beeinträchtigt wird, oder ob<br />
in einem Gebiet Bauten und Anlagen<br />
mit grosser Sorgfalt in die Landschaft<br />
integriert werden können.<br />
Die Ortsplanungsrevision Köniz zeigt<br />
exemplarisch auf, wie mit Ortsbildern<br />
im ländlichen Kontext umgegangen<br />
werden kann. Es ist denkbar, dass<br />
dieses Vorgehen auch unabhängig<br />
von der Einstufung des ISOS bei intakten<br />
und wertvollen Siedlungsstrukturen<br />
angewendet werden kann.<br />
In städtischen Gebieten (bspw. verstädterte<br />
Dörfer oder Städte von nationaler<br />
Bedeutung) ist im Vergleich<br />
zu den ländlichen Könizer Weilern<br />
der Siedlungsdruck grösser und die<br />
Siedlungsstruktur völlig anders – hier<br />
müssen andere Lösungsansätze zum<br />
Zuge kommen.<br />
Langenthaler Modell zur Qualitätssicherung<br />
im Ortskern<br />
In Langenthal umfasst eine Kernzone<br />
den Altstadtbereich, dessen nutzungsmässige<br />
Vielfalt und bauliche<br />
Eigenart erhalten und weiterentwickelt<br />
werden sollen. Diese Kernzone<br />
ist eine Zone mit Planungspflicht<br />
(ZPP), das heisst, dass Neubauten<br />
nur auf der Grundlage einer rechtskräftigen<br />
Überbauungsordnung (UeO)<br />
zulässig sind. Wenn Bauwillige ein<br />
grösseres Projekt planen, empfiehlt<br />
die Stadt ein Qualität sicherndes Verfahren.<br />
Um innert nützlicher Frist zu<br />
einem Vorgehen zu kommen, wurden<br />
in den letzten beiden Jahren konzentrierte<br />
Workshop-Verfahren durchgeführt,<br />
die von einem Fachgremium unter<br />
Beteiligung der Eigentümerschaft<br />
begleitet werden. Dafür hat die Gemeinde<br />
eine feste Projektorganisation<br />
und ein standardisiertes Vorgehen
AKTUELL: VERDICHTUNG | ACTUEL: DENSIFICATION<br />
17<br />
04 05<br />
definiert. In einem dynamischen Prozess<br />
über mehrere Workshop-Anlässe<br />
sucht man in Varianten nach<br />
einer ortsgerechten Lösung. Dieses<br />
Verfahren ist ergebnisoffen. Denkbar<br />
ist, dass im Anschluss an ein solches<br />
Verfahren auf die Ausarbeitung einer<br />
Überbauungsordnung verzichtet werden<br />
kann. Das Verfahren kann aber<br />
auch abgebrochen werden. Durch<br />
dieses Vorgehen werden viele Planungsgeschäfte<br />
durch eine Fachjury<br />
begleitet und hinsichtlich Ortsbildverträglichkeit<br />
auch geschärft. Mit diesem<br />
Verfahren will die Stadt zu einer<br />
fachlich fundierten Meinung kommen,<br />
welche für die Grundeigentümerin<br />
und den Investor verbindlich ist und<br />
für die Bau- und Planungskommission<br />
und den Gemeinderat als Beurteilungsgrundlage<br />
dient. Dieses<br />
standardisierte Verfahren ist ein interessantes<br />
Vorgehen, mit welchem auf<br />
die Ortsbildqualität besser eingegangen<br />
werden kann. In anderen Gemeinden<br />
wird die Qualitätssicherung<br />
durch Kommissionen (bspw. Stadtbildkommission)<br />
sichergestellt. Das<br />
Langenthaler Verfahren bietet aufgrund<br />
der Workshops einen direkteren<br />
Kontakt mit den Planungsbüros.<br />
Es gibt keine Standardlösung. Jede Gemeinde<br />
hat ihre ganz spezifischen Qualitäten<br />
und Entwicklungspotenziale.<br />
Heinrich Hafner<br />
Quartieranalyse Port<br />
Die Gemeinde Port beauftragte im<br />
Rahmen ihrer Ortsplanungsrevision<br />
ein externes Planungsbüro mit einer<br />
Quartieranalyse des eingezonten<br />
Siedlungsgebiets. Dieses wurde in<br />
Quartiere eingeteilt, welche anhand<br />
von Bauvolumen, Freiraum, Erschliessung<br />
etc. nach Siedlungstypen aufgeschlüsselt<br />
wurden. Dies ermöglichte<br />
es, Strategien festzulegen, welche<br />
das zukünftige Entwicklungspotenzial<br />
pro Quartier aufzeigten. Gleichzeitig<br />
wurden spezifische Verdichtungsmassnahmen<br />
definiert, um sicherzustellen,<br />
dass die Qualitäten und der<br />
Charakter der jeweiligen Quartiere erhalten<br />
und entsprechend sorgfältig<br />
weiter entwickelt werden können.<br />
Adrian Stäheli, Eva Schäfer, Lukas Auf der Maur
18<br />
AKTUELL: VERDICHTUNG | ACTUEL: DENSIFICATION<br />
Ausblick:<br />
Instrumente und Vorgehensstrategien<br />
Die Abstimmung zwischen Siedlungsentwicklung und Ortsbildschutz erfordert neue<br />
Instrumente, insbesondere zur Sicherung der Qualität.<br />
Der Paradigmenwechsel, der in der<br />
Raumplanung eingeleitet worden ist,<br />
stellt bei der Umsetzung alle Beteiligten<br />
vor neue Herausforderungen,<br />
Raumplaner und Gemeinden ebenso<br />
wie die kantonalen Fachstellen. Für<br />
die innere Verdichtung gibt es keine<br />
Standardlösungen, die Rahmenbedingungen<br />
und Entwicklungsmöglichkeiten<br />
in den Gemeinden sind enorm<br />
vielfältig. Erprobte Instrumente wie<br />
ISOS oder verschiedene Arbeitshilfen<br />
zum Thema Verdichten stehen zur<br />
Verfügung. Es zeigt sich jedoch, dass<br />
weitere Instrumente und Strategien<br />
für das gezielte Vorgehen notwendig<br />
sind. Ein wichtiges Thema ist dabei<br />
die Sicherung der Qualität.<br />
Siedlungs- und Quartieranalysen<br />
01<br />
01 Ortsplanungsrevision Köniz, Raumentwicklungskonzept<br />
REK, Konzept<br />
Zentrum Köniz Liebefeld – das Dreieck,<br />
20. April 2007. Atelier Wehrlin, Wünnewil.<br />
02 Ortsplanungsrevision Köniz, Richtplan<br />
Raumentwicklung Gesamtgemeinde<br />
RP REGG, Konzept Teilgebiet Köniz/<br />
Liebefeld, Konzept «Städtebau», Plan<br />
«Städtebau», Stand Vorprüfung,<br />
12. April 2012. Atelier Wehrlin, Wünnewil.<br />
03 Ortsplanungsrevision Köniz, Richtplan<br />
Raumentwicklung Gesamtgemeinde<br />
RP REGG, Konzept Teilgebiet Köniz/<br />
Liebefeld, Konzept «Städtebau», Plan<br />
«Baustruktur», Stand Vorprüfung,<br />
12. April 2012. Atelier Wehrlin, Wünnewil.<br />
Das Wichtigste ist<br />
eine seriöse Analyse.<br />
Du musst verstehen,<br />
wie der Ort<br />
gewachsen ist, wie<br />
er entstanden ist.<br />
Daniel Moeri<br />
Die äussere Erscheinung eines Ortes<br />
definiert sich nicht allein durch seine<br />
Einzelobjekte. Von ebensolcher Bedeutung<br />
für den Siedlungscharakter<br />
sind die Freiräume, die Raumstrukturen<br />
und die Strassennetze. Will man<br />
den Charakter der Stadt und des Ortes<br />
bewahren, müssen die Strukturen<br />
des Ortes erkannt werden. Die Planungsbeteiligten<br />
befassten sich bis<br />
heute mit Raumentwicklungskonzepten,<br />
welche Überlegungen auf<br />
übergeordneter Planungsebene im<br />
grossen Massstab erlaubten (Mstb.<br />
1:10‘000 oder grösser). Um die örtlichen<br />
Qualitäten zu erfassen und eine<br />
qualitativ hochstehende Siedlungsergänzung<br />
im Rahmen der vorhandenen<br />
Strukturen zu ermöglichen, sind<br />
jedoch Quartier- und Raumanalysen<br />
im kleineren Massstab (Mstb. 1:1'000<br />
oder kleiner) notwendig. Ortsbauliche<br />
Analysen sowie Bebauungskonzepte<br />
auf Quartierebene sind unverzichtbare<br />
Grundlagen, um alle Anliegen<br />
des Orts- und Landschaftsschutzes<br />
sowie der Siedlungsverdichtung unter<br />
einen Hut zu bringen.
AKTUELL: VERDICHTUNG | ACTUEL: DENSIFICATION<br />
19<br />
02 03<br />
Um diese Siedlungsstrukturen unter<br />
Wahrung ihres Charakters weiterzuentwickeln,<br />
sind Strategien notwendig.<br />
Vittorio Magnago Lampugnani,<br />
Professor für Geschichte des Städtebaus<br />
an der ETH Zürich, spricht treffend<br />
von einer «Veränderungsstrategie»,<br />
welche der Raumplaner neben<br />
der «Erhaltungsstrategie» der klassischen<br />
Denkmalpflege benötigt. Diese<br />
Strategien legen bspw. fest, welche<br />
vorhandenen Siedlungsstrukturen gestärkt<br />
werden sollen, welche Gebiete<br />
sich für eine Neubebauung oder eine<br />
Weiterentwicklung eignen, welche zu<br />
bewahren oder im Bestand zu erneuern<br />
sind, wo Freiflächen ausgeschieden<br />
oder aufgewertet werden können.<br />
Ein echter Nutzen entsteht aber<br />
nur, wenn die Verdichtungsstrategie<br />
als Teil einer Gesamtbetrachtung in<br />
die Nutzungsplanung integriert wird<br />
und damit einen grundeigentümerverbindlichen<br />
Niederschlag findet.<br />
Austausch und Zusammenarbeit<br />
Die Denkmalpflege muss als Fachstelle<br />
vermehrt in Jurys oder bei anderen qualitätssichernden<br />
Verfahren Einfluss nehmen.<br />
Sie muss präsent sein.<br />
Heinrich Hafner<br />
Bei der Umsetzung des Raumplanungsgesetzes<br />
sind vor allem die Gemeinden<br />
in der Pflicht. Planungsbüros<br />
nehmen eine wichtige Schnittstelle<br />
ein und müssen in einem Raumplanungskonzept<br />
als Koordinatorinnen<br />
alle Bedürfnisse berücksichtigen,<br />
wenn eine echte Interessensabwägung<br />
garantiert sein soll.<br />
In der momentanen Praxis wird die<br />
Ortsbildpflege nicht selten erst zum<br />
Zeitpunkt der Baubewilligung in Planungsprojekte<br />
miteinbezogen. Im<br />
Normalfall kommt es zu diesem Zeitpunkt<br />
kaum mehr zu einer echten Interessenabwägung,<br />
da bereits baureife<br />
Projekte vorliegen. Eine vertiefte<br />
Betrachtung bezüglich der Qualität ist<br />
dann nicht mehr möglich. Ein frühzeitiger<br />
Kontakt der Gemeinden mit den<br />
zuständigen kantonalen Fachstellen<br />
und ein Abgleich mit den übergeordneten<br />
Vorgaben begünstigt effiziente<br />
Vorgänge.<br />
Idealerweise fliessen die Rückmeldungen<br />
der Ortsbildpflege bereits in
20<br />
AKTUELL: VERDICHTUNG | ACTUEL: DENSIFICATION<br />
04 05<br />
Durch den gesetzlichen Auftrag zur inneren<br />
Verdichtung muss eine neue Form der<br />
Zusammenarbeit zwischen Raumplanung<br />
und Denkmalpflege gefunden werden.<br />
Heinrich Hafner<br />
04 Gerzensee, Arealentwicklung ZPP Belpbergstrasse.<br />
Das Areal an der Belpbergstrasse<br />
liegt in einer Baugruppe und ist<br />
umgeben von schützenswerten Bauten.<br />
05 Für die Weiterentwicklung des Areals<br />
wurde ein Workshop-Verfahren eingeleitet,<br />
an dem Mitglieder der Einwohnergemeinde,<br />
eine Expertengruppe und<br />
ein Architektenteam beteiligt waren.<br />
Projektplan <strong>2016</strong>. GHZ Architekten AG,<br />
Belp.<br />
06 Bärenplatz Langnau: Bis 1960 prägte<br />
das Hotel Löwen den Platz, später stand<br />
hier die Migros, heute dient das Areal<br />
vorübergehend als Parkplatz. Die Überbauung<br />
der Parzelle ist geplant, ein<br />
qualitätssicherndes Verfahren läuft.<br />
die Siedlungsanalyse ein, so dass in<br />
einer frühen Phase eine ernsthafte<br />
Interessensabwägung zwischen Verdichtungsbestrebung<br />
und Ortsbildschutz<br />
vorgenommen wird. Ein institutionalisierter<br />
Austausch zwischen<br />
Raumplanern, Gemeinde und Ortsbildpflege<br />
ist dafür grundlegend.<br />
Qualitätssicherung<br />
Qualitative Hochwertigkeit ist für Planungsfachleute<br />
im Zusammenhang<br />
mit Verdichtung selbstverständlich.<br />
Im revidierten Raumplanungsgesetz<br />
fehlen Aussagen bezüglich Qualität<br />
aber weitgehend, das Thema ist kaum<br />
in die Revision eingeflossen. Daraus<br />
resultiert, dass im Moment Instrumente<br />
auf übergeordneter Planungsebene<br />
fehlen, die u.a. eine Abstimmung<br />
mit dem Ortsbildschutz<br />
verbindlich regeln und damit garantieren,<br />
dass sich Siedlungen unter Erhaltung<br />
ihres Charakters und ihrer<br />
Qualitäten weiterentwickeln können.<br />
Einheitliche Parameter, nach denen<br />
die Qualitätssicherung erfolgt, und<br />
verbindliche Bedingungen können die<br />
qualitätsvolle Umsetzung sichern.<br />
Aus ortsbildpflegerischer Sicht wären<br />
konkrete Schritte in diese Richtung<br />
wünschenswert.<br />
Gute Voraussetzungen für eine hohe<br />
Qualität der Architektur und der Siedlungsentwicklung<br />
schaffen qualifizierte<br />
Verfahren wie Testplanungen,<br />
Wettbewerbe, Machbarkeitsstudien,<br />
Studienaufträge oder begleitete Verfahren.<br />
Sie ermöglichen bereits zu<br />
Beginn einer Planung die Abstimmung<br />
der verschiedenen Interessen.<br />
Hilfestellung bei der Qualitätssicherung<br />
leisten ausserdem heute schon<br />
Fachgremien in den Gemeinden,<br />
Ortsbildkommissionen und fachliche<br />
Beraterinnen und Berater aus allen<br />
Disziplinen (Architektur, Städtebau,<br />
Denkmalpflege und Raumplanung).<br />
Partizipative Verfahren<br />
Projekte der Siedlungsentwicklung<br />
nach innen können in der Bevölkerung<br />
auch auf Widerstand stossen.<br />
Partizipative Verfahren und eine of-
AKTUELL: VERDICHTUNG | ACTUEL: DENSIFICATION<br />
21<br />
06<br />
Letztlich braucht es Anreize. Wenn eine<br />
Gemeinde bereit ist, auf qualitätsvolle Prozesse,<br />
die zu einem guten Ziel führen, einzugehen,<br />
muss sie dafür belohnt werden.<br />
Daniel Moeri<br />
Zwei beliebige Beispiele aus der aktuellen<br />
Diskussion rund um das<br />
Thema Verdichtung belegen, dass<br />
grundlegende Überlegungen notwendig<br />
sind: Erstens zeigen verschiedene<br />
Studien auf, dass die grösste Dichte<br />
nicht mit Hochhäusern, sondern mit<br />
einer fünfgeschossigen Bauweise erreicht<br />
wird, denn höhere Häuser beanspruchen<br />
mehr Freiraum in der Fläche.<br />
Für die Verdichtung sind wir also<br />
nicht auf Hochhäuser angewiesen.<br />
Trotzdem wird das Hochhaus oft als<br />
ideales Verdichtungsinstrument genannt.<br />
Zweitens sind Quartiere des<br />
20. Jahrhunderts oft fünfgeschossig<br />
und damit dicht. Viele dieser Quartiere<br />
gelten heute als ineffizient und<br />
werden ersetzt. Oft wohnen jedoch<br />
danach weniger Menschen auf der<br />
gleichen Fläche, da der Platzbedarf<br />
pro Kopf massiv gestiegen ist. Faktisch<br />
wird also «entdichtet statt verdichtet».<br />
Eine Begriffsklärung wäre<br />
hilfreich: Was wird eigentlich unter<br />
«dichtem» Bauen verstanden – und<br />
was gilt?<br />
fene Kommunikation erleichtern die<br />
Akzeptanz eines neuen Projekts. Der<br />
Einbezug aller Akteure ist wichtig,<br />
erzeugt eine breite Abstützung und<br />
bildet die Basis für gegenseitiges Vertrauen.<br />
Ziel der Mitwirkungsverfahren<br />
ist es, die Entscheidungsfindungsprozesse<br />
und die Diskussion umstrittener<br />
Themen zu unterstützen.<br />
«Über den Rand hinausschauen»<br />
Handlungsbedarf besteht nicht nur<br />
in den Kerngebieten. Die Siedlungsentwicklung<br />
findet auch in weniger<br />
sensiblen Ortsteilen statt. Diese Gebiete<br />
sind häufig nicht im ISOS oder<br />
in Ortsbildschutzperimetern erfasst<br />
oder weisen keine Bauten auf, die im<br />
kantonalen Inventar aufgeführt sind.<br />
Sie betreffen das Kerngeschäft der<br />
Denkmalpflege nur indirekt, und ihre<br />
Wirkung auf die sensiblen Ortsbilder<br />
oder die Baudenkmäler ist oft von geringer<br />
Tragweite. Trotzdem sind auch<br />
hier räumliche Qualitäten vorhanden,<br />
welche es zu erkennen, zu erhalten<br />
und weiterzuentwickeln gilt, und die<br />
für die zukünftigen Planungen wesentlich<br />
sind. Diesen Strukturen ist<br />
ebenso Sorge zu tragen, denn sie bilden<br />
den Rahmen und sind für die Einbettung<br />
der ausgezeichneten Ortsbilder<br />
verantwortlich. Die Denkmalpflege<br />
steht als Diskussionspartnerin und<br />
Beraterin zur Verfügung.<br />
Was ist dicht?<br />
Tatiana Lori, Lukas Auf der Maur
22<br />
AKTUELL | ACTUEL<br />
Denkmalpflege ist Teamarbeit<br />
Die Bauberatung und die wissenschaftliche Erforschung des Baubestandes benötigen<br />
einander gegenseitig. Dazwischen steht die historische Bauanalyse als Bindeglied.<br />
01<br />
01 Das Pfarrhaus Oberbipp von Südwesten.<br />
Der Bau geht in vorreformatorische Zeit<br />
zurück und wurde mehrmals stark<br />
umgebaut. Seine heutige Erscheinung<br />
erhielt das Haus 1786–1788.<br />
02 Längsschnitt durch das Pfarrhaus<br />
Oberbipp Mstb. 1:250, Baualtersplan<br />
des Dachstuhls. Rot = 1629/30,<br />
Blau = 1786–1788, Oliv = um 1930.<br />
Der Eingriff im Bereich des westlichen<br />
Dachwalms ist gut ablesbar.<br />
03 Längsschnitt durch das Pfarrhaus<br />
Oberbipp Mstb. 1:250. Rekonstruktion<br />
der ursprünglichen Dachform mit zwei<br />
Freibindern und einem Gerschild. Die<br />
schräg verlaufende, unterbrochene Linie<br />
entspricht dem heutigen Dachabschluss<br />
auf der Westseite.<br />
Unter dem Begriff Denkmalpflege verstehen<br />
Kunden zumeist den Einsatz<br />
unserer Fachstelle zugunsten der historischen<br />
Baudenkmäler bei baulichen<br />
Veränderungen. Dieser Bereich<br />
der denkmalpflegerischen Tätigkeit –<br />
wir nennen ihn im Kanton Bern Bauberatung<br />
– wird in der Öffentlichkeit<br />
am stärksten wahrgenommen. In der<br />
Idealvorstellung von Bauherrschaft<br />
und Planenden beurteilt eine effiziente<br />
Bauberaterin oder ein effizienter<br />
Bauberater den Sachverhalt vor Ort<br />
und zeigt sogleich Lösungsmöglichkeiten<br />
auf, die sich aus Sicht der<br />
Denkmalpflege anbieten. Dieses Vorgehen<br />
trifft tatsächlich in vielen Fällen<br />
zu. Aber nicht immer geht es so<br />
schlank: Bauberatung ist mitunter<br />
eine komplexe Aufgabe. Ist der Baubestand<br />
eines Hauses ausgesprochen<br />
vielschichtig und unübersichtlich,<br />
sind die wichtigen Bereiche gar<br />
verborgen, beispielsweise durch<br />
mehrfache Umbauten, dann ist die<br />
Bauberaterin oder der Bauberater<br />
trotz fundierten architekturgeschichtlichen<br />
und bauhandwerklichen Kenntnissen<br />
nicht in der Lage, quasi aus<br />
dem Stegreif Entscheide zu fällen, die<br />
fachlich einer kritischen Überprüfung<br />
standhalten. In solchen Fällen bedarf<br />
es zusätzlicher Abklärungen, in erster<br />
Linie historischer Bauanalysen<br />
vor Ort und Recherchen in Archiven.<br />
Diese leisten in der Regel nicht die<br />
Bauberatenden selbst, sondern die<br />
Kolleginnen und Kollegen aus dem<br />
Fachbereich Baudokumentation und<br />
Archiv. In jüngster Zeit wurden diese<br />
Dienstleistungen ausgebaut, weil sie<br />
für die Bauberatung immer wichtiger<br />
werden: Nutzniesser sind letztlich die<br />
Eigentümer und Planenden selbst, die<br />
auch in komplexeren Fällen dank der<br />
Einblicke in die Geschichte eines<br />
Gebäudes früher und zielgerichteter<br />
beraten werden können. Eine fachlich<br />
Dank Einblicken<br />
in die Geschichte<br />
eines Gebäudes<br />
werden Eigentümer<br />
und Planende zielgerichteter<br />
beraten.
AKTUELL | ACTUEL<br />
23<br />
02 03<br />
fundierte Baudokumentation kommt<br />
zusätzlich den Inventarwerken zugute:<br />
Das Sammeln, Erforschen und<br />
Publizieren von bauhistorischen Erkenntnissen<br />
gehört schliesslich zum<br />
Grundauftrag der Denkmalpflege.<br />
Das Baudokumentations-Team besteht<br />
aus wissenschaftlichen Fachpersonen<br />
für Bauanalyse, Archiv- und<br />
Quellenforschung, einem Zeichner für<br />
Bauaufnahmen sowie aus einem Fotografen.<br />
Daraus wird ersichtlich,<br />
dass die Denkmalpflege zunehmend<br />
zur Teamarbeit wird. Der Nutzen der<br />
Baudokumentation für die Bauberatung<br />
und das Inventarwerk sowie die<br />
Zusammenarbeit soll an einem konkreten<br />
Beispiel, nämlich der Dachsanierung<br />
des Pfarrhauses Oberbipp,<br />
exemplarisch beleuchtet werden.<br />
Pfarrhaus Oberbipp: Recherchen<br />
während der Innensanierung 2006<br />
Oberbipp reicht bis in römische Zeiten<br />
zurück und ist ein früher Kirchenstandort.<br />
Die heutige Saalkirche<br />
entstand 1686 durch Werkmeister<br />
Abraham I Dünz. Sie ist das vierte<br />
Gotteshaus an derselben Stelle und<br />
Bestandteil des eindrücklichen kirchlichen<br />
Ensembles innerhalb des<br />
Das Sammeln, Erforschen und Publizieren<br />
von bauhistorischen Erkenntnissen gehört<br />
zum Grundauftrag der Denkmalpflege.<br />
räumlich intakten Ortskerns. Das<br />
Ortsbild von Oberbipp ist im Inventar<br />
der schützenswerten Ortsbilder der<br />
Schweiz als von nationaler Bedeutung<br />
eingestuft. Das Pfarrhaus mit<br />
angebauter Pfrundscheune erscheint<br />
als barocker Putzbau, geht im Kern<br />
jedoch in die vorreformatorische Zeit<br />
zurück.<br />
Im Jahr 2006 erwarb die reformierte<br />
Kirchgemeinde Oberbipp das Pfarrhaus<br />
aus dem Staatsbesitz. Der prekäre<br />
Bauzustand zwang zu einer<br />
umfassenden Innensanierung. Als<br />
Planungsgrundlage und Entscheidungshilfe<br />
für einen schonungsvollen<br />
Umgang mit dem Gebäude wurden<br />
exakte Aufnahmepläne und eine Untersuchung<br />
des historischen Baubestandes<br />
extern in Auftrag gegeben.<br />
Gleichzeitig recherchierte der Autor<br />
des Kunstdenkmälerbandes Amt<br />
Wangen in den Archiven nach grösseren<br />
und kleineren Umbau- und Renovierungsmassnahmen<br />
aus längst vergangenen<br />
Zeiten. Solche Aufzeichnungen<br />
sind für obrigkeitliche Bauwerke<br />
häufig zu finden und zuweilen<br />
bemerkenswert detailliert verfasst, so<br />
dass man auch die geleistete Arbeit,<br />
deren Preis und die Namen der ausführenden<br />
Handwerksmeister erfährt.<br />
Zusammen mit den Befunden am Objekt<br />
konnte die Baugeschichte des<br />
Oberbipper Pfarrhauses recht genau<br />
nachgezeichnet werden; sie reicht bis<br />
ins ausgehende Mittelalter zurück<br />
und ist entsprechend komplex.<br />
So liess sich der imposante liegende<br />
Dachstuhl dem grossen Pfarrhausumbau<br />
von 1629/30 zuordnen, ohne<br />
dass man eine Holzdatierung in Auftrag<br />
geben musste. Auffällig am klar<br />
konzipierten und gut gezimmerten<br />
Dachwerk sind die ungewöhnlichen<br />
Schmuckformen. Es handelt sich dabei<br />
um Verzierungen an den Bindern,<br />
einfache rote Ornamente. Leicht zu
24 AKTUELL | ACTUEL<br />
04 05<br />
04 Dachstuhl des Pfarrhauses Oberbipp:<br />
Die sägeblattartig in die Streben und<br />
Spanriegel eingepassten Büge sind<br />
typische Merkmale für die Zeit um 1630<br />
und zeugen von guter Zimmermannsarbeit.<br />
05 Von weit geringerer Qualität sind hingegen<br />
die Reparaturen und Umänderungen<br />
am Dachstuhl, die 1786–1788<br />
vorgenommen wurden. Die Abbildung<br />
zeigt den Bereich in der Hausmitte,<br />
wo früher ein Kaminzug die Dachdeckung<br />
durchstiess.<br />
06 Drei Beispiele für die im Inneren eines<br />
Dachraums ungewöhnliche Dekoration<br />
an den Konstruktionshölzern des Dachstuhls<br />
mit gefasten Streben, Bügen und<br />
Spannriegeln der Binder sowie unterschiedlichen<br />
geometrischen Ornamenten<br />
in roter Farbe.<br />
erkennen waren zudem mehrere spätere<br />
Eingriffe im Dachstuhl. Zwei<br />
davon fielen durch ihre rudimentäre,<br />
um nicht zu sagen unprofessionelle<br />
Machart auf. Der eine liegt im Bereich<br />
der westlichen Giebelwand, der andere<br />
ungefähr in der Hausmitte. Weil<br />
bei der Innensanierung die Aussenhülle<br />
unangetastet blieb, verschob<br />
man die Dokumentation der ungewöhnlichen<br />
Ornamentik auf den Zeitpunkt<br />
einer künftigen Fassaden- und<br />
Dachsanierung.<br />
Dachsanierung 2015 bringt neue<br />
Erkenntnisse<br />
Die Dachsanierung plante die Kirchgemeinde<br />
sieben Jahre später, also<br />
2015: Rasch zeigte sich, dass das<br />
Dachwerk im Bereich der erwähnten<br />
Eingriffe, insbesondere am westlichen<br />
Dachschild, instand gesetzt werden<br />
musste. Für die Bauberatung stellte<br />
sich nun die Frage, was denkmalpflegerisch<br />
korrekt ist, die Sanierung der<br />
konstruktiv und handwerklich mangelhaften<br />
Umänderung oder die Rekonstruktion<br />
des ursprünglichen Zustands,<br />
falls dieser einwandfrei<br />
festzustellen ist. Mit der Analyse des<br />
Dachstuhls vor Ort konnte tatsächlich<br />
die ursprüngliche Dachform geklärt<br />
werden. Dabei mussten auch kleinste<br />
Hinweise beachtet und interpretiert<br />
werden. Hilfreich waren die sogenannten<br />
Abbundzeichen, ein Markierungssystem<br />
der Zimmerleute, um die<br />
Mit der Analyse<br />
des Dachstuhls<br />
vor Ort konnte<br />
die ursprüngliche<br />
Dachform geklärt<br />
werden.<br />
Zusammengehörigkeit der vorgefertigten<br />
Konstruktionshölzer zu kennzeichnen.<br />
Schliesslich liess sich<br />
nachweisen, dass der Dachstuhl ursprünglich<br />
mit zwei Bindern versehen<br />
war, die ausserhalb der westlichen<br />
Giebelmauer lagen und dadurch einen<br />
mächtigen Dachvorschärm bildeten.<br />
Darüber befand sich ein Gerschild.<br />
Das Pfarrhaus Oberbipp hatte<br />
folglich seit dem prägenden Umbau<br />
von 1629/30 ein Aussehen wie viele<br />
andere steinerne Häuser aus dem 17.<br />
Jahrhundert im bernischen Gebiet,<br />
unter ihnen zahlreiche Pfarrhäuser.<br />
Grund für den formverändernden Eingriff<br />
am Dach waren Feuchteschäden,<br />
die bei der exponierten Westausrichtung<br />
der Giebelseite nicht<br />
weiter erstaunen. Man entfernte in der<br />
Folge die beiden Binder ausserhalb<br />
der Giebelmauer, trug letztere um<br />
Mannshöhe ab und kappte den ersten<br />
regulären Binder innerhalb des Dachraums.<br />
Anstelle des Gerschilds wurde
AKTUELL | ACTUEL<br />
25<br />
06<br />
DEKORATION IM DACHSTUHL<br />
Die ungewöhnliche Dekoration im<br />
Dachstuhl konzentriert sich auf die<br />
liegenden Binder und umfasst Fasen<br />
an den Streben, an den Bügen sowie<br />
an den Spannriegeln, und zwar<br />
immer an den zum Dachraum hin<br />
gerichteten Kanten der Hölzer. An<br />
den Bügen sind die Fasen mit ihren<br />
Abwürfen unterschiedlich ausformuliert,<br />
jedoch pro Binder identisch.<br />
Die meisten dieser Fasen tragen<br />
geometrisierende Ornamente in roter<br />
Farbe. Dabei handelt es sich um<br />
eine kaum wahrnehmbar dünne, aber<br />
deckende Schicht, die vermutlich<br />
ins Holz eingedrungen ist und sich<br />
im Farbton nicht von den Vorzeichnungen<br />
mit Rötelstift unterscheidet.<br />
Die Ornamente bestehen aus gefüllten<br />
oder bloss als Umriss dargestellten<br />
Dreiecken, rot bemalten<br />
Abwürfen, aufgemalten Rautenfriesen<br />
etc. Gehäuft tauchen diese<br />
rotfarbenen Motive an den Bügen<br />
auf, finden sich aber auch entlang<br />
der Streben. An zwei Stellen sind<br />
auch Teile der flächigen Unterseiten<br />
bemalt, einmal an einer Strebe<br />
(gegenläufiges Rautenmotiv) und<br />
ein weiteres Mal an einem Bug; dort<br />
wurde mit dem Zirkel eine einfache<br />
Blume vorgerissen und ausgemalt.<br />
Dekorationen dieser Art sind aus<br />
Dachräumen kaum bekannt, hingegen<br />
beobachtet man sie an hölzernen<br />
Speichern im Mittelland.<br />
ein wesentlich grösserer Walm gebaut,<br />
der deutlich weiter ins Hausinnere<br />
ragt. Auch die Umänderung<br />
des Dachstuhls in der Hausmitte ist<br />
auf einen gravierenden Fäulnisschaden<br />
zurückzuführen. Hier durchstiess<br />
ein (zwischenzeitlich verschwundener)<br />
Kaminzug die Ziegeldeckung.<br />
Weil der Unterhalt im 18. Jahrhundert<br />
sträflich vernachlässig wurde, drang<br />
Wasser in grossen Mengen in die<br />
Konstruktion ein. Die daraufhin erfolgte<br />
Reparatur war ebenfalls dürftig,<br />
hatte jedoch keine Auswirkung auf die<br />
äussere Erscheinung des Hauses.<br />
Fazit: keine Rückführung zur ursprünglichen<br />
Dachform<br />
Als gemeinsames Ergebnis von Bauanalyse<br />
und Archivforschung konnte<br />
die Dachumänderung der Pfarrhaussanierung<br />
von 1786–1788 zugeordnet<br />
werden. Damals liess man das schadhafte<br />
Gebäude reparieren und innen<br />
mit Böden, Wand- und Deckentäfer,<br />
Türen etc. weitgehend neu ausstatten.<br />
Zu dieser Aktualisierung gehört<br />
auch die veränderte Befensterung.<br />
Anstelle von unregelmässigen spätgotischen<br />
Fensteröffnungen traten<br />
nun auf der Südseite regelmässig auf<br />
Achsen aufgereihte Einzelfenster. Die<br />
Neufassadierung und der veränderte<br />
Dachabschluss sind demnach Teil<br />
desselben Bauvorhabens, gehören<br />
also zusammen und prägen das Bild<br />
des Oberbipper Pfarrhauses.<br />
Nach den wissenschaftlichen Recherchen<br />
kam wiederum die Bauberatung<br />
ins Spiel, die ihre Frage beantwortet<br />
fand: Eine Rückführung zur<br />
ursprünglichen Dachform kam aus<br />
denkmalpflegerischer Sicht nicht in<br />
Frage. Dank der Bauanalyse wurde<br />
jedoch eine zeichnerische Rekonstruktion<br />
möglich, die nun – zusammen<br />
mit dem Jahr der Umgestaltung und<br />
dem Namen des obrigkeitlichen<br />
Werkmeisters Ludwig Emanuel Zehender<br />
– unter dem Pfarrhaus Oberbipp<br />
Eingang im Kunstdenkmälerband<br />
des Amts Wangen finden wird.<br />
Hans Peter Würsten<br />
Oberbipp, Herrengasse 1<br />
Massnahmen: Innensanierung, 2006;<br />
Dachsanierung, 2015<br />
Bauherrschaft: Evangelisch-reformierte<br />
Kirchgemeinde Oberbipp<br />
Bauforschung: Urs Bertschinger, Biel (Aufnahmepläne<br />
und Bauanalyse im Innern 2006)<br />
Denkmalpflege: Eva Schäfer, KDP (Bauberatung<br />
2015), Hans Peter Würsten (Bauberatung<br />
2006, Bauanalyse Dachstuhl 2015),<br />
Richard Buser (Autor Die Kunstdenkmäler des<br />
Kantons Bern, Band Wangen)
26 AKTUELL | ACTUEL<br />
Die Überarbeitung<br />
des Bauinventars<br />
Im Auftrag des Grossen Rates plant die<br />
Erziehungsdirektion, das Bauinventar<br />
zu überarbeiten und dabei die Zahl<br />
der als schützens- und erhaltenswert<br />
eingestuften Gebäude im Kanton Bern<br />
zu reduzieren.<br />
Das Bauinventar des Kantons Bern ist<br />
in der Kulturpflegestrategie ein zentrales<br />
Element für die Priorisierung der<br />
denkmalpflegerischen Tätigkeit des<br />
Kantons. Das Inventar umfasst ohne<br />
die Stadt Bern aktuell rund 39'000<br />
schützens- und erhaltenswerte Objekte,<br />
was knapp zehn Prozent des<br />
gesamten Baubestandes im Kanton<br />
entspricht. Die bereits laufende Revision<br />
des Inventars durch die Denkmalpflege<br />
erfolgte ohne vorgängig<br />
festgelegte Obergrenze, verfolgte<br />
aber schon das Ziel der Bereinigung<br />
und Priorisierung. In der Januarsession<br />
2015 hat der Grosse Rat die<br />
Kulturpflegestrategie zur Kenntnis genommen<br />
und dazu verschiedene<br />
Planungserklärungen verabschiedet.<br />
Eine davon beauftragt die Denkmalpflege,<br />
innerhalb von fünf Jahren den<br />
Status der im Bauinventar aufgeführten<br />
schützens- und erhaltenswerten<br />
Objekten sowie die Baugruppen zu<br />
überprüfen. In der Januarsession<br />
<strong>2016</strong> hat der Grosse Rat über die Revision<br />
des Baugesetzes beraten. In<br />
der ersten Lesung beschloss der Rat,<br />
dass im Bauinventar höchstens sieben<br />
Prozent des gesamten Gebäudebestandes<br />
enthalten sein sollen.<br />
Etappenweise Überarbeitung<br />
Um den Auftrag des Grossen Rates<br />
zu erfüllen, wird die kantonale Denkmalpflege<br />
das Bauinventar in den<br />
kommenden Jahren etappenweise<br />
überarbeiten. In einem ersten Schritt<br />
werden <strong>2016</strong> die Baugruppen überprüft<br />
und reduziert. In einem zweiten<br />
Schritt werden in den Jahren<br />
2017–2020 die erhaltenswerten Objekte<br />
bearbeitet und in der letzten<br />
Phase folgt die Überprüfung der<br />
schützenswerten Objekte.<br />
Die Objekte werden im kantonalen<br />
Quervergleich nach gleichartigen<br />
Baugattungen, Regionen und Baujahren<br />
beurteilt. Die Reduktion des Bauinventars<br />
erfolgt nicht linear über alle<br />
Kategorien. Die Reduktion ist davon<br />
abhängig, wie häufig vergleichbare<br />
Objekte, bspw. Bauernhäuser, Wohnund<br />
Schulhäuser oder Industriebauten,<br />
vorhanden sind. Aufgrund ihrer<br />
grossen Anzahl ergibt sich bei Bauern-<br />
und Wohnhäusern eine mögliche<br />
Reduktion am ehesten. Insgesamt erfolgen<br />
die Kürzungen vor allem in der<br />
Kategorie «erhaltenswert». Bei der<br />
Kategorie «schützenswert» hingegen<br />
ist der Spielraum klein.
AKTUELL | ACTUEL<br />
27<br />
Révision du recensement<br />
architectural<br />
Sur mandat du Grand Conseil, la Direction<br />
de l’instruction publique envisage<br />
de réviser le recensement architectural<br />
et de réduire le nombre de bâtiments<br />
dignes de protection ou de conservation<br />
dans le canton de Berne.<br />
La Stratégie de protection du patrimoine<br />
fait de ce recensement un élément<br />
clé pour hiérarchiser les activités<br />
cantonales de sauvegarde du<br />
patrimoine. Actuellement, près de<br />
39 000 objets dignes de protection ou<br />
de conservation sont inscrits dans le<br />
recensement architectural du canton<br />
de Berne, hors ville de Berne, ce qui<br />
représente un peu moins de 10% du<br />
parc immobilier du canton. La révision<br />
du recensement par le Service<br />
des monuments historiques est déjà<br />
en cours. Elle ne s’effectue pas en<br />
fonction d’une limite maximale préalablement<br />
fixée, mais vise aussi un<br />
objectif de mise à jour et de hiérarchisation.<br />
Le Grand Conseil a pris connaissance<br />
de ce texte lors de sa session<br />
de janvier 2015, en adoptant<br />
plusieurs déclarations de planification.<br />
L’une d’elles charge le Service<br />
des monuments historiques de réexaminer,<br />
dans les cinq prochaines années,<br />
la liste des objets figurant à<br />
l’inventaire du canton de Berne dans<br />
les catégories « digne de protection »<br />
et « digne de conservation » et les<br />
groupes de bâtiments. En cours de la<br />
session de janvier <strong>2016</strong> le Grand<br />
Conseil a délibéré la révision de la<br />
législation sur les constructions. A<br />
l’occasion de la première lecture, le<br />
Grand Conseil a inscrit cette part<br />
dans la loi sur les constructions en la<br />
relevant à 7%.<br />
Révision échelonnée<br />
Le Service cantonal des monuments<br />
historiques va s’atteler à la révision du<br />
recensement architectural. En 2015, le<br />
Service des monuments historiques<br />
va réduire le nombre des groupes<br />
de bâtiments. De 2017 à 2020, il<br />
s’attaquera aux objets dignes de conservation,<br />
puis il finira par les objets<br />
dignes de protection.<br />
Des objets de mêmes type, région et<br />
année de construction seront comparés<br />
dans tout le canton. Le nombre<br />
d’objets qui seront sortis du recensement<br />
variera selon les catégories, il<br />
dépendra du nombre d’objets comparables,<br />
comme les fermes, les maisons<br />
d’habitation, les écoles ou les<br />
bâtiments industriels. En raison du<br />
grand nombre, la réduction potentielle<br />
est particulièrement élevée parmi<br />
les fermes et les maisons d’habitation<br />
et surtout dans la catégorie « dignes<br />
de conservation ». Cependant dans la<br />
catégorie « digne de protection » la<br />
marge de manœuvre est faible.
28 IM GESPRÄCH | DIALOGUE<br />
Gleichgewicht zwischen Schutz und Nutzung<br />
Heinrich Hafner, Tatiana Lori, Adrian Stäheli<br />
ZU DEN PERSONEN<br />
Heinrich Hafner (HH), lic. phil.-nat.<br />
dipl. Geograph, Raumplaner SIA/<br />
FSU ist Partner und Mitglied der<br />
Geschäftsleitung in den beiden privaten<br />
Raumplanungsbüros BHP<br />
Raumplan AG in Bern sowie Archam<br />
et Partenaires SA in Fribourg. Er<br />
beschäftigt sich beruflich seit 25<br />
Jahren mit der Frage, wie die Ortsbildpflege<br />
wirkungsvoll in die raumplanerischen<br />
Tätigkeiten integriert<br />
werden kann. Seine Arbeitsschwerpunkte<br />
liegen unter anderem in der<br />
Areal-, Quartier-, Orts-, Agglomerations-<br />
und Regionalplanung. Mit dem<br />
neuen Raumplanungsgesetz und<br />
der damit verbundenen Siedlungsentwicklung<br />
nach innen stehen diese<br />
Bereiche vor grossen orts- und<br />
städtebaulichen Herausforderungen.<br />
Tatiana Lori (TL), dipl. Architektin<br />
ETH/SIA, MAS ARCH ETH in Denkmalpflege<br />
ist seit 2014 Leiterin der<br />
Fachbereiche Bau- und Ortsbildpflege<br />
der Denkmalpflege des Kantons<br />
Bern. Davor war sie im Amt<br />
für Städtebau der Stadt Zürich als<br />
Denkmalpflegerin tätig.<br />
Adrian Stäheli (AS), dipl. ing.<br />
Raumplaner FH gehört seit 2012<br />
zum Team der Ortsbildpflege der<br />
kantonalen Denkmalpflege.<br />
Seine Schwerpunktregion ist das<br />
Berner Mittelland. Zuvor war er<br />
als Raum- und Verkehrsplaner in<br />
der Gemeinde Köniz tätig.<br />
TL Die Änderung des Raumplanungsgesetzes<br />
fordert die Siedlungsentwicklung<br />
nach innen und<br />
seit dem Bundesgerichtsentscheid<br />
von Rüti 2009, der besagt, dass<br />
man das ISOS innerhalb der Ortsbildplanung<br />
berücksichtigen muss,<br />
hat sich unser Bearbeitungsumfang<br />
in Planungsfragen erhöht. Die Projekte,<br />
die von uns beurteilt werden,<br />
sind hingegen oft schon sehr ausgereift.<br />
Die Auseinandersetzung mit<br />
den örtlichen Gegebenheiten und<br />
die Umsetzung des ISOS werden<br />
vernachlässigt, da diese meist nicht<br />
der Sicht der Bauherrschaft entsprechen.<br />
Unsere Anliegen werden<br />
als Zwängerei empfunden, was die<br />
Zusammenarbeit erschwert. Ein<br />
frühzeitiger Einbezug der Ortsbildpflege<br />
auf Stufe Raumplanung wäre<br />
sinnvoll.<br />
HH Es ist unbestritten, dass unser<br />
gebautes Kulturgut in der Raumplanung<br />
eine wichtige Rolle spielt.<br />
Vom Wert der Denkmalpflege muss<br />
man die Planerinnen und Planer<br />
nicht überzeugen. Die Frage ist vielmehr,<br />
wie die beiden Disziplinen<br />
gemeinsam in einen Dialog treten<br />
können. Der Einstieg in die Planungsprozesse<br />
läuft nach bestimmten<br />
Mustern ab. Das ISOS und die Bauinventare<br />
der Gemeinden sind zwei<br />
Inventare unter vielen, die in die<br />
Ortsplanung integriert werden müssen,<br />
ohne dass diese in der Regel<br />
speziell reflektiert werden. Mit dem<br />
gesetzlichen Auftrag zur inneren<br />
Verdichtung muss eine neue Form<br />
der Zusammenarbeit zwischen<br />
Raumplanung und Denkmalpflege<br />
gefunden werden. Wir stehen in der<br />
Raumplanung vor einem anforderungsreichen<br />
Entwicklungsprozess<br />
01<br />
und müssen uns überlegen, welche<br />
Instrumente nötig sein werden und<br />
wie die Zusammenarbeit gelebt<br />
werden soll. Erst dann zusammen zu<br />
diskutieren, wenn Probleme auftauchen,<br />
wird in Zukunft nicht mehr<br />
genügen. Die Denkmalpflege muss<br />
präsenter sein. Die grosse Herausforderung<br />
besteht darin, bei der<br />
Siedlungsentwicklung nach innen<br />
die angestrebte Verdichtung zu ermöglichen,<br />
ohne dass die vorhandenen<br />
Qualitäten verloren gehen.<br />
Dies betrifft nicht nur die geschützten<br />
oder sensiblen Bauten und Baugruppen,<br />
sondern unseren gesamten<br />
Baubestand.<br />
TL Mit dem Instrument der Baugruppen,<br />
aus denen die Gemeinden<br />
Ortsbildschutzperimeter ausscheiden<br />
können, wird für eine intakte,<br />
dem Schutzobjekt gerecht werdende<br />
Umgebung gesorgt. Der zu betrachtende<br />
Raum erstreckt sich aber<br />
oft weit über den sogenannten roten<br />
Rand, der eine Baugruppe definiert.
IM GESPRÄCH | DIALOGUE<br />
29<br />
Diese Betrachtung über die Perimetergrenzen<br />
hinaus ist anzustreben.<br />
HH Es ist eine zentrale Frage, wo<br />
die Denkmalpflege in Zukunft ihre<br />
Handlungs-Schwerpunkte setzt. Bei<br />
ausreichender Kapazität sollte die<br />
Betrachtung tatsächlich über den<br />
Perimeterrand hinausgehen. Das<br />
Problem liegt vor allem in den Graubereichen,<br />
in welchen ein verhältnismässig<br />
grosser Interpretationsund<br />
Ermessensspielraum besteht.<br />
Was passiert bspw. bei Verdichtungsprojekten<br />
in der Umgebung<br />
von erhaltenswerten Bauten? Wie<br />
überzeugend muss ein Projekt sein,<br />
damit ein erhaltenswertes Gebäude<br />
abgebrochen werden kann? Wenn<br />
wir um einen historischen Stadtkern<br />
herum verdichten, beeinflusst dies<br />
das Ortsbild, auch wenn der Eingriff<br />
ausserhalb des Ortsbildschutzperimeters<br />
erfolgt. Es handelt sich<br />
hier um Fragen, die das Kerngeschäft<br />
der Denkmalpflege nur indirekt<br />
betreffen, bei denen wir aber<br />
in Zukunft darauf angewiesen sind,<br />
einen kompetenten Diskussionspartner<br />
zu haben. Die Denkmalpflege<br />
muss als Fachstelle vermehrt in<br />
Jurys oder bei anderen qualitätssichernden<br />
Verfahren Einfluss nehmen<br />
und sich von Beginn an einbringen.<br />
Verdichtung darf nicht ohne Qualität<br />
passieren. Dazu muss die Denkmalpflege<br />
einen wichtigen Beitrag<br />
leisten.<br />
AS Die Planungsbüros sind eine<br />
wichtige Schnittstelle zwischen der<br />
Denkmalpflege und den Gemeinden.<br />
Sie sind meist als erste vor Ort<br />
und merken rasch, wenn Bereiche<br />
tangiert sind, die für das Ortsbild<br />
relevant sind. Richtigerweise müssten<br />
sie die Gemeinde darauf hinweisen,<br />
die Denkmalpflege beizuziehen,<br />
um das Projekt aus der Sicht<br />
des Ortsbildschutzes richtig aufzugleisen.<br />
Der Austausch zwischen<br />
Planungsbüros und Denkmalpflege<br />
ist zentral.<br />
TL Man muss die Gemeinden vermehrt<br />
für das Thema sensibilisieren.<br />
Gemeinden, die nicht über entsprechende<br />
Fachleute verfügen, werden<br />
mit der Siedlungsentwicklung nach<br />
innen an ihre Grenzen stossen.<br />
Sie sollen angeregt werden, rechtzeitig<br />
über ihre zukünftige Entwick-<br />
01 Heinrich Hafner.<br />
02 Adrian Stäheli, Heinrich Hafner und<br />
Tatiana Lori im Gespräch.<br />
02
30 IM GESPRÄCH | DIALOGUE<br />
lung und Positionierung sowie die<br />
spezifische Identität der Gemeinde<br />
nachzudenken.<br />
HH Bei grösseren Gemeinden mit<br />
professionellen Fachpersonen in der<br />
Verwaltung, engagierten Gemeinderäten<br />
und einer gefestigten Entwicklungskultur<br />
ist das Bewusstsein<br />
für diese Fragestellung schon lange<br />
vorhanden. Bei kleineren Gemeinden<br />
kommt es stark darauf an, wie der<br />
beauftragte Ortsplaner im Verlauf<br />
des Planungsprozesses die inhaltlichen<br />
Schwerpunkte setzt und in<br />
welchem Mass er die Planungskultur<br />
beeinflussen kann. Dies ist jedoch<br />
nicht das Hauptproblem. Uns steht<br />
ein tiefgreifender Paradigmenwechsel<br />
bevor. Wir haben noch wenig<br />
Erfahrung mit der konkreten Umsetzung<br />
der Siedlungsentwicklung nach<br />
innen. Die bisherigen Ortsplanungen<br />
wurden in der Regel dadurch ausgelöst,<br />
dass sich die Gemeinde<br />
neues Bauland erschliessen wollte.<br />
Heute ist dies nur noch unter stark<br />
erschwerten Bedingungen möglich.<br />
Deshalb sind neue Instrumente<br />
nötig. Instrumente, die nicht direkt in<br />
einen Zonenplan einfliessen, sondern<br />
als Zwischenschritte den komplizierten<br />
und langwierigen Weg<br />
zur inneren Verdichtung vorbereiten.<br />
In den nächsten Jahren wird im<br />
Kanton Bern gestützt auf das revidierte<br />
Raumplanungsgesetz und<br />
den Richtplan 2030 eine neue Planungskultur<br />
definiert werden. Wir<br />
werden künftig vor allem im Bestand<br />
und nicht mehr auf freien Flächen<br />
planen. Für die Denkmalpflege ergibt<br />
sich aus diesem Umstand eine<br />
grosse Chance.<br />
Bisher konnte man anhand der Pfeile<br />
im kommunalen Richtplan sehen, in<br />
welche Richtung sich die Gemeinde<br />
ihre zukünftige bauliche Entwicklung<br />
vorstellt. Diese Entwicklung in<br />
die Fläche wird so nicht mehr stattfinden.<br />
Stattdessen müssen wir uns<br />
überlegen, aus welchen Quartieren<br />
eine Ortschaft besteht, welchen<br />
Charakter diese Quartiere haben, wo<br />
der Bestand bewahrt, umstrukturiert<br />
oder durch Neubauten ersetzt werden<br />
soll. Wir müssen vermehrt mit<br />
Architektinnen und Städtebauern<br />
zusammenarbeiten und die Bevölkerung<br />
miteinbeziehen. Die Grundeigentümer<br />
müssen rechtzeitig darüber<br />
informiert werden, in welche<br />
Richtung die Planungen gehen. Die<br />
Prozesse werden länger dauern, da<br />
es Zeit braucht, Grundeigentümer<br />
zu überzeugen, mit ihren Nachbarn<br />
zusammenzuspannen, um etwas<br />
Neues zu entwickeln. Die Denkmalpflege<br />
muss sich überlegen, wie sie<br />
sich in diese Fragestellungen einbringen<br />
und wie sie einen Teil des<br />
Prozesses gemeinsam mit der<br />
Raumplanung gestalten kann.<br />
AS Ich finde das skizzierte Vorgehen<br />
genau richtig, es geht um städtebauliche<br />
Analysen. Die Gemeinden<br />
sind nicht verpflichtet, dies von<br />
den Planern einzufordern. Das AGR<br />
oder die Denkmalpflege müssten die<br />
Planungsbüros und die Gemeinden<br />
entsprechend sensibilisieren. Sonst<br />
besteht die Gefahr, dass sich Planungsbüros<br />
mit den günstigsten Offerten<br />
durchsetzen, welche die gewünschten<br />
Analysen nicht enthalten.<br />
HH Dieses Problem besteht tatsächlich.<br />
Eine profunde Auseinandersetzung<br />
mit den Möglichkeiten<br />
der inneren Verdichtung verteuert<br />
den Planungsprozess und birgt<br />
Risiken, weil das Ergebnis offen ist.<br />
Die Planung wird mehr und mehr<br />
rollend werden. Es gibt keine Standardlösungen.<br />
Man muss das Thema<br />
differenziert betrachten. Jede Gemeinde<br />
hat ihre ganz spezifischen<br />
Qualitäten und Entwicklungspotenziale.<br />
Diese Differenzierung zu erreichen,<br />
ist schwierig. Verdichten bedeutet<br />
überhaupt nicht, dass sämtliche<br />
Lücken gefüllt werden müssen.<br />
Es gibt Ortsteile, wie etwa ein<br />
Schlosspark, wo nicht oder nur sehr<br />
zurückhaltend gebaut werden kann.<br />
Dasselbe gilt auch für die Umgebung<br />
rund um historische Gebäude<br />
und Ortskerne. Im Interesse der<br />
Siedlungsqualität wird es auch weiterhin<br />
oder sogar vermehrt Grünzonen<br />
und öffentliche Freiräume<br />
brauchen. Es braucht intensive Diskussionen<br />
zwischen der Denkmal-
IM GESPRÄCH | DIALOGUE<br />
31<br />
pflege, dem AGR und den Planerinnen<br />
und Planern, um ein stabiles<br />
Gleichgewicht zwischen Schutz und<br />
Nutzung zu finden.<br />
AS Die Aufgabe ist hochkomplex.<br />
Im Moment ist hier eine Differenzierung<br />
nicht vorgesehen. Das AGR<br />
muss den Richtplan umsetzen.<br />
HH Eine grundeigentümerverbindliche<br />
baurechtliche Grundordnung<br />
wird es als Basis immer brauchen.<br />
Man wird in Zukunft verstärkt<br />
mit qualifizierten Verfahren und<br />
Überbauungsordnungen arbeiten<br />
müssen. In der kommunalen Richtplanung<br />
braucht es neben den<br />
räumlichen und quantitativen verstärkt<br />
auch qualitative Entwicklungsvorstellungen.<br />
Die bestehenden<br />
Richtpläne zeigen oft nur das Entwicklungspotential<br />
auf, ohne auf<br />
die bestehenden und zu erhaltenden<br />
Qualitäten einzugehen. Zum Zeitpunkt<br />
der Einreichung eines Baugesuchs<br />
ist es für solche Überlegungen<br />
zu spät.<br />
TL Unser Wunsch ist es, frühzeitig<br />
eingebunden zu werden. Wir möchten<br />
die Gemeinden darin bestärken,<br />
sich jetzt mit ihrer Baukultur auseinanderzusetzen<br />
und die Sicht der<br />
Bevölkerung abzuholen und nicht<br />
nur jene der Investoren. Wenn man<br />
den Auftrag für die innere Siedlungsentwicklung<br />
ernst nimmt, muss die<br />
Diskussion vorher geführt werden.<br />
Einzelprojekte kann ein Ortsbild<br />
noch verkraften, aber mit einer Erhöhung<br />
der Verdichtung um 30 %<br />
werden sich Ortsbilder rasch und<br />
unkontrolliert ändern.<br />
HH Die im kantonalen Richtplan<br />
2030 geforderte Siedlungsentwicklung<br />
nach Innen wird sich mit Sicherheit<br />
stark auf die Ortsbilder<br />
auswirken. Dazu kommt, dass die<br />
Akteure in den Verdichtungsprozessen<br />
unberechenbar sind. Es reicht<br />
nicht, dass ein Bauherr mit der Verdichtung<br />
auf seiner Liegenschaft<br />
einverstanden ist. Auch der Nachbar<br />
muss davon überzeugt werden, dass<br />
eine Verdichtung vor seiner Haustür<br />
richtig ist. Die besten Projekte nützen<br />
nichts, wenn es nicht gelingt,<br />
die Einzelinteressen in den Hintergrund<br />
zu rücken. Um konkurrenzfähig<br />
zu sein, wird leider heute bei den<br />
Planungsofferten regelmässig bei<br />
den partizipativen Prozessen abgespeckt.<br />
Die Gemeinden müssen für<br />
partizipative Verfahren sensibilisiert<br />
werden. Oft fehlt bei den Gemeinden<br />
das Verständnis für eine vertiefte<br />
Auseinandersetzung mit der Frage,<br />
wie ein Dorf gewachsen ist und<br />
welche Schlüsse sich daraus für die<br />
zukünftige Weiterentwicklung ableiten<br />
lassen. Ebenso fehlt häufig das<br />
Verständnis für die Auseinandersetzung<br />
mit der Alltags-Baukultur.<br />
Wir kennen und schätzen die schönen<br />
Gebäude und die schönen Landschaften,<br />
beschäftigen uns aber<br />
kaum mit dem Alltäglichen. Es ist<br />
deshalb wichtig, Konzepte zu entwickeln,<br />
die eine gewisse Grundqualität<br />
garantieren. Es gibt Gemeinden,<br />
die in diesem Zusammenhang eine<br />
unabhängige Fachberatung aufgebaut<br />
haben. Das ermöglicht es der<br />
Baukommission, bei Fragen oder<br />
Unsicherheiten eine externe Fachmeinung<br />
abzuholen, die eine neutrale<br />
Sichtweise garantiert. Länge, Breite<br />
und Höhe sind messbare Faktoren,<br />
bei der Beurteilung der Qualität wird<br />
es schwierig.<br />
TL Qualität ist im Plan nicht darstellbar.<br />
Im städtischen Kontext ist<br />
eine Kernzone anders zu beurteilen<br />
als im ländlichen, auch wenn sie<br />
farblich gleich eingefärbt wird. Differenzierte<br />
Sichtweisen und vertiefte<br />
Analysen der örtlichen Gegebenheiten<br />
sind gefragt.<br />
HH Der Kanton muss das Terrain<br />
für eine qualitativ gute Siedlungsentwicklung<br />
nach innen mit überzeugenden<br />
Beispielen vorbereiten. Die<br />
Denkmalpflege ihrerseits muss innerhalb<br />
der kantonalen Verwaltung<br />
mit Nachdruck die qualitative Komponente<br />
in den Planungsprozessen<br />
einfordern. Die wichtigen Elemente<br />
(ISOS, Bauinventar) werden in der<br />
Ortsplanung standardmässig berücksichtigt.<br />
Wer aber setzt sich für<br />
die baukulturellen Werte ein, die<br />
wir beim Prozess der inneren Verdichtung<br />
berücksichtigen müssen?<br />
Wer kümmert sich um bestehende<br />
und neu zu schaffende Raumqualitäten,<br />
um Zusammenhänge, die über<br />
das eigentliche Baudenkmal hinausgehen?<br />
Verdichten birgt immer das<br />
Risiko, dass wir Qualitäten verlieren<br />
und Chancen verpassen, wo wir<br />
neue Qualität schaffen könnten. Die<br />
künftige Rolle der Denkmalpflege ist<br />
in diesem Zusammenhang zentral.<br />
Sie muss sich in diese Richtung weiterentwickeln<br />
und Verantwortung<br />
für einen Bereich übernehmen, für<br />
den sich bisher niemand so richtig<br />
verantwortlich fühlte.<br />
AS Genau, das wäre dann eine Weiterentwicklung<br />
des Ortsbildschutzes,<br />
welcher sich nicht mehr nur auf<br />
einen Perimeter beschränkt, sondern<br />
sowohl inhaltlich als auch räumlich<br />
weiter gefasst wird und allgemeine<br />
städtebauliche Komponenten und<br />
Ortsbildqualitäten mit einschliesst.
32 BERICHTE | RAPPORTS<br />
01<br />
Wiederentdeckte Kulissen im<br />
Theater Langenthal<br />
Der grösste Teil der Kulissen stammt aus der Bauzeit des Theaters (1914–16) und<br />
kann dem bedeutenden Zürcher Theatermaler Albert Isler zugeschrieben werden.<br />
Das Theatergebäude in Langenthal wird umgebaut und<br />
modernisiert. Im Vorfeld der Umbauplanung kamen im Keller<br />
umfangreiche Kulissenbestände zum Vorschein.<br />
Nach dem Auffinden der Kulissen sichtete ein interdisziplinär<br />
zusammengesetztes Team (eine Vertreterin der<br />
Stadt Langenthal, eine Restauratorin, eine Theatermalerin<br />
und Kunsthistorikerin, die zuständige Bauberaterin der<br />
Denkmalpflege und ein Fotograf) diesen Fund und erstellte<br />
ein Inventar. Die Recherchen zu den Kulissen ergaben,<br />
dass diese Entdeckung aufgrund der Menge an Kulissenelementen,<br />
wegen des weitgehend guten Erhaltungszustands<br />
sowie wegen seiner Seltenheit in der Schweiz einzigartig<br />
sein dürfte.<br />
Warum die Bühnenbilder erhalten sind<br />
Das Theater Langenthal wird bis heute als Gastspielbühne<br />
betrieben. Nach Fertigstellung des Theatergebäudes 1916<br />
hatte die Stadt für die unterschiedlichen Fremdinszenierungen<br />
eigene Kulissenbestände anzuschaffen. Dass der<br />
Theatermaler Albert Isler den Grundstock für die erste<br />
Theaterdekoration samt Bühneneinrichtung schuf, ist dank<br />
eines Artikels aus der Schweizerischen Bauzeitung von<br />
1918 belegt.<br />
Die Kulissen wurden in den darauf folgenden Jahrzehnten<br />
repariert, ergänzt und gelagert. Das belegen die in Langenthal<br />
ebenfalls erhaltenen Archivalien. Vorhanden sind<br />
verschiedene Stuben und Salons, die bis in die 1980er<br />
Jahre auch für externe Anlässe ausgeliehen wurden. Daneben<br />
gibt es diverse Dorf- und Stadtansichten wie die abgebildete<br />
Gassenansicht der Altstadt von Bern. Unter den<br />
über vierzig vorhandenen Kulissenelementen sind einzelne<br />
Häuser, Gartenelemente, Bäume und Waldstücke. Besonders<br />
beeindruckend und in einem ausserordentlich guten<br />
Zustand sind die elf Prospekte, die bereits in einem Inven-
BERICHTE | RAPPORTS<br />
33<br />
01 «Stadtfront» (signiert von Atelier Albert Isler).<br />
02 «Kleine Bauernstube» (signiert von Atelier August Ging, Aarau).<br />
03 Schablonierte Signatur des Ateliers Albert Isler.<br />
02 03<br />
tar aus dem Jahr 1938 erwähnt sind und auch in einem<br />
Fotobuch aus dem Jahr 1951 festgehalten wurden. Aufgrund<br />
des Malstils und der vorhandenen Signaturen sind<br />
diese dem Atelier von Albert Isler zuzuordnen. Gemäss den<br />
archivierten Dokumenten lieferte Albert Isler 1920 weitere<br />
Kulissen zur Inszenierung des Glöckleins des Eremiten<br />
(Oper von Aimé Maillart), an der sich auch der Gesangsverein<br />
beteiligte und die ebenfalls bis heute erhalten sind.<br />
Einige von Islers Kulissenwänden bspw. das sogenannte<br />
«moderne Zimmer» oder der «Rokokosalon» wurden in<br />
späteren Jahrzehnten ergänzt bzw. übermalt. In der zweiten<br />
Hälfte der 1930er Jahre wurden wenige zusätzliche Kulissen<br />
bei Maler und Bühnenbildner Edwin Hitz in Bern bestellt.<br />
Andere Bühnenbilder sind mit dem Schriftzug des<br />
Ateliers August Ging, Aarau, versehen. Hierbei dürfte es<br />
sich um übermalte Isler-Kulissen handeln. Verschiedene<br />
neue Kulissen und Reparaturarbeiten übernahm nach 1950<br />
der Theatermaler Fritz Nyffeler aus Lotzwil.<br />
Der Theatermaler Albert Isler (1874–1933)<br />
Albert Isler wurde 1874 in Langnau am Albis geboren, besuchte<br />
zunächst die Zürcher Kunstgewerbeschule und<br />
absolvierte in Karlsruhe und Stuttgart eine Lehre als Dekorationsmaler.<br />
Von 1897 bis 1899 studierte er an der Kunstakademie<br />
in München Malerei. Als junger Akademieabsolvent<br />
betrieb er ab 1900 zusammen mit dem Theatermaler<br />
J. Alexander Soldenhoff das Atelier des Stadttheaters<br />
Zürich und arbeitete zugleich als freier Bühnenbildner.<br />
Schon bald etablierte er sich zu einem der gefragtesten<br />
Theatermaler in der Schweiz. Alle wichtigen, grösseren<br />
Bühnen in Bern und Basel liessen bei ihm ihren Fundus<br />
vervollständigen. Zudem konzipierte er für diverse Kasinobauten<br />
und Mustermessen Kulissen und Ausstattungen.<br />
Gleichzeitig setzte er sich aber auch für eine bessere Ausstattung<br />
von Laien- und Wanderbühnen ein, indem er<br />
einen Leihfundus unterhielt.<br />
Albert Isler hatte um 1906 bereits die Ausstattung des<br />
Theatersaals im Haus zum Wilden Mann in Wynigen und<br />
dessen Theaterkulissen gemalt. 1911 gestaltete er die Bühnenausstattung<br />
für den Neubau des Kasinogebäudes in<br />
Zug, das wie das Theater Langenthal vom Architekturbüro<br />
Keiser und Bracher entworfen wurde. Später kamen weitere<br />
wichtige Aufträge hinzu, wie etwa für die Tellspiele in<br />
Interlaken oder schon 1914 die Dekorationen für die Bühne<br />
des Heimatschutztheaters im Wirtshaus zum Röseligarten<br />
auf der Schweizerischen Landesausstellung in Bern. Ein<br />
besonders umfangreicher Auftrag dürfte 1923/24 die Dekorationen<br />
und Beleuchtung im Altdorfer Tellspielhaus gewesen<br />
sein, das wiederum vom Architekturbüro Keiser und<br />
Bracher geplant wurde.<br />
In seiner Doppelfunktion als Theatermaler und Bühnenbildner<br />
war Isler am Stadttheater Zürich an zahlreichen bedeutenden<br />
Inszenierungen beteiligt, bspw. 1913 an der<br />
Schweizerischen Erstaufführung von Parzifal, welche bis
34 BERICHTE | RAPPORTS<br />
04 «Rieghaus» (signiert von EKO Bern) mit<br />
durchleuchtbarer Butzenscheibe.<br />
05 Prospekt «Waldbogen» mit Beschriftung<br />
«Langenthal» (signiert von Atelier Albert Isler).<br />
06 «Dorf-Prospekt».<br />
04<br />
05
BERICHTE | RAPPORTS<br />
35<br />
06<br />
heute als die wichtigste Wagner-Premiere überhaupt gilt,<br />
die jemals in Zürich aufgeführt wurde. Islers Bühnenbilder<br />
waren avantgardistisch. Er versuchte die modernen künstlerischen<br />
Tendenzen seiner Zeit im Theater umzusetzen<br />
und arbeitete verschiedentlich mit bildenden Künstlern wie<br />
Gustav Gamper, Paul Bodmer oder Reinhold Kündig zusammen.<br />
Dabei lieferte Isler einen relevanten Beitrag hin<br />
zu einer nach allen Seiten offenen, variabel bespielbaren<br />
Raumbühne. Seine Bühnenbilder wurden zunehmend stilistisch<br />
einfacher und gleichzeitig monumentaler. Er beeinflusste<br />
viele Bühnenbildner und setzte Massstäbe mit seinen<br />
Inszenierungen. Isler gehörte zu Lebzeiten zweifellos<br />
zu den bedeutendsten Bühnenbildgestaltern seiner Zeit.<br />
Zur Bedeutung des Kulissenfundes<br />
Das Wiederauffinden des umfangreichen Kulissenbestandes<br />
in Langenthal ist ein Glücksfall und – wie bereits<br />
eingangs erwähnt – schweizweit wohl einzigartig. Dies bestätigte<br />
sich auf Anfrage bei der Schweizerischen Theatersammlung<br />
in Bern sowie an den grossen Häusern in Basel,<br />
Bern und Zürich. Nirgends werden Kulissen 100 Jahre lang<br />
aufbewahrt. Die Kulissen in Langenthal – insbesondere die<br />
des Theatermalers Albert Isler – sind nicht nur ausgesprochen<br />
wirkungsvoll und qualitativ hochwertig gemalt. Sie<br />
sind auch ausgesprochen selten. Sie sollten einer breiteren<br />
Öffentlichkeit bekannt gemacht und erhalten werden.<br />
Die Stadt Langenthal wird aber im umgebauten Theater<br />
keinen Platz mehr dafür haben. Während die Ursprünge<br />
und die Bedeutung der Kulissen nun etwas näher bestimmt<br />
sind, ist die Zukunft dieses kulturhistorisch bedeutenden<br />
«Schatzes» noch offen.<br />
Eva Schäfer<br />
Langenthal, Aarwangenstrasse 8<br />
Massnahmen: Kulissen-Restaurierung, geplant<br />
Bauherrschaft: Stadt Langenthal<br />
Architekten: Gabriela Krummen, Projektleitung Stadt Langenthal<br />
Restauratoren: Birgitta Berndt, Solothurn<br />
Denkmalpflege: Eva Schäfer (Bauberatung), Katja Köhler-Schneider<br />
(historische Recherche)<br />
Literatur, Quellen: Schweizerische Bauzeitung 57/58 (1911), Heft 1 und<br />
71/72 (1918), Heft 23; Werk 18 (1931), Heft 6; Quellenarchiv der Theaterbetriebskommission<br />
1917 bis heute; Schmid, August. Nachruf Albert Isler, in:<br />
Sechstes Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Theaterkultur 1934;<br />
www.sikart.ch; Walküren über Zürich: 150 Jahre Wagner-Aufführungen in<br />
Zürich. Publikation zur Ausstellung vom 24.05. bis 18.08.2013, hrsg. von der<br />
Zürcher Kunstgesellschaft/Kunsthaus Zürich, 2013.
36 BERICHTE | RAPPORTS<br />
01<br />
Massgeschneiderte Zukunft für ein Bauernhaus<br />
in der Agglomeration<br />
Die neue Nutzung erweist sich als Glücksfall für das Bauernhaus Talacker in Thun.<br />
Lange Zeit stand es leer, der Abbruch wurde diskutiert.<br />
Wie sich die Zeiten wandeln: Auf dem «Geometrischen<br />
Plan» von 1791 stand das um 1780 erbaute Bauerngut<br />
Talacker allein in den weiten Feldern. Es handelt sich um<br />
einen der städtischen Urbanisierungshöfe, die nach der<br />
Trockenlegung der grossen Ebene westlich von Thun, nach<br />
dem Kanderdurchstich, entstanden waren. Heute steht es<br />
nicht weniger imposant, ist jedoch von vorstädtischen<br />
Wohnsiedlungen, Einkaufszentren und Verkehrsanlagen<br />
umgeben. Bis Ende des 20. Jahrhunderts wurde das Bauernhaus<br />
landwirtschaftlich genutzt und blieb lange Zeit in<br />
grossen Teilen unverändert. Nach dem Verkauf stand es<br />
leer, eine weitere landwirtschaftliche Nutzung war aufgrund<br />
der sich nähernden städtischen Bebauung ausgeschlossen.<br />
Verschiedene Varianten standen zur Diskussion,<br />
darunter sogar ein Abbruch. Das naheliegende<br />
Einkaufszentrum kam mit seiner unterirdischen Einstellhalle<br />
dem Gebäude bedrohlich nahe. Schliesslich konnte<br />
mit einem Einrichtungsunternehmen ein langjähriger Nutzer<br />
gefunden werden, welcher das grosse Gebäude als<br />
Ganzes belegen wollte.<br />
Umnutzung<br />
Die neue Nutzung erwies sich als Glücksfall für das voluminöse<br />
Gebäude mit grossem Ökonomieteil. Die Bedürfnisse<br />
des Unternehmens konnten in den bestehenden<br />
Strukturen in nahezu idealer Weise untergebracht werden.<br />
Grundrissliche Anpassungen waren dabei kaum nötig. Im<br />
ehemaligen Wohnteil und im angrenzenden Kornspeicherbereich<br />
sah man grosszügige Büroräumlichkeiten vor.<br />
Diese Nutzung hat den Vorteil, dass nur minimale Sanitärräume<br />
nötig waren, eine einfache Küche wurde am originalen<br />
Standort eingerichtet. In der Tenne wurde ein neuer<br />
Eingangs- und Erschliessungsbereich definiert, in den<br />
ehemaligen Stallungen Ateliers, Lager-, Speditions- sowie
BERICHTE | RAPPORTS<br />
37<br />
01 Das restaurierte ehemalige Bauernhaus mit ausgebautem<br />
Ökonomieteil, im Hintergrund das Einkaufszentrum.<br />
02 Der als Ganzes genutzte Dachraum mit eingebauter Galerie und<br />
hinterglasten Seitenwänden.<br />
03 Büronutzung im Salon im Wohnteil mit aufgefrischtem Parkettboden<br />
und originalgetreu rekonstruierten Fenstern.<br />
02 03<br />
Technikräume eingerichtet. Darüber wird der gesamte ausgedehnte<br />
Heu- und Strohlagerraum in seiner ursprünglichen<br />
Grösse als Empfangsbereich, Ausstellungsraum und<br />
Schaulager verwendet. Eine zusätzliche Galerie wurde eingebaut<br />
und die verschiedenen Ebenen mit grosszügigen<br />
Treppen verbunden. Die bestehenden Öffnungen genügten<br />
für die verschiedenen Nutzungen vollauf und wurden<br />
auf heutige Weise verglast, insbesondere waren keine Eingriffe<br />
in die prägende geschlossene Dachfläche nötig.<br />
Restaurierung<br />
Trotz der geeigneten Umnutzung waren aufgrund des Zustandes<br />
und heutiger Komfortansprüche eine umfassende<br />
Gesamtsanierung und Restaurierung nötig. Im Wohnteil<br />
wurden die Parkettböden und Wandtäfer sorgfältig demontiert<br />
und vor einer Isolationsschicht wieder eingebaut.<br />
Die wenigen noch vorhandenen originalen Fenster wurden<br />
aufgefrischt und innen zusätzlich verglast. Die restlichen<br />
Fenster wurden in der ursprünglichen Teilung nachgebaut.<br />
Die Sitzöfen restaurierte man und machte sie wieder funktionstüchtig.<br />
Im Ökonomieteil musste der gesamte Holzbau<br />
gerichtet werden, der Dachstuhl erhielt fehlende Binder<br />
zurück und wurde mit Zugstangen ergänzt. Den<br />
gesamten Dachstuhl dämmte man nicht sichtbar, die seitlichen<br />
Gimwände wurden mit einer Hinterglasung isoliert.<br />
Die bestehenden Stallböden blieben erhalten, im beheizten<br />
Tennenraum wurde die Pflästerung wieder eingebaut.<br />
Baudenkmal mit Zukunft<br />
Die Restaurierung und die Umnutzung des Bauernhauses<br />
kann man angesichts der Umstände als vorbildlich bezeichnen.<br />
Nahezu ohne Strukturveränderungen konnte das<br />
Gebäude mit seinen Interieurs erhalten werden und es<br />
dient heute dem Inneneinrichtungsbetrieb in idealer Weise<br />
als Basis mit einmaliger Adresse. Das historische Gebäude<br />
behält seine zentrale Stellung im Quartier und entwickelt<br />
sich sogar zum Treffpunkt. Die Erhaltung des Baudenkmals<br />
ist langfristig gewährleistet. Über den reinen Denkmalwert<br />
hinaus ist die Erhaltung von historischen Gebäuden<br />
an exponierten oder zentralen Lagen identitätsstiftend.<br />
Stefan Moser<br />
Thun, Talackerstrasse 52<br />
Massnahmen: Gesamtsanierung und Ausbau, 2014/2015<br />
Bauherrschaft: Gschwend AG Gastro-Bau, Thun<br />
Architekten: Gschwend AG Gastro-Bau, Thun<br />
Restauratoren: Roger Tinguely, Steffisburg<br />
Handwerker: Santschi Holzbau GmbH, Uetendorf (Zimmerarbeiten);<br />
Christian Messerli AG, Thun (Steinhauerarbeiten); Jesus Dapena AG,<br />
Interlaken (Putzarbeiten); Chr. Tschanz + Söhne AG, Schwanden (Fenster)<br />
Denkmalpflege: Stefan Moser (Bauberatung), Ester Adeyemi (Archivrecherche)<br />
Unterschutzstellung: Kanton <strong>2016</strong><br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)
38 BERICHTE | RAPPORTS<br />
01<br />
Erhaltung der Originalsubstanz<br />
Die Restaurierung zweier Bogenbrücken über Schluchten im Umkreis von Biel verlangte<br />
nach verschiedenen Lösungsansätzen, um die Originalsubstanz zu erhalten.<br />
Die beiden Brücken gleichen sich: Für die Fussgängerbrücke<br />
in der Taubenlochschlucht und für die Strassenbrücke<br />
über den Twannbach wurden Bogenkonstruktionen gewählt,<br />
die seitlich in den Fels eingespannt sind. Beide zeigen<br />
den rohen Beton, der 80 Jahre lang ohne Renovierung<br />
der Witterung ausgesetzt war und erzählen ihre eigene Geschichte,<br />
die vor 1900 beginnt. Für den Schweizer Brückenbau<br />
sind sie wichtige Zeugen.<br />
Taubenlochbrücke<br />
Im Bauinventar wird die Fussgängerbrücke fälschlicherweise<br />
als eine der ersten Stampfbetonbrücken bezeichnet.<br />
Sie entstand 1889 – nebst einer Steinbogenbrücke und diversen<br />
Stahlpasserellen – durch die Initiative des Schweizer<br />
Alpen Clubs, Sektion Biel, im Rahmen der Erschliessung<br />
der Taubenlochschlucht. Bei der Sanierung 2015<br />
stellte sich heraus, dass sie anfänglich eine reine Stahlkonstruktion<br />
gewesen war. Konstrukteur war der Ingenieur Eugen<br />
Ritter-Egger, der 1875 ein Unternehmen in Biel gründete<br />
und zuvor für die Jurabahnen, später für die<br />
Gotthardlinie gearbeitet hatte. Wohl zur Verstärkung wurde<br />
die Bogenbrücke 1932 mit armiertem Beton ausgegossen,<br />
wobei auch die Wangen dünn überdeckt wurden und somit<br />
eine Betonkonstruktion vortäuschten. Nur auf der Unterseite<br />
sind die alten Stahlprofile noch sichtbar. Rost hatte<br />
diese so stark angegriffen, dass eine Sanierung nicht mehr<br />
möglich war. Der Abbruch der Brücke hoch über der<br />
Schlucht wäre sehr aufwendig gewesen. Auf Anregung der<br />
kantonalen Denkmalpflege und der Regionalgruppe Biel-<br />
Seeland des Berner Heimatschutzes kam das Ingenieurbüro<br />
Aeschbacher & Partner aus Biel schliesslich auf die<br />
Idee, eine Bogenbrücke aus Stahl über die alte Brücke zu<br />
stülpen – was mit Hilfe eines Helikopters auch geschah.<br />
Der Bogen der neuen Brücke erinnert an die darunterlie-
BERICHTE | RAPPORTS<br />
39<br />
01 Die Brücke über die Twannbachschlucht – ein Werk des<br />
berühmten Ingenieurs Robert Maillart – zeigt auch nach der<br />
Sanierung ihren ursprünglichen Charakter.<br />
02 Die Bogenbrücke in der Taubenlochschlucht (anfänglich eine<br />
Stahlkonstruktion) nach dem Ausgiessen mit Beton 1932.<br />
(Foto aus Sammlung Paul Blösch, wohl 1930er Jahre.)<br />
03 Neue Stahlbogenbrücke, Dezember 2015, über die alte<br />
Brücke gestülpt.<br />
02 03<br />
gende historische Stahlbrücke und schützt sie gleichzeitig.<br />
Am 28. September 2015 wurde die Querverbindung vom<br />
Taubenlochweg über die Brücke zum Tierpark Bözingen<br />
nach längerer Sperrung wieder freigegeben.<br />
Twannbachbrücke<br />
Bei der Betonbrücke über die Twannbachschlucht handelt<br />
es sich um ein Werk des weltbekannten Schweizer Ingenieurs<br />
Robert Maillart. Sie wurde 1936 erbaut, um den motorisierten<br />
Zugang zu den Rebbergen zu ermöglichen. Ihr<br />
konstruktives Konzept wurde aber vor 1900 geboren. Robert<br />
Maillart kam 1899 beim Bau der Stauffacherbrücke in<br />
Zürich auf die Idee, Bogen, Seitenwände und Fahrbahnplatte<br />
zu einem monolithischen Hohlkasten aus armiertem<br />
Beton zu verbinden und realisierte dies 1901 in Zuoz. Er<br />
wählte zudem das System des Dreigelenkbogens, um<br />
Spannungen zu vermeiden, und erfand eine verblüffend<br />
einfache Gelenkausbildung in den Auflagern und im Scheitel<br />
durch die Einschnürung des Betons. Da Maillart in Zuoz<br />
kleine Spannungsrisse in den Seitenwänden entdeckte,<br />
öffnete er diese bei den nachfolgenden Brücken zum Auflager<br />
hin. So entstanden die berühmten eleganten Dreigelenkbogenbrücken<br />
Maillarts (bspw. 1930 Salginatobelbrücke,<br />
1932 Rossgrabenbrücke bei Schwarzenburg). Parallel<br />
dazu entwickelte Maillart das noch luftiger wirkende Konzept<br />
des versteiften Stabbogens, das er für Twann vorsah.<br />
Die Behörden wünschten aber geschlossene Seitenwände.<br />
So gleicht die Brücke nun derjenigen aus Zuoz, wirkt aber<br />
eleganter als eine traditionelle Bogenbrücke. Bei der Sanierung<br />
2015 flickte man den Beton sorgfältig. Einige Armierungseisen<br />
lagen zu nahe an der Oberfläche und mussten<br />
nach dem Entrosten mit einer dickeren Mörtelschicht<br />
überdeckt werden. Die vorschriftsgemässe Erhöhung des<br />
Geländers erfolgte detailgetreu, ein neuer Maschendraht<br />
gewährleistet die Sicherheit. Dank der zurückhaltenden<br />
Sanierung gelang es, viel Originalsubstanz zu erhalten, so<br />
dass die Brücke auch in Zukunft als Teil von Maillarts Gesamtwerk<br />
bewundert werden kann.<br />
Robert Walker<br />
Biel, Taubenlochweg N.N.<br />
Massnahmen: Neue Stahlbrücke über alter Brücke, 2013–2015<br />
Bauherrschaft: Einwohnergemeinde Biel<br />
Ingenieure: Aeschbacher & Partner AG, Bauingenieure und Planer, Biel<br />
Handwerker: Belma Metallbau AG, Nidau<br />
Twann-Tüscherz, Twannbachschlucht N.N.<br />
Massnahmen: Instandsetzung, 2012–2015<br />
Bauherrschaft: Gemeinde Twann-Tüscherz<br />
Ingenieure: Aeschbacher & Partner AG, Bauingenieure und Planer, Biel;<br />
Diggelmann + Partner AG, Bauingenieure, Bern<br />
Handwerker: Betosan AG, Bern<br />
Denkmalpflege: Rolf Weber (Bauberatung)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 2015 & 2014<br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM), Landwirtschaftsamt (LANAT/VOL)
40 BERICHTE | RAPPORTS<br />
01<br />
Der Apfelschuss in Gsteig bei Gstaad<br />
Im <strong>Fachwerk</strong> 2015 wurden die einzigartigen Wandmalereien als Entdeckung erwähnt.<br />
Nun können wir von der erfolgreich abgeschlossenen Restaurierung berichten.<br />
Durch die transdisziplinäre Zusammenarbeit von Denkmalpflege,<br />
archäologischem Dienst, dem lokalen Historiker,<br />
dem Restauratorenpaar, den Architekten und der engagierten<br />
Bauherrschaft liessen sich einige Fragen zur Deutung<br />
der Malereien beantworten. Über viele Hintergründe<br />
kann aber weiterhin nur spekuliert werden. Die Wandmalereien<br />
im Sockelgeschoss des bäuerlichen Wohnhauses<br />
in Gsteig waren vor der Restaurierung nur noch als Fragmente<br />
zu erkennen. Da der Raum lange Zeit als Heizungsraum<br />
genutzt wurde, waren die Wände geschwärzt, die<br />
Motive kaum sichtbar.<br />
Nach einer sorgfältigen Reinigungsaktion gelang es den<br />
Restauratoren, die Themenkreise der Darstellungen aufzuschlüsseln.<br />
Der Eingangsbereich führt zusammen mit dem<br />
Gewölbe in einen Garten Eden. Weinranken, Blumen und<br />
Puten leiten in den festlich geschmückten Raum auf der<br />
rechten Seite. Die Eintretenden sehen zu ihrer Linken einen<br />
Chevalier, der durch den Garten schreitet und dem Betrachter<br />
zuprostet. Überraschend deutlich tritt auch das<br />
Bildthema der Wand rechter Hand zutage: In der Bildmitte<br />
erkennt man Küssnacht mit der Gesslerburg, flankiert vom<br />
übergross dargestellten Gessler hoch zu Ross auf der linken<br />
und der Apfelschussszene auf der rechten Seite. Tell<br />
hat die Armbrust angelegt, Sohn Walter steht mit dem<br />
Apfel auf dem Kopf vor einem Baum. Sowohl Tell als auch<br />
Walter scheinen Kleidung in den Urner Standesfarben Gelb<br />
und Schwarz zu tragen. Bei Tell sieht man den demonstrativ<br />
eingesteckten zweiten Pfeil deutlich. Zwischen den beiden<br />
ist als weiteres Detail Gesslers Hut auf einer Stange<br />
zu erkennen. Die Malerei reicht an dieser Wand nicht bis<br />
zum Boden, vermutlich stand hier ehemals eine Sitzbank.<br />
Die Malereien der gegenüberliegenden östlichen Wand<br />
sind am schlechtesten erhalten, über deren Inhalt kann nur<br />
gerätselt werden. Spiralranken mit Weintrauben greifen in
BERICHTE | RAPPORTS<br />
41<br />
01 Apfelschussszene, links<br />
Gessler hoch zu Pferd,<br />
in der Mitte die Burg<br />
Küssnacht und rechts Tell<br />
mit Sohn Walter beim<br />
Apfelschuss.<br />
02 Chevalier, dem Betrachter<br />
zuprostend.<br />
03 Garten Eden mit Weinranken.<br />
02 03<br />
ein nahezu quadratisch schwarz gerahmtes Feld, über dem<br />
die Kreuzinschrift INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum)<br />
zu sehen ist. Der Inhalt dieses Rahmens ist unklar. Von<br />
rechts scheint eine männliche Figur in Rüstung hineinzutreten.<br />
Diese Figur erinnert am ehesten an einen römischen<br />
Soldaten mit Lanze. Auf der linken Bildseite ist die Figur<br />
einer Frau zu erkennen. Da aber keine wirklichen Spuren<br />
für eine Kreuzigungsdarstellung zu finden sind, ist diese Interpretation<br />
spekulativ.<br />
Mittelalterlicher Vorgängerbau<br />
Anhand von vergleichbaren Gemälden und der Gegenüberstellung<br />
der Kleidung können die Malereien stilistisch<br />
in die Mitte des 17. Jahrhunderts datiert werden. Diese Datierung<br />
passt zudem zu den Resultaten der dendrochronologischen<br />
Analyse (Datierungsmethode, bei der die Jahresringe<br />
von Bäumen anhand ihrer unterschiedlichen<br />
Breite einer bestimmten, bekannten Wachstumszeit zugeordnet<br />
werden) des Bauernhauses von 1641.<br />
Die untersuchten Holzbalken des Sockelgeschosses sind<br />
hingegen deutlich älter und können ins späte Mittelalter<br />
zurück datiert werden. Die Zusammensetzung der Mauermörtel<br />
lässt ebenfalls auf das späte Mittelalter schliessen.<br />
In Anbetracht des annährend quadratischen Grundrisses<br />
gehen wir von einem spätmittelalterlichen Vorgängerbau<br />
aus, von diesem ist das heutige Sockelgeschoss noch<br />
erhalten.<br />
Eine Wirtschaft aus dem 17. Jahrhundert?<br />
Nicht eindeutig kann die Frage der ursprünglichen Nutzung<br />
des bemalten Raumes beantwortet werden. Am ehesten<br />
ist von einer Schenke oder einer Sust (Güterumschlagplatz<br />
zur Zeit des Säumerwesens) auszugehen, befindet sich<br />
doch der imposante Bau an den bedeutenden Handelsrouten<br />
über den Sanetschpass und den Col du Pillon. Künftig<br />
wird der Raum nur noch sanft genutzt und an bestimmten<br />
Tagen zugänglich gemacht.<br />
Fabian Schwarz<br />
Gsteig, Müligässli 4<br />
Massnahmen: Restaurierung der Kellermalereien, 2015<br />
Bauherrschaft: Familie Linder, Gsteig b. Gstaad<br />
Architekten: Matthias Trachsel, Blankenburg<br />
Restauratoren: Fischer & Partner AG Restauratoren, Bern<br />
Archivrecherche: Bendicht Hauswirth, Saanen<br />
Denkmalpflege: Fabian Schwarz (Bauberatung); Georges Herzog<br />
(kunsthistorische Recherche)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 2015<br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM); Christian Rubi-Fonds<br />
Literatur, Quellen: Michael Fischer, Fischer & Partner AG Restauratoren,<br />
Raumbuch und Dokumentation, 2014; Bendicht Hauswirth,<br />
Archivrecherche, 2014
42 BERICHTE | RAPPORTS<br />
01<br />
Sous le lierre… une rocaille<br />
Elément courant de l’art des jardins, la rocaille du Schlossberg à La Neuveville<br />
surprend pourtant par sa qualité, sa richesse et son emplacement.<br />
L’initiative de la commission de gestion du Schlossberg a<br />
permis de reconstituer une rocaille intéressante découverte<br />
au nord-est du château dans les premières années<br />
du XXIe siècle. Le parc du château forme par la qualité<br />
des éléments encore en place (suites d’escaliers, pont,<br />
cascade, jeux d’eau, bassins) et son insertion dans l’environnement<br />
naturel et architectural forme un ensemble<br />
unique et hors du commun à l’échelle régionale.<br />
La rocaille du Schlossberg<br />
La rocaille, rappelons-le, est un élément présent dans<br />
l’aménagement des jardins depuis l’Antiquité, mais qui a<br />
retrouvé ses lettres de noblesse à la fin du XIX e siècle. La<br />
rocaille du Schlossberg est constituée d’un rocher existant<br />
sur lequel s’élevait probablement une construction médiévale.<br />
Aucune fouille archéologique n’a cependant permis<br />
de le vérifier. La configuration du rocher et les pierres<br />
soigneusement choisies forment un sentier artificiellement<br />
accidenté qui crée une impression de danger lors du cheminement.<br />
Quelques cuves ont été aménagées pour les<br />
plantations. Elles sont formées de pierres liées par un mortier<br />
imitant la couleur de la pierre naturelle qui facilite<br />
l’intégration dans l’environnement et dissimule l’aspect<br />
construit de l’ensemble. L’emplacement au nord-est du<br />
château n’a certainement pas été choisi au hasard. Le promeneur<br />
qui emprunte le sentier de la rocaille a une vue<br />
plongeante sur la chaîne des Alpes, et ainsi l’impression<br />
de se trouver dans un site escarpé et montagneux.<br />
La redécouverte<br />
Cet aménagement paysager a été redécouvert en 2003<br />
sous le lierre, les lilas, les frênes, les érables et de nombreux<br />
déchets. La plupart des arbres avaient déjà pris possession<br />
des lieux depuis plus de quarante ans et il était ur-
BERICHTE | RAPPORTS<br />
43<br />
01 Vue générale après<br />
rénovation aux couleurs<br />
d'automne.<br />
02 Parfois au loin l'on aperçoit<br />
la chaîne des Alpes.<br />
03 Le sentier, les marches et<br />
les bacs avec les plantations.<br />
02 03<br />
gent de les éliminer pour retrouver le relief et les éléments<br />
artificiels, et restaurer la rocaille. Le défrichage s’est fait à<br />
la main pour éviter d’endommager davantage encore les<br />
éléments de pierre déjà abîmés par les racines des arbres.<br />
La restauration<br />
Les bacs et le sentier ont été restaurés avant les nouvelles<br />
plantations. Les pierres les plus solides des bacs n’ont pas<br />
été enlevées. Celles qui se sont détachées lors des travaux<br />
ont été numérotées, nettoyées, remontées et liées avec un<br />
mortier de trass (tuf volcanique). Entre les différents bacs,<br />
un système de drainage permet une retenue ou une évacuation<br />
de l’eau (en fonction des plantes qui y seront semées).<br />
Le sentier et ses marches, en gravier à l’origine, ont<br />
été refaits avec un mortier à gravier pour assurer une plus<br />
grande solidité. Les travaux de restauration se sont achevés<br />
en été 2006. La structure a été laissée apparente, sans<br />
plantations, pour permettre la stabilisation et le séchage.<br />
Les plantations<br />
Le choix des plantes s’est fait à l’aide d’ouvrages spécialisés<br />
sur les plantes alpines de l’Europe entière. La première<br />
phase a consisté à préparer les différentes terres pour<br />
les bacs. Puis en automne 2007 ont été plantées les fleurs<br />
à bulbe, et au printemps 2008 les plantes vivaces.<br />
Il reste encore de belles surprises<br />
Les travaux de défrichement relativement léger autour du<br />
Schlossberg ont permis de mettre en évidence d’autres<br />
traces de rocailles et de retrouver l’accès qui permettait,<br />
avant la construction de la route cantonale qui conduit au<br />
Plateau de Diesse, de relier le château au jardin romantique<br />
qui se trouve au sud-ouest.<br />
René Koelliker<br />
La Neuveville, Route du château 56<br />
Mesures : Restauration d’une rocaille, 2003 à 2007<br />
Maître d‘ouvrage : Société simple « Château du Schlossberg »,<br />
La Neuveville, Commission de gestion et Canton de Berne<br />
Analyse historique : ars viridis GmbH, Biel/Bienne<br />
Artisans : Daniel Brotschi et Philippe Wyssmann, ars viridis GmbH,<br />
Biel/Bienne<br />
Service des monuments historiques : Olivier Burri et Jürg Schweizer<br />
(conseillers techniques)
44<br />
OBJEKTE | OBJETS<br />
Aktuelle Objekte<br />
Objets actuels<br />
Die diesjährige Sammlung von kürzlich restaurierten<br />
Baudenkmälern führt quer durch den Kanton zu den<br />
unterschiedlichsten Bauten.<br />
Erst das Engagement der Besitzerinnen und Besitzer<br />
sowie der beteiligten Fachleute aus Architektur und<br />
Handwerk zusammen mit der Denkmalpflege macht es<br />
möglich, dass unsere Baudenkmäler langfristig erhalten<br />
werden können. Eine gute Zusammenarbeit zwischen den<br />
Beteiligten führt zu fruchtbaren Lösungen. Die 30 Objekte<br />
illustrieren dies exemplarisch, sie zeigen aber auch<br />
das breite Spektrum der Tätigkeit der Bauberatung und<br />
der sie unterstützenden Bauforschung und Inventarisation.<br />
Die Denkmalpflege kommt damit ihrer gesetzlich<br />
verankerten Berichterstattungspflicht nach. Die Berichterstattung<br />
ist nicht nur Pflicht, sondern ein wichtiges<br />
Mittel zum Dialog mit der Öffentlichkeit und mit den<br />
Partnern und Bauherrschaften.<br />
La collection de monuments historiques fraîchement<br />
restaurés présentée cette année nous emmène aux<br />
quatre coins du canton à la rencontre des bâtiments<br />
les plus divers.<br />
Ce n’est que grâce à l’engagement conjoint des propriétaires,<br />
des professionnels de l’architecture et de l’artisanat<br />
et du Service des monuments historiques que nos<br />
monuments historiques peuvent être conservés à long<br />
terme. D’une collaboration étroite entre l’ensemble des<br />
parties prenantes naissent des solutions fructueuses. Les<br />
30 objets présentés illustrent bien l’importance de cette<br />
collaboration et montrent aussi toute la diversité des activités<br />
de conseil technique du Service des monuments<br />
historiques ainsi que des activités de recherche et de<br />
recensement qui les accompagnent. En présentant ces<br />
monuments, le Service des monuments historiques satisfait<br />
à son obligation légale de rendre compte de son<br />
travail. Cette tâche ne constitue toutefois pas uniquement<br />
un devoir, c’est aussi un important moyen de dialoguer<br />
avec le grand public, avec nos partenaires et avec les<br />
maîtres d’ouvrage.
OBJEKTE | OBJETS<br />
45<br />
KORNHAUS VON 1616/17<br />
Umnutzung: Im Kornhaus wird<br />
Whisky gebrannt<br />
Das ehemalige Kornhaus in Aarwangen<br />
stammt aus dem frühen 17.<br />
Jahrhundert. Es wurde 2013 von der<br />
Gemeinde Aarwangen an einen privaten<br />
Eigentümer verkauft. Dieser<br />
beabsichtigte, seine Whiskybrennerei<br />
in einer historischen Liegenschaft<br />
zu installieren. Nachdem die Umnutzung<br />
bewilligt werden konnte, wurde<br />
im Erdgeschoss des Kornhauses<br />
die eigentliche Brennerei eingerichtet.<br />
Dank der Saalnutzung der Obergeschosse<br />
war es möglich, ungeeignete<br />
jüngere Einbauten zu entfernen.<br />
Die markantesten Veränderungen<br />
sind aber bereits von aussen zu<br />
sehen: Eines der beiden später eingebauten,<br />
nordseitigen Garagentore<br />
konnte geschlossen werden. Aus<br />
Gründen des Brandschutzes wurde<br />
die bereits bestehende Türöffnung<br />
im 1. Obergeschoss wieder mit einer<br />
Aussentreppe erschlossen, die als<br />
abgelöste Betonskulptur konstruiert<br />
wurde. EMS<br />
MEHRFAMILIENHAUS VON 1898/99<br />
Eine Fassade als Visitenkarte<br />
eines Malermeisters<br />
Das Wohnhaus mit zugehörigem<br />
Laden wurde 1898/99 nach Plänen<br />
des Architekten Ed. Hasenfratz im<br />
Auftrag von Conrad Bolliger und<br />
Fr. Grüring erbaut. Der Massivbau<br />
unter Mansarddach zeigt eine im Stil<br />
des Historimus gestaltete Quaifassade<br />
mit reicher Gliederung durch<br />
Gesimse, Wandpfeiler und anspruchsvolle<br />
Fensterrahmungen und<br />
-verdachungen sowie zwei Balkone<br />
mit kunstvollen Schmiedeeisengeländern.<br />
Die schlichte Südostfassade<br />
erhielt bei der Renovierung 2008<br />
eine hellgelbe Fassung und neue<br />
Balkonvorbauten. An der Nordwestfassade<br />
wurden 2014 neben der<br />
Sanierung der Schaufensterfront die<br />
bisher verdeckten Malereien und<br />
Inschriften aus der Bauzeit wieder<br />
ans Licht geholt. Die feinen Malereien<br />
in der Art des Jugendstils waren<br />
einst wirkungsvolle Reklame für das<br />
Malergeschäft des Bauherrn Conrad<br />
Bolliger. PB<br />
MEHRFAMILIENHAUS VON 1932<br />
Das farbige Biel<br />
Das Mehrfamilienhaus präsentiert<br />
sich als markanter Kopfbau einer<br />
fünfteiligen Wohnhauszeile entlang<br />
der Mattenstrasse. Das auf der Basis<br />
eines Gestaltungskonzepts des<br />
Architekturbüros Alfred Leuenberger<br />
1932 von der Baufirma Calori & Corti<br />
erstellte Gebäude ist der bestechenden<br />
Formensprache des Neuen<br />
Bauens verpflichtet. Die an sich<br />
flächige Fassade des turmartigen<br />
Gebäudes wird durch gradlinige<br />
Details wie Balkone und Fensterband<br />
des Treppenhauses belebt. Unter<br />
dem später aufgetragenen kunststoffhaltigen<br />
Verputz wies der Restaurator<br />
einzig an den westseitigen<br />
Balkonen Verputz und Farbspuren<br />
aus der Bauzeit nach. Bei der<br />
Fassadenrenovierung 2014 erhielt<br />
das Gebäude wieder die ursprüngliche<br />
gelblichrote Fassung. In die<br />
Metallrahmen des Treppenhausfensters<br />
setzte man neue Wärmedämmgläser<br />
ein. PB<br />
Aarwangen, Eyhalde 10<br />
Massnahmen: Umnutzung und Innenausbau,<br />
Anbau Treppe, 2014/15<br />
Bauherrschaft: LANGATUN Kornhaus AG<br />
Architekten: Patrick Müller, Gerold Dietrich<br />
Architekturbüro, Lotzwil<br />
Denkmalpflege: Eva Schäfer (Bauberatung)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 1999<br />
Biel, Unterer Quai 90<br />
Massnahmen: Fassadenrestaurierung,<br />
2008/2014<br />
Bauherrschaft: Vital und Alice Epelbaum, Biel,<br />
und Dina Epelbaum, Bern<br />
Architekten: Mäder + Partner, Architekten AG,<br />
Biel (2008); Harttig Architekten GmbH, Biel (2014)<br />
Restauratoren: Blonski Art Restaurationen,<br />
Zollikofen<br />
Handwerker: Hans-Jörg Gerber (Farbuntersuchung),<br />
Nidau, 2008<br />
Denkmalpflege: Rolf Weber (Bauberatung)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 2008<br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)<br />
Biel, Murtenstrasse 59<br />
Massnahmen: Fassadenrenovierung, 2014<br />
Bauherschaft: Nicolas Campana, Aarberg<br />
Restauratoren: Hans-Jörg Gerber, Nidau<br />
(Farbuntersuchung)<br />
Handwerker: Kiefer Roten AG, Lyss<br />
(Malerarbeiten); Glas Nussbaum AG, Aarberg<br />
Denkmalpflege: Rolf Weber (Bauberatung)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 2014<br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)
46<br />
OBJEKTE | OBJETS<br />
KIRCHE MARIA HIMMELFAHRT, 1901/1902<br />
Zurück auf Start<br />
Anlässlich der Restaurierung von<br />
1986 wurden die zuvor weiss gestrichenen<br />
Wände wieder mit Dekorationsmalereien<br />
versehen und die<br />
Sockelmalerei in Grautönen ersetzt.<br />
Die wegen bauphysikalischer Mängel<br />
zunehmende massive Verschmutzung<br />
der Wände führte mit den Jahren<br />
zu einer fast unerträglich tristen<br />
Stimmung im Kirchenraum. Im<br />
Rahmen einer Gesamterneuerung<br />
wurden die Baumängel durch eine<br />
dünne Hochleistungsdämmung an<br />
den Innenwänden eliminiert. Auf<br />
dem neuen Verputz konnte anschliessend<br />
die originale Innendekoration<br />
von 1902 anhand von Farbuntersuchungen,<br />
bauhistorischen<br />
Untersuchungen und alten Fotografien<br />
vollständig und korrekt rekonstruiert<br />
werden. Heute erstrahlt der<br />
Kirchenraum wieder in der üppigen<br />
Formen- und Farbenpracht, wie<br />
sie Architekt Armin Stöcklin 1902<br />
vorgesehen hatte. MG<br />
VILLA SONNEGG VON 1893<br />
Nach 120 Jahren vollendet<br />
Die notwendige Dachsanierung war<br />
der Anlass zu umfassenden Recherchen<br />
zur ursprünglichen Gestaltung<br />
der Villa Sonnegg. Dabei erwiesen<br />
sich die Baupläne von 1893 als<br />
wichtigste Quelle. Es stellte sich<br />
heraus, dass die ursprünglich<br />
vorgesehene reiche Dachgestaltung<br />
nie ausgeführt worden war: Auf die<br />
schmucken Blechverzierungen an<br />
den Dachlukarnen und Firstgraten<br />
hatte man wohl aus Kostengründen<br />
verzichtet. Diese Haltung widerspricht<br />
aber gänzlich den bis heute<br />
hervorragend erhaltenen, äusserst<br />
aufwendigen Innenausstattungen.<br />
2014 wurde nun das Dach gemäss<br />
den alten Plänen wiederhergestellt.<br />
Zudem erhielt die Fassade den<br />
hellen Ockerton aus der Bauzeit<br />
zurück. Die vorbildliche Gesamtsanierung<br />
gelang nicht zuletzt dank<br />
des ausserordentlichen Engagements<br />
der Bauherrschaft. MG<br />
VILLA DE FABRICANT DU XIX E SIÈCLE<br />
Les fenêtres : un élément patrimonial<br />
d'importance<br />
Le patrimoine ancien doit de plus<br />
en plus donner une réponse positive<br />
aux nouvelles normes d’isolation<br />
thermique. Les fenêtres sont au cœur<br />
des préoccupations dans ce domaine<br />
délicat. En 2014, une solution<br />
intéressante a été trouvée dans la<br />
sauvegarde et le remplacement<br />
du fenestrage de cette maison de<br />
maître de la seconde moitié du XIX e<br />
siècle, afin de conserver une lisibilité<br />
architecturale de qualité. Les<br />
fenêtres anciennes de la façade sud<br />
ont été conservées, restaurées et<br />
munies d’un verre isolant. Celles des<br />
façades est, nord et ouest ont été<br />
remplacées par des fenêtres en bois<br />
créées sur le modèle des anciennes<br />
encore en place sur la façade sud.<br />
En plus des fenêtres, d’autres travaux<br />
ont été effectués sur la façade,<br />
avec la restauration des contrevents.<br />
RK<br />
Burgdorf, Friedeggstrasse 10<br />
Massnahmen: Innensanierung, 2014<br />
Bauherrschaft: Römisch Katholische<br />
Kirchgemeinde Burgdorf<br />
Bauleitung: Lilian Schönauer, Bürogemeinschaft<br />
Hohengasse, Burgdorf<br />
Restauratoren: Walter Ochsner, Bern;<br />
Ernst Baumann, Bundesexperte, Bazenheid<br />
(Bauphysikalisches Gutachten)<br />
Denkmalpflege: Michael Gerber, Hanspeter<br />
Ruch (Bauberatung)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 1985<br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)<br />
Burgdorf, Technikumstrasse 6<br />
Massnahmen: Restaurierung Fassade und<br />
Dach, 2014/15<br />
Bauherrschaft: Albertine und Jörg Amport<br />
Historische Untersuchung: Roger Tinguely,<br />
Steffisburg<br />
Denkmalpflege: Michael Gerber (Bauberatung)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 2002<br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)<br />
Courtelary, Grand-Rue 49<br />
Mesures : Restauration et rénovation des<br />
fenêtres, 2014<br />
Maître d‘ouvrage : Liliane Wernli-Langel,<br />
Les Breuleux<br />
Architectes : MBR Architecture SA, St-Imier<br />
Restaurateurs : Roland von Gunten, Renan<br />
Artisans : Surmely, Tramelan et Jérôme<br />
Ganguillet, Cormoret (ferblanterie-couverture ) ;<br />
Fenêtres Bassin SA, Reconvilier<br />
Service des monuments historiques :<br />
Olivier Burri (conseiller technique)<br />
Mise sous protection : Canton 2003<br />
Contributions : Canton (Fonds de loterie/POM)
OBJEKTE | OBJETS<br />
47<br />
SPEICHER AUS DEM 18. JAHRHUNDERT<br />
Schmuckstück des Weilers<br />
Der Weiler Unterberg, auf einer<br />
flachen Hügelkuppe westlich von<br />
Fraubrunnen gelegen, ist eine<br />
intakte, von Obstbäumen umgebene<br />
Hofgruppe mit prächtigen Bauernhöfen<br />
und qualitätsvollen Nebengebäuden.<br />
Der vorzüglich dekorierte<br />
Speicher in der Mitte der Gruppe war<br />
vor seiner Sanierung in schlechtem<br />
Zustand: Das Dach war undicht, der<br />
rückwärtige Gebäudeteil baufällig.<br />
Mit grosser Sorgfalt restaurierte der<br />
Zimmermann, unterstützt vom Bauherrn,<br />
die alten Bauteile, ersetzte das<br />
Holzwerk wo nötig und ergänzte<br />
fehlende Brüstungs- und Deckbretter.<br />
Durch die Entfernung der seitlichen<br />
und rückwärtigen Anbauten<br />
erhielt der Speicher seine ursprüngliche,<br />
elegante Erscheinung zurück.<br />
Er ist wieder das unumstrittene<br />
Schmuckstück der Hofgruppe. BaF<br />
FERME DE 1826<br />
Renaître des cendres<br />
En février 2011, cette ferme a été la<br />
proie d’un incendie qui a entièrement<br />
dévasté la grange, mais épargné une<br />
partie de l’habitation. Les éléments<br />
historiques sauvés des flammes ont<br />
été restaurés lors de la reconstruction.<br />
Il s’agit de deux poêles, du sol<br />
et du plafond de la chambre principale<br />
située au nord. Des boiseries<br />
anciennes ont également été posées<br />
dans cette pièce. Les murs endommagés<br />
par les flammes ont été recrépis<br />
à la chaux afin de redonner<br />
à l’ensemble son aspect d’avant<br />
l’incendie. Les propriétaires ont pris<br />
le parti de ne pas installer de chauffage<br />
central, mais de chauffer la<br />
maison à l’aide des poêles restaurés.<br />
L’architecte en charge du chantier<br />
a réalisé un projet où le plan initial<br />
est respecté et où dialoguent éléments<br />
contemporains et éléments<br />
anciens. RK<br />
BAUERNHAUSHÄLFTE 18. JAHRHUNDERT<br />
Gsteigwiler Schulstube im Bauernhaus<br />
Im Rahmen der Gesamtrenovierung<br />
der rechten Haushälfte wurde die<br />
früher störend veränderte Befensterung<br />
der Hauptfront rückgeführt,<br />
der bestehende Wohnteil restauriert<br />
und der kleine Ökonomieteil für zusätzlichen<br />
Wohnraum ausgebaut. Die<br />
Arbeiten erfolgten mit viel Sorgfalt<br />
und Sinn fürs Detail und grossem<br />
persönlichem Engagement der Bauherrschaft.<br />
Neue Bauteile wie Treppe<br />
und Sanitäreinbauten wurden auf<br />
unspektakuläre Art in zeitgenössischer<br />
Gestaltung ergänzt. Mit besonderer<br />
Umsicht wurde die im<br />
frühen 19. Jahrhundert eingebaute<br />
erste Schulstube von Gsteigwiler<br />
restauriert. Die Täferungen wurden<br />
vorsichtig demontiert, aufgefrischt<br />
und über einer Isolationsschicht<br />
wieder eingebaut. Die ehemalige<br />
Schulstube dient nun in idealer Weise<br />
als grosszügiger, heller Wohnraum.<br />
SMO<br />
Fraubrunnen, Unterberg 2B<br />
Massnahmen: Gesamtsanierung, 2014<br />
Bauherrschaft: Evelyne und Philipp Böhlen<br />
Handwerker: Philipp Böhlen; Andreas Gosteli,<br />
Bolligen/Geristein (Zimmerarbeiten)<br />
Denkmalpflege: Hanspeter Ruch<br />
(Bauberatung)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 2013<br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)<br />
Grandval, Champs des Coeudres 52<br />
Mesures : Reconstruction et restauration après<br />
incendie, 2012<br />
Maître d‘ouvrage : Sylvie et Fabien Charmillot<br />
Architectes : Luc Bron, Delémont<br />
Artisans : Guy Froidevaux, St-Ursanne (constructions)<br />
; A. Hauser SA, Moutier (charpenterie)<br />
; Zbinden-Joye SA, Moutier (ferblanteriecouverture)<br />
Service des monuments historiques :<br />
Olivier Burri (conseiller technique)<br />
Mise sous protection : 1994<br />
Contributions : Canton (Fonds de loterie/POM)<br />
Gsteigwiler, Hobacher 102<br />
Massnahmen: Gesamtrenovierung der rechten<br />
Haushälfte, 2013/14<br />
Bauherrschaft: Edith Biedermann<br />
Handwerker: Zurbuchen Holzbau GmbH,<br />
Goldswil; Albert Blatter Holz- und Treppenbau,<br />
Unterseen<br />
Denkmalpflege: Stefan Moser (Bauberatung)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 2014<br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)
48 OBJEKTE | OBJETS<br />
STÖCKLI VON 1836<br />
Aussenfassade instand gesetzt<br />
Das hinter dem Gasthof Kreuz<br />
etwas versteckt liegende Stöckli aus<br />
dem frühen 19. Jahrhundert war im<br />
Inneren in den letzten Jahren von<br />
der Eigentümerfamilie in Etappen<br />
um- und ausgebaut worden. In einem<br />
weiteren Schritt sollte die äussere<br />
Erscheinung des Gebäudes wiederhergestellt<br />
werden. Nach einer<br />
Befunduntersuchung am Gebäude<br />
wurde das Stöckli wieder in seiner<br />
ursprünglichen Farbigkeit gestrichen.<br />
Da der Eigentümer Baufachmann<br />
ist, legte er nicht nur selbst Hand an,<br />
sondern fungierte auch als engagierter<br />
Koordinator. So wurden nicht<br />
nur gedrechselte Holzsäulen unter<br />
der westseitigen Laube erstellt, auch<br />
die Verwendung einer besonders<br />
guten skandinavischen Leinölfarbe<br />
organisierte er selbst. EMS<br />
WOHNHAUS VON 1894<br />
Detektivische Vorarbeiten für<br />
die «Seehalde»<br />
Das Wohnhaus Seehalde präsentierte<br />
sich vor der Restaurierung ohne<br />
die originalen Zierelemente im zeittypischen<br />
Schweizer Holzstil und mit<br />
einem wenig attraktiven bräunlichen<br />
Anstrich. Als Vorbereitung wurde<br />
in detektivischer Arbeit anhand von<br />
Farbspuren, eines Vergleichsobjektes<br />
in der Nachbarschaft sowie gestützt<br />
auf historische Fotoaufnahmen das<br />
originale Erscheinungsbild eruiert<br />
und detailliert aufgezeichnet. Die<br />
Zierelemente wurden rekonstruiert<br />
und das Haus in den ursprünglichen<br />
bunten Farbtönen gestrichen. Erst<br />
während der Ausführung kam im<br />
Laubenbereich unter einer nachträglichen<br />
Verschalung eine weitere,<br />
aufwendig ausgesägte Brüstung<br />
zum Vorschein, welche lediglich<br />
aufgefrischt werden musste. Auch<br />
die originellen multifunktionalen<br />
Vorfenster mit integrierten Fensterläden<br />
konnten restauriert werden. SMO<br />
INDUSTRIEGEBÄUDE VON 1876<br />
Wohnen neben dem Hochkamin<br />
Wo ursprünglich Schnaps gebrannt<br />
und später jahrzehntelang Presshefe<br />
produziert wurde, kann nun grosszügig<br />
logiert werden. Dafür wurden<br />
die nachträglich teils zugemauerten<br />
Fenster- und Türöffnungen wieder<br />
vollständig geöffnet und rückwärtig<br />
zwei Balkonachsen angefügt. Für<br />
die sorgfältige Aussensanierung des<br />
ursprünglich nicht gefassten Sandsteinbaus<br />
diente der Zustand um<br />
1920, als das Walmdach einseitig<br />
durch einen Giebel geöffnet, das<br />
Kesselhaus beim Hochkamin durch<br />
einen Neubau ersetzt, alle Fenster<br />
der Hauptgeschosse in Metall<br />
erneuert und der Sandstein partiell<br />
verputzt worden war. Damit ist nun<br />
auch noch der letzte und wichtigste<br />
Industriezeuge auf dem ehemaligen<br />
Hefeareal saniert und einer neuen<br />
Nutzung zugeführt worden – unübersehbar<br />
wegen des bereits 2009 fachgerecht<br />
sanierten Hochkamins. IMR<br />
Herzogenbuchsee, Kirchgasse 5<br />
Massnahmen: Aussenrestaurierung, 2013<br />
Bauherrschaft: Familie Wyss Ricklin<br />
Restauratoren: Walter Ochsner, Bern<br />
Denkmalpflege: Eva Schäfer (Bauberatung)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 2014<br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)<br />
Hilterfingen, Dorfstrasse 49<br />
Massnahmen: Restaurierung Gebäudehülle,<br />
2014/15<br />
Bauherrschaft: Hotel Schönbühl AG<br />
Architekten: Seger Architekten AG, Hünibach<br />
Restauratoren: Roger Tinguely, Steffisburg<br />
Historische Untersuchung: Kurt Keller,<br />
Herznach<br />
Handwerker: von Allmen Holzbau GmbH,<br />
Oberhofen; Maler Koller AG, Oberhofen<br />
Denkmalpflege: Stefan Moser (Bauberatung)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 2014<br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)<br />
Hindelbank, Krauchthalstrasse 2<br />
Massnahmen: Sanierung und Umbau, 2014/15<br />
Bauherrschaft: René Lanz, Niederscherli<br />
Architekten: Renato Buzzi, Montavit Bau<br />
GmbH, Bern<br />
Restauratoren: Blonski Art Restaurationen<br />
(Jozef Blonski), Zollikofen<br />
Handwerker: Guggisberg Dachtechnik AG,<br />
Wabern; Kurt Iseli AG, Bern (Steinhauerarbeiten);<br />
MLG, Metall und Planung AG, Bern<br />
Denkmalpflege: Isabella Meili-Rigert<br />
(Bauberatung)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 2009<br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)
OBJEKTE | OBJETS<br />
49<br />
EHEM. ABSONDERUNGSHAUS, UM 1912<br />
Ein Miteinander von Alt und Neu<br />
Im Zuge des Neubaus des Pflegeheims<br />
Sonnegg wurde intensiv<br />
darüber diskutiert, wie das ehemalige<br />
Absonderungshaus weiterhin<br />
genutzt werden kann. Dem Einsatz<br />
der Bauherrschaft und der Architekten<br />
ist es zu verdanken, dass der<br />
lokalgeschichtlich und für die allgemeine<br />
Spitalgeschichte bedeutende<br />
Bau erhalten bleibt, indem sie<br />
das Gebäude geschickt in die neue<br />
Gartengestaltung integriert haben.<br />
Heute dient es als Rückzugsort für<br />
Bewohner/innen des Alters- und<br />
Pflegeheims Sonnegg. Die originalen<br />
Bauteile wurden anlässlich der<br />
Renovierung lediglich stabilisiert.<br />
Im Innern wurden störende jüngere<br />
Einbauten entfernt. Die überzeugende<br />
räumliche Wirkung ist mit den<br />
zweigeschossigen Räumen wiederhergestellt.<br />
Gestützt auf die Farbuntersuchung<br />
durch den Restaurator<br />
ist zudem das bauzeitliche Farbkonzept<br />
wieder sicht- und erlebbar. STZ<br />
EHEM. BAUERNHAUS, UM 1700<br />
Vorbildliche energetische Sanierung<br />
Das «Güetli» auf der Nyffenegg<br />
weist mehrere, deutlich ablesbare<br />
Bauphasen auf: Die steilen Büge des<br />
eindrücklichen Ständerbaus sind<br />
über 300-jährig, die Fassade stammt<br />
von 1838. Das Gut wurde seit den<br />
1940er Jahren nicht mehr bewirtschaftet<br />
und später als Ferienhaus<br />
genutzt. Bevor die neue Besitzerfamilie<br />
einzog, stand es leer und war<br />
in schlechtem Zustand. Der Bauherr<br />
erbrachte die Gesamtsanierung<br />
nahezu in Eigenleistung. In der Tenne<br />
entstand neuer grosszügiger Wohnraum,<br />
die ehemalige Rauchküche<br />
ist nach oben wieder geöffnet. Mit<br />
grosser Sorgfalt wurden die alten<br />
Hölzer geprüft, restauriert und bei<br />
Bedarf ersetzt. Die historische Gestaltung<br />
blieb weitgehend erhalten.<br />
Dank einer neuen inneren Holzkonstruktion<br />
und schlauer Dämmung<br />
ist das Haus energetisch in bestem<br />
Zustand. BaF<br />
HOTEL INTERLAKEN VON 1906<br />
Ein neuer Farbtupfer am Höheweg<br />
in Interlaken<br />
Die Fassade des Hotels Interlaken<br />
war in die Jahre gekommen. Bei der<br />
letzten Fassadenrenovierung wurde<br />
ein Fassadenputz in Altrosa mit<br />
Ecklisenen, Holzfassungen und<br />
Jalousien in Grau gewählt. Sondierungsarbeiten<br />
durch den Restaurator<br />
sowie alte Fotos liessen auf eine<br />
ganz andere bauzeitliche Farbgebung<br />
schliessen: heller Putz, hellgraue<br />
Fenstereinfassungen und Ecklisenen,<br />
grüne Jalousien mit bunten Fenstern.<br />
Die Bauherrschaft liess sich vom<br />
ursprünglichen Konzept überzeugen.<br />
Damit sich das Hotel vom Schloss<br />
abhebt, wurden die Fensterläden in<br />
einem helleren Grünton und die<br />
Fensterrahmen in Ockerrot gestrichen,<br />
was die Ergänzung mit<br />
aussenliegenden Sprossen bedingte.<br />
Gleichzeitig mit der Fassadenrestaurierung<br />
wurden auch die Absturzsicherungen<br />
der Balkone ergänzt<br />
und das Wappenrelief am Turm auf<br />
der Südseite aufgefrischt. RHA<br />
Huttwil, Hohlenstrasse 4d<br />
Massnahmen: Renovierung und Wiederherstellung,<br />
2014<br />
Bauherrschaft: Stiftung Sonnegg Huttwil<br />
Architekten: A. Furrer und Partner, Bern<br />
Restauratoren: Walter Ochsner, Bern<br />
Handwerker: Habisreutinger Gebäudehülle<br />
GmbH, Huttwil; Burkhalter Malerei, Huttwil;<br />
Tolusso AG Stein-Industrie, Willisau; Peter Lüthi<br />
Holzhandwerk, Schwarzenbach<br />
Denkmalpflege: Stephan Zahno (Bauberatung)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 2014<br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)<br />
Huttwil, Nyffenegg 13<br />
Massnahmen: Gesamtsanierung, 2010–2013<br />
Bauherrschaft: Ruth Leuenberger und<br />
Beat Berger<br />
Handwerker: Beat Berger; Dubach Holzbau<br />
AG, Hüswil; Sägesser Fenster AG, Aarwangen<br />
Denkmalpflege: Hanspeter Ruch<br />
(Bauberatung)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 2010<br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)<br />
Interlaken, Höheweg 74<br />
Massnahmen: Fassadenrestaurierung, 2015<br />
Bauherrschaft: Hotel Interlaken AG<br />
Architekten: ateliermarti architekten ag,<br />
unterseen<br />
Restauratoren: Roger Tinguely, Steffisburg<br />
Handwerker: Jesus Dapena AG, Interlaken;<br />
Frutiger Holzbau AG, Ringgenberg (Fenster);<br />
Peter Rüegsegger AG, Interlaken; Dällenbach +<br />
Co. AG, Interlaken (Malerarbeiten)<br />
Denkmalpflege: Renate Haueter (Bauberatung)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 2015<br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)
50 OBJEKTE | OBJETS<br />
SCHULHAUS VON 1955<br />
Annäherung statt Kontrast<br />
FABRIKGEBÄUDE VON 1888<br />
«Nachgerüstete» Fenster<br />
WOHNSTOCK VON 1788<br />
Altes Amtshaus – aufgefrischt<br />
Nach sechzig Jahren im täglichen<br />
Gebrauch standen für die Schulanlage<br />
Wandermatte eine Ertüchtigung,<br />
eine energetische Sanierung sowie<br />
Umstrukturierungen für eine zeitgemässe<br />
Schulnutzung an. Um eine<br />
überzeugende Gesamtlösung zu<br />
erreichen, wurde 2011 ein offener<br />
Wettbewerb ausgelobt, bei dem das<br />
Projekt von Bienert Kintat aus Zürich<br />
mit dem 1. Rang prämiert wurde.<br />
Das Projekt und die Realisierung<br />
zeichnen sich durch zurückhaltende<br />
und präzise gestaltete Eingriffe im<br />
Innen- und Aussenraum aus, welche<br />
die Annäherung statt den Kontrast<br />
zum Bestehenden suchen. Die Abtrennungen<br />
der Gruppenräume<br />
orientieren sich bspw. am Bestand<br />
und der neu eingebaute Lift ist kaum<br />
erkennbar und fügt sich selbstverständlich<br />
in den Korridor. Diese Eingriffsstrategie<br />
verstärkt den ursprünglichen<br />
Charakter der Anlage<br />
und ein harmonisches Ganzes ist<br />
entstanden. FAS<br />
Gleich bei zwei Liegenschaften in<br />
Langenthal gelang es in den vergangenen<br />
Jahren Fenster nachzurüsten,<br />
ohne die bauzeitlichen Fenster vollständig<br />
ersetzen und die Gestaltung<br />
der Aussenfassade verändern zu<br />
müssen. Zum einen betrifft dies das<br />
«Nyffelerhaus» am Wuhrplatz, das<br />
ursprünglich als Tabak- und Kaffeeersatzfabrik<br />
errichtet wurde. Dort<br />
konnten die äusseren Vorfenster<br />
detailgetreu ersetzt werden, während<br />
die Innenfenster beibehalten werden<br />
konnten, sodass diese die Fassaden<br />
des ehemaligen Fabrik- und heutigen<br />
Wohnhauses nach wie vor prägen.<br />
Zum andern ist dies auch beim reformierten<br />
Kirchengemeindehaus<br />
gelungen, das aus den 1950er Jahren<br />
von Architekt Hans Müller aus<br />
Burgdorf stammt und das auf der<br />
Südseite grossflächige Fenster<br />
aufweist. Im Zuge der Gesamtsanierung<br />
konnten diese Fenster von<br />
einem Schreiner mit IV-Scheiben<br />
nachgerüstet werden. EMS<br />
1788 lassen Vater und Sohn Niklaus<br />
Joost, Löwenwirte, Textilhändler<br />
und Baumwollfabrikanten in Langnau,<br />
diesen ausgezeichneten Vertreter<br />
eines repräsentativen grossgewerblichen<br />
Wohnstocks erbauen.<br />
In grösseren Dörfern entstehen<br />
zwischen 1780 und 1830 Wohn- und<br />
Gewerbehäuser im Stil und Dekor<br />
patrizischer Landsitze. Diese werden<br />
von einflussreichen und begüterten<br />
Wirten, Gerbern, Müllern, Tuch- und<br />
Käseherren in Auftrag gegeben.<br />
Von 1803 bis 1817 ist der Stock Sitz<br />
des neu geschaffenen Oberamtes<br />
Signau, von daher auch die Bezeichnung<br />
«Altes Amtshaus». Mit der<br />
Erneuerung der Dachhaut, der Neueinkleidung<br />
der Lukarnen, der Bereinigung<br />
der Kamine und dem Neuanstrich<br />
der Fassaden wurde die<br />
Gebäudehülle in einen neuwertigen<br />
Stand versetzt. Das Gebäude dient<br />
heute als Wohnhaus und Bäckerei.<br />
DOP<br />
Köniz, Wabern, Eichholzstrasse 29<br />
Massnahmen: Sanierung und Ertüchtigung<br />
Schulanlage, 2013–2015<br />
Bauherrschaft: Gemeinde Köniz<br />
Architekten: Bienert Kintat Architekten, Zürich<br />
Denkmalpflege: Fabian Schwarz<br />
(Bauberatung)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 2015<br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)<br />
Langenthal, Wuhrplatz 1 und<br />
Melchnaustrasse 9<br />
Massnahmen: Neue Vorfenster, 2013/14<br />
Bauherrschaft: Eigentümergemeinschaft<br />
Wuhrplatz 1, Reformierte Kirchgemeinde<br />
Langenthal<br />
Handwerker: studer holz raum werk gmbh,<br />
Utzenstorf<br />
Denkmalpflege: Eva Schäfer (Bauberatung)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 2007<br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)<br />
Langnau, Bernstrasse 12<br />
Massnahmen: Dach- und Fassadenrestaurierung,<br />
2013<br />
Bauherrschaft: Johann Eichenberger<br />
Architekten: ATS-Architektur GmbH, Anne<br />
Tritten, Langnau<br />
Restauratoren: Walter Ochsner, Bern<br />
Handwerker: Stettler Polybau AG, Eggiwil<br />
(Dachdecker- und Spenglerarbeiten), Bigler<br />
Maler und Gipser AG, Langnau<br />
Denkmalpflege: Dominique Plüss<br />
(Bauberatung)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 1987<br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)
OBJEKTE | OBJETS<br />
51<br />
STÖCKLI VON 1866<br />
Minergie im Speicherstöckli<br />
REFORMIERTE KIRCHE VON 1709<br />
Vorbild Berner Münsterchor?<br />
SALLE DE SPECTACLE DE 1951/52<br />
Pour que la fête continue<br />
Die vorgefundene Grundrisseinteilung<br />
sowie die Kornkästen im Obergeschoss<br />
des solide gearbeiteten<br />
Holzständerbaus von 1866 deuten<br />
darauf hin, dass das Gebäude,<br />
zumindest zeitweise, gleichzeitig als<br />
Wohn- und Vorratsraum, als sogenanntes<br />
Speicherstöckli genutzt<br />
wurde. Auf der Anhöhe, hinter<br />
Bauernhaus (datiert um 1750) und<br />
Stöckli, steht die dem Ort namensgebende<br />
«Hochwacht», das ehemalige<br />
Wachthaus, von wo aus die<br />
Einwohner bis Anfang des 19.<br />
Jahrhunderts mit Höhenfeuern vor<br />
Überfällen und Feuersbrünsten<br />
gewarnt wurden. Das Stöckli wurde<br />
mit grosser Sorgfalt, Detailtreue<br />
und Eigenleistung der Bauherrschaft<br />
so saniert, dass es (mit entsprechenden<br />
inneren Dämmschichten, kontrollierter<br />
Lüftung und Anlage für<br />
erneuerbare Energien) nebst dem<br />
üblichen Wohnkomfort heute auch<br />
den Minergie-Standard erfüllt. DOP<br />
1907 zog der damalige Münsterbaumeister<br />
Karl Indermühle im Chor<br />
der Pfarrkirche Münsingen eine<br />
Stuckdecke mit Kreuzgratgewölbe<br />
ein. Die Schlusssteine erhielten<br />
farbige Evangelistensymbole, die<br />
Gewölbeflächen Frucht- und Pflanzenranken<br />
über Goldfriesen, alles<br />
auf tiefblauem Grund. Während das<br />
Farbkonzept zeittypisch war, erinnerten<br />
die Ornamente stark an die Gewölbeausmalung<br />
des Berner Münsterchors.<br />
Später verschwand die<br />
ganze Farbigkeit dieser Scheinarchitektur<br />
unter einer weissen Übertünchung,<br />
so dass das Kreuzgratgewölbe<br />
ohne die gliedernde Malerei<br />
künstlich und verloren erschien. Im<br />
Rahmen der Modernisierungsarbeiten<br />
von 2015 im Innern der Kirche<br />
wurde im Chor der Zustand von 1907<br />
wieder hergestellt. Damit wirkt hier<br />
nun erneut die alte Einheit von Raum<br />
und spektakulärer Farbigkeit. MG<br />
Cette salle de spectacles construite<br />
en 1951-1952 est une réalisation<br />
intéressante de l’architecte Otto<br />
Brechbühl (1889–1984). La rénovation<br />
du bâtiment a fait suite à un<br />
incendie survenu en 1990. De cette<br />
architecture résolument contemporaine<br />
au moment de sa construction<br />
ont été conservées la structure<br />
en béton et les baies groupées qui<br />
soulignent la verticalité du bâtiment<br />
et lui assurent un éclairage généreux.<br />
Le propriétaire a décidé de<br />
changer les fenêtres des façades<br />
sud et nord. Une analyse des<br />
couleurs a permis de restituer la<br />
polychromie des années 1950.<br />
Les fenêtres ont été reconstruites<br />
avec des profils multicolores. RK<br />
Langnau, Hochwacht 170a<br />
Massnahmen: Gesamtsanierung, Aus- und<br />
Umbau, 2013/14<br />
Bauherrschaft: Anita und Roy Bachmann<br />
Architekten: Roy Bachmann, Langnau<br />
Handwerker: Enz Holzbau GmbH, Huttwil;<br />
Elektro Liechti AG, Langnau; Wenger Fenster<br />
AG, Wimmis<br />
Denkmalpflege: Dominique Plüss<br />
(Bauberatung)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 2012<br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)<br />
Münsingen, Bernstrasse 23<br />
Massnahmen: Innenrenovierung, 2014/15<br />
Bauherrschaft: Reformierte Kirchgemeinde<br />
Münsingen<br />
Architekten: Gassner & Leuenberger<br />
Architekten, Thun<br />
Restauratoren: Fischer & Partner AG<br />
Restauratoren, Bern<br />
Handwerker: Farbwerk Herren AG, Münsingen<br />
Denkmalpflege: Michael Gerber, Hanspeter<br />
Ruch (Bauberatung)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 2006<br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)<br />
Saint-Imier, Rue des Jonchères 64<br />
Mesures : Changement des fenêtres, 2014<br />
Maître d‘ouvrage : Commune de Saint-Imier<br />
Restaurateurs : Roland von Gunten, Renan<br />
Artisans : J.-P. Gerber, menuiserie, Saint-Imier<br />
Service des monuments historiques :<br />
Laurie Lehmann (conseillère technique)<br />
Mise sous protection : Canton 2014<br />
Contributions : Canton (Fonds de loterie/POM)
52 OBJEKTE | OBJETS<br />
EHEM. KEGELBAHN AUS DEM 19. JH.<br />
Filigraner Ständerbau<br />
Die ehemalige Kegelbahn mit<br />
Anklängen an den Schweizer Holzstil<br />
vervollständigt die gastronomisch<br />
geprägte Baugruppe Regenhaldenstrasse<br />
mit dem ehemaligen Gasthof<br />
Regenhalde von 1888 (Haus Nr. 35)<br />
und der Liqueur-Fabrik von 1890<br />
(Haus Nr. 36). Der filigran wirkende<br />
Ständerbau mit den beiden Pyramidendächern<br />
und dem dazwischen<br />
liegenden Satteldach ist ein rar gewordener<br />
Vertreter seiner Baugattung.<br />
Die für das Kegelspiel benötigten<br />
Einrichtungen wie Abstossplatz,<br />
Kegelbahn und Kegelhaus sind nicht<br />
mehr vorhanden. Umso erfreulicher<br />
ist es, dass mit viel Enthusiasmus,<br />
Eigenleistung, Einfühlungsvermögen<br />
und Liebe zum Detail die neuen<br />
Eigentümer den Bau restauriert<br />
haben. Dank dieses aussergewöhnlichen<br />
Engagements und der einvernehmlichen<br />
Zusammenarbeit aller<br />
Beteiligten bleibt dieser Zeitzeuge für<br />
künftige Generationen erhalten. STZ<br />
PFERDEREGIEANSTALT VON 1890/92<br />
Neue Nutzung in der Pferderegieanstalt<br />
Steffisburg<br />
Die eidgenössische Pferderegieanstalt,<br />
erstellt von 1890 bis1892, in<br />
Steffisburg, ursprünglich für bis zu<br />
600 Pferde gebaut und zwischenzeitlich<br />
als Armeemotorfahrzeugpark<br />
AMP für fast ebenso viele Militärfahrzeuge<br />
dienend, konnte einer neuen<br />
Nutzung zugeführt werden. Die<br />
schweizweit einzigartige Anlage<br />
dient nun als «Schau»-lager für historisches<br />
Armeematerial. Die hierzu<br />
notwendigen Eingriffe und Einbauten<br />
wurden allesamt reversibel (d.h., sie<br />
können ohne Beschädigung der<br />
Originalsubstanz wieder rückgängig<br />
gemacht werden) ausgeführt. Die<br />
Oberflächen der Stallungen blieben<br />
mit ihren jahrzehntealten Gebrauchsspuren<br />
erhalten. Die wertvollen<br />
Wandbilder der Reithalle hingegen<br />
wurden fachgerecht und sorgfältig<br />
restauriert. FAS<br />
BRUNNEN VON 1904<br />
Seltene patentierte Mechanik ist<br />
wieder in Betrieb<br />
Während der Restaurierung der<br />
malerischen Fabrikantenvilla im<br />
Montlig wunderte sich der Bauberater<br />
der Denkmalpflege über den<br />
kuriosen Brunnen in ihrem Garten.<br />
Es stellte sich heraus, dass der ovale<br />
Aufbau über dem Tuffbrunnen mit<br />
einer seltenen Mechanik ausgestattet<br />
ist, dem patentierten System<br />
der französischen Firma L. Jonet &<br />
Cie in Raismes, Département Nord,<br />
für einen «élévateur d’eau». Über<br />
eine handbetriebene Kurbelmechanik<br />
wird das Wasser in zwei Eimern<br />
gefördert und in das Brunnenbecken<br />
entleert. Eimer und Mechanik waren<br />
stark verrostet. Einen Metallbauspezialisten<br />
zu finden war nun die<br />
grosse Herausforderung. Dies<br />
gelang: Der Fachmann reinigte und<br />
restaurierte die Metallteile sorgfältig<br />
und setzte die Mechanik neu zusammen.<br />
Der Brunnen funktioniert<br />
wieder einwandfrei. BaF<br />
Seeberg, Regenhaldenstrasse 35b<br />
Massnahmen: Restaurierung ehemalige Kegelbahn,<br />
2013/14<br />
Bauherrschaft: Stephanie Stotz und<br />
Andrew Simons<br />
Handwerker: Andrew Simons (Projektleitung<br />
und Zimmerarbeiten); Hannes Pulfer, Burgdorf<br />
(Schreinereiarbeiten); Erich Gygax, Seeberg<br />
(Spenglerarbeiten); Jörg GmbH, Bedachungen<br />
und Fassaden, Grasswil<br />
Denkmalpflege: Stephan Zahno (Bauberatung)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 2013<br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)<br />
Steffisburg, Motorparkstrasse Nr. 103/104<br />
Massnahmen: Umnutzung, 2015<br />
Bauherrschaft: armasuisse Immobilien, Bern<br />
Architekten: Gähler und Partner AG,<br />
Ennetbaden<br />
Denkmalpflege: Fabian Schwarz<br />
(Bauberatung Kanton), Daniel Külling (KOMZ<br />
Denkmalschutz VBS)<br />
Täuffelen, Montligstrasse N.N.<br />
Massnahmen: Restaurierung der Brunnenmechanik<br />
und des Trogs, 2014/2015<br />
Bauherrschaft: Hélène Sironi und Lukas Weiss<br />
Handwerker: metal Carlo von Ballmoos, Biel/<br />
Bienne; Heinz Lehmann, Steinbildhauer,<br />
Leuzigen<br />
Denkmalpflege: Rolf Weber (Bauberatung)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 2015<br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)
OBJEKTE | OBJETS<br />
53<br />
WOHNHAUS UND GARAGE VON 1907/1932<br />
Ungleiches Paar am Thuner<br />
Aarebecken<br />
Bei der Gesamtsanierung der<br />
chaletartigen «Villa Choisy» wurden<br />
im Inneren in aufwendiger Arbeit<br />
die erhaltenen Täferungen und Parkettböden<br />
der Wohnräume restauriert.<br />
Die qualitätsvollen, geschwungenen<br />
und differenziert sprossierten<br />
originalen Fenster wurden restauriert,<br />
jene gegen die lärmbelastete Hofstettenstrasse<br />
hin detailgetreu ersetzt.<br />
Die Farbzier am gut erhaltenen<br />
Holzwerk wurde aufgefrischt. Als<br />
eigentliche Trouvaille erwies sich das<br />
originelle Garagengebäude von 1932,<br />
welches zusätzlich einen Wintergarten-<br />
und Atelierbereich mit Spindeltreppe<br />
aufweist. Auch dieses grau<br />
gefasste Nebengebäude in Massivbauweise<br />
wurde originalgetreu<br />
restauriert, Tore und Fenster aufgefrischt.<br />
Die beiden ungleichen<br />
Gebäude bilden trotz ihrer völlig<br />
verschiedenen Baustile ein harmonisches<br />
Paar. SMO<br />
FABRIQUE D’HORLOGERIE DE 1923<br />
Et elles basculent toujours<br />
Cette ancienne fabrique d’horlogerie<br />
construite vers 1923 a été transformée<br />
en appartement-atelier afin de<br />
redonner une nouvelle vie à un objet<br />
intéressant du patrimoine architectural.<br />
Le remplacement des fenêtres<br />
a fait l’objet d’une réflexion approfondie.<br />
Les anciennes fenêtres<br />
basculantes ne répondant plus aux<br />
normes d’isolation thermique, la<br />
propriétaire a souhaité les remplacer.<br />
Après de nombreuses discussions,<br />
une solution a été trouvée. Les<br />
fenêtres à bascule ont été remplacées<br />
par de nouvelles, identiques,<br />
sans possibilité toutefois d’insérer un<br />
store entre deux verres comme<br />
c’était le cas dans les anciennes.<br />
A ce détail près, le travail de remplacement<br />
a tenu ses promesses et<br />
les nouvelles fenêtres à bascule en<br />
bois ont pu être posées. RK<br />
SPEICHER AUS DEM 17. JAHRHUNDERT<br />
Imposanter Speicher mit Malereien<br />
instand gesetzt<br />
Der grosse, teilweise massive Speicher<br />
stammt mit seinem gemauerten<br />
Kern aus dem 17. Jahrhundert. Der<br />
Holzaufbau muss im späten 18.<br />
Jahrhundert aufgesetzt worden sein.<br />
Der zum Gehöft Hofen 116 gehörende,<br />
gut gelegene Speicher hatte<br />
ein defektes Dach. Der hangseitige<br />
Laubenteil hatte wegen eines Holzschopfanbaus<br />
statische Schäden<br />
erlitten. Diese Defekte mussten behoben<br />
werden. Im Zuge dieser<br />
Massnahmen wurde auch der später<br />
angebaute Hühnerstall entfernt und<br />
der Putz des gemauerten Erdgeschosses<br />
restauriert. Die nur noch<br />
fragmentarisch erhaltenen Kugelfriesmalereien<br />
aus der Bauzeit<br />
wurden gesichert und konserviert.<br />
Die reibungslose Zusammenarbeit<br />
der Eigentümerschaft mit der Denkmalpflege,<br />
den beteiligten Handwerkern<br />
und Restauratoren basierte<br />
auf der Sympathie für dieses ungewöhnliche<br />
Speichergebäude. EMS<br />
Thun, Hofstettenstrasse 16 + 16b<br />
Massnahmen: Restaurierung Wohnhaus und<br />
Garagengebäude, 2013/14<br />
Bauherrschaft: Katharina und Erich<br />
Zimmermann, Gümligen<br />
Architekten: beat huss gmbh architektur +<br />
planung, Thun<br />
Restauratoren: Roger Tinguely, Steffisburg<br />
Handwerker: Pulfer Maler + Gipser AG, Thun;<br />
Brenzikofer Holzbau AG, Wichtrach; Fritz Hänni,<br />
Schreinerei, Belpberg<br />
Denkmalpflege: Stefan Moser (Bauberatung)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 2014<br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)<br />
Tramelan, Rue des prés 6<br />
Mesures : Remplacement des fenêtres,<br />
2012–2014<br />
Maître d‘ouvrage : Esther-Lisette Ganz<br />
Architectes : JDF. raum und kunst, Bienne<br />
Artisans : Gallina-Lus SA, menuiserie, Péry<br />
Service des monuments historiques :<br />
Olivier Burri (conseiller technique)<br />
Mise sous protection : Canton 2013<br />
Contributions : Canton (Fonds de loterie/POM)<br />
Ursenbach, Hofen 116a<br />
Massnahmen: Aussenrestaurierung, 2014/15<br />
Bauherrschaft: Monika und Andreas Bernhard<br />
Restauratoren: Fischer und Partner AG<br />
Restauratoren, Bern<br />
Handwerker: P. Graf AG, Bedachungen und<br />
Fassaden, Ursenbach/Madiswil; ZAHO Zaugg +<br />
Co, Zimmerei/Holzbau, Ursenbach<br />
Denkmalpflege: Eva Schäfer (Bauberatung)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 2014<br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)
54 OBJEKTE | OBJETS<br />
KIRCHE URTENEN VON 1966–1968<br />
Meisterliche Lösung für den Chor<br />
WASSERRAD- UND PUMPENHAUS, 19. JH.<br />
Kein Trinkwasser<br />
STÖCKLI VON 1817<br />
Fast zerfallen – nun wieder bewohnt<br />
Der frei komponierte Sichtbetonbau<br />
des Architekten Edwin Rausser<br />
wirkt auf der höchsten Erhebung von<br />
Urtenen wie eine Skulptur. Beton,<br />
Klinker, Holz und Glas prägen die<br />
Stimmung des Kirchenraums. Für die<br />
zeitgemässe Nutzung wünschte<br />
sich die Kirchgemeinde insbesondere<br />
eine praktischere Konzeption<br />
des leicht ansteigenden Chors. Der<br />
Architekt fand mit einem multifunktionalen<br />
Podest eine meisterliche<br />
Lösung: Das Holzmöbel ist stufenartig<br />
für Chor- wie auch als flache<br />
Ebene für Theateraufführungen nutzbar.<br />
Den zentralen Gottesdienstort<br />
unter monumentalem Leuchter<br />
rahmen die originale Kanzel und ein<br />
neuer, verschiebbarer Abendmahlstisch.<br />
Seine einmalige Atmosphäre<br />
verdankt der Kirchenraum dem<br />
sorgfältigen Umgang mit alten und<br />
neuen Elementen und einer ausgeklügelten<br />
Lichtanlage. BaF<br />
Wer wachen Auges durch Utzenstorf<br />
streift, findet an mehreren Orten<br />
über dem Bachlauf kleine steinerne<br />
Häuschen; eines davon, gemauert<br />
aus grossen Jurasteinquadern, steht<br />
gleich vis-à-vis des Gasthofs Bären.<br />
Dank dem lokalen Verein Radwerk<br />
Landshut ist heute wieder für jedermann<br />
augenfällig, wozu es einst gedient<br />
hatte; es hat sein Innenleben<br />
in Form eines aus Eisen und Holz<br />
gebauten Wasser- und eines Schöpfrades<br />
zurückerhalten. Aufgrund der<br />
heute geringen Wassermenge im<br />
Dorfbach wird das Rad zwar nicht<br />
mehr zur Energiegewinnung genutzt,<br />
aber das Schöpfrad füllt wieder<br />
ein Brunnenbecken, das so selbstverständlich<br />
an der Hausmauer steht,<br />
als wäre es schon immer da gewesen<br />
– nur trinkbar ist das Wasser<br />
leider nicht. IMR<br />
Das einzigartige Stöckli besteht aus<br />
einem Wohngeschoss in Riegbauweise<br />
über einem massiven, ehemals<br />
verputzten Erdgeschoss. Der Bau<br />
besticht durch seine qualitätsvollen<br />
spätbarocken Elemente und durch<br />
die grösstenteils erhaltene originale<br />
Bausubstanz. Das Stöckli präsentierte<br />
sich vor der Renovierung in<br />
einem sehr schlechten Zustand.<br />
Es war längere Zeit unbewohnt und<br />
verlotterte zusehends. Nur durch<br />
den aussergewöhnlichen Einsatz<br />
der Bauherrschaft – von der Denkmalpflege<br />
nach Kräften unterstützt –<br />
gelang es, einen Grossteil der<br />
historischen Substanz zu erhalten<br />
und diesen bedeutenden Bau zu<br />
retten. Das Gebäude wurde sorgfältig<br />
renoviert und an die heutigen<br />
Wohnbedürfnisse angepasst. Heute<br />
dient es wieder als Stöckli, als<br />
sogenannter Altenteil. STZ<br />
Urtenen-Schönbühl, Friedhofweg 9<br />
Massnahmen: Gesamtsanierung, 2010–2012<br />
Bauherrschaft: Reformierte Kirchgemeinde<br />
Jegenstorf Urtenen<br />
Architekten: Architekturbüro Patrick Thurston,<br />
Bern<br />
Handwerker: Indermühle Bauingenieure, Thun;<br />
David Normann, Ipsach (Akustik- und<br />
Audioplanung); Amstein + Walthert AG, Zürich<br />
(Lichtgestaltung & Bauphysik)<br />
Denkmalpflege: Hanspeter Ruch<br />
(Bauberatung)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 2014<br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)<br />
Utzenstorf, Hauptstrasse 21b<br />
Massnahmen: Sanierung Wasserrad und<br />
Schöpfrad, 2014/15<br />
Bauherrschaft: Verein Radwerk Landshut,<br />
Eigentümer: Johannes Hubler-Burkhalter<br />
Architekten: Verein Radwerk Landshut,<br />
Utzenstorf<br />
Handwerker: Verein Radwerk Landshut,<br />
Utzenstorf<br />
Denkmalpflege: Isabella Meili-Rigert<br />
(Bauberatung)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 2014<br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)<br />
Wynigen, Breitslohn 157b<br />
Massnahmen: Gesamtrenovierung, 2013–2015<br />
Bauherrschaft: Familie Walter Zurflüh<br />
Architekten: A+W Architekten AG, Kirchberg<br />
Handwerker: Holzbau Riesen AG, Grasswil;<br />
Beat Hubschmied, Langnau i.E. (Steinhauerarbeiten)<br />
Denkmalpflege: Stephan Zahno (Bauberatung)<br />
Unterschutzstellung: Kanton 2007<br />
Beiträge: Kanton (Lotteriefonds/POM)
ENTDECKUNG | DECOUVERTE<br />
55<br />
Pionierhafte Stromproduktion<br />
Das Kraftwerk Schattenhalb 2 am Reichenbach<br />
Die Entwicklung im Strommarkt<br />
und anstehende Konzessionserneuerungen<br />
führten dazu, dass<br />
in der Schweiz innerhalb weniger<br />
Jahre fast alle kleinen Kraftwerke<br />
aus der Frühzeit der Elektrizität<br />
ausser Betrieb gesetzt<br />
oder modernisisert wurden.<br />
Nicht so das Kraftwerk Schattenhalb<br />
2, das samt Turbinen und<br />
Generatoren glücklicherweise<br />
vollständig erhalten bleibt.<br />
Die Zentrale 2 des Kraftwerks<br />
Schattenhalb liegt hoch über dem<br />
Talgrund und ist nur zu Fuss oder<br />
über eine Betriebs-Haltestelle kurz<br />
vor der Bergstation der Reichenbachfallbahn<br />
erreichbar. Die Anlage<br />
ist mit Pelton-Turbinen der «Ateliers<br />
de construction mécaniques de Vevey»<br />
und Generatoren der «Maschinenfabrik<br />
Oerlikon» ausgestattet,<br />
zwei Pionierfirmen der Schweizer<br />
Maschinen- und Elektroindustrie.<br />
Die grössere Turbinen-Generator-<br />
Gruppe wurde seit 1926 kaum verändert,<br />
die kleinere 1940 ersetzt.<br />
Wie die Reichenbachfallbahn gehen<br />
auch die Kraftwerke Schattenhalb<br />
auf die Initiative der Hoteliers Elias<br />
Flotron und Franz Josef Bucher zurück.<br />
Das «Elektrizitätswerk Schattenhalb<br />
AG» ging 1909 ans Netz.<br />
1917 wurde das Werk vom Besitzer<br />
einer Kalziumkarbidfabrik übernommen,<br />
der 1926 die Zentrale Schattenhalb<br />
2 als obere Stufe der Kraftwerksanlage<br />
errichten liess. Seit<br />
2010 vereint das Kraftwerk Schattenhalb<br />
3 die beiden alten Druckstufen<br />
in einer einzigen Anlage; der<br />
Betrieb der Zentrale 2 wurde eingestellt,<br />
die Zentrale 1 mit reduzierter<br />
Produktion weiterbetrieben.<br />
2015 nahm die BKW-Tochter EWR<br />
Energie die Gesamterneuerung des<br />
Kraftwerks Schattenhalb 1 in Angriff,<br />
Turbinen- und Generatoren wurden<br />
entfernt. Dasselbe war im Kraftwerk<br />
Schattenhalb 2 vorgesehen. Kurz<br />
vor der Demontage konnten Vertreter<br />
von Denkmalpflege und Heimatschutz<br />
das Gebäude erstmals auch<br />
im Innern besichtigen. Die Begeisterung<br />
über die vollständig erhaltene<br />
Apparatur und den hohen industriegeschichtlichen<br />
Wert der<br />
gesamten Anlage war gross. Es gelang<br />
in letzter Minute, die Bauarbeiten<br />
zu stoppen und stattdessen<br />
nach Möglichkeiten für den Erhalt zu<br />
suchen. Eine neu gegründete Stiftung<br />
prüft nun gangbare Wege, die<br />
eindrückliche Maschinerie nachhaltig<br />
zu bewahren und der Öffentlichkeit<br />
zugänglich zu machen. BaF
56 AUSWAHL | SELECTION<br />
Auswahl weiterer Bauprojekte 2014–2015<br />
Biel/Bienne<br />
- Albrecht-Haller-Str. 11<br />
Wohn- und Geschäftshaus<br />
Restaurierung Fassade<br />
und ausgemaltes<br />
Treppenhaus, Dachsanierung<br />
- Alpenstrasse 33/35<br />
Doppeleinfamilienhaus<br />
Fassaden- und Fensterrenovierung,<br />
Dachsanierung<br />
- Bahnhofstrasse 1<br />
Wohn- und Geschäftshaus<br />
Umbau Erdgeschoss,<br />
Einbau Tabakladen<br />
- Bahnhofstrasse 11<br />
Volkshaus<br />
Restaurierung Saal und<br />
Treppenhaus<br />
- Champagneallee<br />
Schulanlage Champagne<br />
Beton- und Dachsanierung<br />
- General-Dufour-Str. 30<br />
Wohn- und Geschäftshaus<br />
Renovierung Fassade<br />
und Fenster, Dachsanierung<br />
- General-Dufour-Str. 64a<br />
Mehrfamilienhaus<br />
Gesamtrenovierung<br />
innen, Fassadenrenovierung<br />
- Jakob-Rosius-Strasse 3<br />
Villa<br />
Renovierung Wohnung<br />
Erdgeschoss<br />
- Neuenburgstrasse 48<br />
Ehem. Pächterhaus<br />
Umbau und Renovierung<br />
Wohnung 1. OG<br />
- Nidaugasse 39<br />
Wohnhaus mit Laden<br />
Fassadenrenovierung<br />
und Dachsanierung<br />
- Paul-Robert-Weg 16<br />
Kinderheim Ried<br />
Gesamtsanierung<br />
- Rennweg 68–82<br />
Genossenschaftssiedlung<br />
Fensterersatz in Holz<br />
- Ring N.N.<br />
Vennerbrunnen<br />
Restaurierung Brunnenschale<br />
und Pflästerung<br />
- Schlösslistr. 35/37/39<br />
Schulhaus Bözingen-<br />
Mett «Chatelet»<br />
Gesamtsanierung<br />
- Seevorstadt N.N.<br />
Strassenbauliche<br />
Sanierung Nordachse<br />
West<br />
Restaurierung Mauern,<br />
Zäune, Brunnen,<br />
Einfassungen Rasenflächen<br />
an Promenade<br />
- Solothurnstrasse 1<br />
Ehem. Drahtwerk,<br />
Schraubenfabrik<br />
Gesamtsanierung, neue<br />
Nutzung<br />
- Unterer Quai 23<br />
Wohn- und Geschäftshaus<br />
Umnutzung Erdgeschoss<br />
- Unterer Quai 31a<br />
Atelier<br />
Fassadenrenovierung<br />
- Wasenstrasse 34–46<br />
Wohnüberbauung<br />
Umbau, Sanierung und<br />
Fassadenrenovierung<br />
Büren an der Aare<br />
- Aareweg 65<br />
Bauernhaus<br />
Umbau und Sanierung<br />
- Hauptgasse 6<br />
Wohn- und Geschäftshaus<br />
Ausbau Dachgeschoss<br />
zu Ärztezentrum<br />
Burgdorf<br />
- Bahnhofstrasse 35<br />
Postgebäude<br />
Aussensanierung,<br />
Dachausbau und<br />
Ertüchtigung Treppengeländer<br />
- Bernstrasse 9<br />
Ehem. Lager- und<br />
Bürogebäude<br />
Umbau und sanfte<br />
Sanierung<br />
- Hohengasse 13<br />
Wohnhaus<br />
Innenrenovierung und<br />
Wiederherstellung<br />
Alkovenzimmer mit<br />
Böden und Ofen<br />
- Kornhausgasse 7<br />
Ehem. Städt. Kornhaus<br />
Fassadensanierung<br />
2. Etappe<br />
- Metzgergasse 20<br />
Wohnhaus<br />
Umbau und Sanierung<br />
- Oberburgstrasse 4<br />
Villa, heute Wohnheim<br />
Aussensanierung<br />
Dotzigen<br />
- Lyssstrasse 24<br />
Alte Mühle<br />
Sanierung Mahlanlage,<br />
Dach und Verputz<br />
Fassade<br />
Erlach<br />
- Amthausgasse 16<br />
Pfarrhaus<br />
Renovierung hinterer Teil<br />
Herzogenbuchsee<br />
- Bernstrasse 15<br />
Umnutzung Erdgeschoss,<br />
Fassaden- und<br />
Dachsanierung<br />
- Oberstrasse 2<br />
Wohnhaus<br />
Ausbau und Sanierung<br />
Dachgeschoss, Fassadenrenovierung<br />
und<br />
Fensterersatz, Restaurierung<br />
Gartenzaun<br />
Hilterfingen<br />
- Dorfstrasse 49<br />
Mehrfamilienhaus<br />
Gesamtsanierung<br />
- Staatsstrasse 52<br />
Schloss Hünegg,<br />
Grottenanlage<br />
Wiederherstellung in<br />
drei Etappen<br />
Iseltwald<br />
- Dorf 29<br />
Haus Bären<br />
Gesamtsanierung<br />
Jegenstorf<br />
- General-Guisanstr. 5<br />
Schloss Jegenstorf<br />
Restaurierung Südfassade<br />
Kiesen<br />
- Bahnhofstrasse 22<br />
Bauernhaus<br />
Um- und Ausbau<br />
Kirchberg<br />
- Eystrasse N.N.<br />
Sonntagsschullokal der<br />
Fabrik Elsässer<br />
Umbau und Renovierung<br />
Köniz<br />
- Juchstrasse 9<br />
Altes Schulhaus Niederwangen<br />
Sanierung der Fassaden<br />
und der Innenräume<br />
- Liebewilstrasse 162<br />
Ofenhaus<br />
Renovierung<br />
- Muhlernstrasse N.N.<br />
Historische Schlossmauer<br />
Sanierung<br />
- Muhlernstrasse 3<br />
Pfarrhaus<br />
Sanierung Riegausfachung,<br />
neue Fenster<br />
nach historischem<br />
Vorbild, neue Bodenbeläge,<br />
Restaurierung
AUSWAHL | SELECTION<br />
57<br />
Festsaal inkl. Wiedereinbau<br />
Kachelofen<br />
Koppigen<br />
- Hauptstrasse 3<br />
Kirche<br />
Gesamtsanierung<br />
Krauchthal<br />
- Dorfstrasse 21<br />
Bauernhaus<br />
Umbau und Sanierung<br />
- Ey 144<br />
Stöckli<br />
Ausbau und Gesamtsanierung<br />
Leuzigen<br />
- Bürenstrasse 27<br />
Kirche<br />
Sanierung Kirchturm<br />
und Glockenstuhl<br />
Ligerz<br />
- Dorfgasse 19<br />
Ehem. Herbsthaus der<br />
Klosterlandvogtei<br />
Thorberg<br />
Um- und Ausbau<br />
Dachgeschoss<br />
Linden<br />
- Egglishäusern 141a<br />
Ofenhausspeicher<br />
Gesamtsanierung<br />
Moosseedorf<br />
- Schlössliweg 6<br />
Wohnstock<br />
Fassadenrenovierung<br />
Moutier<br />
- Rue Industrielle 18<br />
Usine<br />
Assainissement et<br />
amélioration thermique<br />
du toit<br />
Mühleberg<br />
- Buchstrasse 5<br />
Kirche<br />
Sanierung Kirchturm<br />
Nidau<br />
- Balainenweg 25<br />
Schule Balainen<br />
Renovierung<br />
- Hauptstrasse 28<br />
Wohn- und Geschäftshaus<br />
Umbau und Sanierung,<br />
Restaurierung des<br />
Interieurs<br />
Oberdiessbach<br />
- Schloss-Strasse 125<br />
Bauernhaus<br />
Um- und Ausbau<br />
- Thunstrasse 5<br />
Ehem. Rest. Bären<br />
Umfassende Teilsanierung<br />
Renan<br />
- Envers des Convers 40<br />
Pigeonnier<br />
Restauration<br />
- Place Ami-Girard 3<br />
Restauration des<br />
façades et de la toiture<br />
Rüdtligen-Alchenflüh<br />
- Hauptstrasse 9<br />
Villa<br />
Um- und Ausbau<br />
Rüegsau<br />
- Rüegsaustrasse 1<br />
Restaurant Sonne<br />
Fenstersanierung,<br />
Abbruch Saal<br />
Saanen<br />
- Chilchgasse 5<br />
Kirche<br />
Schindeleindeckung von<br />
Kirchenschiff und Turm<br />
Saint-Imier<br />
- Rue Francillon 2<br />
Restauration de<br />
l'enveloppe, aménagement<br />
d’une boutique<br />
Schüpfen<br />
- Schwanden 49a<br />
Speicher und Ofenhaus<br />
Umnutzung<br />
Seeberg<br />
- Bergstrasse 11<br />
Kirche<br />
Sanierung Kirchhofmauer<br />
Spiez<br />
- Bahnhofstrasse 12<br />
Bahnhof<br />
Gesamtsanierung und<br />
Restaurierung Fassaden<br />
Steffisburg<br />
- Bernstrasse 96<br />
Schulhaus<br />
Erweiterung und Sanierung<br />
Sumiswald<br />
- Eichholzstrasse 6<br />
Bauernhaus<br />
Sanierung Wohnteil und<br />
Umbau Ökonomieteil<br />
Tavannes<br />
- Rue du Général Voirol 7<br />
Eglise<br />
Restauration des vitraux<br />
et sauvegarde du<br />
clocher<br />
- Rue du Foyer 4<br />
Immeuble<br />
Réfection de la toiture,<br />
remplacement des<br />
volets et peinture des<br />
façades et toiture<br />
Thun<br />
- Scheibenstrasse 25<br />
Wohlfahrtshaus<br />
Gesamtsanierung<br />
- Schlossberg 12<br />
Stadtkirche Thun<br />
Gesamtsanierung<br />
Tramelan<br />
- Collège 13<br />
Halle de gymnastique<br />
Transformations et<br />
restaurations<br />
Twann-Tüscherz<br />
- Burgweg 8<br />
Ehem. Rebhaus<br />
Um- und Ausbau,<br />
Fassadenrenovierung<br />
Wangen an der Aare<br />
- Vorstadt 15/17<br />
ehem. Bauernhaus<br />
Gesamtsanierung
58 VERLUSTE | PERTES<br />
Verlorene Bauten<br />
TRACHSELWALD, ÄBNIT 46<br />
Bauernhaus von 1832<br />
Das als erhaltenswert eingestufte<br />
Bauernhaus ist Mitte April 2015 bis<br />
auf die Grundmauern abgebrannt.<br />
Die Bewohnerinnen und Bewohner<br />
verloren ihr ganzes Hab und Gut.<br />
Anfang <strong>2016</strong> haben die Arbeiten für<br />
den Ersatzneubau begonnen.<br />
OBERBURG, KRAUCHTHALSTRASSE 26A<br />
Stöckli mit Kern von 1703<br />
Trotz diverser Gutachten, Kostengutsprachen<br />
und einer vorfinanzierten<br />
Machbarkeitsstudie für einen<br />
Wohn- und Atelierumbau konnte das<br />
Stöckli, das nach jahrzehntelangem<br />
Leerstand und ungenügendem<br />
Dachunterhalt zu einer Gefahr für<br />
die Passanten geworden war, nicht<br />
gerettet werden.<br />
SCHATTENHALB, GRIMSELSTRASSE 53/53A<br />
Doppelwohnhaus von 1851<br />
Das schützenswerte Wohnhaus und<br />
die dazugehörige Scheune fielen im<br />
November 2015 einem verheerenden<br />
Brand zum Opfer. Einige Teile der<br />
reich verzierten Hauptfront und der<br />
Sockelbereich blieben zwar verschont,<br />
konnten jedoch aufgrund der<br />
insgesamt starken Zerstörung und<br />
der grossen Löschwasserschäden<br />
nicht erhalten werden.<br />
SCHWANDEN, OBERSCHWANDERSTR. 42<br />
Bauernhaus von 1728<br />
Das Bauernhaus in Schwanden<br />
bei Brienz gehörte zu den ältesten<br />
datierten Bauten in der Gemeinde.<br />
Trotz einer Baubewilligung für<br />
die Restaurierung wurden zuerst<br />
der Blockbau und anschliessend die<br />
Bruchsteinmauern vollständig<br />
abgebrochen. Ein für das Ortsbild<br />
von Schwanden wertvolles Gebäude<br />
ist unwiederbringlich zerstört.
EINBLICKE | APERÇUS<br />
59<br />
Von Ofenkacheln umgeben<br />
Einblick in den Arbeitsalltag von Ivana Wyniger<br />
Ivana Wyniger erfasst und dokumentiert<br />
eine umfangreiche historische<br />
Ofensammlung. Diese<br />
beinhaltet Werke des bekannten<br />
Kachelofenmalers Johann Heinrich<br />
Egli und viele weitere Ofenvariationen.<br />
Der Raum im obersten Geschoss eines<br />
Gewerbebaus ist gross, wird<br />
jedoch nahezu bis zum letzten Zentimeter<br />
genutzt: Unzählige Bananenschachteln<br />
und Holzharassen türmen<br />
sich im vorderen Bereich, dahinter<br />
stehen ordentlich aufgereiht stabile<br />
Holzkisten neueren Datums. «Hier<br />
befinden sich über hundert Öfen»,<br />
erklärt Ivana. Das vermeintliche Sammelsurium<br />
hat System: «In den Bananenkisten<br />
und Harassen befinden<br />
sich Ofenkacheln, die ich noch nicht<br />
erfasst und dokumentiert habe. Sobald<br />
ein Ofen bearbeitet ist, verpacke<br />
ich die einzelnen Kacheln in eine neue<br />
Holzkiste und lege das Datenblatt bei.»<br />
Die Kachelöfen stammen aus verschiedenen<br />
Regionen der Schweiz,<br />
hauptsächlich aber aus dem Kanton<br />
Bern. Als es darum ging, die bedeutsame<br />
Sammlung aufzulösen, wurde<br />
sie deshalb der Denkmalpflege des<br />
Kantons Bern angeboten. Immer wieder<br />
werden Kachelöfen aus dem Bauteillager<br />
der Denkmalpflege in geeignete<br />
Gebäude eingebaut, daher<br />
schien es sinnvoll, die Sammlung in<br />
den Bestand aufzunehmen.<br />
Die Sammlung wurde in der Folge<br />
vorübergehend eingelagert. Die Aufarbeitung<br />
und Eingliederung ins<br />
Bauteillager stand vorerst nicht zur<br />
Diskussion, wurde jedoch aktuell, als<br />
Ivana Wyniger bei der Denkmalpflege<br />
ein Praktikum absolvieren wollte. Sie<br />
ist gelernte Steinbildhauerin und belegt<br />
zurzeit den Masterlehrgang<br />
Denkmalpflege und Umnutzung an<br />
der Fachhochschule Burgdorf. Ein<br />
Glücksfall für die Denkmalpflege:<br />
Ivana verlängerte ihr Praktikum und<br />
nahm unter Anleitung der Ofenspezialisten<br />
der Denkmalpflege die Dokumentation<br />
der Öfen in Angriff.<br />
Im Moment liegen alle Kacheln des<br />
Ofens Nummer 54 ausgebreitet auf<br />
dem Boden. «Es ist jeweils wie Weihnachten,<br />
wenn ich einen neuen Ofen<br />
angehe und die Kacheln auspacke»,<br />
erzählt Ivana. Sie prüft dann die Vollständigkeit<br />
des Ofens und erstellt<br />
eine massgenaue Zeichnung des aufgebauten<br />
Zustands und der Profilschnitte.<br />
Die Kacheln werden fotografiert,<br />
nummeriert und digital erfasst,<br />
was auch wissenschaftlichen Zwecken<br />
dient. «Mit dieser Bauanleitung<br />
kann man einen Ofen relativ einfach<br />
einbauen», erläutert Ivana. Einer der<br />
Öfen soll demnächst in der Propstei<br />
Interlaken installiert werden – die beste<br />
Art, Kulturgüter zu bewahren. BaF
60 ZAHLEN | CHIFFRES<br />
Die Denkmalpflege in Zahlen – 2015<br />
ARBEITSGEBIET<br />
BAUBERATUNG<br />
UND SCHUTZ-<br />
OBJEKTE<br />
CHAMP D’ACTION<br />
DES CONSEILLERS<br />
TECHNIQUES ET<br />
OBJETS CLASSÉS<br />
BEHANDELTE<br />
GESCHÄFTE<br />
Objekte der Denkmalpflege<br />
des Kantons Bern (ohne Stadt<br />
Bern)<br />
AFFAIRES<br />
TRAITÉES<br />
Objets du Service des monuments<br />
historiques (sans la<br />
ville de Berne)<br />
3734 478<br />
117<br />
403’567<br />
100%<br />
Total Bauten im Kanton Bern<br />
(ohne Stadt Bern)<br />
Total des bâtiments en canton de<br />
Berne (sans la ville de Berne)<br />
30’000<br />
7,4%<br />
Von der Denkmalpflege<br />
betreute Bauten<br />
(ohne Stadt Bern)<br />
6’073<br />
1,5%<br />
Bauten unter Schutz des<br />
Kantons oder des Bundes<br />
(ohne Stadt Bern)<br />
Bâtiments sous la<br />
protection du Canton<br />
ou de la Confédération<br />
(sans la ville de Berne)<br />
Bâtiments et projets de<br />
construction accompagnés par<br />
le Service des monuments<br />
historiques (sans la ville de Berne)<br />
Quellen | Sources: 1*, 2*, 3*<br />
Betreute Bauten und<br />
Bauvorhaben<br />
Bâtiments et projets<br />
de construction<br />
accompagnés<br />
ABKLÄRUNGEN<br />
ARCHIV, FOR-<br />
SCHUNG & BAU-<br />
DOKUMENTATION<br />
Anzahl Abklärungen<br />
Nombre de clarifications<br />
332<br />
Beitragsgeschäfte<br />
(ausbezahlt durch<br />
Lotteriefonds)<br />
Dossiers de<br />
contribution<br />
financière<br />
(versés par le<br />
Fonds de loterie)<br />
CLARIFICATIONS<br />
ARCHIVES,<br />
RECHERCHE &<br />
DOCUMENTATION<br />
TECHNIQUE<br />
Externe<br />
Anfragen<br />
Archiv und<br />
Forschung<br />
Stellungnahmen zu<br />
Wettbewerben und<br />
Planungsvorhaben<br />
Prises de position<br />
concernant des<br />
concours et projets<br />
de planification<br />
Quellen | Sources: 2*, 3*<br />
Demandes<br />
extérieures<br />
archives et<br />
recherches<br />
1525<br />
Total<br />
1193<br />
Interne Abklärungen<br />
Archiv,<br />
Forschung und<br />
Baudokumentation<br />
zu Geschäften<br />
der Bauberatung<br />
Demandes<br />
internes archives,<br />
recherche et<br />
documentation<br />
technique<br />
concernant des<br />
dossiers actuels<br />
des conseillers<br />
techniques<br />
Quellen | Sources: 2*
ZAHLEN | CHIFFRES<br />
61<br />
Le Service des monuments historiques<br />
en chiffres – 2015<br />
FINANZHILFEN<br />
CONTRIBUTIONS<br />
FINANCIÈRES<br />
FOLGE-<br />
INVESTITIONEN<br />
INVESTISSE-<br />
MENTS<br />
Objekte der Denkmalpflege<br />
des Kantons Bern (ohne Stadt<br />
Bern)<br />
Ausbezahlte Finanzhilfen<br />
aus Mitteln des kantonalen<br />
Lotteriefonds<br />
12,6 Mio. CHF<br />
Contributions financières<br />
versées grâce à des<br />
prélèvements opérés sur<br />
le Fonds de loterie<br />
Ausbezahlte Finanzhilfen<br />
des Bundesamts für Kultur<br />
Objets du Service des monuments<br />
historiques (sans la<br />
ville de Berne)<br />
Der Schutz und die Pflege von<br />
Baudenkmälern, geschichtlichen<br />
Stätten und Ortsbildern tragen<br />
wesentlich zur Erhaltung der<br />
kulturellen Identität und Vielfalt<br />
unseres Kantons bei. Die Vielfalt<br />
des gebauten Erbes bildet eine<br />
wichtige Grundlage für den Tourismus<br />
und ist volkswirtschaftlich<br />
von Bedeutung. Die öffentliche<br />
Hand löst mit dem Beitrag in der<br />
Höhe eines Frankens Investitionen<br />
von acht weiteren Franken<br />
im Zusammenhang mit der Erhaltung<br />
des gebauten Erbes aus.<br />
La protection et la conservation<br />
du patrimoine bâti (monuments<br />
historiques, sites historiques,<br />
sites construits) font partie des<br />
tâches qui contribuent de<br />
manière significative au maintien<br />
de l’identité et de la diversité<br />
culturelles de notre pays. Des<br />
enquêtes portant sur les intérêts<br />
culturels du public montrent que<br />
les Suisses sont attachés à la<br />
conservation de leur patrimoine.<br />
Le tourisme et l’économie tirent<br />
un grand bénéfice de la diversité<br />
exceptionnelle des monuments<br />
et des paysages culturels.<br />
Chaque franc alloué par les<br />
pouvoirs publics à la conservation<br />
du patrimoine bâti génère huit<br />
francs d’investissement.<br />
1,6 Mio. CHF<br />
Contributions financières<br />
versées de l’Office fédéral<br />
de la culture<br />
Quellen | Sources: 2*, 3*<br />
1 CHF<br />
8 CHF<br />
KOSTEN<br />
PRO KOPF<br />
Pro Kopf der Kantonsbevölkerung<br />
generiert die Denkmalpflege<br />
einen Kostenaufwand<br />
von rund 7 Franken.<br />
COÛTS PAR<br />
HABITANT<br />
Le service des monuments<br />
historiques génère des coûts<br />
de 7 francs par habitant de la<br />
population du canton.<br />
Beitrag<br />
Contribution<br />
Folgeinvestitionen<br />
Investissements<br />
Quellen | Sources: 4*<br />
7,16<br />
CHF<br />
Quellen | Sources: 3*, 5*<br />
*Quellen | Sources:<br />
1 Amt für Geoinformation, BEGID, Total Gebäude 2015 |<br />
Office de l'information géographique, BEGID, bâtiments Total 2015<br />
2 Geschäftsstatistik der Denkmalpflege des Kantons Bern |<br />
Statistiques du Service des monuments historiques du canton de Berne<br />
3 Datenbank Lotteriefonds/Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern |<br />
Base de données du Fonds de loterie/Direction de la police et des<br />
affaires militaires<br />
4 Zitiert in der Kulturbotschaft 2012–2015. Quelle: NIKE, Die volkswirtschaftliche<br />
Bedeutung der Denkmalpflege in der Schweiz, Bern und Zürich, Mai<br />
1991 (aktuellere Studien sind nicht verfügbar). |<br />
Cité dans le message sur la culture 2012–2015. Source: NIKE, Die volkswirtschaftliche<br />
Bedeutung der Denkmalpflege in der Schweiz, Bern und<br />
Zürich, Mai 1991 (des études plus actuelles ne sont pas disponibles).<br />
5 FIS 2000
62 PUBLIKATIONEN | PUBLICATIONS<br />
Baukultur per App und<br />
Internet entdecken<br />
Baudenkmäler begleiten und prägen<br />
uns im Alltag. Sie sind die baulichen,<br />
authentischen Zeugnisse unserer Geschichte<br />
und Kultur. Die Baudenkmäler<br />
des Kantons Bern sind im Bauinventar<br />
erfasst, beschrieben und bewertet. Die<br />
Daten des Bauinventars sind online<br />
oder per Smartphone-Applikation einsehbar.<br />
Interessierten Privatpersonen,<br />
Gemeinden oder Bauschaffenden<br />
steht damit ein praktisches Recherche-Instrument<br />
zur Verfügung.<br />
Die digitale Abfrage präsentiert einen<br />
aktuellen, aber rechtlich nicht verbindlichen<br />
Datenauszug aus dem<br />
Bauinventar. Die rechtsgültige Ausgabe<br />
des kantonalen Bauinventars<br />
liegt auf den Gemeinden und auf<br />
den Regierungsstatthalterämtern in<br />
gedruckter Form vor.<br />
Bauinventar online<br />
Auf der Internetseite der Denkmalpflege<br />
ist das Inventar unter «Bauinventar<br />
online» zu finden. Die Suche<br />
erfolgt mit Hilfe einer einfachen<br />
Suchmaske. Via Gemeinde oder<br />
Adresse kann gezielt nach Baudenkmälern,<br />
nach ihrer Bewertung oder<br />
nach geschützten Baudenkmälern<br />
gesucht werden. Im Suchergebnis<br />
sind die Baudenkmäler mit einer<br />
Fotografie illustriert, dazu erläutert<br />
ein Kurztext die besonderen Qualitäten<br />
des Objekts sowie seine<br />
fachliche Bewertung.<br />
denkmappBE<br />
Per Smartphone oder Tablet erfolgt<br />
der Zugriff auf das Bauinventar mit<br />
der Applikation «denkmappBE».<br />
Diese kann in den Stores für Apple,<br />
Android und Windows kostenlos<br />
heruntergeladen werden. Die Suche<br />
erfolgt via Gemeinde oder Adresse.<br />
Das Suchergebnis liefert zusätzlich<br />
zum beschreibenden Kurztext<br />
mit Foto auch eine Kartenansicht<br />
des jeweiligen Objekts.<br />
Das Bauinventar im Geoportal<br />
Das Geoportal der Bau-, Verkehrsund<br />
Energiedirektion BVE ist die<br />
offizielle Publikationsplattform des<br />
Kantons Bern für Geoinformationen.<br />
Das Bauinventar ist im Kartenangebot<br />
des Geoportals zu finden.<br />
Die Kartenanwendung ermöglicht<br />
die übersichtliche Lokalisierung der<br />
Baudenkmäler und bietet einen<br />
Überblick über den ganzen Kanton.<br />
Die Suche nach Baudenkmälern,<br />
Baugruppen oder Strukturgruppen<br />
erfolgt über die Zoomfunktion oder<br />
über die Adresse.<br />
www.be.ch/geoportal<br />
www.be.ch/denkmalpflege
PUBLIKATIONEN | PUBLICATIONS<br />
63<br />
Découvrir le patrimoine bâti<br />
en ligne et sur App<br />
Les monuments historiques nous accompagnent<br />
au quotidien. Ils sont les<br />
témoins architecturaux authentiques<br />
de notre histoire et de notre culture.<br />
Les monuments historiques du canton<br />
de Berne sont recensés, décrits et<br />
évalués techniquement dans le recensement<br />
architectural. Ce dernier est<br />
disponible sur Internet et via une application<br />
mobile.<br />
Le recensement architectural constitue<br />
donc un outil de recherche<br />
pratique pour les particuliers intéressés,<br />
les communes et les spécialistes<br />
du bâtiment. Les données numériques<br />
sont un extrait actuel et non<br />
contraignant sur le plan juridique du<br />
recensement architectural. La version<br />
légalement valide de celui-ci est<br />
disponible au format papier dans les<br />
communes et dans les préfectures.<br />
Recensement architectural<br />
en ligne<br />
Sur la page Internet du Service des<br />
monuments historiques, l’application<br />
en ligne du recensement architectural<br />
se trouve sous la rubrique « Recensement<br />
architectural en ligne ».<br />
A l’aide d’un masque de recherche<br />
simple, elle permet une recherche<br />
par commune, adresse, appréciation<br />
ou par monument historique classé.<br />
Dans la liste des résultats, les monuments<br />
sont accompagnés d’une<br />
photo, d’un texte bref présentant<br />
leurs principales caractéristiques et<br />
d’une indication sur leur classement.<br />
denkmappBE<br />
L’application « denkmappBE »<br />
(en allemand) permet d’accéder au<br />
recensement architectural sur smartphone<br />
ou tablette. Elle peut être<br />
téléchargée gratuitement depuis<br />
l’App Store, l’Android Market et le<br />
Windows Store. La recherche est<br />
ciblée par commune ou par adresse.<br />
Les résultats sont présentés au<br />
moyen d’un texte succinct, d’une<br />
photo et d’une carte.<br />
Le recensement architectural sur<br />
le géoportail<br />
Les objets du recensement architectural<br />
figurent également dans l’offre<br />
cartographique du géoportail de<br />
la Direction des travaux publics, des<br />
transports et de l’énergie (TTE), la<br />
plate-forme officielle du canton de<br />
Berne pour la publication des informations<br />
géographiques. Grâce à<br />
l’utilitaire de carte, il est facile d’obtenir<br />
un aperçu de la localisation des<br />
monuments historiques sur tout<br />
le territoire cantonal. On trouve ainsi<br />
aisément les objets souhaités au<br />
moyen d’une fonction de recherche<br />
ciblée par monument, par ensemble<br />
bâti ou par ensemble structuré ou<br />
encore en les cherchant sur la carte<br />
par leur adresse ou en zoomant.<br />
www.be.ch/geoportail<br />
www.be.ch/monuments-historiques
64<br />
TERMINE | CALENDRIER<br />
Termine | Calendrier <strong>2016</strong><br />
Denkmalpflegepreis<br />
<strong>2016</strong> verleiht die Denkmalpflege<br />
des Kantons Bern bereits zum<br />
siebten Mal einen Anerkennungspreis<br />
für die Restaurierung und<br />
Weiterentwicklung eines Baudenkmals.<br />
In diesem Jahr geht die Auszeichnung<br />
an die Besitzerinnen und<br />
Besitzer eines Doppel-Einfamilienhauses<br />
von 1903. Die beiden Bauherrschaften<br />
haben die Interieurs<br />
ihrer Hausteile unabhängig voneinander<br />
pragmatisch an die eigenen<br />
Bedürfnisse angepasst und<br />
sorgfältig restauriert. Bewährtes<br />
wurde belassen, die Infrastruktur<br />
mit wenigen Eingriffen optimiert.<br />
Genauso pragmatisch entwickelten<br />
die Bauherrschaften für die gemeinsame<br />
Fassadenrestaurierung<br />
ein Farb- und Materialkonzept, das<br />
auch bei zukünftigen Unterhaltsarbeiten<br />
den Rahmen vorgeben wird.<br />
Spezialpreis<br />
Der Spezialpreis <strong>2016</strong> würdigt das<br />
Engagement einer Bauherrin, die<br />
sich mit viel Elan für einen ehemaligen<br />
Lager- und Gewerbebau von<br />
1860 in Burgdorf eingesetzt hat.<br />
Das Porträt der beiden ausgezeichneten<br />
Objekte erscheint in<br />
der Zeitschrift UMBAUEN+<br />
RENOVIEREN. Das Separatum der<br />
Reportage kann bei der Denkmalpflege<br />
bestellt werden.<br />
Ausstellung in Bern<br />
vom 20. Mai bis 18. Juni <strong>2016</strong><br />
Galerie Kornhausforum<br />
Di–Fr 10–19 Uhr, Sa 10–17 Uhr<br />
Ausstellung in Biel<br />
vom 21. Juni bis 24. Juli <strong>2016</strong><br />
Neues Museum Biel<br />
Di–So 11–17 Uhr<br />
Prix des monuments<br />
historiques<br />
C’est la septième fois que le Service<br />
des monuments historiques<br />
du canton de Berne a décerné son<br />
prix, qui distingue la restauration<br />
et l’aménagement d’un bâtiment<br />
historique.<br />
En <strong>2016</strong>, le prix des monuments<br />
historiques est décerné aux deux<br />
maîtres d’ouvrage d’une maison<br />
jumelée de 1903 à Bienne. Les<br />
propriétaires ont restauré leur intérieur<br />
indépendamment les uns<br />
des autres avec beaucoup de soin<br />
et avec un approche pragmatique,<br />
axée sur la substance bâtie<br />
ancienne. Ils ont amélioré l’équipement<br />
en ménageant la substance,<br />
laissant des éléments éprouvés.<br />
Conjointement ils ont restauré la<br />
façade et créé pour cela une gamme<br />
de couleurs et de matériaux. Ce<br />
programme servira de guide pour<br />
de futurs travaux d’entretien.<br />
Prix spécial<br />
Le prix spécial <strong>2016</strong> récompense<br />
quant à lui l’engagement d’un<br />
maître d’ouvrage de Berthoud, qui<br />
s’est investi corps et âme dans la<br />
restauration d’un ancien bâtiment<br />
artisanal.<br />
Le portrait des deux objets récompensés<br />
paraîtra dans la revue<br />
UMBAUEN+RENOVIEREN. Le<br />
tiré à part du reportage peut être<br />
commandé auprès du Service des<br />
monuments historiques.<br />
Exposition à Berne<br />
du 20 mai au 18 juin <strong>2016</strong><br />
Galerie Kornhausforum<br />
ma–ve 10–19h, sa 10–17h<br />
Exposition à Bienne<br />
du 21 juin au 24 juillet <strong>2016</strong><br />
Nouveau Musée Bienne<br />
ma–di 11–17h<br />
Denkmalpflegepreis <strong>2016</strong>:<br />
Doppelwohnhaus in Biel |<br />
Prix des monuments historiques<br />
<strong>2016</strong> : maison jumelée à Bienne
TERMINE | CALENDRIER<br />
65<br />
Führungen <strong>2016</strong>:<br />
Ortstermin <strong>Fachwerk</strong><br />
Der neue Führungszyklus der<br />
kantonalen Denkmalpflege präsentiert<br />
von Juni bis November eine<br />
bunte Reihe von Besichtigungen.<br />
Treffen Sie uns vor Ort!<br />
Zusätzliche Informationen:<br />
www.be.ch/denkmalpflege<br />
Visites <strong>2016</strong> : <strong>Fachwerk</strong>,<br />
venir pour voir<br />
Dans le cadre de son nouveau<br />
cycle de visites, qui s’étendra de<br />
juin à novembre, le Service des<br />
monuments historiques permettra<br />
au public de découvrir toute une<br />
série de bâtiments uniques.<br />
N’hésitez pas à venir nous voir !<br />
Informations complémentaires :<br />
www.be.ch/monuments-historiques<br />
Burgdorf: Gewerbecharme<br />
und Gebrauchsspuren<br />
9. Juni, 18 Uhr, Bernstrasse 9<br />
Biel/Bienne: Ästhetik und<br />
Qualität | Esthetique et qualité<br />
16. Juni, 18 Uhr | 16 juin, 18 h,<br />
Alpenstrasse 33/35<br />
Taubenlochschlucht:<br />
Sommer-Schlucht-Wanderung<br />
21. Juli, 18 Uhr, Bushaltestelle<br />
«Taubenloch» (mit Anmeldung)<br />
La Neuveville:<br />
Le bon goût de vivre en ville<br />
25 aôut, 18 h, Rue du Marché 17<br />
Gsteig: Der Apfelschuss<br />
in Gsteig bei Gstaad<br />
20. Oktober, 18 Uhr, Müligässli 4<br />
Steffisburg: Pferderegieanstalt –<br />
neue Nutzung<br />
17. November, 17.45 Uhr, Schwäbisstrasse<br />
56 (mit Anmeldung)<br />
Spezialpreis <strong>2016</strong>: ehem. Lagerund<br />
Gewerbebau in Burgdorf |<br />
Prix spécial <strong>2016</strong> : ancien bâtiment<br />
artisanal à Berthoud<br />
Europäische Tage<br />
des Denkmals<br />
Journées européennes<br />
du patrimoine<br />
Die 23. Ausgabe der Europäischen<br />
Tage des Denkmals findet zum<br />
Thema «Oasen» statt und rückt<br />
Entspannungsorte aller Art ins<br />
Scheinwerferlicht: Von historischen<br />
Gärten, Landschaftsparks und<br />
urbanen Plätzen bis zu gestalteten<br />
Firmenarealen und Kulturlandschaften.<br />
Das detaillierte Programm ist ab<br />
Juli im Internet aufgeschaltet:<br />
www.be.ch/denkmalpflege<br />
La 23e édition des Journées<br />
européennes du patrimoine<br />
sera consacrée au thème « Oasis<br />
des villes, oasis des champs » et<br />
met en évidence toutes sortes<br />
de lieux de détente : jardins historiques,<br />
parcs paysagers, places,<br />
cités-jardins, jardins et parcs de<br />
grandes entreprises ou paysages<br />
humanisés.<br />
Le programme sera disponible sur<br />
notre site internet à partir de juillet :<br />
www.be.ch/monuments-historiques
66<br />
PERSONELLES | PERSONNEL<br />
Mitarbeitende | Employés<br />
Stand Anfang April <strong>2016</strong> |<br />
Etat début avril <strong>2016</strong><br />
59 Personen teilen sich 42 Vollzeitstellen<br />
(inklusive befristete Projektstellen)<br />
| 59 personnes se partagent<br />
42 postes à plein temps (postes de<br />
projet à durée déterminée inclus)<br />
Abteilungsleitung |<br />
Direction de la section<br />
Michael Gerber (MG)<br />
Stab | Etat-major<br />
Barbara Frutiger (BaF)<br />
Beat Käsermann<br />
Doris Sommer<br />
Beatrice Stadelmann<br />
Bau- und Ortsbildpflege |<br />
Conseils techniques et conservation<br />
des sites construits<br />
Tatiana Lori, Leitung | direction<br />
Lukas Auf der Maur<br />
Anne-Marie Biland<br />
Olivier Burri<br />
Peter Ernst<br />
Sandra Grossenbacher<br />
Renate Haueter (RHA)<br />
Fritz Hebeisen<br />
Laurie Lehmann<br />
Isabella Meili-Rigert (IMR)<br />
Stefan Moser (SMO)<br />
Dominique Plüss (DOP)<br />
Hanspeter Ruch<br />
Eduard Salzmann<br />
Eva-Maria Schäfer (EMS)<br />
Ralph Schmidt<br />
Fabian Schwarz (FAS)<br />
Adrian Stäheli<br />
Rolf Weber<br />
Ivana Wyniger<br />
Stephan Zahno (STZ)<br />
Forschung und Bauinventar |<br />
Recherche et recensement<br />
architectural<br />
Richard Buser, Leitung | direction<br />
Heinrich Christoph Affolter<br />
Zita Caviezel<br />
Maria D'Alessandro<br />
Jürg Hünerwadel<br />
Katrin Kaufmann<br />
Edith Keller<br />
Katja Köhler-Schneider<br />
René Kölliker (RK)<br />
Andrea Liechti<br />
Isabelle Roland<br />
Andrzej Rulka<br />
Ursula Schneeberger<br />
Robert Walker<br />
Matthias Walter<br />
Andrea Zellweger<br />
Baudokumentation und Archiv |<br />
Documentation technique et<br />
archives<br />
Barbara Imboden, Leitung | direction<br />
Ester Adeyemi<br />
Rolf Bachmann<br />
Peter Bannwart (PB)<br />
Jürg Frey<br />
Nicole Habegger<br />
Beat Schertenleib<br />
Elisabeth Schneeberger<br />
Nicole Wälti<br />
Esther Wetli<br />
Hans Peter Würsten<br />
Support<br />
Regina Fedele Gerber, Leitung |<br />
direction<br />
Karin Aufenast<br />
Karin Bolliger<br />
Sophie Burri<br />
Christina Mooser<br />
Ruth Thomet<br />
Ausblick | Perspectives<br />
In Szene gesetzt<br />
Oft sind es Details, die einen Bau<br />
wirksam in Szene setzen:<br />
Der repräsentative Bauschmuck<br />
demonstriert den Macht- und<br />
Prestigeanspruch seines Bauherrn<br />
oder seiner Bauherrin, die auffällige<br />
Beschriftung eines Industriebaus<br />
ist Teil des Marketingkonzepts, die<br />
Beleuchtung inszeniert die Architektur<br />
bei Nacht, das Wirtshausschild<br />
ist unentbehrlich für das<br />
Gasthaus. Das «<strong>Fachwerk</strong>» 2017<br />
rückt die Details ins Zentrum.<br />
Mise en scène<br />
Souvent, ce sont les détails qui<br />
mettent véritablement un bâtiment<br />
en scène : les décors ornant un<br />
bâtiment assoient le pouvoir d’un<br />
maître d’ouvrage, une inscription<br />
caractéristique apposée sur un<br />
bâtiment industriel fait partie intégrante<br />
du concept marketing, un<br />
éclairage subtil dévoile la nuit des<br />
éléments d’architecture insoupçonnés<br />
et que serait une auberge sans<br />
son enseigne typique ? Dans la revue<br />
« <strong>Fachwerk</strong> » 2017, les détails sont<br />
projetés sur le devant de la scène.
IMPRESSUM<br />
67<br />
Der Tipp<br />
Geschichten vom Bauen.<br />
Ein Sachbuch von Globi<br />
Globi entdeckt das Bauen. Er<br />
erkundet Baustellen, trifft Architekten<br />
und Bauleute, die ihm Einblicke<br />
in ihre Arbeit gewähren. Auf einfache<br />
und spannende Art wird Wissenswertes<br />
zu den Themen Bauen,<br />
Architektur, Heimatschutz und<br />
Stadtentwicklung vermittelt. Globi<br />
macht auch Bekanntschaft mit<br />
Ferien im Baudenkmal, der Stiftung<br />
des Schweizer Heimatschutzes, und<br />
lernt das Huberhaus in Bellwald<br />
kennen. Das Buch bietet Gross und<br />
Klein umfassende, spannende und<br />
unterhaltsame Informationen.<br />
Die verschiedenen Themen sind in<br />
Zusammenarbeit mit Köbi Gantenbein<br />
von der Zeitschrift Hochparterre,<br />
mit dem Heimatschutz Schweiz<br />
und mit weiteren Fachleuten aus den<br />
verschiedenen Bereichen erarbeitet<br />
worden.<br />
Ein Buch für Kinder von 7 bis 12<br />
Jahren – aber auch für interessierte<br />
Erwachsene.<br />
Geschichten vom Bauen.<br />
Ein Sachbuch von Globi<br />
Text: Hubert Bächler, Illustrationen:<br />
Daniel Müller. Globi Wissen Band 5, 2010.<br />
96 Seiten, gebunden, 17 x 28.5 cm,<br />
ISBN 978-3-85703-372-8.<br />
Impressum<br />
Herausgeber | Editeur<br />
Erziehungsdirektion des Kantons<br />
Bern, Amt für Kultur, Denkmalpflege<br />
| Direction de l’instruction<br />
publique du canton de Berne,<br />
Office de la culture, Service des<br />
monuments historiques<br />
Redaktionsteam |<br />
Equipe de rédaction<br />
Richard Buser<br />
Barbara Frutiger<br />
Michael Gerber<br />
Tatiana Lori<br />
Doris Sommer<br />
Beatrice Stadelmann<br />
Gestaltung | Graphisme<br />
Bernet & Schönenberger, Zürich<br />
Layout | Mise en page<br />
Katrin Kaufmann<br />
Druck | Impression<br />
Stämpfli Publikationen AG, Bern<br />
Bestellung | Commande<br />
Denkmalpflege des Kantons Bern<br />
031 633 40 30<br />
denkmalpflege@erz.be.ch<br />
Abbildungsnachweise |<br />
Crédits iconophiques<br />
Yves André, St-Aubin-Sauges: S. 6<br />
(rechts); Atelier Wehrlin, Wünnewil:<br />
S. 18, S. 19 (beide); Rolf Bachmann,<br />
Denkmalpflege des Kantons Bern:<br />
S. 23 (rechts); Bauinventar, Denkmalpflege<br />
des Kantons Bern: S. 4, S. 5,<br />
S. 6 (links), S. 8, S. 26, S. 27, S. 50<br />
(Mitte), S. 58 (alle), S. 66; Jacques<br />
Bélat, Courtemautruy: S. 27 (unten),<br />
S. 47 (Mitte); Urs Bertschinger, Biel/<br />
Bienne: S. 23 (links); Markus Beyeler,<br />
Hinterkappelen: S. 2, S. 26 (unten);<br />
BHP Raumplan AG, Bern: S. 17<br />
(links); Christine Blaser, Schär Buri<br />
Architekten, Bern: S. 10 (beide);<br />
Daniel Brotschi, ars viridis GmbH,<br />
Biel/Bienne: S. 43 (beide), S. 65;<br />
Michael Fischer, Fischer & Partner AG<br />
Restauratoren, Bern: S. 40, S. 41<br />
(beide); GHZ Architekten AG, Belp:<br />
S. 20 (rechts); Christian Helmle, Thun:<br />
S. 55; Ralph Hut, Zürich: S. 54 (links);<br />
ISOS Bundesinventar der schützenswerten<br />
Ortsbilder der Schweiz,<br />
© Bundesamt für Kultur BAK, Bern:<br />
S. 7, S. 13 (links), S. 16 (rechts);<br />
Matthias Kilchhofer, Fischer & Partner<br />
AG Restauratoren, Bern: S. 53<br />
(rechts); René Koelliker, Denkmalpflege<br />
des Kantons Bern: S. 7 (Mitte<br />
links); Isabella Meili-Rigert, Denkmal-<br />
pflege des Kantons Bern: S. 54<br />
(Mitte); Verena Menz, Burgdorf: S. 65<br />
(oben); Orthophotomosaik SWISS-<br />
IMAGE © swisstopo (DV5704002406/<br />
000010): S. 17 (rechts); Dominique<br />
Plüss, Denkmalpflege des Kantons<br />
Bern: S. 51 (links); Damian Poffet,<br />
Liebefeld-Bern: S. 50 (links); Richtplan<br />
2030 Kanton Bern, Amt für<br />
Gemeinden und Raumordnung: S. 7,<br />
S. 14; Beat Schertenleib, Denkmalpflege<br />
des Kantons Bern: S. 9 (beide),<br />
S. 12 (beide), S. 20 (links), S. 21,<br />
S. 22, S. 24, S. 25, S. 27 (Mitte),<br />
S. 28, S. 29, S. 30, S. 32, S. 33 (alle),<br />
S. 34 (beide), S. 35, S. 36, S. 37<br />
(beide), S. 38, S. 39 (rechts), S. 42,<br />
S. 45 (alle), S. 46 (Mitte und rechts),<br />
S. 47 (links und rechts), S. 48 (alle),<br />
S. 49 (Mitte und rechts), S. 50 (Mitte),<br />
S. 50 (Mitte und rechts), S. 52 (links),<br />
S. 54 (rechts), S. 59; Marco Schibig,<br />
Bern: S. 44, S. 49 (links); Fabian<br />
Schwarz, Denkmalpflege des Kantons<br />
Bern: S. 52 (Mitte); Fotoatelier<br />
Spring GmbH, Oberburg: S. 46<br />
(links); Adrian Stäheli, Denkmalpflege<br />
des Kantons Bern: S. 15; Tourismus<br />
& Naturpark Diemtigtal: S. 13 (rechts);<br />
Rolf Weber, Denkmalpflege des<br />
Kantons Bern: S. 52 (rechts); Stefan<br />
Weber, Jens: S. 64.<br />
© Denkmalpflege des Kantons Bern<br />
<strong>2016</strong>. Der Nachdruck des Werks ist<br />
nur mit Bewilligung der Denkmalpflege<br />
gestattet.<br />
ISBN 978-3-9523701-4-8
Erziehungsdirektion<br />
des Kantons Bern<br />
Amt für Kultur<br />
Denkmalpflege<br />
Direction de l’instruction<br />
publique du canton de Berne<br />
Office de la culture<br />
Service des monuments<br />
historiques<br />
www.be.ch/denkmalpflege<br />
www.be.ch/monuments-historiques