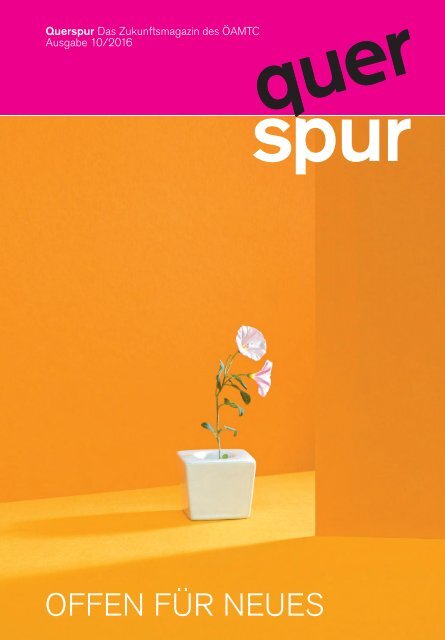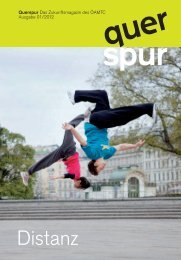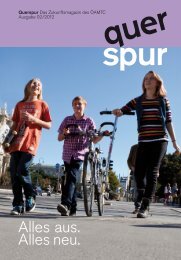Offen für Neues
Querspur - das Zukunftsmagazin des ÖAMTC
Querspur - das Zukunftsmagazin des ÖAMTC
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Querspur Das Zukunftsmagazin des ÖAMTC<br />
Ausgabe 10/2016<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
1
offen <strong>für</strong> neues<br />
Quellen: 1. Nature Neuroscience<br />
Wo ist das<br />
Zentrum der Neugier<br />
im menschlichen Gehirn?<br />
Wissenschafter haben herausgefunden,<br />
dass das Zentrum der Neugier und damit der<br />
Ausgangspunkt von Innovation im Gehirn nicht<br />
einer bestimmten Hirnregion zuzuordnen ist.<br />
Vielmehr geht es um die Verbindungsstärke<br />
bestimmter Hirnregionen. Neugierige Menschen<br />
zeichnen sich vor allem durch eine besonders<br />
gut funktionierende Verbindung von<br />
Striatum (Sitz des Belohnungssystems) und<br />
Hippocampus (<strong>für</strong> bestimmte<br />
Gedächtnisfunktionen<br />
zuständig) aus. 1<br />
Was ist der<br />
Unterschied zwischen<br />
Invention und Innovation?<br />
Was ist Neugier?<br />
Das Lexikon der Psychologie definiert<br />
Neugier als einen Zustand, „der einhergeht<br />
mit einer erhöhten Bereitschaft eines Organismus,<br />
sich neuen, ungewohnten und komplexen Situationen<br />
und Objekten auszusetzen bzw. diese aktiv aufzusuchen“.<br />
Es kann zwischen epistemischer und perzeptiver Neugier<br />
unterschieden werden. Bei Ersterer geht es um den reinen<br />
Erkenntnisweg (griech.: epistéme, dt.: Wissen, Erkenntnis).<br />
Diese Art der Neugier wird ausgelöst, wenn sich<br />
eine Person gedanklich mit Dingen beschäftigt und<br />
diese verstehen will.<br />
Perzeptive Neugier (lat.: percipere, dt.: wahrnehmen)<br />
hingegen entsteht in einer Situation, in der man über<br />
eine Wahrnehmung sofort dazu angeregt ist,<br />
mehr über eine Sache zu erfahren. Etwa<br />
wenn ein Kind vor einer Baustelle steht<br />
und sich diese in der Situation<br />
genau ansehen<br />
möchte.<br />
Eine Invention ist eine Erfindung.<br />
Hierbei kann es sich um eine bloße Idee,<br />
um eine auf wissenschaftlicher Methode<br />
erforschte Erkenntnis oder um eine konkrete<br />
Konzeptentwicklung bis hin zum Prototypen<br />
handeln. Die Invention ist jedoch in der<br />
vormarktlichen Phase verankert.<br />
Erst wenn die Invention produziert und<br />
erfolgreich im Markt platziert ist,<br />
spricht man von<br />
Innovation.<br />
Impressum und <strong>Offen</strong>legung<br />
Medieninhaber und Herausgeber<br />
Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC),<br />
Schubertring 1-3, 1010 Wien, Telefon: +43 (0)1 711 99 0<br />
www.oeamtc.at<br />
ZVR-Zahl: 730335108, UID-Nr.: ATU 36821301<br />
Vereinszweck ist insbesondere die Förderung der Mobilität unter<br />
Bedachtnahme auf die Wahrung der Interessen der Mitglieder.<br />
Rechtsgeschäftliche Vertretung<br />
DI Oliver Schmerold, Verbandsdirektor<br />
Mag. Christoph Mondl, stellvertretender Verbandsdirektor<br />
Konzept und Gesamtkoordination winnovation consulting gmbh<br />
Chefredaktion Dr. Florian Moosbeckhofer (ÖAMTC),<br />
Dr. Gertraud Leimüller (winnovation consulting)<br />
Chefin vom Dienst Silvia Wasserbacher-Schwarzer, BA, MA<br />
Mitarbeiter dieser Ausgabe Dipl.-Bw. Maren Baaz, Ancuta Barbu,<br />
Catherine Gottwald, Margit Hurich, Mag. (FH) Christian Huter, Mag. Claudia Kesche,<br />
Mag. Astrid Kuffner, MMag. Ursula Messner, Dr. Daniela Müller, Dr. Ruth Reitmeier,<br />
DI Anna Vardai, Silvia Wasserbacher-Schwarzer, BA, MA, Armin Winter<br />
Fotos Karin Feitzinger; Umschlag: Karin Feitzinger<br />
Grafik Design, Illustrationen Drahtzieher Design & Kommunikation, Barbara Wais, MA<br />
Korrektorat Mag. Christina Preiner, vice-verba<br />
Druck Hartpress<br />
Blattlinie Querspur ist das zweimal jährlich erscheinende Zukunftsmagazin des ÖAMTC.<br />
Ausgabe 10/2016, erschienen im Oktober 2016<br />
Download www.querspur.at
Foto: © Karin Feitzinger<br />
6<br />
10<br />
28<br />
32<br />
35<br />
59<br />
Heute<br />
Mit anderen Augen<br />
gegen den Strom<br />
Aus der eigenen Welt ausbrechen,<br />
um <strong>Neues</strong> zu schaffen.<br />
Von Ruth Reitmeier<br />
Sesam öffne dich<br />
Organisationen müssen sich schon<br />
heute <strong>für</strong> Innovationsaktivitäten öffnen,<br />
um auf der Überholspur zu bleiben.<br />
Von Silvia Wasserbacher-Schwarzer<br />
Meine Idee<br />
Externe Ideengeber der ÖAMTC<br />
Future Challenge im Portrait.<br />
Von Astrid Kuffner<br />
Futurnauten<br />
Die Jury-Mitglieder der ÖAMTC<br />
Future Challenge im Interview.<br />
Von Catherine Gottwald<br />
Der Schlüssel zum Erfolg<br />
Ob sich eine Innovation auf dem Markt<br />
durchsetzt, hängt von vielen Faktoren<br />
ab. Mitunter auch vom Zeitalter,<br />
in dem sie geschaffen wird.<br />
Von Astrid Bonk<br />
Zeichen der Zeit<br />
Bald wird Europa zum Eldorado<br />
<strong>für</strong> Start-ups.<br />
Von Silvia Wasserbacher-Schwarzer<br />
6<br />
Foto: © shutterstock Foto: © Günther Huck<br />
28<br />
35<br />
Illustration: © Barbara Wais<br />
59<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
3
offen <strong>für</strong> neues<br />
Wie wichtig ist den<br />
Österreichern Wissenschaft?<br />
Eine Studie im Auftrag des<br />
Wissenschaftsministeriums (BMWFW) ergab,<br />
dass 92 % der Befragten (2.000 Erwachsene)<br />
Wissenschaft in Bezug auf Arbeitsplätze in Österreich<br />
und den Wirtschaftsstandort insgesamt als sehr<br />
wichtig oder eher wichtig beurteilen. Der Einfluss von<br />
Wissenschaft auf das internationale Ansehen,<br />
den Wohlstand und das tägliche Leben in Österreich<br />
wird ähnlich hoch bewertet. Können sich die<br />
Menschen vorstellen, auch privat Geld <strong>für</strong><br />
Wissenschaft und Forschung zu spenden?<br />
Dieser Frage stimmten<br />
acht Prozent voll zu, 28 Prozent<br />
stimmten eher zu. 1<br />
Was ist STARTS?<br />
STARTS<br />
(SCIENCE + TECHNOLOGY + ARTS)<br />
ist ein von der Ars Electronica in Linz und im<br />
Auftrag der Europäischen Kommission<br />
ausgeschriebener Preis, der Projekte an der<br />
Schnittstelle von Wissenschaft, Technologie und<br />
Kunst auszeichnet. Der Hintergrund:<br />
Jene Kunstprojekte sollen prämiert werden,<br />
die als Katalysator angesehen werden, um<br />
wissenschaftliches und technologisches Know-how<br />
in der breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen<br />
und innovative Prozesse anzustoßen.<br />
Dotiert ist der STARTS-Preis mit<br />
zwei Mal 20.000 EUR.<br />
www.starts-prize.aec.at<br />
Was ist<br />
Citizen Science?<br />
Als Citizen Science wird eine<br />
Arbeitsmethode bezeichnet, bei der<br />
wissenschaftliche Projekte partizipativ mit<br />
interessierten Amateuren durchgeführt werden. 2<br />
Längere Tradition hat dies in der Vogelkunde oder<br />
Astronomie, wo es um die Erfassung und Verarbeitung<br />
sehr großer Datenmengen geht. In jüngerer Zeit wurde<br />
Citizen Science auch auf andere Bereiche übertragen.<br />
Etwa wird die Crowd nach spezifischen Lösungen <strong>für</strong><br />
sehr konkrete Fragestellungen, z. B. <strong>für</strong> neue Algorithmen,<br />
gefragt. Aber auch in der Wissenschaft können<br />
Laienforscher unter dem Stichwort<br />
„partizipative Forschung“ einen großen Beitrag<br />
leisten und schon in sehr frühen Phasen<br />
eingebunden werden. Zum Beispiel in der<br />
Themensetzung und Formulierung von<br />
Forschungsfragen.<br />
Quellen: 1. Wissenschaftsmonitor 2015; 2. citizen-science.at<br />
Seit wann gibt<br />
es Citizen Science?<br />
In seiner heutigen, digital unterstützten<br />
Form erst seit wenigen Jahren. Die Idee dazu<br />
ist aber nicht neu. Als eines der ersten Citizen<br />
Science-Projekte kann der Christmas Bird Count<br />
(dt.: Wintervogelzählung) angesehen werden, der<br />
im Jahr 1900 das erste Mal durchgeführt wurde.<br />
Anstatt der Tradition nachzugehen und Vögel zu<br />
jagen, schlug der US-amerikanische Ornithologe<br />
Frank M. Chapman vor, die Vögel zu zählen.<br />
Heute nehmen an den jährlich stattfindenden<br />
Vogelzählungen mehrere zehntausend<br />
Hobbyornithologen in den<br />
USA und Kanada teil.<br />
4
14<br />
19<br />
24<br />
38<br />
42<br />
46<br />
50<br />
54<br />
56<br />
Morgen<br />
Mengenlehre<br />
Crowdsourcing wird in Zukunft immer<br />
öfter eine Rolle spielen. Die Methode<br />
ist aber kein Allheilmittel.<br />
Von Ruth Reitmeier<br />
Kein Stau mehr auf<br />
der letzten Meile<br />
Das letzte Wegstück in der Lieferkette<br />
von Onlinebestellungen muss neu<br />
gedacht werden.<br />
Von Daniela Müller<br />
Kunst zeigt neue Wege auf<br />
Über Kunst, die Innovation anstößt.<br />
Christopher Lindinger von der Ars<br />
Electronica im Interview.<br />
Von Catherine Gottwald<br />
Wissenschaft zum Mitmachen<br />
Open Innovation in der Wissenschaft.<br />
Drei Pioniere der Citizen Science im<br />
Interview.<br />
Von Astrid Kuffner<br />
Ab in den Urlaub<br />
Wie könnte eine Reise mit der Familie<br />
in Zukunft aussehen, wenn Ideen<br />
aus der ÖAMTC Future Challenge<br />
umgesetzt sind?<br />
Von Johanna Stieblehner<br />
Zeit ist Geld<br />
Das fahrerlose Auto wird das<br />
Verkehrssystem verändern.<br />
Insassen wie Umwelt müssen sich auf<br />
die neue Art des Transports einstellen.<br />
Das wird dauern.<br />
Von Daniela Müller<br />
Gesund werden in<br />
einer zweiten Welt<br />
Die Rehabilitation der Zukunft wird<br />
vermehrt auf virtuelle Realitäten und<br />
Maschinen setzen, die dem Menschen<br />
individuelles Feedback geben.<br />
Von Ruth Reitmeier<br />
Start-ups<br />
Spannende Ideen zum<br />
Thema „<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong>“.<br />
Von Ancuta Barbu<br />
Die Kleidung denkt mit<br />
Smart-Clothes – Kleidung, die durch<br />
verwebte Hightech immer klüger<br />
wird und mitunter vor falschen<br />
Bewegungen warnt.<br />
Von Armin Winter<br />
Foto: © Karin Feitzinger<br />
19<br />
Foto: © waverlylabs.com Foto: © Florian Voggeneder<br />
24<br />
54<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
5
Mit<br />
anderen<br />
Augen<br />
gegen<br />
den<br />
Strom<br />
6<br />
Foto: © Karin Feitzinger
<strong>Neues</strong> vollBRINGt, wer bereIT dazu ist, auszubreCHen,<br />
MIT den Augen anderer zu sehen und bei BeDArf in die<br />
TrICKKIste der PsyCHOLOGIe zu greifen. Von Ruth Reitmeier<br />
In einer Wiener Bankfiliale hängt ein<br />
Bildschirm. Dort läuft das Security-<br />
Programm, das die Aktivität des Eingangsbereichs<br />
filmt und zeitgleich<br />
abspielt. Ein vielleicht fünfjähriges<br />
Mädchen beäugt zunächst fasziniert<br />
ihre Reflexion und beginnt dann wie<br />
vor einer interaktiven Spielkonsole<br />
zu tanzen. Da die Musik fehlt, singt<br />
sie selbst. Sie legt eine ziemlich gute<br />
Show hin, die endet, sobald ihr Vater<br />
seine Bankgeschäfte erledigt hat.<br />
Was dieses Beispiel zeigt: Das Kind<br />
hat es verstanden, einer Sicherheitseinrichtung<br />
einen ganz anderen<br />
Zweck zu verleihen, nämlich dem<br />
der Unterhaltung zur Überbrückung<br />
langweiliger Wartezeit.<br />
TrADITIOn ist<br />
MAnCHMAL auch<br />
ein Hindernis<br />
Unkonventionelle Ideen sind heute<br />
in fast allen Berufen und Branchen<br />
gefragt, doch das ist gerade in festgefahrenen<br />
Strukturen ein Widerspruch<br />
in sich. Tatsächlich führen<br />
Organisationen mit ihren tradierten<br />
Handlungsweisen nicht selten zu<br />
einer Fixiertheit der Belegschaft.<br />
Genau zu wissen, wie der Hase läuft<br />
und verinnerlichte Regeln stehen der<br />
Innovation im Weg. Das so oft geforderte<br />
„thinking outside the box“<br />
ist schwierig, wenn man im „Kastl“<br />
drinnen ist. In hochspezialisierten<br />
Fachabteilungen lässt es sich, wie<br />
es im Volksmund heißt, ungestört<br />
„im eigenen Saft schmoren“. Experten<br />
neigen dazu, auf ihr Tun so fixiert zu<br />
sein, dass sie keine Veranlassung<br />
sehen, Informationen mit anderen, die<br />
noch dazu weit weniger als sie selbst<br />
vom Fach verstehen, zu teilen. So soll<br />
es schon vorgekommen sein, dass<br />
in Großkonzernen zwei Abteilungen<br />
parallel an der Entwicklung desselben<br />
Produkts gearbeitet haben<br />
und es Monate dauerte, bis dies ans<br />
Tageslicht kam.<br />
Silodenken<br />
verhindert neue<br />
Ideen und sCHAfft<br />
so manCHes PrOBLem<br />
In der Managementliteratur nennt sich<br />
dieses Phänomen „Silodenken“ – ein<br />
etwas sperriger Begriff <strong>für</strong> das gängigere<br />
Wort „Inseldenken“. Die britische<br />
Finanzjournalistin Gillian Tett<br />
analysiert die Auswirkungen dieses<br />
Denkens in ihrem aktuellen Buch<br />
„The Silo Effect“. Ihr Ausgangspunkt<br />
war die Finanzkrise 2008, <strong>für</strong> die Tett<br />
zu einem guten Teil Inseldenken verantwortlich<br />
macht. Nicht nur, dass,<br />
wie sich herausstellte, Abteilungen<br />
großer Finanzinstitutionen nicht miteinander<br />
kommunizierten, operierte<br />
die Bankenwelt insgesamt in sich abgeschottet.<br />
Tett betont zwar, dass Silos durchaus<br />
ihre Berechtigung haben, dass es<br />
Kompetenzzentren braucht – denn<br />
wer will sich schon vom Orthopäden<br />
am offenen Herzen operieren lassen –,<br />
sie zeigt zugleich viele Fälle auf, wo es<br />
sinnvoll war, Fachbereiche zu öffnen<br />
und das Inseldenken zu überwinden.<br />
Nicht zu<br />
unterschäTZen:<br />
Die Lösungsideen<br />
VOn FachfreMDen<br />
Denn Fachfremde sehen Probleme<br />
und ihre Lösungen mitunter glasklar,<br />
die Experten mit Tunnelblick nicht<br />
wahrnehmen. Zuviel Wissen kann der<br />
Innovation durchaus im Wege stehen,<br />
nicht zuletzt deshalb, weil Dogmen<br />
verinnerlicht und mit dem Wissen<br />
verknüpfte Denkweisen als unveränderlich<br />
angesehen werden. Es gibt<br />
zahlreiche Beispiele in der Wissenschaftsgeschichte,<br />
wo echte Durchbrüche<br />
von Fachfremden geleistet<br />
wurden. Inzwischen haben führende<br />
Forschungs institutionen wie z. B. die<br />
US-Raumfahrtbehörde NASA auch<br />
dieses Problem erkannt und laden Tüftler<br />
aus ganz anderen Fachgebieten und<br />
aller Welt dazu ein, ihre Probleme zu lösen<br />
(siehe Artikel „Mengenlehre“, S. 14).<br />
KreATIVITät<br />
entsteht nICHT<br />
auf KnopfdruCK<br />
Eine unkonventionelle Lösung ist<br />
gesucht. Was tun? Die Aufgabenstellung<br />
erfordert einen Geistesblitz,<br />
doch der bleibt aus. Eine Idee muss<br />
her, eine ganz andere. Da stellt sich<br />
zunächst einmal die Frage, ob man<br />
dann eigentlich der/die Richtige <strong>für</strong><br />
den Job ist. Denn wenn eine völlig<br />
andere Lösung gefragt ist, braucht<br />
es ja vielleicht jemand anderen da<strong>für</strong>,<br />
den man sich kurzfristig dazu holen<br />
könnte. Oder zumindest einen anderen<br />
Zugang. Wenn der Druck steigt<br />
und trotzdem nichts kommt, hilft es<br />
vielleicht, sich bewusst zu machen,<br />
dass es keine Faustregel <strong>für</strong> Kreativität<br />
gibt.<br />
Es gibt nicht nur einen Weg, doch ein<br />
ganz guter ist Blaumachen. Man soll<br />
ja schließlich entspannt an die Sache<br />
herangehen. Macht man sich jedoch<br />
mit dem fixen Plan nachmittags ins<br />
Freibad auf, dass einem dort beim<br />
Slalomschwimmen durch aufgekratzte<br />
Kinder der zündende Gedanke kommen<br />
wird, ist das gemogelt und wird<br />
vermutlich nicht funktionieren. Denn<br />
die wirklich guten Einfälle passieren,<br />
wenn man eben nicht mit ihnen rechnet.<br />
Spontan. So bleiben vom geschwänzten<br />
Nachmittag im Freibad<br />
vermutlich ein leichter Sonnenbrand<br />
und die hohen Preise am Kiosk in<br />
Erinnerung, der Geistesblitz aber aus.<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
7
Man sollte sich wohl wilder, instinktiver<br />
ins Abenteuer des Neuen stürzen<br />
und in der Art von Werbeguru Don<br />
Draper, dem Helden der TV-Serie<br />
Mad Men, an die Dinge herangehen.<br />
Der setzt sich dann eben ins Auto und<br />
fährt drauflos, begegnet neuen Menschen,<br />
sammelt Erfahrungen, um am<br />
Ende mit einer brillianten Idee <strong>für</strong> eine<br />
Werbekampagne in die New Yorker<br />
Agenturwelt zurückzukehren. Don<br />
Draper hat es natürlich leicht, denn er<br />
ist ein fiktiver Charakter, der sich die<br />
ausgedehnten Spritztouren erlauben<br />
kann. Denn einen Nachmittag einfach<br />
die Arbeit zu schwänzen ist das eine,<br />
sich jedoch wie Don über Wochen aus<br />
dem Staub zu machen, um sein eigenes<br />
Roadmovie zu leben, eine ganz andere<br />
Liga der Verantwortungslosigkeit, die<br />
nicht jedem möglich ist.<br />
DisTAnz zum eIGenen<br />
ICH aufbauen und<br />
MIT anderen Augen<br />
sehen<br />
Wie kann man dennoch den Trott<br />
ausbremsen und zu neuen Ufern<br />
aufbrechen? Inzwischen ist ganz gut<br />
erforscht, wie man dem kreativen<br />
Denken auf die Sprünge helfen kann –<br />
etwa durch Perspektivenwechsel.<br />
Wer stets in den gleichen gedanklichen<br />
Bahnen nach einer neuen Idee<br />
sucht, wird sie vermutlich nicht finden.<br />
Es empfiehlt sich, ab und an die Welt<br />
mit anderen Augen zu sehen. Aus der<br />
Psychologie wissen wir: Es ist vor<br />
allem das Ich, das uns dabei im Wege<br />
steht. Doch um anders zu denken,<br />
müssen wir zwischenzeitlich zum<br />
Ich auf Distanz gehen und uns vorstellen,<br />
wir seien jemand anders.<br />
Durch solche Ausflüge der Fantasie<br />
läuft der Mensch aber nicht gleich<br />
Gefahr, beim Psychiater zu landen.<br />
Rollenwechsel ist schließlich des<br />
Schauspielers täglich Brot.<br />
GrieCHenland als<br />
sTICHWOrt der<br />
ImaginATIOn<br />
Distanz wirkt. Um Ideen auf die<br />
Sprünge zu helfen, kann es schon<br />
reichen, sich vorzumachen, dass der<br />
Aufgabensteller oder Auftraggeber<br />
ein ganz anderer ist, am besten aus<br />
einem weit entfernten Land. Das<br />
Wissenschaftsmagazin „Spektrum“<br />
berichtet von einem Experiment, das<br />
der Psychologe Lile Jia an der Indiana<br />
University (USA) durchführte. Er beauftragte<br />
zwei Gruppen von Studenten,<br />
sich möglichst viele Transportmittel<br />
vorzustellen. Einer Gruppe gab er<br />
noch mit, dass die Aufgabenstellung<br />
von Griechen erdacht wurde. „Griechenland“<br />
reichte, um die Fantasie der<br />
Studenten auf Reisen zu schicken.<br />
Das Team erdachte neben dem<br />
Standardprogramm einige unkonventionelle<br />
Transportmittel wie die Meditation<br />
oder Fortbewegung durch Radschlag.<br />
Träumen als<br />
Ideen-TurBO<br />
Lässt der rettende Geistesblitz aber<br />
auf sich warten, ist es wichtiger denn<br />
je, gut zu schlafen. Der Beweis ist<br />
zwar noch nicht eindeutig erbracht,<br />
jedoch geht die Forschung davon aus,<br />
dass in traumreichen Tiefschlafphasen<br />
bestimmte, <strong>für</strong> die Impulskontrolle<br />
wichtige Gehirnregionen quasi dicht<br />
machen. Beim angeregt Träumenden<br />
sind also Kontrollsysteme heruntergefahren<br />
und das entfesselte Gehirn<br />
verknüpft Informationen miteinander,<br />
die im Wachzustand wohl nicht zustande<br />
kämen. Fazit: Tief zu schlafen<br />
tut der Kreativität richtig gut. Und<br />
wenn trotz allem gar nichts kommt,<br />
empfehlen Experten, dazwischen an<br />
etwas anderem zu arbeiten. Das Neue<br />
lässt sich eben nicht erzwingen.<br />
In anderen<br />
fACHGebieten<br />
nACH Ideen sTÖBern<br />
Multi(fa)kulti ist ein bewährtes Ambiente<br />
<strong>für</strong> Innovation. Der Unternehmensberater<br />
Frans Johansson zeigt<br />
in seinem Buch „The Medici Effect“,<br />
dass Kollisionen oder auch Kombinationen<br />
unterschiedlicher Fachgebiete<br />
Innovation hervorbringen. Die Menschen<br />
hinter den großen Ideen<br />
be geben sich mitunter durchaus<br />
bewusst an interdisziplinäre Überschneidungspunkte,<br />
um dort ihre<br />
kreative Kraft zu entzünden. Wie<br />
etwa Architekt Mick Pearce, der<br />
durch die Verknüpfung von menschlichem<br />
Planen und jenem der Natur<br />
bahnbrechende Bauten geschaffen<br />
hat, wie den Büro- und Shoppingkomplex<br />
Eastgate Centre in Harare<br />
(Simbabwe), der ohne Klimaanlage<br />
auskommt und trotzdem eine Innentemperatur<br />
von 22 bis maximal 25<br />
Grad hält. Pearce dienten dabei die<br />
Prinzipien des Termitenbaus als Vorbild.<br />
Das genaue Gegenteil<br />
denken, um auf <strong>Neues</strong><br />
zu kommen<br />
Johansson teilt ein paar Tricks mit<br />
seinen Lesern, wie man aus der<br />
Spur denkt oder etwa das genaue<br />
Gegenteil von gesicherten Fakten<br />
anzunehmen. Das funktioniert so:<br />
Wir wissen, dass im Restaurant Essen<br />
serviert wird. Die entgegengesetzte<br />
Behauptung lautet also: Im Restaurant<br />
wird kein Essen serviert. Und<br />
dies kann der Grundstein eines Geschäftsmodells<br />
sein, wo Gäste ihr<br />
eigenes Essen mitbringen und da<strong>für</strong><br />
bezahlen, dass sie in einer schönen<br />
Location mit Freunden zusammenkommen.<br />
Das Neue in die WeLT<br />
zu bringen, ist nICHT<br />
leICHT<br />
Doch machen wir uns nichts vor,<br />
gegen den Strom zu schwimmen ist<br />
schwer, Gruppendruck und Anderssein<br />
stresst. Routine hingegen garantiert<br />
einen reibungslosen Alltag in der<br />
Komfortzone ohne allzu hohe Wellen<br />
und tiefe Konflikte. Mit völlig neuen<br />
Konzepten tun sich viele Menschen<br />
schwer und oft auch mit den Menschen,<br />
die sie parat haben. Der Wissenschaftsjournalist<br />
Jürgen Schaefer<br />
bringt es auf den Punkt, wenn er<br />
meint, Querdenker seien oft erst dann<br />
populär, wenn sie lange genug tot<br />
sind, im eigenen Team schätze man<br />
sie eher nicht. Zugleich braucht die<br />
Menschheit aber die unbequemen<br />
Spinner. Denn ohne Querdenker<br />
8
Foto: © Karin Feitzinger<br />
Nicht selten nimmt man aufgrund des eigenen Silodenkens nur einen kleinen Ausschnitt der Realität wahr.<br />
Durch die Brille eines anderen zu schauen, eröffnet oft einen ganz neuen Horizont.<br />
säßen wir vermutlich noch in der<br />
Höhle. Alles, was wir heute wissen,<br />
war einmal gedankliches Neuland.<br />
Kreativität ist laut dem deutschen<br />
Physiker und Nobelpreisträger Gerd<br />
Binnig im Wesentlichen die Fähigkeit<br />
zur Evolution.<br />
GrOsse<br />
Wissenschafter<br />
MITunter verKAnnt<br />
In der Geschichte der Wissenschaft<br />
wimmelt es von Fällen großer Denker,<br />
die zu ihren Lebzeiten <strong>für</strong> verrückt erklärt<br />
wurden, darunter Galileo Galilei,<br />
der das Weltbild neu erfand, oder der<br />
Entdecker des Kindbettfiebers, Ignaz<br />
Semmelweis. Gerd Binnig beschreibt<br />
in seinem Buch „Aus dem Nichts“,<br />
dass ihm und den beiden anderen Erfindern<br />
des Rastertunnelmikroskops,<br />
<strong>für</strong> das die Wissenschafter 1986 den<br />
Nobelpreis entgegennahmen, zwar<br />
nicht gerade mit Scheiterhaufen oder<br />
Irrenanstalt gedroht wurde, doch<br />
auch ihnen schlug offene Aggression<br />
aus Teilen der Scientific Community<br />
entgegen. „Es sind Leute zu uns<br />
ins Labor gekommen und haben uns<br />
angeschrien, wir seien Lügner“, erinnert<br />
sich Binnig noch Jahre später.<br />
Der Physiker beschreibt die psychologischen<br />
Barrieren im wissenschaftlich-kreativen<br />
Prozess anhand der eigenen<br />
Erfahrung: Das Konzept des<br />
Rastertunnelmikroskops war entwickelt,<br />
dann wurde es gebaut. Die Realisierung<br />
hatte bereits fast ein Jahr an Zeit,<br />
Werkstattkosten und Arbeitseinsatz<br />
verschlungen, als sich das Erfinderteam<br />
eingestehen musste, dass es<br />
den falschen Weg eingeschlagen<br />
hatte. Das Ding funktionierte nicht.<br />
Die Angst vor der<br />
ReAKTIOn anderer<br />
heMMT Innovation<br />
Dies sei laut Binnig der wichtigste<br />
und zugleich schwerste Entschluss in<br />
der gesamten Entwicklung gewesen.<br />
Denn nicht nur die Mechaniker, sondern<br />
die Wissenschafter selbst waren<br />
von sich enttäuscht. Sie brachen also<br />
die Arbeit am Prototyp ab, ohne<br />
Garantie, dass sie es beim nächsten<br />
Anlauf besser machen würden.<br />
Binnig betont, dass es, wenn auch<br />
sinnlos, viel leichter gewesen wäre,<br />
noch eine Zeit lang daran herumzudoktern.<br />
Sein Fazit: Die Angst vor<br />
Verachtung führt dazu, dass wir oft<br />
Dinge tun, von denen wir wissen,<br />
dass sie unsinnig sind. Im konkreten<br />
Fall nahm die Geschichte ein gutes<br />
Ende, der Neustart führte letztlich<br />
dazu, dass das Rastertunnelmikroskop<br />
den Nobelpreis <strong>für</strong> Physik abräumte.<br />
Nach einer fALsCHen<br />
EntsCHeidung<br />
einfACH eine neue<br />
treffen<br />
Ob man nun offen <strong>für</strong> das Neue ist,<br />
ist vor allem eine Lebenseinstellung.<br />
Das Geheimnis von Menschen, die<br />
mit dieser Grundhaltung durch ihr<br />
Leben gehen und sich nicht vor dem<br />
Neuen drücken, liegt nicht zuletzt<br />
darin, ihm wertfrei zu begegnen.<br />
Steht eine größere Entscheidung an,<br />
die vieles verändern wird, vertrauen<br />
sie zudem darauf, dass man, sollte<br />
sich diese zuletzt gefällte Entscheidung<br />
als Fehler herausstellen, ja<br />
auch wieder eine neue treffen kann. •<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
9
Sesam<br />
öffne<br />
dich<br />
10<br />
Foto: © Karin Feitzinger
In einer digitalisierten Welt mit hochdynAMIsCHen MarKTstruKTuren<br />
sind alte LösuNGen <strong>für</strong> neue PROBleme keINe Option meHR.<br />
Wenn sICH OrGAnisATIOnen zu InnovationsZWeCKen nicht öffnen,<br />
sind sie auf der VerLIererstrAsse. <strong>Neues</strong> von aussen hereinzuHOLen,<br />
ist aber auCH kein SpazierGAng.<br />
Von Silvia Wasserbacher-Schwarzer<br />
Der Chauffeur-Dienstleister Uber besitzt<br />
keine Fahrzeugflotte, der Online-<br />
Videodienst und Filmproduzent Netflix<br />
keine Kinosäle, der Telefondienst<br />
Skype keine Telefon-Infrastruktur. Nur<br />
drei Beispiele <strong>für</strong> Unternehmen, die<br />
mit innovativen Geschäftsmodellen<br />
Erfolg haben. „Wenn Organisationen<br />
glauben, dass sie sich der Digitalisierung<br />
und den damit einhergehenden<br />
sehr schnellen sozialen und gesellschaftlichen<br />
Veränderungen entziehen<br />
können, sind sie am Holzweg“,<br />
bringt es Werner Wutscher, Founder,<br />
Unternehmer und Start-up-Experte<br />
auf den Punkt. „Märkte und Gesellschaft<br />
entwickeln sich in einem sehr<br />
hohen Tempo. Dem können Unternehmen<br />
nur schwer nachkommen. Schon<br />
gar nicht, wenn sie sich nur auf interne<br />
Innovationsprozesse verlassen.“<br />
„CuLTure eATs strATegy<br />
for breAKfast“ –<br />
Unternehmenskultur<br />
KAnn innovationshemmend<br />
wirken<br />
Öffnung <strong>für</strong> Innovationszwecke<br />
ist nicht immer leicht. Kleineren<br />
Unternehmen fehlt es oftmals an<br />
Ressourcen. Große Unternehmen<br />
sind vor allem kulturell und mit ihren<br />
Compliance-Richtlinien oft meilenweit<br />
davon entfernt, auf schnellen Input<br />
von außen zu reagieren – sei es über<br />
Crowdsourcing-Prozesse, über den<br />
Input von Lead Usern, bzw. Experten<br />
(Anm.: besonders fortschrittliche<br />
Anwender, die <strong>für</strong> sehr spezifische<br />
Innovationsfragen gesucht und<br />
konsultiert werden können), oder<br />
über die Zusammenarbeit mit Startups.<br />
Und dennoch: Einige Organisa-<br />
tionen haben den Schritt bereits gewagt,<br />
weil sie erkannt haben, dass<br />
neue Probleme nicht mit alten Lösungen<br />
bedient werden können. Die<br />
Fraunhofer-Gesellschaft befragte<br />
etwa gemeinsam mit der University of<br />
California in Berkeley 125 Führungskräfte<br />
aus Unternehmen in Europa<br />
und den USA, wie sie Open Inno vation<br />
(Anm.: offene Innovationsprozesse)<br />
praktizieren. 78 Prozent der<br />
Befragten gaben an, seit mehreren<br />
Jahren einem offenen Innovationsansatz<br />
zu folgen. Keines dieser Unternehmen<br />
ist bisher zum rein geschlossenen<br />
Ansatz zurückgekehrt.<br />
<strong>Offen</strong>e Innovation<br />
ist nICHT den<br />
GrOssKOnzernen<br />
VOrbehalten<br />
In die Reihe bekannter Großkonzerne<br />
und Multis, die offene Innovationsprozesse<br />
fest in ihr System integriert haben<br />
– etwa Siemens, Coca Cola oder<br />
Nestlé, reihen sich auch immer mehr<br />
kleinere Unternehmen, NGOs und<br />
Vereine ein. Etwa der ÖAMTC. Als<br />
größter Verein Österreichs mit über<br />
zwei Millionen Mitgliedern und einer<br />
120-jährigen Geschichte hat der Mobilitätsclub<br />
im Herbst 2015 mit der<br />
Planung eines Crowdsourcing-Prozesses<br />
begonnen. Unter dem Titel<br />
„ÖAMTC Future Challenge“ wollte<br />
er sich als Mitgliederorganisation an<br />
eben diese und die breite Öffentlichkeit<br />
wenden. „Wir leben in einer Zeit,<br />
in der auch Mobilität einem starken<br />
Veränderungsprozess unterworfen<br />
ist. Es war klar, dass wir in die Frage,<br />
was wir tun können, um bei unseren<br />
Mitgliedern relevant zu sein und auch<br />
zu bleiben, die Mitglieder selbst miteinschließen<br />
müssen“, erklärt Florian<br />
Moosbeckhofer, Leiter der Abteilung<br />
Innovation und Mobilität im ÖAMTC.<br />
Über eine eigens eingerichtete<br />
Crowdsourcing-Plattform konnten<br />
alle Interessierten im Zeitraum April/<br />
Mai 2016 ihre Ideen zur Frage „Wie<br />
kann der ÖAMTC Menschen in ihrer<br />
Mobilität künftig noch besser unterstützen?“<br />
einreichen. „Wir haben<br />
nicht nur 450 Ideen und Konzepte<br />
erhalten, die inhaltlich sehr interessant<br />
waren. Es wurde uns auch vermittelt,<br />
wie der ÖAMTC wahrgenommen<br />
wird.“ Viele Ideen beziehen sich<br />
auf Services, die nur dann funktionieren,<br />
wenn Kunden dem Anbieter stark<br />
vertrauen. Etwa der Vorschlag, dass<br />
der ÖAMTC einen Schlüssel-Notfalldienst<br />
anbieten solle: Man hinterlegt<br />
einen Zweitschlüssel beim ÖAMTC.<br />
Schließt man sich aus der eigenen<br />
Wohnung aus, so könnte man einen<br />
Gelben Engel rufen, der zur Adresse<br />
kommt und nach Identitätsüberprüfung<br />
den Schlüssel aushändigt. Hintergrund<br />
der Idee sei einerseits die<br />
ständige Erreichbarkeit des ÖAMTC,<br />
die bei Freunden und Nachbarn nicht<br />
gegeben ist. Zusätzlich würden teure<br />
Sicherheitsschlösser durch ein nötiges<br />
Aufbrechen durch einen Schlüsseldienst<br />
nicht beschädigt werden.<br />
NeTZWerkgeseLLsCHAft<br />
verLAnGT Öffnung<br />
In Österreich sind es noch nicht<br />
sehr viele Organisation, die sich <strong>für</strong><br />
Innova tionszwecke öffnen, „obwohl<br />
wir durch die Digitalisierung und<br />
Globalisierung in einer Netzwerk-<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
11
Foto: © Schindler AG<br />
Innovation durch Öffnung: Der Fahrtreppenhersteller Schindler AG mit Niederlassungen auf der ganzen Welt und<br />
vielen Jahrzehnten an Tradition holt sich Innovations-Know-How auch aus analogen Märkten – Bereiche fern der<br />
eigenen Branche mit ähnlichen Problemstellungen, die bereits über interessante Lösungen verfügen.<br />
gesellschaft leben und die Voraussetzung<br />
<strong>für</strong> Austausch und Kooperationen<br />
gegeben wären“, wie Ursula<br />
Maier-Rabler es beschreibt. Die<br />
stellvertretende Leiterin der Abteilung<br />
Center for Information and Communication<br />
Technologies & Society im<br />
Fachbereich Kommunikationswissenschaft<br />
der Universität Salzburg beschäftigt<br />
sich schon lange mit diesem<br />
Thema. Umgelegt auf Organisationen<br />
bedeute dies, dass ein isoliertes Arbeiten<br />
künftig nicht mehr funktioniere.<br />
GesCHLOssene Türen<br />
aus Angst vor dem<br />
Machtverlust<br />
„In Österreich stehen wir aber vor der<br />
kulturell bedingten Herausforderung,<br />
dass man dem Teilen von Wissen und<br />
Information eher skeptisch gegenübersteht.<br />
Man hat Angst vor einem<br />
ökonomischen Machtverlust.“ Fortschrittlichere<br />
Informationskulturen,<br />
wie Maier-Rabler sie nennt, fände<br />
man in skandinavischen Ländern<br />
wie Schweden, aber auch in England,<br />
Irland und den USA. Begründet sei<br />
das mitunter in einer protestantischen<br />
Wirtschaftsauffassung, bei der der<br />
Erfolg des Einzelnen als positiv empfunden<br />
werde.<br />
Interne ErWArtungen<br />
sind heMMnisse in<br />
innOVATIOnsprojeKTen<br />
Ob eine offene Innovationsoffensive<br />
gelingt, hängt mitunter auch ganz<br />
stark von internen Prozessen und der<br />
Innovationskultur einer Organisation<br />
ab, etwa von den Erwartungen verschiedener<br />
Abteilungen die Ergebnisse<br />
betreffend. Eine Studie der<br />
Fachhochschule Wels in Oberösterreich<br />
ergab, dass interne Interessenskonflikte<br />
zwischen beteiligten Abteilungen<br />
<strong>für</strong> enttäuschte Erwartungen<br />
sorgen können: Versteht das Marketing<br />
ein Crowdsourcing-Projekt vor allem<br />
als Online-Kommunikation mit hohem<br />
Aufmerksamkeitsfaktor, erwartet die<br />
Produktentwicklung umsetzbare Innovationsideen.<br />
Um das zu über brücken,<br />
braucht es gezieltes Training <strong>für</strong> die<br />
Mitarbeiter. Die Lappeenranta University<br />
of Technology in Finnland<br />
entwickelte beispielsweise ein Open<br />
Innovation Competence Model mit<br />
26 Kernkompetenzen, die es sich als<br />
Mitarbeiter anzueignen gilt: Unter<br />
anderem sind darin Collaboration<br />
Skills (z. B. Networking, Aufbau von<br />
Vertrauen), Explorative Skills (z. B.<br />
Flexi bilität, Fehlertoleranz) und<br />
12
Foto: © Karin Feitzinger<br />
Organisationen können sich vor<br />
globalen Vernetzungen nicht<br />
mehr abschotten. Wer den Anschluss<br />
nicht verpassen will, muss offen sein<br />
und auch außerhalb seiner Organisation<br />
nach Neuem suchen.<br />
sogenannten exploitative Skills<br />
(Management von Schutzrechten,<br />
Verhandlungsgeschick) enthalten.<br />
Schindler<br />
fAHrtrePPen<br />
arbeitet seit<br />
jAHren mit offenen<br />
InnOVATIOnsmeTHODen<br />
„Mutig sein, Risiko eingehen, Fehler<br />
zulassen“, sind aus Wutschers Erfahrung<br />
die größten Herausforderungen<br />
<strong>für</strong> Organisationen, die sich zum ersten<br />
oder mitunter zweiten Mal zu Innovationszwecken<br />
nach außen hin<br />
öffnen. Einer, der dies bereits hinter<br />
sich hat, ist Thomas Novacek. Der<br />
Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung<br />
des Fahrtreppenherstellers<br />
Schindler AG mit Niederlassungen<br />
auf der ganzen Welt sieht in<br />
der Öffnung vor allem eines: Den entscheidenden<br />
Wettbewerbsvorteil.<br />
„Wir haben schon einige Open Innovation-Projekte<br />
durchgeführt. Innovation,<br />
abgeschottet von der Außenwelt,<br />
würde <strong>für</strong> uns nicht funktionieren.“<br />
GesCHLOssene<br />
InnOVATIOn<br />
aufgrund globalen<br />
WeTTBewerbs nICHT<br />
mehr möglich<br />
Der globale Wettbewerb sei enorm –<br />
ob im High-End-Bereich, in dem<br />
es vor allem um qualitativ sehr<br />
hochwertige Produkte gehe, oder im<br />
Low-End-Bereich, in dem vor allem<br />
der Preis das Geschäft bestimme.<br />
„Wenn wir da mithalten wollen, vor<br />
allem mit der Konkurrenz aus China,<br />
müssen wir schauen, was um uns<br />
herum passiert.“ Ein Blick in sogenannte<br />
analoge Märkte sei oft sehr<br />
gewinnbringend. Dabei handelt es<br />
sich um Bereiche fern der eigenen<br />
Branche mit ähnlichen Problemstellungen,<br />
die jedoch bereits über interessante<br />
Lösungen verfügen. Daraus<br />
kann man lernen. Novacek, der während<br />
seines Studiums an der US-<br />
Elite-Universität MIT in Boston erstmals<br />
mit Open Innnovation-Methoden<br />
in Kontakt gekommen ist, schätzt den<br />
Vorsprung auf die Konkurrenz durch<br />
die Anwendung von Open Innovation-<br />
Methoden und -Prinzipien in der täglichen<br />
Entwicklungsarbeit auf mehrere<br />
Jahre.<br />
TransdisZIPLInäres<br />
Arbeiten auCH<br />
<strong>für</strong> UniversITäten<br />
sCHWIerig<br />
Zu traditionellen Organisationen<br />
zählen auch Universitäten. Diesen<br />
gelinge es schwer, aus ihrem Silodenken<br />
herauszukommen. „Es gab<br />
immer wieder Versuche, interdisziplinäre<br />
Institute zu etablieren“, so Maier-<br />
Rabler. Es hake aber an der Praxis,<br />
dass Förderungen vor allem an jene<br />
ausgegeben werden, die eng an ihrer<br />
Kerndisziplin forschen. „Die eingereichten<br />
Projekte werden von Einzelwissenschaftern<br />
begutachtet, die danach<br />
trachten, dass ihr Fachgebiet<br />
möglichst stark vertreten ist.“ Auch<br />
der Publikationsdruck in Fachzeitschriften<br />
fördere keine Kultur der<br />
<strong>Offen</strong>heit. Schließlich komme auch<br />
eine persönliche Komponente hinzu.<br />
„Wenn ich transdisziplinär arbeiten<br />
will, muss auch ich mich ändern. Ich<br />
muss den Fachbereich, aus dem ich<br />
komme, hinter mir lassen und mich<br />
auf andere und anderes einlassen.<br />
Sonst kann nichts <strong>Neues</strong> entstehen.“<br />
ÖAMTC <strong>für</strong> Ideen aus<br />
der CrOWD weiterHIn<br />
erreichbar<br />
Zurück zum ÖAMTC: Wie viele Ideen<br />
aus dem Crowdsourcing-Projekt tatsächlich<br />
umgesetzt werden, kann<br />
Florian Moosbeckhofer heute noch<br />
nicht sagen. Man wolle jedenfalls<br />
rasch in eine Umsetzung kommen.<br />
Ein wichtiger Faktor sei es, mit den<br />
Ideen gebern und Ideengeberinnen<br />
weiter in Kontakt zu bleiben, um die<br />
Konzepte weiterentwickeln zu können.<br />
Auch Fokusgruppen seien vorstellbar.<br />
„Wir haben so viel wertvollen Input<br />
von außen bekommen, diesen Kanal<br />
möchten wir unbedingt offenhalten“,<br />
freut sich Moosbeckhofer. „Wir planen<br />
zwar derzeit kein neues Open Innovation-Projekt,<br />
möchten aber unbedingt<br />
<strong>für</strong> Ideen aus der Community<br />
offen sein. Über die E-Mailadresse<br />
innovation@oeamtc.at sind wir auch<br />
weiterhin erreichbar.“ Moosbeckhofer<br />
könne jedem nur empfehlen, einen<br />
offenen Innovationsprozess zu wagen,<br />
obwohl dahinter viel Arbeit stecke.<br />
„Und jetzt geht es ans Abarbeiten<br />
der vielen Ideen aus der ÖAMTC<br />
Future Challenge.“ •<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
13
Mengenlehre<br />
14<br />
Foto: © Karin Feitzinger
CROwdsouRCING ist eIN noch juNGes INNOVAtionsINstrument mit<br />
VIel Potenzial. Was vor wenigen Jahren aufgrund der fehlenden<br />
TeCHnologie noch nicht möglich war, ist heute eine vieLGeLOBTe<br />
InnovationsmeTHODe. Nicht nur in der WirtsCHAft, auCH in der<br />
WissensCHAft und sOGAr in der POLITIK gibt es erfolgreICHe<br />
ProjeKTe. Aber nICHT jede FrAGe kann die CrOWD, also FreIWILLIGe,<br />
DIe an einem CrOWDsourcing-Projekt mitmachen, beanTWOrten.<br />
Von Ruth Reitmeier<br />
Polizeiliche Fahndungsfotos oder<br />
Wanted-Poster im Wilden Westen,<br />
die sich an Unbekannte richten, in<br />
der Hoffnung, dass sie über wertvolle<br />
Information verfügen, sind Crowdsourcing<br />
in seiner Urform. „Die Verbreitung<br />
des Internets markiert einen<br />
Paradigmenwechsel“, sagt der Experte<br />
<strong>für</strong> webbasierte Innovation<br />
Thomas Gegenhuber von der<br />
Johannes Kepler Universität Linz.<br />
Mittlerweile richten sich Aufrufe zu<br />
allen möglichen Themen und Problemstellungen<br />
an unterschiedliche<br />
Zielgruppen. Prinzipiell kann jeder<br />
Mensch eine Crowd erreichen und<br />
mobilisieren. Tatsächlich bedienen<br />
sich aber vor allem größere Unternehmen,<br />
Organisationen und Institutionen<br />
dieser Kommunikationsform,<br />
und nicht überall, wo Crowdsourcing<br />
draufsteht, ist es auch drin. „Es ist<br />
teilweise ein Hype“, sagt Gertraud<br />
Leimüller, Expertin <strong>für</strong> Innovationsmanagement,<br />
„die Bandbreite der<br />
Projekte reicht von der einfachen Suche<br />
nach einem neuen Markenclaim<br />
bis hin zu differenzierten Aufgaben<br />
wie etwa technische Lösungen <strong>für</strong><br />
sehr spezifische Industrieprobleme.“<br />
In der Welt der Unternehmen wird aktuell<br />
intensiv experimentiert. Welche<br />
Standards sich dabei etablieren, wird<br />
die Zukunft zeigen. Als sicher gilt jedoch,<br />
dass es sich beim Crowdsourcing<br />
um mehr als eine Mode erscheinung<br />
handelt. Als Innovationsmethode ist es<br />
<strong>für</strong> Unternehmen wie Organisationen<br />
unverzichtbar geworden.<br />
Beim CrOWDsourcing<br />
geHT es nICHT immer<br />
nur um neue Ideen<br />
Die Crowd wird zumeist dann befragt,<br />
wenn sich Unternehmen auf der Suche<br />
nach Innovation öffnen wollen<br />
oder müssen, wenn es darum geht,<br />
Riesenprojekte zu verwirklichen oder,<br />
um neuartige Zugänge und Lösungen<br />
<strong>für</strong> ein Problem zu finden, an dem<br />
sich andere vergeblich die Zähne<br />
ausgebissen haben. Dabei geht es<br />
selten um die Lösung allein, sondern<br />
auch um das Einbeziehen der Menschen,<br />
sei es, um eine direkte Verbindung<br />
zum Markt herzustellen und/<br />
oder um Projekt-Botschafter zu gewinnen.<br />
Wer heute eine Crowd hat,<br />
also eine Gruppe an Menschen, die<br />
sich <strong>für</strong> die von einer Organisation<br />
zur Lösung gestellten Probleme interessiert<br />
und auch über das jeweils<br />
relevante Wissen verfügt, kann sich<br />
glücklich schätzen und ist gut beraten,<br />
sie zu pflegen. Transparenz<br />
und Feedback sind das Um und Auf.<br />
Denn die Crowd ist das Kostbarste<br />
überhaupt. So kann Missbrauch des<br />
Instruments zu Marketingzwecken<br />
einem Unternehmen mehr schaden<br />
denn nutzen. „Menschen durchschauen<br />
das und reagieren sehr<br />
empfindlich, sobald sie sich ausgenutzt<br />
fühlen“, betont Leimüller.<br />
Die NASA nuTZT<br />
Crowdsourcing<br />
seit Jahren<br />
Läuft es jedoch gut, vermag eine<br />
hochmotivierte Crowd innovative<br />
Lösungen zu finden, die anders kaum<br />
zu erbringen wären: Die US-Raumfahrtbehörde<br />
NASA war mit ihrem<br />
Latein am Ende. Unzufrieden mit den<br />
eigenen Versuchen, ein Verfahren<br />
zur Vorhersage von Sonnenaktivität<br />
zu entwickeln – mehrere Jahre Arbeit<br />
und Ausgaben in zweistelliger Millionenhöhe<br />
hatten lediglich eine 55-prozentige<br />
Prognosesicherheit gebracht –,<br />
wandte sie sich 2010 an Innocentive,<br />
eine hochspezialisierte Crowdsourcingplattform,<br />
die über ein Netzwerk<br />
von mehr als 350.000 poten ziellen<br />
Problemlösern verfügt. Innocentive<br />
stellte den Aufruf samt Preisgeld von<br />
30.000 US-Dollar <strong>für</strong> die beste Idee<br />
online. Innerhalb von drei Monaten<br />
interessierten sich 500 Personen aus<br />
53 Ländern <strong>für</strong> das Problem, elf<br />
reichten Lösungsvorschläge ein.<br />
Die SonnenAKTIVITät<br />
VOn der Erde aus<br />
besTIMMen<br />
Wettbewerbssieger wurde ein pensionierter<br />
Telekommunikationstechniker,<br />
dessen Lösung eine 81-prozentige<br />
Prognosesicherheit <strong>für</strong> Sonnenaktivität<br />
liefert. Seine Methode stützt sich<br />
auf Daten, die von der Erde aus erhoben<br />
werden können. Die NASA hatte<br />
zuvor – was sonst – ausschließlich<br />
Satellitendaten benutzt. „Ohne<br />
Crowdsourcing hätte man diesen<br />
Mann wohl nie gefunden“, sagt Gegenhuber.<br />
Das Preisgeld ist übrigens<br />
meist nur ein erster Motivationsfaktor,<br />
sich eine Lösung <strong>für</strong> das Problem zu<br />
überlegen. Es gibt sogar Projekte,<br />
bei denen es gar keinen materiellen<br />
Preis gibt. Oftmals beteiligen sich die<br />
Menschen allein deshalb, weil ihnen<br />
die Lösung des Problems wirklich am<br />
Herzen liegt.<br />
Überhaupt scheint die NASA die<br />
Crowd als Talentepool entdeckt zu<br />
haben, bediente sie sich doch auf der<br />
Suche nach einem Algorithmus des<br />
Big-Data-Portals Kaggle. Dort treiben<br />
sich vorwiegend Datenexperten<br />
herum, die sich mit smarten Lösungen<br />
um attraktive Preisgelder matchen.<br />
Die Aufgabenstellung der NASA:<br />
Mit Hilfe von 100.000 Bildern von<br />
Galaxien sollten die Tüftler einen Algorithmus<br />
entwickeln, der Hinweise<br />
auf dunkle Materie aufspürt und so<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
15
hilft, das Universum zu vermessen.<br />
In weniger als einer Woche stieß<br />
unerwarteterweise ein Cambridge-<br />
Student der Geologie, spezialisiert<br />
auf Gletscherkunde, auf eine Lösung,<br />
die mit den Ergebnissen der besten<br />
NASA-Experten durchaus mithalten<br />
konnte.<br />
Nicht jede FrAGe<br />
ist geeIGnet <strong>für</strong><br />
die Menge<br />
Crowdsourcing ist aber nicht die Lösung<br />
<strong>für</strong> jede Frage. Etwa, wenn eine<br />
Organisation schon weiß, was sie als<br />
Lösung <strong>für</strong> ein Problem ausschließen<br />
will. Oder wenn gewiss ist, dass sich<br />
die potenzielle Zahl derer, die eine<br />
Frage beantworten oder Ideen einreichen<br />
könnten, auf wenige Menschen<br />
weltweit beschränkt. Das ist bei ganz<br />
spezifischen Problemen der Fall. Hier<br />
sind andere Open Innovation-Methoden<br />
zielführender, etwa die Suche<br />
nach Lead Usern.<br />
Im Bereich der<br />
Wissenschaft ist<br />
üBerseTZungsleistung<br />
gefrAGT<br />
Oft geht es in der Wissenschaft nicht<br />
nur darum, geniale Lösungen aus den<br />
Daten zu heben. Zunächst müssen<br />
diese erst gesammelt werden.<br />
Millionenfach. Die Forschung hat<br />
die Kapazitäten der Crowd längst<br />
<strong>für</strong> sich entdeckt, um Megaprojekte<br />
zu realisieren, die anders kaum finanzierbar<br />
wären oder viel zu viel Zeit in<br />
Anspruch nehmen würden. Damit<br />
Laien an solchen wissenschaftlichen<br />
Projekten mitarbeiten können, müssen<br />
sich Wissenschafter erst einmal<br />
vom Fachchinesisch verabschieden<br />
und die konkrete Aufgabenstellung<br />
verständlich formulieren. Gelingt das,<br />
so vermag die mobilisierte Masse<br />
wissenschaftliche Herkulesaufgaben<br />
zu übernehmen und effizient zu erledigen:<br />
Die von britischen und USamerikanischen<br />
Forschern gegründete<br />
Plattform Galaxy Zoo lud bereits<br />
2007 die breite Öffentlichkeit erstmals<br />
ein, an der Klassifizierung von<br />
900.000 Galaxien mitzuwirken. Sie<br />
nutzt dabei Fotos von Galaxien und<br />
kann von astronomischen Laien<br />
durchgeführt werden, die mit kurzen<br />
Fragen zum Bild informiert werden,<br />
worauf bei der Klassifizierung zu<br />
achten ist. Bereits am Tag nach dem<br />
Start der Plattform nahmen Interessierte<br />
bis zu 70.000 Klassifizierungen<br />
pro Stunde vor. Innerhalb von sieben<br />
Monaten wurden von 150.000 Personen<br />
50 Millionen Klassifizierungen<br />
geleistet – diese wurden mehrfach<br />
durchgeführt, um ein sicheres Ergebnis<br />
zu erhalten –, was einem Arbeitseinsatz<br />
von zirka 83 Mannjahren entspricht.<br />
Interessierte<br />
entsCHLüsseln<br />
TelegrAMMe aus<br />
dem Bürgerkrieg<br />
Mittlerweile wird die Crowd von der<br />
Scientific Community auch in andere<br />
durchaus fordernde Aufgaben eingebunden.<br />
Ein aktuelles Beispiel ist das<br />
historische Projekt „Decoding the<br />
Civil War“, wo es um die Entschlüsselung<br />
der Telegramme der US-Army<br />
aus dem amerikanischen Bürgerkrieg<br />
(1861–1865) geht – Nachrichten von<br />
Präsident Abraham Lincoln inklusive.<br />
Die gegnerische Konföderationsarmee<br />
hatte zwar immer wieder<br />
Nachrichten abgefangen, sie aber<br />
niemals entschlüsselt. Was damals<br />
nicht gelang, soll nun die Crowd<br />
schaffen. 15.971 Telegramme aus<br />
dem Archiv der Huntington Library<br />
in Kalifornien wurden jüngst auf der<br />
Wissenschaftsplattform Zooniverse<br />
online gestellt, in denen es auf den<br />
ersten Blick sinnlos um Zebra, Emma,<br />
Bologna und Tierkreiszeichen geht.<br />
Im Herbst 2016 wird mit dem Decodieren<br />
begonnen. Es soll gemeinschaftlich<br />
gearbeitet werden, zumal<br />
nur sechs der insgesamt zehn Decodierungsbücher<br />
die eineinhalb Jahrhunderte<br />
seit Ende des Sezessionskriegs<br />
überstanden haben. Es wird<br />
also eine perfekte Kombination aus<br />
Software und Hirnschmalz nötig sein,<br />
um den Code zu knacken.<br />
AuCH in der MeDIZIn<br />
sind die AnTWOrten<br />
der CrOWD gefrAGT<br />
Selbst die Medizin öffnet sich <strong>für</strong> das<br />
wertvolle Wissen Betroffener, wenn<br />
etwa Forschungsfragen identifiziert<br />
werden sollen, die aus Sicht der Patienten<br />
und/oder Angehörigen hoch<br />
relevant sind. Die Ludwig Boltzmann<br />
Gesellschaft startete 2014 ein europaweit<br />
einzigartiges Projekt und befragte<br />
Betroffene, was im Bereich<br />
psychischer Erkrankungen unerforscht<br />
sei. Knapp 400 hochqualitative<br />
Beiträge wurden eingereicht. Auf<br />
Basis der Ergebnisse wurden neue<br />
Forschungsfragen formuliert, die<br />
schließlich in Ludwig Boltzmann<br />
Instituten bearbeitet werden (siehe<br />
Interview zum Open-Science-Projekt<br />
der Ludwig Boltzmann Gesellschaft,<br />
S. 40).<br />
IN FINNLAND BRINGen<br />
DIE BürGer IHre IDeen<br />
<strong>für</strong> NEUE GeseTZE EIN<br />
Das berühmte Zitat des österreichischen<br />
Schriftstellers Karl Kraus<br />
(1874–1936) „Ungerechtigkeit muss<br />
sein, sonst kommt man zu keinem<br />
Ende“ hat sich überholt. Gerade<br />
im Bereich der partizipatorischen<br />
Demokratie – sollen etwa Gesetze<br />
novelliert werden – kann die Crowd<br />
wertvollen Input geben. Auf diesem<br />
Gebiet ist Finnland ein Vorreiter, hat<br />
das nordische Land doch bereits<br />
mehrfach Vorschläge <strong>für</strong> Gesetze von<br />
seinen Bürgern eingeholt. „Getragen<br />
werden partizipatorische Projekte von<br />
einem Thinktank, der sich „Zukunftskomitee<br />
der Regierung“ nennt, erklärt<br />
die finnische Soziologin Tanja<br />
Aitamurto, die wissenschaftliche<br />
Beraterin des Komitees ist und an<br />
16
Foto: © shutterstock<br />
Auch im Bereich der Geschichtswissenschaften wird die Crowd um Unterstützung gebeten. Das Archiv der<br />
Huntington Library in Kalifornien stellte kürzlich Telegramme aus dem US-amerikanischen Bürgerkrieg online,<br />
um sie von interessierten Nutzern dechiffrieren zu lassen.<br />
der US-Universität Stanford forscht.<br />
Der Thinktank steht hinter Policy-<br />
Making-Projekten wie diesem:<br />
In Finnland regelt ein eigenes Gesetz<br />
den Verkehr abseits der regulären<br />
Straßen. Das betrifft vor allem den<br />
Snowmobil-Verkehr in ländlichen Regionen.<br />
Vor drei Jahren entschied das<br />
Umweltministerium, dieses Gesetz zu<br />
überarbeiten und die Bürger einzubeziehen.<br />
Dabei wurde die Crowd zunächst<br />
nach konkreten Problemen befragt.<br />
Im nächsten Schritt wurde sie<br />
aufgefordert, Lösungsvorschläge einzubringen.<br />
Die Plattform hatte zirka<br />
10.000 Besucher, davon 1.000 registrierte,<br />
die insgesamt 4.000 Kommentare<br />
abgaben und 500 konkrete Ideen<br />
einsandten. Es zeigte sich, so Aitamurto,<br />
dass die Bürger das Mitgestalten als<br />
Empowerment empfunden haben.<br />
„Die Crowd muss gut gepflegt werden.<br />
Menschen, die sich engagieren,<br />
verbringen oft viele Stunden auf einer<br />
Plattform. Deshalb ist es sehr wichtig,<br />
sie über Fortschritt und Ergebnis des<br />
Projekts zu informieren, ansonsten<br />
riskiert man, dass sie beim nächsten<br />
Mal nicht mehr mitmachen“, betont<br />
die Forscherin.<br />
Die BearbeITung<br />
der DATenmenge<br />
ALs grOsse<br />
Herausforderung<br />
Der wissenschaftliche Beweis, dass<br />
durch Crowdsourcing bessere Gesetze<br />
entstehen, steht noch aus. Die<br />
bisherigen internationalen Erfahrungen<br />
zeigen aber, dass die Komplexität<br />
von Problemen, die es gesetzlich zu<br />
regeln gilt, durch Crowdsourcing realitätsnaher<br />
erfasst wird. Noch nicht<br />
gelöst ist die Schwierigkeit, die Datenmengen<br />
zu bewältigen. Tausende<br />
Kommentare zu sichten und Vorschläge<br />
zu evaluieren, ist vor allem<br />
eines: viel Arbeit. In Stanford wird<br />
deshalb gerade das selbstlernende,<br />
automatisierte System Civic Crowd<br />
Analytics entwickelt, das mittels<br />
Spracherkennung die Beiträge der<br />
Crowd erfasst und ordnet. Wie überall,<br />
wo es Komplexität zu bewältigen<br />
gilt, wird man künftig an Big-Data-<br />
Lösungen nicht vorbeikommen.<br />
Mobilitätsfragen sind hochkomplex<br />
und folglich eine perfekte Aufgabe <strong>für</strong><br />
die Crowd. Der ÖAMTC stellte sich<br />
deshalb jüngst der „Future Challenge“<br />
und lud die Öffentlichkeit ein, Ideen<br />
zur Frage einzureichen, wie sie künftig<br />
vom Club in ihrer Mobilität unterstützt<br />
werden wolle (siehe S. 18).<br />
Crowdsourcing ist eine sehr wirksame<br />
Methode, um Problemlösungen<br />
oder neue Sichtweisen auf eine<br />
bestimmte Frage zu erhalten. Man<br />
darf den Aufwand, der hinter der<br />
Vorbereitung eines solchen Projektes<br />
steht, aber nicht unterschätzen, sagen<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
17
Foto: © Karin Feitzinger<br />
Die ÖAMTC Future CHAllenge:<br />
Ein Aufruf zur Suche nach den besten und innovativsten<br />
Ideen <strong>für</strong> Mobilitätsservices der Zukunft – ob <strong>für</strong> den Weg<br />
zur Arbeit, zum Sport oder in den Urlaub, ob mit Auto,<br />
Bus, Bahn, Flugzeug oder Fahrrad.<br />
Frage: „Wie kann der ÖAMTC Menschen in ihrer Mobilität<br />
künftig noch besser unterstützen?“<br />
Zeitraum <strong>für</strong> Ideeneinreichung: 5. 4.– 23. 5. 2016<br />
Ergebnisse:<br />
454 eingereichte Ideen<br />
801 Kommentare zu den Ideen<br />
1358 registrierte User führten 823 Bewertungen der Ideen durch<br />
3 Jury-Gewinner<br />
3 Community-Gewinner<br />
1 interner Gewinner<br />
1 Sonderpreis<br />
Experten. Eine Schwierigkeit liege<br />
vor allem darin, die Frage, die man<br />
der Crowd stellt, so zu formulieren,<br />
dass sie von allen richtig verstanden<br />
wird. Die Frage bestimme das Ergebnis.<br />
WenIGer ernste<br />
Projekte machen<br />
den MensCHen<br />
auCH Spass<br />
Manchmal darf die Crowd auch einfach<br />
nur Spaß haben. Brendon Ferris,<br />
ein in der Dominikanischen Republik<br />
lebender Programmierer, gibt Laien<br />
auf crowdsound.net die Möglichkeit,<br />
eine Melodie zu komponieren. Das<br />
System funktioniert so: Die Crowd<br />
stimmt über die jeweils nächste Note<br />
ab. Was bisher vorliegt, ist eine gefällige<br />
Melodie mit ein paar interessanten<br />
Stellen. Nach Vollendung der<br />
Komposition soll ein Liedtext in ähnlicher<br />
Manier entstehen.<br />
Crowdsourcing<br />
KAnn auCH mit wenIG<br />
Ressourcen ein<br />
ErfOLG werden<br />
In der Welt der Unternehmen findet<br />
Crowdsourcing bislang vor allem im<br />
Big Business statt. Das ist wohl nicht<br />
zuletzt eine Kostenfrage. Hat jedoch<br />
ein junges Unternehmen Social-Media-Kompetenz<br />
und eine Facebook-<br />
Community, lassen sich kleinere Projekte<br />
auch dort abwickeln. Eine lokale<br />
Bäckerei könnte ihre Kunden danach<br />
fragen, wie sie sich das Brot der Zukunft<br />
vorstellen und auf diese Weise<br />
Feedback über Kundenwünsche und<br />
Ideen <strong>für</strong> neue Rezepte bekommen.<br />
Obwohl sich Unternehmen zusehends<br />
öffnen und die breite Masse in Innovationsaktivitäten<br />
einbeziehen, vergessen<br />
sie oftmals auf die eigenen<br />
Mitarbeiter. Gerade diese sind eine<br />
sehr wichtige Crowd, zumal sie viele<br />
gute Ideen haben. Das bestätigt auch<br />
Gegenhuber: „Es hat sich gezeigt,<br />
dass sich auf Plattformen wie Localmotors,<br />
wo Designlösungen <strong>für</strong> die<br />
Autoindustrie gesucht sind, viele<br />
Mitarbeiter von Autokonzernen engagieren.“<br />
Augenscheinlich bieten die<br />
Arbeitgeber diesen Freizeitdesignern<br />
im Job nicht genug Raum, sich kreativ<br />
auszutoben.<br />
<strong>Offen</strong>e und<br />
gesCHLOssene<br />
InnOVATIOn parALLel<br />
anwenden<br />
Die Zukunft des Crowdsourcing geht<br />
laut Experten in Richtung hybrider<br />
Systeme, wo sich Unternehmen in<br />
bestimmten Phasen <strong>für</strong> Ideen der<br />
Crowd öffnen, sich in anderen<br />
zurückziehen und intern an einer<br />
Lösung arbeiten. Leimüller: „Es<br />
ist ratsam, sich ganz am Anfang zu<br />
öffnen, um Fehlstarts und Flops<br />
zu vermeiden.“ •<br />
18
Kein Stau<br />
mehr auf der<br />
leTZTen Meile<br />
Foto: © Karin Feitzinger<br />
Das krITIsCHe Element jeder Online-BestelluNG ist das leTZTe WegstüCK.<br />
Die leTZTe MeILe verursACHT mitunter die Hälfte der gesAMTen<br />
TransPOrTKOsten, enorm viel Verkehr und UmweLTVersCHMuTZung.<br />
Das ist Grund genug, Logistik komplett neu zu deNKen – zum BeisPIel<br />
so offen und verneTZT wie das Internet. Von Daniela Müller<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
19
Es gibt ein neues Wort, das die<br />
Liefer landschaft Europas verändert:<br />
Sofortness. Konsumenten, die ihre<br />
online bestellten Waren sofort haben<br />
wollen und Anbieter, die das ermöglichen.<br />
Der Versandhändler Amazon<br />
entwickelte daraus ein neues Geschäftsmodell<br />
und nimmt die gesamte<br />
Dienstleistungskette gleich<br />
selbst in die Hand. In Berlin betreibt<br />
das Unternehmen eine Lagerhalle mit<br />
20.000 Artikel des täglichen Bedarfs<br />
– verpackte frische und tiefgekühlte<br />
Nahrung, Drogerieartikel, Getränke,<br />
Elektronik und Spielwaren – die<br />
per Algorithmen stets neu sortiert,<br />
aktualisiert und aussortiert werden,<br />
um nah an den Bedürfnissen und<br />
Wünschen der Sofortness-Kunden<br />
zu sein. Über eine App und eine<br />
Mitgliedschaft in Höhe von 49 Euro<br />
pro Jahr kann der Kunde nun online<br />
Waren bestellen, die innerhalb Berlins<br />
per E-Bike und damit ökologisch<br />
schonend zugestellt werden: Wer es<br />
besonders eilig hat, bekommt sie <strong>für</strong><br />
eine zusätzliche Gebühr in Höhe von<br />
6,99 Euro innerhalb von 60 Minuten.<br />
Wer mehr Geduld hat, kann sich ein<br />
Zeitfenster aussuchen, in dem die<br />
Ware gratis zugestellt wird, auf jeden<br />
Fall noch am selben Tag.<br />
Kunden wünsCHen<br />
die Lieferung am<br />
selben TAG der<br />
BesteLLung<br />
Konsumieren in neuen Dimensionen:<br />
Sofort, bequem und vielschichtig.<br />
Dem werden vor allem Online-Einkäufe<br />
gerecht: Der Mausklick vom<br />
Sofa ist bequem und die Lieferung<br />
erfolgt immer schneller. Same-Day-<br />
Delivery, also die Lieferung noch am<br />
Tag der Bestellung, wird zur Normalität.<br />
Denn auch im Online-Handel<br />
steigt die Konkurrenz und der Konsument<br />
legt Wert auf rasche Lieferungen.<br />
Dass Paketlieferungen <strong>für</strong> Unternehmen<br />
teuer sind und auf Kosten der<br />
Umwelt gehen, weil abgestimmte Logistikkonzepte<br />
mehr Theorie als Praxis<br />
sind, bleibt den Produktempfängern<br />
allerdings meist verborgen.<br />
VorLAuf, HauPTLAuf,<br />
nACHLAuf: KOMPLexe<br />
LOGIsTIK verursACHT<br />
HOHe Kosten<br />
Die klassische Liefermethode ist<br />
nämlich komplex und ineffizient:<br />
Im sogenannten Vorlauf werden<br />
Waren von den verschiedenen<br />
Versendern, also den Händlern,<br />
bei denen die Kunden bestellt haben,<br />
an einen zentralen Punkt, einen<br />
Hub, geschickt. Im anschließenden<br />
Hauptlauf wird die gesammelte Ware<br />
mit großen LKWs oder der Bahn vom<br />
Hub zum nächsten zentralen Punkt<br />
gefahren, von dem aus die Pakete zu<br />
den Empfängern gebracht werden.<br />
Das ist der sogenannte Nachlauf.<br />
Und genau hier liegt das Problem:<br />
Die sogenannte letzte Meile vom Verteilerzentrum<br />
zum Kunden ist der teuerste<br />
Teil der Lieferung. Auf ihn entfallen<br />
bis zu 50 Prozent der Kosten<br />
des klassischen Paketversandes, erklärt<br />
Efrem Lengauer vom Forschungsinstitut<br />
Logistikum der FH Steyr. Auch<br />
seine überproportional hohen CO 2<br />
-<br />
Emissionen sind ein Thema.<br />
Keine<br />
KostenWAHrheit<br />
in der LieferkeTTe<br />
Kostenwahrheit gibt es hier noch<br />
nicht: Um wettbewerbsfähig zu bleiben,<br />
verzichten viele Onlinehändler<br />
auf die Einhebung von Versandkosten<br />
bei den Konsumenten. Deshalb müssen<br />
sie an anderer Stelle einsparen –<br />
mitunter auf Kosten der Mitarbeiter.<br />
Auch deshalb müssen die letzten Kilometer<br />
neu gedacht werden.<br />
Ein LösungsansATZ<br />
heIssT<br />
VerneTZung<br />
Jürgen Schrampf von der Logistikberatung<br />
Econsult macht genau das<br />
und sucht unter dem Stichwort<br />
Smart Urban Logistics neue Logistikkonzepte<br />
<strong>für</strong> den Güterverkehr in<br />
Ballungsräumen: Je mehr online<br />
bestellt wird, desto mehr LKWs<br />
sind auf den Straßen unterwegs.<br />
Um Innenstädte vom Transportverkehr<br />
und generell die Umwelt zu<br />
entlasten, muss die letzte Meile<br />
eines Paketes effizienter gestaltet<br />
werden. Für Schrampf geht es vor<br />
allem um eine Vernetzung bisher<br />
individuell agierender Akteure. Eine<br />
ökonomische Bewältigung der letzten<br />
Meile sei nur mit unterschiedlichen,<br />
aufeinander abgestimmten Systemen<br />
und einem Miteinander von Kurierdiensten,<br />
Logistik- und Handelsunternehmen<br />
sowie Start-ups möglich.<br />
Credo: Zusammenarbeit statt Konkurrenz.<br />
Ein wichtiger Treiber ist dabei<br />
die Digitalisierung, durch die<br />
sich Logistik neu denken lässt: Kann<br />
der Warentransport künftig nicht genauso<br />
wie jener von Information im<br />
Internet passieren – vernetzt, offen,<br />
ressourcenschonend? Die Idee wird<br />
unter Logistik-Experten als Physical<br />
Internet bezeichnet: Durch eine vollständige<br />
Öffnung aller Lager- und<br />
Transportkapazitäten unterschiedlicher<br />
Anbieter sollen Transportkilometer<br />
so gering wie möglich gehalten<br />
und Leerfahrten vermieden werden.<br />
Konkret bedeutet das, dass die Waren<br />
ihre optimale Route selbstständig<br />
bei den jeweils effizientesten „Verkehrsträgern“<br />
finden, egal welcher<br />
Logistik-Dienstleister mit dem Transport<br />
beauftragt wurde. Dadurch wäre<br />
radikal weniger Transportaufwand<br />
nötig. Voraussetzung ist freilich, dass<br />
sämtliche Umschlag- und Lagerstandorte<br />
aller beteiligten Logistik-<br />
20
Nicht nur in Berlin, auch in Wien könnte die Lieferung einer Onlinebestellung über Amazon bald nur mehr eine Stunde dauern.<br />
Um ein solches Service auch abseits von Ballungsräumen möglich zu machen, werden von Amazon in Zusammenarbeit mit der<br />
TU Graz Lieferdrohnen entwickelt. In einem bestimmten Radius um ein Versandzentrum könne man so Express-Lieferungen ermöglichen.<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
21
Die Schweizer Post testet ab September 2016 in den Städten Bern, Köniz und Biberist selbstfahrende Roboter,<br />
die im Schritttempo auf Gehsteigen unterwegs sind und Pakete bis zu zehn Kilogramm transportieren können.<br />
Mit einem SMS „Ihre Sendung ist da“ wird der Empfänger über die Ankunft des Roboters vor der Haustüre verständigt.<br />
Anfangs sind die Roboter noch mit menschlichen Begleitern unterwegs.<br />
unternehmen mit ihren Kapazitäten<br />
und Transportmitteln dem Netzwerk<br />
zur Verfügung stehen. Ja, mehr noch:<br />
Auch private PKWs können das System<br />
ergänzen, indem Lenker Pakete<br />
mitnehmen, wenn sie ohnehin unterwegs<br />
sind.<br />
ProfessIOnelle<br />
LOGIsTIKer und<br />
prIVATe PKWs als<br />
LOGIsTIKKOnzePT<br />
der Zukunft<br />
Allerdings: Bis heute ist die bestechende<br />
Idee des Physical Internet<br />
nicht umgesetzt. IT-Systeme und die<br />
Abrechnung zwischen den beteiligten<br />
Unternehmen müssten vereinheitlicht,<br />
bestehende Logistik-Hubs und<br />
-Terminals weiterentwickelt werden:<br />
Von reinen Be- und Entladestellen<br />
sollten sie hochfrequente, effizienzfördernde<br />
Netzwerkknoten der Verkehrsträger<br />
werden. So würden sie<br />
mithelfen, Transportkilometer zu sparen,<br />
meint Schrampf. Sie sollten auch<br />
innovative Services anbieten, denen<br />
eine direkte Anbindung an ein Liefernetz<br />
zugute kommt wie etwa Sharing-<br />
Points <strong>für</strong> Elektrofahrzeuge oder 3D-<br />
Druck-Center <strong>für</strong> die On-Demand-<br />
Produktion von Waren.<br />
Apropos Hub: Schon heute zeigt der<br />
Zustelldienst UPS in Hamburg eine<br />
Mini-Version davon. An den Stadträndern<br />
stehen Fahrzeuge oder Container,<br />
befüllt mit Paketen, die von<br />
Kurier diensten mit Elektrofahrzeugen<br />
abgeholt und in der Hamburger Innenstadt<br />
ausliefert werden. Damit wird<br />
auch dem Umweltaspekt der letzten<br />
Meile Rechnung getragen. Über Nacht<br />
erfolgt dann die Neubefüllung.<br />
Auch wenn das Physical Internet<br />
noch Utopie ist, wird mit Teillösungen<br />
<strong>für</strong> die effizientere Gestaltung der<br />
letzten Meile intensiv experimentiert.<br />
DerzeIT hilft man<br />
sICH nOCH mit<br />
Teillösungen<br />
Um ein Paket schon bei der ersten<br />
Tour abladen zu können, auch wenn<br />
der Adressat nicht zuhause ist, wird<br />
der PKW-Kofferraum der Paketkunden<br />
zum Depot umfunktio niert.<br />
Ferngesteuert, beziehungsweise per<br />
Code kann der Paketzusteller das<br />
Fahrzeug öffnen und das Paket hinterlegen.<br />
Als Depot funktionieren<br />
auch die 2.700 Packstationen, die<br />
DHL Deutschland installiert hat.<br />
Pakete werden in den Packstationen<br />
vom Lieferanten hinterlassen, der<br />
Kunde erhält eine Nachricht auf sein<br />
Handy und kann das Paket 24 h pro<br />
Tag abholen. In Zukunft sollen solche<br />
Paketräume als fixe Einrichtungen<br />
in neuen Wohnanlagen bereitstehen,<br />
um auch den Weg des Kunden zu<br />
einer Station so gering wie möglich<br />
22
zu halten und sie <strong>für</strong> alle Transporteure<br />
gegen Gebühr anzubieten.<br />
CrOWDsOurced<br />
Delivery –<br />
PrIVATPersonen sind<br />
auCH Lieferanten<br />
Private PKWs in eine effiziente Paketzustellung<br />
miteinzubeziehen, ist beim<br />
sogenannten Crowdsourced Delivery<br />
ein Schlüsselaspekt. Laut Fachhochschule<br />
Steyr legen die Österreicher<br />
pro Jahr in Summe 4,5 Mrd. Kilometer<br />
nur zum Zwecke des Einkaufens zurück.<br />
Diese Wege könnten<br />
genutzt werden, um Bestellungen<br />
<strong>für</strong> andere mitzunehmen. Beim österreichischen<br />
Unternehmen Checkrobin<br />
sind bereits 21.000 Privatpersonen<br />
registriert, die gegen eine zuvor<br />
vereinbarte Summe Pakete an den<br />
Zielort bringen.<br />
Selbst EinKAufen<br />
zu gehen, wird in<br />
Zukunft womöglich<br />
obsolet<br />
In Österreich können Private derzeit<br />
allerdings nur in einem streng<br />
begrenzten gesetzlichen Rahmen<br />
als Boten tätig sein, sprich, der private<br />
Bote darf <strong>für</strong> seine Dienste nicht<br />
mehr als das gesetzliche Kilometergeld<br />
berechnen. Die Checkrobin-Betreiber<br />
Hannes Jagerhofer, Niki Lauda<br />
und Attila Dogudan ärgert dies: Es<br />
sei eine soziale und umweltfreundliche<br />
Sache, mit der Synergien im<br />
Sinne aller genutzt werden könnten,<br />
betont Jagerhofer. Im Herbst will man<br />
auf den deutschen Markt, wo die Justiz<br />
über Crowd-Transporte nicht so<br />
streng urteilt. Jagerhofer jedenfalls<br />
sieht <strong>für</strong> Sharingangebote im städtischen<br />
Bereich eine große Zukunft.<br />
Vielleicht mit Zusatzleistungen, wie<br />
kürzlich eine Checkrobin-Zustellung<br />
zeigte: Ein Fahrer hat den transportierten<br />
Fernseher gleich beim Empfänger<br />
installiert.<br />
Erstreiten und<br />
ErsITZen <strong>für</strong><br />
LAngfrisTIGe<br />
NuTZung<br />
Als Win-Win-Situation sieht auch<br />
Paul Brandstätter vom Wiener Botendienst<br />
Veloce seine App „Veloce<br />
liefert“, in der mittlerweile 10.000<br />
Einkaufsmöglichkeiten in Wien gespeichert<br />
sind. Der Kunde bestellt<br />
über die App, Veloce liefert. Brandstätter<br />
wollte damit nicht nur den<br />
regionalen Handel stärken, sondern<br />
dank effizienter Logistik mehrere<br />
Fliegen mit einer Klappe schlagen:<br />
Nicht mehr der Einzelne geht ein kaufen,<br />
sondern ein Unternehmen beliefert<br />
Kunden nach einem klugen und<br />
effi zienten IT-System. Es hilft Konsumenten<br />
auch dabei, Leerfahrten zu<br />
vermeiden, wenn bestimmte Produkte<br />
gerade nicht verfügbar sind. Die Nachfrage<br />
nach solchen Diensten werde<br />
steigen, ist sich Brandstätter sicher.<br />
Skype-Gründer<br />
enTWICKeln<br />
ZustellrOBOTer<br />
Eine ganz andere Idee, die letzte<br />
Meile billiger und effizienter zu machen,<br />
entwickeln die beiden Skype-<br />
Mitbegründer Janus Friis und Ahti<br />
Heinla. Sie setzen mit ihrem Unternehmen<br />
Starship Technologies auf<br />
Zustellroboter. Ihr Fahrzeug mit sechs<br />
Rädern und zehn Kilo Gewicht läuft<br />
derzeit im Testbetrieb in den USA<br />
und Großbritannien und ist in der<br />
Lage, eine noch überschaubare Warenmenge<br />
im Umkreis von fünf Kilometern<br />
auszuliefern. Es fährt mit rund<br />
sechs km/h auf dem Gehsteig, ist mit<br />
Sensoren und Kameras ausgestattet<br />
und kann Hindernissen ausweichen.<br />
Stationiert ist der Roboter in lokalen<br />
Lieferzentren, wo der Kunde über<br />
App seine Ware bestellt und zugleich<br />
bestimmt, wann sie bei ihm sein soll.<br />
Weil diese Zustellroboter rund um die<br />
Uhr im Einsatz sein können, sollen<br />
auch die Kosten pro Zustellung viel<br />
geringer ausfallen, als bei herkömmlichen<br />
Lieferdiensten, betont man bei<br />
Starship Technologies. Zudem surren<br />
bei den großen internationalen Unternehmen<br />
schon länger Drohnen zum<br />
Zwecke der Zustellung in der Luft.<br />
Großteils wird dies noch von rechtlichen<br />
Auflagen erschwert bis unmöglich<br />
gemacht, vielfach ist diese<br />
Liefermethode erst in der Testphase.<br />
AuCH DrOHnen<br />
KÖnnen PAKete<br />
LIefern<br />
Das Unternehmen DHL hat bereits<br />
bekanntgegeben, dass es in absehbarer<br />
Zeit sogenannte Paketkopter<br />
einsetzen möchte, um Lieferungen in<br />
geografisch schwer zugängliche Gebiete<br />
durchzuführen. Ab Juli ist dies<br />
in Ruanda Realität: Per Drohnen werden<br />
Kliniken mit Medikamenten beliefert.<br />
Im urbanen Gebiet sieht Efrem<br />
Lengauer vom Logistikum Steyr diese<br />
Zustellmöglichkeit als unwirtschaftlich:<br />
Eine Drohne, wie sie in Österreich<br />
aktuell eingesetzt werden dürfe,<br />
könne ein, maximal zwei Pakete anliefern.<br />
In abgelegenen Regionen, wohin<br />
die Post aufgrund der Universaldienstleistung<br />
transportiert werden<br />
muss, seien Drohnen allerdings sehr<br />
wohl eine Alternative, betont der<br />
Logistikexper te. Weite Strecken<br />
wegen einzelner Pakete mit dem Lieferwagen<br />
zu fahren, würde hinfällig.<br />
Die EU gibt vor: Bis<br />
2030 sOLLTe LOGIsTIK<br />
CO 2-frei erfOLGen<br />
Die Zeit <strong>für</strong> neue Logistikkonzepte<br />
drängt, betont Jürgen Schrampf.<br />
Denn nach dem Weißbuch der EU<br />
soll bis 2030 die innerstädtische<br />
Güterlogistik in den größeren<br />
Städten CO 2<br />
-frei erfolgen. Es<br />
heißt also, in die Pedale treten.<br />
Die E-Bike-Lieferung von Amazon<br />
ist nur ein Anfang. •<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
23
„Kunst zeigt ganz<br />
neue Wege auf“<br />
Foto: © Mirjana Rukavina<br />
Christopher Lindinger studierte Informatik<br />
an der Johannes Kepler Universität Linz und<br />
Kulturmanagement in Salzburg. Er beschäftigte<br />
sich mit hochkomplexen Visualisierungsaufgaben<br />
und arbeitete als Wissenschafter im<br />
Bereich der Supercomputer-Visualisierung in<br />
Chicago <strong>für</strong> die NCSA (National Center for<br />
Supercomputing Applications) und die Weltraumorganisation<br />
NASA, aber auch freiberuflich<br />
<strong>für</strong> die Computerspiele-Industrie.<br />
Aufgrund seiner Aktivitäten im Bereich neuer<br />
Technologien, digitaler Kultur und Kunst ist er<br />
seit 1997 mit der Ars Electronica verbunden.<br />
Als Co-Direktor des Ars Electronica Futurelab<br />
verantwortet er den Bereich Forschung<br />
und Innovation. Seine Arbeit ist geprägt von<br />
Kooperationen mit internationalen Partnern,<br />
mit denen er gemeinsam unternehmens- oder<br />
organisationsinterne Innovationsstrategien entwickelt<br />
oder Konzeptionen und Entwicklungen<br />
radikaler Innovationen <strong>für</strong> gesellschaftliche<br />
Zukunftsszenarien vorantreibt. In den vergangenen<br />
Jahren arbeitete Lindinger in diesem Feld<br />
unter anderem mit Toshiba, Mercedes-Benz,<br />
Vodafone, Honda Robotics und Nokia zusammen.Darüber<br />
hinaus berät er Kommunen und<br />
Regierungseinrichtungen im Aufbau kreativwirtschaftlicher<br />
Sektoren und ist als Lehrbeauftragter<br />
an mehreren europäischen Universitäten<br />
tätig.<br />
24
KünsTLer sind von Natur aus experimenTIerfreudig.<br />
AuCH weil <strong>Neues</strong> zu eRFORsCHen uND RisIKen eINzugehen,<br />
als KeRN künstleRIsCHer ARBeit gilt. Der BeitrAG, den Kunst<br />
zu InnOVATIOnen mit hohem geseLLsCHAfTLICHem NuTZen leisten kann,<br />
ist mitunter grOss. Das Gespräch führte Catherine Gottwald<br />
querspur: Herr Lindinger, Sie leiten<br />
den Bereich Forschung und Innovation<br />
im Ars Electronica Futurelab in Linz.<br />
Ist die Kunst eine Zukunftsmacherin?<br />
Christopher Lindinger: Grundsätzlich<br />
ist immer die Frage: Wie versteht<br />
man Kunst? Und in welchem Kontext<br />
versteht man Kunst in der Innovation?<br />
Für mich gibt es zwei mögliche<br />
Zugänge: Einerseits hat Kunst eine<br />
gewisse Mission: Nämlich etwas aus<br />
einer bestehenden Struktur heraus zu<br />
nehmen, es zu verändern, es wieder<br />
in eine Struktur einzuführen und<br />
hierbei eine Irritation zu erzeugen.<br />
Was die Kunst eigentlich kann, ist<br />
eine Perspektivenverschiebung herbeizuführen.<br />
Diese Perspektivenverschiebung<br />
kann entweder ästhetisch,<br />
intellektuell oder emotional sein. Das<br />
ist ein Potenzial von unschätzbarem<br />
Wert und somit auch eine gute Ausgangslage<br />
aus Innovationssicht:<br />
Kunst zeigt neue gedankliche Zugänge<br />
und Herangehensweisen auf<br />
und/oder trägt wesentlich dazu bei,<br />
diese neuen Wege überhaupt zu entdecken.<br />
Darüber hinaus ist Kunst<br />
eine forschende Wissenschaft.<br />
querspur: Kunst hat verschiedene<br />
Funktionen in der Gesellschaft, mitunter<br />
komplexe oder abstrakte wissenschaftliche<br />
Inhalte sichtbar zu machen<br />
und <strong>für</strong> Laien zu übersetzen. Was sind<br />
<strong>für</strong> Sie die Dimensionen der Kunst?<br />
Lindinger: Natürlich schafft es Kunst,<br />
komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge<br />
einfacher darzustellen.<br />
Und natürlich gelingt es der Kunst,<br />
beispielsweise schwer lesbare medizinische<br />
Daten so aufzubereiten, dass<br />
sie <strong>für</strong> Laien verständlich interpretiert<br />
werden können. Das „aesthetic<br />
usabil ity principle“ besagt ja, dass<br />
Dinge, die ästhetisch aufbereitet sind,<br />
eher verwendet werden. Das ist allerdings<br />
eine kommunikative Aufgabe.<br />
Ich sehe die Kunst als forschende<br />
Wissenschaft an. Kunst forscht; sie<br />
bedient sich eben nur anderer Methoden<br />
als „die Wissenschaft“. Das<br />
Übersetzen von wissenschaftlichen<br />
Zusammenhängen steht <strong>für</strong> mich<br />
daher nicht so sehr im Zentrum. Der<br />
Maler und Objektkünstler Marcel<br />
Duchamps (Anm.: 1887–1968) hat<br />
gesagt: „I don’t believe in art. I believe<br />
in artists.“ („Ich glaube nicht<br />
an die Kunst. Ich glaube an Künstler.“)<br />
Eine Philosophie, nach der auch<br />
wir im Ars Electronica Futurelab leben.<br />
Konkret bedeutet das, dass wir<br />
Kunstproduktionen so gestalten, dass<br />
sie relativ frei von Vorgaben ablaufen,<br />
Experimente zulassen und Transformationen<br />
anregen.<br />
querspur: Wie setzen Sie das um?<br />
Lindinger: Was uns im Innovationskontext<br />
primär interessiert, ist den<br />
Künstler mit innovativen Suchfeldern,<br />
das heißt Aufgaben- und Themenbereichen,<br />
zu konfrontieren. Diese können<br />
beispielsweise im Unternehmerischen<br />
liegen. In diesem Prozess soll<br />
nicht nur nachgedacht und erarbeitet<br />
werden, was Lösungen sein können,<br />
sondern auch vorab, wo die verdeckten<br />
Fragestellungen und Probleme<br />
liegen. Es geht ja nicht nur immer darum,<br />
dass man in der Innovation eine<br />
Lösung findet, sondern darum, zuerst<br />
einmal die Frage zu identifizieren.<br />
KünsTLer sind per<br />
se RisIKOfreudig.<br />
Das ist ein<br />
InnOVATIOnsVOrteil<br />
querspur: Sind Kunstschaffende<br />
prinzipiell innovationsfreudig?<br />
Lindinger: Für uns ist interessant,<br />
dass Künstler von ihrem Wesen her<br />
mehr oder weniger „professionelle<br />
risk takers“, also Hasardeure, sind.<br />
Sie sind es gewohnt, Risiken einzugehen,<br />
sich auf Experimente einzulassen<br />
und etwas zu produzieren,<br />
was einer Öffentlichkeit standhalten<br />
muss. Diese Herausforderungen anzunehmen<br />
oder dieses Kapital mitzubringen,<br />
ist <strong>für</strong> Innovationsprozesse<br />
wahnsinnig befruchtend. Risikofreudigkeit<br />
und/oder Out-of-the-Box-<br />
Denken sind hierbei Voraussetzung.<br />
Künstlerische Arbeiten folgen nicht<br />
immer einer logischen Konsequenz.<br />
Nicht die rasche, pragmatische Problemlösung<br />
steht im Zentrum, sondern<br />
das Experiment. Erst das konkrete<br />
Experiment, der Moment, in<br />
dem du anfängst zu bauen, beantwortet<br />
dir Fragen, die du dir in der Theorie<br />
nie gestellt hättest. Und das ist genau<br />
das Spannende, eine physische<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
25
Komponente, nicht nur etwas, das nur<br />
auf dem Papier stattfindet. Das Experiment,<br />
die Konfrontation mit der Öffentlichkeit,<br />
die Rückschlüsse daraus<br />
und der Erkenntnisgewinn sind Charakteristika<br />
des künstlerischen Zugangs.<br />
querspur: In welchem Ausmaß sind<br />
künstlerische Arbeiten Anstoß <strong>für</strong><br />
tatsächlich umgesetzte Innovation,<br />
etwa im Bereich der Technik?<br />
Lindinger: Dazu fallen mir zwei<br />
Beispiele zum Thema Roboter ein:<br />
Das eine sind die „Oribots“ des<br />
australischen Künstlers und langjährigen<br />
Futurelab-Mitarbeiters<br />
Matthew Gardiner, der sich intensiv<br />
mit Origami und Faltungen und deren<br />
künstlerischen Wirkung auseinandersetzt.<br />
Seine Roboterblumen sind<br />
einzelne Kunstwerke. „Ori“ kommt<br />
vom japanischen Wort <strong>für</strong> falten und<br />
„bots“ von Roboter – sozusagen „gefaltete<br />
Roboter“. Sie sehen wie Blumen<br />
aus und funktionieren so, dass<br />
die Blumenblätter, die aus diesen Faltungen<br />
bestehen, durch ihre Reflexionsbeschaffenheit<br />
auf- und zu gehen<br />
und von kleinen LEDs von innen<br />
beleuchtet werden, wenn man näher<br />
kommt. Die LEDs sitzen dort, wo bei<br />
normalen Blumen der Blütenstempel<br />
ist. Das ist ein schönes kleines<br />
Projekt. Was als ästhetisches Experiment<br />
ohne konkrete Aufgabenstellung<br />
<strong>für</strong> die Industrie begonnen hat,<br />
findet jetzt Verwendung in der Medizintechnik:<br />
Eine japanische Firma<br />
arbeitet an einem Patent <strong>für</strong> Herzschrittmacher<br />
nach dem Prinzip der<br />
„Oribots“ (Anm. d. Red.: Mehr kann<br />
über das Projekt an dieser Stelle nicht<br />
berichtet werden, da sich das Patent<br />
zu Redaktionsschluss noch in Anmeldestatus<br />
befindet). In diesem Fall haben<br />
wir die künstlerische Arbeit von<br />
Matthew Gardiner mit Wirtschaftstreibenden<br />
durchdiskutiert und sind<br />
zu diesem Ergebnis gekommen.<br />
Ein weiteres Beispiel ist unsere<br />
Zusammenarbeit mit Daimler und<br />
Mercedes-Benz zur Erforschung<br />
von Mensch-Maschine-Interaktionsszena<br />
rien. Das selbstfahrende Auto<br />
stellt eine der größten kulturellen Revolutionen<br />
dar, die vor uns stehen. Wie<br />
ändert sich also unsere Kultur und was<br />
wären Lösungen im spekulativen Sinne,<br />
wie könnte man an diese Fragestellungen<br />
herangehen?<br />
KuLTurreVOLuTIOn:<br />
seLBstfAHrendes<br />
Auto<br />
Wir haben uns mit der Außenkommunikation<br />
von Roboter-Autos beschäftigt<br />
und der Frage, wie das autonome<br />
Auto mit seiner Umwelt, also<br />
mit Fußgängern, Radfahrern oder anderen<br />
Fahrzeugen interagiert, wenn,<br />
anders, als bei konventionellen Fahrzeugen,<br />
Blickkontakt oder Gesten<br />
fehlen. Was es braucht, ist eine Art<br />
„informiertes Vertrauen“ in den Roboter,<br />
wir nennen es „informed trust“,<br />
damit alle Verkehrsteilnehmer sich<br />
im Straßenverkehr sicher fühlen. Gemeinsam<br />
mit Künstlern und Künstlerinnen<br />
aus dem Ars Electronica<br />
Futurelab haben wir in einem Innovationsprozess<br />
angefangen, eine Art<br />
funktionale Sprache zu entwickeln,<br />
einen Grundwortschatz. Alles, was<br />
ein Auto an einen Fußgänger kommunizieren<br />
müsste.<br />
ForsCHung in<br />
der Kunst ist nICHT<br />
so sTArk durCH<br />
MeTHODen<br />
reGLemenTIert<br />
Wir haben das dann mit unterschiedlichen<br />
Experimentierfeldern erprobt,<br />
was funktionieren könnte, und im<br />
Zuge dieser Forschung ist auch der<br />
F015 entstanden – ein Prototyp eines<br />
selbstfahrenden Autos von Daimler,<br />
der vor eineinhalb Jahren vorgestellt<br />
worden ist.<br />
querspur: Was ist der Weg, der in der<br />
Kunst eingeschlagen wird, um <strong>Neues</strong> zu<br />
entdecken?<br />
Lindinger: Auch in künstlerischen<br />
Forschungsprojekten gibt es Methoden,<br />
diese sind aber bis zu einem bestimmten<br />
Grad offener. Wenn man<br />
sich im Vergleich dazu traditionelle<br />
Forschung anschaut, dann gibt es in<br />
jeder Disziplin eine gewisse Methode.<br />
Diese Methode ist natürlich immer<br />
mit gewissen Schwierigkeiten verbunden,<br />
weil die Methoden eigentlich<br />
dazu erfunden worden sind, dass<br />
man wissenschaftliche Ergebnisse zueinander<br />
vergleicht. Mittlerweile haben<br />
sich Methoden in manchen Bereichen<br />
so stark etabliert, dass sie fast<br />
zwangsweise den Weg darstellen, den<br />
man gehen muss.<br />
querspur: Werden Künstler wegen der<br />
oft spielerisch oder dekorativ anmutenden<br />
Auseinandersetzung mit einer Thematik<br />
von wissenschaftlicher Seite als<br />
Partner ernst genommen?<br />
Lindinger: Hier muss man zwischen<br />
industriellen Innovationprozessen<br />
und dem Bereich Kunst und Wissenschaft<br />
unterscheiden. Das sind<br />
wirklich zwei unterschiedliche Paar<br />
Schuhe. In der Industrie oder in<br />
industrielleren Projekten geht es<br />
wirklich um die Suche. Hier wird<br />
Kunst, sobald man zusammenarbeitet,<br />
automatisch als eine Möglichkeit,<br />
<strong>Neues</strong> oder neue Ansätze zu finden,<br />
respektiert.<br />
Im wissenschaftlichen Kontext ist es<br />
schwieriger: Wissenschaft erzeugt<br />
Erkenntnisgewinn. Publikationen<br />
gelten als höchstes Gut <strong>für</strong> den wissenschaftlichen<br />
Output. Wenn<br />
Künstlern in diese bereits existierenden<br />
starken wissenschaftlichen<br />
Strukturen- und Systeme kein Zutritt<br />
gewährt wird und eine Begegnung auf<br />
Augenhöhe zwischen Kunst und Wissenschaft<br />
nicht stattfindet, entsteht<br />
ein Missverhältnis. Dem muss man<br />
eben entgegenwirken.<br />
querspur: Wie und unter welchen Umständen<br />
gelingt eine derartige Zusammenarbeit?<br />
Lindinger: Wir versuchen Künstlerinnen<br />
und Künstler an die vorderste<br />
Front der wissenschaftlichen Erkenntnis<br />
zu schicken und zu schauen, wie<br />
das funktioniert. Hierbei bringen<br />
wir Künstler an Orte, zu denen sie<br />
26
Foto: © Matthew Gardiner<br />
Von der Kunst zur Medizin: Das Prinzip der Faltblumen „Oribots“<br />
des australischen Künstlers Matthew Gardiner wird in Zukunft<br />
bei Herzschrittmachern zum Einsatz kommen.<br />
Fotos: © Mercedes-Benz<br />
Kulturelle Revolution des autonomen Fahrens: Das Concept Car F015 von Mercedes-Benz zeigt,<br />
wie der Erholungsraum im selbstfahrenden Auto künftig aussehen könnte.<br />
normalerweise keinen Zugang haben.<br />
Beispielsweise zur Europäischen<br />
Weltraumorganisation ESA oder zur<br />
Europäischen Südsternwarte in Chile<br />
(ESO) oder ins CERN (Europäische<br />
Organisation <strong>für</strong> Kernforschung).<br />
Unterstützt und begleitet werden die<br />
Künstler bei diesen Forschungsaufenthalten<br />
von Mitarbeitern des Ars<br />
Electronica Futurelabs, die mit<br />
solchen Prozessen eine gewisse Erfahrung<br />
haben und als Schnittstelle<br />
zwischen den Wissenschaftern und<br />
den Künstlern fungieren. Zwar sind<br />
oft Kunstwerke das Ergebnis dieser<br />
Auseinandersetzung, aber der zentrale<br />
Wert <strong>für</strong> uns sind die Irritationen,<br />
die die Künstler durch ihre<br />
Arbeiten in diesen Institutionen erzeugen.<br />
Leute fangen an, anders über<br />
Dinge nachzudenken. Und dieser Erkenntnisgewinn<br />
geht <strong>für</strong> uns über<br />
den Wert des Absetzens künstlerischer<br />
Ergebnisse hinaus.<br />
querspur: Zusammenarbeit zwischen<br />
Kunst und Wissenschaft ist keine<br />
Neuerfindung. Am Übergang zum<br />
20. Jahrhundert, im sogenannten<br />
Fin de Siècle, standen Künstler und<br />
Wissenschafter in engem Austausch.<br />
Könnte gerade jetzt wieder ein besonderer<br />
Zeitpunkt da<strong>für</strong> sein, gar eine<br />
Notwendigkeit da<strong>für</strong> bestehen?<br />
KünsTLerische<br />
InnovationsforsCHung<br />
bei grOssen<br />
Konzernen<br />
bereits eTABLIert<br />
Lindinger: Grundsätzlich würde<br />
ich sagen, dass Kunst immer wieder<br />
eine entscheidende Rolle gespielt hat<br />
und sie könnte natürlich immer eine<br />
noch entscheidendere Rolle spielen.<br />
Denn sie hat die Möglichkeit durch<br />
das Experimentieren, Dinge zu erproben,<br />
die nicht unmittelbar Sinn<br />
ergeben. Manchmal erschließt sich<br />
dieser erst in einem zweiten Schritt.<br />
Aus unternehmerischer Perspektive<br />
ist es sehr wichtig, Künstler in die<br />
Innovationsmethodik oder -prozesse<br />
zu inte grieren. Bei vielen der multi–<br />
natio nalen Konzerne, mit denen wir<br />
zusammenarbeiten, von Toshiba,<br />
Mercedes, über SAP bis Intel, um<br />
nur einige zu nennen, ist künstlerische<br />
Innovationsforschung bereits<br />
etabliert.<br />
Ein anderer Aspekt ist die Suche nach<br />
neuen Wissenschaftskulturen. Hier<br />
ist die Verschmelzung von Kunst und<br />
Wissenschaft bis zu einem gewissen<br />
Grad eine Wiederentdeckung. Es geht<br />
in der Wissenschaft nicht mehr nur<br />
um Erkenntnisgewinn, dem Publizieren<br />
von Papers und dem Vorantreiben<br />
von großen Karrieren. In einem<br />
größeren Diskus geht es darum, die<br />
Gesellschaft weiterzuentwickeln. Hier<br />
schwingt auch der Gedanke mit, mit<br />
Künstlern zusammenzuarbeiten, anders<br />
über Probleme nachzudenken<br />
und auch den Prozess des Erkenntnisgewinns<br />
anders zu gestalten. •<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
27
USERSTORY<br />
Meine<br />
Idee<br />
Die ÖAMTC Future CHAlleNGe hat über<br />
450 User motIVIert, Ideen eINzureICHen.<br />
DREI davon mit ihren IDEEN im PORTRAIT.<br />
Von Astrid Kuffner<br />
Private<br />
Lademöglichkeiten<br />
teilen<br />
Foto: © Günther Huck<br />
Günther Huck hat insgesamt acht Ideen zur Elektromobilität bei der<br />
Future Challenge eingebracht. Der Vorschlag, die privaten Lademöglichkeiten<br />
der ÖAMTC-Mitglieder untereinander zu teilen, wurde besonders ausgezeichnet.<br />
Als Elektrotechniker, Analytiker, Programmierer und Abteilungsleiter<br />
hat Günther Huck viele Jahre in der IT-Infrastruktur<br />
gearbeitet. Dabei hat der Grazer übersehen, dass er selbst<br />
immer unter Strom stand und schließlich das eigene System<br />
überlastete. Nach einem Burnout war er mehrere Monate<br />
auf Rehabilitation und hat seine Prioritäten neu geordnet.<br />
Dabei dachte der 56-Jährige über sich und die Welt von<br />
heute nach: „Klimaerwärmung, Umweltverschmutzung, unbeschränktes<br />
Wachstum und Ressourcenvergeudung bestimmen<br />
unseren Umgang mit dem Planeten. Gleichzeitig<br />
sind wir in Österreich durch unseren Lebensstil und das<br />
Wirtschaftssystem auf Mobilität angewiesen. Nicht nur ich<br />
sehe daher Elektromobilität als Alternative zur Erdölmobilität.“<br />
Weil es auf jeden Einzelnen ankomme, fing Huck bei sich<br />
selbst an. Er wohnt in einem Plusenergiehaus mit einer Photovoltaikanlage<br />
auf dem Dach, seine Frau und er legen seit einem<br />
Jahr den Großteil der Alltagswege mit Elektroautos (Fiat<br />
500e Karabag) zurück, wobei er davor bereits ein Elektrofahrrad<br />
und ein Elektromoped hatte. Günstig: Sein Wohnort<br />
Kirchbach in der Oststeiermark ist ein Vorreiter der E-Mobilität<br />
mit drei öffentlichen E-Ladestationen.<br />
„Die Problematik ist nicht das Elektrofahrzeug an sich. Ende<br />
der 1980er-Jahre wurde das erste Serien-Elektroauto, Fiat<br />
Panda Elettra, entwickelt und ab 1990 in den Puch-Werken<br />
bei Graz serienmäßig gebaut. Wir haben auch den nötigen<br />
Strom. Was aber immer noch fehlt, ist die Ladeinfrastruktur“,<br />
analysiert er. Und hier kommt die Idee eines Community-basierten<br />
Ladenetzes ins Spiel: Aktuell sind in Österreich<br />
4,5 Millionen private PKW angemeldet. Wenn nur die Hälfte<br />
künftig mit Strom fahren würde, wovon Huck ausgeht, müsse<br />
sofort damit begonnen werden, zumindest 2,5 Millionen<br />
Lade plätze zu schaffen: „Ich habe nicht den Eindruck, dass<br />
diese Ladeinfrastruktur politisch so wichtig genommen wird,<br />
wie die Infrastruktur <strong>für</strong> Trinkwasser, Abwasser oder Internet,<br />
obwohl unser Wirtschaftssystem auf Mobilität aufbaut.“<br />
Er weiß aus eigener Erfahrung: Elektrofahrzeuge sind entweder<br />
unterwegs oder sie hängen an der Steckdose. Statt<br />
bloß auf Schnell-Ladestationen zu setzen, würde er die privaten<br />
Ladeplätze von ÖAMTC-Mitgliedern unter denselben<br />
teilen. Diese sind im Regelfall frei, weil die Besitzer mit dem<br />
E-Auto in die Arbeit fahren. Der ÖAMTC könnte sich um Verwaltung<br />
und Abrechnung kümmern. Seiner Idee nach könnte<br />
jeder Strom-Guthaben in den virtuellen ÖAMTC-Pool<br />
einspeisen: Aus der eigenen PV-Anlage oder über die Beteiligung<br />
an Anlagen <strong>für</strong> Alternativenergie (Windpark, Biogas,<br />
PV-Anlage) und erwirbt so das Recht, ebenso viel wieder zu<br />
beziehen. Dieser Gedanke im Sinne der Shared Economy<br />
und der Gemeinnützigkeit kam Huck spontan, als er via<br />
Newsletter von der Future Challenge erfuhr. Insgesamt hat<br />
er acht Ideen eingereicht, u. a. etwa jene an ÖBB-Züge E-<br />
Autotransport-Waggons anzuhängen, um die Reichweite zu<br />
verbessern. Und Huck hat nicht nur den einzelnen E-Autofahrer<br />
im Blick: „Die technische Umsetzung eines solchen<br />
Ladenetzes sehe ich als Chance. So kann der Wirtschaftsstandort<br />
Österreich vielleicht ein Vorreiter in Europa in dieser<br />
Technologie werden.“ •<br />
28
USERSTORY<br />
Foto: © Daniela Starcevic<br />
Streikwarnung<br />
statt Reisestress<br />
Streik, strike, grève, sciopero! Daniela Starcevic ist früher viel gereist und lernte dabei die Streikfreude<br />
in anderen Ländern Europas kennen. Als ihre Kollegen neulich ein wichtiges Geschäftstreffen beinahe<br />
verpassten, weil der Zug nicht fuhr, stand <strong>für</strong> sie fest: Ein EU-Frühwarnsystem muss her.<br />
Wer viel reist, erlebt auch viel. Nicht nur am Ziel, auch auf<br />
dem Weg dorthin oder retour. Daniela Starcevic war in den<br />
1990er-Jahren im internationalen Tourismus tätig: „Ich habe<br />
in einem gewissen Zeitraum vermutlich öfter die Kontinente<br />
gewechselt als andere die Bettwäsche“, sagt sie über das<br />
Ausmaß ihrer Reisetätigkeit. Oft flog sie über das Drehkreuz<br />
London und besuchte bei dieser Gelegenheit ihre Tante, die<br />
am Rand der Themse-Metropole außerhalb des U-Bahn Netzes<br />
wohnt. Dabei lernte sie die Streikfreudigkeit in den europäischen<br />
Nachbarländern kennen und entdeckte eine Lücke:<br />
Wenn eine nationale Fluglinie oder der Hauptstadt-Flughafen<br />
streikt, steht das in jeder Zeitung. Reisende können sich auf<br />
diese Weise vorbereiten. „Wenn du aber um fünf Uhr morgens<br />
auf dem Bahnsteig der Lokalbahn stehst, um zum Flughafen<br />
zu kommen und die streiken, hast du keine Möglichkeit,<br />
das vorab zu erfahren“, erklärt sie. Damals, als es <strong>für</strong><br />
Starcevic nötig gewesen wäre, gab noch keine Smartphones,<br />
um alternative Routen zu suchen. Wobei das angesichts<br />
von Hektik und hoher Roaminggebühren vielleicht auch heute<br />
nicht zielführend wäre. Verpasste (Übersee-) Flüge, verweigerte<br />
Storni und geplatzte Termine sind jedenfalls unangenehm.<br />
Als eine Kollegin ein zwischen internationalen Partnern mühsam<br />
abgestimmtes Treffen <strong>für</strong> ein EU-Projekt beinahe verpasst<br />
hätte, weil eine regionale Bahnstrecke in Frankreich<br />
bestreikt wurde, knüpfte Daniela Starcevic an ihre eigenen<br />
Erfahrungen wieder an und reichte ihre Idee <strong>für</strong> ein EU-Frühwarnsystem<br />
bei der ÖAMTC Future Challenge ein: Darin<br />
schägt sie ein Reiseportal vor, bei dem Informationen über<br />
regionale Streiks innerhalb der EU zur Verfügung gestellt<br />
werden. Dort könnte man sich vor Reiseantritt erkundigen. In<br />
einer ausgefeilteren Version könnte man vorab die geplante<br />
Route eingeben und per SMS gewarnt werden, wenn bei einem<br />
der Verkehrsmittel Unregelmäßigkeiten auftreten sollten.<br />
Vernetzte Mobilitätsclubs in verschiedenen Ländern könnten<br />
damit gemeinsam eine Art EU-Frühwarnsystem <strong>für</strong> Reisende<br />
aufbauen und auch gleich alternative Anreisemöglichkeiten<br />
vorschlagen. Die Mitglieder könnten dann von unterwegs<br />
kurzfristig abfragen, ob und wo Streikwarnungen vorliegen.<br />
Heute möchte Daniela Starcevic kein Jetsetter-Leben mehr<br />
führen: „Es ist noch stressiger geworden. Bei Fernreisen gibt<br />
es inzwischen unzählige Möglichkeiten, wo etwas nicht klappen<br />
könnte: Von der Baustelle bis zu verschärften Sicherheitskontrollen“.<br />
Die 44-jährige Grazerin ist immer noch ein<br />
Mensch, der sich viel bewegt. Beim Sport, mit dem Rad auf<br />
dem Weg zur Arbeit, mit dem Hybrid-Auto ins Grüne zum<br />
Wandern, mit der Straßenbahn oder zu Fuß. Es fällt ihr also<br />
leicht, die Perspektive unterschiedlicher Verkehrsteilnehmer<br />
einzunehmen. Sie beteilige sich oft an Umfragen, die sie<br />
via ÖAMTC-Newsletter erreichen und brachte insgesamt<br />
gleich drei Vorschläge bei der Future Challenge ein: „Mir gefällt,<br />
dass ein Mobilitätsclub die Rolle als Bürgeranwalt einnimmt<br />
und auch die Anliegen Einzelner bei den politisch Verantwortlichen<br />
einbringt.“ •<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
29
USERSTORY<br />
Foto: © Peter Spannring<br />
Rundum-Service<br />
<strong>für</strong> Zweiräder<br />
Peter Spannring ist beruflich und privat viel mit dem Rad unterwegs.<br />
Dabei kam ihm die Idee, die ÖAMTC-Stützpunkte zu Drehscheiben der Fahrradmobilität auszubauen.<br />
Neben der eigenen Fahrrad-Pannenhilfe soll es auch Leihräder und -helme geben.<br />
Peter Spannring weiß mit Werkzeug umzugehen. Er ist sicherheitsbewusst<br />
und handwerklich geschickt. Und er hält viel<br />
von regelmäßiger Wartung. Dennoch hatte er in den vergangenen<br />
Jahren immer wieder einmal eine Panne. Mit dem<br />
Fahrrad. „Auf einen Kettenriss kannst du dich nicht vorbereiten“,<br />
sagt der Vielradler. Vom frühen Frühjahr bis in den späten<br />
Herbst hinein bewältigt der 51-Jährige die 22 Kilometer<br />
(von Leoben nach Kapfenberg) zur Arbeit mit dem Rad. Auf<br />
dem Heimweg nimmt er nicht selten noch eine kleine Bergwertung<br />
mit. Am Wochenende ist er rund um Leoben unterwegs<br />
und auch bei der Salzkammergut Trophy war er heuer<br />
erstmalig am Start. Mit Mountainbike oder Rennrad bewältigt<br />
er rund 7.000 Kilometer und 100.000 Höhenmeter im<br />
Jahr. Das verrät ihm sein GPS-Tracker. Und dann eben: Panne,<br />
schieben, ärgern. Nicht immer ist ein Geschäft mit Ersatzteilen<br />
geöffnet, nicht immer erreicht er jemanden aus der<br />
Familie, der ihn abholen kann und nicht überall kann er ein Taxi<br />
rufen. Hier kommt die ÖAMTC-Zweirad Pannenhilfe gerade<br />
recht. Aber auch darüber hinaus könnte der ÖAMTC zur<br />
Drehscheibe <strong>für</strong> Fahrradmobilität werden. Als Peter Spanning<br />
in der Mitgliederzeitschrift von der Future Challenge las,<br />
war das seine Gelegenheit, diese Idee einzubringen. Wobei<br />
er auch beruflich ein starker Ideengeber ist: Bei seinem Arbeitgeber<br />
Böhler Edelstahl in Kapfenberg werden Vorschläge<br />
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur kontinuierlichen<br />
Verbesserung sehr ernst genommen. Und Peter Spannring<br />
koordiniert das Vorschlagswesen im Bereich Schmiedelinie.<br />
Zudem ist er Sicherheitsfachkraft. Deswegen wird man<br />
ihn auch nie ohne Helm fahren sehen. Er freut sich darüber,<br />
dass immer mehr Menschen das Rad <strong>für</strong> die alltägliche Fortbewegung<br />
nützen. Durch E-Bikes wird das auch <strong>für</strong> weniger<br />
sportliche und ältere Menschen möglich. Der ÖAMTC<br />
könnte neben der Zweirad-Pannenhilfe auch Servicestellen<br />
<strong>für</strong> Zweiräder an den Stützpunkten inklusive Schlauchautomat<br />
anbieten, meint er. Man könnte auch Fahrräder und Helme<br />
am Stützpunkt verleihen, vor allem das Auto beispielsweise<br />
seinen Geist aufgegeben hat und es daher am Stützpunkt<br />
stehen bleiben müsse.<br />
Zum Radfahren ist Peter Spannring aus gesundheitlichen<br />
Gründen gekommen: In seiner Jugend hat er viel Krafttraining<br />
gemacht, was nach einem Unfall aber nicht mehr möglich<br />
war. Radfahren ist <strong>für</strong> den Genussmenschen eine ideale,<br />
weil in den Alltag integrierbare Möglichkeit zur Gewichtsreduktion.<br />
Umso mehr freut sich über den schönen Preis: Die<br />
Reisegutscheine. Vermutlich wird es ihn und sein Lebensgefährtin<br />
wieder nach Italien ziehen. Die Gegend rund um den<br />
Gardasee liebt er besonders. Und natürlich hat er im Kofferraum<br />
auch immer sein Rad mit dabei. In Italien gibt es neben<br />
gutem Essen viele Radsport-Begeisterte wie ihn. Auch bemerkt<br />
er dort viel Rücksicht und auch Leichtigkeit im Umgang<br />
miteinander. Peter Spannring würde auch gerne Forstwege<br />
<strong>für</strong>s Radfahren öffnen, „wobei es hier natürlich Spielregeln<br />
<strong>für</strong> das Miteinander braucht“. Er überlegt wohl schon, wo er<br />
seine Ideen zu diesem Thema sinnvoll einbringen könnte. •<br />
30
Lorenz Inou, 19<br />
Absolvent HTL Rennweg/Mechatronik aus Wien<br />
„Ich habe gerade die HTL-Matura gemacht. Mein Lehrer <strong>für</strong> Prozessrechentechnik<br />
beschäftigt sich seit Mitte der 1980er-Jahre mit dem Thema Elektromobilität. Er ist<br />
auch Erfinder und ein „Auskenner“, wenn es um technische Lösungen <strong>für</strong> die Einsparung<br />
von CO 2<br />
geht. In den vergangenen zwei Jahren habe ich von ihm viel darüber<br />
gelernt. Ich wollte mit meiner Idee bei der Future Challenge signalisieren, dass<br />
sich ein Mobilitätsclub mit dem Thema Ladenetz bereits heute auseinandersetzen<br />
sollte. E-Mobilität ist <strong>für</strong> Österreich umwelttechnisch und finanziell ein Muss. Ich habe<br />
mich aktiv mit Kommentaren eingebracht, weil ich klassische und bereits veraltete<br />
Kritikpunkte gegenüber E-Mobilität ausräumen will. Ich halte den Emotionen rund<br />
ums Autofahren gerne sachliche Information entgegen.“<br />
USERSTORY<br />
Katharina Aichberger, 49 Jahre, technische Angestellte aus Steyr<br />
„Erneuerbare Energieformen mögen sich weltweit durchsetzen, das wünsche ich mir!<br />
Neben anderen Vorteilen verursachen mit erneuerbarer Energie betankte Elektroautos<br />
weniger Lärm. Dadurch könnte eine gut gelegene Wohnung am viel befahrenen<br />
Wiener Gürtel eine hübsche Wertsteigerung erfahren. Freilich: Das Fehlen von<br />
Motorgeräuschen, die viele Leute unterbewusst als Warnsignale empfinden, verlangt<br />
eine Umstellung. Ich könnte mir schon jetzt spielerische Praxissimulationen bei<br />
Events vorstellen wie etwa Videos, Computerspiele oder Übungskreuzungen, mit<br />
denen die Verkehrsteilnehmer frühzeitig mit der veränderten Verkehrssituation vertraut<br />
gemacht werden. Sie lernen, mit weniger Lärm umzugehen und freuen sich auf<br />
eine hoffentlich bald abgasreduzierte Zukunft.“<br />
Warum haben Sie sich an der<br />
ÖAMTC Future Challenge beteiligt?<br />
Maria Jakob, 66, Pensionistin aus Enns<br />
„Ich war in den Jahren 1969 bis 1982 beruflich viel mit dem Auto unterwegs– in Österreich,<br />
der BRD, Frankreich, Italien und ein halbes Jahr auch in England – und habe wohl<br />
1.300.000 Straßenkilometer abgespult. Heute fahre ich mit meinem Mann und Tempomat<br />
nur noch privat durch Österreich und habe Zeit, bei einem Ideenwettbewerb mitzumachen.<br />
Ich schlage ein Überholverbot <strong>für</strong> LKW und Autobusse auf zweispurigen Autobahnen<br />
vor. Bei den kilometerlangen Überholmanövern – ich nenne sie ‚Elefantenduelle‘<br />
– kommt es zu abrupten Bremsmanövern und unnötigen Staus.“<br />
Tomas Teverný, 40, Koch und kaufmännischer Angestellter im Tourismus aus Schwechat<br />
„Ich habe mich bei der Future Challenge beteiligt, weil ich mir beim Thema Mobilität der Zukunft Bewegung<br />
und <strong>Offen</strong>heit wünsche. Ich bin eine Art personifizierte Street View Map, habe halb Europa bereist<br />
und viele gute und schlechte Lösungen gesehen. Es geht mir darum, dass alle Menschen mitgestalten<br />
können. Ich sehe darin den Zeitgeist der neuen, sich entwickelnden Gesellschaft. Der Einfluss der Politik<br />
bremst wichtige Entwicklungen zunehmend. Man muss kein Fachexperte sein, um zu erkennen, wo<br />
es neuer Lösungen beim Alltagsthema Mobilität bedarf. Von den Ideen können wiederum Fachleute und<br />
Verkehrsplaner profitieren, wenn sie sich da<strong>für</strong> öffnen. Es reichen oft die Alltagserfahrung, das Interesse,<br />
der Hausverstand und die Begeisterung gewöhnlicher Menschen. Der ÖAMTC sollte dieses Portal<br />
als Sammelstelle <strong>für</strong> Ideen zur Mitgestaltung weiter betreiben.“<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
31
Futurnauten<br />
Eine FACHjury aus drei Experten untersCHIedlicher Bereiche<br />
wählte die GewINNer der ÖAMTC Future CHAlleNGe aus.<br />
Querspur bat JuryMITGLIeder zum InterVIew. Die Gespräche führte Catherine Gottwald<br />
Foto: © Irene Fialka<br />
Dr. Irene Fialka ist studierte Molekularbiologin und<br />
seit 2004 Geschäftsführerin von INiTS Universitäres<br />
Gründerservice Wien GmbH, einem preisgekrönten<br />
akademischen Business-Inkubator, der Start-ups in<br />
jeder Entwicklungsphase, also von der Formulierung<br />
ihrer Geschäftsidee bis zur Finanzierung ihres Unternehmens,<br />
unterstützt. In der Fachjury war ihre Kernexpertise<br />
als Start-up-Consultant gefragt.<br />
querspur: Der ÖAMTC feiert 2016 sein<br />
120-jähriges Bestehen und ist mit circa<br />
zwei Millionen Mitgliedern Österreichs<br />
größter Verein. Was bedeutet es, wenn<br />
ein so traditioneller Club einen Crowdsourcing-Prozess<br />
wie die ÖAMTC Future<br />
Challenge startet und dabei interessierte<br />
Bürger und Bürgerinnen, Mitglieder sowie<br />
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen<br />
dazu befragt, wie er sie in ihrer Mobilität<br />
besser unterstützen kann? Hat ein derartiger,<br />
offener Ideenwettbewerb Signalwirkung?<br />
Dr. Irene Fialka: Ich finde, die<br />
ÖAMTC Future Challenge hat absolut<br />
hohe Signalwirkung. Damit<br />
setzt der ÖAMTC in vielerlei Hinsicht<br />
Zeichen: Während Open Innovation,<br />
wie sie der ÖAMTC hier mit<br />
der Future Challenge vorlebt, in der<br />
Wissenschaft seit 30 Jahren praktiziert<br />
wird, ist sie in der unternehmerischen<br />
Realität noch immer nicht<br />
richtig angekommen. Hier übernimmt<br />
der ÖAMTC auch im Vergleich<br />
mit anderen europäischen<br />
Mobilitätsclubs eine Vorreiterrolle.<br />
Andererseits definiert der ÖAMTC<br />
damit auch seine Clubsprache neu.<br />
Clubmitglieder, Mitarbeiter und interessierte<br />
Bürger dürfen und sollen<br />
mitreden und mitgestalten. Die eingereichten<br />
Ideen und Konzepte betreffen<br />
nicht aktuelle Services, bestehende<br />
Bedürfnisse und/oder Defizite,<br />
sondern zeigen deutlich auf, was in<br />
Zukunft möglich und nötig sein wird.<br />
Die Stimme des einzelnen Mitglieds/<br />
Bürgers/Mitarbeiters wird gehört und<br />
hat Gewicht. Die richtige Kommunikation<br />
mit der Crowd ist ein sehr relevanter<br />
Faktor in Crowdsourcing-<br />
Prozessen.<br />
querspur: Würden Sie sagen, die Kommunikation<br />
ist in diesem Fall geglückt?<br />
Fialka: Ja, das sieht man schon anhand<br />
der zahlreichen Einreichungen.<br />
Aber natürlich ist nicht nur die Zahl<br />
der Einreichungen, sondern vor allem<br />
die Qualität der Einreichungen<br />
relevant.<br />
querspur: Als Geschäftsführerin des<br />
Universitären Gründerservice INiTS beschäftigen<br />
Sie sich seit Jahren mit frischen<br />
Ideen und zukunftsfähigen Konzepten.<br />
War bei den eingereichten Ideen<br />
der ÖAMTC Future Challenge eine dabei,<br />
die Sie als Jury-Mitglied so nicht erwartet<br />
hätten?<br />
Fialka: Nein. Aber ich habe festgestellt,<br />
dass einige Ideen absolut im<br />
Trend liegen und deren Umsetzung<br />
die richtigen Schritte in Richtung<br />
Zukunft darstellen. Ein Beispiel da<strong>für</strong><br />
ist die prämierte Idee der Einführung<br />
einer ÖAMTC-Sicherheitsplakette<br />
<strong>für</strong> Drohnen, das 57a-„Pickerl<br />
2.0“. Das Definieren von allgemeinen,<br />
verbindlichen, rechtlichen Rahmenbedingungen<br />
<strong>für</strong> Drohnenpiloten sowie<br />
die technische Überprüfung und<br />
Zertifizierung von Drohnen ist absolut<br />
notwendig. Außerdem besteht<br />
Aufklärungsbedarf beim Gebrauch<br />
von Drohnen. Das wäre eine tolle<br />
neue Aufgabe <strong>für</strong> den ÖAMTC.<br />
querspur: Könnte man zusammenfassend<br />
sagen, dass die Themen, Ideen und<br />
Vorschläge, die bei der ÖAMTC Future<br />
Challenge ein- und vorgebracht wurden,<br />
das Thema Mobilität auf eine höhere<br />
Stufe gestellt haben?<br />
Fialka: Ja. Für den ÖAMTC und seine<br />
Clubmitglieder ganz bestimmt. •<br />
32
Foto: © KTM<br />
KTM-Chef DI Stefan Pierer studierte Betriebs- und<br />
Energiewirtschaft an der Montanuniversität Leoben.<br />
Seit 1992 ist er Aktionär und Vorstand des Sportmotorradherstellers<br />
KTM AG. Seine unternehmerische<br />
Vision hat aus KTM eine Weltmarke gemacht. Das<br />
KTM Zero-Emission Motorcycle „Freeride-E“ erhielt<br />
2011 den österreichischen Staatspreis der Kategorie<br />
„Innovativ E-Mobil“. In der Fachjury der ÖAMTC Future<br />
Challenge war vor allem seine Erfahrung und sein<br />
Knowhow im Bereich motorisierte Zweiradmobilität<br />
gefragt. Und sein Spürsinn <strong>für</strong> gelebte Innovation.<br />
querspur: Warum haben Sie die Einladung,<br />
als Fachjuror bei der ÖAMTC<br />
Future Challenge mitzuwirken, angenommen?<br />
DI Stefan Pierer: Für einen Veteranen<br />
aus der Mobilitäts- und Fahrzeugindustrie<br />
wie mich sind Themen, die<br />
Mobilität betreffen, immer sehr spannend<br />
und informativ. Egal, ob diese<br />
Ideen und Konzepte nun direkt von<br />
den ÖAMTC-Mitarbeitern (Anmerkung:<br />
7,5 % der Einreichungen<br />
bei der ÖAMTC Future Challenge<br />
stammten von ÖAMTC-Mitarbeitern<br />
und -Mitarbeiterinnen), Clubmitgliedern<br />
oder interessierten Bürgern eingebracht<br />
wurden. Der ÖAMTC ist<br />
eine österreichische Institution, die<br />
die gesamte Bandbreite der Mobilität,<br />
also Vierrad- und Zweiradmobilität<br />
abdeckt, und dabei auch das Thema<br />
Sicherheit hoch ansetzt. Darum finde<br />
ich es ganz wichtig, dass man einerseits<br />
von den Mitgliedern und auch<br />
von den eigenen Mitarbeitern Vorschläge<br />
zur Verbesserung einholt.<br />
querspur: Was haben Sie aus dieser<br />
Erfahrung <strong>für</strong> sich mitgenommen?<br />
Pierer: Ich konnte mir einen ausgezeichneten<br />
Gesamtüberblick über<br />
den Megatrend Mobilität verschaffen.<br />
Das Thema urbane Mobilität ist eines<br />
der Hauptthemen, und die urbane<br />
Mobilität wird in Zukunft sicher sehr<br />
stark auf Elektromobilität basieren.<br />
Auch wir bei KTM haben viele interessante<br />
Zukunftskonzepte im<br />
Bereich Zweirad-Elektromobilität,<br />
die bereits auf Rädern stehen und auf<br />
eine sehr reelle Überleitung warten.<br />
querspur: War auch eine Idee dabei,<br />
die Sie überrascht hat?<br />
Pierer: Nicht überrascht, sondern<br />
eher bestätigt! Im Bereich Elektromobilität<br />
hat sich klar gezeigt, dass<br />
man nicht beim Auto beginnt und<br />
dann bei der Zweiradmobilität endet,<br />
sondern dass die Entwicklung umgekehrt<br />
von unten nach oben verläuft:<br />
Das Elektro-Bike beispielweise ist in<br />
der breiten Bevölkerung längst angekommen<br />
und verkauft sich bestens.<br />
querspur: Bei KTM wird Innovation<br />
groß geschrieben. Zahlreiche aktuelle<br />
Motorsportrekorde im Bereich Konstruktion<br />
zeugen vom Erfindungsgeist der<br />
KTM-Entwicklerinnen und -Entwickler.<br />
Wäre ein Ideenwettbewerb/Crowdsourcing-Prozess<br />
wie die ÖAMTC Future<br />
Challenge auch bei KTM möglich?<br />
Pierer: Bei uns ist Innovation ein gelebter<br />
Prozess, den wir nicht formal<br />
ausschreiben. Feedback von Kundenund<br />
Händlerseite fließt permanent<br />
ein. Dennoch ist der Rennsport die<br />
treibende Kraft. Er verbindet die beiden<br />
Elemente aus der Innovationstheorie:<br />
Die freiwillige Innovation<br />
und die erzwungene. Die freiwillige<br />
Innovation ist die schwierigere, weil<br />
man da permanent Selbstantrieb<br />
haben muss. Umgekehrt bedeutet<br />
erzwungene Innovation, dass man an<br />
der Situation dringend etwas ändern<br />
muss, um seine Spitzenposition zu<br />
halten. Unsere 400–500 Mitarbeiter<br />
in der Entwicklung sind hoch motiviert<br />
und haben meistens auch eine<br />
Motorradvergangenheit. Sie suchen<br />
sogar am Wochenende in ihrer Freizeit<br />
nach Lösungen, wie man unsere<br />
Produkte verbessern kann.<br />
querspur: Auch sehr kleine Ideen<br />
können eine große Resonanz haben.<br />
Hätten Sie auch eine Idee bei der<br />
ÖAMTC Future Challenge eingereicht,<br />
wenn Sie nicht Mitglied der Fachjury<br />
gewesen wären? Wäre es <strong>für</strong> Sie auch<br />
interessant gewesen?<br />
Pierer: Ja, vor allem das Thema Erhöhung<br />
der Sicherheit. Im Bereich<br />
Zweiräder, das geht vom Fahrrad<br />
bis zum Motorrad und Mofa. Denn<br />
dieser Verkehrsteilnehmer ist ein<br />
sehr verwundbarer, der hat keine<br />
Knautschzone und keine Crashzone,<br />
ist aber ein aktiver Teilnehmer im<br />
öffentlichen Verkehr und damit sehr<br />
gefährdet. Alle Ideen, die dazu beitragen,<br />
hier die Sicherheit zu erhöhen,<br />
sind natürlich von unserer Seite nicht<br />
nur hoch willkommen, sondern auch<br />
angestrebt. •<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
33
Foto: © Nicolas Uphaus<br />
Dr. Stephan Rammler ist Professor <strong>für</strong> Transportation<br />
Design & Social Sciences an der Hochschule <strong>für</strong><br />
Bildende Künste in Braunschweig und Gründer des<br />
Instituts <strong>für</strong> Transportation Design. Seine Arbeitsschwerpunkte<br />
sind die Mobilitäts- und Zukunftsforschung,<br />
Verkehrs-, Energie- und Innovationspolitik,<br />
Fragen kultureller Transformation und zukunftsfähiger<br />
Umwelt- und Gesellschaftspolitik. 2016 erhielt er den<br />
ZEIT WISSEN-Preis Mut zur Nachhaltigkeit, der seit<br />
2013 von der Initiative Mut zur Nachhaltigkeit, dem<br />
Magazin ZEIT WISSEN sowie dem Unternehmer<br />
August Oetker ausgelobt wird.<br />
querspur: In Ihrem 2014 erschienenen<br />
Buch „Schubumkehr – Die Zukunft der<br />
Mobilität“ zitieren Sie den amerikanischen<br />
Visionär R. Buckminister Fuller<br />
„The best way to predict the future is<br />
to design it“ (dt.: „Die beste Art, die<br />
Zukunft vorherzusagen, ist sie zu<br />
gestalten“) und prägen den Begriff<br />
„Futurnauten“. Haben Sie beim<br />
Crowd sourcing-Prozess der ÖAMTC<br />
Future Challenge einige Futurnauten<br />
angetroffen, die die Zukunft gestalten?<br />
Prof. Dr. Stephan Rammler: Ja.<br />
Futurnauten sind <strong>für</strong> mich einerseits<br />
Experten, Wissenschafter und<br />
Futurologen, Spezialisten in Sachen<br />
Zukunft. Andererseits sind <strong>für</strong> mich<br />
Futurnauten auch ganz normale<br />
Menschen, Bürger, Konsumenten,<br />
Mobilitätsteilnehmer usw., die versuchen,<br />
aus ihrer eigenen Lebenspraxis<br />
heraus einen Horizont in die Zukunft<br />
zu öffnen. Menschen, die sich Ideen<br />
oder Konzepte ausdenken, ob es nun<br />
Produkte oder Dienstleistungen sind,<br />
um ihre, aber auch die Lebenswirklichkeit<br />
anderer Mitgenossen auf diesem<br />
Planten zu verbessern. Insofern<br />
sind <strong>für</strong> mich die eingereichten Ideen<br />
Ausdruck solcher Expertise, über Zukunft<br />
und Nachhaltigkeit anders<br />
nachzudenken.<br />
querspur: Sind also bei einem Crowdsourcing-Prozess<br />
wie der ÖAMTC<br />
Future Challenge die Beiträge von<br />
Experten, Mitgliedern, Mitarbeitern<br />
und interessierten Bürgerinnen und<br />
Bürgern in gleichem Maße wertvoll?<br />
Rammler: Unterschiedlich wertvoll.<br />
Experten, Wissenschafter oder Spezialisten<br />
haben den Vorteil, dass sie<br />
sich mit einem Thema womöglich<br />
über Jahre hinweg beschäftigen und<br />
in diesen Gebieten genau Bescheid<br />
wissen. Andererseits sind Konsumenten<br />
und Bürger die besten Experten<br />
in eigener Sache. Weil sie die Betroffenen<br />
sind. Sie leben in der Lebenswirklichkeit,<br />
in der Probleme auftauchen.<br />
Sie sind die besten Experten im<br />
Sinne Alltagspraxis und Umsetzung<br />
von neuen Konzepten und Ideen. Insofern<br />
brauchen wir beide Perspektiven.<br />
querspur: Wie wichtig ist es <strong>für</strong><br />
Österreichs größten Mobilitäts-Club<br />
mit einer 120-jährigen Geschichte<br />
einen Crowdsourcing-Prozess in<br />
Gang zu setzen?<br />
Rammler: Gerade <strong>für</strong> einen Club,<br />
der mit einer breiten Masse von<br />
Konsumenten zu tun hat, ist es<br />
immer wichtig, ein Gefühl <strong>für</strong> die<br />
Basis zu haben. Der ÖAMTC ist<br />
ein Publikumsverein. Ein Verein,<br />
der breit in die Gesellschaft hineinwächst.<br />
Insofern ist es gerade <strong>für</strong> einen<br />
solchen Verein immer unglaublich<br />
wichtig, auch zu wissen, was an<br />
der Basis mit den Mitgliedern los ist.<br />
Das ist die eine Perspektive. Die andere<br />
ist, dass ein solcher Verein wie<br />
der ÖAMTC – gerade weil er so breit<br />
in die Gesellschaft ausstrahlt – ein<br />
unglaublich gutes Sprachrohr sein<br />
kann. Als vertrauenswürdige, althergebrachte,<br />
traditionelle Institution<br />
hat der ÖAMTC diesen Bonus, diesen<br />
Vertrauensvorschuss.<br />
Er kann vielleicht ein Stück weit noch<br />
besser als andere Institutionen, vielleicht<br />
auch besser als politische Institutionen,<br />
diesen Blick auf die Zukunft<br />
richten und diesen Prozess<br />
auch gestalten. Wir erleben gerade<br />
eine totale, tiefgreifende, strukturelle<br />
Transmutation der Mobilitätswirtschaft.<br />
Es ist nötig, dass gerade traditionelle<br />
Institutionen beginnen sich<br />
zu bewegen und neue Zukunftsmodelle<br />
und -konzepte, Leitbilder,<br />
Visionen zu entwickeln. Insofern<br />
ist es wichtig, dass ein Club wie der<br />
ÖAMTC, genau wie die Autobauer<br />
und andere große Akteure der Mobilitätswirtschaft,<br />
sich um die große<br />
Frage der Nachhaltigkeit kümmert.<br />
Und das tut er, indem er Crowdsourcing-Prozesse<br />
anschiebt, abfragt und<br />
durch diesen Prozess in das Meer seiner<br />
Mitglieder zurückwirkt. •<br />
34
Foto: © shutterstock<br />
Der SchlüSSel<br />
zum Erfolg<br />
DIE GLÜHBIrne, DAS AUTO ODER DAS INTerneT – INNOVATIOnen,<br />
DIE WIRTSCHAFT UND GeseLLSCHAFT NACHHALTIG VERÄNDerT HABen.<br />
AUCH WEIL SIE ZUM RICHTIGen ZEITPunKT AM RICHTIGen ORT WAren.<br />
DOCH LänGST NICHT Alle ERFINDUNGEN SETZEN SICH ERFOLGREICH<br />
Auf dem MARKT DURCH. WAS IST DAS GEHEIMNIS, DAMIT NEUE SYSTEME<br />
UND TECHNOLOGIen ZU ERFOLGreICHEN INNOVATIOnen WerDEN?<br />
Von Astrid Bonk<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
35
Eine Spaghettigabel, die die Nudeln<br />
mit eingebautem Motor selbst auf die<br />
Zinken dreht, eine Schaukelbadewanne<br />
oder eine Heizvorrichtung <strong>für</strong><br />
Fahrradsättel – Ideen, die bis auf den<br />
Erfinder vermutlich niemals jemand<br />
brauchen wird.<br />
Im Jahr 2015 wurden laut Österreichischem<br />
Patentamt fast 2.500 neue<br />
Patente angemeldet. Auch die Schaukelbadewanne<br />
ist patentiert. Und obwohl<br />
die Zahl der Patente oftmals als<br />
Maß <strong>für</strong> die Höhe an Innovationsaktivitäten<br />
eines Landes gilt, so wird<br />
schnell klar: Ganz aussagekräftig ist<br />
dieser Indikator nicht. Zumal es sich<br />
bei einem Patent per Definition noch<br />
gar nicht um eine Innovation handelt,<br />
sondern streng genommen um eine<br />
Invention, also eine Erfindung. Als Innovation<br />
gilt erst ein über den Prototypen<br />
hinaus entwickeltes Produkt,<br />
das auf dem Markt erfolgreich ist.<br />
MarKTerfOLG einer<br />
InnOVATIOn von<br />
VIelen Faktoren<br />
abhänGIG<br />
Der Markterfolg ist kein Ziel, das im<br />
standardisierten Verfahren erreicht<br />
werden kann. Vielmehr braucht es<br />
ein Zusammenspiel verschiedener<br />
Faktoren. Etwa den hohen Nutzen<br />
<strong>für</strong> eine große Anzahl an Usern als<br />
Grundvoraussetzung <strong>für</strong> den Erfolg<br />
einer Innovation. Gerade Inventionen,<br />
die gezielt entwickelt werden, um andere<br />
Lösungen zu substituieren und<br />
deren wirklicher Anwendernutzen<br />
nicht hoch genug ist, verschwinden<br />
recht schnell vom Markt. Ein Beispiel:<br />
Die DVD konnte die Videokassette<br />
durch die höhere Qualität der Aufzeichnung<br />
innerhalb weniger Jahre<br />
vollkommen ersetzen. Der Nachfolger<br />
der DVD, die Blu-Ray-Disc, die<br />
eine noch höhere Bildqualität ermöglicht,<br />
konnte sich indes nie behaupten.<br />
Grund da<strong>für</strong>: Der Unterschied zur<br />
DVD wird als nicht groß genug empfunden.<br />
Für den Erfolg einer Innovation ist mit<br />
dem großen Nutzen <strong>für</strong> den User die<br />
Bereitschaft des Marktes untrennbar<br />
verbunden. Das bedeutet, dass nicht<br />
nur das Produkt seinerseits ausgeklügelt<br />
sein soll, sondern auch die Bedürfnisse<br />
der Gesellschaft der jeweiligen<br />
Zeit und im jeweiligen Kontext<br />
berücksichtigen müssen. Der Markt<br />
muss quasi nach einer Innovation<br />
lechzen, damit diese Erfolg hat.<br />
ÜberfLIeger<br />
LeonarDO da VinCI<br />
mit MisserfOLGen<br />
Leonardo da Vinci (1452–1519) gilt<br />
als ein Erfinder, der seiner Zeit weit<br />
voraus war, was ihm aber nicht immer<br />
zum Vorteil gereichte. Etwa entwickelte<br />
er im Wunsch, fliegen zu können, um<br />
1485 den ersten Fallschirm. 350 Jahre<br />
vor dem Bau des ersten Flugzeugs<br />
konnten die Menschen mit einer derartigen<br />
Erfindung jedoch nichts anfangen.<br />
Der Fallschirm war damit zwar etwas<br />
radikal <strong>Neues</strong>, die Bedürfnisse der Gesellschaft<br />
befriedigte er jedoch nicht.<br />
Erfolgreicher verhielt es sich mit einem<br />
Beispiel aus jüngster Zeit: Das Internet<br />
und die Digitalisierung haben die<br />
Art, wie wir Medien konsumieren,<br />
radikal verändert. Video-on-Demand-<br />
Angebote wurden <strong>für</strong> die Nutzer immer<br />
attraktiver. Fernsehen ist nicht<br />
mehr an den eigenen Apparat im<br />
Wohnzimmer gekoppelt, sondern<br />
findet statt wo und wann man will.<br />
Nach einer Unterbrechung schaut<br />
man einfach am nächst verfügbaren<br />
Gerät weiter. On-Demand-Video-<br />
Plattformen, wie wir sie von den<br />
Homepages der herkömmlichen<br />
TV-Sender kennen, sind da nur eine<br />
Basisvariante. Inzwischen haben sich<br />
eigene Internet-Pattformen wie<br />
Netflix etabliert, die dem User in<br />
einer Zeit der Individualisierung<br />
und des Kon sumierens „On the Go“<br />
das gewünschte Service bieten und<br />
selbst die Blu-Ray-Disc als Nachfolgerin<br />
der DVD alt aussehen lassen.<br />
Nicht nur der<br />
ZeITPunkt, auCH der<br />
sOZIALe Kontext ist<br />
wesentlich<br />
Die Bereitschaft einer Gesellschaft<br />
<strong>für</strong> ein bestimmtes Produkt oder<br />
einen bestimmten Service ist das<br />
eine, hinzu kommt mitunter der<br />
soziale Kontext, innerhalb dessen<br />
sich Innovation abspielt. Anders als<br />
in Europa hat die Mehrheit der Menschen<br />
am afrikanischen Kontinent –<br />
vor allem jene im ländlichen Raum –<br />
kein Bankkonto. Viele Millionen Menschen<br />
hatten daher lange Zeit keinen<br />
Zugang zur Geldwirtschaft.<br />
Im Zuge der Verbreitung des Mobiltelefons<br />
zu Beginn des 21. Jahrhunderts<br />
änderte sich das. In vielen Regionen<br />
Afrikas hatten die Menschen<br />
erstmals nicht nur Zugang zu Information<br />
und Kommunikation, sondern<br />
auch die Übertragung von Gesprächsguthaben<br />
als „mobiles“ Zahlungsmittel<br />
etablierte sich rasch.<br />
Stadtbewohner transferierten Gesprächsminuten<br />
an ihre Familienangehörigen<br />
auf dem Land, die statt mit<br />
Bargeld mit dem Guthaben zum<br />
Beispiel ihre Einkäufe bezahlten.<br />
Der gesamte Zahlungsverkehr<br />
wurde so wesentlich vereinfacht.<br />
Weltweit erste<br />
Handy-Bank in KenIA<br />
Diesem Erfolg geschuldet, wurde<br />
2007 mit M-Pesa die weltweit erste<br />
mobile Bank in Kenia gegründet.<br />
Jeder, der ein Mobiltelefon besitzt,<br />
kann bei M-Pesa ein mobiles Konto<br />
eröffnen. Danach kann per Handy<br />
jederzeit einfach und schnell bargeldlos<br />
bezahlt werden, sogar Stromrechnungen,<br />
Schulgebühren und Löhne<br />
werden inzwischen auf diese Weise<br />
überwiesen. Ein- und Auszahlungen<br />
von Bargeld werden landesweit bei<br />
sogenannten Agents (z. B. Inhaber<br />
von Tankstellen oder Supermärkte)<br />
abgewickelt. Mittlerweile gibt es allein<br />
in Ostafrika rund zwei Dutzend<br />
ähnlicher Anbieter, allein in Kenia nutzen<br />
über 19 Millionen Menschen die<br />
Services von M-Pesa. Das Handy war<br />
deshalb nicht nur eine bedeutende<br />
technische Erfindung, sondern auch<br />
eine der wichtigsten sozialen Innovationen<br />
des letzten Jahrhunderts.<br />
Zurück nach Europa: Wieviel soziale<br />
Innovation ist nötig, wenn die technischen<br />
Möglichkeiten schon vorhanden<br />
sind? Florian Moosbeckhofer,<br />
Leiter der Abteilung Innovation<br />
und Mobilität im ÖAMTC, berichtet<br />
36
Aufmerksamkeit<br />
Gipfel der<br />
überzogenen<br />
Erwartungen<br />
Pfad der<br />
Erleuchtung<br />
Plateau der<br />
Produktivität<br />
Illustration: © Barbara Wais<br />
Technologischer<br />
Auslöser<br />
Tal der<br />
Enttäuschungen<br />
Zeit<br />
Gartner Hype-Zyklus: Auf der Y-Achse ist die Aufmerksamkeit (Erwartungen) <strong>für</strong> die neue Technologie dargestellt,<br />
auf der X-Achse die Zeit seit ihrer Entwicklung. Am Anfang gibt es stets überzogene Erwartungen, bis sich letztlich<br />
herausstellt, wozu die Technologie wirklich taugt.<br />
von vielen Einreichungen zum Thema<br />
Mitfahrgelegenheit bei der kürzlich<br />
durchgeführten Future Challenge.<br />
„Die vielen Einmeldungen zum Thema<br />
Mitfahrgelegenheiten haben uns gezeigt,<br />
dass das Thema in der breiten<br />
Öffentlichkeit angekommen ist. Während<br />
bereits technisch ausgereifte<br />
Lösungen verfügbar sind, scheitern<br />
diese in der Praxis bislang häufig an<br />
der praktischen Nutzbarkeit und der<br />
sozialen Akzeptanz.“<br />
Vertrauen bei<br />
MitfAHrBÖrsen als<br />
Thema NuMMer eins<br />
Eingereicht wurden Beiträge wie<br />
etwa Mitfahrservices speziell <strong>für</strong><br />
Events, eine ÖAMTC-eigene Mitfahrplattform<br />
bzw. -App oder eine<br />
Identity Card & App, die das Autostoppen<br />
einfach und sicher macht.<br />
Hintergrund waren <strong>für</strong> die Ideengeber<br />
die Themen Sicherheit und Vertrauen.<br />
Soll ich wirklich zu einem Unbekannten<br />
ins Auto steigen? Soll ich<br />
jemanden mitnehmen, den ich gar<br />
nicht kenne? Was passiert bei einem<br />
Unfall, wer übernimmt hier die Haftung?<br />
So hält etwa Andrea Vierthaler<br />
im Rahmen ihrer Idee „Mitfahrzentrale<br />
ÖAMTC“ fest, dass man auf<br />
Suchmaschinen zwar eine große Anzahl<br />
an mehr oder minder vertrauenswürdigen<br />
Angeboten <strong>für</strong> Mitfahrgelegenheiten<br />
finde. Viele Menschen<br />
hätten aber eine Hemmschwelle, solche<br />
Angebote zu nutzen. Das sei bei<br />
jüngeren genauso wie bei älteren<br />
Menschen der Fall. Auch sozioökonomische<br />
Veränderungen sind mitunter<br />
ein Grund, ob und vor allem wann<br />
sich eine Innovation durchsetzt. Die<br />
Mikrowelle etwa wurde schon 1947<br />
per Zufall erfunden. Zur Massenware<br />
wurde sie erst in den 1970er Jahren,<br />
als sozioökonomische Veränderungen<br />
in der Gesellschaft eintraten.<br />
Je mehr Frauen berufstätig waren,<br />
desto mehr Nachfrage gab es nach<br />
der Möglichkeit, vorgekochtes Essen<br />
schnell aufzuwärmen.<br />
Gartner Hype-ZyKLus<br />
lässt MarKTerfOLG<br />
VOrhersAGen<br />
Ob sich technologische Innovationen<br />
wirklich auf dem Markt durchsetzen<br />
oder nicht, kann niemand mit Sicherheit<br />
voraussagen. Was sich allerdings<br />
mit Gewissheit sagen lässt,<br />
ist, dass technologische Innovatio -<br />
nen – sofern die Zeit reif da<strong>für</strong> ist –<br />
bei Markteinführung nach einem<br />
bestimmten Muster von den Usern<br />
aufgenommen werden, wie Experten<br />
festgestellt haben: Mithilfe des Gartner<br />
Hype-Zyklus lässt sich ungefähr<br />
vorhersagen, welche Aufmerksamkeit<br />
eine Innovation in den ersten Phasen<br />
auf dem Markt durchläuft. Die Darstellung<br />
erfolgt mithilfe eines Diagramms<br />
(siehe Abbildung). Die Kurve steigt<br />
zu Beginn sehr stark an und fällt nach<br />
dem Peak ebenso stark ab, um sich<br />
dann auf einem Mittelniveau einzupendeln.<br />
Ein Beispiel, das die Kurve veranschaulicht,<br />
sind Apps oder Smartphones:<br />
Zu Beginn gehypt, folgt meist<br />
eine Phase der Ernüchterung, bis sich<br />
die jeweilige Anwendung bei einem<br />
Niveau einpendelt.<br />
17 MILLIOnen<br />
InnOVATIOnen in<br />
nAHer Zukunft<br />
Was als nächstes unser Leben revolutionieren<br />
wird, lässt sich noch nicht<br />
sagen. Eine Google-Abfrage verspricht<br />
jedoch viel: Bei Eingabe<br />
der Worte „Innovation der Zukunft“<br />
erhält man über 17 Millionen Treffer.<br />
Im ersten Eintrag steht übrigens:<br />
„Die Zukunft der Innovation: Alle<br />
entwickeln mit.“ •<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
37
Foto: © shutterstock<br />
Citizen Scientists<br />
Bürgerinnen und Bürger,<br />
die sich an einem<br />
wissenschaftlichen Projekt<br />
als Laienforscher<br />
beteiligen.<br />
Wissenschaft<br />
zum Mitmachen<br />
38
<strong>Neues</strong> Wissen zu sCHAffen ist eine KernKOMPetenz der ForsCHung.<br />
Aber wie funKTIOniert das, wenn sICH WissensCHAft gegenüber<br />
neuen WissensqueLLen öffnen sOLL? Drei PIONIere, die Wissen von<br />
auSSen in ihre FORsCHuNG eINBezOGen haben („Citizen ScieNCe“),<br />
berichten über ihre ErfahruNGen. Von Astrid Kuffner<br />
Foto: © Wilfried Reinthaler<br />
Partizipatives Design stellt<br />
Mensch in den Mittelpunkt<br />
Peter Purgathofer, Professor in der Human Computer<br />
Inter action-Group am Institut <strong>für</strong> Gestaltungs- und Wirkungsforschung<br />
(TU Wien) hat 2008 das Design Research-<br />
Projekt „Sparkling Hands“ zusammen mit Schülerinnen und<br />
Schülern durchgeführt. 2016 arbeitet er wieder mit Jugendlichen.<br />
Im aktuellen Projekt werden Lernspiele entwickelt,<br />
welche die Interaktion von Technologie und Gesellschaft<br />
erfahrbar machen sollen.<br />
www.piglab.org/sparklinggames<br />
https://peter.purgathofer.net<br />
Wie es zu dem Projekt kam: In unserem<br />
Projekt „Sparkling Hands“ haben wir mit<br />
blinden und sehbehinderten Kindern<br />
eine haptische Lernunterlage <strong>für</strong> das<br />
Planlesen erarbeitet, ein Kernfach<br />
in der Ausbildung, um ein räumliches<br />
Vorstellungsvermögen zu entwickeln.<br />
Am Bundesblindeninstitut hat sich uns<br />
Designern die bisher unbekannte Welt<br />
des „Sehens durch Berührung“ eröffnet.<br />
Die Rolle der Citizen Scientists: Unsere<br />
Projekte regen Kinder und Jugendliche<br />
zum wissenschaftlichen Arbeiten an.<br />
Wir arbeiten mit dem partizipativen<br />
Design-Ansatz. Damit nähern wir uns<br />
schrittweise der bestgeeigneten technischen<br />
Lösung. Bei „Sparkling Hands“<br />
haben wir gemeinsam mit den sehbehinderten<br />
und blinden Schülerinnen und<br />
Schülern Anforderungen und Materialien<br />
definiert, wie Landkarten einfach<br />
hergestellt, erfahrbar gemacht und sinnvoll<br />
mit Audio-Informationen verknüpft<br />
werden könnten.<br />
Wie verändert sich der Forschungsprozess:<br />
Generell gehen junge Menschen<br />
heute ganz selbstverständlich mit IKT<br />
(Anm.: Informations- und Kommunikationstechnik)<br />
um. Sie haben eigene und<br />
andere Visio nen vom zukünftigen Leben<br />
als dies heute schon Erwachsene haben<br />
oder hatten. Bei „Sparkling Fingers“ war<br />
es nur mit den Kindern möglich, die<br />
beste Interaktionsform von Mensch<br />
und Maschine zu finden. Ganz konkret:<br />
Am Touchscreen unterscheiden zu<br />
können, ob es sich um die Funktion<br />
„Mehrfinger-Planlesen-Berührung“<br />
oder „Ich will etwas dazu hören“-<br />
Berührung handelt.<br />
Das wollen wir verbessern: Ganz grundsätzlich<br />
hoffen wir, dass in unseren<br />
Projekten Jugendliche erfahren können,<br />
was sie selbst antreibt, anstatt Prüfungsanforderungen<br />
zu erfüllen.<br />
Für partizipative Gestaltung brauchen<br />
wir spezialisierte Fachleute, die sich der<br />
Sprache und den Ideen anderer Disziplinen<br />
öffnen wollen. Unsere gesamte Forschungsfinanzierung<br />
steht leider konträr<br />
zur Interdisziplinarität und zur ergebnisoffenen<br />
Praxis. Sie passt am besten zum<br />
klassisch naturwissenschaftlichen Ansatz.<br />
Da will ich noch mehr wissen: Das<br />
Motivieren und Halten einer Crowd ist<br />
der heilige Gral der Citizen Science.<br />
Bisher sind jedenfalls die Grundpfeiler<br />
intrinsischer Motivation bekannt:<br />
Mastery („ich werde oder bin meisterhaft<br />
in diesem Feld“), Autonomy („ich kann<br />
es allein bewältigen) und Purpose („ich<br />
sehe einen Sinn darin).<br />
Transparenz trägt sicher zu allen drei<br />
Kategorien bei. Deshalb ist die verständliche<br />
Kommunikation von Forschungs-<br />
Ergebnissen wichtig.<br />
Citizen Science ist eine Methode, die<br />
der Gestaltungs- und Wirkungsforschung<br />
nicht fremd ist. Wir haben uns<br />
am Institut der „humanistic human<br />
computer interaction“ verschrieben.<br />
Bei Neuentwicklungen stellen wir den<br />
Menschen in den Mittelpunkt statt abstrakt<br />
psychologisch-technische Kennzahlen<br />
und technische Möglichkeiten.<br />
Das ist mir wichtig: Ich wünsche mir<br />
mehr Verständnis <strong>für</strong> die Ergebnisoffenheit<br />
von Forschungsprozessen mit<br />
Crowdsourcing. Ich würde mich freuen,<br />
wenn sich jemand an der TU Wien<br />
hauptberuflich des Themas Citizen<br />
Science annimmt. •<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
39
Foto: © Franz Pfluegl<br />
Input aus der Bevölkerung<br />
<strong>für</strong> neue Forschungsfragen<br />
Claudia Lingner ist Geschäftsführerin der Ludwig<br />
Boltzmann Forschungsgesellschaft. „Reden Sie mit!“ (2015)<br />
war europaweit das erste Projekt, in dem Open Innovation-<br />
Methoden zur Formulierung neuer Forschungsfragen in der<br />
Wissenschaft eingesetzt wurden. Mittels Crowdsourcing<br />
wurden Forschungsfragen zum Thema psychische Gesundheit<br />
aus dem Blickwinkel von Betroffenen, Fachleuten und<br />
Angehörigen gesammelt. Aktuell wird der Aufbau einer<br />
neuen Forschungsinitiative vorbereitet, um die identifizierten<br />
Fragen im letztlich ausgewählten Themenfeld „Psychische<br />
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen“ zu bearbeiten.<br />
www.openinnovationinscience.at<br />
Wie es zu dem Projekt kam: Unsere Inspiration<br />
war ein Fallbeispiel von der<br />
Harvard Medical School, bei dem Laien<br />
danach gefragt wurden, was im Bereich<br />
von Diabetes Mellitus noch nicht erforscht<br />
ist. Der entscheidende Input <strong>für</strong><br />
neue Fragestellungen kam darin von den<br />
Betroffenen selbst. Strategisch war ein<br />
solches Projekt <strong>für</strong> die Ludwig Boltzmann<br />
Gesellschaft eine logische Konsequenz.<br />
Grundsätzlich arbeiten wir nahe<br />
am Menschen, aber wir wollten noch<br />
einen Schritt näher an das Individuum<br />
und seine Interessen herankommen.<br />
Bei der Themenwahl hatten wir folgende<br />
Kriterien: Es muss Forschungslücken abdecken,<br />
eine große Gruppe ansprechen,<br />
im direkten Kontakt mit Betroffenen –<br />
und nicht über Institutionen – verbessert<br />
werden und ein neues Forschungsfeld <strong>für</strong><br />
die Ludwig Boltzmann Gesellschaft erschließen.<br />
Die Rolle der Citizen Scientists:<br />
Betroffene, Angehörige und Fachleute<br />
wurden über offene Forschungsfragen im<br />
Bereich psychische Gesundheit befragt<br />
und konnten ihre Beiträge auf einer<br />
Onlineplattform posten. Der Crowdsourcing-Prozess<br />
musste gut vorbereitet<br />
und begleitet werden. Aufgrund der<br />
Tabuisierung des Themas musste die<br />
technische Plattform entsprechend aufgebaut<br />
sein: Zusicherung von Anonymität,<br />
keine Kommentare oder Reaktionen<br />
von anderen, keine Möglichkeit, dass Interessensgruppen<br />
versuchen, ihr Thema<br />
zu pushen.<br />
Das haben wir gelernt: Die Crowd zu<br />
erreichen ist harte Arbeit! Wir haben Intermediäre<br />
besucht und in persönlichen<br />
Gesprächen überzeugt, um Betroffene zu<br />
erreichen. Es ist schwierig, eine gute Idee<br />
in der analogen Welt <strong>für</strong> die breite Beteiligung<br />
und einfache Auswertung in die<br />
digitale Welt zu überführen.<br />
Wie verändert sich der Forschungsprozess?<br />
Wir wollten wissen, welche Forschung<br />
wirklich gebraucht wird. Sich mit<br />
den Anregungen gezielt auseinanderzusetzen,<br />
erweitert und beeinflusst den<br />
Forschungsprozess. Wir haben 400 hochwertige<br />
Beiträge bekommen und daraus<br />
700 Textstellen analysiert. Die Auswertung<br />
ergab mehr als zehn relevante Themencluster.<br />
Nach einem Onlinevoting<br />
haben wir die erste Reihung an eine interdisziplinäre<br />
Expertenjury zurückgespielt,<br />
in der auch Vertreter von Patienten<br />
vertreten waren. Es braucht sehr gut<br />
durchdachte Evaluierungsprozesse, um<br />
gute und neuartige Ergebnisse zu erzielen.<br />
Diese müssen zum Teil deutlich von<br />
den üblichen Prozessen in der Wissenschaft<br />
abweichen, weil das Wissen der<br />
Crowd und die Neuigkeit nicht „hinausevaluiert“<br />
werden dürfen.<br />
Das wollen wir verbessern: Wir wollen<br />
die vielfältigen Ergebnisse <strong>für</strong> viele Spezialisten<br />
anschlussfähig gestalten und<br />
veröffentlichen, damit andere Organisationen<br />
sie aufgreifen können.<br />
Da will ich noch mehr wissen: In der<br />
Forschung ist es angesichts begrenzter<br />
Mittel nicht leicht, Crowdsourcing-Projekte<br />
durchzuführen. Wir wussten ja<br />
im Vorfeld überhaupt nicht, welche Forschungsfragen<br />
herauskommen würden.<br />
Dynamik kann nur entstehen, wenn man<br />
Diskussion und Ideen zulässt. Befristungen<br />
befördern Dynamik, können sie<br />
aber auch abstoppen. Wir müssen neuartige<br />
Wege einschlagen, um Forschung<br />
mit Open Innovation-Prinzipien durchzuführen<br />
und radikale Innovationen zu<br />
ermöglichen.<br />
Citizen Science ist eine Methode, mit<br />
der man zu neuen Forschungsfragen<br />
kommen kann. Der Input der Crowd ist<br />
<strong>für</strong> Open Innovation in Science wertvoll,<br />
aber ohne Experten geht es nicht.<br />
Inter disziplinarität ist leider noch immer<br />
schwierig. Wir sind heute gefordert zu<br />
kommunizieren woran wir forschen und<br />
was das bringt. Das ist ein Beitrag zur<br />
Bewusstseinsbildung in Bezug auf Forschung.<br />
Hier kann man nicht aktiv genug<br />
werden.<br />
Das ist mir wichtig: Bei Open Innovation<br />
in Science ist das Um und Auf eine<br />
Kultur der Transparenz, des Dialogs und<br />
der Augenhöhe. Man muss offen kommunizieren<br />
und Vereinbarungen einhalten,<br />
sonst bleibt die Crowd nicht dabei.<br />
Unser Wissen zum Thema verbreiten<br />
wir als Ludwig Boltzmann Gesellschaft<br />
im seit 2016 laufenden Ausbildungscurriculum<br />
„Lab for Open Innovation<br />
in Science“ (LOIS). Hier lernen Wissenschafter<br />
konkret, wie sie Open Innovation-Methoden<br />
und -Prinzipien in der<br />
Forschung anwenden können. •<br />
40
Foto: © Daniel Dörler<br />
Wildtier-Statistik per<br />
App verbessern<br />
Florian Heigl, Dissertant am Institut <strong>für</strong> Zoologie der<br />
Universität <strong>für</strong> Bodenkultur, betreibt seit 2013 das Projekt<br />
„Roadkill“ mit einer App zur Erfassung überfahrener<br />
Wirbeltiere. Vorbild sind die USA, wo Freiwillige seit 2009<br />
tote Tiere auf der Straße <strong>für</strong> die Statistik erfassen. Er will<br />
Lücken in der Statistik schließen und mehr Bewusstsein<br />
<strong>für</strong> den menschlichen Einfluss auf Wildtiere schaffen.<br />
Heigl ist außerdem Gründer und Koordinator der<br />
Plattform citizen-science.at und Mitveranstalter der<br />
jährlichen österreichischen Citizen Science Konferenz.<br />
http://roadkill.at und<br />
www.citizen-science.at<br />
Wie kam es zum Projekt: Angefangen<br />
hat alles 2013 mit praktischen Übungen<br />
<strong>für</strong> Studierende, die Daten sammeln und<br />
auswerten lernen sollten. Die Idee, in der<br />
Übung, Daten zu überfahrenen Tieren<br />
mittels App zu erheben, war gut, doch<br />
die vorhandene Technik stieß bald an<br />
ihre Grenzen. Wir bekamen viel Feedback<br />
zu unserer Methode und konnten<br />
die Datenerfassung seither verbessern.<br />
Wir haben jetzt eine Website und dazugehörige<br />
Apps (<strong>für</strong> Android und iOS)<br />
und arbeiten seit 2014 mit der Bevölkerung<br />
zusammen. Unser Technik partner<br />
N!NC entwickelt gemeinsam mit uns<br />
eine Referenz-App <strong>für</strong> solche Projekte.<br />
Die Rolle der Citizen Scientists: Es wird<br />
erhoben, welche Tiere auf Straßen zu<br />
Tode kommen und welche Gründe es da<strong>für</strong><br />
geben könnte. Die Crowd, also interessierte<br />
Bürger und Bürgerinnen, erfassen<br />
Daten zu überfahrenen Tieren. Sie<br />
können Fotos und Beschreibungen nach<br />
Registrierung auf der Projekt-Website<br />
oder über eine eigens entwickelte App<br />
melden und wir machen die statistische<br />
Auswertung.<br />
Das haben wir gelernt: In der Wissenschaft<br />
kommt es fast nur auf gute Daten<br />
an. Bei Citizen Science steht aber auch<br />
die Kommunikation und eine leichte Bedienbarkeit<br />
des Meldesystems <strong>für</strong> die Bevölkerung<br />
weit oben auf der Prioritätenliste.<br />
Da wir mit Apps arbeiten, die über<br />
ein Smartphone bedient werden, stehen<br />
wir bei Design und Usability in Konkurrenz<br />
zu kommerziellen (Spiele-)Anbietern:<br />
Die App muss super ausschauen<br />
und komplett intuitiv sein, sonst wird sie<br />
nicht genutzt.<br />
Wie verändert sich der Forschungsprozess,<br />
wenn man die Bevölkerung integriert?<br />
Wir könnten im Rahmen eines<br />
klassischen Forschungsprojekts an der<br />
BOKU diese Daten nie in der Breite und<br />
mit dem engen zeitlichen Bezug erheben.<br />
Etwa die Krötenwanderung. Sie beginnt<br />
regional und zeitlich gestaffelt. Wenn ein<br />
Kälteeinbruch kommt, hört sie auf und<br />
fängt dann wieder an. Das könnte man<br />
von Wien aus nie durchführen. Der Roadkill,<br />
also auf der Straße getötete Tiere,<br />
bleibt zudem oft nur maximal zwei Tage<br />
liegen. Selbst mit einem engmaschigen<br />
Monitoring würde man viele tote Tiere<br />
nicht finden. Wir bekommen zu den einzelnen<br />
Datenpunkten viele Zusatzinfos,<br />
die Teilnehmer lernen voneinander, und<br />
auch wir Wissenschafter haben schon einiges<br />
von den Teilnehmern gelernt.<br />
Das wollen wir verbessern: Wir tasten<br />
uns heran von zu Beginn „einfach mal<br />
machen“ zu „gut machen“. Noch haben<br />
wir bei den Teilnehmenden von Ost nach<br />
West ein Gefälle. Es braucht Zeit, die<br />
Community in Österreich aufzubauen.<br />
Das Projekt ist nach wie vor nicht finanziert,<br />
sondern von allen Beteiligten Freiwilligenarbeit.<br />
Ich arbeite im Rahmen<br />
meiner Dissertation ohne Anstellung<br />
an der BOKU daran. Bisher entwickelt<br />
N!NC die App im Rah men der eigenen<br />
Produktentwickung pro bono weiter. Wir<br />
versuchen, Sponsoren aufzutreiben, denn<br />
eine App zu entwickeln und zu erhalten<br />
ist teuer. In der gängigen Forschungsfinanzierung<br />
wird so etwas nicht abgedeckt.<br />
Inhaltlich wollen wir uns von Zufallsfunden<br />
zur Streckenüberwachung<br />
vortasten. Dabei melden uns Menschen,<br />
die regelmäßig eine bestimmte Strecke<br />
fahren, ob sie etwas gefunden haben und<br />
auch, wenn sie nichts gefunden haben.<br />
Da will ich noch mehr wissen: Es wäre<br />
interessant zu erfahren, was Men schen<br />
motiviert, über einen längeren Zeitraum<br />
mitzumachen. Der Austausch mit Kollegen<br />
und Kolleginnen aus verschiedenen<br />
Fachbereichen kann uns hier weiterbringen.<br />
Parallel setzen wir uns interdisziplinär<br />
damit auseinander, was Wissenschaft<br />
eigentlich ist, wo ihre Grenzen liegen<br />
und welche Disziplin was genau darunter<br />
versteht. Das alles macht deutlich, dass<br />
wir Lernen de sind, nicht Allwissende.<br />
Citizen Science ist eine Methode, die<br />
nicht Selbstzweck sein soll und sich nicht<br />
<strong>für</strong> jede Fragestellung eignet. Man muss<br />
wissen, dass Kommunikation ein großer<br />
Teil der Arbeit ist, und die ist auch teuer.<br />
Citizen Science ist sicher keine billige<br />
Datenerhebung. Man braucht Zeit und<br />
muss die Ansprache designen, durchdenken,<br />
technisch aufsetzen und die Teilnehmenden<br />
mit Respekt betreuen. Ergebnisse<br />
aus Citizen Science-Projekten<br />
sind mittlerweile in der Wissenschaftswelt<br />
anerkannt. Damit die Crowd langfristig<br />
motiviert bleibt, müssen die Ergebnisse<br />
jedoch übersetzt und an sie<br />
zurückgespielt werden.<br />
Das ist mir wichtig: Die Auseinandersetzung<br />
auf Augenhöhe mit der Crowd<br />
und die interdisziplinäre Interaktion<br />
zwischen verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen.<br />
Ich arbeite parallel daran,<br />
dass der Begriff nicht verwaschen wird<br />
und nicht jede Umfrage Citizen Science<br />
genannt werden kann. •<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
41
Ab in<br />
den<br />
UrLAub<br />
42<br />
Foto: © Karin Feitzinger
Wie köNNte die ZukuNFt aussehen, weNN die Ideen aus der ÖAMTC<br />
Future CHAlleNGe uMGesetzt sIND? Die folgende GesCHICHTe<br />
über die fIKTIVe Familie Mayer auf dem Weg in den UrLAub ist ein von<br />
der AuTOrin enTWOrfenes ZukunftsBILD, das anhand ausgewäHLTer<br />
TeilnehmerIdeen aus dem CrOWDsourcing-WeTTBewerb enTWICKelt<br />
wurde. Von Johanna Stieblehner<br />
Frau Mayer freut sich schon seit<br />
Wochen auf den gemeinsamen<br />
Urlaub mit ihrer Familie. Dieses Jahr<br />
besuchen sie die Eltern von Frau<br />
Mayer in Zell am Moos in Oberösterreich.<br />
Seitdem sie den neuen Job in<br />
Graz hat, sehen sie einander leider<br />
viel zu selten. Gleich nach dem letzten<br />
Meeting am Nachmittag kann sich<br />
Frau Mayer auf den Weg machen.<br />
Moritz Mayer, ihr Mann, ist mit den<br />
Kindern bereits am Vormittag mit dem<br />
E-Car losgefahren. Sie hatten Glück,<br />
dass das Auto noch frei war. Denn<br />
seit einigen Jahren teilt sich Familie<br />
Mayer das Auto mit zwei anderen<br />
Familien. Im Alltag funktioniert das<br />
gut. Nur in der Ferienzeit müssen<br />
sich alle genau absprechen, denn<br />
es scheint so, als würden alle gleichzeitig<br />
auf Urlaub fahren wollen.<br />
Eine APP, die InforMA-<br />
TIOnen zu Tourismus<br />
und Mobilität vereint<br />
In diesem Jahr haben Moritz Mayer<br />
und die Kinder angeboten, die<br />
Urlaubsplanung zu übernehmen.<br />
Herr Mayer hat dazu eine neue App<br />
entdeckt: Tourility. Diese App wird<br />
vom ÖAMTC betrieben und bietet<br />
den Nutzern auf verschiedenen<br />
Devices (z. B. Smartphone, im<br />
Cockpit des Autos, etc.) touristische<br />
Informationen in Kombination mit<br />
Mobilitätsinformationen (z. B. Routenplanung,<br />
Baustelleninformation,<br />
Tankstellenübersicht). Herr Mayer<br />
schwärmt regelrecht von dieser App,<br />
scheint sie doch ein Alleskönner in<br />
Bezug auf die Urlaubsplanung zu sein.<br />
ZwischensTOPPs<br />
auf der Reiseroute<br />
VOn der COMMunity<br />
bewertet<br />
Vollbepackt sind die drei heute mit<br />
dem Auto losgefahren. Erster Stopp<br />
ist am Toplitzsee in der Nähe von Bad<br />
Aussee. Tourility hat diesen kleinen<br />
Umweg empfohlen. ÖAMTC-Mitglieder,<br />
die gleichzeitig Tourility-Nutzer<br />
sind, haben diese Empfehlung hinterlegt.<br />
Herr Mayer konnte nachlesen,<br />
dass die Wanderroute und der See<br />
von ÖAMTC-Mitgliedern gut bewertet<br />
und <strong>für</strong> einen Familienausflug geeignet<br />
sind. Und die Kinder wollten sich<br />
am ersten Tag sowieso „aus powern“,<br />
wie die kleine Katharina sagte. Sie<br />
ist gerade sechs Jahre alt geworden,<br />
aber schon eine richtige Sportskanone<br />
– ganz wie ihr großer Bruder<br />
Lukas.<br />
Eine Art MOBILITäts-<br />
KreDITKArte<br />
„Für den Fall, dass die Strecke doch<br />
zu weit wird, habe ich gesehen, dass<br />
sich ein Fahrradverleih auf der Strecke<br />
befindet“, hat Herr Mayer seiner Frau<br />
versichert. Die Gebühren dazu sind<br />
auch über die Austrian Mobility Card<br />
gedeckt. Die Austrian Mobility Card<br />
wird Familie Mayer im Urlaub häufig<br />
nutzen, immerhin sind nach einer<br />
jährlichen Pauschalgebühr alle Verkehrsmittel<br />
der Kooperationspartner<br />
(Schlüsselakteure der österreichischen<br />
Mobilität) inkludiert. Aber auch<br />
Radverleihe und Bootsverleihe zählen<br />
zu den Partnern. Mit der Austrian Mobility<br />
Card muss sich Familie Mayer<br />
nicht aufwändig um Fahrkarten kümmern<br />
und sich in der Menge der Angebote,<br />
Ermäßigungen und Sonderermäßigungen<br />
zurechtfinden, sondern<br />
kann z. B. den Fahrrad-Verleih oder<br />
die Bahn einfach nutzen. Wenn die<br />
Beine der Kinder zu schwer werden,<br />
können die fleißigen Wanderer also<br />
problemlos aufs Rad wechseln. Und<br />
sollte es ganz schlimm werden, könnten<br />
sie auch auf ein Boot umsteigen<br />
und den See damit überqueren. Die<br />
Gebühr <strong>für</strong> das Boot ist ja ebenfalls<br />
über die Austrian Mobility Card gedeckt.<br />
AuTOfAHrer machen<br />
einander auf<br />
sCHäden aufmerksAM<br />
Gerade hat Frau Mayer eine Nachricht<br />
von ihrem Mann und den Kindern<br />
bekommen. Der Car-Communicator<br />
unterhält die drei mit seinen Signalen.<br />
Diesmal wurden sie informiert, dass<br />
das linke Rücklicht nicht funktioniert.<br />
Die Kinder finden es sehr lustig, wenn<br />
es im Auto klingelt und sie von einem<br />
anderen Autofahrer auf einen Schaden<br />
am Auto aufmerksam gemacht<br />
werden. Sie machen ein Spiel daraus<br />
und raten, welches von den vorbeifahrenden<br />
Autos es war. Oder sie<br />
gehen den umgekehrten Weg und<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
43
Mobile Ladestation<br />
von<br />
Rene Decker<br />
Tourility Touristik<br />
und Mobilität<br />
von<br />
Karl Pramendorfer<br />
Datenbrille <strong>für</strong><br />
Servicetechniker<br />
von<br />
Jürgen Pucher<br />
KFZ-Communicator<br />
von<br />
Christoph Seewald<br />
Mobilitätscard<br />
Austria<br />
von<br />
Jose Luis Aabd Garcia<br />
Ferndiagnosestecker<br />
von<br />
Jürgen Hube<br />
Elektrisch gehen<br />
von<br />
Johann Günther<br />
Die ÖAMTC Future Challenge: Auf die Frage, welche Services der ÖAMTC seinen Mitgliedern in Zukunft anbieten soll,<br />
wurden eine Vielzahl an Ideen eingereicht. Der thematische Bogen ist weit gespannt. Hier eine kleine Auswahl der 454 Vorschläge.<br />
suchen nach einem Auto mit Defekt,<br />
den sie dem Fahrer melden können.<br />
Das geht recht einfach, Familie Mayer<br />
musste sich vorab nur die notwendige<br />
App im Auto installieren. Wird ein beschädigtes<br />
Auto erkannt, so genügt<br />
es, das Nummernschild des betroffenen<br />
Autos einzutippen. Der betroffene<br />
Fahrer erhält sogleich auf seinem<br />
Bordcomputer den Hinweis.<br />
Wanderroute<br />
und Anreise<br />
auf<br />
KnopfdruCK<br />
Die Zugfahrt nach Zell am Moos wird<br />
Frau Mayer nutzen, um über Tourility<br />
eine Wanderroute zu suchen, die die<br />
Familie inklusive ihrer Eltern und den<br />
Kindern mühelos absolvieren können.<br />
Besonders praktisch findet sie, dass<br />
die App automatisch anzeigt, wie man<br />
den Ausgangspunkt der Wanderung<br />
mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht.<br />
Zu sechst im Auto ist einer<br />
zu viel und ihre Eltern fahren ja nicht<br />
mehr mit dem Auto.<br />
Für ihren Vater hat Frau Mayer einen<br />
Spazierschweber reserviert, damit<br />
er Spaziergänge mitmachen kann,<br />
denn vor allem längere Strecken<br />
oder Bergaufgehen sind <strong>für</strong> ihn einfach<br />
schon sehr beschwerlich. Der<br />
Spazierschwe ber ist ein elektrisch<br />
unterstützter Kick-Roller. So kann<br />
der Großvater mitgehen und hat dabei<br />
noch mehr Ausdauer als die Kleinen.<br />
Die Kinder finden es auch immer<br />
spannend, wenn er das Gerät benutzt.<br />
Die mobile<br />
LADesTATIOn tanKT<br />
DAs Elektro-AuTO<br />
WIeder auf<br />
Scheinbar hat Herr Mayer heute kein<br />
Glück mit dem Auto. Er hat seine<br />
Frau soeben informiert, dass der<br />
Akku des Elektroautos plötzlich leer<br />
war. Es sei ohne vorherige Warnung<br />
völlig überraschend passiert. Der<br />
Wagen hat aber sofort den ÖAMTC<br />
verständigt, und so konnte die „Erste<br />
Hilfe“-Kette rasch in Gang gesetzt.<br />
Das Prozedere ist heute ja sehr einfach:<br />
Die Autodaten werden der<br />
Pannenhilfe online übermittelt.<br />
Damit kann ein ÖAMTC-Techniker<br />
per Ferndiagnose feststellen, was<br />
fehlerhaft ist. Leicht zu behebende<br />
Defekte kann der Pannenhelfer quasi<br />
per Fernsteuerung direkt von seinem<br />
PC aus erledigen. Sollten größere<br />
Schäden vorliegen, werden die<br />
GPS-Daten an einen ÖAMTC-<br />
Pannenhelfer in der Nähe geschickt,<br />
der dann vor Ort kommt. Diesmal<br />
hatte der Gelbe Engel die mobile<br />
Ladestation dabei. Im Prinzip funktioniert<br />
diese wie ein Reserve kanister<br />
<strong>für</strong> flüssigen Treibstoff. Die Batterie<br />
wird auf 20 % gefüllt, sodass der<br />
Fahrer zumindest bis zur nächsten<br />
Tankstelle kommt. Dort kann die<br />
Batterie dann vollständig geladen<br />
bzw. weitere Schäden behoben<br />
werden.<br />
44
Illustration: © shutterstock<br />
Eine DATenbrille<br />
HILft dem TeCHniker<br />
das GebreCHen<br />
sCHneLL zu finden<br />
Frau Mayer hat gerade ihren Sohn<br />
Lukas am Telefon. Er erzählt ihr, was<br />
an der Tankstelle passiert. Lukas ist so<br />
aufgeregt, dass sie ihn kaum versteht:<br />
„Nachdem Papa dem Service techniker<br />
den Vorfall geschildert hatte, sagte der<br />
Techniker zu Katharina und mir, dass<br />
er jetzt seine Zauberbrille holen würde.<br />
Ich bin gespannt, was das <strong>für</strong> eine<br />
Brille ist!“ Es handelt sich natürlich um<br />
eine Datenbrille, die den Techniker dabei<br />
unterstützt, das Auto zu untersuchen,<br />
ohne es gleich in alle Einzelteile<br />
zerlegen zu müssen.<br />
Während der<br />
RePArATur können<br />
E-BIKes ausgeBOrgt<br />
werden<br />
Damit steht aber auch sofort fest,<br />
dass Herr Mayer und die Kinder eine<br />
längere Pause an der Tankstelle einlegen<br />
müssen. Und wieder kommt die<br />
Tourility-App zum Einsatz. Sie zeigt<br />
ein Freibad in der Nähe der Tankstelle<br />
an. Es hat geöffnet und es gibt eine<br />
Drei-Stunden-Karte. Bei diesem Wetter<br />
das optimale Alternativprogramm!<br />
Herr Mayer und die Kinder haben sich<br />
die an der Tankstelle zum Verleih bereitgestellten<br />
E-Bikes ausgeborgt und<br />
fahren jetzt mit Sack und Pack ins Bad.<br />
Drei Stunden sollten <strong>für</strong> die Reparatur<br />
des Autos auch ausreichen.<br />
LeICHT geMACHT:<br />
MehrMALIGes<br />
uMsteigen mit<br />
Austrian MOBILITy<br />
Card<br />
Vor ihrem Meeting muss Frau Mayer<br />
noch schauen, dass sie alle Sachen<br />
bereit hat, damit sie danach gleich los<br />
kann. Sie darf nicht auf die Austrian<br />
Mobility Card vergessen; sie muss<br />
ja mehrmals umsteigen, und mit der<br />
Card kann sie alle Verkehrsmittel nutzen,<br />
die sie <strong>für</strong> ihre Anreise braucht.<br />
Zusätzlich hat sie sämtliche Platzreservierungen<br />
auf der Card gespeichert.<br />
Zuerst nimmt sie das E-Citybike<br />
vom Büro zu Bahnhof. Sie hat<br />
sicherheitshalber rechtzeitig eines<br />
reserviert, damit um 17:00 Uhr<br />
auch eines bereit steht. Die Strecke<br />
zum Bahnhof schafft sie locker in<br />
15 Minuten. Einen Sitzplatz im Zug hat<br />
sie auch schon im Voraus gebucht.<br />
AuCH eine<br />
MitfAHrBÖrse<br />
ist im NeTZWerk<br />
In Salzburg steigt sie in das Fahrzeug<br />
einer Fahrgemeinschaft um. Zufällig<br />
fährt jemand direkt von Salzburg nach<br />
Zell am Moos, da hatte sie Glück.<br />
Gut, dass sich der Fahrer im Austrian<br />
Mobility Card-Netz registriert hat.<br />
Sonst hätte sie ihn nicht gefunden.<br />
Das Meeting hat pünktlich geendet<br />
und Frau Mayer sitzt bereits im Zug<br />
nach Salzburg. Herr Mayer hat ihr ein<br />
Video geschickt mit der frohen Botschaft,<br />
dass sie auch bereits bei ihren<br />
Eltern angekommen sind. Das Wetter<br />
ist heute gut und sie waren alle schon<br />
im See schwimmen. Jetzt kann<br />
der Urlaub auch <strong>für</strong> Frau Mayer<br />
beginnen. •<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
45
Zeit ist Geld<br />
Bild: © shutterstock<br />
46
Das selbstfahreNDe Auto ist im beGRIFF, die StraSSen zu eROBeRN.<br />
Bis es sICH fläCHendeCKend ausbreITet, könnten jeDOCH Jahrzehnte<br />
vergehen. Das lässt Zeit <strong>für</strong> VisIOnen:<br />
Basierend auf ExperteninterVIews besCHreIBT Die JournALIsTIn<br />
DanieLA MüLLer das Leben mit RoboterauTOs im Jahr 2035.<br />
Von Daniela Müller<br />
On the Road im Jahr 2035. In der<br />
Stadt fährt auf einem <strong>für</strong> selbstfahrende<br />
Autos definierten Fahrstreifen<br />
ein Taxi ohne Lenker, auf dem Gehsteig<br />
bewegt sich neben einer älteren<br />
Dame ein kleiner Roboter, der ihren<br />
Einkauf trägt. Auf dem Universitätscampus<br />
fährt ein Roboterauto die Studierenden<br />
und Mitarbeiter von Institut<br />
zu Institut. Viele Tourismusorte haben<br />
zur Verkehrsberuhigung beschlossen,<br />
den motorisierten Individualverkehr<br />
durch selbstfahrende Großraumlimousinen,<br />
in denen die Gäste transportiert<br />
werden, zu ersetzen.<br />
50 Minuten mehr<br />
ZeIT pro TAG weIL<br />
das Auto<br />
selbst fährt<br />
Das selbstfahrende Auto ist zwar<br />
nicht so uneingeschränkt unterwegs,<br />
wie man das 2016 noch geglaubt<br />
hatte, es hat das Straßenbild aber<br />
doch verändert. Damals, als man in<br />
Bezug auf das autonome Fahren noch<br />
von Testphasen sprach, galt das<br />
Concept Car F015 von Daimler als<br />
Vorzeigemodell, was in Sachen autonomes<br />
Fahren möglich sein könnte.<br />
Das großräumige Testauto sollte sich<br />
selbst lenken, der Fahrer machte es<br />
sich hingegen im geräumigen Fond<br />
des Fahrzeuges bequem. 50 Minuten<br />
mehr pro Tag, stellte eine Studie<br />
der Unternehmensberatung McKinsey<br />
2016 fest, würden autonome Fahrzeuge<br />
den Insassen an Zeit schenken.<br />
Diese könnten sie nutzen, um sich zu<br />
entspannen, zu schlafen, zu arbeiten<br />
oder Sitzungen abzuhalten. Damals<br />
waren sich die Verkehrsexperten<br />
einig: Es werde noch viel, sehr viel<br />
Zeit vergehen, bis selbstfahrende<br />
Fahrzeuge wie der F015 das Straßenbild<br />
prägen würden. Etwa erwies<br />
sich der Tesla-Unfall im Jahr 2016<br />
als große Ernüchterung. Das damalige<br />
Vorzeige-Elektroauto hatte we-<br />
gen des starken Sonnenlichts einen<br />
im Gegenverkehr linksabbiegenden<br />
Lkw-Zug nicht gesehen und war ungebremst<br />
in diesen gefahren. Dabei<br />
starb der Lenker, der die Herrschaft<br />
über das Fahrzeug an den Computer<br />
abgegeben hatte. Neben der Technologie<br />
müssten auch andere wesentliche<br />
Dinge geklärt werden: Wer<br />
ist schuld, wenn das computergesteuerte<br />
Auto einen Unfall verursacht?<br />
Wie sollen die Städte der Zukunft<br />
aussehen, um die geeignete Infrastruktur<br />
<strong>für</strong> das Roboterauto zu bieten?<br />
Wie kommunizieren Mensch und<br />
Maschine miteinander, etwa in unklaren<br />
Vorrangsituationen? Und überhaupt:<br />
Will man in einem Auto sitzen,<br />
das man nicht selbst lenkt?<br />
Im Jahr 2016 hatte man sich viel<br />
vorgenommen. Internetriesen wie<br />
Google oder Apple tüftelten an<br />
Konzepten, wie <strong>für</strong> die Insassen<br />
der Aufenthalt in den Fahrzeugen<br />
interessant, unterhaltsam und bereichernd<br />
gestaltet werden könnte.<br />
Denn 50 Minuten mehr Zeit pro Tag<br />
könnten mit Onlineshopping oder mit<br />
der Nutzung kostenpflichtiger Apps<br />
verbracht werden. Zeit wäre damit<br />
einmal mehr Geld.<br />
ReCHTLICHe FrAGen<br />
sOLLTen BIs 2035<br />
geklärt sein<br />
Heute, 2035, sind rechtliche Aspekte<br />
des autonomen Fahrens kein Thema<br />
mehr, hat doch jedes Fahrzeug eine<br />
Blackbox, die das Unfallgeschehen<br />
genau nachvollziehbar macht. Fahrerflucht<br />
ist damit unmöglich geworden<br />
und die Aufgaben der Polizei haben<br />
sich um eine Komplexitätsstufe verringert:<br />
Per Knopfdruck kann der Unfallhergang<br />
auf dem Screen des Polizeicomputers<br />
wiedergegeben werden.<br />
Das Suchen und das Befragen von<br />
Unfallzeugen ist damit hinfällig, die<br />
Schuldfrage recht schnell geklärt.<br />
KOMMunikation<br />
ZWIschen Mensch<br />
und MasCHIne als<br />
grOsse Aufgabe<br />
der ForsCHung<br />
Unterschätzt hatte man hingegen die<br />
komplexe Aufgabe, Mensch und Maschine<br />
miteinander in Kommunikation<br />
zu bringen. Es brauchte jahrelange intensive<br />
Forschung, bis fahrerlose<br />
Autos alle Arten von Fußgängern<br />
100-prozentig erkannten und jedem<br />
Einzelnen signalisierten, dass er<br />
oder sie die Straße bitteschön queren<br />
möge. Denn nicht nur das Auto<br />
musste ein klares Signal geben, auch<br />
der Mensch musste dieses eindeutig<br />
erkennen können. Man hatte damals<br />
viel ausprobiert. Etwa gab es ein Kooperationsprojekt<br />
des Linzer Ars<br />
Electronica Future Labs mit Daimler<br />
und dessen F015 Concept Car.<br />
VOM Auto<br />
projIZIerter<br />
Zebrastreifen als<br />
sIGnAL zum Queren<br />
der StrAsse<br />
Die Frage, wie das selbstfahrende<br />
Auto mit einem Fußgänger kommunizieren<br />
soll, wurde 2016 so getestet:<br />
Will ein Fußgänger vor dem Auto über<br />
die Straße gehen und ist das nach<br />
Überprüfung der gesamten Verkehrssituation<br />
durch das F015 gefahrlos<br />
möglich, so bleibt das F015 stehen.<br />
Mittels projiziertem Zebrastreifen und<br />
animierten LED-Pfeilen an der Fahrzeugfront<br />
zeigt das Auto dem Passanten<br />
an, dass er die Straße queren<br />
kann. Auf der Heckscheibe des Autos<br />
erscheint ein großes Stoppschild, um<br />
den hinterherkommenden Fahrzeugen<br />
zu kommunizieren, dass sie sich<br />
einbremsen müssen. Martina Mara,<br />
die 2016 als Roboter-Psychologin im<br />
Ars Electronica Future-Lab maßgeblich<br />
an den Tests beteiligt war, stellte<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
47
Alexander<br />
Mankowsky,<br />
Zukunftsforscher<br />
bei Daimler:<br />
Markus<br />
Maurer,<br />
TU<br />
Braunschweig:<br />
Foto: © Daimler<br />
„2035 werden weiträumige autonome Fahrfunktionen<br />
möglich sein, von selbstfahrenden Lkws, Lastenrobotern,<br />
Drohnen bis hin zu computergesteuerten Autos. Es wird<br />
neue Systeme geben, etwa hochliegende Straßenbahnen<br />
oder Drohnen, die Lasten oder auch Menschen transportieren.<br />
Wer das Rennen als beliebtestes Transportmittel<br />
gewinnt, wird bis dahin nicht klar sein. Selbstfahrende<br />
Autos werden sich zunächst dort durchsetzen, wo sie<br />
als Arbeitsmittel gebraucht werden, im öffentlichen<br />
Nahverkehr oder bei Menschen, die sich die Autos<br />
leisten können. Und es wird eine neue Industrie<br />
entstehen: zwischen der Automobiltechnologie und<br />
dem, was die großen Internetkonzerne in den Bereich<br />
autonomes Fahren einbringen.“<br />
Foto: © Daimler Benz Stiftung<br />
„Ich schätze, dass automatisches Überholen auf<br />
der Landstraße frühestens in 20 Jahren möglich<br />
sein wird. Schon in wenigen Jahren realisierbar<br />
könnte autonomes Fahren in Stausitua tionen<br />
oder von selbstfahrenden Transportfahrzeugen in<br />
definierten Zonen sein, etwa auf Campusarealen<br />
oder in autofreien Tourismusorten. Robotaxis<br />
könnten in etwa 15 Jahren das Stadtbild prägen.<br />
Ich glaube, die Technologie wird nicht so das<br />
Problem sein, sondern vielmehr, das gesellschaftliche<br />
Konzept <strong>für</strong> autonomes Fahren auszuverhandeln.“<br />
auch in Aussicht, dass das Auto dem<br />
Fußgänger verbal die Querung der<br />
Straße anzeigen könnte. Dies erwies<br />
sich jedoch schon in Testverfahren<br />
wenig praktikabel, da mit der steigenden<br />
Anzahl der autonomen Autos auf<br />
den Straßen zusammen mit dem Umgebungslärm<br />
einzelne Sprachsignale<br />
untergehen würden.<br />
Schlafen, einkaufen<br />
ODer SprACHen<br />
lernen ansTATT das<br />
fAHrzeug zu lenken<br />
Die Annahme, dass autonomes Fahren<br />
weniger Spaß machen würde als<br />
selbst am Steuer zu sitzen, gilt 2035<br />
als widerlegt. Die Zeit im Auto wird<br />
nur eben anders genutzt als um zu<br />
kuppeln, zu bremsen oder Gas zu geben.<br />
2016 erhob eine Studie der Managementberatung<br />
Horváth & Partners<br />
gemeinsam mit dem Fraunhofer<br />
Institut <strong>für</strong> Arbeitswirtschaft und Organisation,<br />
was Menschen in der potenziell<br />
zur Verfügung stehenden Zeit<br />
gerne machen würden. Das Ergebnis<br />
erwies sich als zukunftsweisend: Sie<br />
würden gerne arbeiten, online Einkäufe<br />
erledigen, Fitnessübungen<br />
machen, Fernsehen, Sprachkurse<br />
absolvieren oder einfach essen und<br />
schlafen, hieß es. Besonders interessant:<br />
Drei Viertel der Befragten waren<br />
schon damals breit, Geld <strong>für</strong> den<br />
Zeitvertreib an Bord zu bezahlen. Je<br />
nach Altersgruppe und „Unterhaltungskategorie“,<br />
von Produktivität (Arbeiten,<br />
Weiterbildung, etc.) über Information<br />
bis hin zu Wohlfühl- und Fitnessprogrammen,<br />
waren das 20 bis 40 Euro<br />
im Monat.<br />
20 Jahre nach Erscheinen der Studie<br />
hat sich die Vorhersage in ein Milliardengeschäft<br />
<strong>für</strong> die Industrie gewandelt:<br />
Auf Wunsch der Kunden werden<br />
Schreibtische ins Auto eingebaut,<br />
mitunter kleine Küchenzeilen, ausklappbare<br />
Betten oder aber auch<br />
Bildschirme und Head-up-Displays.<br />
Das sind Anzeigesysteme, bei denen<br />
der Nutzer seine Kopfhaltung bzw.<br />
Blickrichtung beibehalten kann, weil<br />
die Informationen in sein Sichtfeld<br />
projiziert werden. Längst haben sich<br />
Hotels etabliert, die ihr Geschäftsmodell<br />
erweitert haben und dem Gast<br />
nicht nur Bett und Verköstigung anbieten,<br />
sondern auch Transport.<br />
ResTAurants auf<br />
Rädern als<br />
GesCHäftsMODeLL<br />
der Zukunft<br />
Restaurants auf Rädern sind vor allem<br />
über die Mittagszeit ausgebucht. Das<br />
Geschäft boome, doch noch mehr<br />
Zulassungen würde das Straßennetz<br />
nicht vertragen, sagt der Verkehrsminister.<br />
Schließlich müsse auch noch<br />
Platz <strong>für</strong> den Individualverkehr sein.<br />
Und das, obwohl die Anzahl an zugelassenen<br />
Privat-Pkws gesunken ist;<br />
vor allem zwischen 2025 und 2035,<br />
obwohl Verkehrsforscher dies schon<br />
2016 prophezeiten.<br />
WasCHstrasse,<br />
SerVICe, Tanken –<br />
erledigt das AuTO<br />
selbst<br />
Heute sind zwar weniger Privat-Pkws<br />
zugelassen, sie sind aber länger auf<br />
der Straße unterwegs als dies früher<br />
der Fall gewesen ist. Carsharing, also<br />
das Teilen eines Autos mit anderen<br />
Nutzern, ist <strong>für</strong> viele zur Einnahmenquelle<br />
geworden. Ausgetüftelte Apps<br />
sorgen <strong>für</strong> den Überblick, wer das<br />
Auto wann und wo benutzt. Weil das<br />
Fahrzeug autonom unterwegs ist,<br />
fährt es alleine in die Waschstraße,<br />
zum Service und zur Ladestation.<br />
Rückblickend betrachtet, ist es unverständlich,<br />
warum es so lange gedauert<br />
hat, bis sich Carsharing durchgesetzt<br />
hat: Im Berlin des Jahres 2016<br />
wurde ein Fahrzeug nur 36 Minuten<br />
pro Tag verwendet, 95 Prozent seiner<br />
Zeit stand es auf wertvollem (Park-)<br />
Raum, der nun anderweitig genutzt<br />
werden kann. Und die CO 2-Emissionen<br />
waren in keinem anderen Bereich –<br />
nicht einmal in der Industrie – so<br />
hoch wie im Straßenverkehr.<br />
48
Foto: © Mallaun Photography<br />
Thomas Sauter-<br />
Servaes, Zürcher<br />
Hochschule <strong>für</strong><br />
Angewandte<br />
Wissenschaften:<br />
„Die ersten Fahrzeuge werden aufgrund der technologischen<br />
Komplexität teuer sein, doch ich rechne damit,<br />
dass durch eine Vielzahl an Fahrzeug- und Service anbietern<br />
die Kosten bald sinken werden. Es könnte sogar,<br />
sofern nicht regulierend eingegriffen wird, zu Effekten<br />
wie in der Luftfahrtbranche kommen, dass Lowcost-<br />
Anbieter andere vom Markt drängen.<br />
Für den Nutzer könnten Mobilitätsangebote ähnlich<br />
konsumierbar sein wie Musikdienste: Mit dem Bezahlen<br />
einer monatlichen Flatrate kann der Nutzer so viele<br />
Angebote in Anspruch nehmen wie er möchte.“<br />
Foto: © Institut <strong>für</strong> Verkehrsforschung DLR<br />
Barbara Lenz,<br />
Institut <strong>für</strong><br />
Verkehrsforschung<br />
Dlr in Berlin:<br />
„Ich glaube nicht, dass teil- oder vollautomatisches<br />
Fahren die Mobilität völlig umkrempeln wird. Bis<br />
flächen deckend Roboter autos unterwegs sein werden,<br />
vergeht noch sehr viel Zeit. Die Möglichkeit des<br />
autonomen Fahrens bietet zunächst Bequemlichkeit<br />
und Komfort und wird vor allem dem öffentlichen<br />
Verkehr Konkurrenz machen. Der öffentliche Verkehr<br />
muss hier besondere Maßnahmen bieten, um attraktiv<br />
zu bleiben, vor allem bei den Schnittstellen, sprich<br />
Bequemlichkeit bei Anschluss- und Umsteigemöglichkeiten.<br />
Mit computergesteuerten Fahrzeugen könnte<br />
vor allem der Transport auf dem Land kostengünstiger<br />
abgewickelt werden.“<br />
Dass nun neue Verkehrskonzepte mit<br />
mehr Flächen <strong>für</strong> Fußgänger und<br />
Radfahrer zur Verfügung stehen, hat<br />
auch mit einer anderen Entwicklung,<br />
nämlich im Gesundheitsbereich zu<br />
tun: Versicherungsnehmer, die ihre<br />
Bewegungsdaten über Smart Clothes<br />
– also Kleidung, die durch verwebte<br />
Elektronik Daten erfassen kann – aufzeichnen<br />
und der Versicherung übermitteln,<br />
zahlen weniger Prämien. Seither<br />
verzichten immer mehr Menschen<br />
auf ihr eigenes Auto. Dieser Trend ist<br />
gerade in Städten spürbar, wo sukzessive<br />
die Fahrspuren enger, da<strong>für</strong><br />
Radfahr- und Gehwege breiter wurden.<br />
Dazu ein nostalgischer Rückblick,<br />
der zeigt, wie 2016 die „Macht“<br />
im Straßenverkehr aufgeteilt war: In<br />
New York nahmen zehn Prozent der<br />
Verkehrsteilnehmer – nämlich die<br />
nicht-autonomen Autos – 90 Prozent<br />
des Verkehrsraums in Anspruch.<br />
SeLBsTBesTIMMung<br />
IM ALTer durCH<br />
auTOnomes Fahren<br />
unterstüTZT<br />
Das Roboterauto hat nicht nur das<br />
Fahren selbst und das damit verbundene<br />
System des Straßenverkehrs<br />
verändert, es hat auch neue Geschäftsmodelle<br />
hervorgebracht und<br />
in letzter Zeit auch vermehrt Einfluss<br />
auf das soziale Leben genommen:<br />
In einer Gesellschaft mit hohem Anteil<br />
an älteren Menschen ist individuelle<br />
Mobilität keine Frage des Alters<br />
mehr, Selbstbestimmung hingegen<br />
gelebte Realität. Hatten ältere Menschen<br />
2016 das eigene Auto zu einem<br />
bestimmten Zeitpunkt abgegeben,<br />
so bietet ihnen das autonome<br />
Fahrzeug 2035 noch Unterstützung.<br />
Gewohnheiten müssen daher nicht<br />
umgestellt werden, die Lebensqualität<br />
bleibt erhalten. Oder sie sind Teil<br />
einer Carsharing-Gemeinschaft. Vor<br />
allem <strong>für</strong> jene älteren Menschen eine<br />
gute Option, die ähnlich wie jüngere<br />
Menschen oder wie auch Pendler nur<br />
wenige, aber immer dieselben Wegstrecken<br />
zu bewältigen haben. Sie<br />
mieten sich ein Auto, das von selbst<br />
kommt, sie abholt, sicher an ihr Ziel<br />
und wieder nach Hause bringt.<br />
Pendeln wird als<br />
AKTIVe ArbeITszeIT<br />
genuTZT<br />
2035 ist das Überholen auf der Landstraße<br />
<strong>für</strong> das selbstfahrende Fahrzeug<br />
endlich möglich. Ein Vorteil <strong>für</strong><br />
alle, die es eilig haben. Denn z. B. die<br />
tägliche Fahrzeit zum Arbeitsplatz, so<br />
nicht durch interaktives Arbeiten im<br />
Homeoffice obsolet geworden, ist<br />
gestiegen, weil in den letzten Jahrzehnten<br />
immer mehr Menschen ihre<br />
Wohnsitze auf das Land verlegt haben.<br />
In vielen Städten ist das Leben zu<br />
teuer geworden. Und während man<br />
am Arbeitsplatz ist, schickt man künftig<br />
möglicherweise sein selbstfahrendes<br />
Auto zum Geldverdienen auf die<br />
Reise. Entweder zum nächsten privaten<br />
Nutzer oder der Wagen gliedert<br />
sich von selbst in ein Zustellsystem<br />
ein, das Waren abholt und selbstständig<br />
ausliefert. Am Abend holt das<br />
Auto den Besitzer wieder ab und fährt<br />
ihn in sein Haus auf dem Land.<br />
Umweltgedanke<br />
bei der WAHL des<br />
VerkehrsMITTels<br />
MITunter<br />
aussCHLAGGebend<br />
Doch nicht <strong>für</strong> jeden Weg ist das<br />
autonome Fahrzeug Mittel der Wahl.<br />
Eine Umfrage aus dem Jahr 2030<br />
zeigt, dass die Verantwortung der<br />
Bürger <strong>für</strong> ihr Mobilitätsverhalten<br />
gestiegen ist. Sie lassen sich von<br />
Algorithmen berechnen, wie viel<br />
CO 2-Ausstoß sie <strong>für</strong> ihre Fahrt in<br />
Kauf nehmen wollen und machen<br />
die Wahl des Transportmittels davon<br />
abhängig. Ausgenommen sind Tage,<br />
an denen man aus der Hektik des Alltags<br />
entfliehen will. Rückzugsräume<br />
und Erholungspausen brauchen die<br />
Menschen 2035 genauso wie 2016.<br />
Sie finden diese nun auch im selbstfahrenden<br />
Auto. •<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
49
Gesund werden<br />
in einer<br />
zweiten Welt<br />
50<br />
Foto: © shutterstock
VIRtuelle Realitäten uND MasCHINen, die so intellIGent sIND,<br />
DAss sie den MensCHen individuelles FeeDBACK geben – diese<br />
KOMBInATIOn wird die Art und Weise verändern, wie ReHABILITATIOn<br />
sTATTfindet. Bis hin zu menTALem BewegungstrAIning, das bereITs in<br />
der IntensIVsTATIOn beGInnt. Von Ruth Reitmeier<br />
Beschreiben Experten die künftig<br />
denkbaren Möglichkeiten der virtuellen<br />
Rehabilitation, so erinnert dies<br />
ein wenig an James Camerons Fantasy-Film<br />
AVATAR, wo der von der<br />
Hüfte abwärts gelähmte US-Marine<br />
Jake Sully in einem künstlichen Körper,<br />
einem Avatar, den Planeten Pandora<br />
erkundet. Während Sullys echter<br />
Körper regungslos in einem Medizintechnik-Gerät<br />
liegt, turnt er im Avatar<br />
fit und kerngesund durch den Urwald.<br />
So oder ähnlich könnten in Zukunft<br />
nach einem Unfall traumatisierte Intensivpatienten<br />
verloren gegangene<br />
Bewegungsabläufe wieder erlernen.<br />
PATIenten müssen <strong>für</strong><br />
die PhysIOTHerAPIe<br />
nICHT mehr in die<br />
Praxis des<br />
TherAPeuten kommen<br />
Denn der Einsatz virtueller Realität,<br />
also in Echtzeit computergenerierte<br />
und interaktive virtuelle Umgebungen<br />
und Bilder, die Patienten über Bildschirme<br />
oder Datenbrillen erleben,<br />
kann die Therapie von psychologischen,<br />
neurologischen, physiologischen<br />
oder kognitiven Erkrankungen<br />
wesentlich unterstützen. Sie versetzt<br />
den Patienten in einen Dschungel, ein<br />
Raumschiff oder in einen Konzertsaal,<br />
um einige Beispiele zu nennen. Das<br />
erhöht nicht nur die Motivation und<br />
den Spaßfaktor, sondern ermöglicht,<br />
gezielt eingesetzt, auch sehr spezielle<br />
Lerneffekte sowohl in der Klinik und<br />
Praxis oder auch zu Hause, weit entfernt<br />
vom Therapeuten.<br />
EinsATZ virtueller<br />
MöglichkeITen<br />
ein grOsses<br />
ZukunftsTHeMA<br />
der Rehabilitation<br />
„Der Einsatz von Virtualität in der Rehabilitation<br />
ist ein noch junges und<br />
vorerst kleines Gebiet in der Physiotherapie,<br />
doch eines mit großem<br />
Potenzial“, sagt Birgit Happenhofer.<br />
Die Physiotherapeutin hat beim Grazer<br />
Unternehmen Tyromotion, das auf<br />
Computer- und Robotik-gestützte Rehabilitation<br />
spezialisiert ist, unter anderem<br />
in der Entwicklung virtueller<br />
Rehabilitationslösungen mitgearbeitet.<br />
Damit die Geräte von Therapeuten<br />
und Patienten angenommen werden,<br />
ist es wichtig, dass diese als User<br />
von Anfang an in die Entwicklung eingebunden<br />
werden.<br />
InDIVIDueLLes<br />
Feedback via<br />
Computer, fALLs<br />
eTWAs nICHT<br />
rund läuft<br />
Ganz wichtig ist, zusätzlich zur virtuellen<br />
Realität, dass Computer mittlerweile<br />
so intelligent sind, dass sie individuelles<br />
Feedback geben können:<br />
Patienten werden nicht nur in eine<br />
andere Welt entführt. Die Übungen<br />
des Patienten werden auch laufend<br />
verfolgt, analysiert und via Computerprogramm,<br />
wie durch einen echten<br />
Therapeuten, sofort korrigiert, falls<br />
etwas nicht stimmt.<br />
Um zu Hause effektive Reha-Übungen<br />
durchführen zu können, genügt<br />
<strong>für</strong> den Patienten mitunter schon ein<br />
kleines Endgerät wie ein Tablet. Der<br />
Patient wird wie in ein Spiel involviert<br />
und erhält zu bestimmten Übungen,<br />
zum Beispiel zur Handrehabilitation,<br />
laufend individuelle Rückmeldungen.<br />
ZU VIEL EHRGEIZ BEIM<br />
THerAPIE-TRAINING<br />
KAnn KONTRA-<br />
PRODUKTIV SEIN<br />
In der Praxis hat sich allerdings<br />
gezeigt, dass der Computer erst<br />
dann zum Üben eingesetzt werden<br />
sollte, wenn beim Patien ten der<br />
ideale motorische Ablauf sitzt, also<br />
der Bewegungsablauf automatisiert<br />
und verinnerlicht wurde. „Wie sich<br />
gezeigt hat, können Probleme entstehen,<br />
wenn die Patienten so<br />
hochmotiviert sind, dass sie beim<br />
ambitionierten Training auf gut automatisierte<br />
Bewegungsmuster zurückgreifen<br />
und die Übenden so in ihre<br />
pathologischen Bewegungen zurückfallen<br />
können“, betont Gödl-Purrer<br />
vom Institut <strong>für</strong> Physiotherapie an der<br />
Fachhochschule Joanneum in Graz.<br />
Je eifriger geübt wird, etwa das Werfen<br />
eines Balls, desto stärker kann<br />
die Kompensationsbewegung ausfallen<br />
– und der Computer erkennt<br />
natürlich längst nicht alle falschen<br />
Bewegungen.<br />
Doch es ist ein großer Vorteil, dass<br />
das virtuelle Erlebnis und der Trainingsplan<br />
an die individuellen Bedürfnisse<br />
des Patienten angepasst<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
51
Foto: © shutterstock<br />
Physikalische Therapie in einer virtuellen Welt: Der Computer gibt ständig individuelles Feedback an den Patienten.<br />
werden können. Beides kann zudem<br />
variiert werden. Virtuelle, computerunterstützte<br />
Rehabilitation kann somit<br />
abwechslungsreicher sein als das<br />
ewige Hin- und Herschieben eines<br />
Balls auf dem Tisch und beugt damit<br />
Therapiemüdigkeit vor. Steigerungen<br />
und Abwechslung sind das Um<br />
und Auf, um Patienten bei der Stange<br />
zu halten. Denn nach dem 30. Durchgang<br />
einer Trainingseinheit, die das<br />
Blumenpflücken simuliert, wird dies<br />
selbst kleinen Kindern zu langweilig.<br />
ComputerprOGrAMMe<br />
erMÖGLICHen es,<br />
KLeinste ErfOLGe<br />
DArzustellen<br />
Doch bereits ohne virtuelle Realität<br />
hat der Einsatz von reaktiven Computerprogrammen<br />
einen großen<br />
Mehrwert: Sie können selbst kleine<br />
Fortschritte der verbesserten Beweglichkeit<br />
erkennen und entsprechend<br />
loben und dadurch die Patienten<br />
motivieren, weiterzumachen.<br />
Happenhofer: „Es können auch nur drei<br />
Grad mehr Beweglichkeit dargestellt<br />
werden. Und das bedeutet vor allem<br />
eines: Motivation.“ Hinzu kommt:<br />
Patient und Therapeut sind künftig<br />
vernetzt, und dadurch kann der Physiotherapeut<br />
auch das Heimtraining im<br />
Auge behalten, ohne ständig dabei<br />
sein zu müssen – ein Fortschritt in der<br />
Rehabilitation im häuslichen Bereich.<br />
„Bisher haben die Patienten Übungstagebücher<br />
geführt. Das ist jedoch<br />
aufgrund sehr subjektiver Einschätzun-<br />
52
gen oft wenig aussagekräftig“, betont<br />
Barbara Gödl-Purrer.<br />
Fokus im deutsCHsprACHIGen<br />
Raum<br />
nOCH auf direktem<br />
KonTAKT zwisCHen Pa-<br />
TIent und TherAPeut<br />
Sie hat ihr Master-Studium an der<br />
Queen Margaret University in Edinburgh<br />
absolviert. In Schottland<br />
stünde man der Integration von virtueller<br />
Realität, neuen Geräten und<br />
Technologien in der Therapie deutlich<br />
positiver gegenüber als im deutschsprachigen<br />
Raum. In Österreich steht<br />
in der Ausbildung der taktile Kontakt<br />
zwischen Therapeuten und Patienten<br />
im Vordergrund. „Es ist noch eine<br />
Wegstrecke zurückzulegen, bis die<br />
Technik angenommen und in die Therapie<br />
integriert wird“, betont die Expertin.<br />
DIGITAL Natives <strong>für</strong><br />
neue TeCHnologien<br />
offen<br />
Auch in Österreich stellt freilich das<br />
Studium der Physiotherapie den Anspruch,<br />
am jeweils aktuellen Stand<br />
der Wissenschaft zu sein, technologieunterstützte<br />
Therapie ist folglich<br />
Teil des Curriculums, wenn auch kein<br />
Schwerpunkt. „Es kommt gerade einiges<br />
in Bewegung, zumal die neue<br />
Studentengeneration aus Digital Natives<br />
besteht und neuen Technologien<br />
ohne Vorbehalte gegenübersteht. Das<br />
ist <strong>für</strong> sie eine Selbstverständlichkeit“,<br />
sagt Gödl-Purrer.<br />
Maximale<br />
SelbststänDIGKeit<br />
ALs Ziel der<br />
PhysIOTHerAPIe<br />
Der eine will am Meer trainieren, die<br />
andere im Wald. Individualisierung ist<br />
auch in der Rehabilitation angekommen.<br />
Über Sensoren ist der Patient<br />
mit einem Bildschirm verbunden, auf<br />
dem Bewegungsübungen in einer attraktiven<br />
Umgebung simuliert werden.<br />
Etwa das Bergsteigen, weil es Patienten<br />
optimal motiviert.<br />
„Ziel der Physiotherapie ist es, den<br />
Patienten in die maximale Selbständigkeit<br />
zu führen“, sagt Gödl-Purrer.<br />
Die Physiotherapie stellt den<br />
Anspruch, Langzeiteffekte zu erzielen.<br />
Über den Einsatz von Virtualität<br />
kommt sie diesem Ziel messbar näher.<br />
Das bedeutet einen echten Qualitätssprung,<br />
zumal Verhaltensveränderungen<br />
in der Motorik besonders<br />
schwierig und langwierig sind. Basisbewegungen<br />
sind automatisiert, erfolgen<br />
spontan und lassen sich deshalb<br />
am schwersten verändern. Nur durch<br />
viel Übung und konkrete Umsetzung<br />
im Alltag kann dies gelingen. Am Beispiel<br />
eines Pianisten lässt sich dies<br />
veranschaulichen: Der Musiker hat<br />
beim Klavierspielen die Angewohnheit,<br />
die rechte Schulter hochzuziehen.<br />
Diese Eigenheit hat sich zu einem<br />
schmerzhaften Problem des<br />
Bewegungsapparats kumuliert. Mithilfe<br />
einer Datenbrille könnte er etwa<br />
das Spielen mit lockeren Schultern<br />
in der virtuellen Realität des Konzertsaals<br />
üben. Über die Verbindung mit<br />
dem Computerprogramm bekommt<br />
er solange ständiges Feedback über<br />
seine Bewegungsabläufe, bis er –<br />
motorisch quasi neu programmiert –<br />
in den echten Konzertsaal zurückkehrt.<br />
Virtuelle<br />
ReHABILITATIOn<br />
erMÖGLICHT sehr<br />
frühen<br />
TherAPIebeGInn<br />
Ein weiterer Vorteil des Einsatzes virtueller<br />
Realität in der Rehabilitation<br />
liegt zweifellos darin, dass bereits zu<br />
einem frühen Zeitpunkt, etwa nach einem<br />
Unfall, mit der Mobilisierung begonnen<br />
werden kann. Allein das Zeigen<br />
von Bildern weckt im Gehirn jene<br />
Assoziationen, die an Bewegung erinnern.<br />
Motorische Abläufe hinterlassen<br />
tiefe Spuren im Gehirn und können<br />
durch Bilder reanimiert werden. Sehen<br />
Menschen, die auf der Intensivstation<br />
nach einem Unfall traumatisiert<br />
liegen, vertraute Bewegungsabläufe<br />
z. B. über eine Datenbrille. So kann das<br />
Gehirn entsprechend stimuliert werden,<br />
um die Chancen der Patien ten zu erhöhen,<br />
schneller wieder auf die Beine zu<br />
kommen und bessere Therapieerfolge<br />
erzielen zu können. Dazu liefert auch<br />
die neurowissenschaftliche Forschung<br />
Ergebnisse: Das Gehirn von Hochleistungssportlern<br />
ist bei einer sportlichen<br />
Bewegung genauso aktiv wie der Körper.<br />
Sich den Bewegungsablauf ganz<br />
bewusst vorzustellen, ist entscheidend<br />
<strong>für</strong> den Erfolg. So wird das Training im<br />
Spitzensport künftig verstärkt mental<br />
erfolgen. Diese Erkenntnis ist umso<br />
wichtiger <strong>für</strong> verletzte Sportler, die ja<br />
oft über Wochen und Monate ausfallen.<br />
Wie erste Versuche zeigen, kann durch<br />
gezieltes mentales Training während<br />
der körperlichen Zwangspause vieles<br />
an Zeitverlust wettgemacht werden.<br />
Dies ist laut Neurowissenschaftern auf<br />
die Rehabilitation der Zukunft allgemein<br />
anwendbar. So gewöhnen sich etwa<br />
Menschen, denen eine Gliedmaße<br />
amputiert wurde, sehr viel schneller<br />
an eine Prothese, wenn sie sich den<br />
fremden Körperteil zunächst bewusst<br />
vorstellen.<br />
AuCH der<br />
Kostenfaktor<br />
<strong>für</strong> das<br />
GesundheITssystem<br />
sPIelt eine Rolle<br />
Es ist laut Experten denkbar, dass<br />
man in Zukunft Intensivpatienten<br />
zwecks Rehabilitation gar in virtuelle<br />
Welten schickt – ähnlich wie Jake<br />
Sully in AVATAR. Beschleunigt sich<br />
dadurch die Genesung, könnte neben<br />
dem medizinischen nicht zuletzt der<br />
wirtschaftliche Vorteil diese neuen<br />
Therapieformen vorantreiben. In der<br />
alternden Gesellschaft steigt der Bedarf<br />
an Rehabilitation. Um diesen zu<br />
finanzieren, wird eine Effizienzsteigerung<br />
des Therapiebetriebs notwendig<br />
werden. Virtuelle Welten und maschinelle<br />
Intelligenz könnten dazu jedenfalls<br />
beitragen. •<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
53
innovatives online & offline<br />
StART-UPs<br />
Spannende Ideen zum TheMA offen <strong>für</strong> neues<br />
Von Ancuta Barbu<br />
////// Programmieren & Robotik kinderleicht ///<br />
Wie können Kinder bestmöglich unterstützt werden, spielerisch Programmieren, Robotik<br />
und kreatives Denken zu erlernen – Fähigkeiten, die im 21. Jahrhundert von<br />
großer Bedeutung sind? Eine Antwort entwickelte das Start-up Robo Wunderkind:<br />
Bauklötze mit Sensoren und Kameras, die durch ein smartes Verbindungssystem zu<br />
einem modularen Roboter zusammengebaut werden können. Dieser kann umherfahren,<br />
einer Lichtquelle folgen oder selbst aufgenommene Geräusche wiedergeben.<br />
Die Programmierung und Bedienung des Roboters erfolgt visuell und ohne Programmcodes<br />
über die Robo App am Smartphone oder Tablet. Robo Wunderkind ist<br />
<strong>für</strong> Kinder ab fünf Jahren konzipiert. Das Start-up wurde über eine Kickstarterkampagne<br />
von Begeisterten aus 58 Ländern mit 246.000 US-Dollar unterstützt.<br />
www.startrobo.com<br />
////// Expertise-Datenbank ////////////////////////////<br />
Laut UNHCR leben Flüchtlinge im Durchschnitt 17 Jahre im Exil. Zu viel Zeit, in der<br />
wertvolle Potenziale ungenutzt bleiben. Die Österreicherin Julia Bachler wollte das<br />
ändern und gründete das Start-up Use Potential: Bei der Registrierung von Flüchtlingen<br />
in großen Camps sollen in einer Datenbank besondere Fähigkeiten (z. B. im<br />
Handwerk, in Sprachen oder in Medizin) erfasst werden. Im Bedarfsfall kann die jeweilige<br />
Person mit ihrer jeweiligen Fähigkeit die Arbeit im Camp unterstützen oder<br />
anderen Flüchtlingen helfen. Der zugrundeliegende Gedanke ist, dass die Flüchtlinge<br />
aus ihrer passiven Hilfsempfängerrolle geholt und unterstützt werden, eine aktive,<br />
ihre Umwelt mitgestaltende Rolle übernehmen zu können.<br />
http://socialimpactaward.at/project/use-potential<br />
////// Smarte Designer-cArports ///////////////////<br />
Eine modulare Autoüberdachung, die nach den eigenen Designvorstellungen selbst<br />
aufgebaut werden kann und die über Solarpanele das Elektroauto oder -fahrrad „betankt“:<br />
Iconic creative carport ist eine Unterstell-Konstruktion aus sehr leichtem Material<br />
<strong>für</strong> Autos. Die Photovoltaik-Dachmembran ermöglicht, Strom zu erzeugen und<br />
liefert so einen Beitrag zu einem energieautarken Leben. Das iconic creative carport<br />
besteht aus modularen Teilen und wird vom Kunden online konfiguriert. Die Idee entstand<br />
aus dem Bedürfnis, ein Carport zu schaffen, das modernes Design mit hohem<br />
Nutzen <strong>für</strong> den User verbindet.<br />
www.iconic-product.at<br />
////// lAnDSchaftSPläne mittels<br />
Drohnen-SoftWAre //////////////////////////////<br />
Detaillierte Pläne aus der Vogelperspektive mittels Foto-Drohnen und Spezialsoftware<br />
zu erstellen, das hat sich das Start-up Skycatch zur Aufgabe gemacht. Mittels<br />
Drohnen werden 2D- und 3D-Aufnahmen geschossen, die über die spezielle Software<br />
zu einem Plan zusammengesetzt werden und dem Kunden detailliert Auskunft<br />
über große geographische Areale geben. Die Idee dazu entstand, als der Gründer<br />
Christian Sanz während einer Vorführung seiner Drohnen von einem Bauingenieur<br />
angesprochen wurde, die „Flugshow“ zum Fotografieren seiner Baustelle zu nutzen.<br />
So konnte er den Baufortschritt aus der Luft beurteilen und potenziell kostspielige<br />
Fehler frühzeitig erkennen und vermeiden.<br />
www.skycatch.com<br />
54
DAS Kornfeld im Haus ///////////////////////////<br />
Landwirtschaft in Innenräumen zu ermöglichen ist die Idee von INFARM. Das Berliner<br />
Start-up möchte Stadtbewohner mit frischen lokalen Bioprodukten versorgen –<br />
egal zu welcher Jahreszeit. Um das Konzept bekannt zu machen, wurde nun die erste<br />
„in-store“ Landwirtschaft in Europa eröffnet: Ein kleiner Kräutergarten in einem Berliner<br />
Supermarkt. Er sieht aus wie ein Mini-Gewächshaus, in dem die Kunden Kräuter<br />
und Salat selbst ernten können.<br />
INFARM bietet auch Kurse und Workshops an, wie mittels Indoor-Landwirtschaft<br />
günstige und umweltfreundlich erzeugte Lebensmittel <strong>für</strong> alle Menschen bereitgestellt<br />
werden könnten. Die Idee dahinter ist es, ein Netzwerk aus Stadtbauern zu<br />
schaffen, die ihre eigenen Lebensmittel anbauen und diese je nach Bedarf mit den<br />
anderen Netzwerkmitgliedern tauschen.<br />
www.infarm.de<br />
////// untersuchung daheim statt beim Arzt ////<br />
Telemedizin wird in Zukunft eine größere Rolle spielen. Neue Technologien machen<br />
es möglich, dass Patienten ihre medizinischen Werte selbst erfassen und an ihren<br />
Arzt schicken. So bleiben ihnen zumindest <strong>für</strong> die Erstuntersuchung der Weg in die<br />
Arztpraxis und oftmals lange Wartezeiten erspart. Das US-amerikanische Unternehmen<br />
MedWand hat nun ein Gerät in der Größe einer elektrischen Zahnbürste entwickelt,<br />
das eine Reihe an Untersuchungen von zu Hause aus ermöglicht: Neben<br />
einem Pulsoximeter (zum Messen von Puls, Sauerstoffsättigung, etc.) integriert Med-<br />
Wand ein Ohrthermometer, ein digitales Stethoskop sowie eine kleine Kamera, mit<br />
der Ohren, Augen, Hals und Rachen inspiziert werden können. Über Bluetooth können<br />
weitere Geräte angeschlossen werden, etwa ein Blutzuckermessgerät oder ein<br />
Blutdruck-Monitor. Die medizinischen Daten können in eine elektronische Patientenakte<br />
überspielt werden, die der Arzt abrufen kann.<br />
www.medwand.com<br />
////// Übersetzer im Ohr ////////////////////////////////<br />
Eine Welt ohne Sprachbarrieren? In Zukunft können sich zwei Menschen miteinander<br />
unterhalten, ohne die Sprache des jeweils andern zu sprechen. Die Idee des<br />
US-Amerikaners Andrew Ochoa ist ein kleines Hörgerät, das neueste Technologien<br />
aus den Bereichen Spracherkennung und maschinengesteuerte Übersetzung<br />
vereint. Wenn eine Person spricht, hört die andere Person die Konversation in ihrer<br />
Muttersprache. Der Einfall dazu kam dem Gründer, als er eine französische Frau kennenlernte,<br />
die nicht Englisch sprach. Ab Mai 2017 sollen die Ohrstöpsel inklusive<br />
Übersetzungs-App <strong>für</strong> die Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch<br />
und Portugiesisch erhältlich sein.<br />
www.waverlylabs.com<br />
////// Freundin <strong>für</strong> den Urlaub ///////////////////////<br />
Individualreisen sind beliebt. Auch bei Frauen, die immer öfter alleine unterwegs<br />
sind. Um diese dabei zu unterstützen, unabhängig, frei und sicher zu reisen, gründete<br />
die Österreicherin Marisa Mühlböck das Start-up „Sue met Lin“. Dabei handelt<br />
es sich um eine Social Travel Plattform, die eine einfache Vernetzung zwischen<br />
weiblichen Reisenden ermöglicht. Auch weibliche Locals können die Plattform nutzen.<br />
Nachdem man sich eingeloggt hat, zeigt die App an, welche Userin sich noch<br />
in der Nähe befindet. Die Idee zum Netzwerk hatte Marisa Mühlböck, als sie selbst<br />
auf Urlaub war. Sie wollte sich mit einer „Freundin auf Zeit“ sicherer fühlen, wenn<br />
sie abends ausging, die Kosten <strong>für</strong> einen Mietwagen teilen oder sich einfach mit einer<br />
Gleichgesinnten über Erlebnisse austauschen. Die Plattform soll im Herbst 2016<br />
online gehen.<br />
www.suemetlin.com<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
55
Die Kleidung<br />
denkt mit<br />
Körpertemperaturmessung<br />
Anspannungssensor<br />
GPS<br />
UV-Einwirkungswarnsystem<br />
Emotionskontrolle<br />
Herzinfarkt-<br />
Warnsystem<br />
Herzrhythmuscheck<br />
Gewichtskontrolle<br />
Hautchecksensoren<br />
Verdauungskontrolle<br />
Schrittzähler<br />
Luftzirkulatoren<br />
Massagefunktion<br />
Hautfettmesser<br />
Venenkontrolle<br />
Schweißfußwarnsystem<br />
Foto: © shutterstock; Illustration: Barbara Wais<br />
56<br />
Stossdämpferfunktion
KleIDuNG wIRD dank HIGHteCH immer klüger:<br />
Sensoren in T-sHIrts, Hosen oder Socken liefern DER PersON,<br />
DIE SIE TräGT, DATen UND KÖnnen SIE WArnen. AuCH vor einer<br />
GeWICHTszunAHMe. Von Armin Winter<br />
Erst kürzlich stellte Samsung einen<br />
Gürtel vor, der nicht nur Schritte<br />
zählt, sondern den Träger frühzeitig<br />
informiert, wenn er an Gewicht zuoder<br />
abnimmt. Der Gürtel-Prototyp<br />
„Welt“ ist smart und kann eine kurzfristige<br />
Zunahme des Taillenumfangs<br />
während des Essens von einer dauerhaften<br />
Zunahme unterscheiden. Die<br />
Technologie ist in der Schnalle eingebaut.<br />
Die Messdaten werden per App<br />
auf das Smartphone geliefert.<br />
TrAGBAre Systeme<br />
BALD mit KleIDung<br />
verWOBen<br />
Smart Clothes – intelligente, mit<br />
Sensoren versehene, internetfähige<br />
Textilien – sind auf dem Vormarsch.<br />
Durch die technologische Entwicklung<br />
werden die elektronischen<br />
Messteilchen, die in die Kleiderfasern<br />
eingearbeitet sind, immer kleiner.<br />
Damit können künftig bisher relativ<br />
große tragbare Computersysteme<br />
wie Schrittzähler, Pulsmesser und<br />
Smartwatches direkt in intelligente<br />
Stoffe integriert werden.<br />
Von der<br />
fITnessindustrie<br />
in die MeDIZIn und<br />
Arbeitswelt<br />
„Tatsächlich sind im Moment<br />
Freizeit und Fitness die größten<br />
Märkte <strong>für</strong> Smart Clothes“, sagt<br />
Antonio Krüger, Professor am<br />
Deutschen Forschungszentrum <strong>für</strong><br />
Künstliche Intelligenz (DFKI) in<br />
Saarbrücken. Konsumenten legen<br />
hier schon lange besonderen Wert<br />
auf die Erfassung und Überprüfung<br />
von körperlichen Messdaten. Sportliche<br />
Erfolge werden damit auf Knopfdruck<br />
sichtbar, was nicht nur zu zusätzlicher<br />
Motivation führt, sondern<br />
wodurch auch der Trainingsplan optimiert<br />
werden kann.<br />
Schon morgen könnten Smart Clothes<br />
auch im Leistungssport eine<br />
große Rolle spielen. Ein Schweizer<br />
Unternehmen zeigte kürzlich auf der<br />
CeBIT, der größten Messe <strong>für</strong> Informationstechnik<br />
in Hannover, ein intelligentes<br />
„Leiberl“ <strong>für</strong> Fußballer, das<br />
Teil eines Monitoring-Systems ist.<br />
Sensoren in dem Shirt messen unter<br />
anderem Bewegungsintensität<br />
oder Atemfrequenz des Spielers. Die<br />
Daten geben Aufschluss über die<br />
körperliche Verfassung des Fußballers,<br />
wie viel er gelaufen ist, wie<br />
viele Pässe er angenommen hat und<br />
wie fit er im Match noch ist. Auf Basis<br />
dessen kann der Trainer während<br />
des Spiels entscheiden, ob und wie<br />
er den Spieler weiter einsetzt. Aber<br />
auch nach dem Spiel sind die Daten<br />
interessant: Eine eigene Software erfasst<br />
und analysiert die Messwerte<br />
<strong>für</strong> das gesamte Betreuerteam inklusive<br />
Arzt und Therapeuten. So können<br />
umfassende Trainings- und Therapiekonzepte<br />
anhand von realen<br />
Situationen erstellt werden.<br />
ArbeITsanzug<br />
sIGnALIsiert fALsCHe<br />
BewegungsABLäufe<br />
Smart Clothes sind auch in der modernen<br />
Arbeitswelt ein Thema, obwohl<br />
man derzeit nicht davon ausgehen<br />
dürfe, dass diese schon ein<br />
Breitenphänomen seien, wie Professor<br />
Krüger betont. An seinem Forschungszentrum<br />
wird auch ein Blaumann<br />
entwickelt, ein Arbeitsanzug,<br />
der den Träger oder die Trägerin bei<br />
unergonomischen Bewegungen über<br />
Vibration alarmiert und so hilft, körperliche<br />
Schäden durch falsche Bewegungsmuster<br />
zu vermeiden. Die<br />
in den Anzug eingearbeiteten Sensoren<br />
zeichnen die Bewegungen auf<br />
und alarmieren nicht nur im Akutfall,<br />
sondern lassen vor allem eine umfassende<br />
Analyse durch einen Arzt oder<br />
Therapeuten zu. Dieser kann auf Basis<br />
der ausgelesenen Daten ein ergonomisches<br />
Bewegungskonzept<br />
zusammen mit dem Betroffenen erstellen.<br />
Warnung vor<br />
HerzinfarKT nOCH<br />
ZukunftsmusIK<br />
Wo der Forscher Smart Clothes in<br />
Zukunft sieht? „Noch eine Vision ist<br />
der umfassende Gesundheitsassistent,<br />
der die Arterienqualität beurteilen<br />
und vor Herzinfarkten warnen<br />
kann.“ Erste Schritte in diese Richtung<br />
machte das Fraunhofer-Institut<br />
<strong>für</strong> Silicatforschung ISC in Würzburg.<br />
Es entwickelte eine Socke <strong>für</strong> Diabetiker.<br />
Der Messstrumpf warnt die Patienten<br />
vor zu hoher Druckbelastung<br />
auf den Fuß. Der Hintergrund: Diabeteskranke<br />
verlieren oft das Empfinden<br />
in ihren Füßen und erkennen<br />
nicht, wann es durch Überbelastung<br />
zu Druckstellen und Wunden kommt.<br />
Unbehandelt kann dies zu Geschwüren<br />
und schlimmstenfalls zur Amputation<br />
von Fuß oder Zehen führen. In<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
57
den Strumpf sind Sensoren integriert,<br />
die den Druck und die Belastung an<br />
Sohle, Ferse, Rist und Knöchel messen.<br />
Überschreiten die Werte eine bestimmte<br />
Grenze, werden Trägerinnen<br />
oder Träger aufmerksam gemacht, die<br />
Fußposition und Belastung zu ändern.<br />
Die Signale werden dreidimensional<br />
aufgezeichnet. Die Messdaten kommen<br />
per Funk auf das Smartphone<br />
oder das Tablet.<br />
Smart Clothes könnten in Zukunft<br />
aber auch über die reine Datenvermessung<br />
hinaus gehen. Zum Beispiel,<br />
wenn sich die Farbe von Kleidung<br />
oder Accessoirs auf Knopfdruck<br />
ändern lässt. Was <strong>für</strong> den Privatgebrauch<br />
eher ein Gag ist, spielt <strong>für</strong><br />
die Anwendung beim Militär eine<br />
ernstere Rolle: Die Anpassung an<br />
die Farbe der Umwelt vollautomatisch<br />
oder auf Befehl kann im Einsatz ein<br />
wesentlicher Vorteil sein. •<br />
Foto: © DFKI<br />
Smart Clothes können den Menschen im<br />
Alltag, in der Mobilität und im Freizeitsport<br />
unterstützen, schützen und warnen.<br />
Antonio Krüger, Professor am Deutschen<br />
Forschungszentrum <strong>für</strong> Künstliche Intelligenz (DFKI),<br />
im Kurzinterview.<br />
querspur: Besteht aus Ihrer Sicht<br />
die Gefahr, dass wir uns zu sehr auf<br />
die technologische Unterstützung,<br />
die wir vielleicht bald an uns tragen,<br />
verlassen? Könnte das auf Kosten der<br />
Fähigkeit zur Gefahreneinschätzung,<br />
der Aufmerksamkeit oder der Erinnerung<br />
gehen?<br />
Antonio Krüger: Selbstverständlich<br />
führt die technologische Entwicklung<br />
zu einem gewissen Grad<br />
an Abhängigkeit. Schon Navigationssysteme<br />
haben nachweislich dazu geführt,<br />
dass sich die Leute schlechter<br />
in fremden Umgebungen zurechtfinden.<br />
Ähnliche Effekte kann man<br />
auch von tragbarer Technologie im<br />
Allgemeinen erwarten. Allerdings bin<br />
ich zuversichtlich, dass der Mensch<br />
als Kulturwesen sich den neuen<br />
Technologien kreativ annehmen<br />
wird, so wie das Internet natürlich<br />
Einfluss auf Aufmerksamkeitsspanne<br />
oder motorische Fähigkeiten (Handschreiben)<br />
genommen hat, aber<br />
auf der anderen Seite neue Wissenskulturen<br />
entstanden sind. Um etwa<br />
Wikipedia und Youtube zu nennen.<br />
querspur: Gibt es schon Smart<br />
Clothes, die speziell <strong>für</strong> den Bereich<br />
Mobilität und Verkehr entwickelt<br />
wurden?<br />
Krüger: Es gibt eine Reihe von<br />
Lösungen, um die Sichtbarkeit von<br />
Verkehrsteilnehmern zu erhöhen,<br />
wie zum Beispiel intelligente Westen,<br />
die Blinken sobald ein Radfahrer<br />
bremst oder abbiegen möchte.<br />
querspur: Was kann man Kritikern<br />
entgegen, die sich angesichts der<br />
Datenmengen Sorgen wegen des<br />
Daten schutzes machen? Wie groß ist<br />
die Begehrlichkeit von Arbeitgebern,<br />
Krankenkassen, Unfallversicherungen,<br />
an noch mehr Datenmaterial heranzukommen?<br />
Krüger: Diese Sorgen sollte man<br />
ernst nehmen. Hier sehe ich Handlungsbedarf<br />
in der Politik. Das Recht<br />
an den eigenen Daten darf nicht nur<br />
theoretisch existieren, sondern muss<br />
vom Einzelnen auch gegenüber internationalen<br />
Konzernen durchgesetzt<br />
werden können. Auf der anderen<br />
Seite wird die Analyse großer Datenmengen<br />
dem Einzelnen riesige Vorteile<br />
bringen. Der Einzelne, der von<br />
einem Analyseprogramm vor dem<br />
Herztod gerettet wurde, sorgt sich<br />
nicht in erster Linie um den Datenschutz.<br />
•<br />
58
ZeiCHen der Zeit<br />
Fortschrittseuphorie gab es nicht in jedem Zeitalter. In der Antike hatte Cicero seinen Gegnern „Te innovasti!“<br />
zugerufen und damit gemeint, dass sie sich dem Neuen hingegeben hätten und vom guten Alten abgekehrt wären.<br />
Erst in der Renaissance (ab dem 15. Jhdt.) wurde die menschliche Neugier als Motor des Neuen, der Innovation,<br />
wieder als Tugend anerkannt und verlor den Stempel des Lasters. Viele wichtige Erfindungen sind seither entstanden.<br />
Von Silvia Wasserbacher-Schwarzer<br />
daten & FAKTEN<br />
Ob jeder Innovation, die heute nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken ist, ein systematisch angelegter Erkenntnisweg<br />
vorausgegangen ist, ist ungewiss. Auf jeden Fall sind einige Ideen schon sehr alt. 1<br />
3650 v. Chr. 1590 1655 1810 1834 1863<br />
Innovations-Hub EU Mehr Bürokratie, keine Kultur des Scheiterns, weniger Zugang zu Risikokapital –<br />
europäische Städte galten lange Zeit nicht als Eldorado <strong>für</strong> Gründer. Boyd Cohen, Professor <strong>für</strong> Entrepreneurship,<br />
Nachhaltigkeit und Smart Cities an der Universität del Desarrollo in Santiago, Chile, führt einige klare Gründe<br />
an, warum EU-Städte bald US-amerikanische Städte als Hubs <strong>für</strong> Innovation überholen könnten.<br />
Bessere<br />
Lebensqualität & bessere<br />
soziale Absicherung:<br />
Sieben der zehn Städte mit der<br />
besten Lebensqualität<br />
(Mercer Ranking) sind EU-Städte.<br />
Erst auf Platz 28 findet sich eine<br />
us-amerikanische Stadt: San Francisco.<br />
Auch die soziale Absicherung ist in der<br />
eu besser. Beruflich zu scheitern hat<br />
z. B. nicht den Verlust der<br />
Kranken versicherung<br />
zur Folge.<br />
Europäische<br />
Smart Cities:<br />
Smart Cities sind attraktiv <strong>für</strong><br />
Start-ups, weil gerade in solchen<br />
Städten neue Ideen, Konzepte<br />
und Technologien gebraucht werden.<br />
In der EU steht die Entwicklung und<br />
Förderung von Smart Cities seit vielen<br />
Jahren auf der Agenda. In den USA<br />
wurde das Konzept von<br />
Präsident Obama erst 2015<br />
durch den Zuspruch eines<br />
eigenen Budgets ($ 160 Mio)<br />
offiziell unterstützt.<br />
Mehr<br />
spezifische Infrastruktur<br />
<strong>für</strong> Entrepreneure:<br />
Um Privatpersonen zu ermöglichen,<br />
ihre innovativen Ideen umzusetzen,<br />
wurden in den USA sog. Fab Labs (Fabrication<br />
Laboratory) eingeführt. Dort steht die nötige<br />
Infrastruktur bereit: Von der Fräsmaschine bis<br />
zum 3D-Drucker, alles, was zum Erzeugen eines<br />
Pototypen gebraucht wird. In den USA gibt es<br />
115 Fab Labs, in der EU 300.<br />
Auch Coworking Spaces sind in der EU in der<br />
Überzahl. Barcelona etwa hat 300. In der<br />
us-Stadt Philadelphia, die eine ähnliche<br />
Einwohnerzahl wie Barcelona<br />
aufweist, sind es nur ca. 12.<br />
Quellen: 1 GEO Magazin, Ranking der 100 wichtigsten Erfindungen der Menschheit<br />
In unserem digitalen Zeitalter, in dem Wissen weit verteilt ist, kann Innovation nicht mehr im abgekapselten Raum<br />
entstehen. Um besser und schneller innovieren zu können, müssen sich Organisationen öffnen.<br />
Drei große Marken, die Crowdsourcing nutzen.<br />
Der Getränke-Riese<br />
Coca Cola wollte seine<br />
Kunden besser verstehen<br />
und befragte die<br />
Crowd in Singapur,<br />
was sie unter dem<br />
Claim „It’s possible“<br />
(dt. „Es ist möglich“)<br />
verstehen.<br />
Das IT- und<br />
Beratungsunternehmen<br />
IBM betreibt seine eigene<br />
Crowdsourcing-Seite,<br />
auf der regelmäßig<br />
Challenges abgehalten<br />
werden:<br />
collaborationjam.com<br />
<strong>Offen</strong> <strong>für</strong> <strong>Neues</strong><br />
Das Wissen der<br />
Masse nutzt auch der<br />
Google Translator – ein<br />
Online-Sprachübersetzungstool.<br />
Findet der Nutzer, dass die<br />
Übersetzung nicht gut ist, kann er<br />
Verbesserungs vorschläge<br />
in einer eigens da<strong>für</strong> vorgesehenen<br />
Box vermerken. Die<br />
Qualität von Google Translator<br />
wird so kontinuierlich<br />
verbessert.<br />
59
Querspur Das Zukunftsmagazin des ÖAMTC<br />
Tierische Schwärme<br />
Tiere bilden Schwärme, um sich einen<br />
Vorteil bei der Futtersuche zu verschaffen oder<br />
um sich besser vor den jeweiligen Feinden<br />
schützen zu können.<br />
1986 fand der Computerexperte Craig Reynolds<br />
heraus, dass drei simple Regeln das Bilden und<br />
Funktionieren eines Schwarmes ausmachen:<br />
1. Bewege dich in Richtung des Mittelpunkts derer,<br />
die du in deinem Umfeld siehst.<br />
2. Bewege dich weg, sobald dir<br />
jemand zu nahe kommt.<br />
3. Bewege dich in etwa in<br />
dieselbe Richtung wie<br />
deine Nachbarn.<br />
60