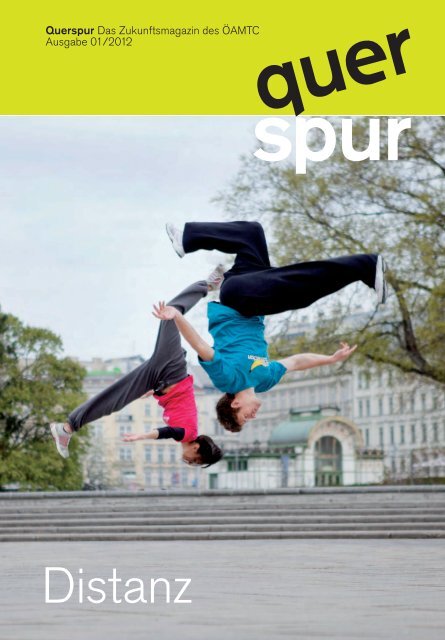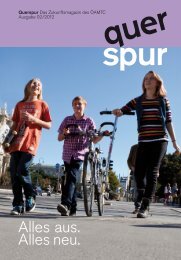Distanz
Querspur: Das Zukunftsmagazin des ÖAMTC Ausgabe 01/2012
Querspur: Das Zukunftsmagazin des ÖAMTC
Ausgabe 01/2012
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Querspur Das Zukunftsmagazin des ÖAMTC<br />
Ausgabe 01/2012<br />
<strong>Distanz</strong><br />
<strong>Distanz</strong><br />
1
DISTANZ<br />
WIE VIEL BRAUCHEN WIR? WIE VIEL ERTRAGEN WIR?<br />
<strong>Distanz</strong><br />
(von lat.: distare –<br />
abstehen, entfernt sein):<br />
1.<br />
räumlicher, zeitlicher<br />
oder innerer Abstand<br />
2.<br />
zurückzulegende Strecke, Gesamtzeit<br />
der angesetzten Runden (Sport)<br />
3.<br />
Reserviertheit, abwartende<br />
Zurückhaltung<br />
300 km/h<br />
Der Deutsche<br />
Alexander Neumeister zählt zu den<br />
renommiertesten Industriedesignern weltweit.<br />
Neben dem Transrapid und dem ICE<br />
zählt der japanische Shinkansen 500 Nozomi<br />
(dt.: „die Hoffnung“) zu seinen bekanntesten<br />
Entwürfen. Dieser Hochgeschwindigkeitszug<br />
erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von<br />
300 km/h. 64 Fahrmotoren übernehmen<br />
den Antrieb. Aktuell verkehrt der Nozomi,<br />
der für 1324 Sitze ausgelegt ist, zwischen<br />
Tokio und dem im Süden Japans<br />
liegenden Hakata. Für die<br />
1069 Kilometer braucht er<br />
vier Stunden<br />
und 49 Minuten.<br />
Mobilität<br />
(von lat.: mobilitas – Beweglichkeit)<br />
bezeichnet die Eigenschaft, bewegt<br />
werden zu können, also passive<br />
Bewegungsfähigkeit. Die Fähigkeit,<br />
sich aktiv zu bewegen, heißt hingegen Motilität.<br />
Das Gegenteil von aktiver Bewegungsfähigkeit<br />
ist Sessilität: Sessile Tiere sitzen an<br />
ihrem Aufenthaltsort fest, zum Beispiel<br />
Korallen und Schwämme. Auch<br />
manche Parasiten werden, sobald sie<br />
einen Wirt gefunden haben,<br />
sessil, etwa die Walläuse<br />
auf der Haut von<br />
Walen.<br />
Fahrerloses Auto<br />
Unabhängigkeit<br />
„Wenn ich unterwegs bin,<br />
achte ich im Allgemeinen besonders<br />
darauf, dass ich selbst bestimmen<br />
kann, mit wem ich unterwegs bin.“<br />
Die Mobilitätsstudie 2011 des<br />
ÖAMTC zeigt, dass 83% der<br />
österreichischen Bevölkerung<br />
folgender Aussage „voll und<br />
ganz zustimmen“ und<br />
„zustimmen“.<br />
Ultralangstrecke<br />
Manche Vogelarten können es<br />
mit Langstreckenflugzeugen locker<br />
aufnehmen: Die Pfuhlschnepfe kann<br />
nonstop von Alaska nach<br />
Neuseeland fliegen – 11.500 Kilometer.<br />
Zum Vergleich: Der zurzeit längste<br />
Linienflug mit 16.600 Kilometern<br />
findet zwischen Singapur<br />
und New York<br />
statt.<br />
Mit 1. März 2012 hat Nevada als erster<br />
US-Bundesstaat selbstfahrende Autos<br />
auf seinen Straßen erlaubt und diese<br />
folgendermaßen definiert:<br />
Autonomous vehicle means a motor vehicle that<br />
uses artificial intelligence, sensors and global<br />
positioning system coordinates to drive itself without<br />
the active intervention of a human operator.“<br />
Unter einem „selbstfahrenden Auto“ wird ein<br />
motorisiertes Fahrzeug verstanden, das<br />
künstliche Intelligenz, Sensoren und<br />
GPS-Koordinaten nutzt, um<br />
selbstständig und ohne aktiven<br />
menschlichen Eingriff<br />
zu fahren.<br />
Impressum und Offenlegung<br />
Nichtpendler<br />
27% der Erwerbsbevölkerung<br />
in Österreich werden als Nichtpendler<br />
bezeichnet. Sie wohnen und arbeiten<br />
entweder im gleichen Haus oder auf<br />
dem gleichen Grundstück. Oder sie<br />
arbeiten auf einem anderen Grundstück<br />
in der gleichen Wohngemeinde.<br />
„Binnenpendler“, zum Beispiel<br />
zwischen verschiedenen<br />
Stadtteilen, zählen ebenso<br />
zu den Nichtpendlern.<br />
Pendler<br />
Sonderform der Wanderung,<br />
die nicht mit einer Verlegung des<br />
Wohnorts verbunden ist.<br />
In Österreich pendeln 63 % der<br />
Erwerbsbevölkerung – 1% pendelt<br />
ins Ausland, 14% pendeln zw.<br />
Bundesländern, 23% pendeln<br />
zw. politischen Bezirken des<br />
Bundeslandes, 25% pendeln<br />
zw. Gemeinden eines<br />
politischen Bezirks.<br />
Medieninhaber und Herausgeber<br />
Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC)<br />
Schubertring 1-3, 1010 Wien, Telefon: +43 (0)1 711 99 0<br />
www.oeamtc.at<br />
ZVR-Zahl: 730335108, UID-Nr.: ATU 36821301<br />
Vereinszweck ist insbesondere die Förderung der Mobilität unter<br />
Bedachtnahme auf die Wahrung der Interessen der Mitglieder.<br />
Der ÖAMTC wird vertreten durch den Präsidenten Dkfm. Werner Kraus<br />
und den Generalsekretär DI Oliver Schmerold.<br />
Konzept und Gesamtkoordination winnovation consulting gmbh<br />
Chefredaktion Mag. Gabriele Gerhardter (ÖAMTC),<br />
Dr. Gertraud Leimüller (winnovation consulting)<br />
Chefin vom Dienst Silvia Wasserbacher, BA<br />
MitarbeiterInnen dieser Ausgabe<br />
Dipl.-Bw. Maren Baaz, Mag. Eva Hübner, Mag. (FH) Christian Huter,<br />
Mag. Claudia Kesche, Nicole Kolisch, Bakk., Mag. Konstantin Kouloukakos,<br />
Leo Ludwig, Mag. Uwe Mauch, Dr. Daniela Müller, Dr. Ruth Reitmeier,<br />
Katrin Stehrer, BSc, DI Anna Várdai<br />
Grafik Design, Illustrationen Drahtzieher Design & Kommunikation<br />
Korrektorat Christina Preiner, vice-verba<br />
Fotografie Lukas Ilgner, Christoph Wisser<br />
Covermodels apeconnection.com (Michael Mölschl, Pamela Obiniana)<br />
Druck Hartpress<br />
Download www.querspur.at<br />
Blattlinie Querspur ist das zweimal jährlich erscheinende Zukunftsmagazin des ÖAMTC.
4<br />
7<br />
15<br />
20<br />
26<br />
27<br />
28<br />
Heute<br />
Allein in der Masse.<br />
Abstand ist in den öffentlichen<br />
Verkehrsmittel essentiell –<br />
von Daniela Müller<br />
Mobilitätstypen.<br />
Wer bewegt sich wie und warum?<br />
Wie bewegen wir uns?<br />
Womit sind wir unterwegs und wie<br />
lange brauchen wir?<br />
Homo Mobilis. Wir reisen<br />
schneller, weiter, effizienter als je<br />
zuvor. Ungeklärt bleibt die Frage: Zur<br />
Last oder Lust? – von Nicole Kolisch<br />
Tierische Rekorde.<br />
Wer bewegt sich wie und warum?<br />
Die Vermessung der Welt.<br />
Warum beim Warten auf die<br />
Straßenbahn aus vier plötzlich<br />
sechs Minuten werden können –<br />
von Nicole Kolisch<br />
Wegemuster durch die Stadt.<br />
Sichtbare Strecken zeigen unterschiedliche<br />
Nutzungsprofile –<br />
von Ruth Reitmeier<br />
20<br />
12<br />
8<br />
12<br />
Zukunft<br />
Auto mit Hirn. In den Autos der<br />
Zukunft darf der Lenker schlafen,<br />
nachdenken und arbeiten –<br />
von Leo Ludwig<br />
Die Aufholjagd der U-Bahnen.<br />
Alexander Neumeister entwirft Züge<br />
und U-Bahnen mit viel Raumgefühl –<br />
von Ruth Reitmeier<br />
16<br />
16<br />
18<br />
24<br />
Per Faltrad in die Zukunft.<br />
Uwe Mauch pendelt (ohne Auto)<br />
zwischen Wien und Zagreb –<br />
eine Reportage<br />
Startups. Spannende Ideen<br />
zum Thema <strong>Distanz</strong> und intermodale<br />
Mobilität – von Katrin Stehrer<br />
Autostoppen 3.0.<br />
Mitfahrbörsen werden intelligent –<br />
von Daniela Müller<br />
18<br />
<strong>Distanz</strong><br />
3
4<br />
Foto: Wikipedia, Daniel Schwen
Allein in<br />
der Masse<br />
ABSTAND IST IN ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN ESSENTIELL.<br />
DIE KÜNFTIGE HERAUSFORDERUNG HEISST, INDIVIDUELLES REISEN<br />
IN DER MASSE ZU ERMÖGLICHEN.<br />
Von Daniela Müller<br />
Nicht jeder Kenianer ist ein guter Läufer.<br />
Aber viele. Mobilität in Afrika bedeutet Körpereinsatz,<br />
vor allem, wenn Eltern kein Geld<br />
für den Schulbus haben und der Schulweg<br />
zehn Kilometer und mehr beträgt. Gehen oder<br />
Laufen ist Notwendigkeit zum Überleben. Für<br />
die kenianischen Marathonläufer in zweifacher<br />
Hinsicht: Die Gewinnprämien sichern<br />
ihnen und ihren Familien ein gutes Leben.<br />
Das wirtschaftliche Überleben zwingt auch<br />
viele Wanderarbeiter in China und Millionen<br />
Menschen in Indien zu langen Pendelstrecken,<br />
meist mit dem Zug, „Holzklasse“ mit Fenstern<br />
ohne Glasscheiben. Die Pendler sitzen nicht<br />
selten bis zu 40 Stunden im Zug, um der Arbeit<br />
nachzufahren, die in den Metropolen<br />
Chinas oder Indiens auf sie wartet. Was für<br />
den mitreisenden Touristen anstrengend ist,<br />
wird für so manchen kontaktfreudigen Inder<br />
zur Netzwerkveranstaltung. Während sich<br />
die obere Gesellschaftsschicht in die 1. Klasse<br />
zurückzieht, wird in der „Holzklasse“ geplaudert,<br />
getratscht und nach der Reise sind für<br />
Manche neue Bekannte oder potenzielle<br />
Geschäftspartner gefunden.<br />
„Beweglichkeit war schon immer die Haupttriebkraft<br />
von Menschen“, erklärt Andreas Knie,<br />
Soziologe und Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum<br />
Berlin und der TU Berlin. Seit<br />
den 1960-er Jahren habe sich in Deutschland<br />
die Pendelleistung verdoppelt und nehmen<br />
weiterhin leicht zu, wenn sich auch mit der<br />
Tele arbeit eine leichte Gegentendenz zeige. Die<br />
Zumutbarkeit sieht Knie bei einer Stunde pro<br />
Strecke erreicht: Bei längeren Strecken würden<br />
psychische und Herzkreislauferkrankungen<br />
steigen, beobachtbar seien zudem stärkere<br />
Zerrüttungstendenzen in den Familien.<br />
BEI WENIGER ALS 64 ZENTI-<br />
METERN ABSTAND SCHLÄGT<br />
DAS MENSCHLICHE GEHIRN<br />
ALARM<br />
Doch Kontakte suchen beim Pendeln die wenigsten.<br />
Untersuchungen haben gezeigt, dass<br />
in den meisten Kulturen soziale Kontakte in<br />
öffentlichen Verkehrsmitteln vermieden werden.<br />
Im California Institute of Technology hat<br />
man herausgefunden, dass bei weniger als 64<br />
Zentimetern Abstand zwischen Menschen das<br />
Areal im Gehirn, das für Wut und Angst zuständig<br />
ist, Alarm schlägt. In den asiatischen<br />
Ländern lassen die Menschen trotzdem mehr<br />
räumliche Nähe zu. Auch weil ihnen in Anbetracht<br />
der oft restlos überfüllten Züge und<br />
Busse nichts anderes übrig bleibt. Da kommt es<br />
schon vor, dass, am Haltegriff festgeklammert,<br />
die Fahrzeit für Powernapping, den leistungssteigernden<br />
Kurzschlaf, genutzt wird.<br />
„Diejenigen, die routinemäßig in öffentlichen<br />
Verkehrsmitteln unterwegs sind, individua-<br />
<strong>Distanz</strong><br />
5
Foto: erysipel/pixelio<br />
Smartphone vor Auto.<br />
Die intensivsten Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln<br />
sind junge Menschen. Für sieben von zehn<br />
sind Bus, Bahn, Straßen- oder U-Bahn unverzichtbar<br />
geworden. In Deutschland besitzen laut einer<br />
Timescout-Untersuchung drei Viertel der 20- bis<br />
29-jährigen Deutschen zwar einen Führerschein,<br />
die Hälfte davon fährt jedoch kaum Auto.<br />
Smartphone und MP3 Player haben in dieser Gruppe<br />
einen höheren Stellenwert als die eigenen vier Räder.<br />
lisieren ihre Fahrtstrecke. Entweder sie lesen<br />
oder sie verstöpseln sich. Das ist mit graduellen<br />
Unterschieden auf der ganzen Welt so“, erklärt<br />
Mobilitätsforscher Knie. Obwohl es in Pariser<br />
Vorortezügen erfolgreiche Versuche gab, in<br />
einzelnen Abteilen Weiterbildungsprogramme<br />
oder Sprachkurse abzuhalten, wählten laut<br />
Knie europäische Pendler die Abgrenzung zu<br />
anderen Fahrgästen mittels Zeitung, Zeitschrift,<br />
Buch und immer stärker mit digitalen Medien.<br />
Als Zeitvertreib, jedoch auch um unterwegs zu<br />
arbeiten. Ist dann Reisen noch die Haupttätigkeit?<br />
Oder schon Nebensache?<br />
„IN DER ERSTEN KLASSE<br />
WIRD KAUM NOCH JEMAND<br />
LAUT TELEFONIEREN“<br />
Die Grenzen sind schwimmend. Designer sehen<br />
Autos schon länger als rollende Smartphones.<br />
Nun ziehen auch öffentliche Verkehrsbetreiber<br />
nach, die stärker nach Technologien wie Internet<br />
oder Mobilfunk-Netz nachfragen, beobachtet<br />
Siemens Rail Systems, weltweit tätiger<br />
Hersteller von Eisenbahnen, Metros, Straßenund<br />
Stadtbahnen. Fahrgäste würden mehr als<br />
früher erwarten, im Zug arbeiten zu können.<br />
Zusätzlich zeigt sich laut Siemens Rail Systems<br />
auch ein klarer Zukunftstrend beim Design<br />
der Wagons: Diese orientierten sich stärker als<br />
noch vor wenigen Jahren an unterschiedlichen<br />
Zielgruppen – etwa mit Ruhezonen, in denen<br />
Handys tabu seien, eigenen Arbeitszonen oder<br />
Mutter-Kind-Abteilen. In diesem Zusammenhang<br />
berichtet Mobilitätsforscher Knie von<br />
einer deutlich beobachtbaren Zivilisierung bei<br />
den Kommunikationsformen: „In Zügen der<br />
1. Klasse wird man in Deutschland heute kaum<br />
mehr erleben, dass jemand laut telefoniert.“<br />
Individualisiertes Reisen in der Masse. Wird<br />
dieses Gefühl in Zukunft stärker erzeugt,<br />
steigen mehr Menschen vom Auto auf öffentliche<br />
Verkehrsmittel um. Davon ist Christine<br />
Chaloupka-Risser vom Mobilitäts- und Verkehrsforschungsinstitut<br />
Factum überzeugt:<br />
„Dann verlassen Autofahrer ihren geschützten,<br />
komfortablen, und vor allem individuell eingerichteten<br />
Raum, in dem sie das Gefühl hatten,<br />
sicher und pünktlich anzukommen, auch<br />
wenn das in der Realität nicht stimmte.“ Psychologie<br />
und Gestaltung seien für einen Umstieg<br />
genauso wichtig wie der Kostenfaktor.<br />
Bei Siemens Rail Systems geht man dazu über,<br />
alles, was im Fahrgastraum nicht unbedingt<br />
gebraucht wird, herauszunehmen und unterflur<br />
zu verstauen. Wichtig im öffentlichen<br />
Verkehr sei zudem, ob und wie die Passagiere<br />
über die Fahrt informiert würden, meint<br />
Christine Chaloupka-Risser. „Die Fahrgäste<br />
wollen sehen oder hören, wo Störungen oder<br />
Verspätungen sind und nicht am Bahnsteig<br />
stehen gelassen werden.“ Dazu gehörten etwa<br />
die Bekanntgabe von Verbindungs- und Umsteigmöglichkeiten<br />
oder, im Falle von Verspätungen,<br />
die Information, ob die Anschlüsse<br />
gesichert seien oder welche Alternativen es<br />
gebe.<br />
Doch auch psychologische Faktoren würden<br />
an Bedeutung gewinnen, meint Chaloupka-<br />
Risser. Etwa Stress am Bahnhof zu vermeiden,<br />
zu schauen, wie man die Fahrgäste bequem<br />
weiterbringen kann oder jemandem, der sich<br />
nicht auskennt, gut zu leiten. Sauberkeit und<br />
Helligkeit seien in den Wagons ebenso wichtig<br />
wie auf den Bahnsteigen. Auch Personal, das<br />
nach dem Rechten schaue, erhöhe das individuelle<br />
Sicherheitsgefühl bei den Fahrgästen.<br />
Fortbewegung sichert, im Norden wie im<br />
Süden, das wirtschaftliche Überleben. Völlig<br />
verlassen will sich dabei aber letztendlich<br />
niemand fühlen, ob in Afrika, Indien oder<br />
Europa. <br />
6
MOBILITÄTSTYPEN<br />
WER BEWEGT SICH WIE UND WOMIT?<br />
DIE ÖSTERREICHERINNEN UND ÖSTERREICHER FOLGEN<br />
SECHS UNTERSCHIEDLICHEN MUSTERN.<br />
Quelle: Mobilitätsstudie 2011 des ÖAMTC<br />
DATEN & FAKTEN<br />
16 %<br />
DIE FAMILIEN AUF ACHSE<br />
Ob Eltern, die ihre Kinder morgens in die Schule<br />
bringen, anschließend zur Arbeit fahren und danach<br />
noch den Einkauf erledigen oder ArbeitnehmerInnen,<br />
die zur Arbeit pendeln: Bedingt durch das<br />
große Pensum an Wegen und mangels öffentlicher<br />
Alternativen ist für Pendler in Dörfern und Kleinstädten<br />
klar: „Ich bin aufs Auto angewiesen“.<br />
DIE NETZMOBILEN<br />
Vor allem junge Akademikerinnen in Städten<br />
repräsentieren diesen Typ. Diese nutzen den<br />
gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr und<br />
sehen Kosten und Umwelteffekte eines eigenen<br />
Autos kritisch. So kommen Sie zu dem Entschluss:<br />
„Im Alltag brauche ich kein Auto.“<br />
11 % 10 %<br />
DIE AUTOFANS<br />
Hier geht es nicht um Zweckmäßigkeit, sondern<br />
um Status und Spaß: Das Auto repräsentiert die<br />
Stellung, bewundernde Blicke der Nachbarn sind<br />
erwünscht. Kosten spielen eine Nebenrolle.<br />
„Mein Auto ist für mich alles“, lautet das<br />
Statement der meist ländlichen und männlichen<br />
Autofans.<br />
DIE TRADITIONALISTEN<br />
Gesellschaftlich aktiv zu bleiben ist ihnen<br />
wichtig und das Auto dabei unentbehrliche<br />
Unterstützung: „Ohne mein Auto bleibe ich<br />
über“, lautet das Credo dieser Gruppe, die<br />
vorwiegend aus Senioren auf dem Land besteht<br />
und sich mit Fahrgemeinschaften und öffentlichem<br />
Nahverkehr wenig anfreunden kann.<br />
DIE SITUATIVEN ENTSCHEIDER<br />
Die städtische Generation 55 plus repräsentiert<br />
diesen Typus. Nicht mehr der schnellste Weg,<br />
sondern selbstbestimmt und sicher Ziele erreichen<br />
ist das Motto, zumal auch der tägliche Weg zur<br />
Arbeit schon teilweise wegfällt. Die Einstellung<br />
dieser Gruppe ist „Ich muss nicht (mehr)<br />
überall mit dem Auto hin.“<br />
26 % 20 %<br />
<strong>Distanz</strong><br />
DIE JUNGEN KALKULIERER<br />
Diese tummeln sich vor allem in Wien oder am Land.<br />
Sie stehen vor der Herausforderung, morgens<br />
pünktlich am Ausbildungs- oder Studienplatz sein<br />
zu müssen, ohne ein Auto zu besitzen. Ihr Budget<br />
ist knapp. Deswegen ist Mitfahren für sie attraktiv.<br />
Ihr Motto: „Ich bin noch für alles offen,<br />
ein eigenes Auto wäre aber der Hit.“<br />
15 %<br />
7
8<br />
Foto: AutoNOMOS
Auto<br />
mit Hirn<br />
IN DEN SELBSTFAHRENDEN AUTOS DER ZUKUNFT WIRD MAN SCHLAFEN,<br />
NACHDENKEN UND ARBEITEN KÖNNEN. WAS LEONARDO DA VINCI VOR<br />
500 JAHREN ERTRÄUMTE, WIRD ENDLICH WIRKLICHKEIT.<br />
Von Leo Ludwig<br />
DIE WELT IN 20 JAHREN<br />
Bis heute weiß man nicht, ob es 1495 oder<br />
1478 war: Das Multitalent Leonardo da Vinci<br />
zeichnete eine heute noch verfügbare Skizze<br />
für ein „Carro semovente“: ein selbst fahrender<br />
Karren mit drei Rädern und einem überdimensionierten<br />
Uhrwerk zum Aufziehen als<br />
Antrieb. Das Ungetüm konnte sogar selbst<br />
lenken, allerdings nur geradeaus oder nach<br />
rechts. Folgerichtig hatte der große Künstler<br />
keinen Fahrersitz eingezeichnet.<br />
Die Idee vom Roboter-Auto ist also alt. Sehr<br />
alt. Wortwörtlich übersetzt heißt sogar Automobil<br />
„selbst fahrend“. Doch wirklich zum<br />
Greifen nah ist die radikale Verwirklichung<br />
des Autos mit Hirn erst seit kurzem durch<br />
die großen Fortschritte in der Digitalisierung<br />
und Sensortechnik. Ohne viel darüber zu<br />
reden, arbeiten alle namhaften Autohersteller,<br />
VW, BMW, Audi, Toyota, viele Zulieferer<br />
sowie Forschergruppen fieberhaft an der<br />
Weiterentwicklung der Assistenzsysteme, die<br />
mittlerweile standardmäßig in Autos eingebaut<br />
werden (siehe Box Seite 11). In der extremsten<br />
Version wird der menschliche Fahrer<br />
überflüssig und zum Mitfahrer degradiert.<br />
Oder, je nach Sicht, aufgewertet, weil dann die<br />
Passagiere die Fahrzeit zur Unterhaltung, für<br />
Videokonferenzen, Arbeit am Computer oder<br />
einfach nur zum Schlafen nützen können,<br />
während sie ans Ziel kutschiert werden.<br />
Die Technik für autonome Fahrzeuge, die<br />
eigenständig lenken, bremsen und beschleunigen<br />
können, sei inzwischen ausgereift, bestätigt<br />
Raul Rojas, wissenschaftlicher Leiter des<br />
Projekts AutoNOMOS der Freien Universität<br />
Berlin. Schon heute seien solche im geschlossenen<br />
Gelände in Einsatz, etwa in Fabriken<br />
und auf Flughäfen: In Heathrow chauffiert<br />
auf bestimmten Routen ein fahrerloser Bus<br />
die Passagiere.<br />
„IN 10–15 JAHREN WERDEN<br />
FAHRERLOSE AUTOS AUF<br />
AUTOBAHNEN UNTERWEGS<br />
SEIN“<br />
In 10 bis 15 Jahren, erklärt der Professor,<br />
würden fahrerlose Autos serienmäßig auf<br />
Autobahnen unterwegs sein. Testweise gibt<br />
es sie schon jetzt zu sehen, insbesondere in<br />
Kalifornien: Google hat sieben selbstfahrende<br />
Autos im Testbetrieb, die in der Bay Area<br />
bereits mehr als 230.000 Kilometer zurückgelegt<br />
haben. Mit Geschwindigkeiten von bis zu<br />
120 Stundenkilometern auf dicht befahrenden<br />
Highways, inklusive Spurwechsel und Überholmanövern.<br />
Und, bis auf einen Auffahrunfall,<br />
unfallfrei.<br />
<strong>Distanz</strong><br />
9
Foto: MadeinGermany<br />
Fotos: Steve Jurvetson<br />
In Deutschland und den USA haben selbstfahrende<br />
Autos schon viele Tausend Kilometer zurückgelegt.<br />
Noch sitzt aus Kontrollgründen ein Mensch hinter dem Lenkrad.<br />
Er wird jedoch bereits vom Computer selbständig chauffiert.<br />
Auch eines der Forschungsautos von Rojas,<br />
„MadeInGermany“, legte im Herbst 2011 eine<br />
tadellose Testfahrt durch 80 Kilometer Berliner<br />
Stadtverkehr hin; 46 Ampeln inklusive.<br />
Keine einzige hat der umgebaute VW Passat<br />
bei Rot durchfahren.<br />
Dabei unterscheiden sich die Wunderdinger<br />
äußerlich, bis auf einen kleinen Aufbau am<br />
Dach, nicht von normalen Autos. Das Innenleben<br />
aber hat es in sich: Laser-Scanner, Mini-<br />
Kameras und Radarsysteme, verteilt auf Frontund<br />
Rückseite, Dach sowie Rückspiegel, tasten<br />
permanent die Umwelt ab und schaffen eine<br />
360-Grad-Sicht, die das Computerhirn im Inneren<br />
des Fahrzeugs verarbeitet und als Basis<br />
für seine Fahrentscheidungen nimmt. Zusätzlich<br />
weiß es dank exakter GPS-Positionierung<br />
immer genau, wo sich das Auto befindet.<br />
DIE SCHRECKSEKUNDE ENT-<br />
FÄLLT, DER BREMSWEG IST<br />
DAHER UM VIELES KÜRZER<br />
Roboter-Autos können mehr sehen und fühlen<br />
als Menschen. Deshalb glaubt Sebastian<br />
Thrun, Stanford-Professor, VW-Partner und<br />
Mastermind hinter der Google-Flotte, an<br />
eine drastische Reduktion der Unfallzahlen,<br />
sobald die intelligenten Vehikel die Straßen<br />
erobern. Das Messen von <strong>Distanz</strong>en und das<br />
Interpretieren der entdeckten Widerstände<br />
sind Kernfunktionen, auf die es ankommt.<br />
Wo befinden sich andere Fahrzeuge? Fußgänger?<br />
Straßenmarkierungen? Was steht<br />
auf Verkehrszeichen? Dazu kommt die<br />
Schnelligkeit: Computer kennen keine<br />
Schrecksekunde. Ein normales Auto sollte<br />
bei 120 Kilometern pro Stunde mindestens<br />
60 Meter Abstand zum nächsten Auto halten,<br />
damit der Fahrer rechtzeitig bremsen kann.<br />
Computer-gelenkte einen Bruchteil dieses Abstands.<br />
Autobahnen könnten dann gefahrlos<br />
von zwei bis drei Mal so vielen Fahrzeugen<br />
befahren werden wie heute, sagen Experten.<br />
Auch Parkplätze könnten dichter gefüllt werden,<br />
da Roboter-Autos ihren Weg bis in die kleinste<br />
Parklücke finden. Automatische Einparksysteme,<br />
wie sie bereits serienmäßig Anwendung<br />
finden, benötigen vorne und hinten nur 30<br />
Zentimeter Abstand, um zu manövrieren.<br />
Werden die Roboter den Menschen also dazu<br />
verleiten, eine weitere Verkehrsexplosion<br />
zuzulassen? Nein, im Gegenteil: In Städten<br />
wie Berlin, wo gut ausgebaute öffentliche Verkehrsmittel<br />
vorhanden seien, werde künftig<br />
nur noch ein Zehntel des heutigen Autobestands<br />
nötig sein, vermutet Professor Rojas.<br />
Viele Garagen und Parkplätze würden überflüssig:<br />
„Wir werden keine eigenen Autos mehr<br />
besitzen, sondern bei Bedarf mittels Smartphone<br />
ein fahrerloses Taxi bestellen. Dieses<br />
wird es in unterschiedlichen Klassen geben: In<br />
der höheren Klasse fährt man alleine, in der<br />
niedrigeren steigen andere Fahrgäste zu.“ Auf<br />
diese Weise könnte jedes einzelne Fahrzeug<br />
längere <strong>Distanz</strong>en zurücklegen als die weniger<br />
intelligenten „Stehzeuge“ heute.<br />
10
Das Auto denkt, der Mensch lenkt<br />
Im Moment hat der Mensch das Steuer noch fest im Griff. Doch eine<br />
Fülle an unterschiedlichen Assistenzsystemen nimmt ihm Denkarbeit<br />
ab: vom Abstandsregler, der sich im nervtötenden Stop-and-Go-Verkehr<br />
bewährt, bis hin zum Notbremsassistenten, der das Fahrzeug automatisch<br />
bremst, wenn andere Fahrzeuge, Fußgänger oder Radfahrer<br />
zu nahe kommen. Selbst Müdigkeitsassistenten gibt es, die die Fitness<br />
des Fahrers registrieren. Ist diese bereits gering, kann der Fahrer den<br />
temporären Autopiloten einschalten. Ob er auf der Spur bleibt, zeigt ihm<br />
der Spurhalteassistent an, ob er überholen kann, der Spurwechselassistent.<br />
Ach ja, und für das Einparken gibt es auch eine Hilfe: Man kann<br />
aussteigen, der eingebaute Butler erledigt das ganz allein. Technisch ist<br />
der Schritt zum vollautomatischen Fahren nur noch klein.<br />
Das exakte Messen von <strong>Distanz</strong>en und das Interpretieren<br />
der entdeckten Widerstände sind Kernfunktionen, die ein<br />
lenkender Computer beherrschen muss.<br />
Wann diese Revolution in den staugeplagten<br />
Ballungsräumen ankommt, ist allerdings ungewiss:<br />
In 20, 30 oder 40 Jahren? Das hängt<br />
davon ab, wie rasch eine vom Freiheits- und<br />
Individualsymbol Auto geprägte Gesellschaft<br />
benötigt, um im wahrsten Sinn des Wortes<br />
das Steuer aus der Hand zu geben. Derzeit<br />
kostet die Versicherung eines einzigen fahrerlosen<br />
Autos noch rund 100 Millionen Euro.<br />
Erfahrungswerte über die Eintrittswahrscheinlichkeit<br />
von Schäden sowie Standardisierungen<br />
fehlen. Wer ist schuld, wenn ein<br />
Computer „durchdreht“?<br />
DIE SICHERHEIT VON<br />
ROBOTER-AUTOS WIRD<br />
WESENTLICH HÖHER SEIN<br />
ALS JENE DER HEUTIGEN<br />
AUTOS, SONST WERDEN<br />
SIE NICHT AKZEPTIERT<br />
Selbst euphorischen Forschern ist bewusst,<br />
dass die Sicherheit der selbstfahrenden Autos<br />
in den nächsten Jahren noch einmal kräftig<br />
hinaufgeschraubt werden muss, um breite gesellschaftliche<br />
Akzeptanz für den Einsatz im<br />
komplexen Stadtverkehr zu finden. Letztlich<br />
wird von ihnen wesentlich mehr Sicherheit<br />
verlangt werden als von heutigen Autos. Und<br />
ein Notfallschalter: Der Mensch muss die Automatik<br />
jederzeit beenden können.<br />
Das schließt jedoch rasche, sprunghafte Entwicklungen<br />
in Nischenmärkten nicht aus,<br />
wie zum Beispiel den Einsatz von fahrerlosen<br />
Metrobussen in den jungen Großstädten<br />
Chinas und Indiens. Diese könnten auf reservierten<br />
Spuren fahren und auf diese Weise<br />
U-Bahn-Netze ersetzen, deren Aufbau ein<br />
Vielfaches teurer wäre. Modellversuche dazu<br />
gibt es bereits in den USA und Frankreich.<br />
Die wirklich großen Brocken, die noch zu<br />
erledigen sind, sind jedoch rechtlicher Natur:<br />
Noch sind fahrerlose Autos generell verboten.<br />
Das ist mit ein Grund, warum in allen Testfahrten<br />
Forscher als Co-Piloten mitfahren<br />
müssen. Die Diskussion, wie der rechtliche<br />
Rahmen für Computer-gesteuerte Autos aussehen<br />
könnte, hat in internationalen Gremien<br />
wie der UNO gerade erst begonnen.<br />
IN DEN USA MÜSSEN INTELLI-<br />
GENTE AUTOS EINE FÜHRER-<br />
SCHEINPRÜFUNG ABLEGEN<br />
Ob viel Zeit dafür bleibt, ist fraglich: In den<br />
USA hat der Bundesstaat Nevada mit 1. März<br />
2012 eine Rahmengesetzgebung erlassen, um<br />
künftig auch Führerscheine für Computer<br />
oder Roboter auszustellen. Angeblich auf Betreiben<br />
Googles hin. Kalifornien und Florida<br />
wollen nachziehen.<br />
Gleiches Recht für alle: So wie Menschen<br />
müssen auch Computer Prüfungen ablegen,<br />
bevor sie lenken dürfen. Das erste Roboter-<br />
Auto vielleicht ausgenommen: Leonardo da<br />
Vincis selbst fahrender Karren war nicht für<br />
die Straße, sondern fürs Theater gedacht. <br />
<strong>Distanz</strong><br />
11
DIE AUFHOLJAGD<br />
DER U-BAHNEN<br />
ALEXANDER NEUMEISTER ENTWIRFT ZÜGE UND U-BAHNEN,<br />
IN TOKIO GENAUSO WIE IN SAO PAULO UND MÜNCHEN.<br />
QUERSPUR SPRACH MIT IHM ÜBER EXTREMLÖSUNGEN<br />
UND ZUKUNFTSTRENDS.<br />
Das Gespräch führte Ruth Reitmeier<br />
Fahren Sie gerne U-Bahn?<br />
Ja, natürlich, ich wohne in München<br />
in der Nähe einer U-Bahnstation und<br />
fahre regelmäßig mit der U-Bahn.<br />
Doch ich habe festgestellt, dass es<br />
manchmal fast genauso schnell geht,<br />
wenn man zu Fuß unterwegs ist.<br />
Sie arbeiten allerdings auch in Millionen-Metropolen<br />
wie Tokio, Sao Paulo,<br />
Beijing, wo weder der Fußmarsch noch<br />
der Pkw realistische Alternativen zum<br />
öffentlichen Verkehr sind.<br />
Wenn man München etwa mit Tokio<br />
vergleicht, wo wir die Linie 13 zusammen<br />
mit Hitachi gestaltet haben, ist<br />
die Realität natürlich eine ganz andere.<br />
Um dort einen wichtigen Termin zu<br />
halten, gibt es zu öffentlichen Verkehrsmitteln<br />
keine Alternative. Oder<br />
etwa Sao Paulo, wo wir zurzeit an<br />
der Linha 4 arbeiten. In dieser Stadt<br />
herrscht bereits früh morgens Stau,<br />
weshalb der U-Bahnbau jetzt mit Intensität<br />
vorangetrieben wird.<br />
In vielen europäischen Städten<br />
hingegen hat man noch eine echte Wahl<br />
zwischen Individual- und öffentlichem<br />
Verkehr. Welche sind die wesentlichen<br />
Unterschiede?<br />
Im eigenen Pkw habe ich eine kontrollierte<br />
Umgebung, nämlich die von mir<br />
gewünschte, besetzt mit Personen, die<br />
ich ausgewählt habe. In der U-Bahn<br />
habe ich diese Kontrolle über meine<br />
Umgebung freilich nicht, dort teile ich<br />
den Raum mit wahllosen Mitreisenden.<br />
Hinzu kommt, dass Passagiere öffentlicher<br />
Verkehrsmittel mit extrem unterschiedlichen<br />
Reise situationen rechnen<br />
müssen. Gerade deshalb steht der Designer<br />
vor der Aufgabe, eine möglichst<br />
attraktive Umgebung zu gestalten.<br />
DESIGN BEEINFLUSST,<br />
WO MENSCHEN IN DEN<br />
ZUG EINSTEIGEN<br />
Ein konkretes Beispiel?<br />
Hier in München haben wir bereits<br />
Ende der 90er-Jahre beim U-Bahn-<br />
Design etwas Spezielles versucht. Einen<br />
neuartigen Grundriss, der auf den Erfahrungen<br />
der Münchner Verkehrsbetriebe<br />
basierte. Man hatte festgestellt,<br />
dass sich die Fahrgäste am Anfang oder<br />
am Ende der Plattform sammeln –<br />
eben dort, wo die Stations-Zugänge<br />
sind –, und die Mitte der Plattform<br />
weitgehend leer blieb. Wir haben damals<br />
das Problem mit einem neuartigen<br />
Grundriss gelöst. Die Plätze<br />
vorne und hinten wurden für Kurzreisende<br />
geplant, mit vielen Stehplätzen<br />
und an den Seitenwänden montierten<br />
Sitzen. Die Mitte des Zugs wurde mit<br />
komfortabler Vis-à-vis-Bestuhlung gestaltet.<br />
Das heißt, die Leute, die länger<br />
unterwegs waren und es dabei bequemer<br />
haben wollten, gingen automatisch<br />
in die Mitte der Plattform. Durch diesen<br />
Design-Trick wurde zugleich die<br />
Verteilung der Passagiere gesteuert.<br />
Bei Durchsicht Ihrer Arbeiten sticht<br />
diese Mischform des Sitzplatz-Angebots<br />
heraus. Doch in vielen großen<br />
Städten, wie etwa in New York, gibt es<br />
ausschließ lich Längsbestuhlung.<br />
Warum eigentlich? Passen so mehr<br />
Menschen in den Zug?<br />
Ja, diese Anordnung bietet einfach<br />
mehr Kapazität. In Tokio gab es sogar<br />
eine Linie, bei der die Seitensitze automatisch<br />
hochgeklappt werden konnten.<br />
In den Hauptverkehrszeiten gab es<br />
dann eben nur noch Stehplätze. Das ist<br />
freilich eine Extremlösung. Doch wer<br />
Tokioter Verkehrsspitzen erlebt hat,<br />
wird verstehen, wie sie entstanden ist.<br />
Noch ein paar Kunstgriffe?<br />
Neben dem Layout geht es im U-Bahn-<br />
Design immer auch um den Versuch<br />
trotz der Enge den Eindruck von Weite<br />
zu schaffen. Und da gibt es tatsächlich<br />
ein paar Tricks. Einer der wichtigsten<br />
ist, die Haltestangen in einem großzügigen<br />
Bogen an die Seitenwand zu<br />
leiten. Dadurch vermeidet man den<br />
Stangenwald. Denn betritt der Passagier<br />
den Zug und sieht als erstes eine<br />
vertikale Stange vor sich, hat er sofort<br />
das Gefühl: „Das wird eng“. Kann der<br />
Fahrgast den Blick aber schweifen lassen,<br />
empfindet er den Raum als großzügig,<br />
obwohl sich an der Raumgröße<br />
ja nichts geändert hat. Eine wichtige<br />
Rolle spielt auch die Beleuchtung, die<br />
ich immer möglichst dicht an die Seitenwände<br />
lege. Denn das Auge geht<br />
magisch an die hellen Stellen, und helle<br />
12
Foto: N+P Industrial Design GmbH<br />
Er hat eine schöne Stimme und Humor.<br />
Wie viele Kreative, die ein erfülltes Berufsleben<br />
führen, wirkt er deutlich jünger als<br />
er tatsäch lich ist. Der deutsche Designer<br />
Alexander Neumeister, Ei gentümer von<br />
N+P Industrial Design GmbH mit Sitz in<br />
München, ist 70.<br />
Es war jedenfalls weder die Holz- noch die<br />
Modell-Eisenbahn, die den jungen „Alex“<br />
zum Design führten. Der Groschen fiel bei<br />
einem Vortrag zur Berufsorientierung, dem<br />
er als Gymnasiast im letzten Schuljahr beiwohnte.<br />
Da war ihm sofort klar, dass das<br />
Berufsbild des Designers seine Interessen<br />
für Technik und Gestaltung optimal vereinte.<br />
Nach dem Diplom an der Hochschule für<br />
Gestal tung in Ulm führte ihn ein Stipendium<br />
nach Japan. „Das war ein bahnbrechendes<br />
Erlebnis für meine wei tere Laufbahn. Ich<br />
bewundere diese Kultur, die über Jahrhunderte<br />
eine Qualität an Design geschaffen<br />
hat. Sie wurde für mich zum Vorbild“, betont<br />
er.<br />
Konsequenterweise ist die Kreation des<br />
Shinkansen Nozomi 500, der lange Zeit als<br />
schnellster Zug der Welt durch Japan düste,<br />
des Designers persönliches Karriere-Highlight.<br />
1999 wurde Neumeister dafür – als<br />
erster Ausländer – mit dem Kaiserlichen<br />
Erfinderpreis des japanischen Institute for<br />
Invention and Innovation ausgezeichnet.<br />
Neumeister ist Vater zweier Töchter, lebt<br />
seit 1970 in München und verbringt nunmehr<br />
etwa die Hälfte des Jahres in Brasilien,<br />
zumal er seit 2011 mit einer Brasilianerin<br />
verheiratet ist. Der Designer plant, sich noch<br />
heuer aus dem Business zurückzuziehen<br />
und will N+P, an „P“, seinen Partner, übergeben.<br />
www.neumeisterdesign.de<br />
Wände vergrößern den Raum optisch.<br />
Und bei der neuen Münchner U-Bahn<br />
gibt es zudem sehr große Seitenfenster.<br />
Große Fenster für die Fahrt<br />
im U-Bahntunnel?<br />
Berechtigte Frage, die großen Fenster<br />
bringen wenig im Tunnel, aber sobald<br />
der Zug in die Station einfährt, bekommt<br />
der Innenraum dadurch eine<br />
größere Dimension.<br />
Gibt es Ihrer Erfahrung nach kulturelle<br />
Unterschiede oder ist es letztlich eine<br />
Frage der real gegebenen Möglichkeiten,<br />
wie viel Nähe man zu anderen Menschen<br />
erträgt?<br />
WER ENG ZUSAMMEN-<br />
GEDRÜCKT WIRD,<br />
VERSCHAFFT SICH<br />
FLUCHTMÖGLICHKEITEN<br />
Zweifellos spielt die Kultur eine Rolle.<br />
Andererseits muss man wissen, dass<br />
sich Menschen, die eng zusammengedrückt<br />
sind, Fluchtmöglichkeiten verschaffen.<br />
Ich finde das immer wieder<br />
faszinierend etwa in Tokio, wie dort<br />
dieser Blätterwald an Werbung, der an<br />
der Decke hängt, für die in Stoßzeiten<br />
dicht gedrängten Reisenden zur oft<br />
einzigen Fluchtmöglichkeit wird.<br />
Doch selbst in halb leeren Zügen suchen<br />
Menschen Rückzugsmöglichkeiten hinter<br />
der Zeitung, mithilfe des Handys.<br />
Genau! Da kommen wir zu einem<br />
Thema, das mir zu denken gib. Der<br />
Trend zur Selbstbeschäftigungsmaschine<br />
hat uns auch in der U-Bahn<br />
längst erreicht. Ich persönlich finde<br />
es eine traurige Entwicklung, wenn<br />
die Menschen gar nicht wahrnehmen,<br />
dass sie Sitznachbarn haben, mit denen<br />
man vielleicht reden könnte. Es ist<br />
schon kurios, dass man während der<br />
Fahrt vielleicht übers Internet Kontakt<br />
zu jemandem hat, der mehrere hundert<br />
Kilometer entfernt ist, aber dabei<br />
nicht registriert, neben wem man sitzt.<br />
<strong>Distanz</strong><br />
13
Neumeisters „Linha 4“ in Sao Paulo, die erste Metro mit<br />
fahrerlosem, vollautomatischem Betrieb in ganz Lateinamerika.<br />
Die Metro in Sao Paulo von innen: Die Herausforderung liegt darin,<br />
trotz der Enge das Gefühl der Weite zu schaffen.<br />
Transparenz und Schwebesitze in München: Neumeister<br />
designte auch die neue C2-Reihe, die ab 2013 zum Einsatz kommt.<br />
Für den Nozomi 500 (bis 300 km/h) bekam der Deutsche als erster<br />
Ausländer den Erfinderpreis des japanischen Kaiserhauses.<br />
Gegen Zufallsbekanntschaften schotten<br />
wir uns zunehmend ab.<br />
Ist das vielleicht eine Gegenreaktion auf<br />
den eingangs besprochen Kontrollverlust<br />
in öffentlichen Verkehrsmitteln?<br />
Mag sein, mir scheint es auch eine Entwicklung<br />
zu sein, die auch sehr viel mit<br />
der nordeuropäischen Art des Zusammenlebens<br />
zu tun hat. Man kommt<br />
einfach nicht so locker in Kontakt.<br />
Das wird einem bewusst, wenn man in<br />
anderen Ländern beobachtet, wie leicht<br />
Gespräche entstehen können.<br />
Wohin entwickelt sich das Design<br />
von Zügen und U-Bahnzügen?<br />
Zug-Interieurs, also Reiseumgebungen<br />
für den öffentlichen Verkehr, hinkten<br />
lange Zeit hinterher. Es gab die Plüsch-<br />
Varianten oder aber die Züge waren<br />
quasi Vandalismus-resistent. Parallel<br />
dazu hatte sich jedoch die Gestaltung<br />
vieler anderer Verkehrsmittel extrem<br />
weiterentwickelt. Beeinflusst von Flugzeug-Interieurs,<br />
dem Pkw, aber auch<br />
von kleinen Cafés oder Geschäften,<br />
entstand eine völlig andere Vorstellung<br />
von einer angemessenen Reiseumgebung.<br />
Daher ging es beim Zug-Design<br />
zunächst darum, wieder auf ein Niveau<br />
zu kommen, das in anderen<br />
öffentlichen Räumen Standard war.<br />
DIE FAHRGÄSTE<br />
ERWARTEN SICH<br />
PERFEKTION WIE<br />
IM AUTO<br />
Und wie geht es weiter?<br />
Der gehobene Mittelklassewagen bleibt<br />
zweifellos ein Orientierungspunkt für<br />
die Zukunft. Das gilt auch für Passagierflugzeuge.<br />
Diese Verkehrsmittel<br />
haben Einfluss darauf, was man von<br />
einer gehobenen Reiseklasse erwartet.<br />
Die Züge müssen hier mithalten.<br />
Welche Trends erkennen Sie beim<br />
Außen-Design von Zügen?<br />
Was ich über den Innenraum gesagt<br />
habe, gilt im Wesentlichen auch für<br />
den Außenbereich, wobei hier ebenfalls<br />
der Pkw Vorstellungen von einem<br />
angemessenen Produkt geschaffen hat.<br />
Dieser Beurteilungsmaßstab darf auf<br />
keinen Fall unterschätzt werden. Es<br />
gibt immer wieder Besprechungen mit<br />
Konstrukteuren, die irgendwo sichtbare<br />
Scharniere oder Verschraubungen<br />
verwenden wollen anstatt sich die Mühe<br />
zu machen, alles unsichtbar zu befestigen.<br />
Wenn ich dann frage, ob sie das<br />
bei Ihrem Auto auch akzeptieren würden,<br />
lautet die Antwort fast immer<br />
„Niemals“. Zudem erlauben Aluminium-Bauweise<br />
und Kunststoff-Technologien<br />
einen Grad an Perfektion<br />
auch bei Kleinserien-Produkten, die<br />
früher undenkbar war. <br />
14
WIE BEWEGEN WIR UNS?<br />
Welche Verkehrsmittel werden für Fahrten zur Arbeits- oder Ausbildungsstelle benutzt?<br />
Angaben in Prozent %<br />
DATEN & FAKTEN<br />
Öffentliche Verkehrsmittel<br />
zu Fuß<br />
Fahrrad<br />
Individualverkehr<br />
91<br />
4 5<br />
45<br />
7 10<br />
38<br />
16<br />
5<br />
12<br />
67<br />
28<br />
66<br />
1<br />
5<br />
Quelle: Europäische Kommission, Meinungsumfrage zur Qualität in europäischen Städten, Mai 2010<br />
Nikosia (Zypern)<br />
30<br />
Wie viel Zeit wird pro Tag benötigt, um zur Arbeits- oder Ausbildungsstelle zu gelangen?<br />
Angaben in Prozent %<br />
In Graz<br />
liegt das Mittel bei<br />
15 Minuten pro Strecke,<br />
das sind 112,5 Stunden<br />
reine Fahrzeit pro Jahr.<br />
In 40 erwerbstätigen<br />
Jahren wären das<br />
562,5<br />
volle Tage.<br />
22<br />
46<br />
2<br />
Amsterdam (Niederlande)<br />
Oulu (Finnland)<br />
34<br />
4<br />
9<br />
Wien<br />
53<br />
28<br />
9 3<br />
60<br />
Groningen (Niederlande)<br />
Paris (Frankreich)<br />
35<br />
28<br />
27<br />
Graz<br />
Kopenhagen (Dänemark)<br />
10<br />
15<br />
20 5<br />
24 13<br />
Minuten1937<br />
< 10<br />
10–20 Minuten<br />
20–30 Minuten<br />
30–45 Minuten<br />
60<br />
Prag (Tschechien)<br />
45–60 Minuten<br />
5 1<br />
> 60 Minuten<br />
In Wien<br />
liegt das Mittel bei<br />
25 Minuten pro Strecke,<br />
das sind 187,5 Stunden<br />
reine Fahrzeit pro Jahr.<br />
In 40 erwerbstätigen<br />
Jahren wären das<br />
937,5<br />
volle Tage.<br />
2332 20<br />
Minuten11<br />
< 10<br />
10–20 Minuten<br />
20–30 Minuten<br />
30–45 Minuten<br />
45–60 Minuten<br />
10 4<br />
> 60 Minuten<br />
<strong>Distanz</strong><br />
15
Fotos: Lukas Ilgner; Uwe Mauch<br />
USER STORY<br />
PER FALTRAD<br />
IN DIE ZUKUNFT<br />
UWE MAUCH PENDELT (OHNE AUTO) ZWISCHEN WIEN UND ZAGREB<br />
MEINE FAMILIE IN KROATIEN – MEIN ARBEITGEBER IN ÖSTERREICH.<br />
WIENER WOHNUNG AM STADTRAND, DAS BÜRO IN DER INNENSTADT.<br />
GROSSE DISTANZEN. MODERNES, SCHNELLES LEBEN. ZUKUNFTSREICH.<br />
DABEI IST MEIN VERHÄLTNIS ZUM AUTO MEHR ALS NUR DISTANZIERT.<br />
EINE HOMMAGE AN FLOTTE FALTRÄDER UND LANGSAME IC-ZÜGE.<br />
WIEN-MEIDLING, Freitag, 8.02<br />
Uhr. Mein MacBook ist bereits betriebsbe<br />
reit, da setzt sich der „Emona“<br />
in Be wegung. Und siehe da: Bevor der<br />
Fernreisezug die Stadt hinter Liesing<br />
verlassen kann, stehen auch schon<br />
zwei halbwegs brauchbare Sätze zu<br />
Buche.<br />
Ja, ich bin praktizierender Mitteleuropäer!<br />
Meine Frau lebt mit unseren beiden<br />
Kindern in Zagreb, mir zahlt die<br />
Republik Österreich eine Pendlerpauschale,<br />
weil ich am Ende der alten<br />
Woche von der österreichischen in<br />
die kroatische Haupstadt und am Beginn<br />
der neuen Woche zurück nach<br />
Wien reise.<br />
„Gastarbajter“, witzelt ein befreundeter<br />
Nachbar in Zagreb. „Quoten-Jugo“,<br />
nennt mich ein befreundeter Kollega in<br />
Wien. Die Betonung liegt auf befreundet.<br />
Der Schneeberg fliegt rechts am Zugfenster<br />
vorbei. Alles gut. Willkommen<br />
in der Zukunft! Unsere Kinder beherrschen<br />
drei Sprachen: Kroatisch,<br />
Deutsch und Englisch (ihre Mutterund<br />
ihre Vatersprache akzentfrei).<br />
WIENER NEUSTADT, 8.33 Uhr.<br />
Fahrscheinkontrolle. Man grüßt sich.<br />
16
Man kennt sich – nach 17 Jahren!<br />
Der Schaffner, der heute Zugbegleiter<br />
genannt werden soll, weiß nicht, wie<br />
oft er schon hinauf zum Semmering<br />
gefahren ist. Durch all die Tunnel,<br />
über all die Via dukte. Wir rechnen<br />
nach: Bei mir werden es an die 1000<br />
Mal gewesen sein.<br />
Und ich bereue es nicht!<br />
Die Welt ist enger zusammen gerückt.<br />
Da heiratet man nicht mehr zwangsläufig<br />
im selben Ort. Da sind zwei Wohnsitze,<br />
die 400 km voneinander entfernt<br />
sind, nicht mehr Utopie. Da nimmt man<br />
auch nicht mehr blind den eigenen<br />
Wagen. Ich zum Beispiel fahre kombiniert<br />
– mit Bahn und Rad.<br />
es aus wie eine Sporttasche. Die<br />
Kombi aus Bahn und Rad ist vor allem<br />
im urbanen Raum unschlagbar schnell.<br />
Ich habe keinen Führerschein, habe<br />
auch noch nie Benzin getankt. In der<br />
Früh von der Wohnung in die Garage,<br />
dann mit dem Auto ins Büro, ohne den<br />
Himmel zu sehen, den Wind zu spüren<br />
und die Stadt zu atmen – alleine die<br />
Vorstellung ist für mich ein Graus.<br />
Eine Stunde radle ich von meiner<br />
Wohnung in Wien-Floridsdorf bis zum<br />
Büro in Wien-Neubau. Eine Stunde,<br />
die nur mir gehört. Ebenso wie jene<br />
Stunde am Abend. Niemand stoppt<br />
mich, unterwegs werden Muskeln aufgebaut<br />
und Hirnwindungen entlüftet.<br />
Und wünscht sich: Mehr schnelle Züge<br />
– nicht nur auf der viel beworbenen<br />
Westbahn, auch auf den Nebenbahnen.<br />
Mehr Komfort an Bord (z. B. getrennte<br />
Ruhe- und Rede-Zonen). Mehr moderne<br />
Lokomotiven, die nicht nur theoretisch,<br />
sondern auch praktisch in einem<br />
Zug durchfahren. Vor allem: Mehr Eisenbahn-Manager,<br />
deren Horizont nicht<br />
in Spielfeld oder Strass endet.<br />
Langsam arbeitet sich der Intercity-Zug<br />
den Zauberberg hinauf, schlängelt<br />
sich durch enge Kurven. Japaner und<br />
Amerikaner sind begeistert über das<br />
große Kino, das ihnen auf Ghegas<br />
Weltkulturerbe-Strecke geboten wird.<br />
Berufspendler verwünschen dagegen<br />
den NÖ. Landeshauptmann, der den<br />
Bau des Semmering-Basis-Tunnels<br />
virtuos in die Länge zieht.<br />
Was soll’s? Die Bahn bietet auch ohne<br />
Röhre Vorteile: Sie ist verlässlich (verlässlicher<br />
als das Flugzeug), stellt mir<br />
kostengünstig einen Fahrer zur Verfügung<br />
und ist darüber hinaus mein<br />
Schreib-Labor. Kein neues E-Mail<br />
blinkt auf, kein Anruf stört. In der Mur-<br />
Mürz-Furche kann man oft nix empfangen.<br />
Danke, liebe ÖBB!<br />
BRUCK AN DER MUR, 10.02 Uhr.<br />
Eisenbahnknotenpunkt haben wir in<br />
unsere Schulhefte geschrieben. Derzeit<br />
ist der Bahnhof ein gordischer<br />
Knoten: Baustelle. Neben meinem Sitz<br />
parkt mein Faltrad, zusammengefaltet<br />
auf Gepäckstückgröße. Mit seinem<br />
schwarzen Kunststoff-Umhang sieht<br />
GRAZ, 10.38 Uhr. Wieder Verspätung<br />
– auch das ist (noch) Realität.<br />
Zeit für einen Blick in die Zukunft:<br />
Schon bald werde ich kein Alien mehr<br />
sein. Mehr Menschen werden künftig<br />
den Wechsel von <strong>Distanz</strong> und Nähe<br />
schätzen, ohne deshalb die CO 2<br />
-Werte<br />
weiter in die Höhe zu treiben. Erklärt<br />
der Wiener Zukunftsforscher Harry<br />
Gatterer.<br />
Mit der selben Rasanz, mit der die<br />
Bahngesellschaften seit Jahren die<br />
Fahrkarten-Preise erhöhen, werden sie<br />
das Angebot verbessern. Fügt er hinzu.<br />
Der Markt wird ihnen gar keine andere<br />
Wahl lassen. Zwischen Graz und der<br />
aktuellen europäischen Kulturhauptstadt<br />
Maribor hat diese Zukunft leider<br />
noch nicht begonnen ...<br />
SPIELFELD-STRASS, 10.52 Uhr.<br />
15 Minuten Aufenthalt am alten, im<br />
Schengenland nutzlos gewordenen<br />
Grenzbahnhof. Man fragt sich: Warum<br />
wird heute noch die Lok gewechselt?<br />
Und denkt an die Chinesen: Die schaffen<br />
mit ihren modernen Hochgeschwindigkeitszügen<br />
1000 km in drei Stunden.<br />
MARIBOR, 11.45 Uhr. Den slowenischen<br />
Eisenbahnern, die in Maribor<br />
jeden Pimperlzug den Zügen nach<br />
Kroatien vorziehen, wünsche ich wiederum<br />
ein bisserl weniger Engstirnigkeit<br />
unterm Dienst-Kapperl. Und den<br />
schroffen slowenischen Grenzbeamten,<br />
dass sie – wie zuvor ihre österreichischen<br />
Vorbilder – bald in die Geschichte<br />
eingehen werden.<br />
ZIDANI MOST, 13.05 Uhr. Genug<br />
geschrieben! Nach der Einfahrt in den<br />
alten k. u. k. Bahnhof (neben der Mündung<br />
der Savina in die Save) steige<br />
ich aus dem „Emona“. Mit meinem<br />
Londoner Lifestyle-Falter fliege ich<br />
weiter – über die steinerne Brücke und<br />
dann der Save entlang. Richtung Süden.<br />
Es hat aufgehört zu regnen. Die Luft ist<br />
rein. Und ich freu’ mich schon, meine<br />
Frau und meine Kinder in die Arme<br />
nehmen zu können. Das Leben kann<br />
schön sein! <br />
<strong>Distanz</strong><br />
17
INNOVATIVES ONLINE & OFFLINE<br />
STARTUPS<br />
SPANNENDE IDEEN ZUM THEMA DISTANZ UND INTERMODALE MOBILITÄT<br />
Von Katrin Stehrer<br />
////// DAS ENDE DER WARTEZEIT /////////////////////////<br />
Das Hauptärgernis vieler Nutzer des öffentlichen Verkehrs sind die Wartezeiten.<br />
Ebenso lästig: häufig Lebensmittel einkaufen zu müssen. Diese Probleme löst die<br />
Supermarktkette Tesco, indem sie virtuelle Supermärkte in U-Bahnstationen in Seoul<br />
und Shanghai betreibt. In den Regalen befinden sich mit QR-Codes versehene Produktfotos,<br />
die von den Kunden mittels Smartphone eingelesen und bezahlt werden<br />
können. Die echten Lebensmittel werden dann nach Hause geliefert.<br />
www.tescoplc.com/index.asp?pageid=17&newsid=593<br />
In der US-Stadt Boston wurden Wartezeit-Countdowns auf Anzeigetafeln in Geschäfte,<br />
Büros und Lokale verlegt. Ziel auch hier: Einkaufen oder Arbeiten während<br />
man wartet. Noch länger Zeit zu Hause oder produktiv im Büro verbringen können indes<br />
Smartphone-User, wenn sie Echtzeit-Apps nutzen. Besonders attraktiv für Vielbeschäftigte<br />
ist der CTA Bus Tracker in Chicago. Auf einer interaktiven Karte kann<br />
man genau verfolgen, wann der Bus oder Zug kommt, den man erreichen will.<br />
www.ctatracker.com<br />
////// AB IN DIE MITTE ///////////////////////////////////////<br />
„Treffen wir uns in der Mitte!“ Stefan Wehrmeyer, ein junger Entwickler von Web-Applikationen,<br />
macht es einfach, die Mitte auch wirklich zu finden: Seine App Mapnificient<br />
visualisiert Fahrtzeiten von öffentlichen Verkehrsmitteln. User, die sich verabreden<br />
wollen, geben einfach an, von wo sie wegfahren, wie lang sie unterwegs sein<br />
und was sie tun wollen. Den Rest erledigt Mapnificent: Rote Pins zeigen passende<br />
Treffpunkte an, zum Beispiel Cafés.<br />
www.mapnificent.net<br />
////// KONTAKTE KNÜPFEN LEICHT GEMACHT /////////<br />
Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln in Afrika oder Südostasien unterscheiden<br />
sich vor allem durch eines von jenen im Westen: Sie unterhalten sich und knüpfen<br />
Kontakte. Die preisgekrönte Pariser Social Commuting Plattform Submate will genau<br />
das zurück in westliche Städte bringen. Ist man eingeloggt, schlägt Submate interessante<br />
Reisekompagnons vor und erleichtert die Kontaktanbahnung. Die Idee kam<br />
Gründer Laurent Kretz auf seinen täglichen U-Bahnfahrten, wo es ihn störte, dass er<br />
immer wieder dieselben Personen sah, aber trotzdem nichts über sie wusste.<br />
www.submate.com<br />
Sogar im Flugzeug kann man jetzt leichter Kontakte knüpfen. Meet and Seat von<br />
KLM zeigt wer in derselben Maschine sitzt und man kann seinen Sitzplatz neben<br />
Fahrgästen mit ähnlichen Interessen wählen. www.klm.com<br />
18
STRAMPELN LOHNT SICH DREIFACH //////////////<br />
Finanzielle Belohnung für grüne Fortbewegung: Was zu schön klingt, um wahr zu<br />
sein, könnte mit mo, dem neuen Mobilitätssystem der Münchner Umweltorganisation<br />
Green City, Realität werden. Je mehr Kilometer man per Rad oder im öffentlichen Verkehr<br />
zurücklegt, desto weniger zahlt man im Gegenzug für ein Carsharing-Auto. Dabei<br />
zählen Rad-Kilometer dreifach. Für die Umsetzung des Anreizsystems, das mit der<br />
Wuppertal Universität und dem Designbüro LUNAReurope entwickelt wurde, sucht<br />
Green City nun Partnerstädte.<br />
www.mo-bility.com<br />
////// BIS INS LETZTE ECK //////////////////////////////////<br />
Eine Lösung, wie man die Wege von und zu den Bushaltestellen schnell und ohne<br />
Schwitzen bewältigen kann, hat der Kalifornier Gabriel Wartofsky gefunden: In seinem<br />
Bike-Sharing-Konzept für die Londoner Verkehrsbetriebe zeigt er das volle Potential<br />
eines E-Faltbikes. Entlehnboxen mit integrierten Ladevorrichtungen sind an die öffentlichen<br />
Autobusse gekoppelt. Damit hat man immer ein Fahrzeug zum Weiterfahren<br />
griffbereit. Wie zukunftsträchtig die Idee ist, zeigt die Tatsache, dass Wartofsky über<br />
die Crowdfunding-Plattform Kickstarter 25.955 US-Dollar für die Pilotproduktion des<br />
E-Faltrads ab 2012 einsammelt konnte.<br />
www.consciouscommuter.com<br />
////// RUTSCHE IN DEN UNTERGRUND ////////////////////<br />
Auf einem Bahnhof in Utrecht wird seit kurzem die Umsteigezeit auf unterhaltsame<br />
Weise verkürzt: Für Reisende, die es eilig haben, installierte die niederländische<br />
ProRail den Transfer Accelerator. Der futuristische Name steht für eine ganz normale<br />
Rutsche, die aber den versprochenen Zweck erfüllt: Sie beschleunigt das Vorankommen.<br />
www.hik-ontwerpers.nl<br />
////// FAHRSCHEIN AM HANDGELENK ///////////////////<br />
Mit Oi hat der Designer Benjamin Parton den Staus in Londoner U-Bahnstationen<br />
den Kampf angesagt. Oi ist ein elektronischer Fahrschein, der als Ring oder an der<br />
Armbanduhr getragen wird. Damit kommt man schneller durch die Zutrittsschranken<br />
als mit Karte. Wie die normale Oyster Card nutzt Oi RFID-Technologie. Für die Umsetzung<br />
seiner Idee sucht Parton derzeit nach Partnern. Sein Traum: Bei der Olympiade<br />
in London im Sommer 2012 soll Oi bereits die Staus vor den Zugangsschranken<br />
der U-Bahn in Grenzen halten.<br />
www.benjaminparton.com<br />
////// VON WIEN NACH TOKIO /////////////////////////////<br />
Die Vision, Europa und Asien über eine gigantische Seilbahn zu verbinden, verfolgen<br />
die Österreicher Wolfgang Lehrner und Matthias Pázmándy. Unfassbare 28 Mrd. Euro,<br />
50.000 Mitarbeiter und 24.000 km Kabel werden gebraucht, um eine Konstruktion<br />
zu bauen, die in einem Tempo von 50 km/h 21 Städte verbindet. Der Haken: Ebenso<br />
visionäre Finanzierungspartner fehlen noch.<br />
www.eurasiangondolas.com<br />
<strong>Distanz</strong><br />
19
All God’s<br />
children need<br />
travelling shoes.<br />
Maya Angelou,<br />
amerikanische<br />
Bürgerrechtsaktivistin<br />
Seelen können<br />
sich nicht so schnell<br />
fortbewegen, also bleiben<br />
sie zurück, und man muss<br />
auf sie warten wie auf<br />
verloren gegangenes Gepäck.<br />
William Gibson,<br />
Science Fiction Autor<br />
Ich fragte<br />
eine Schnecke,<br />
warum sie so langsam wäre.<br />
Sie antwortete,<br />
dadurch hätte sie mehr Zeit,<br />
die Welt zu sehen.<br />
Wolfgang J. Reus,<br />
deutscher Journalist<br />
Abbildung: aus: Wikipedia, Florian Prischl<br />
20
Homo<br />
Mobilis<br />
DISTANZEN SIND ZUM ÜBERWINDEN DA, DESHALB HABEN WIR<br />
UNSERE MOBILITÄTEN VERFEINERT. WIR REISEN SCHNELLER, WEITER,<br />
EFFIZIENTER ALS JE ZUVOR. UNGEKLÄRT BLEIBT DIE FRAGE:<br />
ZUR LAST ODER LUST?<br />
Von Nicole Kolisch<br />
Glaubt man dem arabischen Sprichwort, so<br />
reist die Seele mit der Geschwindigkeit eines<br />
Kamels. Zwar überwinden wir innerhalb eines<br />
Wimpernschlages <strong>Distanz</strong>en, von denen die<br />
Karawanen unserer Ahnen nicht zu träumen<br />
wagten, ob wir allerdings dafür geschaffen<br />
sind, ob der Mensch ein „<strong>Distanz</strong>wesen“ ist,<br />
geleitet vom Wandertrieb, darf zumindest<br />
hinterfragt werden. „Als Sozialwissenschaftler<br />
ist man natürlich geneigt, so etwas als Biologismus<br />
einzustufen“, meint Ingrid Thurner,<br />
die am Institut für Kultur- und Sozialanthropologie<br />
zum Thema „Freiwillige Mobilität“<br />
forscht. „Haben wir einen Reisetrieb, quasi ein<br />
Relikt aus der Nomadenzeit? Solche Vorstellungen<br />
geistern immer wieder durch die Literatur.“<br />
Orientiert man sich etwa an der gern<br />
zitierten Maslow’schen Bedürfnispyramide, so<br />
wäre Mobilität an der Spitze einzuordnen, als<br />
Faktor der Selbstverwirklichung, der uns erst<br />
dann unter den Nägeln brennt, wenn die basalen<br />
Erfordernisse (z.B. Nahrung, Sex, Sicherheit)<br />
erfüllt sind. Thurner schüttelt den Kopf,<br />
„Nein, freiwillige Mobilität ist nicht endogen,<br />
sie hängt von sozialen und wirtschaftlichen<br />
Bedingungen ab.“<br />
An Hand von Berufsmobilität lässt sich das<br />
auch gut zurückverfolgen. Deren Geburtsstunde<br />
wird gern mit der Industrialisierung<br />
angenommen, tatsächlich reicht sie viel weiter<br />
zurück: Die Irrfahrten des Odysseus zählen<br />
ebenso dazu wie die Handelsreisen der Phönizier.<br />
Das römische Reich wäre ohne fahren de<br />
Händler undenkbar gewesen, die <strong>Distanz</strong>en<br />
zwischen Europa und dem Vorderen Orient<br />
zu überwinden wussten. Und bereits hier zeigt<br />
sich, wie stark der Grad der Mobilität mit der<br />
jeweiligen Profession verknüpft ist: Ein Hufschmied<br />
wird sein Umfeld kaum verlassen,<br />
ein Stoffhändler zwangsläufig.<br />
INDUSTRIALISIERUNG LIESS<br />
MOBILITÄT EXPLODIEREN<br />
Zu einer Explosion der Mobilität – sei es<br />
zweckgebunden wie bei Pendlern oder aus<br />
reiner Lust am Erlebnis – führt allerdings<br />
wirklich erst die Industrialisierung: Der<br />
Engländer Thomas Newcomen erfindet 1712<br />
die Dampfmaschine und ebnet dadurch den<br />
Weg für die Turbo-Kamele seiner Zeit: Die<br />
Dampfschifffahrt und die Dampflokomotive.<br />
Reisen wird billiger, erstmals auch für breitere<br />
Schichten der Bevölkerung erschwinglich.<br />
Erlebnismobilität wird unter den Besserverdienern<br />
geradezu schick; auch hier zeigen sich<br />
die Engländer als federführend und erfinden<br />
flugs die Reisegruppe (1845) und die Travellerschecks<br />
(1874)…<br />
Die ersten Fabriken gieren indes nach Arbeitskraft,<br />
schaffen erstmals Mobilität auch in<br />
Handwerksberufen. Bauernsöhne folgen dem<br />
Ruf der Werkssirene in die Stadt: Sie pendeln.<br />
Wo bislang am selben Hof gemäht, geerntet,<br />
geschlafen und geliebt wurde, kommt es nun<br />
<strong>Distanz</strong><br />
21
Foto: Barbara Wais<br />
zu einer Trennung von Wohn- und Arbeitsplatz.<br />
Lohnarbeit lockt, Berufsverkehr entsteht.<br />
„Dabei geht es längst nicht nur um die Möglichkeit,<br />
räumliche <strong>Distanz</strong>en, sondern auch<br />
um die Fähigkeit, soziale Grenzen zu überwinden“,<br />
sagt Thurner. „Wenn wir von<br />
Mobilität sprechen, sollten wir vertikale Bewegung<br />
ebenso betrachten wie horizontale.“<br />
Horizontale Mobilität – das ist die rein geografische:<br />
von Neusiedl nach Wien, von Paddock<br />
Wood nach London. Vertikale hingegen<br />
bezeichnet den Auf- oder Abstieg innerhalb<br />
der Gesellschaft. Thurner: „Es lässt sich nicht<br />
Gesetz hinkt hinterher<br />
Das Gesetz bildet neue Entwicklungen<br />
noch nicht ab. Hier sind Arbeitszeiten<br />
schwarz-weiß geregelt:<br />
Wenn Arbeit bereits am Weg zur Firma<br />
erledigt wird, ist das nicht vergütbar.<br />
Arbeitsstunden sind nur jene, die auch<br />
physisch am Arbeitsplatz verbracht<br />
werden.<br />
Eine indirekte Folge des Trends zum<br />
Unterwegs-Arbeiten sind jedoch All-<br />
In-Verträge (Überstundenpauschalen)<br />
bzw. eine generelle Lockerung der<br />
Arbeitszeiten (z. B. vermehrt Gleitzeit).<br />
Technisch wäre es längst möglich, einen<br />
Abrechnungsmodus zu finden, der auch<br />
Wege als Arbeitszeit berücksichtigt.<br />
Rolf Gleißner,<br />
Arbeitsrechtsexperte der WKO<br />
fein säuberlich auseinander dividieren. Oft<br />
geht das Hand in Hand, auch vertikale Mobilität<br />
ist mit physischer Bewegung verbunden.“<br />
Ganz banal: Wer mehr verdient, zieht um.<br />
Selbst in der Sprache ist die enge Verknüpfung<br />
von Mobilität und Prestige dokumentiert. Wir<br />
drücken unsere Anerkennung in Bewegungsmetaphern<br />
aus: Jemand ist „bewandert“, er<br />
ist „erfahren“, hat „Routine“ (zurückzuführen<br />
auf die Route) oder besitzt erstrebenswerte<br />
„Fertigkeiten“ („fertig“ leitet sich ebenfalls<br />
von „fahren“ ab). Wir „erweitern unseren<br />
Horizont“, wir sind „sattelfest“ und „gut beschlagen“.<br />
Nur selten ist uns dabei bewusst,<br />
dass wir hier von der eingangs erwähnten Kamelmobilität<br />
sprechen. (Zugegeben, in Europa<br />
eher Postkutsche als Kamel …)<br />
WER MEHR VERDIENT,<br />
ZIEHT UM – MOBILITÄT<br />
BRINGT PRESTIGE<br />
Unsere Erfahrung (sic!) von <strong>Distanz</strong> ist dabei<br />
höchst individuell, ob wir eine Strecke als<br />
Klacks oder als Zumutung einstufen, von<br />
multiplen Faktoren bestimmt. Amerikaner<br />
sind beispielsweise unterrepräsentiert, wenn<br />
es um den Besitz von Reisepässen geht – ihre<br />
Bereitschaft zur Mobilität innerhalb der USA<br />
ist jedoch Legende. Skandinavier fahren oft 200<br />
Kilometer, nur um in die Disko zu gehen. Wiener<br />
raunzen, wenn sie beruflich einen Tag nach<br />
Salzburg müssen. Linz geht gerade noch …<br />
22
Öffentliche Verkehrsmittel<br />
werden zum<br />
mobilen Arbeitsplatz.<br />
Foto: Lukas Ilgner<br />
Entscheidend ist dabei weniger die Mentalität<br />
einer Nation als ihre Besiedelungsdichte.<br />
Thurner: „Wenn nur alle paar hundert Kilometer<br />
eine Stadt ist, steigt die Bereitschaft,<br />
größere <strong>Distanz</strong>en zurückzulegen. Eine berufliche<br />
Mobilität, wie wir sie aus Amerika kennen,<br />
wo sehr oft nicht nur gependelt, sondern für<br />
den Job komplett der Standort gewechselt<br />
wird, gibt es bei uns erst in den letzten Jahren.“<br />
Auf den Geschmack kommt die Generation<br />
Praktikum durch Studentenaustauschprogramme<br />
wie Erasmus – und auch hier wandelt sich<br />
unsere Wahrnehmung: Vor 20 Jahren bedurften<br />
Auslandssemester noch einer gewissen<br />
Rechtfertigung vor Verwandtschaft und<br />
Freundeskreis, heute muss man sich fast<br />
rechtfertigen, wenn man keines absolviert.<br />
KOPPLUNG VON ARBEIT<br />
UND ARBEITSWEG IST NEU<br />
„Ändert sich unser <strong>Distanz</strong>empfinden auch<br />
durch neue Medien?“, wollen wir wissen.<br />
„Stand früher die Fahrt mit all ihren Beschwernissen<br />
im Mittelpunkt, während sie<br />
heute, iPad und Netbook sei Dank, zusehends<br />
zur Nebentätigkeit wird?“ – Nein, meint die<br />
Forscherin. Schon der Landvermesser Sven<br />
Hedin hätte auf seinem Kamel immer gelesen,<br />
weil ihm die Reise durch die Steppe so langweilig<br />
war. Er hatte bloß noch keinen iPod,<br />
aber dass Reisen nicht Selbstzweck ist, ist<br />
nicht neu.<br />
Neu ist hingegen die Kopplung von Arbeit<br />
und Arbeitsweg: E-Mails in der Schnellbahn<br />
beantworten, den Präsentationen im Flieger<br />
den letzten Feinschliff verpassen. Wir erledigen<br />
das on the go! <strong>Distanz</strong>en werden so nicht nur<br />
schneller überwunden, sie werden auch effizient<br />
genutzt. Leerläufe sind out – bezahlt wird<br />
uns das allerdings nicht [siehe Info-Kasten,<br />
S. 22]. Warum tun wir’s uns dann an?<br />
Spätestens durch die Zwangspause, die der<br />
Eyjafjallajökull vor zwei Jahren der Überholspur-Gesellschaft<br />
verpasst hat, ist in Europa<br />
eine Art „Entschleunigungs-Diskurs“ entbrannt:<br />
Leben wir unnatürlich schnell?<br />
Kommt die Seele, in ihrem Kameltempo<br />
noch mit? Eine Studie der Stanford University<br />
prophezeit uns einen „Peak Travel“, analog<br />
zum „Peak Oil“. Demnach bremsen wir uns<br />
erstmals seit der Industrialisierung wieder<br />
ein wenig ein. Bis 2030 sollte das auch an<br />
geringeren Emissionen messbar werden.<br />
Warten wir’s ab. <br />
<strong>Distanz</strong><br />
23
Autostoppen 3.0<br />
Foto: Lukas Ilgner<br />
MITFAHRBÖRSEN WERDEN INTELLIGENT. SOGAR KURZFRISTIG<br />
ENTSCHLOSSENE KÖNNEN DAMIT IHR GLÜCK FINDEN.<br />
VOR ALLEM IN DEN STÄDTEN WIRD DEM CARSHARING DER<br />
ANDEREN ART EINE GROSSE ZUKUNFT VORAUSGESAGT.<br />
Von Daniela Müller<br />
„Do you know the Taliban?“, entgegnet<br />
der junge Mann auf dem Beifahrersitz<br />
auf die Frage der Fahrerin, was<br />
ihn denn nach Österreich getrieben<br />
habe. „Yes, we all know the Taliban“,<br />
antwortet die Fahrerin und meint<br />
dabei nicht nur sich, sondern auch die<br />
beiden Männer im Fond des Autos,<br />
die sie noch nicht kennt.<br />
Was sich abenteuerlich anhört, ist<br />
für mittlerweile Millionen Menschen<br />
in Europa Normalität: Man nimmt<br />
fremde Menschen mit. Oder steigt zu<br />
ihnen ins Auto. Wenngleich die Beifahrer<br />
nicht immer so spektakuläre<br />
Gesprächsthemen zu bieten haben.<br />
„Der Preis ist der Hauptgrund für<br />
die meisten, über Mitfahrbörsen<br />
nach Begleitern zu suchen“, erklärt<br />
Carpooling-Geschäftsführer Markus<br />
Barnikel. Das deutsche Unternehmen<br />
betreibt www.mitfahrgelegenheit.at,<br />
die zur Zeit größte Vermittlungsplattform<br />
im Internet. Mitfahren auf der<br />
Strecke Graz–Salzburg kostet im<br />
Durchschnitt 15 Euro gegenüber<br />
48 Euro für ein Vollpreis-Bahnticket.<br />
Dazu kommt eine Zeitersparnis von<br />
über einer Stunde im Vergleich zur<br />
Bahn.<br />
Umgekehrt sind Mitfahrer auch für<br />
Autobesitzer attraktiv, die einmalig<br />
oder regelmäßig von A nach B fahren,<br />
die die hohen Spritpreise nicht alleine<br />
tragen wollen oder einfach keine Lust<br />
haben, alleine im Auto zu sitzen.<br />
24
Automatisches Match-Making<br />
Während Plattformen wie www.mitfahrgelegenheit.at,<br />
www.mitfahrzentrale.at und www.karzoo.at auf eine langfristigere<br />
Buchung abzielen, ist das Fraunhofer Fokus-Projekt OpenRide<br />
oder die Plattform www.flinc.org auf die spontane und flexible<br />
Echtzeitbuchung von Mitfahrgelegenheiten ausgerichtet.<br />
Bei beiden Lösungen gibt der Fahrer per Smartphone oder Internet<br />
seinen Start- und Endpunkt und die Zahl der freien Plätze an.<br />
Das System sucht automatisch nach registrierten Mitfahrern, die<br />
auf dieser Strecke oder Teilen davon mitgenommen werden wollen<br />
und meldet dies dem Fahrer. Beide, Fahrer und Mitfahrer, erhalten<br />
Informationen über den jeweils anderen, der Mitfahrer erfährt die<br />
Höhe der Fahrtkosten und beide können nun entscheiden, ob sie<br />
die gemeinsame Fahrt antreten wollen. Bei OpenRide erhält der<br />
Fahrer per Smartphone die neue Wegstrecke und Fahrzeit, der<br />
Mitfahrer den genauen Zeitpunkt, zu dem er abgeholt wird.<br />
Mitfahrgelegenheiten gibt es auch über spezielle Plattformen wie<br />
www.bergfex.at für sportliche Aktivitäten.<br />
Unter www.adriaforum.com sind Fahrten nach Kroatien und/oder<br />
retour gelistet. Eine kleine Mitfahrbörse findet sich auch unter<br />
www.flohmarkt.at.<br />
Mitunter erfahren sie bewegende Geschichten:<br />
So erzählt der Mann auf<br />
dem Beifahrersitz mit dem Namen<br />
Bilal, dass er nach einer Todesdrohung<br />
vor den Taliban nach Österreich<br />
geflohen sei und nun Freunde in<br />
Salzburg besuchen wolle. Für seine<br />
Flucht nach Österreich, die er zum<br />
Teil im Unterbau eines Lkw verbracht<br />
habe, hätten die Schlepper fast 5.000<br />
Euro verlangt. Die Asylbehörde habe<br />
ihm seine Geschichte zwar geglaubt,<br />
den Antrag auf Asyl jedoch abgelehnt,<br />
berichtet Bilal. Nun heißt es für den<br />
jungen Mann Warten auf eine nächste<br />
Gesprächsmöglichkeit mit dem Amt.<br />
Vielleicht Jahre.<br />
HOHE AKZEPTANZ<br />
VOR ALLEM UNTER<br />
JUNGEN LEUTEN<br />
Bei der Plattform „Mitfahrgelegenheit“<br />
sind viele der Registrierten regelmäßige<br />
Pendler. Etwa Pjotr, der seit 13<br />
Jahren jede Woche 1200 Kilometer<br />
von Slowenien nach Deutschland zur<br />
Arbeit fährt. Oder der Tiroler Franz,<br />
der sich einige Jahre vor seiner Pension<br />
in die Südsteiermark verliebt, sich dort<br />
ein Haus gekauft hat, beruflich aber<br />
nach Innsbruck pendeln muss.<br />
Die Zukunft sieht das Fraunhofer-<br />
Institut für Offene Kommunikationssysteme<br />
(Fokus) in Berlin jedoch vor<br />
allem in spontanen, kürzeren Fahrten<br />
im Umfeld von Städten: als Erweiterung<br />
von Carsharing und als Baustein,<br />
mit dem Mobilität neu definiert<br />
werden kann. Mitfahrbörsen würden<br />
künftig von jungen, kurzentschlossenen<br />
Menschen ohne eigenes Auto<br />
genutzt, Carsharing hingegen von<br />
jenen, die sich sonst ein Taxi genommen<br />
hätten, sagt Forschungsleiter Ilja<br />
Radusch. Indem jeder zum Taxifahrer<br />
werden könne, freilich ohne mit dem<br />
Beförderungsgesetz in Konflikt zu<br />
kommen, würde man eine Menge an<br />
Leerfahrten vermeiden. „Menschen<br />
wollen heute nicht mehr unbedingt<br />
selbst mit dem Auto fahren, sondern<br />
schnell von A nach B kommen.“ Für<br />
die jüngere Generation sei es kein<br />
Muss mehr, alles selbst zu besitzen,<br />
bestätigt auch Markus Barnikel von<br />
Carpooling. Das gelte für Autos genauso<br />
wie für Musik-CDs.<br />
JEDEM SEINE GANZ<br />
PRIVATE MITFAHR-<br />
COMMUNITY<br />
Doch wie bringt man Autofahrer und<br />
Mitfahrer kurzfristig zusammen?<br />
Beim Projekt OpenRide des Fraunhofer<br />
Fokus sowie auf der neuen<br />
Plattform www.flinc.org geschieht das<br />
über geeignete Softwareprogramme<br />
online und in Echtzeit. Benutzer können<br />
unterwegs via Smartphone nach<br />
Mitfahrmöglichkeiten suchen oder<br />
umgekehrt anbieten, jemanden mitzunehmen.<br />
Die spontane Vermittlung<br />
hat allerdings den Nachteil, dass sowohl<br />
Fahrer als auch Mitfahrer keine<br />
Möglichkeit haben, sich über den<br />
jeweils anderen vorab ausführlich zu<br />
informieren.<br />
Das versuchen OpenRide und flinc<br />
allerdings dadurch zu kompensieren,<br />
dass sie sich an bestehende Communities<br />
anhängen wollen: Man will Unternehmen<br />
ansprechen, die ihre Mitarbeiter<br />
bei der spontanen Bildung von<br />
Fahrgemeinschaften unterstützen,<br />
Gemeinden, die ihr Mobilitätsangebot<br />
erweitern und Veranstalter, die die<br />
Anreise der Besucher effizient gestalten<br />
wollen. Auch Vereine und Universitäten<br />
gehören zur Zielgruppe. flinc<br />
setzt zudem stark auf Social Media:<br />
Der Einzelne kann sein privates Mobilitätsnetz<br />
aufbauen und seine eigene<br />
Mitfahr-Community schaffen.<br />
Das schafft Vertrauen zwischen den<br />
Menschen, die sich ein Auto teilen.<br />
Mitunter bleibt es nicht bei einmaligen<br />
Gelegenheiten: So erzählte die<br />
Autofahrerin einer Journalistin vom<br />
Afghanen Bilal, die daraufhin einen<br />
Artikel über seine Geschichte veröffentlichte.<br />
Zufall oder nicht, nur<br />
wenige Tage später flatterte ein Brief<br />
der Asylbehörde in die Unterkunft<br />
des Afghanen: Bilal soll einen Pass<br />
bekommen. <br />
<strong>Distanz</strong><br />
25
DATEN & FAKTEN<br />
TIERISCHE REKORDE<br />
Einmal die Erde umrunden = 40.000 km<br />
4.000.000 km<br />
Der Mauersegler<br />
schafft es in seinen bis<br />
zu 20 Lebensjahren auf<br />
4.000.000 Flugkilo meter.<br />
Er fliegt jedes Jahr ca.<br />
200.000 km, das ist so<br />
weit wie viermal um die<br />
Erde!<br />
1.100.000 km 60.000 km 40.000 km 15.000 km<br />
Grauwale bewegen sich<br />
mit einer Geschwindigkeit<br />
von max. 9 km/h<br />
extrem langsam,<br />
legen aber nach<br />
55 Lebens jahren doch<br />
ca. 1.100.000 km zurück.<br />
Karibus sind ständig in<br />
Bewegung und laufen<br />
pro Jahr ca. 6000 km. Bei<br />
einer Lebenserwartung<br />
von zehn Jahren legen<br />
sie 60.000 km in einem<br />
Leben zurück.<br />
Mensch 50 Millionen<br />
Schritte machen wir in<br />
unserem Leben. Dabei<br />
legen wir 40.000 Kilometer<br />
zurück – wir laufen<br />
also einmal um den Erdball.<br />
Unechte Karettschildkröten<br />
Dank ihrer phänomenalen<br />
Orientierung<br />
steuert das Tier nach gut<br />
25 Jahren und ca. 15.000<br />
zurückgelegten Kilometern<br />
genau den Strand an,<br />
an dem es einst aus dem<br />
Ei schlüpfte.<br />
Dunkler Sturmtaucher Der 64.000 km<br />
weite Flug dieses Vogels ist die längste<br />
bisher nachgewiesene Reise einer Vogelart.<br />
Er trug einen elektronischen Sender und<br />
benötigte rund 200 Tage für die Strecke.<br />
Tierische Transportsysteme<br />
Die Pfuhlschnepfe namens E7<br />
sei ohne Zwischenlandung<br />
von Alaska nach Neuseeland<br />
(ca. 11.500 km) geflogen.<br />
Der längste Passagierflug Der längste<br />
derzeit durchgeführte Flug ist der von<br />
Singapore Airlines mit einem A340-500<br />
durchgeführte Linienflug von Singapur nach<br />
New York mit 16.600 km und einer Flugzeit<br />
von etwa 18 Stunden.<br />
Kuhreiher nutzen Elefanten als<br />
Aussichtsplattform: Die Jagd nach<br />
Insekten und Kleintieren wird ihnen<br />
dadurch erleichtert, dass die<br />
Beutetiere durch die Elefanten<br />
aufgescheucht werden.<br />
Schiffshalter heften sich an<br />
Haie, sodass sie jederzeit an<br />
abfallenden Beuteteilchen<br />
teilhaben können.<br />
Manche Tiere ohne Nest wie<br />
das Känguru und die Geburtshelferkröte<br />
transportieren Brut<br />
und Jungtiere auf dem Rücken,<br />
im Körper oder in eigenen Bruttaschen.<br />
Krötenmännchen lassen sich<br />
längere Zeit während der Laichzeit<br />
von den Weibchen tragen.<br />
26
DIE VERMESSUNG DER WELT<br />
WARUM WERDEN AN DER STRASSENBAHN-HALTESTELLE AUS VIER<br />
ANGEZEIGTEN MITUNTER SECHS TATSÄCHLICHE MINUTEN WARTEZEIT?<br />
KÖNNEN ORTUNGSSYSTEME KEINE UHREN LESEN?<br />
QUERSPUR HAT SICH ZWISCHEN RAUM UND ZEIT SCHLAU GEMACHT.<br />
Von Nicole Kolisch<br />
////// ANZEIGETAFEL IN ECHTZEIT /////////////////////////<br />
Wer in Wien an einer Haltestelle wartet, sieht auf der Anzeigetafel in Echtzeit<br />
wann die nächste Straßenbahn kommt. Die Anzeige ist in Minuten und theo retisch<br />
exakt. Theoretisch, wohlgemerkt: „Wir nennen das die Wiener Linien Minuten“, sagt<br />
Michael Kieslinger, dessen Firma Fluidtime hinter der Berechnung steckt. „Busse<br />
oder Straßenbahnen funken ihren Standort und wir rechnen die verbleibenden Meter<br />
bis zur nächsten Haltestelle in Zeit um.“ Der Algorithmus berücksichtigt die durchschnittliche<br />
Verkehrssituation. Parkt aber gerade ein Auto aus, nachdem der Standort<br />
gefunkt wurde, kommt es zu Abweichungen. „Das Verkehrsgeschehen der Zukunft<br />
kann nicht berücksichtigt werden“, meint Kieslinger. „Die angezeigte Ankunftszeit ist<br />
deshalb immer die kürzest mögliche, nicht unbedingt die reale.“<br />
KOMPLEXES EINFACH ERKLÄRT<br />
////// UNVORSTELLBAR //////////////////////////////////////<br />
<strong>Distanz</strong>en lassen sich auf zweierlei Arten darstellen: einerseits als gemessene<br />
Strecke (metrisch), andererseits als Zeitangabe. In unterschiedlichen Situatio nen<br />
empfinden wir diese Angaben unterschiedlich sinnvoll. Klar: Dass eine Autostrecke<br />
3 km misst, ist eine nützliche Auskunft. Dass es bis Kairo 2384 km Luftlinie sind, hilft<br />
uns hingegen weniger. Hier zählt allein die Auskunft über die Reisedauer: 3 Stunden<br />
Flugzeit. Kurz: Je weiter die <strong>Distanz</strong>en, desto weniger vermag der Verstand räumliche<br />
Angaben zu erfassen. So wie wir eher vom Lichtjahr sprechen, als von 9,5 Billionen km.<br />
Foto: bikemap; Firma Hale Electronic; Internet; Wiener Linien<br />
////// ZEIT ODER WEGSTRECKE /////////////////////////////<br />
„Ein Taxameter funktioniert im Prinzip wie die Waage im Wurstgeschäft“, sagt Paul<br />
Blachnik (Bundesfachverband für Personenbeförderungsgewerbe), „nur dass eben<br />
nicht Gramm, sondern Weg gemessen wird“. Die Wahrheit ist noch sehr viel komplizierter:<br />
Neben der Kilometer-Anzahl wird gleichzeitig auch die Zeit gemessen. Entsprechend<br />
der europäischen Richtlinie für Taxameter erfolgt die Fahrpreisberechnung<br />
in der Weise, dass unterhalb der sogenannten Umschaltgeschwindigkeit der Zeittarif<br />
und oberhalb der Wegtarif zugrunde gelegt wird. Ist das Taxi sehr langsam unterwegs,<br />
zählen die Minuten, ist es schneller unterwegs, die Kilometer. Übrigens: Die<br />
Salzburger Firma Hale Electronic ist Marktführer und beliefert mehr als 40 Länder mit<br />
ihren geeichten Taxametern. Ein Exportschlager made in Austria.<br />
////// DIE IDEALE ROUTE /////////////////////////////////////<br />
Für die Fahrradrouten-App von bikemap.net spielt Zeit hingegen kaum eine Rolle.<br />
„Autos sind einheitlicher, aber bei Fahrrädern kommt es sehr auf das Modell bzw. die<br />
körperliche Kondition an. Da sind 08/15-Wegzeitangaben sinnlos“, erklärt Developer<br />
Helge Fahrnberger. Um die ideale Route für eine Anfrage zu ermitteln, füttert er seinen<br />
Algorithmus stattdessen mit topografischen Daten (Steigungen) und Klassifizierungen<br />
der Wege. Eine weitere wichtige Komponente stellt das seit Jahren via bikemap gesammelte<br />
Userfeedback dar: „In Wien gibt es viele Wege vom Stubentor zum Westbahnhof,<br />
aber aufgrund unserer Daten sehen wir, welcher von 80 % der Nutzer gewählt<br />
wurde und können eine entsprechende Empfehlung abgeben.“<br />
<strong>Distanz</strong><br />
27
Kindergarten<br />
Erwerbsarbeit/Teilzeit<br />
Mittagessen<br />
Schule<br />
Erwerbsarbeit/Teilzeit<br />
Zuhause<br />
Spielplatz<br />
Zuhause<br />
Sport<br />
Supermarkt<br />
Musikschule<br />
Foto: Lukas Ilgner<br />
28
Wegemuster<br />
durch<br />
die Stadt<br />
FRAUEN LEGEN KOMPLEXERE STRECKEN ZURÜCK ALS MÄNNER.<br />
UND: EINHEIMISCHE KOMMEN PRO TAG AUF DURCHSCHNITTLICH<br />
12.000 METER STRECKE, MIGRANTEN HINGEGEN NUR AUF 8000.<br />
DIE SOZIOLOGIN ELLI SCAMBOR UND DER MEDIENKÜNSTLER FRÄNK ZIMMER<br />
UNTERSUCHTEN UND VISUALISIERTEN DIE ALLTAGSWEGE<br />
DER GRAZER BEVÖLKERUNG.<br />
Das Gespräch führte Ruth Reitmeier<br />
Frau Scambor, Sie leben in Graz, Sie<br />
sind Soziologin. Gibt es Erkenntnisse<br />
dieser Studie, die Sie dennoch richtig<br />
überrascht haben?<br />
Ja. Eine Sache war, dass sich die<br />
Mobilitäten von Männern und<br />
Frauen mit Kindern unter 14 Jahren<br />
so stark voneinander unterscheiden.<br />
Natürlich wissen wir, dass die Arbeitsteilungsmodelle<br />
in Österreich so<br />
aussehen, dass hauptsächlich Männer<br />
einer Vollzeiterwerbstätigkeit nachgehen,<br />
und Frauen Teilzeit arbeiten<br />
und die Kinderbetreuung übernehmen.<br />
Wir hatten jedoch erwartet,<br />
dass sich in einer Stadt dieser Größe<br />
eine höhere Komplexität zeigen<br />
würde.<br />
Es hat sich jedenfalls gezeigt, dass<br />
an dem Vorurteil, dass Frauen<br />
nicht mobil seien, nichts dran ist.<br />
Richtig. Frauen sind hochmobil.<br />
Und Frauen mit Kindern unter 14<br />
weisen die komplexesten Mobilitäten<br />
von allen auf. Frauen und Mädchen<br />
werden ja für zwei Lebensbereiche<br />
sozialisiert, für die Erwerbsarbeit und<br />
für die Familie. Männer hingegen werden<br />
haupt sächlich für die Erwerbsarbeit<br />
sozia lisiert. Die Frage war also,<br />
ob sich dies in den Mobilitäten der<br />
Menschen zeigt. Nun, es zeigt sich,<br />
sobald Kinder da sind. Bei den Männern<br />
bleibt die Mobilität im Prinzip<br />
gleich. Die der Mütter hingegen wird<br />
viel komplexer und entspricht dieser<br />
doppelten Eingebundenheit in die<br />
Gesellschaft. Da werden viele Orte miteinander<br />
verknüpft, und viele dieser<br />
Punkte auf dem Weg verweisen auf<br />
die Familienarbeit: Das beginnt damit,<br />
dass Frauen morgens die Kinder<br />
in den Kindergarten oder in die Schule<br />
bringen, dann gehen sie arbeiten. Mittags<br />
werden die Kinder wieder abgeholt.<br />
Nachmittags geht es dann zum<br />
Flötenunterricht, zum Spielplatz, zum<br />
Supermarkt.<br />
Wenn man sich diese Muster ansieht,<br />
ist das „andere Geschlecht“ nicht die<br />
Frau, sondern die Mutter. Denn die<br />
Mobilität von Frauen ohne Kinder<br />
unterscheidet sich ja kaum von<br />
jenen der Männer.<br />
Erwerbstätige Frauen ohne Kinder<br />
haben entsprechend einfache Wege,<br />
ähnlich wie Männer.<br />
Gab es denn keine neuen Väter<br />
im Sample?<br />
Doch, die gab es. Wenn man die Daten<br />
im Detail ansieht, zeigt sich, dass<br />
vor allem Väter mit höherer Bildung<br />
komplexere Mobilität und Wegeketten<br />
haben als etwa Väter mit niedrigem<br />
Bildungsniveau. Es sind aber<br />
nicht sehr viele und über die gesamte<br />
Stichprobe von 1650 Menschen gerechnet,<br />
verschwinden sie.<br />
Denken Sie, dass etwa in Uppsala die<br />
Mobilitätsmuster von Eltern mit Kindern<br />
anders aussehen?<br />
Ich denke schon, dass die Mobilitäten<br />
in Ländern wie Schweden anders aus -<br />
sehen, weil ja auch die Arbeitsteilungsmodelle<br />
einer gerechten Aufteilung<br />
von Erwerbsarbeit und Familienarbeit<br />
entsprechen.<br />
<strong>Distanz</strong><br />
29
Foto: Elli Scambor, Fränk Zimmer<br />
Das Team<br />
Die Soziologin...<br />
Elli Scambor ist Lektorin an mehreren Unis in Graz. Wissenschaftliche<br />
Koordinatorin im Forschungsbüro der Männerberatung Graz.<br />
Schwerpunkte: Genderanalyse, Diversitäts- und Männerforschung<br />
in den Bereichen Stadtraum, Arbeit, Organisation, soziale Netzwerke.<br />
Projekte an der Schnittstelle von Sozialforschung und Medienkunst.<br />
http://elliscambor.mur.at<br />
... und der Medienkünstler<br />
Fränk Zimmer, geboren in Luxemburg, lebt und arbeitet in Graz.<br />
Musikwissenschaftliche Studien in Graz und Wien. Klang- und<br />
Medieninstallationsprojekte im öffentlichen Raum. Producer des<br />
ORF Musikprotokolls im Steirischen Herbst. Schwerpunkte künstlerischer<br />
Arbeiten bilden die Verschränkung von Medienkunst und<br />
angewandter Sozialforschung. http://fz.mur.at<br />
Das Projekt<br />
1650 Grazer zeichneten ihre täglichen Wege in den Stadtplan ein.<br />
Die so gewonnenen Daten wurden in der „Intersectional Map“, einem<br />
Grazer Stadtplan der Alltagsmobilitäten, dargestellt. Eine der<br />
Zielsetzungen war, diese Daten wieder in die Bevölkerung zurückzuspielen.<br />
Dafür wurden Monitore mit der Map-Installation aufgebaut,<br />
die über Monate durch die Stadt wanderten. Die Map ist online<br />
abrufbar unter. http://intersectional-map.mur.at/<br />
Das Buch<br />
Das Studien-Projekt liegt aktuell als Buch vor.<br />
Elli Scambor, Fränk Zimmer (Hg.)<br />
Die intersektionelle Stadt.<br />
Geschlechterforschung und Medienkunst<br />
an den Achsen der Ungleichheit.<br />
Februar 2012 / ISBN 978-3-8376-1415-2<br />
Transcript. Verlag für Kommunikation, Kultur und soziale Praxis<br />
30
Auf Achse in der Berliner Großstadt<br />
Der Berliner Atlas paradoxaler Mobilität von Friedrich von Borries zeigt eine ungewöhnliche<br />
Sicht auf Berlin und die Phänomene moderner Mobilität. Es ist eine Sammlung unorthodoxer<br />
Kartografien – etwa zu überfahrenen Füchsen, Wagensiedlungen, unvollendeten Autobahnbrücken<br />
sowie Grätzel mit hoher Porsche-Dichte –, mit Fotos, Essays und Interviews.<br />
Dabei werden die Bewegungsmuster von Fahrradkurieren genauso beschrieben wie jene<br />
von Drogendealern oder Touristen. Interviews mit Straßenmusikanten, Trampern, Obdachlosen,<br />
Lastwagenfahrern und mobilen Würstchenbratern liefern Einblicke<br />
in Mobilitätskulturen direkt von der Straße.<br />
Friedrich von Borries (Hg.)<br />
Berliner Atlas paradoxaler Mobilität<br />
ISBN: 978-3-88396-304-4<br />
Merve Verlag Berlin 2011<br />
Ist Ihnen ein Unterschied zwischen<br />
Männern und Frauen in der Nutzung<br />
der Art der Verkehrsmittel aufgefallen?<br />
Das haben wir hier nicht erhoben. Es<br />
gibt allerdings Studien, die belegen,<br />
dass gerade Frauen Verkehrsmittel<br />
häufiger wechseln und stärker multimodal<br />
unterwegs sind als Männer.<br />
Legen Frauen mit Kindern insgesamt<br />
kürzere Strecken zurück?<br />
Die Weglängen zeigten keine auffälligen<br />
Unterschiede, zumal Frauen mit<br />
ihren Kindern oft mehrere Stadtteile<br />
durchqueren, um an spezielle Orte<br />
wie etwa zum Montessori-Kindergarten<br />
zu gelangen. Die Unterschiede bei<br />
den <strong>Distanz</strong>en waren zwischen Inländern<br />
und Menschen mit Migrations-Hintergrund<br />
am auffälligsten.<br />
Womit wir beim zweiten wichtige Ergebnis<br />
der Studie wären: Zuwanderer<br />
legen deutlich kürzere Strecken zurück<br />
als Einheimische. Die Messung<br />
ergab 8000 Meter pro Tag zu 12.000.<br />
Genau. Das war, wenn man so will,<br />
die zweite Überraschung. Diese Zuwanderer-Communities<br />
haben starke<br />
lokale Netzwerke und bleiben unter<br />
sich. Also über die Mur, auf die traditionell<br />
bürgerliche Seite, gibt es nur<br />
wenige Querungen aus diesen Vierteln.<br />
Ein paar Einrichtungen haben<br />
diese Teilung ein wenig aufgebrochen.<br />
Wie etwa das Kunsthaus Graz oder<br />
die Fachhochschule. Stadtteile mit<br />
einem hohen Anteil an Zuwanderern<br />
werden durch solche Ansiedelungen<br />
heterogener, in die andere Richtung<br />
passiert das aber kaum. Soziale<br />
Homogenität betrifft ja nicht nur die<br />
Zuwanderer-, sondern auch die bürgerlichen<br />
Viertel.<br />
Die Studie zeigt auch, dass die Stadtnutzung<br />
sehr unterschiedlich ist. Was<br />
lässt sich aus den Ergebnissen für die<br />
Stadtentwicklung ableiten?<br />
Die wichtigste Aufgabe dieser Studie<br />
ist ja zunächst das Aufzeigen einer<br />
Fragmentierung. Im nächsten Schritt<br />
könnten sich die Stadtpolitikerinnen<br />
und -politiker fragen: Was ist das für<br />
eine Stadt, in der sich alle Menschen<br />
wohl fühlen? Also das ist für mich<br />
eine zentrale Fragestellung. Denn ich<br />
betrachte die Stadt als etwas Gesellschaftliches.<br />
Sie ist nicht etwas, das<br />
außerhalb von uns existiert, sondern<br />
sie ist das, zu dem wir sie machen.<br />
Indem ich die Stadt nutze, wird sie<br />
zu meiner Stadt.<br />
Wir wissen also jetzt, wer sich wo<br />
in der Stadt bewegt. Was wäre der<br />
nächste Schritt?<br />
Der nächste Schritt wäre, zu schauen,<br />
wie zufrieden die Menschen damit<br />
sind. Diese qualitative Dimension<br />
zu erheben, wäre wichtig, denn damit<br />
wird vielleicht der Auftrag an<br />
die Stadtpolitik noch deutlicher, sich<br />
Konzepte zu überlegen, die eine stärkere<br />
soziale Durchmischung zum<br />
Ziel haben.<br />
Denken Sie, dass technische Innovationen<br />
die Mobilitätsmuster verändern<br />
werden?<br />
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass<br />
sich hier durch neue Technologien<br />
großartig etwas ändern würde, – also<br />
nicht für diese Fragestellung. Wir haben<br />
uns ja primär angeschaut, welche<br />
Orte besucht werden, nicht das Wie.<br />
Die Veränderung liegt also in der<br />
sozia len Innovation. Würden Sie die<br />
Studie in zehn Jahren wiederholen,<br />
denken Sie, dass die Mobilitäten von<br />
Eltern sich angeglichen haben werden?<br />
Was diese Studie abbildet, sind gesamtgesellschaftliche<br />
Verhältnisse,<br />
und das betrifft Veränderungen, die<br />
lange Zeit brauchen. Also dass die<br />
Mobilitäten von Männern mit Kindern<br />
ähnlich komplex werden wie<br />
jene der Frauen, das ist etwas, das<br />
werde ich vermutlich nicht erleben.<br />
Wie sehen Sie die Zukunft der Alltagsmobilität?<br />
Wenn ich mir Mobilität ganz allgemein<br />
ansehe, über diese Studie hinausblickend,<br />
habe ich den Eindruck,<br />
dass zu Fuß gehen wieder wichtiger<br />
wird und sich das Verhalten insgesamt<br />
verändert. Also der Trend geht<br />
in Richtung multimodale Mobilität.<br />
Haben Sie sich Ihre eigene Mobilität<br />
angesehen?<br />
Ja.<br />
Überrascht?<br />
Ja, doch. Denn es ist mir aufgefallen,<br />
dass es ein langer Weg ist, und einer,<br />
wo ich unterwegs viele Dinge mitnehme.<br />
<br />
<strong>Distanz</strong><br />
31
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28<br />
32<br />
Querspur Das Zukunftsmagazin des ÖAMTC<br />
PARKOUR<br />
ist eine aus den 1980er-Jahren<br />
in Frankreich entstandene Sportart.<br />
Ihr Ziel ist es, durch elegante, effiziente,<br />
geschmeidige und flüssige Bewegungen alle<br />
Hindernisse zu überwinden, die sich dem Traceur –<br />
der ausübenden Person – in den Weg stellen.<br />
<strong>Distanz</strong>en werden charakteristisch ohne Hilfsmittel<br />
und Veränderung der Umgebung überwunden.<br />
Der Traceur nimmt dazu auf kreative Weise andere<br />
Wege, als sie architektonisch vorgegeben sind.<br />
In seiner ursprünglichen Form ist der Parkour<br />
keine Akrobatik sondern die Philosophie,<br />
die eignen durch Körper und Umwelt<br />
gesetzten Grenzen zu erkennen<br />
und zu überwinden.