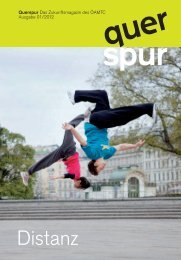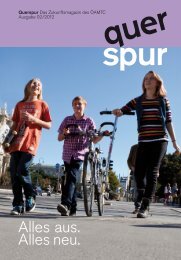Regeln
Querspur: Das Zukunftsmagazin des ÖAMTC Ausgabe 04/2013
Querspur: Das Zukunftsmagazin des ÖAMTC
Ausgabe 04/2013
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Querspur Das Zukunftsmagazin des ÖAMTC<br />
Ausgabe 04/2013<br />
<strong>Regeln</strong><br />
<strong>Regeln</strong><br />
1
<strong>Regeln</strong><br />
Was kann<br />
das Internet der Dinge?<br />
Neben dem Menschen, der Daten ins<br />
Internet einspeist und auf Endgeräten wie PC<br />
und Smartphone wieder nutzt, werden künftig auch<br />
immer mehr Maschinen ins Internet einsteigen und<br />
somit „intelligent“ werden. Bis 2020 sollen weltweit<br />
50 Milliarden Geräte 1 untereinander vernetzt sein:<br />
Waschmaschinen werden sich selbstständig<br />
einschalten, wenn der Strom gerade am günstigsten<br />
ist, oder die Fenster schließen von selbst, bevor<br />
der Regen kommt. Der Begriff „Internet of Things“<br />
wurde 1999 von Kevin Ashton erfunden,<br />
ein High-tech-Entrepreneur, der auch mit<br />
dem Massachusetts Institute of<br />
Quellen:<br />
1 Cisco IBSG<br />
2 VwGH 1448/62 VwSig 5.963 A = ZVR 1963/304<br />
3 BRalpha.de<br />
Technology (MIT)<br />
zusammenarbeitet.<br />
Impressum und Offenlegung<br />
Was ist<br />
die Wissenschaft<br />
Komplexer Systeme?<br />
Komplexe Systeme sind weit verbreitet, in<br />
der Biologie genauso wie im Sozialen: Das<br />
Gehirn besteht aus stark miteinander verflochtenen<br />
Zellverbänden. Auch menschliche<br />
Gesellschaften gelten als komplexe Systeme, weil<br />
Individuen in vielfältiger Weise miteinander in<br />
Beziehung treten. Die Wissenschaft<br />
Komplexer Systeme erforscht Muster und<br />
<strong>Regeln</strong> in der Wechselwirkung der<br />
unterschiedlichen Teile. Größte<br />
Herausforderung: Komplexe<br />
Systeme verhalten<br />
sich nicht linear.<br />
Medieninhaber und Herausgeber<br />
Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC),<br />
Schubertring 1-3, 1010 Wien, Telefon: +43 (0)1 711 99 0<br />
www.oeamtc.at<br />
ZVR-Zahl: 730335108, UID-Nr.: ATU 36821301<br />
Vereinszweck ist insbesondere die Förderung der Mobilität unter<br />
Bedachtnahme auf die Wahrung der Interessen der Mitglieder.<br />
Rechtsgeschäftliche Vertretung<br />
DI Oliver Schmerold, Verbandsdirektor;<br />
Mag. Christoph Mondl, stellvertretender Verbandsdirektor.<br />
Konzept und Gesamtkoordination winnovation consulting gmbh<br />
Chefredaktion Mag. Gabriele Gerhardter (ÖAMTC),<br />
Dr. Gertraud Leimüller (winnovation consulting)<br />
Chefin vom Dienst Silvia Wasserbacher-Schwarzer, BA, MA<br />
Gibt es immer<br />
mehr <strong>Regeln</strong>?<br />
Seit 2007 setzt die EU<br />
auf Bürokratieabbau: Verwaltungslasten,<br />
die aus neuen EU-Regelungen resultieren,<br />
sollten um 25% reduziert werden, hieß es<br />
damals. Dennoch nimmt insgesamt die<br />
Regeldichte nicht ab: Allein in Österreich<br />
hat der Nationalrat zwischen Herbst 2008<br />
und Juli 2013 647 Gesetze verabschiedet.<br />
Wie viele alte, ungenutzte Gesetze<br />
in dieser Zeit gestrichen wurden,<br />
ist hingegen<br />
unbekannt.<br />
Sind <strong>Regeln</strong> und<br />
Intuition ein Widerspruch?<br />
Eine Regel ist der Ausdruck bestimmter<br />
Gesetzmäßigkeiten, Erfahrungen und Erkenntnisse.<br />
Ihr Entstehungsprozess kann rational<br />
nachvollzogen werden. Intuition hingegen bedeutet,<br />
ohne rationalen Erkenntnisweg zu einer Entscheidung<br />
zu kommen. Man verlässt sich auf seine Eingebung.<br />
Überraschend: Auch in einer streng regelgeleiteten<br />
Wissenschaft wird die Intuition als anerkannte<br />
Quelle der Kreativität und des Erkenntnisweges<br />
genutzt. So sind etwa die Physiker Hans Peter<br />
Dürr und Anton Zeilinger überzeugt 3 ,<br />
dass das Neue nur mithilfe von<br />
Intuition geboren<br />
werden könne.<br />
Was sind<br />
Lead User?<br />
Userinnovatoren (oder Lead User)<br />
entwickeln Lösungen für eigene Bedürfnisse,<br />
weil der Markt ihnen nichts Passendes bietet.<br />
Ein Beispiel ist das Mountainbike:<br />
Der US-Amerikaner Gary Fisher erfand in den<br />
1970er-Jahren ein stabiles Fahrrad, das auch die von<br />
ihm geliebten Bergab-Rennen überstand. Seit 1986<br />
wurde die Lead User Method vom MIT-Professor Eric<br />
von Hippel zu einer wissenschaftlich fundierten<br />
Innovationsmethode entwickelt. Heute befassen sich<br />
Forscher auf der ganzen Welt mit dem Phänomen<br />
der User Innovation, da es für kommerzielle<br />
Anbieter sehr interessant sein kann,<br />
besonders innovative Anwender<br />
frühzeitig aufzuspüren und<br />
mit ihnen zusammenzuarbeiten.<br />
Was ist ein<br />
Verkehrszeichen?<br />
Ein Verkehrszeichen ist laut<br />
Verwaltungsgerichtshof ein stabil<br />
angebrachtes Zeichen, „das auf einer<br />
Straße mit öffentlichem Verkehr angebracht<br />
und schon nach seiner<br />
gesamten Aufmachung<br />
dazu bestimmt ist, den<br />
Verkehr an dieser<br />
Straßenstelle<br />
zu regeln“. 2<br />
Wer erfand<br />
die Ampel?<br />
Das erste Patent für eine Ampel<br />
meldete der amerikanische Ingenieur<br />
Earnest Sirrine am 28.04.1910 an (Patent Nr.<br />
US 976 939 A). Wie so oft bei Erfindungen ist<br />
jedoch zweifelhaft, ob er tatsächlich der erste<br />
war. Denn bereits 1868 soll in London eine<br />
mechanische Gaslaternenanlage mit rotem und<br />
grünem Licht installiert worden sein. Unsere<br />
heutigen Verkehrslichtsignalanlagen sind jedenfalls<br />
standardisiert und unterliegen den<br />
Vorgaben der ÖNORM (z.B. ÖNORM<br />
V 2020 – Installation von Verkehrslichtsignalanlagen<br />
(VLSA) –<br />
Neubau, Umbau und<br />
Verlegung).<br />
Wozu eine<br />
Signalschau?<br />
Alle zwei Jahre wird behördlich<br />
überprüft, ob Einrichtungen,<br />
die zur Regelung und Sicherung<br />
des Verkehrs dienen (z.B. Verkehrszeichen,<br />
Ampeln), noch erforderlich<br />
sind. Dieser Vorgang wird als<br />
Signalschau bezeichnet und<br />
ist in §96 Abs 2 der StVO<br />
festgelegt.<br />
Mitarbeiter dieser Ausgabe Dipl-Bw. Maren Baaz, Margit Hurich, Mag. (FH) Christian Huter,<br />
Mag. Claudia Kesche, Mag. Uwe Mauch, MMag. Ursula Messner, Dr. Daniela Müller, Dr. Ruth<br />
Reitmeier, Martin Strubreiter, Mag. Fritz Pessl, Mag. Julia Schilly, Katrin Stehrer, BSc,<br />
Theresia Tasser, DI Anna Várdai, Silvia Wasserbacher-Schwarzer, BA, MA<br />
Grafikdesign, Illustrationen Drahtzieher Design & Kommunikation, Barbara Wais, MA<br />
Fotos Karin Feitzinger<br />
Korrektorat Mag. Christina Preiner, vice-verba<br />
Druck Hartpress<br />
Blattlinie Querspur ist das zweimal jährlich erscheinende Zukunftsmagazin des ÖAMTC.<br />
Ausgabe 04/2013, erschienen im Oktober 2013<br />
Download www.querspur.at
8<br />
10<br />
14<br />
25<br />
31<br />
4<br />
17<br />
20<br />
22<br />
26<br />
28<br />
Heute<br />
Die Regelbrecher<br />
Ob im Hausbau oder bei Versicherungen<br />
– wer unzufrieden mit bestehenden<br />
<strong>Regeln</strong> ist, muss neue schaffen.<br />
Von Uwe Mauch<br />
Keine Flamme ohne Rauch<br />
Wer <strong>Regeln</strong> hinterfragt, kann rasch<br />
auf Widerstand stoßen.<br />
Von Daniela Müller<br />
Weniger <strong>Regeln</strong>: Ein Vorteil<br />
Um in der Katastrophe einen kühlen<br />
Kopf zu bewahren, braucht es vor<br />
allem Menschen, denen man blind<br />
vertrauen kann. Gerry Foitik über<br />
das Management außergewöhnlicher<br />
Situationen.<br />
Von Fritz Pessl<br />
Bewegungsmuster<br />
Von Fußgängerströmen, flexiblen<br />
Verkehrsanzeigen und Flugzeugaus<br />
lastungssystemen.<br />
Von Ruth Reitmeier<br />
Unmissverständliche Signale<br />
Kleines Lexikon der internationalen<br />
Verkehrsregeln.<br />
Von Silvia Wasserbacher-Schwarzer<br />
Morgen<br />
Maschinengeflüster<br />
Das Internet der Dinge gibt Werkstoffen<br />
ein Gehirn: Sie wissen, was aus<br />
ihnen werden soll. Die Produktion<br />
der Zukunft steuert sich somit selbst.<br />
Von Ruth Reitmeier<br />
Weniger Grenzen, mehr Leben<br />
Was Design im Straßenraum verändert.<br />
Von Martin Strubreiter<br />
Start-ups<br />
Spannende Ideen zum Thema <strong>Regeln</strong>.<br />
Von Katrin Stehrer<br />
Spielregeln des Überlebens<br />
Schwarmintelligenz: Wenn Roboter<br />
von Ameisen lernen.<br />
Von Julia Schilly<br />
Mobilität kann man nicht in<br />
Kilometern messen<br />
Verkehrskonzepte als Veränderungsmotor<br />
einer Gesellschaft. Der Mobilitätsforscher<br />
Stephan Rammler im Interview.<br />
Von Daniela Müller<br />
Mit Hand und Fuß<br />
Künstliche Arme und Beine rücken<br />
dank fortschreitender Technologien<br />
immer näher an ihre natürlichen<br />
Vorbilder heran.<br />
Von Theresia Tasser<br />
10<br />
14<br />
4<br />
Foto: © festo.com Foto: © Karin Feitzinger<br />
Foto: © Rotes Kreuz Foto: © wavebreakmedia<br />
28<br />
<strong>Regeln</strong><br />
3
Maschinengeflüster<br />
Prozessor<br />
GPS<br />
Audio-In<br />
Interne Festplatte<br />
Optik<br />
Externe Lautsprecher<br />
Emotionsdisplay<br />
Audio-Out<br />
Umweltsondierung<br />
Sauerstoffansauger<br />
Treibtoffzufuhr<br />
Antriebsbatterie<br />
Steuerungselement<br />
Reproduktionseinheit<br />
Greifarm<br />
Steuerungselement<br />
Energieumwandler<br />
Feinsensorik<br />
Reproduktionseinheit<br />
Transportmechanismus<br />
4<br />
Temperatursensor<br />
Transportmechanismus<br />
Bodenbeschaffenheitsanalyse<br />
Foto: © Karin Feitzinger, Illustration: Barbara Wais
In der Produktion der Zukunft werden Materialien reden,<br />
Maschinen Teamfähigkeit beweisen müssen und Menschen bloSS<br />
noch dirigieren.<br />
Von Ruth Reitmeier<br />
Industrie 4.0 ist eines der ganz großen<br />
Schlagworte der Zukunft und<br />
steht ambitioniert für die vierte industrielle<br />
Revolution. Nach der Dampfmaschine,<br />
dem Fließband und dem<br />
Computer ist nun die Wertschöpfungskette<br />
im und über das Internet<br />
der Dinge & Dienste angekündigt.<br />
In der Fabrik der Zukunft denkt die<br />
Maschine und der Mensch lenkt –<br />
oder ist es umgekehrt?<br />
In diesem neuen Industriezeitalter<br />
werden Maschinenbau und Elektrotechnik<br />
mit Informationstechnologie<br />
verschmolzen und dabei entsteht<br />
eine hochgradig flexible Fertigung.<br />
Kunden werden Produkte zunehmend<br />
nach individuellen Wünschen bestellen,<br />
es wird eine Produktion von Sonderanfertigungen<br />
sein. Das ist quasi<br />
das Versprechen der Industrie 4.0,<br />
und dies erfordert eine völlig andere<br />
Art, Dinge herzustellen – in Fertigungsprozessen,<br />
die sich weitgehend<br />
selbst organisieren.<br />
Das Kunststück:<br />
Mehr Waren mit<br />
weniger Rohstoffen<br />
und Energie<br />
„Die Schwierigkeit liegt dabei nicht<br />
zuletzt in der Planung des Materiallagers“,<br />
betont Andreas Kamagaew,<br />
Abteilungsleiter für Automation und<br />
eingebettete Systeme am Fraunhofer-<br />
Institut für Materialfluss und Logistik<br />
(IML). Die smarte Produktion in der Industrie<br />
4.0 funktioniert nur im Zusammenspiel<br />
mit intelligenter Logistik und<br />
Materialwirtschaft, zumal in Zukunft<br />
immer mehr Waren mit weniger Ressourcen<br />
hergestellt werden müssen.<br />
Dass sich etwa die Autoproduktion<br />
grundlegend ändert, ist keine Idee<br />
von Technikverliebten, sondern eine<br />
Überlebensfrage für die Branche.<br />
„Der Paradigmenwechsel, getrieben<br />
durch die Ressourcenknappheit und<br />
die daraus resultierenden Veränderungen,<br />
wie zum Beispiel die E-Mobilität<br />
in der Antriebstechnik erfordern<br />
eine Neudefinition der Wertschöpfungsketten.<br />
Deshalb müssen wir uns<br />
von bestehenden Produktionsstrukturen<br />
verabschieden“, betont Thomas<br />
Bauernhansl, Leiter des Fraunhofer-<br />
Instituts für Produktionstechnik und<br />
Automatisierung IPA in Stuttgart.<br />
FlieSSband adé:<br />
Produktion ohne<br />
Takt und Linie<br />
Wie Pkw künftig gefertigt werden,<br />
wird im Forschungsprojekt Arena<br />
2036 an der Universität Stuttgart entwickelt.<br />
Im Jahr 2036 feiert das Auto<br />
seinen 150. Geburtstag. Termingerecht<br />
soll die Neuerfindung seiner<br />
Produktion stehen. Konkret: Es wird<br />
eine Autoproduktion ohne Takt, ohne<br />
Linie sein. Die Fahrzeuge werden in<br />
Leichtbauweise aus Sekundärrohstoffen<br />
(Recyclingprodukte) gefertigt<br />
werden. Der Pkw wird keine linearverkettete<br />
Produktion, sondern Sta -<br />
tionen durchlaufen – eigenständig.<br />
Deshalb wird das Auto zunächst<br />
auf Räder gestellt und mit Kommunika<br />
tions technologie ausgestattet werden.<br />
Das rollende Chassis wird sich<br />
selbst zu den einzelnen Produktionsstationen<br />
aufmachen und dort den Impuls<br />
zum weiteren Aufbau geben. Im<br />
Unterschied zur klassischen Produktion<br />
wird dies ein System sein, das<br />
rasch auf Änderungen reagieren kann.<br />
Jedes Fahrgestell<br />
kennt seinen<br />
Auftrag und baut<br />
sich selbst auf<br />
Das funktioniert freilich nur, wenn alle<br />
dafür benötigten Informationen vernetzt<br />
zugänglich sind. Im Internet der<br />
Dinge hat deshalb jedes Teil einen Informationsträger,<br />
auf dem seine spezifischen<br />
Daten gespeichert sind: Wo<br />
komme ich her, in welchem Zustand<br />
bin ich, was soll aus mir werden? Die<br />
Teile kommunizieren übers Internet in<br />
der Cloud mit Maschinen und Menschen,<br />
konfigurieren sich selbst und<br />
speichern laufend neue Informationen<br />
ab. Ganze Fabriken werden sich über<br />
ein Touchdisplay überwachen lassen.<br />
Bei vielen Herstellern löst der Blick in<br />
diese Zukunft Euphorie aus. „Unternehmer,<br />
mit denen ich persönlich gesprochen<br />
habe, erwarten Effizienzvorteile<br />
bis zu 50 Prozent“, betont Bauernhansl.<br />
Diese Produktion ist lean (schlank<br />
in der Produktion), clean, green (weil<br />
ressourcenschonend) und digitalisiert<br />
und das impliziert, dass sie schnell<br />
und fehlerfrei sowie enorm wettbewerbsfähig<br />
ist.<br />
Getrübt wird die Freude von Ängsten<br />
ob der Sicherheit der Daten, denn die<br />
Industrie 4.0 kommt nicht ohne IT-<br />
Cloud aus. Die Übertragung sensibler<br />
Daten in virtuelle Rechenzentren<br />
ist jedoch vielen Unternehmen nicht<br />
geheuer. Vertrauensvolle Anbieter<br />
<strong>Regeln</strong><br />
5
Abbildung: © DLR (CC-BY 3.0) Foto: © Annexrf, Collage: Barbara Wais<br />
Das Industriezeitalter 4.0 ist schon<br />
angebrochen: Im Internet der Dinge vernetzen<br />
sich Geräte untereinander – im Haushalt<br />
genauso wie in der Produktionshalle und<br />
beim Transport.<br />
Fortpflanzung inbegriffen: Software wird<br />
sich künftig selbstständig weiterentwickeln.<br />
Manche sprechen in diesem Zusammenhang<br />
nicht mehr von Revolution, sondern von Evolution.<br />
Die neue Rolle des Menschen: Er wird vom<br />
Fabriksarbeiter zum Dirigenten.<br />
sicherer Lösungen werden wohl eine<br />
Schlüsselrolle auf dem Weg ins neue<br />
Industriezeitalter spielen. Es gibt aber<br />
auch brancheninterne Hürden. Damit<br />
die Industrie 4.0 an Breite gewinnen<br />
kann, sich entfaltet und Zusammenarbeit<br />
möglich wird, werden sich Unternehmen<br />
weltweit auf gemeinsame<br />
Standards einlassen müssen.<br />
die neue rolle von<br />
fabriksarbeitern:<br />
wertschöpfungsketten<br />
dirigieren<br />
Wo aber bleibt der Mensch? Tritt er<br />
nur noch als Kunde in Erscheinung<br />
oder aber als der eine, der in der<br />
smarten Fabrik das Tablet in der<br />
Hand hat? Experten versichern, dass<br />
auch die intelligente Produktion nicht<br />
ohne Menschen auskommt, die Rolle<br />
des Fabrikarbeiters sich jedoch fundamental<br />
ändern wird. Statt Fließbandarbeit<br />
im Takt und an der Seite<br />
klobiger Roboterarme wird der<br />
Mensch in der smarten Fabrik primär<br />
Leitungs- und Kontrollfunktionen<br />
übernehmen.<br />
Die Familie wird<br />
öfters in die Fabrik<br />
kommen<br />
„Er wird nach wie vor im Mittelpunkt<br />
dieser Fabrik stehen. Er wird der Dirigent<br />
der Wertschöpfung sein“, meint<br />
Bauernhansl. Auch wenn es niemand<br />
ausspricht, wird die smarte Fabrik<br />
mit weniger Beschäftigten auskommen.<br />
Automatisierung bedeutet immer<br />
auch Rationalisierung.<br />
Mit der Industrie 4.0 kündigt sich laut<br />
Experten zudem eine Kehrtwende<br />
in der Standortwahl an. Nachdem es<br />
sich dabei um eine nachhaltige und<br />
saubere Produktion handelt, wird<br />
sich die Fabrik in der Nähe ihres Personals<br />
ansiedeln und das Zentrum ihres<br />
Lebens bilden. Das erspart den<br />
Mitarbeitern einerseits lange Wege<br />
zwischen Wohn- und Arbeitsort, zugleich<br />
werden die Grenzen zwischen<br />
Berufs- und Privatleben zunehmend<br />
verschwimmen und sich letzteres<br />
stärker an den Arbeitsplatz verlagern.<br />
Bauernhansl: „Die Familie wird künftig<br />
öfter in die Fabrik kommen. Urbane<br />
Produktion meint ja nicht zuletzt,<br />
dass die Unternehmen auch den Familien<br />
der Mitarbeiter etwas bieten.<br />
Wenn die Schulkinder beim Mittagessen<br />
in der Werkskantine den Eltern<br />
von der Mathearbeit erzählen<br />
und dann in der Nachmittagsbetreuung<br />
des Unternehmens ihre Hausaufgaben<br />
machen, werden die Eltern<br />
vielleicht noch motivierter und leistungsfähiger<br />
arbeiten, ohne wegen<br />
familiärer Anforderungen unter Druck<br />
zu geraten.“<br />
Die ersten smarten Fabriken werden<br />
in etwa zwölf Jahren zu besichtigen<br />
sein. Die Industrierevolution kommt<br />
also nicht über Nacht, es bleibt noch<br />
6
ein wenig Zeit, die Gesellschaft auf<br />
die Veränderungen vorzubereiten.<br />
Diese sollte keinesfalls ungenutzt<br />
verstreichen, betonen Technikphilosophen.<br />
Zumal die Bevölkerung den<br />
Wandel nur dann akzeptieren und<br />
mittragen wird, wenn sie in die Entscheidungen<br />
darüber eingebunden<br />
ist. Werde dies verabsäumt, könne<br />
es statt zur industriellen Revolution<br />
zu gesellschaftlichem Widerstand<br />
kommen. Nicht alle Involvierten verstehen<br />
Industrie 4.0 als Revolution,<br />
einige sprechen von Evolution. Wobei<br />
die Weiterentwicklung primär<br />
aus der IT kommt. Auf den Punkt gebracht:<br />
Software wird sich künftig eigenständig<br />
weiterentwickeln.<br />
Fahrzeuge suchen<br />
sich eigenständig<br />
Aufgaben und Wege<br />
Am praktischen Beispiel des Gepäck-Handling<br />
auf Flughäfen: Die<br />
Steuerung von Fördersystemen, zum<br />
Beispiel das Anlaufen der Förderbänder,<br />
funktioniert bereits heute weitgehend<br />
automatisiert. Das klappt wie<br />
geschmiert, es sei denn, der Flughafen<br />
wächst und die Förderkapazitäten<br />
für Gepäck geraten an ihre Grenzen.<br />
„Denn bevor das bestehende System<br />
auch nur um einen Meter Förderband<br />
erweitert wird, müssen zunächst<br />
zirka 300.000 Euro ins Programmieren<br />
der Software gesteckt werden“,<br />
betont Kamagaew. In Zukunft wird<br />
sich bei einer Verlängerung des Förderbandes<br />
dieses eigenständig an<br />
die neuen Gegebenheiten anpassen.<br />
Softwarelösungen werden also immer<br />
besser werden (müssen) und adaptiv<br />
reagieren. Konnten in früheren Forschungsprojekten<br />
fahrerlose Transportfahrzeuge<br />
nur entlang einer<br />
Magnetspur steuern, nehmen sie<br />
heute Umgebungsinformationen auf.<br />
Am Fraunhofer IML wuseln in einer<br />
großen Halle 50 solcher Fahrzeuge<br />
herum, suchen sich eigenständig ihre<br />
Aufgaben und Wege, ja rittern quasi<br />
um neue Jobs. Wer ihn bekommt,<br />
folgt klaren <strong>Regeln</strong>: Der Transporter<br />
mit dem kürzesten Weg und/oder<br />
dem vollsten Akku. Dieses System<br />
organisiert sich selbst, es sei denn,<br />
der Mensch greift ein und zieht einen<br />
bestimmten Auftrag vor. „Der Mensch<br />
und seine Entscheidung bleibt letztendlich<br />
wichtiger“, betont Kamagaew.<br />
Intelligente<br />
Kiste meldet<br />
ihren Füllzustand<br />
Eine smarte Logistiklösung, die bereits<br />
in Serie erzeugt wird, ist der intelligente<br />
Behälter inBin, eine Kooperation<br />
zwischen dem Fraunhofer IML<br />
und dem Würth-Konzern, Spezialist<br />
für Schrauben und kleine Montageteile.<br />
Die tolle Kiste verfügt über ein<br />
Display, Tasten, eine Funkschnittstelle<br />
sowie eine integrierte Kamera und<br />
beherrscht Energy Harvesting, das<br />
heißt sie ist energieautark. Im Behälter<br />
sind Zähl- und Bestellfunktion bereits<br />
integriert, der Füllstand aller in<br />
ihm befindlichen Artikel wird automatisch<br />
ans Warenwirtschaftssystem<br />
übermittelt. Geht eine Schraubenart<br />
zur Neige, bestellt das Behältnis<br />
selbst nach. Wird ein iBin gerade<br />
nicht gebraucht, erteilt es den Auftrag,<br />
abgeholt zu werden.<br />
Der intelligente Container kann eine<br />
kleine Kiste oder ein 40-Fuß-Container<br />
mit einem Volumen von 67 m 3<br />
sein, der Platz für mehr als 10.000<br />
Schuhkartons bieten würde. Auch<br />
Lufthansa Cargo entwickelt zurzeit<br />
die Containerlogistik in diese Richtung.<br />
„Man ist dadurch nicht mehr<br />
von einem übergeordneten System<br />
abhängig“, betont Kamagaew. Der<br />
Container selbst ist das System.<br />
Roboter scheitern<br />
am Griff in<br />
die Kiste<br />
Zwar fallen jeder Automatisierung als<br />
erstes die Routinejobs zum Opfer,<br />
doch es gibt nach wie vor Tätigkeiten,<br />
denen Maschinen einfach nicht gewachsen<br />
sind und für die man trotzdem<br />
keinen Hochschulabschluss<br />
braucht – etwa Dinge aus der iBin<br />
herauszunehmen. Roboter scheitern<br />
kläglich am gezielten Griff in die Kiste.<br />
„Es gibt eben kein universell einsetzbareres<br />
Werkzeug als den Menschen“,<br />
sagt Kamagaew. Der Mensch wird allerdings<br />
künftig durch die Unterstützung<br />
kluger, teamfähiger Maschinen<br />
viel produktiver arbeiten. Smarte Lieferketten<br />
und -systeme spielen naturgemäß<br />
im Transport von Frischware<br />
eine wichtige Rolle, vor allem dabei,<br />
die nach wie vor hohen Verluste zu reduzieren.<br />
Das passiert bereits heute,<br />
etwa wenn Bananen während ihrer<br />
Schiffsreise so kühl gelagert werden,<br />
dass sie nicht weiter reifen, und erst<br />
in der Lagerhalle am Zielort quasi<br />
„aufgeweckt“ werden.<br />
SMARTE LIEFERKETTE:<br />
DER REIFEGRAD von<br />
Obst ENTSCHEIDET<br />
ÜBER DEN ZIELORT<br />
Der Reifegrad von Obst wird an seinem<br />
Ethylenausstoß bemessen. Im<br />
Monitoring von Frischware liegt noch<br />
enormes Optimierungspotenzial.<br />
„Denn bis zu 50 Prozent davon kommt<br />
verdorben im Geschäft an und wird<br />
weggeworfen“, betont Christiane<br />
Auffermann, Expertin für Handelslogistik<br />
am Fraunhofer IML. Wird<br />
jedoch bereits in Spanien der Reifegrad<br />
der Tomaten gemessen, kann<br />
der Großhändler kurzfristig entscheiden,<br />
dass die Ware den Transport<br />
nach Österreich nicht frisch überstehen<br />
wird, und die Ladung stattdessen<br />
regional verkaufen.<br />
Auch in der Handelslogistik geht es<br />
also in Zukunft darum, flexibler, nachhaltiger<br />
und kosteneffizienter zu liefern.<br />
So arbeitet Auffermann aktuell an<br />
einem Projekt für drei deutsche<br />
Lebensmittelhandelskonzerne. Von<br />
einem gemeinsamen Hub aus werden<br />
umliegende Geschäfte mit Waren aller<br />
drei Anbieter beliefert. Damit wird<br />
nicht nur die Auslastung der Transportfahrzeuge<br />
erhöht, Touren können<br />
effizienter geplant werden, und das<br />
spart Zeit, Geld und Verkehr. •<br />
<strong>Regeln</strong><br />
7
USERSTORY<br />
Die, die es lieben,<br />
Konventionen zu<br />
brechen<br />
Fotos: linke Seite: © Günter Lang; rechte Seite: © Karin Feitzinger<br />
ÜBER ZWEI, DIE SICH NICHT MIT DEM<br />
IST-ZUSTAND IHRER WELT ZUFRIEDEN<br />
GEBEN WOLLTEN UND DAHER EINE<br />
EIGENE LÖSUNG SCHUFEN. Von Uwe Mauch<br />
Aktiv zum Passivhaus<br />
Alle waren skeptisch. Damals, 1999: Der Bürgermeister<br />
einer kleinen Salzkammergut-Gemeinde, weil er sich um das<br />
Ortsbild sorgte. Der Rauchfangkehrer, weil in seinem Weltbild<br />
kein Haus ohne Notkamin vorgesehen war. Die Kollegen<br />
des Bautechnikers, weil man einen kreisrunden Messestand<br />
nie und nimmer in ein Einfamilienhaus, noch dazu in ein Passivhaus,<br />
verwandeln kann. Die Fensterverkäufer bei diversen<br />
Energiesparmessen, weil sie die Frage nach einem Passivhaus-Fenster<br />
als die Frage eines Spinners abtaten. Und die<br />
Kostenrechner, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass<br />
man beim Ausbau eines Hauses mit bis zu 53 cm dicker Dämmung<br />
Geld sparen und Lebensqualität gewinnen kann.<br />
GÜNTER LANG, einer der ersten Passivhausbesitzer Österreichs<br />
und Gründer einer Passivhaus-Consultingagentur,<br />
lächelt zufrieden: „Ich war immer schon als Sturschädel bekannt.<br />
Erst wenn mir so viel Skepsis entgegenschlägt, weiß<br />
ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin.“<br />
Den richtigen Weg beschreibt Lang so: „Mein Haus hat<br />
nicht mehr gekostet als der Bau eines herkömmlichen Hauses.“<br />
Der Verzicht auf alle Gerätschaften und Räume, die<br />
man zum Heizen benötigt, habe sich vom ersten Tag an rentiert.<br />
Und die Lebensqualität? Er schwärmt: „Wir haben in<br />
Wien eine Wohnung. Beides probiert, kein Vergleich.“<br />
Faktum ist auch: Hätte er sich an die Konventionen gehalten,<br />
hätte er sein Haus nie bezogen, hätte er auch seine Consulting-Firma<br />
nicht gründen können.<br />
Viele sind skeptisch. Heute, 2013. Lang hat fertige Konzepte<br />
erarbeitet, wie man Österreich in ein Passivland verwandeln<br />
könnte, mit vielen Passivhäusern, die in Summe mit<br />
weniger statt mit noch mehr Kraftwerken betrieben werden<br />
könnten. Noch immer sieht er sich auf dem richtigen Weg.<br />
Heute sagt er: „Meine drei Söhne geben mir die Kraft, gegen<br />
die Widerstände weiter anzukämpfen.“<br />
www.langconsulting.at<br />
8
„Wir haben den Markt aufgemischt“<br />
Nein, sie passt nicht ins Bild: Wer in der Welt der Versicherungen<br />
das Sagen hat, kommt zu den Meetings,<br />
in denen es um Millionen geht, niemals mit dem Fahrrad.<br />
Und ist nie und nimmer eine zierliche, lockerselbstbewusst<br />
auftretende Frau.<br />
DIANA RADULOVSKI, mit ihren 27 Jahren schon eine<br />
Grande Dame in der hiesigen Versicherungswirtschaft, versichert<br />
mit einem ernsten Lächeln: „Ich liebe es, Konventionen<br />
zu brechen.“<br />
Liebe beruht auch auf eigenen Erfahrungen. Radulovskis Erfah<br />
rungen waren in ihrer Kindheit von Armutsphänomenen geprägt.<br />
Die Tochter eines Exportmanagers und einer Buchhalterin<br />
war zum Zeitpunkt des kommunistischen Zerfalls gerade<br />
fünf. „Aufgrund der Schließung vieler Staatsbetriebe haben<br />
mein Vater, meine Mutter, mein Opa, meine Oma und meine<br />
Tante ihre Arbeit verloren.“ Ihre Familie lebte dann von der Hand<br />
in den Mund. „Wir haben in unserem Garten Obst und Gemüse<br />
angebaut und die Ernte an unsere Nachbarn verkauft.“<br />
Ihre Eltern waren daher gar nicht begeistert, als sie in ihrer<br />
Tochter eine hochbegabte Schülerin sahen. Denn diese Schülerin<br />
hatte sich in den Kopf gesetzt, ein teures Elite-Gymnasium<br />
zu besuchen. Wer weiß, wo sie heute wäre, wenn sie den<br />
Worten ihres Vaters gefolgt wäre: „Diana, du wirst dich auch<br />
durchsetzen, wenn du in eine herkömmliche Schule gehst.“ Ist<br />
sie aber nicht, weil sie sich nicht zum duldsamen Menschen<br />
eignet. „Ich bin mit 13 von zu Hause ausgezogen.“<br />
Heute sind Dianas Eltern, die ihre letzten Lew für ihre Schulbildung<br />
ausgegeben haben, sehr stolz. Dabei hat es ihnen ihre<br />
Diana lange nicht leicht gemacht.<br />
Exemplarisch auch ihr Auszug nach Ägypten: „Bald nach der<br />
Matura konnte ich ein Semester mit einem Stipendium an der<br />
Universität in Klagenfurt studieren.“ Doch sie wollte länger<br />
studieren als ein Semester, was nicht finanzierbar war, und in<br />
Österreich arbeiten durfte sie damals auch nicht. Gegen den<br />
Willen ihrer Eltern flog sie daher als Animateurin einer großen<br />
Hotelkette ins ägyptische Hurghada. „Für mich war das wie<br />
ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Ich war gerade 19,<br />
durfte zum ersten Mal fliegen, und dann stand ich vor diesem<br />
beeindruckenden Hotelpalast.“<br />
Binnen kurzer Zeit stieg sie zur angesehenen Hotelmanagerin<br />
auf. Wichtiger war ihr jedoch ihre Ausbildung. Daher kam sie<br />
an die Wirtschaftsuniversität in Wien. Und musste erneut bei<br />
Null beginnen: „Ich war in jedem Geschäft in der Mariahilfer<br />
Straße und habe gefragt, ob es Arbeit für mich gibt.“ Es gab<br />
nichts, und aus heutiger Sicht ist das auch gut so.<br />
Während des Studiums, das sie in Mindestzeit abgeschlossen<br />
hat, lernte sie ihren Mann kennen, der damals bulgarischen<br />
Landsleuten Versicherungen verkaufte. Gemeinsam<br />
setzten die beiden ihre eigene Idee um: „Die unübersichtlichen,<br />
teils verwirrenden Angebote der großen und kleinen<br />
Versicherungen genau zu vergleichen und unsere Ergebnisse<br />
im Internet für alle zugänglich zu machen.“<br />
Inzwischen ist ihr Online-Portal versichern24.at gut etabliert.<br />
„Die Menschen, die bei uns die Angebote bequem vergleichen<br />
können, lieben uns.“ Die erstaunlich Erfolgreiche, die<br />
heute 15 Menschen – darunter auch ihrer Mutter – Arbeit geben<br />
kann, geht auch in die heutige Sitzung völlig entspannt.<br />
Sie weiß es, und auch die Herren in den Anzügen, von denen<br />
sie einer einmal um einen Kaffee schicken wollte, wissen es<br />
längst: „Keiner hat an die Idee, über das Internet Versicherungen<br />
zu verkaufen, geglaubt. Die Bank wollte uns erst gar<br />
keinen Kredit geben. Inzwischen kooperieren die meisten<br />
Unternehmen mit uns. Wir haben den Markt aufgemischt.“<br />
Schon hat Diana Radulovski ein zweites Portal eröffnet. Dort<br />
vergleichen ihre Leute die Preisunterschiede der Strom- und<br />
Gas-Anbieter. Was sie sonst noch vor hat, will die unkonventionelle<br />
Unternehmerin noch nicht laut sagen. Wir dürfen gespannt<br />
sein, und Versicherer und Energie-Anbieter sollten<br />
sich schon einmal warm anziehen.<br />
www.versichern24.at<br />
www.stromgas24.at<br />
<strong>Regeln</strong><br />
9
10<br />
Foto: © Karin Feitzinger
Keine<br />
Flamme<br />
ohne Rauch<br />
Das Wiener Schnitzel ist paniert, das Mailänder wird mit<br />
Spaghetti serviert. Konventionen regeln das Leben.<br />
Doch muss man diese, beim Kochen wie auch sonst im Leben,<br />
wirklich befolgen? Von Daniela Müller<br />
Menschen befolgen <strong>Regeln</strong>. Beim<br />
Autofahren, beim Arbeiten, beim<br />
Kochen. Schert jedoch einer aus, kann<br />
das ungemütlich werden: Der Koch<br />
Bernhard Gössnitzer aus Eggelsberg<br />
in Oberösterreich weiß darüber<br />
eine Geschichte zu erzählen. Sie beschreibt,<br />
wie heftig die Sanktionen der<br />
Gesellschaft nach dem Ausbruch aus<br />
dem Geordneten sein können. Und<br />
wie wichtig es manchmal dennoch ist,<br />
<strong>Regeln</strong> zu brechen.<br />
Bernhard Gössnitzer kann kochen.<br />
Auf sehr hohem Niveau. In sein kleines<br />
Wirtshaus im Innviertel strömten<br />
gleich zu Beginn seiner Karriere viele<br />
Genussmenschen, die seine Küche<br />
zu schätzen wussten. Darunter auch<br />
Gourmetführer, die ihm bald eine<br />
Haube aufsetzten. Auf der Straße zum<br />
Erfolg missfiel ihm jedoch eines ganz<br />
arg: Der Hummer-Gourmet-Hype<br />
der 90er-Jahre. Als er an eine große<br />
Tageszeitung einen Leserbrief schrieb,<br />
in dem er die Tierquälerei bei der Zubereitung<br />
von Hummer anprangerte<br />
– Hummer werden lebend gekocht –,<br />
kam postwendend ein Brief vom großen<br />
Gourmetführer, der ihn gerade<br />
auf den Thron gehoben hatte, in dem<br />
er den Revoluzzer zur Ordnung rief.<br />
Daraufhin gab Gössnitzer seine<br />
Haube zurück und entsagte sich<br />
fortan jeglicher Kochbewertung<br />
durch Gourmetführer. Seine eigenen<br />
moralischen Vorstellungen in Bezug<br />
auf Tierschutz waren ihm wichtiger<br />
als das Urteil der Gourmetkritiker.<br />
Seit diesem Schlüsselerlebnis definiert<br />
er seine Küche strikt nach seinen<br />
eigenen Vorstellungen und fährt,<br />
gemessen am Zuspruch seiner Gäste,<br />
gut damit.<br />
TROTZ REGELBRUCHs<br />
EIN GUTES GESCHÄFT<br />
<strong>Regeln</strong> sind dazu da, gebrochen zu<br />
werden, besagt ein Sprichwort. Doch<br />
ganz so leicht ist es nicht: Vorschriften<br />
werden in den meisten Systemen<br />
und Gesellschaften nur selten infrage<br />
gestellt, der Mensch wird in<br />
das Regelwerk hineingeboren. „Eine<br />
Ordnung lebt davon, dass sie nicht als<br />
Ordnung thematisiert wird“, sagt der<br />
Soziologe Stephan Lessenich von der<br />
Universität Jena.<br />
Schließlich haben <strong>Regeln</strong> wichtige<br />
Funktionen für das Leben in der<br />
Gemeinschaft: Sie geben vor, wie<br />
sich die Mitglieder einer Gesellschaft<br />
verhalten müssen (Gesetze), sollen<br />
(Sitten) oder können (Gebräuche und<br />
Gewohnheiten).<br />
DER NATÜRLICHEN<br />
UNORDNUNG<br />
einen Riegel<br />
vorschieben<br />
Da sie für alle Mitglieder bindend<br />
sind und das Verhalten wechselseitig<br />
kalkulierbar machen, sorgen sie für<br />
Ordnung und Stabilität und damit für<br />
Handlungssicherheit: Der Einzelne<br />
kann dann allerdings nicht mehr machen,<br />
was er will. Doch er weiß, dass<br />
sich auch die anderen an die Normen<br />
zu halten haben. Nur so ist eine Gesellschaft<br />
des Gemeinwohls möglich,<br />
indem beispielsweise Steuern und<br />
Sozialbeträge fraglos bezahlt werden.<br />
„Mit gewissen ungleichen Voraussetzungen<br />
muss eine Gesellschaft im<br />
Wohlfahrtsstaat einfach leben, dass<br />
also manche mehr aus dem System<br />
nehmen als sie einbringen“, erklärt<br />
<strong>Regeln</strong><br />
11
Foto: © wavebreakmedia<br />
Raus aus dem Silo einer Fachkarriere: Immer mehr Menschen orientieren sich beruflich um und starten etwas Neues. Solche Patchwork-<br />
Karrieren werden heute noch vielfach als Verstoß gegen gesellschaftliche Konventionen gesehen. Doch das wird sich ändern.<br />
Lessenich, „Es ist wie im Straßenverkehr.<br />
Ich muss vertrauen, dass der<br />
andere nicht ohne Vorwarnung die<br />
Spur wechselt.“<br />
An sozialen Verhaltensvorschriften<br />
können wir ablesen, was einer Gesellschaft<br />
wichtig ist. Problematisch<br />
wird es allerdings, wenn die Gruppe<br />
der Regelbrecher zu klein wird. Dann<br />
herrscht zu viel Erstarrung und passiert<br />
zu wenig Fortschritt. Und auch<br />
umgekehrt: Gibt es zu viele Regelbrecher,<br />
können Systeme kippen. Wenn<br />
sich zum Beispiel mehr Menschen aus<br />
(sozialen) Versicherungssystemen bedienen,<br />
als es Einzahler gibt.<br />
Für das Gemeinwohl sei es wichtig,<br />
möglichst vielfältige Gruppen in einer<br />
großen Sicherheitsgemeinschaft<br />
zusammenzuschließen und die Risiken<br />
auszugleichen, ist der Soziologe<br />
überzeugt. Das kann allerdings neue<br />
Vorschriften und Beschränkungen<br />
bedeuten. Und auch neue Sanktionen<br />
bringen: Weil es von der Gesellschaft<br />
nicht in jedem Kontext goutiert wird,<br />
sein eigenes Süppchen zu kochen,<br />
werden Regelbrecher bestraft. Die<br />
Geldstrafe für jene, die bei Rot über<br />
die Ampel fahren, Haftstrafen für Gewalttäter<br />
oder eben den erzwungenen<br />
oder freiwilligen Ausstieg aus einer<br />
Gemeinschaft bei Ungehorsam.<br />
Erwünschtes<br />
Verhalten wird von<br />
der Mittelschicht<br />
diktiert<br />
Sanktionen verfolgen zwei Ziele: Einerseits<br />
sollen sie Regelbrecher für<br />
ihr Vergehen bestrafen, gleichzeitig<br />
aber der Gemeinschaft auch zeigen,<br />
was passiert, wenn man aus der Reihe<br />
tanzt. Das betraf auch den Koch.<br />
Wo es nur um Gewohnheiten oder<br />
Gebräuche geht und nicht um Gesetze,<br />
bestimmen informelle <strong>Regeln</strong>,<br />
wie das erwünschte Verhalten aussehen<br />
soll. Festgelegt werden diese<br />
übrigens in den westlichen Gesellschaften<br />
meist von der Mittelschicht:<br />
Diese gibt seit den 1950er-Jahren vor,<br />
wie und wann man heiratet, wie und<br />
wo man wohnt, zur Miete oder im<br />
Eigentum, welche Jobs hochwertig<br />
sind und welche minderwertig. Die<br />
Mittelschicht ist die am häufigsten<br />
angestrebte Lebensform, zu der sich<br />
immerhin 80 Prozent der westlichen<br />
Bevölkerung zugehörig fühlen. Und<br />
weil viele Menschen dieser Schicht<br />
angehören wollen, handeln sie, wie<br />
man es eben sollte. Essen, was gerade<br />
angesagt ist. Unbewusst oder<br />
bewusst.<br />
„Viele Diktate der Gesellschaft muss<br />
man hinnehmen, wenn auch zähneknirschend.<br />
Wir leben eben auf<br />
Geleisen, die wenig Fußmärsche und<br />
Abseits-Tingeltangel zulassen“, sagt<br />
der Koch Bernhard Gössnitzer.<br />
12
Foto: ©Christoph Wisser<br />
Weg vom Massenstandard, hin zum Individualismus: In Sportarten wie dem Parkour ist es Programm, die Grenzen des Möglichen von<br />
Mensch und Umgebung auszuloten und damit für sich selbst neue <strong>Regeln</strong> zu definieren.<br />
Die Grenzen der Freiheit<br />
Freiheit versus Regelvielfalt ist wie Yin und Yang, das eine braucht<br />
das andere. Das Gegensatzpaar wechselt sich in der Gesellschaft in<br />
regelmäßigen Zyklen ab, zuletzt kam nach der großen Freiheitsliebe<br />
der 1960er- und 1970er-Jahre eine neokonservative Gegenbewegung.<br />
Individueller als vor wenigen Jahrzehnten sind heute tendenziell<br />
die persönlichen Biografien, weil im Leben mehr Entscheidungen als<br />
früher getroffen werden müssen. Parallel dazu nehmen Meinungsmacher<br />
wiederum Standardisierungen in der Mode, bei Musikstilen und<br />
in der Freizeitbeschäftigung vor – mit klaren Anweisungen, was hip ist<br />
und bei den anderen angeblich gut ankommt. Standardisierungen und<br />
eine gewisse Konformität sind auch bei Lebenswegentscheidungen<br />
zu finden, etwa welche Bildungszertifikate man erwirbt oder ob man<br />
ein Auslandssemester absolviert. Tut man das nicht, gibt es Sanktionen:<br />
Ein Schulabbruch schließt einen beispielsweise von bestimmten<br />
Arbeitsmarktsegmenten aus. Individualismus und Konformität sind somit<br />
stets ein Wechselspiel. Doch sobald im gesellschaftlichen Kontext<br />
gedacht wird, ist ein System ohne <strong>Regeln</strong> ohnehin nicht denkbar.<br />
Das sagte schon vor über hundert Jahren der französische Soziologe<br />
Émile Durkheim. Unbeschränkte Freiheit sei unmöglich. Die eigene<br />
beginne nämlich dort, wo die Freiheit des anderen aufhöre. Oder um<br />
es mit Rosa Luxemburg auszudrücken: „Freiheit ist immer Freiheit der<br />
Andersdenkenden.“<br />
Wird etwas nur<br />
gemacht, weil es<br />
schon immer so<br />
war?<br />
Lob gibt es für Regelbrecher oder<br />
solche, die <strong>Regeln</strong> hinterfragen,<br />
nämlich kaum. Dabei wären sie ein<br />
wichtiger Motor des Fortschritts: So<br />
lange eine Gesellschaft nicht über die<br />
bestehende Ordnung diskutiere, fänden<br />
kaum Veränderungen statt, betont<br />
Lessenich. Meist werde dieser Prozess<br />
von Wissenschaftern und Forschern<br />
ausgelöst, die als Warnmelder fungierten.<br />
Allerdings brauche Veränderung<br />
ihre Zeit: Der Soziologe ist überzeugt,<br />
dass ein zu frühes Eingreifen – im<br />
Sinn einer Veränderung der Spielregeln<br />
– in den meisten Fällen nur<br />
Widerstand wecke, etwa wenn man<br />
aufgrund der Erkenntnis, dass CO 2<br />
zu Umweltproblemen führt, nur mehr<br />
Drei-Liter-Autos zulassen würde.<br />
Die Zeit für neue <strong>Regeln</strong> kommt meist<br />
erst dann, wenn in einer breiteren<br />
Bevölkerungsschicht thematisiert und<br />
wahrgenommen wird, dass ein kollektives<br />
Problem besteht, etwa wenn<br />
die Folgen von ungebremstem CO 2<br />
-<br />
Ausstoß wirklich nicht mehr geleugnet<br />
werden können. Das macht es auch<br />
der Politik so schwer, vorausschauender<br />
zu agieren. Wobei in den meisten<br />
Fällen im Nachhinein klar werde, dass<br />
die Diagnose sogar zu spät erfolgte,<br />
beobachtet der Soziologe Lessenich.<br />
Doch das sei nun einmal die Logik des<br />
Sozia len. Rechtzeitiges Ausbrechen<br />
funktioniert nur dann, wenn viele<br />
Menschen bedenkliche <strong>Regeln</strong> früher<br />
hinterfragen. Veränderung durch<br />
Nachfragen, was man unter <strong>Regeln</strong><br />
überhaupt versteht und wie sie zustande<br />
gekommen sind, sei ein großer<br />
Schritt vorwärts, sagt der Soziologe<br />
Lessenich. „Wird etwas gemacht, weil<br />
es schon immer so gemacht wurde?<br />
Kennedy hat nicht<br />
den einfachsten Weg<br />
gewählt – weil er<br />
etwas bewegen<br />
wollte<br />
Oder kann man mitbestimmen? Das<br />
wäre Demokratie.“ Der unreflektierte<br />
Umgang mit <strong>Regeln</strong>, bloßes Mit- und<br />
Nachmachen ist auch für Gössnitzer<br />
ein Greuel. Die Welt wäre mehr in<br />
Ordnung, würde jeder seine Gedanken<br />
dort einsetzen, wo sie für die<br />
ganze Gesellschaft nützlich werden<br />
könnten. „J.F. Kennedy hat es mit<br />
folgendem Spruch schön beschrieben:<br />
„We choose to go to the moon in this<br />
decade and do the other things. Not<br />
because they are easy, but because<br />
they are hard.“ Das Einfache im Leben<br />
ist nicht immer der einfachste<br />
Weg, doch es sei wichtig, seinen eigenen<br />
Weg zu finden und zu gehen.<br />
•<br />
<strong>Regeln</strong><br />
13
„Wenige formale <strong>Regeln</strong><br />
sind ein großer Vorteil“<br />
Foto: © Rotes Kreuz<br />
Was gibt in der Katastrophe Sicherheit?<br />
Entscheidend seien Sozialkapital und rasche Information,<br />
die in Zukunft vermehrt von den Bürgern kommen werde,<br />
sagt Bundesrettungskommandant Gerry Foitik. Von Fritz Pessl<br />
Sie sind seit 2007 oberster Einsatzkoordinator<br />
des Roten Kreuzes.<br />
Welche Eigenschaften muss ein<br />
guter Katastrophenmanager<br />
mitbringen?<br />
Er muss sein Handwerk beherrschen, gut<br />
kommunizieren und darf keine Scheu<br />
haben, seine Stärken und Schwächen zu<br />
offenbaren. Und Entscheidungsstärke,<br />
das heißt, mit unsicheren Informationen<br />
rasch zu entscheiden. Den Mitarbeitern<br />
vor Ort muss das Gefühl vermittelt werden,<br />
dass jemand da ist, der die Situation<br />
im Blick hat.<br />
Im Katastrophenmanagement findet<br />
man nur wenige Frauen. Warum ist<br />
dieser Beruf so männerdominiert?<br />
Das ist aus der Tradition erklärbar. Bis<br />
vor zehn Jahren waren wenige Frauen<br />
bei den Notorganisationen tätig. Beim<br />
Roten Kreuz haben Frauen im Rettungsdienst<br />
stark aufgeholt, einige sind schon<br />
Kata strophenmanagerinnen. Sie sind<br />
aber noch immer unterrepräsentiert.<br />
Gibt es etwas, das Frauen im Katastrophenmanagement<br />
besser machen als<br />
Männer?<br />
Die Stärke von Frauen ist, dass sie offener<br />
kommunizieren. Sie senden mehr Ich-<br />
Botschaften, ohne gleich zu befürchten,<br />
das könnte als Schwäche ausgelegt werden.<br />
Aber das ist der einzige Unterschied und<br />
der ist marginal. In den meisten Fällen<br />
würde mir nicht auffallen, ob eine Einheit<br />
von einer Frau oder einem Mann geführt<br />
wird.<br />
Nach welchen <strong>Regeln</strong> funktioniert das<br />
Management von Katastrophen?<br />
Grundsätzlich dienen <strong>Regeln</strong> dazu,<br />
für Menschen, die einander nicht oder<br />
14
Foto: © Rotes Kreuz<br />
Ein großer Raum mit vielen Monitoren, Pinwänden, Telefonen und dicht<br />
aneinander gestellten Schreibtischen, damit Informationen schnell dort<br />
hinkommen, wo sie gebraucht werden: Die Katastropheneinsatzzentrale<br />
ist Gerry Foitiks Arbeitsplatz. Er ist Bundesrettungskommandant des Österreichischen<br />
Roten Kreuzes und verantwortlich für das länderübergreifende<br />
strategische Katastrophenmanagement, das er mit einem bis zu<br />
20 Personen umfassenden Führungsstab koordiniert. Zu den letzten großen<br />
Einsätzen, die der 43-jährige Betriebswirt leitete, zählen das Schneechaos<br />
in Ungarn im März 2013 und das Hochwasser im vergangenen Sommer,<br />
bei denen mehrere Hundert Hilfskräfte unter seiner Verantwortung agierten.<br />
nicht gut kennen, klare Rollen- und<br />
Kompetenz verteilungen zu treffen. Und<br />
transparent zu machen, damit jeder weiß,<br />
was seine Aufgabe ist und was er sich<br />
von anderen erwarten kann. In der Praxis<br />
haben wir Rahmengesetze, welche die<br />
Kompetenz an Fachdienste wie Feuerwehr,<br />
Rotes Kreuz und Polizei übertragen.<br />
Dabei ist nicht exakt definiert, wie<br />
eine Menschenrettung oder eine Bergung<br />
durchzuführen sind. Im Vergleich<br />
zu Deutschland ist in Österreich extrem<br />
wenig formal geregelt. Das ist ein großer<br />
Vorteil.<br />
Wenig <strong>Regeln</strong> und<br />
starker Föderalismus<br />
führen zu<br />
Schlagkraft<br />
Warum?<br />
Es ist ein Vorteil, weil die Experten damit<br />
vor Ort angepasst auf die Situation reagieren<br />
können. Die Kombination aus geringem<br />
Regelungsgrad und stark ausgeprägtem<br />
Föderalismus führt zu einem sehr<br />
schlagkräftigen System, weil Feuerwehrund<br />
Bezirksrettungskommandanten nicht<br />
lange in irgendeiner Zentrale fragen müssen,<br />
ob sie etwas machen dürfen. In<br />
Österreich werden Entscheidungen rasch<br />
und schadensnah getroffen. Formale<br />
<strong>Regeln</strong> werden ersetzt durch gute persönliche<br />
Bekanntschaft der Experten,<br />
die während der vielen Übungen und<br />
Trainings entstehen. Wir wissen, dass wir<br />
uns blind aufeinander verlassen können.<br />
Sie sagen, in Deutschland sei die Katastrophenhilfe<br />
formal viel strenger geregelt.<br />
Welches System funktioniert besser?<br />
Beide Länder sind gut vorbereitet. Die<br />
Deutschen produzieren viel Papier, auf<br />
dem viele Abläufe genau geregelt sind,<br />
man kann gut nachschauen und nach diesem<br />
Schema trainieren. In Österreich hat<br />
man wenig Papier, man entscheidet mehr<br />
in der Situation. Dafür gibt es viel an gemeinsamer<br />
Tradition, Anerkennung des<br />
Expertenwissens des anderen und die persönliche<br />
Bekanntschaft. Zwischen Feuerwehr<br />
und Rotem Kreuz bedarf es keiner<br />
Formalitäten, es genügt ein Anruf. Die<br />
Schwäche unseres Systems ist, dass fehlende<br />
formale Abläufe einzelne Schritte<br />
nicht mehr genau nachvollziehbar machen.<br />
Wir machen das aber durch gute<br />
Dokumentation wett.<br />
Gehen wir von einem Massenunfall<br />
in einem Tunnel aus. Wie werden<br />
Rettungssysteme in einer unvorhergesehenen<br />
Situation zum Laufen<br />
gebracht?<br />
Mit dem Eingehen eines Notrufes bei<br />
einer Leitstelle werden automatisch alle<br />
Einsatzorganisationen informiert. Die<br />
Menschenrettung aus dem Tunnel ist<br />
Sache der Feuerwehr. Sache der Rettung<br />
ist es, die Verunglückten an einem Übergabepunkt<br />
außerhalb des Gefahrenbereiches<br />
entgegenzunehmen und zu<br />
versorgen. Aufgabe der Polizei ist es, den<br />
Gefahrenbereich abzusichern und Schaulustige<br />
fernzuhalten.<br />
Wichtig ist, die Chaosphase<br />
möglichst kurz<br />
zu halten<br />
… damit in einer Phase großer<br />
Unsicherheit alles seinen geregelten<br />
Lauf nehmen kann.<br />
Ja, denn jedes Ereignis hat eine unterschiedlich<br />
lange Chaosphase mit großer<br />
Unsicherheit. Diese besteht hauptsächlich<br />
aufgrund mangelnder Information.<br />
Ziel ist es, sich in sehr kurzer Zeit einen<br />
Überblick über die Situation zu verschaffen.<br />
Und natürlich werden bei jedem Massenunfall<br />
auch Prozesse abgearbeitet, die<br />
in den Organisationen standardisiert sind.<br />
Diese Einsatzpläne sind zwischen den<br />
Hilfsorganisationen abgestimmt. Man<br />
kann sich das vorstellen, wie gemeinsames<br />
Kochen. Beim ersten Mal wird man<br />
viel miteinander reden müssen, damit bei<br />
einem Vier-Gänge-Menü kein Chaos ausbricht.<br />
Beim fünften Mal kennt jeder seine<br />
Aufgaben. Aber das Rezept muss sitzen,<br />
nach dem jeder sein Gericht kocht.<br />
Gibt es Unterschiede zwischen längeren<br />
Einsätzen und kürzeren Noteinsätzen?<br />
Bei längeren zum Beispiel auch grenz-<br />
<strong>Regeln</strong><br />
15
Foto: © Rotes Kreuz<br />
Im Katastrophenfall ist entscheidend, den Mitarbeitern vor Ort das Gefühl zu vermitteln, dass jemand da ist, der die<br />
Situation im Griff hat. Die immer besser werdenden Möglichkeiten elektronischer Datenverknüpfung werden künftig bei<br />
Einsätzen eine große Rolle spielen.<br />
überschreitenden Einsätzen, wo mehr<br />
Organisationen und oft auch Regierungen<br />
anderer Länder eingebunden sind, wird<br />
der Kommunikationsaufwand intensiver.<br />
Der Ablauf für die einzelnen Hilfskräfte<br />
und Kommandogeber selbst unterscheidet<br />
sich nicht.<br />
DAS AMERIKANISCHE<br />
ROTE KREUZ NUTZT<br />
SOCIAL MEDIA SCHON<br />
SYSTEMATISCH<br />
Was bestimmt den Erfolg des Katastrophenmanagements,<br />
sind <strong>Regeln</strong> die<br />
entscheidende Komponente?<br />
Nein. Entscheidend ist, die eigene Aufgabe<br />
gut zu beherrschen und richtig zu<br />
kommunizieren. Zudem ist wesentlich,<br />
dass die Bürger selbst gut vorbereitet<br />
sind. Weil sie in einer Katastrophe<br />
länger als sonst üblich auf sich allein<br />
gestellt sind. Die staatliche Katastrophenhilfe<br />
kann nicht überall gleichzeitig sein,<br />
diese Ressourcen gibt es nicht. Daher<br />
müssen Haushalte und Unternehmen<br />
vorsorgen: Lebensmittel und Medikamente<br />
bunkern beziehungsweise Notfallpläne<br />
parat haben. Das ist oft der<br />
entscheidende Faktor.<br />
Können moderne Technologien bei<br />
Katastropheneinsätzen helfen?<br />
Ganz wesentlich sind Technologien, die<br />
der Bevölkerung zur Verfügung stehen.<br />
Wir können uns mit den Facebook-Fotos,<br />
die Menschen zum Beispiel bei einer Naturkatastrophe<br />
innerhalb von Minuten<br />
online stellen, sehr schnell ein Bild des<br />
Ausmaßes der Katastrophe machen.<br />
Beim letzten Hochwasser haben uns tausende<br />
Fotos gezeigt, wo es in Österreich<br />
wie schlimm aussieht. Wir müssen aber<br />
erst lernen, diesen Kanal zu den Menschen<br />
systematisch zu nutzen. Das amerikanische<br />
Rote Kreuz hat bereits einen<br />
eigenen Social Media Room, wo diese<br />
Gruppen den ganzen Tag beobachtet und<br />
online betreut werden.<br />
vorhandenen<br />
Datenmengen zu<br />
verknüpfen wäre<br />
ein groSSer Sprung<br />
nach vorne<br />
Und abseits des Internets?<br />
Wir (das Rote Kreuz, Anm.) überlegen,<br />
wie wir das gesamte Videoüberwachungssystem<br />
im öffentlichen Raum für Zwecke<br />
der Katastrophenhilfe nutzen könnten.<br />
Um festzustellen, wie viele Personen in<br />
einem U-Bahn-Zug sind. Oder mit einem<br />
Video bild die Körpertemperatur der Menschen<br />
messen, um festzustellen, ob eventuell<br />
eine Grippeepidemie im Anmarsch ist.<br />
Roboter beziehungsweise Drohnen sind<br />
derzeit in aller Munde, auch in Ihrem<br />
Bereich?<br />
Roboter sind immer dort sehr nützlich,<br />
wo es zu gefährlich ist, Menschen hinzuschicken.<br />
Drohnen bringen den Vorteil,<br />
dass sie einen Lageüberblick verschaffen.<br />
Sie werden gelegentlich auch schon<br />
eingesetzt, um Kameras in Positionen zu<br />
bringen, die sonst nicht erreichbar wären.<br />
Drohnen könnten auch als Relaisfunkstationen<br />
genutzt werden. Das bedeutet, dass<br />
sie Funk auch in funkfreien Zonen ermöglichen,<br />
weil das Signal von der Luft<br />
aus empfangen werden kann.<br />
Gibt es etwas, was das bisherige<br />
Katastrophenmanagement<br />
revolutionieren könnte?<br />
In technischer Hinsicht wird entscheidend<br />
sein, die vorhandenen Datenmengen, die<br />
Verkehrsbetriebe mit der U-Bahnüberwachung,<br />
Banken oder Handybetreiber<br />
schon gesammelt haben, für den Einsatzfall<br />
zu verknüpfen und schneller verfügbar<br />
zu machen. Damit könnten wir zum<br />
Beispiel binnen Minuten wissen, wie viele<br />
Passagiere sich in einem brennenden<br />
U-Bahn-Zug befinden. Solche Systeme<br />
zu nutzen lernen wir – gerade zum<br />
Wohle der Menschen.<br />
•<br />
16
Weniger Grenzen,<br />
mehr Leben<br />
Foto: © Karin Feitzinger<br />
Weniger Verkehrszeichen und geringere Geschwindigkeiten,<br />
mehr FuSSgänger und flüssigeres Fortkommen:<br />
Gemeinschaftsstrassen erweitern die Möglichkeiten<br />
im ohnehin knappen öffentlichen Raum.<br />
Von Martin Strubreiter<br />
Den norddeutschen Ort Bohmte<br />
durchqueren täglich mehr als 12.000<br />
Fahrzeuge, davon 1.000 LKW. Denn<br />
die 400-Meter lange L81 führt mitten<br />
durch den 13.000-Einwohner-<br />
Ort. Ampeln und Verkehrsschilder<br />
sucht man jedoch vergebens, denn<br />
der Schilderwald wurde mit der Einrichtung<br />
eines Shared Space bereits<br />
2008 gelichtet.<br />
Dadurch wurde der Verkehrsfluss<br />
verbessert und den Menschen in<br />
der Kleinstadt mehr Lebensqualität<br />
er möglicht, Dauerlärm und starke<br />
Schadstoffbelastung gehören der<br />
Vergangenheit an. Intelligentes Design<br />
statt Gebots- und Verbotstafeln<br />
ist seither die Devise. In ihrer Funktion<br />
seien Verkehrsschilder ohnedies nur<br />
zweite Wahl, wie Verkehrspsychologin<br />
und Universitätslektorin Lilo<br />
Schmidt weiß: „Verkehrsschilder<br />
müssen kognitiv erfasst werden, also<br />
durch kurzes Nachdenken, während<br />
beispielsweise Bodenmarkierungen<br />
und Fahrbahngestaltung intuitiv und<br />
daher viel direkter und schneller wirken.“<br />
Die Fahrbahn sagt einem quasi<br />
während des Fahrens ein, wie man<br />
sich verhalten soll. Ein potenzielles<br />
<strong>Regeln</strong><br />
17
Foto: © gehlarchitects.com<br />
Unterschiedliche Konzepte und Namen<br />
Viele Namen sind im Umlauf, um die von allen Verkehrsteilnehmern benützte<br />
Flächen zu beschreiben, zum Beispiel:<br />
Das Shared-Space-Konzept, am niederländischen Keuning Instituut<br />
unter Hans Mondermann erarbeitet, ist mittlerweile ein eingetragenes<br />
Markenzeichen. Die ersten Ansätze kamen völlig ohne Verkehrszeichen,<br />
Bodenmarkierungen oder Ampeln aus.<br />
Das Berner Modell setzt auf Koexistenz statt Dominanz, alle Beteiligten<br />
erarbeiten die optimale Lösung gemeinsam. Ziel ist Vermeidung<br />
und Verlagerung von KFZ-Verkehr und die verträgliche Abwicklung<br />
des verbleibenden Verkehrs.<br />
In Begegnungszonen sind Fußgänger und Radfahrer zum Benutzen<br />
der gesamten Verkehrsfläche befugt und gegenüber anderen Fahrzeugen<br />
mit Ausnahme der Straßenbahn im Vorrang. Dieser ursprünglich<br />
in der Schweiz definierte Begriff wird derzeit auch in Österreich<br />
so verwendet.<br />
In Koexistenz- und Mischverkehrszonen ist die Geschwindigkeit<br />
auf 30 km/h beschränkt, Autofahrer und Fußgänger teilen sich die Verkehrsfläche<br />
in verträglichem Miteinander.<br />
Der Versuch, alle diese Flächen mit einer einheitlichen Definition und<br />
einheitlichen Rechten und Pflichten zusammenzufassen, führt zum<br />
Vorschlag des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, den Überbegriff<br />
„Gemeinschaftsstraßen“ einzuführen.<br />
Im Bild: Das Projekt New Road in Brighton, Großbritannien<br />
Zukunftsmodell also, weil der Lernprozess<br />
der Nutzer viel kürzer ist. Es<br />
ist wie mit leicht bedien baren Smartphones,<br />
Homepages oder dem von<br />
Regalen geleiteten Weg durch den<br />
Supermarkt: Was intuitiv erfasst wird,<br />
braucht keinen kognitiven Zwischenschritt<br />
und erschließt sich schneller.<br />
Geistige Barrierefreiheit sozusagen.<br />
SMARTE GESTALTUNG<br />
FÜHRT ZU<br />
ERWÜNSCHTEM<br />
VERHALTEN<br />
Ein umfassendes Modell, bei dem<br />
Design im Straßenverkehr zum Einsatz<br />
kommt, sind Gemeinschaftsstraßen –<br />
ein Sammelbegriff, der aufgrund der<br />
relativen Neuartigkeit des dahin terliegenden<br />
Konzeptes gern verwendet<br />
wird. Er steht für mehrere ähnliche<br />
Modelle, bei dem unterschiedliche<br />
Verkehrsteilnehmer Flächen gemeinsam<br />
nutzen können (siehe Infobox).<br />
Dabei steht bei Shared Spaces die<br />
Sicherheit im Vordergrund; beim so<br />
genannten Modell der Koexistenz<br />
geht es um das flüssige Vorankommen<br />
aller Verkehrsteilnehmer; bei Begegnungszonen<br />
liegt der Fokus auf<br />
der gesteigerten Aufenthaltsqualität<br />
auf der jeweiligen Straße, die zum<br />
Verweilen einladen soll. Allen Modellen<br />
liegt zugrunde, dass die jeweilige<br />
Zone überwiegend durch ihre Gestaltung<br />
suggeriert, welches Verhalten<br />
erwünscht und angebracht ist.<br />
UNSICHERHEIT<br />
ERHÖHT<br />
SICHERHEIT<br />
Essenziell ist die Oberflächengestaltung<br />
der Verkehrsräume, die eine gewisse<br />
Struktur aufweisen: Die Übergänge<br />
der Flächen sind sanft und frei<br />
von schroffen Randsteinen, damit der<br />
Eindruck einer ungeteilten Fläche erhalten<br />
bleibt. Die Fahrbahn sollte<br />
zwar Platz für entgegenkommende<br />
LKW bieten, durch farbliche Gestaltung<br />
jedoch eng erscheinen, damit<br />
Fahrzeuglenker ihre Geschwindigkeit<br />
reduzieren. Auch visuelle Barrieren<br />
wie zum Beispiel die quer zur<br />
Fahrtrichtung verlaufenden, andersfarbigen<br />
Streifen wie jene des Grazer<br />
Sonnenfelsplatzes oder die Rhomben<br />
auf der Londoner Exhibition Road<br />
wirken bremsend. Fußgänger dürfen<br />
überall queren. Der Ansatz funktioniert<br />
auch deshalb, weil fehlende Verkehrszeichen<br />
zu einer gewissen Unsicherheit<br />
bei den Menschen führen. Paradoxer<br />
weise steigert diese wiederum<br />
die Umsichtigkeit und gegenseitige<br />
Rück sichtnahme, weshalb die Sicherheit<br />
schlussendlich erhöht wird. Auch<br />
entwickeln Verkehrsteilnehmer gegen<br />
intuitiv Erfassbares kaum Widerstand,<br />
gegen <strong>Regeln</strong>, die sie als solche<br />
empfinden und befolgen müssen,<br />
eher schon. Und Hans Monderman,<br />
als Erfinder des Shared Space einer<br />
der Pioniere der Gemeinschaftsstraßen,<br />
postulierte, dass die übermäßige<br />
Regulierung des Verkehrs dazu führe,<br />
dass sich Verkehrsteilnehmer ihrer<br />
Verantwortung entledigt sähen. Ohne<br />
Regelung durch Ampeln und Schilder<br />
aber müsse man die Verantwortung<br />
wieder selbst wahrnehmen.<br />
DESIGN KANN<br />
ANGSTRÄUME<br />
REDUZIEREN<br />
Neben der Bodengestaltung innerhalb<br />
von Gemeinschaftsstraßen vermittelt<br />
die sogenannte Möblierung<br />
<strong>Regeln</strong> gleichsam intuitiv: Bänke und<br />
Pflanzen laden zum Verweilen ein, die<br />
18
Pflanzen sind aber niedrig, um keine<br />
Sichtbarrieren zwischen den Verkehrsteilnehmern<br />
aufzubauen. Auch der<br />
Einsatz von Licht ist wichtig. Lilo<br />
Schmidt: „Mehr Licht ist nicht nötig,<br />
aber es muss besser strukturiert sein.<br />
Kritische Zonen, sogenannte Angsträume,<br />
sollen nachts heller ausgeleuchtet<br />
sein, um Fußgängern und<br />
Radfahrern die Furcht vor dem Unterwegssein<br />
zu nehmen.“ So werden<br />
Straßen auch bei Dunkelheit von verschiedenen<br />
Verkehrsteilnehmern genutzt.<br />
BLICKKONTAKT BEI<br />
TEMPO 100 IST<br />
UNMÖGLICH<br />
Sind durch Design geregelte Gemeinschaftsflächen<br />
also künftig ein<br />
Allheilmittel gegen Lärm, Verkehrsunfälle<br />
und das Sterben von Einkaufsstraßen?<br />
Die Antwort fällt eindeutig<br />
aus: Nein, denn Straßen haben unterschiedliche<br />
Funktionen und damit<br />
unterschiedliche Geschwindigkeiten.<br />
Lilo Schmidt: „Je schneller der Verkehr,<br />
umso mehr werden klar festgelegte<br />
<strong>Regeln</strong> gebraucht. Höhere Geschwindigkeiten<br />
machen es praktisch<br />
unmöglich, in der Situation über Gesten<br />
und Blicke zu kommunizieren.“<br />
Deshalb ist auch am Flugfeld, wo<br />
Schnelligkeit und Sicherheit absolute<br />
Priorität genießen, jede Bewegung<br />
der Flugzeuge streng geregelt und<br />
daher sind Autobahnen aus der Umsetzungspalette<br />
intuitiver Erfassung<br />
ausgeschlossen: Dort stehen Verkehrsschilder<br />
mit Recht, wie auch<br />
der Niederländer Hans Monderman<br />
stets betonte.<br />
Potenzial vor<br />
allem im Ortsgebiet<br />
Gemeinschaftsflächen sind kein One-<br />
Fits-All-Konzept, sie müssen individuell<br />
geplant werden: „Der Ersatz<br />
von <strong>Regeln</strong> durch Design ist besonders<br />
innerhalb von Ortschaften möglich,<br />
wo Autos grundsätzlich langsamer<br />
fahren“, erklärt Ursula Faix von<br />
bad architects, Ko-Autorin der Studie<br />
Shared-Space-Konzepte * . „Wir haben<br />
nämlich herausgefunden, dass<br />
Shared-Space-Konzepte vor allem<br />
dann sinnvoll sind, wenn das KFZ-<br />
Aufkommen bei unter 25.000 KFZ<br />
täglich bleibt, auch Radfahrer und<br />
Fußgänger in großer Zahl unterwegs<br />
sind, die Straße von Fußgängern gerne<br />
gequert wird und nur geringer<br />
Parkplatzbedarf besteht.“<br />
Weltweit gibt es eine unzählbare<br />
Menge an Gemeinschaftsstraßen.<br />
Eines davon ist die New Road in<br />
Brighton, Großbritannien, eine Einkaufsstraße<br />
mit schachbrettartigem<br />
Belag. Das 2007 realisierte Projekt<br />
hat den Autoverkehr um 93 % reduziert,<br />
die Fußgänger um 62 % vermehrt,<br />
der Fahrradverkehr hat um<br />
22% zugelegt, die Verweildauer der<br />
Menschen ist um 600 % gestiegen,<br />
Verkehrsschilder oder Ampeln waren<br />
dazu nicht nötig. Ein anderes Beispiel:<br />
Die Exhibition Road im Zentrum von<br />
London mit ihren Museen gilt seit der<br />
Umgestaltung auch als freundlicher<br />
Ort der Begegnung.<br />
In Gleinstätten in der Südsteiermark<br />
hat die Umgestaltung der Sulmtaler<br />
Straße mit ihren Geschäften, der<br />
Schule und dem Busbahnhof zum<br />
Shared Space den Autoverkehr marginal<br />
eingedämmt, die Fußgängerfrequenz<br />
aber ist um fast 1.600 %<br />
gestiegen, Zeichen einer als gleichberechtigt<br />
empfundenen Nutzung:<br />
Jetzt dürfen Fußgänger ja überall<br />
queren, ohne Zebrastreifen oder<br />
Ampel.<br />
mit geschlossenen<br />
Augen über<br />
die Strasse<br />
gehen<br />
Im niedersächsischen Ort Bohmte<br />
stiegen seit der Einrichtung des<br />
Shared Space die Unfallzahlen.<br />
Vizebürgermeisterin Sabine Buhr-<br />
Deichsel begründet das mit einer<br />
neuen Straßenlaterne, die beim<br />
Rückwärtsfahren ständig umgefahren<br />
wurde: „Die haben wir inzwischen<br />
versetzt.“ Sie ist von der Sicherheit<br />
der L81 überzeugt und traut sich sogar<br />
mit geschlossenen Augen über<br />
die Straße. Ihre Erfahrung: Ohne<br />
Verkehrszeichen stellen sich die<br />
Verkehrsteilnehmer stärker auf die individuelle<br />
Situation ein. Das bestätigt<br />
auch Lilo Schmidt: „Uns Menschen<br />
fehlt es nicht an situationsabhängiger<br />
Problemlösungskompetenz. Diese<br />
wurde aufgrund der vielen <strong>Regeln</strong> in<br />
unserer Welt nur ein wenig zurückgedrängt.“<br />
Bei Bedarf sei sie aber nach<br />
wie vor vorhanden. •<br />
* Ursula Faix und Paul Burgstaller, bad architects group:<br />
Shared-Space-Konzepte in Österreich, der Schweiz und Deutschland.<br />
Herausgegeben vom Salzburger Institut für Raumordnung & Wohnen (SIR), 2012<br />
Bad architects: www.bad-architects.gp/index.php?page=publicationdetails&projectID=85<br />
New Road in Brighton: http://www.gehlarchitects.com/#/159503/<br />
Exhibition Road in London: www.hamilton-baillie.co.uk/index.php?do=projects&sub=details&pid=75<br />
Berner Modell: www.youtube.com/watch?v=anFjmW0TVo8&list=UU-GTEQOt6v50U-cg-ZshFTA<br />
Zentrum Köniz bei Bern: www.youtube.com/watch?v=wn2NfUH0G-Q<br />
Broschüre zur Definition der Gemeinschaftsstraßen: www.e5-salzburg.at/downloads/gemeinschaftsstrassen.pdf<br />
<strong>Regeln</strong><br />
19
innovatives online & offline<br />
StART-UPs<br />
Spannende Ideen aus aller Welt zum Thema REGELN.<br />
Von Katrin Stehrer<br />
////// Taxi per FuSSpedal ////////////////////////////////<br />
Das Heranwinken eines Taxis kann in Megastädten zur nervenraubenden Angelegenheit<br />
werden. Erleichterung könnte ein preisgekröntes Funksystem bringen, das sich<br />
Studenten der Xi’an Universität für Design und Technologie (Ostchina) einfallen ließen:<br />
Gehsteigkanten werden mit einem drucksensiblen Kommunikationssystem ausgestattet,<br />
dessen Farbe von Blau auf Grün wechselt, sobald sich ein Kunde darauf<br />
stellt und ein Taxifahrer den so übertragenen Funk angenommen hat. Die Realisierung<br />
des investitionsintensiven Projektes hat einen guten Ausgangspunkt: Die Erfinder<br />
holten sich den ersten Platz des anerkannten Red Dot Awards für Design in Singapur<br />
in der Kategorie Public Space (öffentlicher Raum).<br />
http://gajitz.com/conceptual-taxi-system-puts-civility-back-in-urban-transport<br />
////// Tierisch flüssig ////////////////////////////////////<br />
Ozan Tonguz, Telekommunikationsforscher an der Carnegie Mellon Universität in<br />
Pittsburgh, USA übertrug eine Beobachtung aus der Tierwelt in die Verkehrstelematik:<br />
Treffen Käferkolonnen aus verschiedenen Richtungen zusammen, wartet die<br />
kürzere Schlange so lange, bis die größere Gruppe den Weg passiert hat. Auf diese<br />
Logik baute Tonguz sein dynamisches Ampelkonzept Virtual Traffic Lights auf: Ein<br />
im Inneren des Fahrzeugs installiertes grünes Licht signalisiert den Autos der längeren<br />
Schlange das „Go“. Sobald die Kolonne kleiner geworden ist, erhält die nächstgrößte<br />
Gruppe das OK zum Fahren. Eine US-amerikanische Autobahnverwaltungsgesellschaft<br />
hat bereits Interesse gezeigt, die Idee im Straßenverkehr umzusetzen.<br />
O.K. Tonguz, “Biologically Inspired Solutions to Fundamental Transportation Problems”,<br />
IEEE Communications Magazine, l. 49, no. 11, pp. 106-115, November 2011.<br />
http://gajitz.com/virtual-traffic-lights-inspired-by-insects-could-end-traffic-woes<br />
////// Schwimmend ins Büro ///////////////////////////<br />
Alex Smith und David Lomax, Architekten und Gründer von [Y/N]studios, wollen<br />
dem 13,8 Kilometer langen Regent’s Kanal in London seinen ursprünglichen Zweck<br />
zurück geben, Teil des innerstädtischen Verkehrssystems zu sein. Die unkonventionelle<br />
Idee: Ein Swimmingpool, das sich über die gesamte Länge erstreckt, mit gefiltertem<br />
Kanalwasser gefüllt ist und Pendlern dazu dient, ihren Weg zur Arbeit mit<br />
Sport zu verbinden. Auch der Winter wäre für Sportmuffel keine Ausrede: Auf gefrorenem<br />
Eis ließe sich die Strecke mit Eislaufschuhen befahren.<br />
http://ynstudio.eu/filter/Projects<br />
20
Mit der Sonne um die Welt /////////////////////<br />
Mit dem Flugzeug um die Welt, jedoch ausschließlich mit der Kraft der Sonne, auch<br />
in der Nacht: 2015 soll es für das Projekt Solarimpulse nach zahlreichen Testflügen<br />
so weit sein und das 90-köpfige Team rund um den Schweizer Piloten Bertrand<br />
Piccard den Weltrekordversuch wagen. Das Flugzeug, das diese 25-tägige Reise<br />
schaffen soll, ist im Vergleich zur Testversion mit 10.000 zusätzlichen Photovoltaikzellen<br />
ausgestattet, die tagsüber genug Energie in die Akkus speisen, um die langen<br />
Nachtstunden am Äquator überstehen zu können. Das Sonnenflugzeug hat 80<br />
Meter breite Flügel. Sie sind um 20 cm breiter als jene des größten Passagierflugzeuges<br />
der Welt, dem A380. Ein Wermutstropfen bleibt allerdings: Das Solar Plane<br />
trägt nur eine Person.<br />
www.solarimpulse.com<br />
////// Faltbarer Lastenträger ///////////////////////<br />
Der Cargo-Scooter kommt in den immer dichter werdenden urbanen Räumen gerade<br />
recht: Mit erneuerbarer Energie betrieben, platzsparend und trotzdem genug Laderaum<br />
um auch einmal einen größeren Einkauf zu transportieren. Kernidee des kalifornischen<br />
Start-ups Lit Motors war es, den Motor in den Hinterreifen des Rollers zu integrieren,<br />
damit der 50 × 50 × 50 cm große Stauraum, der einer Traglast von bis zu<br />
90 kg standhält, realisiert werden konnte. Bemerkenswert ist, dass der Cargo-Scooter<br />
auf die Hälfte seiner Größe zusammengeklappt werden kann, um auch in kleinen<br />
(Stadt-)Wohnungen Platz zu finden. Die ersten 80 km/h schnellen Scooter sollen<br />
noch 2013 um rund 5.000 US-Dollar erhältlich sein.<br />
www.litmotors.com<br />
////// Airbag für den Kopf /////////////////////////////<br />
Anna Haupt und Terese Alstin wollten einen Fahrradhelm anbieten, der die Frisur<br />
nicht zerstört und daher auch ohne Zwang gerne getragen wird. Ihr neues Produkt:<br />
Ein modischer Schal, aus dem sich im Ernstfall ein Schutzhelm entfaltet – vergleichbar<br />
mit einem Airbag im Auto. Millisekunden vor dem Aufprall stülpt sich der Hövding<br />
(schwedisch für Häuptling) über den Kopf. Laut den Gründerinnen sollen eingebaute<br />
Sensoren jede mögliche Gefahrensituation erkennen (außer wenn ein Gegenstand<br />
von oben herabfällt). Zusätzlich enthält der Helm auch eine eingebaute Blackbox, die<br />
den Unfallhergang speichert und damit zur Aufklärung beitragen kann. Der Helm ist<br />
auf www.hovding.com für 399 Euro zu haben.<br />
////// Strampeln, um zu Tanzen ///////////////////////<br />
Strampeln, um zu tanzen, ist das Partymotto der Zukunft – zumindest, wenn es nach<br />
dem Wiener Umweltverein IndyAct und dessen Projekt „BIKE IT ON“ geht. Mit sechs<br />
umgebauten Elektrofahrrädern für Erwachsene und einem Kinderelektrorad können<br />
bis zu 2.000 Watt Strom von den Besuchern selbst erzeugt werden – genug für mittelgroße<br />
Events wie Musikkonzerte und Kinovorführungen. Neueste Erweiterung ist<br />
die Kooperation mit dem Verein Gehsteigdisko: Das Partyvolk hört die Musik des DJs<br />
über Fahrradstrom-betriebene Kopfhörer. Für lärmarme Wohnungspartys nur dann<br />
geeignet, wenn die vorab kalkulierte Gästezahl eingehalten wird.<br />
www.indyact.at<br />
www.bike-it-on.at<br />
<strong>Regeln</strong><br />
21
Geheimnisvolle<br />
Spielregeln<br />
des Überlebens<br />
22<br />
Foto: © Frank Wehrmann
Der Begriff Schwarmintelligenz verheiSSt Gutes – Doch nicht<br />
immer ist das kollektive Gehirn stärker als der Einzelne.<br />
Von Julia Schilly<br />
Garri Kasparow war bereits 15 Jahre<br />
ungeschlagener Schachweltmeister.<br />
Da beschloss der Russe online gegen<br />
die Weltbevölkerung anzutreten.<br />
Die Partie galt als Experiment: Ob die<br />
Zusammenarbeit vieler Menschen<br />
zu einer höheren Leistung als der<br />
des Einzelnen führen kann? Kollektive<br />
Intelligenz oder Schwarmintelligenz<br />
wird das Phänomen genannt,<br />
wenn komplexe Systeme zu mehr als<br />
die Summe ihrer Teile werden. Durch<br />
Vernetzung entstehen unvorhergesehene<br />
Qualitäten, die man mit Blick<br />
auf die einzelnen Bausteine nicht erwarten<br />
könnte.<br />
Sozialverhalten<br />
macht Ameisen immun<br />
Ein gutes Beispiel ist der Ameisenstaat.<br />
Eine einzelne Ameise hat ein<br />
sehr begrenztes Repertoire an Verhaltens-<br />
und Reaktionsmöglichkeiten.<br />
Im Zusammenspiel wird sie jedoch<br />
stark.<br />
Die schwarmintelligente Waffe ist ihre<br />
„soziale Immunität“, wie es die Ameisenforscherin<br />
Sylvia Cremer nennt.<br />
Die Nürnbergerin forscht am Institute<br />
of Science and Technology Austria<br />
(ISTA). Zum Beispiel stellt ein Ameisenbau<br />
einen idealen Nährboden für<br />
Epidemien dar. Dennoch kommt es<br />
selten zu einem Ausbruch. Was dazu<br />
führt, dass weibliche Ameisen in unseren<br />
Breiten bis zu zwei Jahre, die<br />
Königinnen sogar bis zu 25 Jahre alt<br />
werden.<br />
In einem Versuch klebte Cremer einer<br />
Arbeiterin Sporen eines Pilzes auf<br />
den Rücken, der einen Tag lang unschädlich<br />
ist. Dann erst dringt er in<br />
das Innere ein und tötet den Wirt.<br />
Das Resultat des Tests: Alle Ameisen<br />
änderten sofort ihr Verhalten<br />
und widmeten sich spezifischen, teils<br />
neuen Aufgaben. Die infizierte Arbeiterin<br />
blieb den Larven fern, „Krankenpfleger“<br />
putzten ihre Körperoberfläche<br />
sowohl mechanisch als auch chemisch<br />
mit Ameisensäure, wiederum<br />
andere widmeten sich verstärkt der<br />
Brutpflege. Die Krankenpflege löste in<br />
der Gruppe eine Immunisierung aus.<br />
Denn als fünf Tage später die anderen<br />
Ameisen den Pilzsporen ausgesetzt<br />
wurden, erkrankten weniger als in der<br />
Vergleichsgruppe, in der es keine Vorbehandlung<br />
gegeben hatte.<br />
Die Robotik schielt schon länger auf<br />
die erstaunlichen Fähigkeiten der kollektiven<br />
Intelligenz im Tierreich. Am<br />
Artificial Life Laboratory an der Karl-<br />
Franzens-Universität in Graz wird<br />
etwa daran gearbeitet, Schwarmintelli<br />
genz auf Roboter zu übertragen.<br />
Nach dem Vorbild der Honigbiene<br />
sollen Roboter sich selbst organisieren<br />
und untereinander effizient kommunizieren.<br />
Roboter sollen<br />
wie honigbieneN<br />
kommunizieren<br />
Bienen nutzen Tänze, um Information<br />
über Ort und Beschaffenheit von<br />
Nahrung auszutauschen. Zoologe<br />
Thomas Schmickl und sein Team<br />
simulieren dieses Verhalten bei<br />
mobilen Robotern mit integrierter<br />
Speicherkarte, welche die Roboter<br />
an interessanten Orten mit Zahlen<br />
anfüllen, ganz so als würden sie<br />
Nektar trinken. Gleichzeitig geben<br />
sie auch Daten an die anderen<br />
Roboter um sich herum weiter. Je<br />
größer der Datenaustausch zwischen<br />
den Maschinen, desto schneller befinden<br />
sich alle auf dem gleichen Wissensstand,<br />
was wiederum bessere<br />
Entscheidun gen des Einzelnen, wohin<br />
er sich weiter fortbewegt, zur Folge<br />
hat. Im Collective Cognitive Robots<br />
Projekt (CoCoRo) nutzte Schmickl<br />
dieses Wissen für den größten autonom<br />
unter Wasser arbeitenden Roboterschwarm<br />
der Welt. Dabei werden<br />
Algorithmen aus der Kommunikation<br />
von Ameisen, Bienen und Schimmelpilzamöben<br />
angewendet.<br />
Ameisenforscherin Sylvia Cremer vom<br />
Institute of Science and Technology Austria (ISTA)<br />
Wie funktioniert der<br />
Informationsfluss bei<br />
Ameisen eigentlich?<br />
Cremer: Sie leben in kompletter<br />
Dunkelheit. Die meiste Kommunikation<br />
findet daher durch Pheromone statt.<br />
Ein Wachs am Körper trägt Informationen<br />
über Nestzugehörigkeit, Königin<br />
oder Arbeitsbereich. Die anderen<br />
Ameisen lesen das durch Abtasten mit<br />
ihren Antennen.<br />
Wird die Missachtung von<br />
<strong>Regeln</strong> bei Ameisen sanktioniert?<br />
Cremer: Ja, das wird „policing“ genannt.<br />
Ein Beispiel: Im Normalfall produziert nur<br />
die Königin Eier und sendet ein Fertilitätssignal<br />
aus, das die Entwicklung der<br />
Eierstöcke bei den Arbeiterinnen unterdrückt.<br />
Falls dennoch eine Arbeiterin mit<br />
der Eierproduktion anfängt, halten sie ihre<br />
Kolleginnen so lange fest, bis sie ihre<br />
Eierstöcke wieder zurückbildet.<br />
<strong>Regeln</strong><br />
23
Foto: © CoCoRo<br />
Der größte autonome Roboterschwarm der Welt:<br />
Die Mini-U-Boote des Projektes CoCoRo sammeln<br />
Informationen individuell und übertragen sie auf das<br />
Gesamtsystem. Das ist effiziente Kommunikation<br />
nach dem Vorbild eines Bienenschwarms.<br />
Die Mini-U-Boote treffen dadurch<br />
ihre Entscheidungen wie ein einziges<br />
großes Gehirn und finden auf<br />
effizien te Weise Lecks in Pipelines<br />
oder Müllansammlungen im Meer.<br />
Schwarmintelligenz<br />
zur Erkundung<br />
weit entfernter<br />
Planeten<br />
Langfristig gesehen könnten solche<br />
Roboterschwärme sogar ferne Planeten<br />
erkunden. Der große Vorteil<br />
ist die Widerstandsfähigkeit eines<br />
Schwarms: Viele kleine, eher simple<br />
Roboter kosten genau so viel wie ein<br />
großer, komplizierter Roboter. Bei<br />
einem Schwarm ist die Wahrscheinlichkeit<br />
jedoch größer, dass viele<br />
während der Erkundungen intakt<br />
bleiben.<br />
Physiker Stefan Thurner, Leiter des<br />
Instituts für die Wissenschaft komplexer<br />
Systeme der MedUni Wien,<br />
forscht zur kollektiven Intelligenz<br />
beim Menschen. Alle Aktionen von<br />
rund 400.000 Usern des Second-<br />
Life-Computerspiels Pardus werden<br />
dazu seit Jahren gespeichert. Wer<br />
mit wem kommuniziert und in Interaktion<br />
tritt, ist im normalen Leben für<br />
keinen Mensch überschaubar. Über<br />
Computer kann das Verhalten hingegen<br />
gut analysiert werden. „Trotz<br />
weitgehender Anarchie haben sich<br />
Normen und <strong>Regeln</strong> herausgebildet“,<br />
berichtet Thurner von den Auswertungen<br />
des Computerspiels. Verblüffend<br />
sei, dass nur zwei Prozent aller<br />
Handlungen in der Gruppe aggressiv<br />
seien. Die Spieler würden sich nämlich<br />
schnell gegenseitig mit Spielausschluss<br />
oder Ignoranz bestrafen,<br />
wenn sich jemand nicht „ordentlich“<br />
verhalte. „Wir haben jedoch erkannt,<br />
dass die Aggression um ein Zehnfaches<br />
steigt, wenn ein Spieler selbst-<br />
Negatives erfährt“, sagt der Forscher.<br />
Eins, Zwei, Schwarm –<br />
ein Trugschluss<br />
der Medien<br />
Momentan wird der Begriff Schwarm -<br />
intelligenz für die Erklärung verschiedener<br />
Spielweisen menschlichen<br />
Verhaltens vor allem im Internet inflationär<br />
verwendet. Selten wird dabei<br />
so wissenschaftlich vorgegangen<br />
wie an der MedUni. „Die populäre<br />
Berichterstattung kennt hingegen<br />
nur drei Zahlenangaben: eins, zwei,<br />
Schwarm“, kritisierte Autor Sascha<br />
Lobo im Spiegel. Denn in den Foren<br />
von Online-Medien seien viele User,<br />
aber nur selten die Weisheit anwesend,<br />
argumentiert er.<br />
Schwarmintelligenz entsteht vielmehr<br />
aus dem Zusammenspiel einer Gruppe,<br />
welches nur unter effizienter Koordination<br />
neue Qualitäten entwickeln<br />
kann. Eindrucksvoll zeigt das zum<br />
Beispiel das „Oregon-Experiment“:<br />
Eindrucksvoller<br />
Praxistest der<br />
Gruppenintelligenz<br />
Der Wiener Architekt Christopher<br />
Alexander entschloss sich Ende der<br />
60er-Jahre, die Platzierung der Gehwege<br />
auf dem Gelände der Universität<br />
von Oregon (USA) mit Hilfe der<br />
Studierenden zu optimieren. Dafür<br />
wurde Rasen gesät. Die abgetrampelten<br />
Linien im Gras wurden als effizienteste<br />
Straßen identifiziert und<br />
geteert.<br />
Und wie endete die Schachpartie gegen<br />
Kasparow? Führte das geballte<br />
Wissen der Menschen zum Sieg? Es<br />
dauerte genau 62 Züge, und die Welt<br />
war schachmatt. Zu homogen, zu unorganisiert<br />
agierten die Gegner. Gemeinsam<br />
können wir also auch dümmer<br />
sein als das Individuum. •<br />
Ameisenforscherin Sylvia Cremer: http://ist.ac.at/de/forschung/forschungsgruppen/cremer-gruppe/<br />
Robotik am Artificial Life Laboratory: http://zool33.uni-graz.at/artlife/<br />
Institut für komplexe Systeme: www.complex-systems.meduniwien.ac.at/people/sthurner/<br />
24
ewegungsmuster<br />
Wie verhalten sich Menschen, wenn viele von ihnen an einem Ort<br />
sind oder dorthin wollen? Vorhersagen sind komplex,<br />
werden jedoch zwecks Steuerung immer wichtiger.<br />
Von Ruth Reitmeier<br />
komplexes einfach erklärt<br />
////// FuSSgängerströme /////////////////////////////<br />
Wenn bei Großveranstaltungen viele Menschen im Strom gehen oder sich ihre Bahnen kreuzen,<br />
entstehen Fußgängerströme. Um dem Risiko von Staus und gefährlichem Gedränge vorzubeugen,<br />
werden neuerdings Gesetzmäßigkeiten, die dem Verhalten der Fußgänger<br />
zugrunde liegen, wissenschaftlich analysiert. Dafür werden Computersimulationen mit<br />
Agent-Based-Models herangezogen: Die „Agents“, die simulierten Teilnehmer, wirken<br />
dabei nach vorab definierten <strong>Regeln</strong> zusammen. Weil es dafür bisher jedoch keine brauchbaren<br />
Grunddaten zu Fußgängerströmen gab, etwa ab welchem Personendurchsatz es<br />
zum Stau kommt, führten Wissenschafter des deutschen Forschungszentrums Jülich unter<br />
der Leitung von Armin Seyfried im Juni 2013 in Düsseldorf ein weltweit einmaliges Großexperiment<br />
durch. Dabei wurden bis zu 950 echte Menschen losgeschickt, um ihr Verhalten<br />
im Strom zu simulieren und den Übergang vom Stau zum Gedränge zu beobachten. Eines<br />
der Ergebnisse: Um ein plötzliches Stehenbleiben Einzelner und damit das Entstehen<br />
eines gefährlichen Staus zu vermeiden, müssten neben Leitsystemen vor allem die Attraktionen<br />
im Raum so verteilt werden, dass Personen darauf zugehen und die Menge in Bewegung<br />
bleibt, so Seyfried.<br />
Am Ende der mehrjährigen Auswertung der 40 Terabyte Daten soll ein Tabellenwerk mit<br />
handfesten Zahlen vorliegen, auf deren Basis Veranstalter ablesen können, ob eine Anlage<br />
für einen geplanten Event auch geeignet ist.<br />
www.fz-juelich.de/ias/jsc/EN/AboutUs/Organisation/CivilSecurityAndTraffic/_node.html<br />
Bilder: www.fz-juelich.de / Asfinag: fotowerk aichner og / wikipedia.org: Rene Ehrhardt<br />
////// Flexible Verkehrsanzeigen //////////////////<br />
Weit fortgeschritten ist hingegen bereits die Auswertung der Verkehrsströme im Autoverkehr:<br />
Daten zur aktuellen Verkehrssituation werden entlang der Autobahn über Sensoren<br />
gesammelt, zudem liefert der Streckendienst der ASFINAG Informationen. Einige<br />
Schaltungen erfolgen automatisch, andere werden in der zentralen Verkehrssteuerung in<br />
Inzersdorf manuell eingegeben. Die dort tätigen Operatoren überwachen das Netz und greifen<br />
im Ernstfall ein, indem sie etwa einen Tunnel auf Rot schalten, entsprechende Tempo- und<br />
Umleitungsschaltungen vornehmen oder die Einsatzkräfte alarmieren. Über Verkehrsbeeinflussungsanlagen<br />
– das sind dynamische Anzeigen – werden Autofahrer aktuell vor Gefahren,<br />
Unfällen, Unwettern und entstehenden Staus gewarnt. Durch das Reduzieren der Höchstgeschwindigkeit<br />
oder die Information über Alternativrouten soll der Verkehr im Fluss bleiben.<br />
////// Flugzeugauslastung ///////////////////////////<br />
Die Auslastung von Flugzeugen wird von Revenue Management Systemen gesteuert,<br />
die Prognosen auf der Basis von Vorjahresdaten erstellen. Anhand dieser Zahlen wird die<br />
Nachfrage für zukünftige Abflüge errechnet. Dabei geht es nicht allein um die möglichst hohe<br />
Auslastung einer Maschine, wie man bei Austrian Airlines betont. Die Kunst liege darin, einen<br />
optimalen Mix zwischen hochwertigen und günstigen Tickets zu erreichen. Die Prognosen<br />
helfen zudem, die richtigen Maschinentypen einzusetzen. Neben der Auslastung der Passagierkabine<br />
zählen auch Cargo und Post, beides einträgliche Geschäftsbereiche, zur Gesamtauslastung<br />
eines Flugzeugs.<br />
<strong>Regeln</strong><br />
25
„Mobilität kann man nicht<br />
in Kilometern messen“<br />
Wir sind im StraSSenverkehr auf Rüpelhaftigkeit programmiert.<br />
Daran seien Verkehrsregeln mitschuld, erklärt der Mobilitätsforscher<br />
Stefan Rammler vom Institut für Transportation<br />
Design an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig.<br />
Das Gespräch führte Daniela Müller<br />
Als vor eineinhalb Jahren in Graz der<br />
erste Shared Space Österreichs eingerichtet<br />
wurde, hieß es vielfach „Wozu<br />
brauchen wir das?“ Was sagt das über<br />
unsere Einstellung im Straßenverkehr<br />
aus?<br />
Hier muss man fragen, warum überhaupt<br />
Shared Spaces gemacht werden.<br />
Es gibt Studien, wonach es in Ländern<br />
mit weniger Verkehrsschildern und<br />
unreglementierterem Straßenverkehr<br />
weniger Unfälle gibt als in Ländern<br />
mit vielen Verkehrsregeln. Wo viel geregelt<br />
ist, neigen wir gern dazu, bis<br />
an die Grenze der Regelung zu gehen,<br />
nach dem Motto „Das ist mein Recht!“<br />
Das macht möglicherweise blind gegenüber<br />
der Situation und meinem<br />
Gegenüber.<br />
Warum tun wir uns mit<br />
Shared Spaces so schwer?<br />
Möglicherweise, weil wir über 60, 70<br />
Jahre intensiv produzierte Verkehrssicherheit<br />
und -sozialisation hinter<br />
uns haben. Vor der Massenmotorisierung<br />
war die Straße ein Shared Space:<br />
Kinder haben dort gespielt, Hühner<br />
gegrast und Menschen ihre Siesta gehalten.<br />
Erst im Zuge der Massenmotorisierung<br />
brauchte es die funktionale<br />
Differenzierung der Räume, die<br />
Straße wurde als dominanter Raum<br />
für das Automobil definiert, es kamen<br />
Verkehrserziehung, <strong>Regeln</strong>, Überwachung<br />
dazu, um das System der Automobilität<br />
und des Hochgeschwindigkeitsverkehrs<br />
sicher zu machen. Es<br />
ging auch darum, verkehrsfunktionales<br />
Verhalten, das wir von Natur aus<br />
nicht haben, anzuerziehen. Eine alte<br />
verkehrssoziologische Wahrheit heißt,<br />
dass der Verkehr der Spiegel der Gesellschaft<br />
ist. Und da sind wir stark<br />
konkurrenzorientiert: Der Kräftigere<br />
setzt sich durch, der Schnellere hat<br />
Vorfahrt, jeder will schnell am Ziel<br />
sein. Beim Shared Space müssen wir<br />
plötzlich auf kooperativ umschalten.<br />
GröSSere Vielfalt an<br />
Mobilitätsangeboten,<br />
die perfekt<br />
interagieren<br />
Sie leiten ein eigenes Institut für Transportation<br />
Design an der Hochschule<br />
für Bildende Künste in Braunschweig.<br />
Braucht das Thema Mobilität Unterstützung<br />
durch die Kunst?<br />
Ich möchte lieber von kreativen Disziplinen<br />
sprechen, von Design, Medien,<br />
Kunstwissenschaften. Wir brauchen<br />
in allen Zukunftsfragen Impulse von<br />
außen, etwa bei Mobilität, Energie,<br />
Ernährung, um zu lernen, wie man<br />
anders mit den Themen umgehen<br />
kann als bisher. Da geht es weniger<br />
um Nachhilfe von der Kunst, sondern<br />
um das Einbeziehen von Strukturen,<br />
Prozessen, Abläufen mit großer Offenheit<br />
gegenüber kreativen Prozessen.<br />
Welchen Beitrag könnte Design für eine<br />
zukunftsfähigere Mobilität leisten?<br />
Einen großen. Angefangen bei der<br />
Gestaltung der Fahrzeuge im Spannungsfeld<br />
Design und Konstruktionswissenschaft,<br />
mit neuen Materialien,<br />
einer leichteren Bauweise, durch<br />
Elektromobilität oder Automatisierungstechnologien.<br />
Hier kann Design<br />
wertschöpfend in Richtung ökologischer<br />
Zukunft vorbereiten. Doch Design ist<br />
immer nur der Diener von Entscheidungen,<br />
die an anderer Stelle getroffen<br />
werden. Ich persönlich vertrete<br />
ein Design der Zukunft, das geteilt ist:<br />
Carsharing, leichtere Fahrzeuge mit<br />
Alternativantrieben, öffentlicher Verkehr,<br />
Fahrräder.<br />
Wie lange können wir uns<br />
die Mobilität von heute noch leisten?<br />
Leisten können wir sie uns schon lange<br />
nicht mehr. Es stellt sich vielmehr die<br />
Frage, ob wir den Klimawandel ernst<br />
nehmen und auch die Tatsache, dass<br />
ein großer Teil der Klima emission<br />
durch den Straßenverkehr verursacht<br />
wird. Wir erzeugen weiterhin Klimagase,<br />
machen das Problem größer, erzeugen<br />
in der Welt Elend und Armut<br />
durch die Art, wie wir fossile Energien<br />
extrahieren. Das sind hochgradig ungerechte<br />
Systeme.<br />
Was ist Ihre liebste Vorstellung<br />
der Mobilität von morgen?<br />
Wir müssen weg von „nur“ Automobil<br />
zu einer größeren Vielfalt von Mobilitätsangeboten<br />
auf Basis der Elektromobilität<br />
in Kombination mit einem<br />
gut ausgebauten und preisgünstigen<br />
öffentlichen Verkehr, die perfekt interagieren.<br />
Wenn ich Städte so baue,<br />
dass ich vom Wohnort zur Arbeit eine<br />
Stunde unterwegs bin, erzeuge ich<br />
Mobilitätsbedarf. Wir messen Mobilität<br />
nach wie vor in Verkehrsleistung,<br />
26
Foto: © © Nicolas Uphaus<br />
Stefan Rammler ist Gründungsdirektor des Instituts für Transportation<br />
Design (ITD) und Professor für Transportation Design &<br />
Social Sciences an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig.<br />
Er arbeitet mit seinem Team an der Gestaltung einer zukunftsfähigen,<br />
postfossilen Mobilität. Rammler versteht Mobilität<br />
als unverzichtbare Grundlage unserer modernen Kultur und Gesellschaft<br />
und gleichsam als Dreh- und Angelpunkt einer gesellschaftlichen<br />
Modernisierung. Seine professionellen Ziele setzt der<br />
Politologe, Soziologe und Ökonom auch privat um: Er ist multimodal<br />
unterwegs und misst seine Mobilitätsleistung nicht an zurückgelegten<br />
Kilometern, sondern daran, wie viele Erledigungen er auf<br />
einer Wegstrecke gemacht hat.<br />
also in Kilometern pro Kopf. Das sagt<br />
nichts darüber aus, wie mobil ich bin.<br />
Nach diesen Kriterien ist jemand, der<br />
500 Kilometer in die Arbeit und zurück<br />
nach Hause fährt, hoch mobil.<br />
Jemand, der fünf Minuten mit dem<br />
Fahrrad zur Arbeit fährt und dabei<br />
noch fünf andere Wege macht, nicht.<br />
Wir sollten Mobilität künftig als Erreichbarkeit<br />
von Orten und Einrichtungen<br />
definieren, statt als Verkehrsleistung<br />
in Personenkilometern. Das<br />
gehörte an den Anfang der Diskussion.<br />
Durch Ausbrechen<br />
aus der Routine und<br />
Ausprobieren von<br />
Neuem kann jeder<br />
mitgestalten<br />
Welche Rolle spielt der Einzelne?<br />
Ich meine nicht, dass alle ihr Leben<br />
radikal ändern müssen. Aber wir können<br />
beginnen, die kollaborativen Angebote<br />
zu nutzen, etwa Sharing-Angebote<br />
oder Elektroautos, auch wenn es<br />
erst einmal einen Routinebruch darstellt,<br />
und einfach versuchen, Vorurteile<br />
abzubauen und Neues auszuprobieren.<br />
In der neuen Mobilitätskultur<br />
wird sich einiges ändern. Doch nicht<br />
jeder hat für eine massive Änderung<br />
den finanziellen oder zeitlichen Spielraum,<br />
etwa ein Weitpendler. Das ist<br />
dann auch eine Frage der politischen<br />
und raumplanerischen Gestaltung.<br />
Wie sieht Ihre private Mobilität aus?<br />
Wir haben den Wohnort so gelegt,<br />
dass die Kinder zu Fuß oder mit dem<br />
Fahrrad zur Schule fahren können.<br />
Wir haben eine gute Fahrradflotte zu<br />
Hause und einen Anhänger zum Einkaufen<br />
sowie die richtige Kleidung.<br />
Unser Auto nutzen wir nur eingeschränkt,<br />
es ist alt und es abzuschaffen<br />
lohnt sich nicht. Wir nutzen Sharingangebote<br />
und fliegen nicht mehr, sondern<br />
machen seit sechs Jahren dort<br />
Urlaub, wo wir mit dem Nachtzug hinfahren<br />
können. Wobei ich im Notfall<br />
schon fliegen würde und das dann mit<br />
Zahlungen für ein Aufforstungsprogramm<br />
kompensieren würde. Wir<br />
versuchen, vegetarisch oder vegan zu<br />
leben, der Fleischkonsum verursacht<br />
schließlich auch viel Mobilität. All das<br />
reduziert den ökologischen Footprint<br />
enorm und zeigt, dass man mit wenig<br />
Aufwand viel erreichen kann.<br />
Wenn Sie über die Mobilität von<br />
morgen sprechen, was müssen<br />
Entscheider künftig stärker mitdenken?<br />
Design! Designer haben ein Bild von<br />
der Zukunft der Gesellschaft, von Nutzerbedürfnissen<br />
und von Konzepten<br />
und Prototypen. Sie haben eine Übersetzungsfunktion<br />
und kennen sich in<br />
der Bedürfniswelt der Kunden gut aus.<br />
Wir brauchen aber auch die IT, Techniker<br />
und Ingenieure, da wir bei aller<br />
Einsicht in die Frage der Lebensstiländerung<br />
auch Gestaltungsaufgaben<br />
technisch lösen müssen, etwa die Frage<br />
der Antriebsformen. Wir brauchen<br />
weiter die Sozialwissenschaften und<br />
die Ökonomie, die über neue Wirtschaftsmodelle<br />
und ein Weggehen<br />
vom Modell der reinen Wachstumsökonomie<br />
nachdenken.<br />
•<br />
<strong>Regeln</strong><br />
27
Mit Hand<br />
und Fuß<br />
Foto: © festo.com<br />
Künstliche Arme und Hightech-Beine: Bionische Prothesen können<br />
fast so viel wie menschliche GliedmaSSen und sollen in naher<br />
Zukunft sogar echten Spürsinn entwickeln.<br />
Von Theresia Tasser<br />
Schnitzel schneiden, Weinflaschen<br />
entkorken, Hemdknöpfe schließen.<br />
Was für uns Zweihänder zum banalen<br />
Alltag zählt, kann für Menschen mit einem<br />
amputierten Arm recht schnell<br />
zum Alptraum mutieren. Eine mechanische<br />
Hand à la Goethes Götz von<br />
Berlichingen stellt auch keine große<br />
Hilfe dar. Mit traditionellen Prothesen<br />
kann man zwar die Faust ballen und<br />
damit auf den Tisch schlagen, aber<br />
keine Schuhbänder binden. Bei komplexen<br />
Bewegungsabläufen und feinmotorischen<br />
Finessen geraten die<br />
Ersatzarme unweigerlich an die Grenzen<br />
ihrer mechanischen Möglichkeiten.<br />
Erst die bionische Prothetik, eine<br />
Kombination aus Medizintechnik,<br />
Biologie und Neurochirurgie, die auf<br />
der Reproduktion natürlicher Bewegungsmuster<br />
basiert, ist alltäglichen<br />
Anforderungen zunehmend gewachsen<br />
und sorgt derzeit für einen Quantensprung<br />
von Lebensqualität und<br />
Bewegungsfreiheit.<br />
von dädalus’ flügel<br />
zur bionischen<br />
hightech-prothese<br />
Die Idee der Bionik, also der technischen<br />
Umsetzung natürlicher Abläufe,<br />
ist nicht ganz neu. Schon in der griechischen<br />
Mythologie wurde das Thema<br />
aufgegriffen – Dädalus hat sich an<br />
der Imitation des Vogelflugs versucht,<br />
als er seine Flügel baute. Eindeutig<br />
neu und bahnbrechend sind allerdings<br />
die Fortschritte der bionischen<br />
Forschung und Entwicklung, die zu<br />
laufend präziseren und funktionsgetreueren<br />
Hightech-Gliedmaßen führen.<br />
Die heuti gen „Handlanger“ haben<br />
bereits aus reichend Potenzial, um im<br />
wahrsten Sinn des Wortes mit dem<br />
Menschen zu verwachsen: Targeted<br />
Muscle Reinervation (TMR – ein Verfahren,<br />
bei dem Nervenreste für die<br />
bionische Prothese aktiviert werden)<br />
und Pattern Recognition (Erkennung<br />
von Mustern) sind zwei technologische<br />
Errungenschaften, dank derer<br />
die innovativen Phantomarme direkt<br />
durch Gedankensteuerung reagiert.<br />
28
Foto: © fdpa/t mn<br />
WENN DER EIGENE ANBLICK SCHMERZT<br />
Wenn wir allmorgendlich in den Spiegel blicken, kann es vorkommen, dass unser Abbild<br />
verkatert, übermüdet oder unfrisiert zurückschaut. Ein wenig erfreulicher, aber<br />
dennoch vergänglicher Zustand. Was aber empfinden Menschen, die anstelle einer<br />
Nase ein Loch besitzen, das freie Sicht auf das Gaumensegel gewährt. Oder die wegen<br />
ihrer Einäugigkeit blöd angestarrt werden. Dagegen hilft nur ewige Einsiedelei<br />
oder eine Epithese. Diese künstlichen Gesichtsteile zur Kaschierung fazialer Defekte<br />
können zwar an einer Brille befestigt werden, aber sehr praktikabel ist diese Möglichkeit<br />
nicht. Besser für den Patienten und dessen Selbstbewusstsein ist zweifelsohne<br />
ein chirurgisches Implantat.<br />
In Österreich werden künstliche Gesichtsprothesen nur im AKH Linz angebracht.<br />
Gefertigt werden diese Kunststücke der menschlichen Maskenbildnerei meist von<br />
Zahntechnikern mit Zusatzausbildung. Die Befestigung erfolgt mit Hautmagneten<br />
und einem Titanstift im Knochen, was um vieles teurer als die Brillenvariante, aber<br />
auch um vieles menschenwürdiger ist. „Wenn außerdem die Brille beschlägt, kann<br />
man sie nicht abnehmen, weil man sie mit der Nase abnehmen würde,“ sagt Chirurg<br />
Hubert Ofner vom LKH Linz in einem Interview. „Das soziale Leben des Patienten ist<br />
eingeschränkt, weil er sich mit dieser unsicheren Epithese fast nicht in die Öffentlichkeit<br />
traut.“ Ganz nach dem alten, inhumanen Motto „Wer den Schaden hat, braucht<br />
für den Spott nicht zu sorgen.“ Bleibt zu wünschen, dass hierzulande statt Hautkleber<br />
und Brillen nur noch chirurgische Versatzstücke zum Einsatz kommen, was aber<br />
meist weniger an deren technischer Machbarkeit sondern an der Kostenerstattung<br />
der Krankenkassen scheitert.<br />
Ein internationaler Pionier auf diesem<br />
Gebiet ist Oskar Aszmann, Experte für<br />
plastische und rekonstruktive Chirurgie,<br />
der in Wien am Christian-Doppler-<br />
Labor für die Wiederherstellung von<br />
Extremitätenfunktionen gemeinsam<br />
mit dem Prothesenhersteller Otto<br />
Bock an einem speziellen Computerprogramm<br />
arbeitet, das individuelle<br />
Bewegungsmuster speichert. Durch<br />
die Übertragung auf die Prothese lassen<br />
sich beinahe 80 Prozent der Leistungsfähigkeit<br />
einer gesunden Hand<br />
erzielen, denn sie reagiert unmittelbar,<br />
ohne Zeitverzögerung.<br />
Signalübertragung<br />
von mensch auf<br />
maschine ist<br />
diffizil<br />
„Ich stehe anderen in fast nichts nach“,<br />
bestätigt Patrick Mayrhofer in einem<br />
YouTube-Interview. Der junge Linzer<br />
Elektrotechniker, dem 2008 nach einem<br />
Arbeitsunfall der linke Arm amputiert<br />
wurde, trägt seit 2011 eine<br />
so genannte Michelangelo-Hand der<br />
Firma Otto Bock. Diese wird über<br />
gedankeninitiierte Nervenimpulse<br />
gesteuert, die von Elektroden auf der<br />
Haut erfasst und in vorhandene Muskelgruppen<br />
geleitet werden, wo elektrische<br />
Signale an die Kunsthand gesendet<br />
werden. Wobei die Signalübertragung<br />
an der Schnittstelle<br />
Mensch-Maschine, also vom Körper<br />
zur Prothese, sehr diffizil ist. Heute<br />
kann Mayrhofer wieder problemlos<br />
Flaschen öffnen und Schuhbänder<br />
verknoten – wie jeder andere auch.<br />
natur schlägt<br />
technik immer<br />
(noch)<br />
Allen medialen Behauptungen zum<br />
Trotz ist die Prothese aber noch nicht<br />
gänzlich gedankengesteuert. Christian<br />
Hofer von Otto Bock spricht lieber<br />
von einer „intuitiven und simultanen“<br />
Bewegungsmöglichkeit der modernen<br />
Prothesen, das heißt, die Bewegungen<br />
kommen einem natürlichen<br />
Ablauf schon sehr nahe. Und von der<br />
prothetischen Zukunftsmusik, die derzeit<br />
unter Laborbedingungen komponiert<br />
wird: Weil die Anforderungen an<br />
den Bewegungsapparat von Mensch<br />
zu Mensch verschieden sind, gebe<br />
es zur Verbesserung des Alltags von<br />
Menschen mit eingeschränkter Mobilität<br />
ein fast unendliches Betätigungsfeld.<br />
Allerdings sei der Mensch so<br />
gut konstruiert, dass noch lange daran<br />
gearbeitet werden müsse, um an<br />
das von Natur aus Gestaltete heran zu<br />
kommen.<br />
Auch Hubert Egger, erster österreichischer<br />
Prothetik-Professor an der FH<br />
Oberösterreich, will Menschen, die<br />
Gliedmaßen verloren haben, möglichst<br />
viel an Lebensqualität zurück-<br />
geben. Und kämpft mit seinem Forscherteam<br />
gegen die derzeitige Gefühlskälte<br />
künstlicher Extremitäten an.<br />
„Bereits in naher Zukunft steht neben<br />
der motorischen Verbindung auch die<br />
Verbindung des sensorischen Teils<br />
des Nervensystems mit der Prothese“,<br />
erklärt Egger. „Weil dadurch die Prothese<br />
wie ein natürlicher Körperteil<br />
empfunden wird, kann sie vom Anwender<br />
viel zielsicherer gesteuert und<br />
als natürlicher Teil des Körpers angenommen<br />
werden.“<br />
die erste<br />
HAND PROTHese mit<br />
Fingerspitzengefühl<br />
ist greifbar<br />
Noch in diesem Jahr wird vom deutschen<br />
Kooperationspartner Vincent<br />
System die erste fühlende Handprothese<br />
mit Tastsinn auf den Markt gebracht<br />
(VINCENT evolution2). Dadurch<br />
wird dem Prothesenträger über<br />
eine sogenannte vibrotaktile Rückmeldung<br />
– durch Schwingungsfühler –<br />
wieder ein Berührungsgefühl von den<br />
Einzelfingern der Prothese vermittelt.<br />
Prothetik-Lösungen können auch mit<br />
einem ganz anderen Ziel hergestellt<br />
werden. So ist zum Beispiel die Exo-<br />
Hand der Firma Festo primär zum<br />
kraftunterstützenden Einsatz bei monotonen<br />
und anstrengenden Montage -<br />
tätigkeiten in der Industrie gedacht.<br />
<strong>Regeln</strong><br />
29
Schritt für Schritt wird das<br />
Bauprinzip der Natur entschlüsselt.<br />
Sogar feinmotorisch schwierige Bewegungen<br />
werden mit den Handprothesen<br />
der neuen Generation möglich.<br />
Fotos: festo.com<br />
„Entstanden ist dieses Future-Concept<br />
allerdings primär als Hilfsmittel<br />
für den Arbeitsalltag“, erklärt Wolfgang<br />
Keiner, Geschäftsführer von<br />
Festo Österreich. Als Spezialist für<br />
industrielle Automation beschäftigt<br />
sich das Unternehmen in erster Linie<br />
mit bionischen Lösungen, die körperlich<br />
anstrengende berufliche Tätigkeiten<br />
erleichtern, eine im Hinblick auf<br />
immer länger arbeitende, ältere Arbeitnehmer<br />
eine wichtige Herausforderung<br />
darstellt.<br />
Handschuh<br />
verstärkt Kraft<br />
in Fingern<br />
Die ExoHand wird aber auch im Bereich<br />
der Rehabilitation nach einem<br />
Schlaganfall eingesetzt: Sie wird wie<br />
ein Handschuh übergestülpt und erleichtert<br />
alltägliche Handgriffe, weil<br />
sie zum Beispiel die Kraft in den Fingern<br />
verstärkt.<br />
Im Bereich der Beinprothetik ist das<br />
Holzbein ein Bild der Vergangenheit<br />
und derart Rudimentäres wie Beschränkendes<br />
nur mehr Geschichte.<br />
Mittlerweile werden Erkenntnisse aus<br />
dem Gebiet der Armprothetik, deren<br />
Anforderung an die Beweglichkeit<br />
weit komplexer sind, bereits sinnvoll<br />
im Bereich der Beine genutzt. Davon<br />
profitiert auch der neunjährige Jan,<br />
dem nach einem schweren Schiunfall<br />
der rechte Unterschenkel abgenommen<br />
werden musste. Hubert Egger,<br />
der den kleinen Jan derzeit im wahrsten<br />
Sinn des Wortes auf die Beine<br />
hilft, ist guter Hoffnung, dass der<br />
Verlust des Beines die Möglichkeiten<br />
in seinem bevorstehenden Leben vergleichsweise<br />
wenig beeinträchtigt.<br />
„Freilich hängt das neben den technischen<br />
Möglichkeiten auch vom mentalen<br />
Zugang zu einem Leben mit einer<br />
Prothese ab“, meint er. Und weist<br />
auch auf diverse Hürden hin, die es<br />
noch zu überwinden bzw. zu optimieren<br />
gilt. Etwa die Sicherheit beim Gehen<br />
durch eine empfindsame Prothese,<br />
an der bereits geforscht wird.<br />
Oder Industriepartner, welche letztendlich<br />
leistbare, zuverlässige und<br />
robuste Prothesen für Menschen<br />
unterschiedlichen Alters und in unterschiedlichen<br />
Alltagssituationen herstellen.<br />
TopModel mit<br />
Prothese<br />
Persönlichen Höchstleistungen stellen<br />
künstliche Unterschenkel jedoch<br />
bereits heute kein Bein mehr. Der<br />
Deutsche Mario Galla etwa, der seit<br />
seinem dritten Lebensjahr mit einer<br />
Prothese durchs Leben geht, kann<br />
nicht nur Fußball spielen und Rad<br />
fahren, er hat als Topmodel sogar<br />
den Olymp internationaler Laufstege<br />
erklommen. Trotz und vielleicht manchmal<br />
sogar wegen der Prothese und<br />
der daraus resultierenden Individualität.<br />
Heather Mills, die Exfrau des<br />
Beatle Paul McCartney, verlor bei einem<br />
Verkehrsunfall ein Bein und arbeitete<br />
weiterhin als Model. Heute<br />
macht sie mit sportlichen Einsätzen<br />
von sich reden. Mills, die in Kärnten<br />
lebt und trainiert, will bei den Paralympics<br />
2014, in den Alpinski-Bewerben<br />
antreten.<br />
Dennoch gilt es noch vieles zu erforschen,<br />
um natürlichen Mustern und<br />
Maßstäben zu entsprechen. „Die<br />
Mechanismen im Mikro- und Nanobereich<br />
müssen noch ganz exakt entschlüsselt<br />
und verstanden werden,<br />
um noch bessere Verfahren für die<br />
Neuroprothetik zu entwickeln.“<br />
Nanotechnologie<br />
macht sehende<br />
Augenprothesen<br />
möglich<br />
Frank Rattay, Präsident der TU-Bio-<br />
Med (Gesellschaft für Biomedical<br />
Engineering an der TU Wien), sieht<br />
die zukünftige Größe bionischer<br />
Ersatzglieder vor allem im Kleinen:<br />
„Es wird viel von Nanotechnologie gesprochen,<br />
aber in der Medizintechnik<br />
bewegen wir uns zumeist noch im<br />
Millimeter-Bereich“, stellt er fest.<br />
„Damit haben wir noch viel Potenzial<br />
und Entwicklungsarbeit vor uns.“<br />
Aber wenn es irgendwann gelingt,<br />
etwa das Netzwerk der Nervenzellen<br />
in der Retina wissenschaftlich zu<br />
durchblicken und technisch nachzuvollziehen,<br />
dann werden sogar<br />
Augen prothesen dank kleinster implantierter<br />
Fotorezeptoren sehend<br />
werden. Erste Erfolge, bei denen blinde<br />
Menschen durch eingepflanzte Computerchips<br />
schemenhaft Buchstaben<br />
erkennen können, gibt es bereits.<br />
•<br />
30
Unmissverständliche Signale<br />
Eigentlich sind Verkehrszeichen und -regeln international<br />
einheitlich, und doch sind die Unterschiede mitunter<br />
beträchtlich. In Indien sollten Fahrzeuglenker auf die<br />
Arme ihrer Kollegen achten. In Kanada bleibt man bei<br />
grün blinkenden Ampeln besser stehen. Von Silvia Wasserbacher-Schwarzer<br />
daten & fakten<br />
Autofahren mit Handzeichen<br />
In Ländern mit besonders hohem Verkehrsaufkommen, wie zum<br />
Beispiel in Indien, reichen Verkehrsschilder sowie Blinker und<br />
Bremslichter nicht aus, um durch die Rushour zu kommen. Hier sind<br />
die Fahrer aufgefordert, zusätzlich zum Lenken Handzeichen zu geben,<br />
um ihr nächstes Manöver anzukündigen. Beispielsweise zeigt<br />
eine rotierende Hand an, ob man nach rechts oder links abbiegt.<br />
Handfläche nach unten heißt, dass man stehen bleibt und winken<br />
bedeutet, dass man dem anderen gestattet, zu überholen.<br />
Wie fährt man in Indien Auto?<br />
Will links<br />
abbiegen<br />
Eine Sprache auf allen Straßen<br />
Damit sich Verkehrsteilnehmer weltweit<br />
im Straßenverkehr zurecht finden, hat die<br />
UNO im Wiener Übereinkommen über<br />
Straßenverkehrszeichen das Aussehen<br />
einheitlicher Verkehrsschilder festgelegt.<br />
Erkennen Sie, was die Tafeln in Ländern,<br />
welche das Übereinkommen nicht unterzeichnet<br />
haben, bedeuten?<br />
Erkennen Sie diese Verkehrszeichen?<br />
Die Auflösung findet sich auf der<br />
Rückseite des Magazins.<br />
1<br />
Indien<br />
2<br />
Japan<br />
Will rechts<br />
abbiegen<br />
5<br />
Türkei<br />
3<br />
China<br />
Stoppe<br />
jetzt!<br />
Werde<br />
langsamer<br />
Wie geht das<br />
internationale<br />
Blinkalphabet?<br />
4<br />
Japan<br />
Warum stehen<br />
an der Kreuzung<br />
kurzzeitig alle<br />
Fahrzeuge?<br />
Gelbes Blinken<br />
Eine gelb blinkende<br />
Ampel in Deutschland,<br />
Österreich oder der<br />
Schweiz bedeutet<br />
„Vorsicht“ – ohne dass<br />
ein zwingendes Stehenbleiben<br />
verlangt wird.<br />
Grünes Blinken<br />
Wenn die Ampeln auf Hauptstraßen in<br />
British Columbia (Kanada) andauernd<br />
grün blinken, liegt es nicht an einer<br />
defekten Lampe. Vielmehr ist es das<br />
Freisignal für Autofahrer. Fußgängern,<br />
welche die Straße überqueren möchten,<br />
gibt es den Hinweis, den Aktivierungsknopf<br />
zu drücken. Das Signal<br />
springt auf Gelb und Rot für die Autos,<br />
die Fußgänger bekommen ihr „walk“<br />
(Grünsignal).<br />
Rotes Blinken<br />
Es gibt aber auch rotes<br />
Blinklicht – zum Beispiel<br />
in den USA. Dieses hat<br />
die gleiche Bedeutung<br />
wie ein Stoppschild:<br />
Erst nach dem Anhalten<br />
ist ein langsames Weiterfahren<br />
erlaubt, sofern die<br />
Kreuzung frei ist.<br />
Zwischenzeit<br />
Es gibt amtliche Zwischenzeiten, deshalb haben phasenweise alle<br />
Verkehrsteilnehmer an der Kreuzung Rot. Die Zwischenzeit ist jene<br />
Zeitspanne, in der die Ampel auf der einen Seite gerade von Grün auf<br />
Rot umspringt und ums Eck gerade noch Rot ist.<br />
Die Zwischenzeit verhindert eine Kollision durch eine zu rasche Grünphase<br />
auf der einen Seite, wenn gleichzeitig auf der anderen Seite noch<br />
nicht alle Fahrzeuge den Kreuzungsbereich verlassen haben. Die exakte<br />
Zwischenzeit, die in Sekunden berechnet wird, richtet sich nach der<br />
Breite der Fahrbahn: Je breiter sie ist, und damit auch je größer die Kreuzung<br />
ist, desto länger ist die Zwischenzeit, weil mehr Zeit zum Verlassen<br />
der Kreuzung nötig ist.<br />
<strong>Regeln</strong><br />
31
Querspur Das Zukunftsmagazin des ÖAMTC<br />
Beim Gehen<br />
wird nicht gegessen,<br />
getrunken, telefoniert<br />
oder geraucht.<br />
Beim<br />
Stiegensteigen<br />
werden nur<br />
die Fußballen<br />
aufgesetzt, der Einsatz<br />
der Fersen wird<br />
vermieden.<br />
Beim<br />
Gehen auf der<br />
Straße überlässt die<br />
rangniedrigere Person<br />
der ranghöheren die<br />
rechte Seite<br />
(Ehrenplatz).<br />
Auch wenn<br />
„der Knigge“<br />
heute als die Bibel<br />
guter Umgangsformen gilt – die<br />
ursprüngliche Version von 1788 war<br />
kein Benimmbuch. Vielmehr verfasste<br />
Adolph Freiherr Knigge sein Werk<br />
„Über den Umgang mit Menschen“<br />
als eine Aufklärungsschrift, die darüber<br />
Auskunft gab, wie man höflich mit<br />
Menschen von verschiedenen Temperamenten<br />
umgeht. Erst später kamen Benimmregeln<br />
hinzu. Heute gibt der Deutsche Knigge Rat<br />
regelmäßig neue, an gesellschaftliche<br />
Entwicklungen angepasste<br />
Verhaltensregeln<br />
heraus.<br />
32<br />
Auflösung Seite 31: 1 Überholverbot/Indien 2 Überholverbot/Japan 3 Vorrang geben/China 4 Stoppschild/Japan 5 Einbahn/Türkei