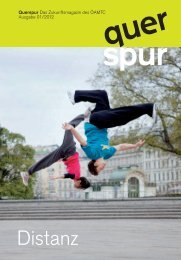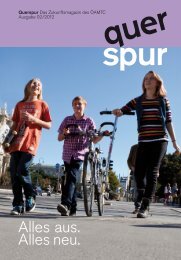Leidenschaft
Querspur: Das Zukunftsmagazin des ÖAMTC Ausgabe 03/2013
Querspur: Das Zukunftsmagazin des ÖAMTC
Ausgabe 03/2013
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Querspur Das Zukunftsmagazin des ÖAMTC<br />
Ausgabe 03/2013<br />
<strong>Leidenschaft</strong><br />
<strong>Leidenschaft</strong><br />
1
<strong>Leidenschaft</strong><br />
Was ist<br />
Entrepreneurship?<br />
Entrepreneurship bedeutet,<br />
neue Marktchancen zu erkennen,<br />
daraus eine Geschäftsidee zu entwickeln und diese<br />
selbst unter Ungewissheit in Form von innovativen<br />
Geschäftsmodellen umzusetzen. In seiner heutigen<br />
Ausprägung hat der österreichische Ökonom<br />
Joseph Schumpeter den Begriff maßgeblich<br />
gestaltet. Der Entrepreneur ist ein ständiger Innovator,<br />
der Wirtschaftswachstum und sozialen Wandel<br />
vorantreibt. Der Unterschied zum Unternehmer ist,<br />
dass nicht alle Unternehmer zwingend innovativ sein<br />
müssen und Unternehmer meist auch die Eigentümer<br />
des Unternehmens sind. Ein Entrepreneur<br />
kann hingegen auch in einem<br />
Unternehmen beschäftigt sein –<br />
als Intrapreneur.<br />
Quellen:<br />
1 Statistik Austria<br />
2 www.bmvit.gv.at<br />
Was ist<br />
Familie?<br />
Das Wort Familie stammt aus dem<br />
Lateinischen familia für „Hausgemeinschaft“.<br />
Eine einheitliche Definition gibt<br />
es nicht. Ein Vorschlag ist das Kernfamilienkonzept<br />
der Vereinten Nationen. 1 Danach<br />
bilden Ehepaare oder Lebensgemeinschaften<br />
mit oder ohne Kinder eine Familie.<br />
Alleinerziehende Elternteile mit Kind(ern)<br />
werden als Ein-Eltern-Familie bezeichnet.<br />
Wenn Alleinerzieher neue Lebensgemeinschaften<br />
eingehen,<br />
entsteht eine<br />
Patchworkfamilie.<br />
Was ist<br />
<strong>Leidenschaft</strong>?<br />
<strong>Leidenschaft</strong> ist ein Zustand völlig<br />
vereinnahmender Emotion. Das Wort ist<br />
eine Erfindung des deutschen Schriftstellers<br />
Philipp von Zesen, der im 17. Jahrhundert<br />
lateinische Ausdrücke durch seine<br />
deutschen Kreationen ersetzte. Passion –<br />
von passio, „leiden“ – ersetzte er durch das<br />
althochdeutsche lidan, was so viel heißt<br />
wie „erfahren, durchmachen“. Nicht mit<br />
allen Erfindungen war von Zesen<br />
erfolgreich: Das Fenster – vom<br />
lateinischen fenestra – wird heute<br />
nicht als Tageleuchter<br />
bezeichnet.<br />
Wo sind die<br />
meisten<br />
Oldtimer zugelassen?<br />
Gemessen an der Einwohnerzahl<br />
gibt es die meisten Oldtimer in<br />
Oberösterreich. Hier sind<br />
779 PKW als historische Kraftwagen<br />
zugelassen(55 auf 100.000 Einwohner).<br />
Im Burgenland fahren die wenigsten<br />
Oldtimer: Hier kommen nur<br />
30 Zulassungen<br />
auf 100.000<br />
Einwohner. 2<br />
Was ist eine<br />
Benefit Corporation?<br />
Die Benefit Corporation (B Corp)<br />
wurde 2010 in den USA eingeführt. Sie dient<br />
vor allem jungen Unternehmern, die in ihrem<br />
Geschäftsmodell soziale Komponenten vorgesehen<br />
haben, dazu, leichter an Wachstumskapital zu kommen.<br />
Durch die Gründung einer B Corp wird Transparenz<br />
über die gesellschaftlichen und unternehmerischen Ziele<br />
geschaffen. Impact-Investoren, die mit ihrem<br />
Geld gezielt Gutes tun wollen, können gezielter<br />
angezogen werden. Eine B Corp muss jährlich<br />
verpflichtend einen Benefit Report vorlegen, in<br />
dem sie Rechenschaft über ihre sozialen und<br />
ökologischen Aktivitäten ablegt.<br />
Derzeit gibt es in den<br />
USA 650 B Corps.<br />
Wo sitzt<br />
<strong>Leidenschaft</strong>?<br />
Das Herz ist der Quell aller<br />
<strong>Leidenschaft</strong>, sagt der Volksmund. Die<br />
Wissenschaft ist anderer Meinung und<br />
erkennt den Ursprung der Emotion vor<br />
allem in den Mandelkernen, einer<br />
Funktionseinheit des limbischen Systems,<br />
das sich durch das gesamte Gehirn zieht.<br />
Es handelt sich also um keinen<br />
bestimmten Teil des Gehirns, sondern<br />
ein komplexes Netzwerk neuronaler<br />
Schaltkreise, das bis heute nicht<br />
genau erforscht ist.<br />
Wann wird ein<br />
Auto zum Oldtimer?<br />
Als historische Kraftwagen gelten<br />
in der Fachsprache Autos bis zum<br />
Baujahr 1955, sowie jene, die älter als 30 Jahre<br />
sind und in die Liste der historischen<br />
Kraftfahrzeuge vom Bundesministerium für Verkehr,<br />
Innovation und Technologie eingetragen sind. Sie<br />
dürfen laut Gesetz nur an 120 Tagen pro Jahr<br />
gefahren werden. Historische Krafträder nur an<br />
60 Tagen pro Jahr. Über die Verwendung ist ein<br />
Fahrtenbuch zu führen, das auch den Zweck<br />
der Fahrt enthält. 2 Diese genaue Regelung ist<br />
nötig, weil Oldtimer bei Steuern und<br />
Versicherung begünstigt<br />
sind (z.B. keine NoVA<br />
oder CO 2<br />
-Steuer).<br />
Impressum und Offenlegung<br />
Medieninhaber und Herausgeber<br />
Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC),<br />
Schubertring 1-3, 1010 Wien, Telefon: +43 (0)1 711 99 0<br />
www.oeamtc.at<br />
ZVR-Zahl: 730335108, UID-Nr.: ATU 36821301<br />
Vereinszweck ist insbesondere die Förderung der Mobilität unter<br />
Bedachtnahme auf die Wahrung der Interessen der Mitglieder.<br />
Rechtsgeschäftliche Vertretung DI Oliver Schmerold, Verbandsdirektor;<br />
Mag. Christoph Mondl, stellvertretender Verbandsdirektor.<br />
Konzept und Gesamtkoordination winnovation consulting gmbh<br />
Chefredaktion Mag. Gabriele Gerhardter (ÖAMTC),<br />
Dr. Gertraud Leimüller (winnovation consulting)<br />
Chefin vom Dienst Silvia Wasserbacher, BA, MA<br />
Mitarbeiter dieser Ausgabe Dipl-Bw. Maren Baaz, Matthias Berger, Margit Hurich,<br />
Mag. (FH) Christian Huter, Mag. Claudia Kesche, Mag. Uwe Mauch, MMag. Ursula Messner,<br />
Dr. Daniela Müller, Martin Strubreiter, Dr. Ruth Reitmeier, Mag. Julia Schilly, Katrin Stehrer, BSc,<br />
DI Anna Várdai, Silvia Wasserbacher, BA, MA<br />
Grafik Design, Illustrationen Drahtzieher Design & Kommunikation, Barbara Wais, MA<br />
Fotos Karin Feitzinger<br />
Raumtechnik Filippos Zisidis<br />
Korrektorat Christina Preiner, vice-verba<br />
Covermodels siehe Umschlagrückseite<br />
Druck Hartpress<br />
Blattlinie Querspur ist das zweimal jährlich erscheinende Zukunftsmagazin des ÖAMTC.<br />
Ausgabe 03/2013, erschienen im April 2013<br />
Download www.querspur.at
8<br />
12<br />
20<br />
31<br />
4<br />
14<br />
17<br />
18<br />
22<br />
24<br />
28<br />
Heute<br />
Erhofft und doch verbannt. Sie ist<br />
Quelle des Neuen und bringt uns voran.<br />
Trotzdem verbannen wir die <strong>Leidenschaft</strong> aus<br />
vielen Lebensbereichen. Von Daniela Müller<br />
Leben was man liebt, lieben was man<br />
tut. Bauchtanz, Handschrift, Pollenforschung:<br />
Drei Menschen, die es schaffen, ihren ungewöhnlichen<br />
Vorlieben im Alltag zu fröhnen.<br />
Von Uwe Mauch<br />
Altes Blech, junge Freude. Sammelobjekte<br />
sagen oft mehr über ihre Besitzer<br />
aus, als man auf den ersten Blick vermutet.<br />
Von Martin Strubreiter<br />
Von West nach Ost: Wo schlägt das<br />
Herz den Kopf? Die Passionen der<br />
Österreicher nach Bundesländern.<br />
Von Silvia Wasserbacher<br />
Morgen<br />
Gutes tun und Geld verdienen.<br />
Eine Reportage über den Hub-Vienna, der<br />
größte Knotenpunkt für Social Entrepreneurs<br />
in Österreich. Von Uwe Mauch<br />
Die rastlose Weltfamilie. Immer mehr<br />
Familien leben getrennt voneinander.<br />
Wieviel physische Nähe braucht es in einer<br />
globalisierten Welt? Von Julia Schilly<br />
Laufen, kaufen, um Punkte raufen.<br />
Was wirklich in Kundenbonusprogrammen<br />
steckt. Von Matthias Berger<br />
<strong>Leidenschaft</strong> braucht Trott. Christian<br />
Hlade, Gründer von „WeltweitWandern“,<br />
verrät, wie er sich durch große Reisen<br />
verändert hat und wie wir in Zukunft reisen<br />
werden. Von Daniela Müller<br />
Start-ups. Spannende Ideen aus aller Welt<br />
von oder für Menschen mit <strong>Leidenschaft</strong>.<br />
Von Katrin Stehrer<br />
Programmierte Empathie.<br />
Der Mensch überschreitet Grenzen, indem<br />
er Maschinen auf Emotion programmiert.<br />
Von Ruth Reitmeier<br />
Die Suche nach dem Glück.<br />
Die österreichische Filmemacherin Clara<br />
Harden fi nanziert ihre außergewöhnlichen<br />
Projekte über Crowdfunding. Ein Knochenjob.<br />
Von Ruth Reitmeier<br />
Foto: © Karin Feitzinger<br />
4<br />
8<br />
14<br />
Foto: © www.iuro-project.eu<br />
24<br />
<strong>Leidenschaft</strong><br />
3
Talia Radford<br />
Mitbegründerin von<br />
taliaYsebastian, einem<br />
Industriedesign-Studio,<br />
das neue, nachhaltige<br />
Technologien mit dem<br />
richtigen Design verbindet<br />
Lena Robinson<br />
PR-Managerin bei<br />
Three Coins, einem<br />
Unternehmen,<br />
das Jugendlichen<br />
den Umgang mit<br />
Geld näher bringt<br />
Alexis Eremia<br />
Co-Gründerin des<br />
Hub Vienna<br />
Claudia Käfer<br />
Mitbegründerin von<br />
Inventures, einer<br />
Online Plattform,<br />
die Startups für eine<br />
breite Öffentlichkeit<br />
sichtbar macht<br />
Erika Büttner<br />
Mitbegründerin von<br />
Papertown, einem<br />
Designstudio, das mit dem<br />
Konstruktionsmaterial 4<br />
Karton arbeitet<br />
Foto: © Karin Feitzinger
Gutes tun und<br />
Geld verdienen<br />
THE HUB VIENNA IN WIEN 7 IST NICHT NUR EIN ARBEITSPLATZ<br />
MIT BESONDEREM FLAIR, SONDERN AUCH EIN MAGNET FÜR<br />
KREATIVE UND SOZIAL ENGAGIERTE UNTERNEHMER.<br />
EINE MODERNE ARBEITSWELT-REPORTAGE.<br />
Von Uwe Mauch<br />
Es ist der Freitag nach dem Fest, der<br />
Freitag nach dem Drei-Jahres-Jubiläum.<br />
Anderswo meldet man sich nach<br />
einer derart fröhlichen Nacht vorsichtshalber<br />
krank. Oder nimmt sich<br />
einen Urlaubstag. Oder lässt sich anmerken,<br />
dass man heute nicht mehr<br />
fröhlich ist.<br />
Nicht so hier. The Hub Vienna in einem<br />
Hinterhofhaus in der Lindengasse<br />
Nr. 56 in Wien 7 ist eine moderne<br />
Denkfabrik und ein Coworking-<br />
Space. Vor allem für Menschen aus<br />
der jahrelang bemitleideten „Generation<br />
Praktikum“, die nicht darüber<br />
jammern, dass die Welt so schlecht<br />
ist, sondern lieber hart daran arbeiten<br />
wollen, dass die Welt ein wenig besser<br />
wird. Einige verdienen mit ihren<br />
Projekten und Unternehmen, die von<br />
kreativen Ideen, professionellen<br />
Zugängen zur Arbeit und sozialem<br />
Engagement getragenen sind, auch<br />
schon gutes Geld!<br />
MAN FEUERT SICH<br />
GEGENSEITIG AN<br />
Gegen 9 Uhr werden auf den selbst<br />
gebauten Tischen die ersten Mac-<br />
Books aufgeklappt. Auch am Beginn<br />
des vierten Jahres will das emsige<br />
Tippen auf den schwarzen Plastiktasten<br />
nicht verstummen.<br />
„The Hub ist ein inzwischen weltweit<br />
verbreitetes Netzwerk, das ursprünglich<br />
in London entwickelt wurde“, verrät<br />
Lena Robinson am Eingang zum<br />
ebenso klug wie stilsicher eingerichteten<br />
Wiener Umschlagplatz für<br />
nachhaltiges, sozial- und umweltverträgliches<br />
Wirtschaften.<br />
Mister Jonathan Robinson, nicht verwandt<br />
mit der Wiener Frau Robinson,<br />
hat es im Jahr 2005 gegründet. Der<br />
englische Anthropologe wollte nicht<br />
länger hinnehmen, dass die Kreativen<br />
in London in ihren Schlafzimmern und<br />
Werkstätten vor sich hinwerken, ohne<br />
sich gegenseitig anzufeuern, immer<br />
hart am Abgrund zum Prekariat. So<br />
eröffnete er mit Mitstreitern und<br />
Freunden die erste Schnittstelle für<br />
so genannte Social Entrepreneurs.<br />
Per Defi nition sind das Selbstständige,<br />
die innovative unternehmerische<br />
Lösungen für drängende soziale<br />
Probleme fi nden und umsetzen.<br />
The Hub Vienna wurde Anfang 2010<br />
eröffnet. Damals als Nr. 15 in der<br />
langen Hub-Kette. Heute gibt es<br />
bereits 37 Schnittstellen – von<br />
Sao Paolo über London und Wien bis<br />
Shanghai. In der Wiener Filiale sind<br />
knapp 300 Mitglieder registriert. Das<br />
Spektrum reicht hier von Industriedesignern<br />
über Improvisationskünstler<br />
bis zu ehemaligen Geschäftsführern<br />
in Konzernen und Bankern, für die<br />
Geld nicht alles ist. Sie alle eint die<br />
Überzeugung, dass man als Mensch<br />
gut leben und Geld verdienen kann,<br />
auch wenn man das Gemeinwohl im<br />
Fokus hat.<br />
DREI MÜNZEN GEGEN<br />
DIE SCHULDENFALLE<br />
Auch die Namensvetterin des Londoner<br />
Hub-Gründers, Lena Robinson,<br />
hat Anthropologie studiert. Und auch<br />
sie will mit ihrer Arbeit gesellschaftlich<br />
etwas bewegen. Die 26-jährige<br />
Grazerin hat zuvor erfolgreich im Tourismus-Marketing<br />
und im Kultur-Management<br />
gearbeitet. Im Hub Vienna,<br />
das auf insgesamt 400 Quadratmetern<br />
ausreichend Platz für individuelle<br />
Entfaltung und gemeinsame Gestaltung<br />
lässt, ist sie für die Pressearbeit<br />
zuständig.<br />
Darüber hinaus engagiert sich Robinson<br />
für die „Three Coins“ GmbH.<br />
Social Entrepreneurship<br />
Social Entrepreneurs lösen drängende soziale und ökologische Probleme<br />
mittels marktwirtschaftlicher Mechanismen. Eines ihrer großen<br />
internationalen Vorbilder ist Muhammad Yunus, Friedensnobelpreisträger<br />
und Gründer der Grameen Bank. Die „Bank für die Armen“<br />
vergibt Mikrokredite an Menschen ohne Einkommenssicherheiten.<br />
Nur durch die soziale Kontrolle in der Community wird eine Rückzahlungsquote<br />
von 97 % erreicht.<br />
Im Unterschied zu NGOs erwirtschaften Social Entrepreneurs das<br />
Geld zum Betrieb ihrer Unternehmen selbst. Gewinne werden häufi g<br />
ins Unternehmen reinvestiert. Die Wurzeln von Social Entrepreneurship<br />
reichen weit in die Geschichte zurück. Mittlerweile ist daraus<br />
eine weltweite Bewegung mit vielen Initiativen, großem Zulauf von<br />
jungen Unternehmern sowie einer Ausstrahlung bis in etablierte, gewinnorientierte<br />
Unternehmen entstanden.<br />
<strong>Leidenschaft</strong><br />
5
Der Hub Vienna ist der größte<br />
Knotenpunkt für Social Entrepreneurs<br />
in Österreich und Teil eines globalen<br />
Netzwerkes mit mehr als 5000 Mitgliedern.<br />
Wiener Zentrum für Social Entrepreneurs:<br />
www.vienna.the-hub.net<br />
Spielend den Umgang mit Geld lernen:<br />
www.threecoins.org<br />
Dekorationen aus der Wiener Papierstadt:<br />
www.papertown.at<br />
Foto: © Karin Feitzinger<br />
Moderne Kultur in der Lichtfabrik:<br />
www.dielichtfabrik.at<br />
Best of CEE Start-ups:<br />
www.inventures.eu<br />
Design zum An- und Begreifen:<br />
www.taliaysebastian.com<br />
Die Idee dafür kam von einer Juristin<br />
und einem Game-Designer. So unterschiedlich<br />
ihr Beruf, so eindeutig ihre<br />
Geschäftsidee. Robinson: „Wir entwickeln<br />
ein Online-Spiel, das 14- bis<br />
19-Jährigen den Umgang mit Geld<br />
näher bringen soll, ausgehend von<br />
der Beobachtung, dass bei immer<br />
mehr jungen Menschen allzu schnell<br />
die Schuldenfalle zuschnappt.“<br />
PAPIERSTADT UND<br />
LICHTFABRIK<br />
Am Nebentisch arbeitet Erika<br />
Büttner an sehr Konkretem. Mit dem<br />
Architek ten Philipp Blume, einem<br />
Konstrukteur und einem Licht- und<br />
Mediendesigner hat sie den Beweis<br />
erbracht, dass Papier viel mehr sein<br />
kann als nur geduldig.<br />
In ihrem Design-Studio „papertown“<br />
auf dem Sparkassenplatz in Wien 15<br />
wird Karton als Alternative zu Kunststoff<br />
verwendet. Vor allem zur Gestaltung<br />
und Dekoration von Messeständen,<br />
Bühnen und Einrichtungsgegenständen.<br />
„Wir sind erst seit einem<br />
dreiviertel Jahr als Firma aktiv, und<br />
können uns nicht über zu wenig<br />
Nachfrage beklagen“, freut sich<br />
Büttner. Im Gegenteil. Und damit ihr<br />
Leben ausreichend spannend bleibt,<br />
will die Projektentwicklerin, die in ihren<br />
ersten 28 Lebensjahren schon erstaunlich<br />
viel von der Welt gesehen<br />
hat, nebenbei die „Lichtfabrik“ im<br />
Wiener Kulturgefüge etablieren: „Als<br />
ein Kulturzentrum, das noch wenig<br />
bekannten Künstlern eine Bühne<br />
bieten soll.“<br />
AUSSERGEWÖHNLICHE<br />
IDEEN WERDEN NICHT<br />
BELÄCHELT<br />
Am Hub schätzt Büttner die familiäre<br />
Atmosphäre und die Möglichkeit, inspirierende<br />
Menschen kennen zu lernen:<br />
„Wenn man hier eine außergewöhnliche<br />
Idee vorstellt, wird man<br />
nicht belächelt, sondern beraten, wie<br />
man sie am besten umsetzen könnte.“<br />
Die Atmosphäre im Hub wirkt angenehm,<br />
entspannt. Auf dem Tresen der<br />
Bar in der Mitte, die signalisiert, dass<br />
6
der Mensch nicht nur zum Computerarbeiten<br />
gemacht wurde (sondern<br />
auch zum Netzwerken), stehen Kaffee<br />
und Kuchen. Dessen ungeachtet<br />
geht es an jedem der Tische, an denen<br />
geschrieben, kalkuliert, diskutiert<br />
und nachgedacht wird, um sehr viel.<br />
Nicht zuletzt um die Etablierung neuer<br />
Firmen und die fi nanzielle Grundlage<br />
deren Mitarbeiter.<br />
Auch Claudia Käfer hat noch einige<br />
Hürden aus dem Weg zu räumen. Im<br />
Moment arbeitet die 29-jährige Betriebswirtin<br />
und Soziologin an der Dekoration<br />
und Ausstattung eines neuen<br />
Hub-Portals im Internet. Dieses Schaufenster<br />
für Interessierte trägt den Namen<br />
„Inventures“ und wird von Social<br />
Entrepreneurs für Social Entrepreneurs<br />
gestaltet. Vorgestellt und damit<br />
auch unterstützt werden viel versprechende<br />
Start-up-Projekte.<br />
WESTEN WAR<br />
GESTERN<br />
Interessant ist dabei auch die Blickrichtung.<br />
„Westen war gestern“,<br />
sagt Käfer. Die Zukunft liegt auch<br />
für hiesige Kreative in den viel zitierten<br />
Ländern Mittel- und Osteuropas.<br />
Derzeit fi nanziert sich das Inventures-<br />
Portal, wie auch eine Reihe anderer<br />
Projekte im Hub, durch eine Förderung<br />
des Austria Wirtschaftsservice,<br />
kurz AWS, einer Einrichtung des<br />
österreichischen Wirtschaftsministeriums.<br />
Künftig will Käfer möglichst<br />
ohne Förderung auskommen. Dabei<br />
strebt sie ein Modell an, in dem die<br />
bereits Arrivierten den Gründern<br />
Starthilfe geben und so möglicherweise<br />
neue Partner fi nden.<br />
The Hub als modernes Haus der<br />
Begegnung ist auch eine Meisterleistung<br />
der Technik und Architektur. Es<br />
gibt kleine Telefonzellen, in denen<br />
man in Ruhe wichtige Gespräche<br />
führen kann; es gibt Ruhezonen zum<br />
Arbeiten ebenso wie zum Ausruhen,<br />
einen Seminarraum und ein größeres<br />
Atrium, das für Veranstaltungen gebucht<br />
werden kann. Der offene Raum<br />
ist multifunktional und mit wenigen<br />
Handgriffen veränderbar.<br />
Talia Radford betritt soeben das Hub.<br />
Sie sagt, dass sie gerne hierher kommt.<br />
Auch, weil man neben gleichgesinnten<br />
Geschäftspartnern auch neue<br />
Freunde und Bekannte kennen lernen<br />
kann. Das fi nanztechnische Know-how<br />
anderer Hubianer hat ihr schon bisher<br />
beim Aufbau ihrer Firma geholfen.<br />
„Und das möchte ich auch weiterhin<br />
nicht missen.“ Die 30-jährige Spanierin,<br />
die in Mallorca geboren wurde<br />
und in England zur Schule gegangen<br />
ist, sagt offen: „Ich habe Design studiert,<br />
nicht Business. Die Workshops<br />
für Start-up-Unternehmen waren daher<br />
für mich sehr hilfreich.“<br />
Radford ist Mitbegründerin des Industrial<br />
Design-Studios „taliaYsebastian“,<br />
das sich auf die Entwicklung von<br />
ausgeklügelten Design-Konzepten<br />
spezialisiert hat, um neue Umwelt<br />
schonende und sozial verträgliche<br />
Technologien einer breiteren Öffentlichkeit<br />
zugänglich und besser verständlich<br />
zu machen.<br />
LERNPROGRAMME FÜR<br />
DIE ECHTE UMSETZUNG<br />
VON IDEEN<br />
Dass Hub-Mitglieder keine Träumer<br />
sind, sondern Profi s in ihrem Metier,<br />
zeigt auch die Tatsache, dass ein<br />
namhafter Konzern wie Osram, der<br />
eine neue Generation von LED-Lampen<br />
entwickelt hat und diese in zwei<br />
Jahren auf den Markt bringen möchte,<br />
auf die Dienste des Ein-Frau-Unternehmens<br />
baut. Radford erklärt ihren<br />
Auftrag: „Um Vertrauen in die<br />
neue Technologie zu gewinnen, bedarf<br />
es auch einer speziellen Haptik<br />
und Didaktik, die den Menschen das<br />
neue, weniger Energie verbrauchende<br />
Licht-Konzept näher bringen soll.“<br />
Wer meint, dass es nach den spannenden<br />
Begegnungen mit Menschen, die<br />
viel positive Energie ausstrahlen, nicht<br />
mehr besser kommen kann, hat die<br />
Rechnung ohne die Bankerin Alexis<br />
Eremia gemacht. Eremia ist ein wahres<br />
Energiebündel, lacht gerne, wirkt dabei<br />
hoch konzentriert, ist eine Managerin,<br />
die naturgemäß auch die schwarzen<br />
Zahlen auf dem Papier im Auge hat,<br />
aber weit mehr als nur die Zahlen.<br />
Gemeinsam mit den beiden Jungunternehmern<br />
Matthias Reisinger und<br />
Hinnerk Hansen hat sie vor drei Jahren<br />
The Hub Vienna gegründet. Und damit<br />
wohl auch ein neues Kapitel in<br />
der österreichischen Wirtschaftsgeschichte<br />
eröffnet. Denn in der Tradition<br />
der hiesigen Sozialpartner gab<br />
es bisher nur das Lager-Denken:<br />
Hier die Eigentümer der Produktionsmittel,<br />
dort die Umwelt- und Arbeitnehmerschützer.<br />
Hier Wirtschafts-,<br />
dort Arbeiterkammer.<br />
„Ich habe in Bukarest Finanzwirtschaft<br />
studiert“, erzählt Eremia. „Ich habe<br />
dann auch in Wien in einer Bank gearbeitet.<br />
“ Um als Bankerin nicht ihre<br />
Ideale verraten zu müssen, habe sie<br />
sich immer eine Hintertür offen gehalten.<br />
„So kam es auch zur Hub-<br />
Gründung.“<br />
Dort ist nicht nur ihre gute Laune<br />
ansteckend, sie hilft auch den neuen<br />
Mitgliedern, Fuß zu fassen. Vor allem<br />
solchen, die eine gute Idee, aber keinen<br />
Businessplan haben. Speziell<br />
für sie hat sie eine ganze Reihe von<br />
Lernprogrammen entwickelt. Diese<br />
reichen von Workshops über spezielle<br />
Coachings bis hin zu Networking-<br />
Veranstaltungen.<br />
JEDER SCHULE IHREN<br />
ENTREPRENEURSHIP<br />
HUB<br />
Menschen wie Alexis Eremia machen<br />
sich naturgemäß auch Gedanken<br />
über die Zukunft: Schon bald wird es<br />
im offenen Raum in der Lindengasse<br />
zu eng werden. The Hub Vienna expandiert,<br />
weiterhin rasant. „Wir werden<br />
spätestens in einem Jahr einen<br />
größeren Raum benötigen.“ Und in<br />
Zukunft? Die Vordenkerin lächelt, dabei<br />
ist es ihr durchaus ernst: „Da wird<br />
es ohne Social Entrepreneurs in der<br />
Wirtschaft einfach nicht mehr gehen.<br />
Daher wünsche ich mir auch, dass es<br />
in Zukunft in jeder Schule des Landes<br />
eine Art Mini-Hub geben wird.“<br />
<br />
<strong>Leidenschaft</strong><br />
7
8<br />
Foto: © Karin Feitzinger, Illustration: Barbara Wais
Erhofft und<br />
doch verbannt<br />
SIE PACKT UNS, FESSELT UNS, VERÄNDERT UNS.<br />
SIE HAT REVOLUTIONEN AUSGELÖST UND GESELLSCHAFTEN VERÄNDERT.<br />
DOCH WARUM BLENDEN WIR LEIDENSCHAFT IM ALLTAG LIEBER AUS?<br />
Von Daniela Müller<br />
<strong>Leidenschaft</strong>. Die österreichische Tagespresse<br />
ist voll davon. Sie berichtet<br />
über die niederländische Königin<br />
Beatrix, die sich im Ruhestand ihrer<br />
<strong>Leidenschaft</strong>, der Bildhauerei, widmen<br />
wird, über den leidenschaftlichen<br />
Erneuerer populärer Filmgenres, den<br />
Regisseur Quentin Tarantino, oder<br />
über den Fußballklub Rapid, der seine<br />
<strong>Leidenschaft</strong> wiederentdeckt haben<br />
soll. Es wird geklagt, dass der Ausbau<br />
technischer Universitätsbereiche mit<br />
zu wenig Strategie und <strong>Leidenschaft</strong><br />
betrieben werde, und der polnische<br />
Bischof Tadeusz Pieronek betont, dass<br />
keine Macht den Menschen von dem<br />
abhalte, wozu ihn die <strong>Leidenschaft</strong>en<br />
trieben. Ja, wozu? Was steckt dahinter,<br />
was ist das genau, <strong>Leidenschaft</strong>?<br />
VORAUSSETZUNG IST,<br />
DASS MAN SICH<br />
ANGENOMMEN FÜHLT<br />
Unter <strong>Leidenschaft</strong> wird vieles subsummiert.<br />
Richtige <strong>Leidenschaft</strong> ergreift<br />
uns, lässt uns nicht mehr los.<br />
<strong>Leidenschaft</strong> kann aber auch als<br />
Ersatzhandlung in Erscheinung treten.<br />
Sie wird oft vorgetäuscht, wenn<br />
Menschen bluffen, um mit gespieltem<br />
Höchsteinsatz andere von ihrer Meinung<br />
zu überzeugen.<br />
Damit richtige <strong>Leidenschaft</strong> entstehen<br />
kann, braucht es laut Hirnforscher<br />
Gerald Hüther ein Grundvertrauen,<br />
dass man sich so, wie man ist, angenommen<br />
fühlt. In der Hirnforschung<br />
wird dieser Zustand als Kohärenz bezeichnet,<br />
wenn kein Widerspruch ist<br />
zwischen dem, was ist und dem, was<br />
man möchte. Doch diese Kohärenz,<br />
das Gefühl, dazuzugehören, fehlt vielen<br />
Menschen. Sie machen sich taub<br />
gegen diesen Schmerz und spüren<br />
sich nicht mehr. Zivilisationskrankheiten<br />
wie Magengeschwüre, Bluthochdruck<br />
oder Haltungsschäden<br />
sind Spätfolgen dieser verloren gegangenen<br />
Sensibilität. Oder sie suchen sich<br />
Ersatzhandlungen, die getarnt als<br />
<strong>Leidenschaft</strong> auftauchen. Das kann<br />
eine Sammelleidenschaft sein, ein<br />
Faible für teure Uhren oder schnelle<br />
Autos oder wenn Menschen die Karriereleiter<br />
hochklettern, um sich so<br />
Gehör und Ansehen zu verschaffen.<br />
Diese Menschen werden zwar selten<br />
froh, erklärt Hüther, sind meist aber<br />
zumindest einigermaßen zufrieden.<br />
Jedenfalls so lange, bis das vermeintliche<br />
Glück der Ersatzhandlung zerbricht.<br />
Etwa wenn es karrieremäßig<br />
nicht mehr weiter geht oder eine<br />
Sammelleidenschaft durch richtige<br />
<strong>Leidenschaft</strong> ersetzt wird, wenn der<br />
Sammler seinen Seelenpartner findet.<br />
Wobei: Das Hirn kann nicht unterscheiden,<br />
ob es sich um wahre <strong>Leidenschaft</strong><br />
handelt oder nur um eine Ersatzhandlung.<br />
EMOTION IST EINE<br />
BEDROHUNG<br />
<strong>Leidenschaft</strong> zeigt sich also in vielen<br />
Gesichtern. Wirkliche <strong>Leidenschaft</strong><br />
treibt uns an, kann aber auch negativ<br />
sein, wenn sie sich in Hass ausdrückt.<br />
Sie steckt hinter religiöser oder politischer<br />
Begeisterung und bringt uns<br />
dazu, trotz Gegenwinds unsere Ziele<br />
zu verfolgen. <strong>Leidenschaft</strong> ist auch<br />
eine zentrale Triebfeder, damit in der<br />
Zivilgesellschaft Wandlungen stattfinden<br />
können – sei es die Französische<br />
Revolution oder der Arabische Frühling.<br />
Nur: So richtig offen ist unsere<br />
Gesellschaft für <strong>Leidenschaft</strong> immer<br />
noch nicht. Emotion wird durch die<br />
gesamte Geschichte der Philosophie,<br />
und auch noch heute, als Gegensatz<br />
zum Verstand gesehen. „Gefahr“ gehe<br />
vom leidenschaftlichen Menschen<br />
in sofern aus, weil er für die anderen<br />
Mitglieder einer Gesellschaft weniger<br />
berechen- und steuerbar sei, sagt die<br />
deutsche Philosophin Eva-Maria<br />
Engelen.<br />
<strong>Leidenschaft</strong><br />
9
Foto: © www.publicdomainpictures.net, Illustration: Barbara Wais<br />
Nur Mut zur Ermutigung: Hirnforscher Hüther rät dazu, die Ideen und Träume der Kinder ernst zu nehmen und nicht schon an<br />
der Wurzel als Leichtsinn abzukanzeln. Das Resultat wäre, dass mehr Menschen ihre Ideen ohne Scheu umsetzen würden.<br />
Damit könnte sich die Gesellschaft ingesamt schneller weiterentwickeln.<br />
Über die Kraft der <strong>Leidenschaft</strong><br />
dachte schon Aristoteles nach: Von<br />
einer Herrschaftselite aus gleichberechtigten<br />
Männern sollten nur die<br />
tugendhaften regieren dürfen, die<br />
über die nötige Selbstbeherrschung<br />
verfügen. Diese sei Ausdruck von<br />
„geschulten Emotionen“. Wer etwa<br />
schamhaft sei, zeige, dass er über<br />
Bewusstsein für Gesetze und deren<br />
Übertretung verfüge.<br />
In der modernen Philosophie hat<br />
sich der gesellschaftliche Zugang zu<br />
<strong>Leidenschaft</strong> zwar verändert, mehr<br />
Platz hat sie aber nicht. „Heute wird<br />
vieles, was mit Emotionen zu tun hat,<br />
moralisierend betrachtet. Kinder dürfen<br />
zum Beispiel nicht mehr bockig<br />
sein. Haut eines um sich, ist es gleich<br />
ein Schlägertyp“, sagt Engelen. In<br />
der Arbeitswelt würden Sprache und<br />
Handeln immer mehr entemotionalisiert.<br />
Ein Beispiel: Obwohl man den<br />
Arbeitsauftrag des Vorgesetzten gern<br />
als „Schwachsinn“ bezeichnen würde,<br />
kontert man mit einem diplomatischen<br />
Standardsatz wie „Glauben Sie, dass<br />
wir so zum Ziel kommen?“ – und<br />
macht, was verlangt wird. Man passt<br />
sich eben an.<br />
Ein Grund dafür ist die Macht der<br />
<strong>Leidenschaft</strong>: <strong>Leidenschaft</strong>liche Menschen<br />
haben bestimmte Vorstellungen<br />
oder Wünsche und sind getrieben<br />
vom Drang nach Wunscherfüllung.<br />
ZÜGELUNG UND<br />
GEFÜHLSKONTROLLE<br />
FÜR SOZIALE ORDNUNG<br />
Siegmund Freud konstatierte, dass<br />
<strong>Leidenschaft</strong> von Trieben gespeist ist,<br />
die tief in uns schlummern. <strong>Leidenschaft</strong>lich<br />
ist, wer sich dem hingibt,<br />
für das er brennt, auch wenn das Ziel<br />
noch weit entfernt ist und ein Scheitern<br />
möglich ist. Von Freud wissen<br />
wir auch, dass das Triebhafte in unserer<br />
Gesellschaft negativ konnotiert<br />
ist. Deshalb erlauben wir der <strong>Leidenschaft</strong><br />
nur unter bestimmten Rahmenbedingungen<br />
volle Entfaltung.<br />
Die Zügelung äußere sich gewöhnlich<br />
durch Gefühlskontrolle und diene<br />
der Beibehaltung sozialer Ordnung,<br />
sagt die Sozialanthropologin Herta<br />
Nöbauer und nennt das Beispiel Ehe:<br />
Damit das eheliche Band bestehen<br />
kann, muss <strong>Leidenschaft</strong> immer wieder<br />
domestiziert und in andere Bereiche<br />
verschoben werden. Während zu<br />
frühgeschichtlichen Zeiten die Ehe<br />
zur Zügelung von Promiskuität, also<br />
dem sexuellen Kontakt mit mehreren<br />
Partnern gleichzeitig, diene, wird<br />
heute ein Zuviel an sexueller <strong>Leidenschaft</strong><br />
von der Ehe in die Sexindustrie<br />
ausgelagert. Aber auch beim Sport<br />
geht es um das Ausleben der „triebhaften“<br />
<strong>Leidenschaft</strong>, allerdings in<br />
WIRTSCHAFT IST<br />
NICHTS RATIONALES<br />
einem klar definiertem Rahmen.<br />
Nicht nur bei menschlichen Beziehungen<br />
spielt die <strong>Leidenschaft</strong> eine<br />
Rolle, sondern auch in der Wirtschaft.<br />
Nach Adam Smith wird diese nicht<br />
von der Ratio, sondern von Passion<br />
angetrieben. Samt der Schattenseiten,<br />
etwa wenn die Gier zuschlägt, weil<br />
Menschen und ihre Finanzprodukte<br />
nicht mehr kontrolliert werden können<br />
und Teile der Wirtschaft so in<br />
den Abgrund fahren. Gerade die<br />
Wirtschaft sei ein Bereich, wo viele<br />
Bluffer unterwegs seien, betont Bärbel<br />
Schwertfeger, Chefredakteurin des<br />
Magazins „Wirtschaftspsychologie“.<br />
„Wie der Banker, dem soziale Verantwortung<br />
plötzlich ein Anliegen ist,<br />
10
<strong>Leidenschaft</strong> ist uns in die Wiege gelegt. Der Säugling<br />
kommt mit Offenheit und Vertrauen zur Welt, dass<br />
er so, wie er ist, richtig ist. Kohärenz nennt die Hirnforschung<br />
diesen Zustand, wenn kein Widerspruch<br />
ist zwischen dem, was ist und dem, was man möchte.<br />
In der Welt der Erwachsenen sind dies jene seltenen<br />
Glücksmomente, die leidenschaftliche Menschen erleben,<br />
erklärt der Hirnforscher Gerald Hüther. Fällt<br />
ein Mensch hingegen aus der Verbundenheit heraus,<br />
wird im Cortex (Hirnrinde) der Bereich aktiviert, der<br />
auch für körperliche Schmerzen zuständig ist.<br />
Gerald Hüther:<br />
www.kulturwandel.org<br />
www.lernwelt.at<br />
www.sinn-stiftung.eu<br />
Eva-Maria Engelen:<br />
http://www.uni-konstanz.de<br />
Herta Nöbauer:<br />
http://www.univie.ac.at/ksa/html/inh/pers/<br />
lekt/noeb.htm<br />
Foto: © Franziska Hüther<br />
wohlwissend, dass er es nur auf seine<br />
Boni abgesehen hat.“ Wirkliche<br />
<strong>Leidenschaft</strong> hingegen zeige sich<br />
durch innere Überzeugung der Protagonisten<br />
und sei stets authentisch,<br />
allerdings nicht unbedingt strategisch<br />
oder diplomatisch, weiß Schwertfeger.<br />
„Dabei besteht immer die Gefahr, dass<br />
man sich verrennt. Etwa jene, die aus<br />
<strong>Leidenschaft</strong> missionieren und nicht<br />
akzeptieren, dass andere Personen<br />
Dinge anders sehen.“ Oder dass man<br />
selbst aus- oder verbrennt.<br />
Grundsätzlich ist Schwertfeger der<br />
Meinung, dass in unserer Gesellschaft<br />
eher die angepassten Menschen dominieren.<br />
Schwertfegers Credo: „Jeder<br />
sollte sich fragen, was er wirklich<br />
gern machen würde.“<br />
SCHULEN TREIBEN<br />
LEIDENSCHAFT AUS<br />
„Das Grundvertrauen, die Basis für<br />
<strong>Leidenschaft</strong>, gerät spätestens dann<br />
ins Wanken, wenn das Kind zur<br />
Schule kommt“, erzählt Hirnforscher<br />
Gerald Hüther. Unser Schulsystem<br />
erziehe, belehre, und selektiere mit<br />
dem Ergebnis, dass am Ende der<br />
Volksschule viele Kinder krank seien:<br />
ADHS (ein Aufmerksamkeitsdefizit-/<br />
Hyperaktivitätssyndrom), Adipositas,<br />
Diabetes, Haltungsschäden. Für den<br />
Hirnforscher Hüther ist das Schlimmste,<br />
was in der Schule passieren kann,<br />
wenn die Schüler dort ihre <strong>Leidenschaft</strong><br />
am eigenen Entdecken und Gestalten<br />
verlieren und nur noch mit <strong>Leidenschaft</strong><br />
um gute Zensu ren kämpfen,<br />
geleitet von den Kriterien „Strafe vermeiden“<br />
oder „Belohnung“. Seine Lösung:<br />
Ein Schulsystem, das nicht auf<br />
Auswendiglernen basiere, sondern wo<br />
die Schüler in Teams ihre Aufgabenbereiche<br />
eigenständig und mit Freude<br />
erarbeiten. Dazu bräuchte es aber eine<br />
völlig neue Beziehungskultur. Keine<br />
Einzelkämpfer, sondern Teamworker,<br />
die begreifen, dass man nur gemeinsam<br />
etwas erreichen kann.<br />
Nur: Von oben lasse sich kein Kulturwandel<br />
anordnen, das sei ein langfristiger<br />
Transformationsprozess, der<br />
durch einen „Wust an Regulatorien“<br />
und die vorhandenen Verwaltungsstrukturen<br />
systematisch aufgehalten<br />
werde. Dabei wäre es höchste Zeit, das<br />
zu ändern, fordert Hüther. Bereits<br />
heute suchten die Universitäten keine<br />
„funktionierenden“ jungen Leute<br />
mehr, und Firmen bräuchten Menschen,<br />
die Lust hätten, sich einzubringen,<br />
Leute mit Teamfähigkeit, Kompetenz<br />
und Einfühlungsvermögen.<br />
Menschen, die erfahren hätten, wie<br />
es ist, ihr Leben selbst gestalten zu<br />
können.<br />
UNKONVENTIONELLE<br />
WEGE STATT ANPASSUNG<br />
Würden Menschen nicht primär versuchen,<br />
sich an die gegenwärtig herrschenden<br />
Erfordernisse anzupassen,<br />
sondern sich leidenschaftlicher dem<br />
hinzugeben, was sie tun wollen, würde<br />
das nicht nur mehr innovative Tüftler<br />
und Erfinder hervorbringen, sondern<br />
alle Lebensbereiche vorantreiben, ist<br />
Hirnforscher Hüther überzeugt. Er berät<br />
nicht nur in Sachen Bildung, sondern<br />
unterstützt auch Unternehmen, unkonventionellere<br />
und kreativere Wege zu<br />
gehen. Etwa die Bremer Kammerphilharmonie,<br />
die ohne Dirigent auskommt,<br />
weil den Musikern das gemeinsame Erarbeiten<br />
der Stücke wichtig ist. Deren<br />
39 Mitglieder führen die Philharmonie<br />
wie ein Unternehmen und haften mit<br />
ihren Privatvermögen. Mit dem Ergebnis,<br />
dass das Orchester mit nur einem<br />
Drittel der Subventionen auskommt.<br />
Die Musiker mischen auch beim Nachwuchs<br />
mit. Jedes Orchestermit glied<br />
investiert mindestens zehn Prozent<br />
seiner Arbeit in Kinder, um das Veränderungspotenzial,<br />
das in klassischer<br />
Musik liegt, an die nächste Generation<br />
weiterzugeben. Die Schüler sitzen dann<br />
mucksmäuschenstill zwischen den Orchestermitgliedern<br />
auf der Probebühne<br />
und lassen sich von der Konzentration<br />
der Künstler anstecken. <br />
<strong>Leidenschaft</strong><br />
11
USERSTORY<br />
Leben was man liebt,<br />
lieben was man tut<br />
Fotos: © Uwe Mauch<br />
DREI MENSCHEN, DIE FÜR IHRE ARBEIT UND FÜR IHRE IDEEN BRENNEN.<br />
Von Uwe Mauch<br />
ÜBER DIE SANFTE<br />
MOBILITÄT DES BAUCHES<br />
Ein kleines Tanzstudio in einer Nebengasse der Ottakringer<br />
Straße in Wien. Orientalische Musik aus dem Lautsprecher.<br />
MARIANNE GRUBER, gestandene Geschäftsfrau aus dem<br />
Waldviertel mit viel Bauchgefühl, legt sofort los.<br />
Schon wischt sie leicht bekleidet und leichtfüßig über das<br />
Parkett. Mit anmutigen Handbewegungen führt die Tänzerin<br />
ihren Schleier, rollt mit den Augen und dazu über die Fußballen,<br />
ehe sich langsam ihre Hüften zu drehen beginnen.<br />
Abseits der Schönheitsideale stellt Gruber etliche Klischees<br />
auf den Kopf. Weil sie die Vorbehalte kennt, zitiert die 56-Jährige<br />
ihren ägyptischen Tanzlehrer: „Erst eine voll erblühte Rose<br />
entfaltet ihren vollen Duft.“<br />
Mit dem Bauchtanz hat sie vor bald zwanzig Jahren begonnen,<br />
ursprünglich, um ihre Kreuzschmerzen zu lindern. Aus<br />
der hilfreichen Therapie wurde bald eine <strong>Leidenschaft</strong>.<br />
Und aus der <strong>Leidenschaft</strong> ein Business: Belissimas Orientpalast<br />
– so nennt sie ihr Geschäft an der Ottakringer Straße.<br />
Eine Straße, in der das Gros der Geschäftsleute einen multikulturellen<br />
Hintergrund hat und in der eine Waldviertlerin Seltenheitswert<br />
genießt. Ohne die sanfte Mobilität will sie heute<br />
nicht mehr leben: „Das Tanzen tut mir einfach gut, seelisch<br />
und körperlich.“ Zum Takt der Musik holt sie weiter aus:<br />
„Man kann dabei die Weiblichkeit spüren, die ja in einer<br />
männerdominierten Welt völlig unterdrückt wird.“<br />
Zwei, drei Mal pro Jahr geht Frau Gruber auf Reisen. In den<br />
Orient. Sie vertraut nämlich auf das Geschick der Näherinnen<br />
am Stadtrand von Kairo. Wo die Straßen keine Namen haben.<br />
Wo sie im Kopftuch vorfährt, immer mit schützendem<br />
Begleiter. Egal ob Ottakringer Straße oder Orient, Marianne<br />
Gruber ist heute in beiden Welten zu Hause. Ihr Bauchgefühl<br />
hat auch ihren Horizont erweitert.<br />
www.orientpalast.at<br />
12
ÜBER DEN KREATIVEN AKT<br />
DES FEDERFÜHRENS<br />
Langsam, leise, elegant, eigenwillig schwingt seine Feder<br />
über das Papier. Für ROMAN STEINER ist das Bewegen<br />
der Füllfeder elementarer Teil eines spannenden Kreativ-<br />
Prozesses. Steiner ist ein gut gebuchter Marken-Designer<br />
mit einem Faible für das Schöne. Für den REWE-Konzern hat<br />
er einst die Eigenmarke „clever“ entwickelt, für den Österreichischen<br />
Fußballbund lieferte seine Firma das Corporate<br />
Design.<br />
Alles spannend. Doch seine Augen beginnen zu funkeln,<br />
wenn er über seine Füllfedern spricht. Und ja, es sind seine<br />
Füllfedern! Vor zwei Jahren hat er die erste Füllfeder mit dem<br />
eingetragenen Markennamen „Gusswerk“ verkauft. Er hat<br />
für die Entwicklung dieser edlen und dennoch leistbaren<br />
Schreibgeräte viel Geld in die Hand genommen. Noch<br />
schreibt er damit keine Gewinne. Doch in einer Zeit, in der<br />
man sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren beginnt,<br />
da arbeitet die Zeit auch für ihn.<br />
„Das ist für mich eine tiefe <strong>Leidenschaft</strong>“, sagt der 42-jährige<br />
Marken-Designer. „Mit zwölf habe ich von meinem Vater einen<br />
Pierre-Cardin-Füller geschenkt bekommen. Der war<br />
blau und gold und nicht unbedingt schön. Ich habe ihn dennoch<br />
in der Schule verwendet, wohl auch, um mich damit<br />
von den anderen in der Klasse abzuheben.“<br />
Heute trägt er neben iPad und iPhone immer auch ein Moleskine-Tagebuch<br />
und eine Füllfeder mit sich, um damit<br />
fl üchtige Gedanken, Ideen, Entwürfe und auch konkrete Arbeitsschritte<br />
festzuhalten.<br />
„Ich schreibe anders“, erläutert der Entwickler von Marken,<br />
„wenn ich mit der Hand schreibe“. Er hat sich dabei auch<br />
selbst beobachtet: „Durch die Langsamkeit des Notierens<br />
bekommen meine Gedanken mehr Zeit, um sich auszuformen.<br />
Von Hand geschrieben sind die Gedanken oft noch<br />
nicht so konkret. Da bleibt für mich noch mehr Raum für<br />
Krea tivität.“<br />
Und noch eines: „Wenn ich meine Feder führe, fühlt sich jeder<br />
Buchstabe anders an. Auf der Tastatur meines Computers<br />
hingegen, da sind alle Buchstaben gleich.“<br />
www.originalgusswerk.com<br />
ÜBER ALLERLEI ENTDECKUNGEN<br />
IN FERNEN WELTEN<br />
Fragt man die international anerkannte Pollenforscherin<br />
MARTINA WEBER, die an der Universität Wien forscht und<br />
lehrt, wohin die nächste Reise gehen soll, antwortet sie immer<br />
mit dem selben Satz: „Das kann ich ganz genau sagen!“<br />
Die Vielfl iegerin sammelt Bonuspunkte für Flugmeilen so<br />
wie andere Vergünstigungen bei den ÖBB oder im Supermarkt<br />
ihres Vertrauens. Dabei reist sie nie in Gruppen, und<br />
nie gestresst. Davon zeugen unzählige Foto-Alben, die veranschaulichen,<br />
dass die Welt nicht nur in 3sat-Dokumentationen<br />
wunderschön sein kann.<br />
Die Weltgewandte forscht aber auch begeistert und begeisternd<br />
im Minimalbereich des Lebens. Dort fand sie heraus,<br />
wie Spermazellen in einem Pollenkorn entstehen. Komplex –<br />
ihre Doktorarbeit. Mehr noch – ihr Lebenswerk.<br />
Das Innenleben des Pollens ist für sie auch eine Welt für<br />
sich: „Faszinierend, wie alles zusammenpasst. Jede Zelle<br />
funktioniert wie eine moderne Fabrikshalle. In einem Teil<br />
wird etwas produziert, an einer anderen Stelle wird es verpackt,<br />
und am Ende wird es an die Oberfl äche zum Abtransport<br />
gebracht.“<br />
Und doch kommt das Gespräch bald wieder auf die große<br />
Welt zurück. Denn es gibt auch auf Martina Webers Erdball<br />
noch weiße Flecken, die sie noch nicht erforscht hat. Ihre<br />
Augen leuchten: „Mich interessiert in erster Linie das Andere.<br />
Nepal und Tibet, da will ich unbedingt noch hin. Und seit ich<br />
auf der Osterinsel war, muss ich auch noch zur Weihnachtsinsel.“<br />
Ihre nächste Reise geht Ende August nach Spitzbergen,<br />
Grönland und Island, dieses Mal mit dem Schiff. Damit steht<br />
auch schon der Resturlaub am Ende des Jahres fest. So wie<br />
fast immer: „Null.“<br />
www.botanik.univie.ac.at/sfb/<br />
<strong>Leidenschaft</strong><br />
13
Die<br />
rastlose<br />
Weltfamilie<br />
Fotomontage: © Barbara Wais<br />
14
SICH ONLINE UND ANONYM VERLIEBEN, EINE PARTNERSCHAFT<br />
MIT ZWEI WOHNSITZEN IN UNTERSCHIEDLICHEN STÄDTEN FÜHREN:<br />
DISTANZ MUSS DER LIEBE KEINEN ABBRUCH TUN.<br />
IN EINER GLOBALISIERTEN WELT VERÄNDERN SICH FAMILIEN<br />
UND MÜSSEN DAHER NEU DEFINIERT WERDEN. Von Julia Schilly<br />
„Was kommt nach der Familie?“, fragte<br />
die Wissenschafterin Elisabeth Beck-<br />
Gernsheim bereits 1998 im gleichnamigen<br />
Buch. Darin stellte sie die<br />
These auf, dass sich die Familie immer<br />
mehr zu einem widersprüchlichen<br />
Modell zwischen traditionellen<br />
Sehnsüchten und neuen Herausforderungen<br />
entwickelt. Denn vor allem<br />
die neuen Jobchancen der globalisierten<br />
Welt schaffen neben der<br />
klassischen Form der Familie, die<br />
am gleichen Ort lebt, immer mehr<br />
verstreute Strukturen. Von manchen<br />
wird dieser Zustand erhofft, von anderen<br />
erlitten. Mit welchen Strategien<br />
überleben also diese neuen Beziehungen,<br />
ja sogar Liebe auf Distanz?<br />
„WIR WAREN NIE<br />
LÄNGER ALS<br />
14 TAGE GETRENNT“<br />
Beck-Gernsheim spricht aus eigener<br />
Erfahrung, da sie und ihr Mann, der<br />
ebenso bekannte Soziologe Ulrich<br />
Beck, seit Jahren an unterschiedlichen<br />
Orten arbeiten: Sie unterrichtet<br />
an der Universität in Trondheim in<br />
Norwegen, er pendelt nach London,<br />
beide leben in München. Beck-<br />
Gernsheim nennt die wichtigste persönliche<br />
Grundregel für ihre Fernbeziehung:<br />
„Wir waren nie länger als<br />
14 Tage getrennt.“ Ihr Modell kann<br />
jedoch nicht von allen Paaren angewendet<br />
werden. Für Wissenschafter<br />
und ohne Kinder sei es einfacher,<br />
sich die Zeit frei einzuteilen: „Wir packen<br />
so viel Arbeit wie möglich in den<br />
Zeitraum, in dem wir uns nicht sehen,<br />
damit wir dann ein paar Tage völlig<br />
frei haben.“<br />
In ihrem jüngsten Buch „Fernliebe“<br />
hat das Ehepaar Beck nun seine<br />
Untersuchungen zu Liebe und Beziehungen<br />
weitergesponnen und<br />
verschiedene Modelle von Fernbeziehungen,<br />
deren Stolperfallen und<br />
Chancen beleuchtet. Interessant ist,<br />
dass Beck-Gernsheim eine Fernbeziehung<br />
nicht nur pessimistisch sieht:<br />
Durch sie entstünden neue Anregungen.<br />
Der größte Feind der Liebe sei ja<br />
bekanntlich nicht nur Distanz, sondern<br />
auch zu viel Nähe und Routine.<br />
JEDER VIERTE<br />
ÖSTERREICHER<br />
KENNT FERNLIEBE<br />
Die Becks beweisen mit ihrer Themenwahl<br />
ein Gespür für aktuelle<br />
Trends: Wie Studien zeigen, gibt es<br />
immer mehr Fernbeziehungen. Laut<br />
Statistik Austria führten 1985 nur vier<br />
Prozent der Menschen über 30 Jahre<br />
eine Fernbeziehung. Aktuell hat jeder<br />
vierte Österreicher in dieser Altersgruppe<br />
Erfahrung damit. Vor allem<br />
junge Akademiker sind betroffen.<br />
Partnerbörsen im Internet schaffen<br />
die Möglichkeit, weit entfernte Partner<br />
kennenzulernen. Doch vor allem<br />
der Arbeitsmarkt begünstigt diese<br />
Entwicklung. Wer berufl ich weiterkom<br />
men will, muss fl exibel sein.<br />
Manchmal gehört eben auch ein<br />
Wohnortwechsel dazu. Die gängige<br />
Defi nition der Familie, deren Mitglieder<br />
im selben Haushalt leben, ist damit<br />
nicht mehr gültig.<br />
Erleichtert wurde der Strukturwandel<br />
der Familie und die Entstehung einer<br />
„Fernfamilie“ von modernen Kommunikationstechnologien<br />
wie E-Mail, Skype<br />
und Videotelefonie. Die Großmutter<br />
in Österreich kann dadurch bei der<br />
Weihnachtsbescherung in Spanien<br />
dabei sein, die Kinder zeigen ihre<br />
ersten Schritte am Bildschirm oder<br />
das frisch verliebte Paar schwört sich<br />
am Abend im Chatroom die Liebe.<br />
Doch körperliche Nähe und Geborgenheit<br />
können dadurch nicht ersetzt<br />
werden. Für Familien mit Kindern bedeutet<br />
das eine noch größere Entbehrung.<br />
„Aber wenn einmal etwas<br />
Schlimmes passiert, ist es doch etwas<br />
anderes, in den Arm genommen zu<br />
werden. Daher spricht man in diesem<br />
Zusammenhang auch von ‚sunny day<br />
technologies‘“, sagt Beck-Gernsheim.<br />
PHANTASIE WAR<br />
NOCH NIE SO GEFRAGT<br />
WIE HEUTE<br />
Die Technologie hat aber nicht nur<br />
das Potenzial, Beziehungen zu erhalten.<br />
Flirten, verlieben, betrügen und<br />
trennen: Vor allem das Internet habe<br />
die Art, wie wir lieben, in den vergangenen<br />
Jahren stark verändert, sagt<br />
der israelische Emotionsforscher<br />
Aaron Ben-Ze’ev. Der Professor der<br />
Philosophie hat sich in seinem Buch<br />
„In the Name of Love“ mit dem Thema<br />
eingehend auseinandergesetzt.<br />
Ein Aspekt dieser neuen Art der virtuellen<br />
Liebe ist jener, dass sich Paare<br />
online verlieben, ohne sich jemals offline<br />
getroffen zu haben. „Unser Vorstellungsvermögen<br />
war schon immer<br />
ein wichtiger Teil des menschlichen<br />
Lebens. Es war jedoch noch nie so<br />
gefragt, wie im Cyberspace“, sagt<br />
der Philosoph.<br />
KÖRPERLOSES<br />
VERLIEBEN<br />
Zunächst sind online alle Menschen<br />
gleich. Aussehen, Alter, Geschlecht<br />
oder Religion sind unbekannt. Bei<br />
persönlichen Bekanntschaften hingegen<br />
können solche Aspekte schon in<br />
den ersten Sekunden darüber entscheiden,<br />
ob man ein Gespräch aufnimmt<br />
oder zu fl irten beginnt. Wenn<br />
online der erste Funken übergesprungen<br />
ist, entsteht oft sehr schnell eine<br />
Nähe. Die Distanz tut der <strong>Leidenschaft</strong><br />
keinen Abbruch. Im Gegenteil:<br />
Es bestehe sogar die Möglichkeit,<br />
dass der Austausch von Informationen<br />
tiefer, vielseitiger und schneller<br />
passiere, sagt Ben-Ze’ev. Denn die<br />
Kommunikation kompensiert in diesem<br />
Fall die körperliche Distanz.<br />
<strong>Leidenschaft</strong><br />
15
Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim: „Fernliebe”;<br />
280 Seiten, Suhrkamp Verlag 2011<br />
Aaron Ben-Ze’ev: Love online: Emotions on the<br />
Internet. 302 Seiten; Cambridge: Cambridge<br />
University Press. 2004<br />
Foto: © Isolde Ohlbaum<br />
Aaron Ben-Ze’ev, Ruhama Goussinsky: In the Name of<br />
Love: Romantic Ideology and Its Victims. 260 Seiten;<br />
Oxford University Press, USA. 2008<br />
Aaron Ben-Ze’evs Blog „In the Name of Love“:<br />
www.psychologytoday.com/blog/in-the-name-love<br />
Philippinische Arbeitsmigrantinnen vernetzen sich<br />
http://mmceai.blogspot.co.at<br />
Elisabeth Beck-Gernsheim und ihr Mann Ulrick Beck prognostizierten schon 1998 den Wandel der Familie zu immer<br />
mehr global verstreuten Teilfamilien. Heute lebt das bekannte Soziologenehepaar selbst eine Fernliebe:<br />
Sie arbeitet in Norwegen, er in England. Diesem Lebenskonzept liegt jedoch eine freiwillige Entscheidung zugrunde.<br />
Gleichzeitig bedeutet dies jedoch<br />
nicht, dass die Sache mit der Liebe<br />
einfacher wird. Es sei schwieriger geworden,<br />
eine feste Beziehung zu erhalten.<br />
Wir lebten in einer leistungsorientierten<br />
Gesellschaft, sagt der<br />
Philosoph. Im Hinterkopf hätten viele<br />
Menschen ständig den Gedanken,<br />
dass es jemand „Besseren“ oder eine<br />
„bessere Beziehung“ für sie geben<br />
könnte. Daher werde in Krisensituationen<br />
an bestehenden Beziehungen<br />
weniger gearbeitet. „Das hat aber<br />
nichts mit Faulheit zu tun. Es spielt<br />
vielmehr die Überlegung mit, wieso<br />
hart gearbeitet werden sollte, wenn<br />
es so viele vermeintlich angenehmere<br />
Möglichkeiten gibt“, sagt er.<br />
DIE EINEN WOLLEN,<br />
DIE ANDEREN MÜSSEN:<br />
FERNFAMILIEN AUF<br />
ZWEI KONTINENTEN<br />
Im Fall von Jobnomaden aus Asien,<br />
Afrika oder Osteuropa verlangt das<br />
Thema Fernliebe eine andere Betrachtungsweise,<br />
betont Elisabeth<br />
Beck-Gernsheim: Vor allem das Phänomen,<br />
dass Frauen ihre Familien<br />
verlassen, um in einem anderen Land<br />
(fremde) Kinder zu betreuen oder alte<br />
und kranke Menschen zu pfl egen,<br />
nimmt zu. Im Unterschied zum Brain-<br />
Drain, dem Abwandern qualifi zierter<br />
Arbeitskräfte in reichere Länder,<br />
spricht man hier vom Care-Drain.<br />
So suche sich eine berufstätige Frau<br />
in Österreich zum Beispiel die Hilfe<br />
eines Au-pairs, „bevor sie ganz in ihrer<br />
eigenen Arbeit und Betreuungspfl<br />
icht der Kinder<br />
untergeht“, sagt Beck-Gernsheim.<br />
Die Geschichten von Arbeitsmigranten<br />
sind sehr unterschiedlich, ein<br />
Beispiel ist Elena Manulat, die heute<br />
46 Jahre alt ist. Sie stammt aus<br />
Mindanao, der südlichsten Insel der<br />
Philippinen und ging mit 20 Jahren in<br />
die USA. Ihre erste Tochter ließ sie<br />
damals für die Aussicht auf ein besseres<br />
Leben für sich und ihre Familie<br />
zurück.<br />
DER EXPORTSCHLAGER<br />
DER PHILIPPINEN SIND<br />
ARBEITSKRÄFTE<br />
Manulat ist kein Einzelfall. Wer weggeht,<br />
gilt auf den Philippinen als Held.<br />
Arbeitskraft ist das wichtigste Exportgut:<br />
Achteinhalb Millionen Menschen<br />
arbeiten in mehr als 200 Staaten der<br />
Welt. Täglich ziehen bis zu 4000 Philippiner<br />
weg und suchen anderswo<br />
ihr Glück. Dieser Schritt wird massiv<br />
von der Regierung gefördert.<br />
Die Geld-überweisungen der sogenannten<br />
OFW, den „Overseas Filipino<br />
Workers“, aus dem Ausland an ihre<br />
Verwandten in der Heimat machen<br />
jähr lich bis zu zwölf Prozent des<br />
Bruttoinlandprodukts aus.<br />
Solange die Philippinerinnen im Ausland<br />
sind, erfolgt die Zuwendung für<br />
ihre Familien in materieller Form –<br />
so wie bei getrennten Familien in<br />
den Industrieländern. Die „sunny<br />
days technologies“ ersetzen aber<br />
auch hier nur begrenzt die Erziehung<br />
der Kinder oder die Partnerschaft.<br />
FERNFAMILIE IST OFT<br />
EIN INDIVIDUELLES<br />
EXPERIMENT<br />
AUF ZEIT<br />
Die Folge auf dem asiatischen Kontinent<br />
sind: Enttäuschungen auf beiden<br />
Seiten. Das Geld, das im Ausland<br />
verdient wird, sichert den<br />
Wohlstand zu Hause nicht in dem<br />
Maße ab wie ursprünglich erhofft.<br />
Die Kinder und der Mann zeigen nicht<br />
genug Dankbarkeit für die Entbehrungen<br />
der Frau. Elena Manulat lebt<br />
heute wieder in Mindanaos Hauptstadt<br />
Davao City und engagiert sich<br />
im Verein „Mindanao Migrants“. Ihr ist<br />
wichtig, bei den betroffenen Angehörigen<br />
Verständnis für die im Ausland<br />
arbeitenden Familienmitglieder zu<br />
wecken. Arbeit hat sie genug. Denn<br />
weltweit wird die Fernfamilie in Zukunft<br />
weiter wachsen.<br />
Auch wenn ein Teil der Betroffenen<br />
das Projekt Fernfamilie nach einer<br />
bestimmten Zeit beendet und sich<br />
entschließt, wieder an einem Ort<br />
zusammen zu sein. <br />
16
LAUFEN, KAUFEN, UM PUNKTE RAUFEN<br />
BEFRAGUNG WAR GESTERN. HEUTE BEOBACHTEN UNTERNEHMEN IHRE<br />
KUNDEN UND ERFAHREN DAMIT VIEL MEHR ÜBER SIE, ALS DIESE SELBST<br />
VON SICH WISSEN. Von Matthias Berger<br />
75 Prozent der Österreicher haben<br />
zumindest eine Kundenkarte. Laut einer<br />
Erhebung des Vereins für Konsumenteninformation<br />
beulen durchschnittlich fünf<br />
Plastikkarten die Geldbörsen aus.<br />
Mehr als 20 Millionen<br />
Kundenkarten sind in<br />
Österreich im Umlauf,<br />
Tendenz stark steigend.<br />
////// PSYCHOLOGIE DES SAMMELNS ////////////////////<br />
Der Mensch liebt es, nach Rabatten zu jagen und Punkte zu sammeln: Fünf Kundenkarten<br />
tragen die Österreicher im Durchschnitt mit sich herum. In Deutschland sind es vier. Warum<br />
eigentlich? Prestige spielt z.B. bei Meilensammelprogrammen eine klare Rolle. Darüber<br />
hinaus liefert die Theorie der Behavioral Economics von Nobelpreisträger David Kahnemann<br />
eine mögliche Erklärung: Gewinne, und sind sie noch so klein, werden vom Menschen<br />
stärker wahrgenommen als damit verbundene Kosten (Mittragen der Kundenkarten,<br />
zusätzlich getätigte Einkäufe). Ein Resultat dieser inneren Bewertung sind Mileage Runs:<br />
In Onlineforen rechnen besonders leidenschaftliche Vielfl ieger aus, über welche Reise -<br />
routen der billigste Flug mit den meisten Meilen zu holen ist. Die inbrünstige Tüftelei nimmt<br />
mitunter Stunden und Tage in Anspruch.<br />
KOMPLEXES EINFACH ERKLÄRT<br />
////// LUKRATIV FÜR ANBIETER ////////////////////////////<br />
Für die Unternehmen sind Kundenkarten pures Kalkül, aus zumindest drei Gründen. Erstens<br />
Umsatzsteigerung: Rabatte führen dazu, dass wir größere Mengen einkaufen. Gleichzeitig<br />
führen uns Sammelkarten an neue Produkte heran, die wir normalerweise nicht kaufen.<br />
Die so erzielten Zusatzumsätze bei den Händlern sind beachtlich: selbst in gesättigten<br />
Märkten oft bis zu 20 Prozent. Zweitens geht es um Kundenbindung: Kundenkarten führen<br />
im Ideal fall zu einer größeren Treue von Kunden: Statt zu wechseln, kommen wir immer<br />
wieder. Je besser die Datenfl ut analysiert und daher Kunden mit maßgeschneiderten Aktionen<br />
versorgt werden können, desto besser funktioniert die Kundenbindung. Das Ziel lautet:<br />
Massen personalisierung in der Werbung wie im Angebot. Das führt nahtlos zum dritten Vorteil:<br />
Händler, die wissen, was die guten Kunden wann kaufen (wollen), können ihr Sortiment<br />
so optimieren, dass sie letztlich noch einmal mehr verkaufen.<br />
////// BIG DATA – DAS NEUE GOLD ////////////////////////<br />
Überraschend ist, wie wenig die Datenberge, die gläserne Konsumenten bisweilen freiwillig<br />
liefern, in der Realität ausgewertet werden: Zur Zeit kann nur ein Drittel der Daten sammelnden<br />
Unternehmen weltweit ihre Daten nutzbringend verarbeiten. Zu diesem Schluss kam<br />
eine Studie des IT-Unternehmens EMC in Deutschland. Unter den Vorreitern befi ndet sich<br />
der britische Händler Tesco, dem jedes Prozent richtig ausgewerteter Daten jährlich bis zu<br />
120 Millionen Pfund mehr hereinspült. Der große Rest ist mit der extrem komplizierten Analyse<br />
und der Verwertung der Ergebnisse noch überfordert. Ein Beispiel aus der Praxis: Was<br />
nützt es einem Fan von Zartbitterschokolade, wenn er einen Gutschein für Lachgummi bekommt,<br />
nur weil die Süßwaren in der Datenanalyse noch nicht genauen Untergruppen zugeordnet<br />
werden können? Und: Nicht alles, was technisch möglich ist, ist klar geregelt<br />
oder erlaubt. Auch das führt dazu, dass der Goldschatz, den manche in Big Data wähnen,<br />
nur zögerlich gehoben wird.<br />
Illustration: Barbara Wais<br />
In Zukunft werden die<br />
Kundenkarten im Smartphone<br />
gespeichert sein.<br />
Nach einer Prognose von McKinsey wird bis 2018 der Bedarf an Big-Data-Experten die<br />
verfügbaren Arbeitskräfte in den USA um 60 Prozent übersteigen. Dann ist maßgeschneiderte<br />
Kundeninformation vielleicht schon ein alter Hut. Es wird neue Wege der Verhaltensbeeinfl<br />
ussung geben: Im Geschäft wird eine automatische Koppelung zwischen Kundenkarte<br />
und Einkaufswagen den Kunden direkt zu jenen Produkten führen, die zu ihm passen<br />
könnten. Zusätzlich erhalten Kunden Vorschläge in Echtzeit: Hat er oder sie nur Kuchen im<br />
Korb, aber kein Schlagobers und befi ndet sich schon bei der Kassa? Schon kommt ein Erinnerungs-SMS.<br />
Plastikkarten an der Kasse vorzuzeigen, wird in wenigen Jahren nicht mehr<br />
nötig sein: Dann werden Mitgliedschaften automatisch vom Smartphone abgelesen werden.<br />
Überladene Geldbörsen, ausgebeulte Hosen – adé!<br />
<strong>Leidenschaft</strong><br />
17
<strong>Leidenschaft</strong><br />
braucht Trott<br />
STATT DIE ELTERLICHE BAUFIRMA ZU ÜBERNEHMEN, HAT DER GRAZER<br />
CHRISTIAN HLADE EIN UNGEWÖHNLICHES REISEBÜRO GEGRÜNDET:<br />
WELTWEITWANDERN (WWW) BEGLEITET SEINE GÄSTE AUF REISEN JENSEITS<br />
DES MASSENTOURISMUS. Das Gespräch führte Daniela Müller<br />
Sie haben Architektur studiert.<br />
Eigentlich ein Beruf mit Potenzial zu<br />
<strong>Leidenschaft</strong>.<br />
Für mich nicht so ganz. Ich sollte die<br />
Baufirma der Eltern übernehmen,<br />
wollte aber nicht. Nach der HTL-<br />
Matura war ich vier Monate in Indien<br />
und Nepal und bin sterbenskrank mit<br />
einem Virus zurückgekommen, aber<br />
mit dem Entschluss, studieren zu wollen.<br />
Das Architekturstudium war für<br />
mich ein Wegbewegen vom Wunsch<br />
der Eltern, ohne den Plan ganz wegzuwerfen,<br />
quasi ein Abbiegen in Richtung<br />
Freiheit.<br />
Was ist auf der Reise passiert?<br />
Nach dieser Reise öffnete sich etwas in<br />
meinem Leben. Ich weiß nicht genau,<br />
was der Auslöser war, vielleicht die<br />
Berge, jedenfalls nichts Esoterisches.<br />
Nepal und Indien sind so anders, es<br />
rüttelt einen durcheinander.<br />
Reisen macht mit Ihnen etwas?<br />
Ich brauche die Ferne, um in der Nähe<br />
die Dinge zu ordnen – eine weitere<br />
Perspektive beizubehalten, um mich<br />
in der Nähe nicht in den kleinen Details<br />
zu verlieren. Das ist etwa, wenn<br />
ich zu lange in den normalen Trott<br />
eingespannt bin, aus dem ich nicht gut<br />
herauskomme. Wenn <strong>Leidenschaft</strong><br />
produktiv sein will, braucht es beides.<br />
Bergführer ohne Beziehung zum Land<br />
sind tragische Gestalten genauso wie<br />
die, die zu 100 Prozent im Alltag gefangen<br />
sind. Es braucht den Trott und<br />
das Eingebundensein in die Gesellschaft<br />
und es braucht das Ausreißen<br />
in die Weite.<br />
KOMMUNIKATION<br />
UND INFORMATION<br />
HABEN DAS REISEN<br />
STARK VERÄNDERT<br />
Haben Sie eine besondere Erfahrung<br />
mit dem Ausreißen?<br />
Ja. Ich durchlebte vor zwei Jahren eine<br />
Phase der Perspektiv- und Energielosigkeit<br />
und wollte auf Weltreise gehen.<br />
Die Firma habe ich den Mitarbeitern<br />
übergeben, ich hatte nicht einmal<br />
mehr eine Mailadresse. Bedenken<br />
hatte ich wegen meiner drei Kinder.<br />
Schließlich meinte meine Frau, „Wenn<br />
du so rumhängst, kann ich dich hier<br />
auch nicht brauchen.“ Ich wollte mehrere<br />
Monate weg sein, spürte aber bald,<br />
dass ich nicht mehr der Student mit<br />
Rucksack bin und dass planloses Reisen<br />
nicht mehr meins ist. Die Mitreisenden<br />
redeten mich mit „Sie“ an! Ich<br />
bin von dieser Reise früher zurückgekommen,<br />
es passte einfach zu meiner<br />
Rolle nicht mehr. Seither schaue ich,<br />
wie ich meine verschiedenen Pole in<br />
Balance bringen kann.<br />
Verändert das Reisen Ihre Gäste?<br />
Ich glaube, dass jene, die mit dem Leben<br />
unzufrieden sind – übrigens eher<br />
eine kleine Minderheit –, durch das<br />
Gehen und die Natureindrücke einen<br />
klareren Kopf bekommen. Durch das<br />
Erleben anderer Kulturen und anderer<br />
Möglichkeiten zu leben bekommt man<br />
wieder einen besseren Blick auf das eigene<br />
Leben.<br />
Wie hat sich das Reisen in den letzten<br />
Jahrzehnten geändert?<br />
Sehr stark, bedingt durch die Kommunikation<br />
und Information. Überall<br />
gibt es Satellitenfernsehen und<br />
arme Länder haben massiv aufgeholt.<br />
Ich habe in Ladakh (Tibet) vor 13 Jahren<br />
eine Schule gebaut, die fünf Tage<br />
von der nächsten Straße entfernt war.<br />
Heuer werde ich zum ersten Mal mit<br />
dem Taxi zur Schule fahren können.<br />
In den letzten Jahren hat die Mittelschicht<br />
Südamerikas und Asiens stark<br />
aufgeholt, Tausende brechen auf. Wir<br />
Europäer sind nicht mehr die Könige<br />
im weltweiten Tourismus.<br />
18
Fotos © Christian Hlade<br />
Global vernetzt und doch geerdet<br />
Christian Hlade kennt die schönsten Ziele auf<br />
der ganzen Welt. Mehrmals im Jahr geht er<br />
für sein Unternehmen Weltweitwandern auf<br />
Reisen.<br />
Die Firma legt er derweil in die Hände seiner<br />
Angestellten. Weltweitwandern bietet nicht<br />
nur alternatives und sanftes Reisen, das Unternehmen<br />
wurde auch vielfach für seine Mitarbeiterfreundlichkeit<br />
ausgezeichnet.<br />
Auch in seine Partner vor Ort investiert Hlade<br />
viel: Sie erhalten in Österreich Sprachkurse,<br />
lernen das Land und seine Werte kennen. Er<br />
organisiert zudem Austauschbesuche, der<br />
marokkanische Partner reist etwa in ein tibetisches<br />
Kloster und umgekehrt.<br />
Für die 20 wichtigsten Partner veranstaltet<br />
Hlade eine Akademie zur Fortbildung und<br />
zum interkulturellen Austausch. Davon profi -<br />
tieren laut Hlade alle Seiten. „Das ist unser<br />
USP.“<br />
Welche Folgen sind hier zu erwarten?<br />
Europa ist nicht mehr die große Nummer<br />
als Reiseveranstalter. Dann haben<br />
sich Länder wie Burma in Richtung<br />
Demokratie geöffnet, innerhalb kurzer<br />
Zeit hat sich die Touristenzahl verdreifacht.<br />
Dort boomt es, der Bau von<br />
Infra struktur explodiert, es ist eine<br />
rapide, ungesteuerte Entwicklung zu<br />
befürchten. Was sicher gefährlich für<br />
Naturschutz oder Kulturbewahrung<br />
ist. Aber es gibt in Burma bereits einen<br />
starken Wunsch, die Entwicklung zu<br />
bremsen, weil die ersten negativen<br />
Auswirkungen durch explodierende<br />
Grundstückspreise an den Stränden<br />
zu sehen sind.<br />
STATT VIELER<br />
STÄDTEREISEN<br />
LIEBER AB UND ZU<br />
EINE GROSSE REISE<br />
Und im Bereich der Reisemobilität?<br />
Der weltweite Flugverkehr wird gewaltig<br />
steigen, man kann aber den neuen<br />
Reisenden die für sie erst seit Kurzem<br />
leistbar gewordenen Flüge nicht verbieten.<br />
Vor allem wir Europäer kommen<br />
da in einen schweren Argumentationsnotstand.<br />
Aber es muss Ziel sein,<br />
den weltweiten Flugverkehr einzudämmen,<br />
das geht meiner Ansicht nach<br />
nur über das Einschränken der Verfügbarkeit.<br />
Wir von Weltweitwandern<br />
empfehlen, nicht mehrere kurze<br />
Städte reisen pro Jahr zu machen, sondern<br />
eher Nahurlaub und dazu einige<br />
Male im Leben eine richtige Reise, die<br />
den Horizont erweitert. Doch auch wir<br />
sind in die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen<br />
eingebunden. Wir hatten<br />
eine Bulgarienreise mit Bus und Zug<br />
im Programm, die niemand gebucht<br />
hat. Letztlich sehe ich eine Lösung auf<br />
der internationalen politischen Ebene<br />
und in Form einer gewaltigen Verteuerung<br />
des Rohstoffes Erdöl. Gerade das<br />
Thema Flugreisen muss auf globaler<br />
Ebene gelöst werden, „Global Warming“<br />
betrifft uns alle.<br />
Was macht die Sehnsucht nach den<br />
„großen“ Reisezielen aus?<br />
Sie sind schön. Wenn sie in Filmen<br />
und Büchern gut beschrieben sind,<br />
schürt das die Sehnsucht. Etwa nach<br />
Tibet: Obwohl wir wissen, dass die<br />
Tibeter fürchterlich unterdrückt sind,<br />
wollen wir dort ein Paradies sehen –<br />
das wir zwischendurch immer wieder<br />
finden. Es ist der Wunsch nach diesen<br />
Augenblicken. Bei der Hitparade der<br />
Reue sind nicht gemachte Reisen auf<br />
Platz 2. Platz eins besetzt die Liebe.<br />
IN NEPAL LEBEN<br />
DIE MENSCHEN<br />
VIEL MEHR<br />
IM AUGENBLICK<br />
Was bremst die <strong>Leidenschaft</strong> in unserer<br />
Gesellschaft?<br />
Ich denke, das hängt mit Achtsamkeit<br />
zusammen. In Nepal leben die Menschen<br />
viel mehr im Augenblick. Sie<br />
sehen etwas, das ihnen gefällt und<br />
rennen dort hin. Bei uns gibt es so<br />
etwas nicht. Menschen haben mehr<br />
Sorgen, Probleme, beschäftigen sich<br />
mit Zukunftsprojekten und Vergangenheitsreue.<br />
Ein Geheimnis vom<br />
Reisen, etwa nach Indien, ist, dass<br />
man an die eigenen Probleme nicht<br />
mehr denkt, weil die Probleme vor<br />
dem Auge so schreiend sind. Wenn<br />
ich von einer solchen Reise zurückkomme,<br />
sehe ich daheim alles wieder<br />
neu und lebe mehr im Augenblick. <br />
<strong>Leidenschaft</strong><br />
19
Altes Blech, junge Freude<br />
WER OLDTIMER, MOTOR- ODER FAHRRÄDER SAMMELT, SIEHT DIESE MIT<br />
ANDEREN AUGEN. DAS FAHREN SELBST IST NUR NOCH NEBENASPEKT.<br />
NATÜRLICH GESCHIEHT DAS ALLES NICHT ZUFÄLLIG, WIE DIE<br />
WISSENSCHAFT WEISS. Von Martin Strubreiter<br />
Moderne Autos sind schnell, sicher,<br />
zuverlässig und Oldtimerfreunden zu<br />
langweilig. Die entdecken lieber den<br />
Charme des Langsamen, das Sinnliche<br />
des Unperfekten, das Einzigartige der<br />
alten Formen, und wer seinen Werkzeugkoffer<br />
virtuos einzusetzen versteht,<br />
ist im Vorteil. Andere renovieren Fahrräder,<br />
die noch vor wenigen Jahren im<br />
Sperrmüll versunken wären, bauen sie<br />
zu Single-Speeds 1 um oder rollen auf<br />
Porteurs-Rädern 2 in die neueste Modewelle.<br />
Japanische Sammler hängen sich<br />
Renn- und Reiseräder berühmter Rahmenbauer<br />
neben edle Gemälde an die<br />
Wand, und man erkennt: Hier agiert<br />
reine <strong>Leidenschaft</strong>, um Mobilität alleine<br />
geht’s längst nicht mehr.<br />
Das gilt auch für Gerhard Würnschimmel:<br />
„Wenn mich jemand angesichts<br />
der restaurierungsbedürftigen<br />
Autos fragt, wann meine Sammlung<br />
fertig ist, dann sage ich: Sie ist schon<br />
fertig, und wenn ich in einigen Monaten<br />
ein weiteres Auto fahrbereit habe,<br />
dann ist sie eben anders fertig.“<br />
„MEINE WELLNESS-<br />
OASE IST ETWAS<br />
STAUBIG“<br />
Gerhard Würnschimmel sammelt seit<br />
40 Jahren Autos des 1961 untergegangenen<br />
deutschen Borgward-Konzerns.<br />
Die Kollektion umfasst schöne und<br />
perfekte Autos – und solche, die Neuwagenfahrer<br />
als Wracks bezeichnen<br />
würden. Das ist meist für Außenstehende<br />
ein Problem, nicht aber für<br />
den Sammler: „Manchmal fahre ich<br />
in meine Scheune, setzt mich in einige<br />
Autos, höre den Geschichten zu,<br />
die ihre Patina erzählt, und wenn ich<br />
wieder heimfahre, bin ich entspannt<br />
und fröhlich. Meine Wellness-Oase<br />
ist etwas staubiger als die des Durchschnittsbürgers.“<br />
Derlei <strong>Leidenschaft</strong><br />
verstehen am ehesten andere Sammler<br />
– oder Psychologen, Soziologen<br />
und Philosophen. Der Wirtschaftspädagoge<br />
und Germanist Lothar Beinke<br />
schreibt in seinem Buch „Sammeln<br />
und Sammler“: „Es ist beim Sammeln<br />
das Entscheidende, dass der Gegenstand<br />
aus allen ursprünglichen<br />
Funktionen gelöst wird, um in die<br />
denkbar engste Beziehung zu seinesgleichen<br />
zu treten. Dies ist der diametrale<br />
Gegensatz zum Nutzen.“<br />
Spätestens jetzt ist der Blick frei auf<br />
die reine Freude, die Sammler mit<br />
ihrem Hobby zelebrieren. Sammeln<br />
nur als Rest des früheren Jagdtriebes<br />
zu sehen, sei zu populärwissenschaftlich,<br />
meint die Psychotherapeutin<br />
Veronika Schröter: „Sammeln hat viel<br />
mit Schönheit, Ästhetik und Kultur zu<br />
tun, es ist eine wunderbare Ressource<br />
zur Erholung, und auch eine Positionierung:<br />
Der Sammler zeigt sich als<br />
Teil dieser Welt, indem er sich mit ihr<br />
über die Sammlung verbindet und in<br />
die Geschichte seiner Sammelobjekte<br />
eintaucht.“<br />
SAMMELOBJEKTE<br />
VERRATEN VIEL ÜBER<br />
DIE GESCHICHTE DES<br />
SAMMLERS<br />
Ralph Sichler, Professor für Sozialund<br />
Angewandte Psychologie an der<br />
Siegmund Freud Universität in Wien<br />
ergänzt: „Ich sehe Sammeln als Versuch,<br />
sich eine vertraute Umgebung zu<br />
schaffen, in der man sich gut auskennt.<br />
Man vertieft sich in etwas, wo es immer<br />
weitergehen kann, wo es aber auch<br />
klare Grenzen gibt: Das sammle ich –<br />
und das nicht.“<br />
Für den Psychoanalytiker und Kunstsammler<br />
Werner Muensterberger ist<br />
das fortwährende Suchen ein Kernelement<br />
der Sammlerpersönlichkeit, wie<br />
er in „Sammeln. Eine unbändige <strong>Leidenschaft</strong>“<br />
beschreibt: „Es ist mit viel<br />
tiefer liegenden Wurzeln verknüpft, es<br />
erweist sich als Neigung, die aus einer<br />
nicht sofort erkennbaren Erinnerung<br />
an Entbehrung, Verlust oder Verletzung<br />
und einem sich daraus ergebenden Verlangen<br />
nach Ersatz herrührt.“<br />
Warum aber werden alte Autos gesammelt?<br />
Ralph Sichler meint, dass die Vertrautheit<br />
mit der eigenen Jugend mit<br />
eine Rolle spiele, vieles werde verklärt:<br />
Schlechte Erfahrungen würden ausgeblendet,<br />
die guten blieben erhalten.<br />
SAMMLER WOLLEN<br />
DURCH IHRE<br />
SAMMLUNG IN EWIGER<br />
ERINNERUNG BLEIBEN<br />
Gertraud Flemming-Hagn, Besitzerin<br />
mehrerer Citroen 2CV, bestätigt das.<br />
„Der Geist des Entenfahrens hat viel<br />
mit den 70er Jahren zu tun, mit der<br />
Hochblüte der Hippiezeit in Österreich.<br />
Bis heute strahlt der 2CV für<br />
mich Liebe und Frieden aus.“<br />
Die Freude am Fahren ist bei Fahrradsammlern<br />
ähnlich. Walter Schmidl,<br />
Besitzer von rund 125 Fahrrädern der<br />
Baujahre 1891 bis 2000: „Je nach Wetter<br />
und Transportbedarf nehme ich in<br />
der Früh ein Rad aus meiner Sammlung<br />
und fahre in die Arbeit. So beginnt<br />
jeder Tag mit meinem Hobby.<br />
Fahrradsammeln deckt viele Bereiche<br />
ab, die mich interessieren: das Nützliche,<br />
das Sportliche, das Finden, Restaurieren<br />
und das Erforschen der<br />
Fahrradgeschichte.“ Der Forschertrieb<br />
sammelt also mit, und auch das<br />
Bestreben, der Nachwelt einmal eine<br />
feine Sammlung zu hinterlassen, ist<br />
ein wesentliches Motiv vieler Sammler.<br />
Natürlich könnte man auch neue Autos<br />
sammeln. Da wird viel durch den<br />
Freundeskreis bestimmt: Sammel-<br />
20
Gerhard Würnschimmel sagt zu seiner Oldtimersammlung „Wellnessoase“.<br />
Fotos: © Karin Feitzinger<br />
Foto: © wikipedia/Mick<br />
Für Walter Schmidl beginnt jeder Tag mit einem seiner<br />
125 geliebten Fahrräder der Baujahre 1891–2000.<br />
<strong>Leidenschaft</strong> für den Citroen 2CV prägt bis heute so<br />
manchen Freundeskreis und führte sogar Liebende zusammen.<br />
objekte sind irgendwie auch Statussymbole.<br />
Ralph Sichler: „Will man<br />
Aner kennung erfahren, dann ist das<br />
Lebensumfeld entscheidend. Mit Spoilern<br />
bestückte, tiefergelegte BMWs<br />
sind bei Vorstandsvorsitzenden eher<br />
nicht so gefragt wie in manch ländlicher<br />
Gegend.“ Natürlich tauchen wir<br />
da mitten ins Henne-Ei-Problem, denn<br />
auch das Sammelgebiet formt den<br />
Freundeskreis. Gertraud Flemming-<br />
Hagen: „Bis auf wenige Ausnahmen<br />
kommen alle unsere Freunde aus der<br />
2CV-Szene, und meinen Mann habe<br />
ich auch bei einem Klubtreffen kennengelernt.“<br />
KLUBTREFFEN SIND<br />
KULT UND FORMEN<br />
DEN FREUNDESKREIS<br />
Überhaupt, die Clubtreffen. Was einfach<br />
als fröhliche Zusammenkunft<br />
Gleichgesinnter gesehen werden kann,<br />
kommt kultischen Handlungen nahe:<br />
Als Kult im strengen Sinn gilt eine Zusammenkunft<br />
mehrerer Menschen, die<br />
ritualisierte Handlungen zu Ehren eines<br />
Objektes vollführen. Oldtimerausfahrten<br />
sind da verdächtig nahe dran.<br />
Was die Art des Sammelns betrifft, so<br />
haben Männer und Frauen einen unterschiedlichen<br />
Zugang, wie Ralph<br />
Sichler erklärt: „Fahrzeuge sprechen<br />
tendenziell eher Männer an, man darf<br />
spekulieren, ob da die Eroberung der<br />
Welt mitspielt und Kraft und Power,<br />
auch wenn alte Autos nicht so viel<br />
Kraft haben.“ Provokant formuliert<br />
lautet der Umkehrschluss, dass Frauen<br />
ihre Kraft und Power auch ohne fahrbaren<br />
Untersatz demonstrieren können.<br />
DAS ENDE EINER<br />
SAMMLUNG IST<br />
EINE RATIONALE<br />
ENTSCHEIDUNG ÜBER<br />
AUFWAND UND ERTRAG<br />
Eine Oldtimersammlung kann aber<br />
auch ausufern. „Häuft jemand zu viel<br />
an, dann liegt das oft daran, dass es<br />
mehr um den Kick beim Erwerben<br />
geht, ums Siegen, um den Erfolg beim<br />
Ersteigern“, erläutert Ralph Sichler.<br />
Eine überbordende Sammlung will aber<br />
nicht mit Messietum verwechselt werden.<br />
Das sei laut Veronika Schröter ein<br />
anderes Phänomen, es wurzle im Unvermögen,<br />
etwas loszulassen. Gefährdet<br />
seien besonders Personen, die in ihrer<br />
Kindheit viele Zwänge erlebt haben.<br />
Einem Messie aber sei seine Wohnung<br />
peinlich, während ein Sammler stolz<br />
auf seine Kollektion sei. Dennoch trennen<br />
sich Sammler bisweilen von ihrer<br />
gesamten Sammlung. Ralph Sichler:<br />
„Diese Entscheidung kann sehr rational<br />
sein, wenn ein Sammler erkennt,<br />
dass Aufwand und Ertrag nicht mehr<br />
zusammenpassen – gerade bei Oldtimern<br />
steckt ja oft auch viel Geld in der<br />
Sammlung. Es kann mit Frustration<br />
und Enttäuschung zu tun haben, wenn<br />
man erkennt, dass einen das Sammelgebiet<br />
nicht so erfreut wie erhofft. Oder<br />
neue Lebenszusammenhänge wie beispielsweise<br />
eine neue Beziehung eröffnen<br />
frische Perspektiven.“ Im Idealfall<br />
also erkennen Sammler, wann die<br />
Zeit reif ist für einen neuen Lebensabschnitt.<br />
Oder ein neues Sammelgebiet.<br />
<br />
1 Sehr schlanke, reduzierte Fahrräder ohne<br />
Schaltung und folglich mit nur einer Übersetzung<br />
– entweder mit Freilauf oder ohne, letztere<br />
sind auch als Fixies bekannt.<br />
2 Transporträder mit einem überbreiten Gepäcksträger<br />
über dem Vorderrad, wie sie einst<br />
beispielsweise von Bäckern benützt wurden.<br />
<strong>Leidenschaft</strong><br />
21
INNOVATIVES ONLINE & OFFLINE<br />
START-UPS<br />
SPANNENDE IDEEN AUS ALLER WELT VON ODER FÜR<br />
MENSCHEN MIT LEIDENSCHAFT. Von Katrin Stehrer<br />
////// NACHHALTIGKEIT AUF DREI RÄDERN /////////////<br />
Das visionäre indisch-holländische Startup Three Wheels United (TWU) will mit<br />
dem Verkauf von Hybrid-Tuk-Tuks die Umweltverschmutzung und den Lärm in Indiens<br />
Großstädten bis 2020 um bis zu 30% reduzieren. Die prekäre Einkommenssituation<br />
der fünf Millionen indischen Tuk-Tuk-Fahrer soll ebenfalls verbessert werden:<br />
TWU erleichtert den Fahrern den Kauf der Rikschas durch faire Darlehen und<br />
sichert ihnen eine zusätzliche Einnahmequelle: die Nutzung der Tuk-Tuks als Werbeträger.<br />
Das Start-up wurde vom holländischen Social Impact Inkubator Enviu mitbegründet<br />
und vom Fast Company Magazin unter die 10 innovativsten Unternehmen<br />
der Welt gereiht.<br />
www.threewheelsunited.com<br />
enviu.org<br />
////// DIE BOX FÜR ALLE FÄLLE ////////////////////////////<br />
Der Schweizer Philippe Perakis wollte sich bei seinen Touren von Unterbrechungen<br />
wie etwa einer Hotelübernachtung im Tal nicht mehr einschränken lassen. Der einstige<br />
Profi -Mountainbiker entwickelte die swissRoomBox, eine Wohnung in der Kiste,<br />
die im Auto mitgenommen werden kann. Die swissRoomBox wird im Kofferraum<br />
transportiert und kann je nach Bedarf ausgeklappt werden: zur Warmwasserdusche<br />
mit Duschvorhang, zum Doppelbett, zur Küche oder zum Esszimmer. Einzelne Module<br />
gibt es ab ca. EUR 700, die all-inclusive Version kostet rund EUR 7500.<br />
www.swissroombox.com<br />
////// NICHT OHNE MEIN FAHRRAD ///////////////////////<br />
Vrachtfiets, niederländisch für Cargo Fahrrad, ist eine Transportlösung für wahre<br />
Fahrradenthusiasten, die selbst beim Umzug nicht auf das Bike verzichten möchten.<br />
Es hat Platz für zwei Personen, bietet Lagerraum für zwei Kubikmeter Fracht und wird<br />
durch einen mit Solarstrom betriebenen Elektroantrieb unterstützt.<br />
Entwickelt wurde es von den beiden Industriedesignstudenten Onno Sminia und<br />
Louis Pierre Geerinckx an der TU Delft. Obwohl das Vrachtfi ets für Privatkunden gedacht<br />
war, sind die ersten Kunden große Abnehmer wie die Stadt Delft, die Technische<br />
Universität Delft sowie Ikea.<br />
www.vrachtfi ets.nl<br />
////// FENSTERPLÄTZE ZUM SPIELEN /////////////////////<br />
Auf langen Zugfahrten vertreiben sich die Passagiere die Zeit meist lieber mit Büchern<br />
oder Mobilgeräten, anstatt bloß die vorbeiziehende Landschaft zu betrachten.<br />
Die japanische audio-visuelle Gruppe Salad will das ändern und integriert die Landschaft<br />
in ein Spiel. Touch the Train Window ermöglicht es den Reisenden durch<br />
bloßes Berühren der Fensterscheibe Gegenstände wie Ballons, Flugzeuge, Bäume,<br />
aber auch Vögel und Menschen in der Landschaft zu platzieren. Die Augmented-<br />
Rea lity-Technologie ist eine Mischung aus iPhone, Kinect, openFramework, GPS<br />
Modul und Beamer. Wenn sich die Idee durchsetzt, müssen wohl bald alle Sitze im<br />
Zug Fensterplätze sein.<br />
www.csp-salad.com<br />
22
THERAPIE AN DER BUSHALTESTELLE /////////////<br />
Der Mangel an Sonnenlicht und damit an Vitamin D ist ein bekannter Auslöser von<br />
Winterdepressionen. Dem hat der Energiekonzern Umeå Energi im schwedischen<br />
Umeå den Kampf angesagt. Weil es in der 500 Kilometer nördlich von Stockholm gelegenen<br />
Stadt im Dezember nur vier Lichtstunden pro Tag gibt, ersetzte Umeå Energi<br />
die Werbefl ächen von 30 Bushaltestellen mit fototherapeutischen Lampen. Diese<br />
sollen die Tagesdosis an Licht erhöhen und den Hormonspiegel im Gehirn in lichtarmen<br />
Zeiten auf einem gesunden Level halten. Um die volle Wirkung der kostenlosen<br />
Lichttherapie nutzen zu können, müsste man sich 30 Minuten pro Tag bestrahlen<br />
lassen – bei Temperaturen von bis zu minus 30 Grad eine große Überwindung.<br />
www.umeaenergi.se<br />
////// DIE STRASSE ALS KRAFTWERK ////////////////////<br />
Solarenergie liegt im Trend und wird schon lange nicht mehr nur am Dach des<br />
Eigen heims gewonnen. In Europa hat das niederländische Forschungsinstitut TNO<br />
die Solarzelle nun auf die Straße gebracht. In einem Kooperationsprojekt mit einer<br />
Straßen baugesellschaft und einem Elektrotechnikkonzern wurde die Solaroad<br />
(Solarstraße) entwickelt. Sie ist mit einer zentimeterdicken Solarzellenschicht bedeckt<br />
und lässt sich modulartig auf eine beliebige Länge zusammensetzen. Das System<br />
Solaroad könnte unter anderem zur Stromversorgung der umliegenden Häuser<br />
beitragen: Bereits 30 Quadratmeter decken den Energiebedarf eines Singlehaushalts<br />
in der Höhe von 1.500 kwh pro Jahr. Alleine Holland hat ein Straßennetz von<br />
ca. 140.000 Kilometern Länge, das dafür genutzt werden könnte. Der Proto typ, ein<br />
Fahrradweg in Krommenie in der Nähe von Amsterdam, kann bereits besichtigt<br />
werden.<br />
www.tno.nl/solaroad<br />
Der Elektroingenieur Scott Brusaw arbeitet am US-amerikanischen Pendant zur Solaroad.<br />
2009 entwickelte er für die US-Highway-Verwaltungsbehörde einen Solarroad<br />
Prototyp. Seit 2011 wird auch an einem Parkplatz-Protoypen gearbeitet. Seine<br />
Vision ist, das Land von Kalifornien bis New York City mit einer Solarstraße auszustatten.<br />
So komme es zu einem Kontinent überspannenden Netzwerkeffekt, über den<br />
die Westhälfte der USA in der Nacht mit der Energie der Osthälfte, an der Tag ist,<br />
versorgt wird und umgekehrt.<br />
http://solarroadways.com/intro.shtml<br />
////// DER BALL ZUM MINENRÄUMEN /////////////////////<br />
Schätzungen zufolge gibt es weltweit 100 Millionen Landminen, 10 Millionen sollen<br />
es allein in Afghanistan sein. Massoud Hassani, Absolvent der Design Academy<br />
Eindhoven, suchte nach einer Lösung für dieses Problem und erfand den Minenräumungsball<br />
Mine Kafon (Persisch für Explosion). Er sieht aus wie der überdimensionierte<br />
Kopf einer Pusteblume mit zwei Metern Durchmesser und ist aus biologisch<br />
abbaubarem Hartplastik und Bambusrohren konstruiert. Sobald der Räumungsball<br />
über eine Landmine rollt, wird die Detonation ausgelöst. Der 80 Kilogramm schwere<br />
Mine Kafon wird durch den starken afghanischen Wind angetrieben, dieser bestimmt<br />
auch die Richtung des Weges. Der eingebaute GPS-Sensor zeigt die Landminenfreien<br />
Zonen später im Internet an. Ob eine serienmäßige Produktion folgt, ist noch<br />
unklar.<br />
http://minekafon.blogspot.co.at<br />
www.vimeo.com/51887079<br />
<strong>Leidenschaft</strong><br />
23
PROGRAMMIERTE<br />
EMPATHIE<br />
Foto: © www.iuro-project.eu<br />
24
IN NAHER ZUKUNFT WERDEN EMPATHISCHE ROBOTER IN DIE<br />
PRIVATHAUSHALTE EINZIEHEN, SIE WERDEN UNS ALLTAGSENTSCHEIDUNGEN<br />
ABNEHMEN UND WIR WERDEN SIE DAFÜR LIEBEN.<br />
Von Ruth Reitmeier<br />
„Wir sind soziale Wesen, das ist nicht<br />
unsere Entscheidung“, sagt Paolo Petta,<br />
Emotionsforscher am Austrian Research<br />
Institute for Artificial Intelligence<br />
(OFAI). Und plötzlich sitzt er<br />
vollkommen regungslos da. Was sich<br />
wie eine Ewigkeit anfühlt, dauert vielleicht<br />
zwei, höchstens drei Sekunden.<br />
Dann die Erlösung, wie auf Knopfdruck<br />
wieder zum Leben erweckt sagt<br />
er: „Ja, wir sind es.“ – Er hat mit dieser<br />
kleinen Demonstration wirklich anschaulich<br />
verdeutlicht, was er meint:<br />
Wer auf sein Gegenüber nicht mehr<br />
eingeht, wirkt sofort unmenschlich.<br />
Auch Barbara Kühnlenz von der<br />
Technischen Universität München<br />
(TUM) erforscht menschliche Emotion<br />
in der Interaktion mit der Maschine.<br />
Konkret arbeitet sie zusammen<br />
mit Projektpartnern mehrerer<br />
europäischer Universitäten an IURO,<br />
einem Roboter, der in der Lage ist,<br />
mit dem Menschen face-to-face zu<br />
kommunizieren. Sein Repertoire baut<br />
auf Erkenntnissen der Psychologie<br />
auf, vor allem dem Wissen, dass Empathie<br />
das Fundament menschlicher<br />
Beziehungen darstellt. Ein Freund ist<br />
jemand, der einen verständnisvoll ansieht<br />
und einem zuhört. Nun erforschen<br />
Wissenschafter wie Kühnlenz,<br />
ob die Mechanismen der Empathie<br />
die Maschine dem Menschen näher<br />
bringen können. Tritt IURO mit einem<br />
Menschen in Kontakt, stellt er<br />
sich zunächst vor und fragte dann<br />
sein Gegenüber wie es ihm gehe. Dadurch<br />
entsteht die Basis für eine prosoziale<br />
Interaktion mit dem Roboter.<br />
Noch sind sie hauptsächlich in Fabriken<br />
im Einsatz, doch die Roboter<br />
kommen. Da sind sich die Experten<br />
einig. Kleinserien als Alltagshilfen<br />
dürften in zehn bis 15 Jahren vom<br />
Band rollen, spätestens 2050 werden<br />
Roboter in privaten Haushalten standardmäßig<br />
im Einsatz sein. Diese<br />
Helfer sollten als möglichst angenehme<br />
Gesellschaft empfunden werden,<br />
Befindlichkeiten des Menschen<br />
erkennen und berücksichtigen können.<br />
„Der Roboter sollte etwa merken,<br />
dass der Mensch gerade nicht gut<br />
drauf und vom Staubsauger genervt<br />
ist, und in einem anderen Raum zuerst<br />
saugen“, sagt Kühnlenz.<br />
2050 SIND SERVICE-<br />
ROBOTER AKTIVE<br />
FAMILIENMITGLIEDER<br />
IURO ist zirka 1,70 Meter groß, besteht<br />
aus einem kompakten, robusten<br />
Rumpf, Armen und ist auf Rädern unterwegs.<br />
Auf den ersten Blick beeindruckt<br />
aber IUROs Gesicht: Riesige<br />
blaue Augen, hinter denen Kameras<br />
eingebaut sind, er kann die Mundwinkel<br />
und die Augenbrauen hochziehen<br />
und lustig mit den kleinen<br />
Ohren schlagen. Was IURO sagt und<br />
wie die Mimik-Features in der Interaktion<br />
mit dem Menschen eingebracht<br />
werden, ist Kühnlenz’ Domäne. „Wir<br />
Menschen empfinden es als natürlicher,<br />
wenn der Roboter überrascht<br />
dreinschaut, weil er einen Auftrag<br />
nicht verstanden hat, als wenn ein<br />
rotes Lämpchen aufleuchtet“, sagt sie.<br />
IURO kann mittlerweile sogar in den<br />
Gesichtern der Menschen lesen. Der<br />
erste Ausflug des Prototypen führte<br />
in die Münchner Innenstadt. Der Roboter<br />
wurde losgeschickt, um nach<br />
dem Weg zum Marienplatz zu fragen.<br />
Das Ziel war, dass die Menschen ihm<br />
helfen sollten. IURO steuerte also<br />
Passanten an. In diesem Feldversuch<br />
kam bereits eine anspruchsvollere<br />
Variante des Small Talk zum Einsatz.<br />
Denn IURO schätzte anhand<br />
des Gesichtsausdrucks ein, wie sich<br />
der Mensch gerade fühlt – darauf ist<br />
er programmiert. „Die Einschätzung<br />
war zwar nicht immer korrekt, aber<br />
dadurch wurde eine gemeinsame<br />
Basis für eine Interaktion geschaffen.<br />
Die meisten Menschen haben ihm<br />
dann auch geholfen“, sagt Kühnlenz.<br />
Dies ist der sozialpsychologische Angelpunkt,<br />
von dem aus sich ein noch<br />
größeres soziales Repertoire des Roboters<br />
entwickeln lässt. Nachdem<br />
auch die Robotik verstärkt selbstlernende<br />
Systeme einsetzt, wird der Roboter<br />
künftig vom Menschen lernen,<br />
der ihm Feedback gibt: „Das hast du<br />
gut gemacht.“ Der Mensch wird für<br />
den Roboter zur wichtigsten Informationsquelle.<br />
Auch der Affective Intelligent Driving<br />
Agent, kurz AIDA, hat große Augen,<br />
wenn auch nur als Bildschirmgrafik.<br />
Er ist ein freundlicher Co-Pilot, eine<br />
aktuelle Entwicklung von Volkswagen<br />
of America in Zusammenarbeit<br />
mit dem Massachusetts Institute of<br />
Technology (MIT). AIDA verarbeitet<br />
Daten aus dem Inneren des Wagens<br />
und allem, was sich außerhalb tut.<br />
Das System spricht mit dem Lenker<br />
und ist Autodidakt: Mit jeder Fahrt<br />
lernt es den Fahrer und die Verkehrssituation<br />
in der Stadt besser kennen.<br />
Das Gerät ist quasi die nächste Generation<br />
der Navigationssysteme und<br />
kann deutlich mehr. Es gibt dem Fahrer<br />
nicht nur die beste Route durch<br />
und rechtzeitig Bescheid, wenn er<br />
sich etwa zu seinem Termin verspätet.<br />
<strong>Leidenschaft</strong><br />
25
RADIKALE<br />
TRENDBRÜCHE AUF<br />
DEM WEG ZUR MOBILITÄT<br />
DER ZUKUNFT<br />
Foto: © www.iuro-project.eu<br />
Können gegenseitig ihre Gesichter lesen und Small Talk führen:<br />
Roboter IURO und seine Chefi n Barbara Kühnlenz von der technischen Universität München.<br />
Mehr noch, auf Wunsch schreibt das<br />
Ding gleich eine SMS an den Wartenden<br />
und gibt dem Fahrer sodann die<br />
Antwort durch. Wird der Fahrer ein<br />
wenig müde, spielt es flotte Musik aus<br />
den im Handy gespeicherten Playlists.<br />
PROGRAMMIERTE<br />
LIEBE FUNKTIONIERT<br />
NICHT<br />
Wenn IURO mit seinen großen Augen<br />
verständnisvoll dreinschaut, so<br />
ist dies programmiert. Roboter, die<br />
mit gängiger Software unterwegs sind,<br />
seien nicht klüger als Waschmaschinen,<br />
betont der irische Informatiker<br />
Noel Sharkey. Roboter und Computer,<br />
die sich verselbständigen, die durchknallen<br />
und die Menschheit vernichten<br />
wollen, kennt man aus der Science-<br />
Fiction-Literatur und Filmen. Dass<br />
Roboter Gefühle erlernen und Bewusstsein<br />
erlangen werden, gar<br />
liebes- und leidensfähig sind, wie<br />
etwa das Roboterkind David in Steven<br />
Spielbergs Film AI, der seine Menschenmutter<br />
abgöttisch liebt, bleibt<br />
ein Mythos. Und daran wird auch<br />
das Einspeichern immer größere Datenmengen<br />
nichts ändern. „Vielleicht<br />
wird es irgendwann möglich, dass<br />
durch die Verschaltung der richtigen<br />
Kreise der Roboter eine Art Bewusstsein<br />
herausbildet“, meint Kühnlenz.<br />
Herausforderungen, die einer Gesellschaft<br />
voller Robotern blühen, werden<br />
wohl andere sein. Die Menschheitsgeschichte<br />
zeigt, dass jede technologische<br />
Revolution massive gesell schaftliche<br />
Veränderungen zur Folge hat, betont<br />
Petta vom OFAI in Wien. Roboter, soviel<br />
steht fest, fügen sich zunehmend<br />
effizienter in die Arbeits welt ein. Industrieroboter<br />
arbeiten mittlerweile so<br />
genau und sind so günstig, dass bereits<br />
Produktionsverlagerungen von Industrie-<br />
in Billiglohnländer abgesagt und<br />
stattdessen Roboter angeschafft wurden.<br />
Es stellt sich also die Frage, was<br />
das für eine Gesellschaft sein wird, in<br />
der sie allgegenwärtig sind und viele<br />
Arbeiten und Tätigkeiten übernehmen,<br />
und noch wichtiger: Was werden dann<br />
die Menschen tun?<br />
ÄLTERE MENSCHEN<br />
WOLLEN ROBOTER<br />
NICHT MEHR<br />
HERGEBEN<br />
Der Roboter wird möglicherweise niemals<br />
Gefühle entwickeln können, das<br />
Affektwesen Mensch wird sich jedoch<br />
an die Maschine binden. Im Feldver -<br />
such zur Interaktion zwischen Mensch<br />
und Roboter in der Münchner Innenstadt<br />
zeigte sich, dass viele Menschen,<br />
vor allem auch ältere, gerne bereit waren,<br />
mit dem Roboter zu kommunizieren.<br />
„Und sie waren auch sehr geduldig<br />
mit ihm“, betont Kühnlenz.<br />
Petta vom OFAI berichtet davon, wie<br />
älteren Menschen für die Zeit nach<br />
einer Operation oder Rehabilitation<br />
ein Miniroboter zur Verfügung gestellt<br />
wurde, um sie etwa daran zu erinnern,<br />
regelmäßig ihre Medikamente<br />
einzunehmen, Blutdruck zu messen<br />
und die Werte einzutragen. „Was man<br />
aber nicht bedacht hatte, war wie sich<br />
die älteren Leute dabei fühlen werden,<br />
wenn der Roboter nach einigen Wochen<br />
wieder abgeholt wird.“ Sie hatten<br />
sich an ihn gewöhnt, einige sprachen<br />
mit ihm.<br />
Anhand von Beispielen wie diesem<br />
hat man inzwischen erkannt, wie<br />
wichtig es ist, die ethische Dimension<br />
zu überprüfen, aber auch, dass man<br />
die Entscheidung darüber nicht dem<br />
Entwickler überantworten kann, sondern<br />
andere, am besten wir alle, daran<br />
Teil haben. Technologiefolgenabschätzung<br />
ist vielschichtig, der gesell schaft-<br />
26
Fotos: © MIT SENSEable City Lab and<br />
Personal Robots Group of Media Lab<br />
Auch der Affective Intelligent Driving Agent (AIDA) wird bald neben dem Navigieren auch und die Gefühle des Fahrers erkennen<br />
und sie mit seinen blauen Augen ausdrücken. Ziel ist es, in der richtigen Situation richtig zu reagieren, um das Fahrerlebnis zu verbessern.<br />
Zum Beispiel werden Fahrtipps nur bei guter Gemütslage des Lenkers gegeben.<br />
liche Diskurs darüber von enormer<br />
Relevanz. Petta: „Wir alle sind aufgerufen,<br />
einen Umgang mit neuen Technologien<br />
zu finden. Man lässt ja auch<br />
kein Stanleymesser offen herumliegen.“<br />
Und Klaus Mainzer, TUM-Professor<br />
für Philosophie und Wissenschaftstheorie<br />
unterstreicht, dass etwa für<br />
die fortschreitende globale Vernetzung<br />
gelten muss, was für jedes Küchengerät<br />
gilt, das auf den Markt<br />
kommt: Sicherheitsstandards müssen<br />
eingehalten werden.<br />
Ethiker und Technikphilosophen beschäftigen<br />
sich nicht nur mit Robotern,<br />
sondern mit der zunehmenden globalen<br />
Vernetzung intelligenter Infrastrukturen.<br />
Schon in naher Zukunft<br />
werden wir die Komplexität des Alltags,<br />
Energieversorgung und Verkehrsprobleme<br />
über solche Netzwerke<br />
lösen. Sie werden den Globus wie ein<br />
Nervensystem überziehen. Und sie<br />
werden sich eigenständig organisieren<br />
und autonom agieren müssen, nicht<br />
zuletzt weil der Mensch die Details<br />
gar nicht mehr überblickt.<br />
Parallel zu diesen großen Netzen<br />
spannt sich das so genannte Internet<br />
der Dinge. Kleinstcomputer werden<br />
künftig alle Objekte miteinander verbinden<br />
und Informationen mit Menschen<br />
sowie anderen Dingen austauschen.<br />
Ins Internet der Dinge sind<br />
nicht nur das Heizsystem oder der<br />
Kühlschrank eingebunden, sondern<br />
selbst so kleine Objekte wie die Glühbirne,<br />
die über WLAN verfügt. Vergisst<br />
der Letzte also, das Licht auszumachen,<br />
kann er dies übers Handy<br />
später bequem vom Büro aus erledigen.<br />
Das Internet der Dinge wird als das<br />
nächste große Ding gehandelt, die<br />
Infrastruktur dafür ist de facto längst<br />
geschaffen. Seit August 2010 sind bereits<br />
mehr Maschinen als Menschen<br />
im Internet. Der Technologiekonzern<br />
Cisco schätzt, dass bis 2015 rund<br />
15 Milliarden Gerätschaften mit dem<br />
Internet verbunden sein werden,<br />
50 Milliarden bis 2020. Und weil das<br />
Internet bereits jetzt aus allen Nähten<br />
platzt, muss ein neues Adressierungssystem<br />
eingeführt werden. Statt<br />
4,3 Milliarden Webadressen wird das<br />
neue Internet Raum für 340 Sextillionen<br />
Adressen bieten (die Sextillion<br />
hat 36 Nullen!).<br />
Das Internet der Dinge klingt nach einer<br />
wundervollen und gespens tischen<br />
neuen Welt zugleich. Man stelle sich<br />
vor, das Auto macht während der<br />
Fahrt ein merkwürdiges Geräusch,<br />
der Fahrer hält an, das Fahrzeug meldet<br />
dem Fahrer, wo das Problem liegt,<br />
ruft den Pannendienst an und informiert<br />
auch diesen darüber, gibt den<br />
genauen Standort durch und welche<br />
Ersatzteile benötigt werden sowie wo<br />
diese lagernd sind.<br />
Keine Branche wird davon unberührt<br />
bleiben. Und noch wichtiger, die fortschreitende<br />
Technikintegration wird<br />
tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen<br />
nach sich ziehen. Das erzeugt<br />
Begeisterung, aber auch Unbehagen.<br />
In einer Welt, in der alles<br />
vernetzt ist, bleibt nichts geheim.<br />
Die Technik bietet ungeahnte Möglichkeiten.<br />
Entdecken wird diese das<br />
niemals auf Bequemlichkeit ausgelegte<br />
„Steinzeithirn“ des Menschen,<br />
das gefordert werden will: Neurowissenschaftliche<br />
Untersuchungen zeigen,<br />
dass mit der Hand zu schreiben mehr<br />
Gehirnareale aktiviert, darunter jene,<br />
die für das Lernen und Merken zuständig<br />
sind, als vergleichsweise flüchtiges<br />
Tippen auf dem Keyboard. Eine Studie,<br />
die Psychologen an der Universität<br />
Princeton durchgeführt haben, offenbarte,<br />
dass sich die Studenten Textinhalte<br />
besser gemerkt haben, wenn<br />
diese in schlechter Druckqualität<br />
daher kamen.<br />
GEGENREAKTION AUF<br />
TECHNOLOGISIERUNG:<br />
MANUELLE<br />
ANSTRENGUNG<br />
Gewisse Komplikationen scheinen<br />
das Gehirn regelrecht zu beflügeln<br />
und der Kreativität auf die Sprünge<br />
zu helfen. Der amerikanische Rockmusiker<br />
Jack White ist davon überzeugt,<br />
dass gute Musik nicht leicht<br />
von der Hand gehen darf, und macht<br />
sich deshalb das Leben auf der Bühne<br />
absichtlich schwer: indem er etwa auf<br />
billigen Gitarren spielt und verschiedene<br />
Instrumente so anordnet, dass<br />
er sich anstrengen muss, wenn er zwischen<br />
ihnen wechseln will.<br />
Der österreichische Schriftsteller<br />
Arno Geiger beschreibt die Tücken<br />
der Technologisierung im Zusammenhang<br />
mit menschlicher <strong>Leidenschaft</strong><br />
im Onlinemagazin Chrismon:<br />
„Ich würde gerne Gitarre spielen können,<br />
aber wenn ich mir dafür am<br />
Kiosk nur einen Chip kaufen müsste,<br />
wäre es nichts wert. Das Schöne ist,<br />
dass ich die Sehnsucht habe, etwas zu<br />
können, aber mir meiner Unfähigkeit<br />
bewusst bin und dann eine <strong>Leidenschaft</strong><br />
dafür entwickle. Das erzeugt<br />
Glück.“ <br />
www.iuro-project.eu<br />
www.ofai.at<br />
http://senseable.mit.edu/aida<br />
<strong>Leidenschaft</strong><br />
27
DIE SUCHE<br />
Foto: © Klara Harden<br />
NACH DEM<br />
GLÜCK<br />
DIE ÖSTERREICHERIN KLARA HARDEN FINANZIERT ÜBER CROWDFUNDING<br />
FILMPROJEKTE, FÜR DIE SIE BRENNT. ZULETZT BEREISTE SIE ZUSAMMEN MIT<br />
KARSTEN PRÜHL MADAGASKAR. AUF FAHRRÄDERN ERKUNDETEN DIE BEIDEN<br />
FILMEMACHER DIE INSEL, FINGEN IHRE SCHÖNHEIT WIE AUCH IHRE PROBLEME<br />
EIN. IHR AKTUELLER FILM WITH LOVE FROM MADAGASCAR LÄUFT IM INTERNET.<br />
Das Gespräch führte Ruth Reitmeier<br />
„With Love from Madagascar“ wurde<br />
wie schon Ihr erstes Film-Abenteuer<br />
„Made in Iceland“ über Crowdfunding<br />
finanziert, konkret über die Plattform<br />
Startnext. Wieso haben Sie sich für<br />
diese Art der Finanzierung entschieden?<br />
Ich denke, ohne Crowdfunding wäre<br />
es nicht möglich gewesen, dieses Projekt<br />
überhaupt zu machen. Die Supporter<br />
sind alle Kleinstproduzenten<br />
und sie sind stolz darauf, wenn sie ihren<br />
Namen im Abspann lesen.<br />
Alle Unterstützer werden namentlich<br />
genannt?<br />
Ja selbstverständlich, es ist sehr wichtig<br />
zu zeigen, dass wir ja nicht bloß<br />
einen Film machen wollten, sondern<br />
wir haben diesen Film für genau<br />
diese Menschen gemacht. Denn sie<br />
haben entschieden, dass er gedreht<br />
wird. Das ist das Schöne am Crowdfunding:<br />
Hat man eine Idee, die andere<br />
berührt oder den Zeitgeist trifft,<br />
dann kann man etwas produzieren,<br />
das sonst kaum Chance auf Realisierung<br />
hätte.<br />
28
Crowdfunding – die Schwarmfi nanzierung – wurde in der Kulturund<br />
Kreativszene zwecks Projektfi nanzierung erdacht. Auf den US-<br />
Plattformen Kickstarter und Indiegogo sammeln Kreative seit Jahren<br />
Geld für Buchprojekte, Musik, kultige Magazine. Seit zirka 2010<br />
sind auch mehrere deutsche Crowdfunding-Plattformen online, darunter<br />
Startnext. Kreative präsentieren ihre Projekte in einem kurzen<br />
Video auf der Plattform. Der Investor unterstützt jene Projekte, die er<br />
realisiert sehen will. Es gilt das Alles-oder-nichts-Prinzip. Findet die<br />
Idee binnen einer Frist nicht genug Anklang, dann wird sie auch<br />
nicht verwirklicht. Jene, die bereits überwiesen haben, bekommen<br />
ihr Geld zurück.<br />
Anders als beim Spenden geht es beim Crowdfunding um Geben<br />
und Nehmen. Die Mäzene zahlen 10, 20, 100 Euro oder auch mehr<br />
für ihr Wunschprojekt ein und bekommen als Gegenleistung ein<br />
exklusives „Dankeschön“. Das kann eine handsignierte CD sein,<br />
eine Premierenkarte, ein T-Shirt. Crowdfunding entwicklet sich zu<br />
einem Instrument der Kulturfi nanzierung, einer Alternative zur Subventionierung<br />
durch die öffentliche Hand. Mischformen zwischen<br />
staatlicher und privater Projektfi nanzierung durch Crowdfunding<br />
sind im Kommen.<br />
Findige Internet-Unternehmer haben die Idee des Crowdfunding<br />
längst weitergedreht und renditefähig gemacht. Das Crowdinvesting<br />
ward geboren. Beim Crowdinvesting legt eine Großgruppe von<br />
Kleinst-Investoren zusammen und stellt Risikokapital für Start-ups<br />
und innovative Unternehmen bereit. Crowdinvesting hat starkes Potenzial:<br />
Zum einen wird es für Gründer und mittelständische Unternehmen<br />
zunehmend schwieriger, Risikokapital für Innovationen<br />
von Banken zu bekommen. Für den Anleger ist das Modell in Zeiten<br />
mickriger Sparzinsen nicht zuletzt deshalb interessant, weil er mit<br />
überschaubaren Geldbeträgen in der Höhe von hundert Euro direkt<br />
in Unternehmen seiner Wahl investieren kann. Durch die Investition<br />
in mehrere unterschiedliche Projekte kann das Risiko gestreut werden.<br />
Hinzu kommt: Im deutschsprachigen Raum ist laut Branchenkennern<br />
noch jede Menge Platz für private Geldgeber.<br />
CROWDFUNDING<br />
FINANZIERT IDEEN,<br />
DIE SONST KEINE<br />
CHANCE HÄTTEN<br />
Wie viel Geld hatten Sie letztendlich<br />
zur Verfügung?<br />
Über die Startnext haben wir die angepeilten<br />
5000 Euro gesammelt, dazu<br />
kam eine Filmförderung von Cinestyria<br />
über 2500 Euro. Zudem haben uns<br />
drei Unternehmen mit Expeditionsequipment<br />
gesponsert.<br />
Dieses Budget ist für ein Projekt<br />
dieser Art schmal. Sind Sie damit<br />
durchgekommen?<br />
Nein, das war uns allerdings von<br />
Anfang an klar, dass sich das nicht<br />
ausgehen wird. Ich erinnere mich<br />
aller dings noch, dass Startnext<br />
meinte, dass un ser Zielbetrag von<br />
5000 Euro für das Finanzierungsinstrument<br />
Crowdfund ing doch recht<br />
hoch ist. Das hat sich seither allerdings<br />
geändert, mittler weile ist es<br />
durchaus üblich, 10.000-Euro-<br />
Projekte so zu finanzieren.<br />
Und wie haben Sie die Finanzlücke<br />
geschlossen?<br />
Bei unserem Filmprojekt ist auch unser<br />
privates Geld hineingeflossen und wir<br />
haben die gesamte Produktion, also<br />
etwa den zeitaufwändigen Filmschnitt,<br />
als unbezahlte Arbeitszeit aus der<br />
eigenen Tasche finanziert.<br />
DIESE ART DER FILME<br />
SICHERN MICH SOZIAL<br />
NICHT AB<br />
Und wie verdienen Sie Ihren<br />
Lebensunterhalt?<br />
In Berlin mache ich Fotos für Schauspieler,<br />
das sind kleinere Aufträge.<br />
In Österreich habe ich zuletzt für<br />
Red Bull als Kamerafrau gearbeitet.<br />
Das sind Jobs, die ganz ordentlich<br />
bezahlt sind und von denen ich lebe,<br />
auch in der Zeit, in der ich an den<br />
eigenen Projekten arbeite.<br />
Was ist die Motivation, sich das<br />
überhaupt anzutun?<br />
Die Motivation für den Madagaskar-<br />
Film war für uns, dass wir, obwohl es in<br />
Europa alles gibt, von diesem Leben<br />
nicht ausgefüllt waren. Wir dachten,<br />
dass es da noch mehr, mehr Sinn geben<br />
muss. Und ich wollte diesmal die Aufmerksamkeit,<br />
die mir durch den Island-<br />
Film zuteil wurde,für etwas nutzen, für<br />
das sie wirklich gebraucht wird. Durch<br />
den Film konnten wir sichtbar machen,<br />
welche Hilfsprojekte es auf Madagaskar<br />
gibt, was sie machen, und welche Art<br />
von Unterstützung die richtige ist.<br />
DIE MENSCHEN IN<br />
MADAGASKAR LEBEN<br />
VON ABHOLZUNG, DAS<br />
IST NICHT NACHHALTIG<br />
Madagaskars gravierenstes Problem<br />
ist die Umweltzerstörung durch Abholzung...<br />
Ja. Und wir hoffen natürlich, dass<br />
wir die Organisationen, die wir<br />
besucht haben, durch den Film<br />
bekannter machen und auf diese<br />
Weise unterstützen können.<br />
Ein heilsamer Geldfluss zieht sich<br />
durch diese Geschichte: Mit Crowdfunding<br />
haben Sie den Film weitgehend<br />
finanziert und zugleich die<br />
Fan-Community aufgebaut, und nun<br />
werden noch mehr Menschen den<br />
Film sehen und das vielleicht zum<br />
Anlass nehmen, eines der porträtierten<br />
Projekte zu unterstützen. Doch<br />
der Film bietet vor allem Spannung<br />
und Abenteuer.<br />
Auf der Madagaskar-Reise ist so vieles<br />
passiert, und wir haben dort auch<br />
harte Zeiten und viele Überraschungen<br />
erlebt. Wir konnten deutlich<br />
weniger von Madagaskar bereisen als<br />
geplant, dafür war die Reise intensiver.<br />
Was hat Sie aufgehalten?<br />
Etwa eine auf der Landkarte einge-<br />
<strong>Leidenschaft</strong><br />
29
Fotos: © Klara Harden<br />
Nach einer intensiven Zeit des Crowdfunding können die Filmemacher Klara Harden und Karsten Prühl ihren neuesten Film<br />
„With Love from Madagaskar“ drehen. Vor Ort stoßen die jungen Kreativen auf unerwartete Hürden wie zum Beispiel im Plan verzeichnete<br />
aber real nicht vorhandene Straßen. Aufgeben ist jedoch keine Option.<br />
zeichnete Straße am Meer entlang, die<br />
sich als Sandpiste entpuppte, wo man<br />
mit dem Fahrrad einfach nicht mehr<br />
fahren konnte.<br />
CROWDFUNDING<br />
FUNKTIONIERT NUR BEI<br />
AUSSERGEWÖHNLICHEN<br />
IDEEN UND SEHR<br />
PRÄZISE FORMULIERTEN<br />
ANLIEGEN<br />
Beim Crowdfundig muss man die Idee<br />
schon in einem frühen Stadium mit<br />
anderen teilen. Ist das ein Problem<br />
für den kreativen Prozess?<br />
Im Gegenteil, es ist eher förderlich,<br />
weil man seine Idee sehr früh, sehr<br />
präzise ausformulieren muss. Dadurch<br />
wird einem auch selbst klar,<br />
was man eigentlich erreichen will.<br />
Fehlermachen ist Teil dieses Lernprozesses,<br />
denn es wird einem von der<br />
Community schnell und direkt vermittelt,<br />
wenn man auf dem Holzweg<br />
ist.<br />
Konkret?<br />
Wir haben etwa diesmal nicht nur ein,<br />
sondern zwei Präsentationsvideos gemacht,<br />
weil wir gemerkt haben, dass<br />
sich die Leute beim ersten Anlauf<br />
schwer getan haben, zu verstehen, was<br />
wir wollen. Beim Islandfilm war die<br />
Aussage simpel: „Eine junge Frau will<br />
sich ihren Traum erfüllen, und wenn<br />
du auch an Träume glaubst, dann unterstützt<br />
du sie.“ Das war leicht zu<br />
formu lieren. Madagaskar war ein deutlich<br />
komplexeres Projekt. Hinzu kam:<br />
Wir haben das erste Video auf Englisch<br />
gedreht, haben aber gemerkt, dass das<br />
für die deutschsprachigen Unterstützer<br />
schwierig war. Das zweite Video haben<br />
wir auf Deutsch mit englischen Untertiteln<br />
gemacht.<br />
GESCHENKE UND<br />
EINE NENNUNG IM<br />
ABSPANN ALS LOHN<br />
Haben Sie denn Fans außerhalb<br />
Österreichs und Deutschlands?<br />
Aber ja, einige unserer Supporter<br />
kommen aus den USA, einige aus<br />
Asien, und viele aus anderen Ländern<br />
Europas.<br />
Was bekommen Eure Unterstützer<br />
als Dankeschön?<br />
Die meisten, die uns über Startnext<br />
unterstützt haben, haben eine selbstgemachte<br />
Postkarte gewählt. Wir haben<br />
auch Briefe versandt, und Karsten<br />
Prühl hat Zeichnungen mitgeschickt.<br />
Vielen Briefen waren kleine Dinge beigelegt,<br />
wie ein Korallenstück oder eine<br />
Bohne aus Madagaskar. Neben der exklusiven<br />
Preview des Films für die<br />
Supporter werden sie allesamt im Abspann<br />
genannt.<br />
Was motiviert Sie, sich wiederholt<br />
einer so schwierigen Aufgaben wie<br />
dem Filmen zu stellen, zumal damit<br />
kein Geld zu machen ist.<br />
Ich habe während des Filmschneidens<br />
wieder darüber nachgedacht. Das ist<br />
nämlich sehr anstrengend und man<br />
kann dazwischen die Motivation verlieren.<br />
Doch ich weiß, warum ich das<br />
mache: weil für mich ein europäisches<br />
Standardleben nicht funktionieren<br />
würde. Viel Geld ist für mich im Augenblick<br />
nicht wichtig, ich muss niemanden<br />
versorgen. Ich will mich auch<br />
nicht an Güter binden, weil ich weiß,<br />
dass das nicht glücklich macht. Die<br />
Arbeit ist eine Suche nach Glück und<br />
auch eine Investition in die Zukunft.<br />
Vielleicht gibt es ja künftig eine Möglichkeit,<br />
davon sogar leben zu können.<br />
Gibt es neue Vorhaben?<br />
Es ist noch nichts spruchreif, doch es<br />
gibt Pläne für künftige Abenteuer.<br />
Es geht also weiter ...<br />
Ja, und ich glaube nicht, dass ich<br />
jemals damit aufhören werde. <br />
„With Love from Madagascar“ unter:<br />
http://klaraharden.com/<br />
So funktioniert Crowdfunding:<br />
www.youtube.com/<br />
watch?v=kowE3CrOpMg<br />
30
VON WEST NACH OST: WO<br />
SCHLÄGT DAS HERZ DEN KOPF?<br />
OB AUF DEM RÜCKEN DES MOTORRADES, IM INTERNET ODER IM GOURMET-<br />
LOKAL – DIE ÖSTERREICHER FINDEN IHRE LEIDENSCHAFT AUCH REGIONAL<br />
AUF HÖCHST UNTERSCHIEDLICHE WEISE. Von Silvia Wasserbacher<br />
DATEN & FAKTEN<br />
Essen ist <strong>Leidenschaft</strong>. Wenn es um die gehobene Küche geht,<br />
sind der Phantasie und dem Geschmackserlebnis keine Grenzen<br />
gesetzt. Die meisten Gourmet Tempel befinden sich in Salzburg.<br />
Vielleicht gibt es deshalb seit geraumer Zeit das Studium der<br />
Gastrosophie. In fünf Semestern wird man an der Universität<br />
Salzburg zum akademischen Gourmet und lernt, wie Ernährung,<br />
Kultur, Medizin, Wirtschaft und Kommunikation zusammenhängen.<br />
Schlusslicht bildet Oberösterreich. Vielleicht, weil der Weg nach<br />
Salzburg nicht weit ist. www.gastrosophie.at<br />
Anzahl der Haubenrestaurants je<br />
100.000 Einwohner in Österreich<br />
Quelle: Gault Millau, getestete Restaurants 2012<br />
Oberösterreich<br />
Niederösterreich<br />
Steiermark<br />
Vorarlberg<br />
Tirol<br />
Burgenland<br />
Wien<br />
Kärnten<br />
Salzburg<br />
Anzahl der Kaffeehäuser je<br />
100.000 Einwohner in Österreich<br />
Quelle: WKÖ, Kaffeehäuser und Kaffeekonditoreien<br />
Vorarlberg<br />
50,8<br />
Wien<br />
51,2<br />
Niederösterreich<br />
58,9<br />
Salzburg 69,8<br />
Oberösterreich 73,9<br />
Burgenland 87,3<br />
Kärnten<br />
117,6<br />
Steiermark<br />
132,0<br />
Tirol<br />
148,6<br />
8,3<br />
13,1<br />
18,2<br />
19,7<br />
21,3<br />
22,4<br />
27,3<br />
28,3<br />
36,7<br />
Schwarz und stark oder mit viel Milch und Schlag – Kaffee ist<br />
nicht nur ein Koffein-Kick sondern auch Genussmittel. Die<br />
größte Kaffeehausdichte gibt es nicht in Wien, sondern in Tirol.<br />
In der Großstadt schätzt man die Anonymität. Daher können sich<br />
59 % der Wiener vorstellen, ihren Partner im Internet zu suchen. In<br />
Tirol sind es nur 34 %. Im Umkehrschluss könnte man sagen, dass<br />
die Wiener österreichweit das kleinste Selbstbewusstsein haben.<br />
Denn über das Medium Internet ist die Mutschwelle niedriger, jemanden<br />
anzusprechen. Eine Umfrage des GfK Austria* bestätigt<br />
die Vermutung: Nur 72 % der Wiener fühlen sich attraktiv, wohingegen<br />
die Eigenschaft 80 % der Tiroler für sich attestieren.<br />
* GfK Austria Sozial- und Organisationsforschung, telefonische Befragung von<br />
n= 500 Personen, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 15 Jahren.<br />
Vorstellbarkeit der Partnersuche im Internet in<br />
Prozent in Österreich Tirol 33,8 %<br />
Quelle: parship.at<br />
Burgenland<br />
38,2 %<br />
Kärnten<br />
38,6 %<br />
Oberösterreich<br />
42,3 %<br />
Salzburg<br />
46,8 %<br />
Vorarlberg<br />
47,6 %<br />
Steiermark<br />
47,7 %<br />
Niederösterreich<br />
57,2 %<br />
Wien<br />
58,8 %<br />
Einmal im Jahr werden 70.000 Motorräder am Faaker See gezählt.<br />
Dann treffen sich in Kärnten die Harley-Davidson-Fans aus ganz Europa<br />
und zelebrieren das Gefühl der Freiheit. Unterm Jahr geht es ruhiger zu.<br />
Dennoch: Mit Blick auf den Österreich-Vergleich steht das südliche<br />
Bundesland in der Motorradstatistik an erster Stelle.<br />
Dem Motto „gemeinsam statt einsam“<br />
folgen im Vereinsland Österreich vor<br />
allem die Kärntner. Ob Brauchtum und<br />
Kultur, ob Tiere und Natur oder Sport und<br />
Gesundheit, es ist für jeden etwas dabei.<br />
Tanzen ist die <strong>Leidenschaft</strong><br />
schlechthin. Die meisten Tanzschulen<br />
Österreichs werden im<br />
Burgenland betrieben.<br />
Schlusslicht ist Vorarlberg.<br />
Anzahl der Motorräder je<br />
100.000 Einwohner in Österreich<br />
Quelle: Statistik Austria 2011<br />
Wien<br />
Salzburg<br />
Oberösterreich<br />
Tirol<br />
Burgenland<br />
Steiermark<br />
Vorarlberg<br />
Niederösterreich<br />
Kärnten<br />
3.511<br />
4.751<br />
4.857<br />
5.108<br />
5.127<br />
5.233<br />
5.445<br />
5.564<br />
5.654<br />
Anzahl Vereine je<br />
100.000 Einwohner in Österreich<br />
Quelle: BMI Vereinsstatistik 2012<br />
Oberösterreich<br />
Vorarlberg<br />
Salzburg<br />
Niederösterreich<br />
Steiermark<br />
Tirol<br />
Wien<br />
Burgenland<br />
Kärnten<br />
1.198<br />
1.222<br />
1.239<br />
1.350<br />
1.456<br />
1.484<br />
1.511<br />
1.715<br />
1.732<br />
Anzahl der Tanzschulen je<br />
100.000 Einwohner in Österreich<br />
Quelle: WKÖ, nur aktive WK-Mitgliedsbetriebe<br />
Vorarlberg<br />
Salzburg<br />
Tirol<br />
Wien<br />
Oberösterreich<br />
Steiermark<br />
Kärnten<br />
Niederösterreich<br />
Burgenland<br />
0,54<br />
0,56<br />
0,98<br />
1,50<br />
1,98<br />
2,15<br />
2,35<br />
2,91<br />
4,55<br />
<strong>Leidenschaft</strong><br />
31
Querspur Das Zukunftsmagazin des ÖAMTC<br />
Seit vielen Jahren<br />
liebt Brigitte Schmidhuber<br />
reines, hochwertiges Olivenöl.<br />
2010 hat sie ihre Passion<br />
zum Beruf gemacht und versorgt<br />
seither Wien mit echtem italienischen<br />
Olivenöl aus limitierter Produktion<br />
sowie mit Verkostungen und Seminaren<br />
für Olivenöl-Interessierte. Diese<br />
organisiert die Gastronomiefachfrau<br />
und Filmwissenschafterin<br />
gemeinsam mit ihrem Partner<br />
Domenico Pugliese.<br />
www.casacaria.com<br />
Christopher Schweiger’s<br />
Leben ist die Musik. Vor genau<br />
drei Jahren hat der ehemalige<br />
Profireiter seine sehr erfolgreiche<br />
Karriere als Architekt aufgegeben<br />
und einen Plattenladen eröffnet.<br />
Seither nutzt er sein Wissen über<br />
die Dimension Raum, befüllt sie<br />
mit Körper und Klang<br />
und geht darin voll auf.<br />
www.tongues.at<br />
Markus Handl ist<br />
Grafik-Designer und fühlt sich<br />
gleichermaßen nach Hamburg<br />
und seiner Heimatstadt Wien<br />
gezogen. Um beide Orte zu<br />
vereinen, verwandelt er jeden<br />
Abend sein kleines Grafikbüro<br />
in einen Hamburg-Shop samt<br />
hanseatischer Kneipe.<br />
www.hafenjunge.at<br />
Margit Hurich hat<br />
den Blick für das Schöne.<br />
Ihre besondere <strong>Leidenschaft</strong><br />
sind High Heels. Täglich trägt sie<br />
eines der mittlerweile über 80 Paare<br />
und jedes erzählt seine eigene<br />
Geschichte. Daher wird nur sehr<br />
selten ein Paar ausgemistet. Schon als<br />
kleines Mädchen entdeckte die studierte<br />
Romanistin, dass ein schöner<br />
Schuh die Persönlichkeit<br />
unterstreicht und den<br />
selbstbewussten Tritt ins<br />
Leben erleichtert.<br />
Jessica Gaspar’s<br />
<strong>Leidenschaft</strong> ist das Tanzen.<br />
Nach einem langen Arbeitstag<br />
am Schreibtisch findet die<br />
Grafikerin darin den nötigen<br />
Ausgleich. Ob in den eigenen<br />
vier Wänden oder nächtens im<br />
Club spielt keine Rolle – solange<br />
der Bass hart und die Musik<br />
laut genug ist.<br />
www.jessicagaspar.at<br />
32