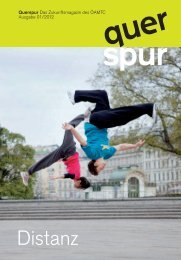Alles aus. Alles neu.
Querspur: Das Zukunftsmagazin des ÖAMTC Ausgabe 02/2012
Querspur: Das Zukunftsmagazin des ÖAMTC
Ausgabe 02/2012
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Querspur Das Zukunftsmagazin des ÖAMTC<br />
Ausgabe 02/2012<br />
<strong>Alles</strong> <strong>aus</strong>.<br />
<strong>Alles</strong> <strong>neu</strong>.<br />
<strong>Alles</strong> <strong>aus</strong>. <strong>Alles</strong> <strong>neu</strong>.<br />
1
<strong>Alles</strong> <strong>aus</strong>.<br />
<strong>Alles</strong> <strong>neu</strong>.<br />
Serendipität<br />
Serendipität (engl. serendipity)<br />
bezeichnet eine zufällige Beobachtung<br />
von etwas ursprünglich nicht Gesuchtem,<br />
das sich als <strong>neu</strong>e und überraschende<br />
Entdeckung erweist. Nylonstrumpf und<br />
Röntgenstrahlen sind nur zwei von vielen<br />
nützlichen Zufallsentdeckungen.<br />
Serendipaceratops wird im Übrigen<br />
ein Dinosaurier genannt, von dessen<br />
Überresten bis heute nur eine<br />
Elle bekannt ist.<br />
Gemeinden in<br />
Österreich<br />
Eine Gemeinde ist die kleinste Form<br />
der territorialen Gliederung des Staatsgebietes.<br />
In ganz Österreich werden derzeit 2.357<br />
Gemeinden gezählt. Seit 1980 (2.300) hat ihre<br />
Zahl um 2,5% leicht zugenommen, seit 1965<br />
(3.931) ist sie jedoch um fast 40% geschrumpft.<br />
Das ist großteils auf Gemeindezusammenlegungen<br />
zurückzuführen. Es verschieben sich jedoch<br />
nicht nur die Gemeindegrenzen, auch die<br />
Bevölkerungszahlen ändern sich: In<br />
30% der Gemeinden (727) ist die<br />
Einwohnerzahl seit 1961<br />
zurückgegangen.<br />
(Quelle: Statistik<br />
Austria)<br />
Schrumpfung<br />
Schrumpfung, das Gegenteil von<br />
Wachstum, wird der Prozess des<br />
kleiner oder weniger Werdens genannt.<br />
Schrumpfen kann in der Natur beobachtet<br />
werden, wenn z. B. der Boden durch Entwässerung<br />
an Volumen abnimmt. Auch der Mensch<br />
schrumpft mit zunehmendem Alter, weil mit<br />
abnehmendem Flüssigkeitsgehalt im Körper auch<br />
das Volumen der Bandscheiben abnimmt. In der<br />
Raumplanung wird Schrumpfungsprozessen<br />
häufig mit Rückbaumaßnahmen von<br />
immer dünner besiedelten oder<br />
verlassenen Regionen<br />
begegnet.<br />
55 Menschen<br />
Betrachtet man die<br />
Gemeindegrößen, so fällt auf, dass<br />
90% der österreichischen Gemeinden<br />
weniger als 5.000 Einwohner zählen.<br />
Die kleinste Gemeinde ist Gramais im<br />
Tiroler Teil des Lechtals mit 55 Bewohnern.<br />
Neun Gemeinden – das sind 0,4% der<br />
Gesamtzahl – haben mehr als 50.000<br />
Einwohner. Der unangefochtene<br />
Spitzenreiter dieser Gruppe ist Wien<br />
mit 1,7 Millionen Menschen.<br />
(Quelle: Österreichischer<br />
Gemeindebund)<br />
Impressum und Offenlegung<br />
Medieninhaber und Her<strong>aus</strong>geber<br />
Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC),<br />
Schubertring 1-3, 1010 Wien, Telefon: +43 (0)1 711 99 0<br />
www.oeamtc.at<br />
ZVR-Zahl: 730335108, UID-Nr.: ATU 36821301<br />
Vereinszweck ist insbesondere die Förderung der Mobilität unter<br />
Bedachtnahme auf die Wahrung der Interessen der Mitglieder.<br />
Rechtsgeschäftliche Vertretung<br />
DI Oliver Schmerold, Verbandsdirektor;<br />
Mag. Christoph Mondl, stellvertretender Verbandsdirektor.<br />
Konzept und Gesamtkoordination winnovation consulting gmbh<br />
Chefredaktion Mag. Gabriele Gerhardter (ÖAMTC),<br />
Dr. Gertraud Leimüller (winnovation consulting)<br />
Chefin vom Dienst Silvia Wasserbacher, BA<br />
Beamen<br />
Beamen zu können ist einer<br />
der großen Menschheitsträume.<br />
Beamen, auch Teleportation genannt,<br />
bezeichnet den Transport einer Person oder<br />
eines Gegenstandes von einem Ort zu<br />
einem anderen, ohne dass das Objekt dabei<br />
den dazwischen liegenden Raum durchquert.<br />
Wirklichkeit dürfte diese Art der Mobilität<br />
jedoch noch lange nicht werden. Weil nur<br />
Information, nicht aber Materie gebeamt<br />
werden kann, müssen wir uns<br />
weiterhin physisch<br />
fortbewegen.<br />
Weltuntergang<br />
Weltuntergangszenarien sind so alt<br />
wie die Menschheitsgeschichte. Schon<br />
die Assyrer glaubten um 1500 v. Chr.<br />
an apokalyptische Weissagungen.<br />
In unserer jüngeren Vergangenheit seit dem<br />
Jahr 2000 hätte die Erde bereits 25 Mal<br />
untergehen sollen, zuletzt mit der Inbetriebnahme<br />
des CERN-Teilchenbeschleunigers LHC im Jahr 2008.<br />
Nachdem die Erde von Genf <strong>aus</strong> doch nicht in den<br />
Abgrund gerissen wurde, darf man gespannt auf<br />
den 21.12.2012 warten, das Ende des<br />
Maja-Kalenders, für den auch das<br />
Ende der Welt prognostiziert wird.<br />
Wird es wieder nichts, könnte<br />
es laut Sir Isaac Newton<br />
2060 wieder so<br />
weit sein.<br />
Quantenphysik<br />
Der geistige Vater der Quantenphysik,<br />
Erwin Schrödinger,<br />
sprach von der Quantenmechanik,<br />
Albert Einstein von der Quantentheorie.<br />
Die Begriffe<br />
Quantenphysik, Quantentheorie<br />
und Quantenmechanik werden<br />
heute als Synonym<br />
füreinander<br />
verwendet.<br />
Mitarbeiter dieser Ausgabe Dipl-Bw. Maren Baaz, Mag. Eva Hübner,<br />
Margit Hurich, Mag. (FH) Christian Huter, Mag. Claudia Kesche, Anita Kattinger, Bakk.phil.,<br />
Mag. Konstantin Kouloukakos, Mag. Uwe Mauch, Dr. Daniela Müller, Martin Strubreiter,<br />
Dr. Ruth Reitmeier, Katrin Stehrer, BSc, DI Anna Várdai<br />
Fotos Christoph Wisser<br />
Grafik Design, Illustrationen Drahtzieher Design & Kommunikation, MA Barbara Wais<br />
Korrektorat Christina Preiner, vice-verba<br />
Covermodels Ines Mostböck, Lukas Aigner, Emil Gamauf<br />
Druck Hartpress<br />
Blattlinie Querspur ist das zweimal jährlich erscheinende Zukunftsmagazin des ÖAMTC.<br />
Ausgabe 02/2012, erschienen im Oktober 2012<br />
Download www.querspur.at
7<br />
8<br />
12<br />
16<br />
31<br />
4<br />
11<br />
20<br />
24<br />
26<br />
28<br />
Heute<br />
Ein Kommen und Gehen.<br />
In den vergangenen 140 Jahren sind<br />
viele Verkehrsmittel verschwunden und<br />
einige gekommen. Von Katrin Stehrer<br />
Vier Menschen, vier Wege zu<br />
vier <strong>neu</strong>en Zielen. Wie persönliche<br />
Umbruchssituationen die Mobilität verändern.<br />
Von Uwe Mauch<br />
Große P<strong>aus</strong>e. Die Menschheit sucht<br />
in hohem Tempo das Neue. Vielleicht<br />
ist Innehalten die bessere Strategie.<br />
Von Ruth Reitmeier<br />
Land in Sicht. Über die (Un)Möglichkeit,<br />
schrumpfende Regionen zu<br />
<strong>neu</strong>em Leben zu erwecken.<br />
Von Daniela Müller<br />
Von allem mehr. Ob öffentlicher<br />
Verkehr, Auto oder Rad, der Mensch<br />
nutzt immer mehr Verkehrsmittel<br />
gleichzeitig.<br />
Morgen<br />
Autoindustrie im Umbruch.<br />
Die Autoindustrie durchläuft den<br />
größten Wandel ihrer Geschichte.<br />
Von Martin Strubreiter<br />
Über und unter der Erde.<br />
New York – Peking in zwei Stunden.<br />
Revolutionen im Reisen.<br />
Von Anita Kattinger<br />
Die Stadt nach Plan. Der deutsche<br />
Architekt Meinhard von Gerkan hat<br />
sich eine ganz <strong>neu</strong>e Stadt in China<br />
<strong>aus</strong>gedacht, die jetzt auch gebaut wird.<br />
Von Ruth Reitmeier<br />
Beamen bleibt vorerst Utopie.<br />
Die Quantenphysik wird unser<br />
bisheriges Denken ablösen, sagt der<br />
Quantenphysiker Markus Aspelmeyer.<br />
Von Daniela Müller<br />
Start-ups. Spannende Ideen und<br />
internationale Konzepte.<br />
Von Katrin Stehrer<br />
Von sprechenden Ampeln und<br />
Autos, die überflüssig werden.<br />
Utopien für 2050. Von Martin Strubreiter<br />
Foto: © Hashi Future Parking Equipmen Foto: © Marcus Bredt<br />
Foto: © Christoph Wisser Foto: © Uwe Mauch<br />
8<br />
16<br />
20<br />
26<br />
<strong>Alles</strong> <strong>aus</strong>. <strong>Alles</strong> <strong>neu</strong>.<br />
3
Umweltfreundliches Karosseriedesign<br />
Flexible Farb<strong>aus</strong>wahl<br />
Parkplatzsparende Länge<br />
Intelligentes<br />
Einparksystem<br />
und<br />
Straßenkontrolle<br />
Kommunikationszentrum<br />
Terminplaner<br />
Müdigkeitswarner<br />
Relaxzone<br />
Motoren, Getriebe und<br />
Plattformen werden von<br />
konkurrierenden<br />
Herstellern gemeinsam<br />
entwickelt<br />
Elektro- oder<br />
Hybridantrieb<br />
Rollt per<br />
Knopfdruck<br />
<strong>aus</strong> der Garage<br />
Roboter als Chauffeur<br />
Fahrassistenz<br />
Start- und Stoppautomatik<br />
Spurassistent<br />
Abstands- und<br />
Geschwindigkeitskontrolle<br />
Routenplanung<br />
Foto: Christoph Wisser, Illustration: Barbara Wais<br />
4
Autoindustrie<br />
im Umbruch<br />
Neue Märkte in Asien, Fokus auf Nachhaltigkeit, verstopfte Städte<br />
und ein Wirtschaftsleben, das alten Strukturen kaum noch<br />
Chancen lässt: Auf die Autoindustrie wartet der gröSSte Wandel<br />
ihrer Geschichte.<br />
Von Martin Strubreiter<br />
Das kleine, gallische Dorf der Autoindustrie<br />
steht in Malvern Link, Großbritannien.<br />
Bei der Firma Morgan<br />
werden Roadster nach alter Sitte gebaut,<br />
also von Hand. Die Hände sind<br />
oft seit Jahrzehnten dieselben, noch<br />
treuer als Belegschaft und Fans sind<br />
lediglich die Eigentümer: Morgan<br />
ist seit 1909 im Familienbesitz, seine<br />
auffälligste Innovation ist das vierte<br />
Rad – die ersten Morgans waren<br />
Threewheeler.<br />
Die Automobilindustrie aber wird in<br />
einigen Jahren grundlegend anders<br />
<strong>aus</strong>sehen. Eine der markantesten Veränderungen<br />
der nächsten Jahrzehnte:<br />
Europa und die USA werden langsam<br />
zur Fußnote der Autoindustrie, die<br />
Kernmärkte verschieben sich nach<br />
Asien. Schon 2010 lag China mit<br />
18,1 Millionen <strong>neu</strong> zugelassenen<br />
Kraftfahrzeugen deutlich vor den USA<br />
(11,8 Millionen), Japan (5 Millionen),<br />
Brasilien (3,5 Millionen) und<br />
Deutschland (3,2 Millionen). In den<br />
BRICS-Staaten (Brasilien, Russland,<br />
Indien, China, Südafrika) werden<br />
2020 fast sechsmal so viele Neuwagenkäufe<br />
erwartet wie im Jahr 2010.<br />
Und selbst dann werden die Märkte<br />
noch lange nicht so gesättigt sein wie<br />
heute in Europa, Japan und den USA.<br />
In 20 Jahren<br />
werden asiatische<br />
Bedürfnisse den<br />
Auto-Weltmarkt<br />
bestimmen<br />
Dann wird auch die Produktion und<br />
Entwicklung in den <strong>neu</strong>en Märkten<br />
erfolgen. Michael Ebner, Pressesprecher<br />
von BMW Öster reich:<br />
„Wir handeln nach dem Grund satz:<br />
Der Produktionsstandort folgt dem<br />
Markt. Das haben wir mit unseren<br />
Werken in den USA sowie in Indien<br />
und China gezeigt.“ Schon 2020 wird<br />
mehr Forschung und Entwicklung in<br />
den Schwellenländern stattfinden als<br />
in den etablierten Märkten, prognostiziert<br />
die Unternehmensberatung<br />
A.T. Kearney.<br />
Noch werden in China eher Modelle<br />
produziert, die in Europa schon <strong>aus</strong>gelaufen<br />
sind (z.B. eine Langversion<br />
des 5er BMW). Aber der Trend wird<br />
sich zumindest teilweise umkehren:<br />
Ende 2013 bringt Citroën sein <strong>neu</strong>es<br />
Topmodell, den DS9, exklusiv in<br />
China auf den Markt, zugeschnitten<br />
auf chinesische Bedürfnisse – gerade<br />
groß genug, um die Grundbedürfnisse<br />
der Mobilität abzudecken. Diese<br />
Modelle werden dann, um Entwicklungskosten<br />
zu sparen, gewiss auch<br />
nach Europa kommen.<br />
Zugespitzt formuliert: In 15 bis 20<br />
Jahren werden chinesische, indische<br />
oder russische Bedürfnisse das Auto<br />
für Europa oder die USA entscheidend<br />
beeinflussen. Damit werden einerseits<br />
kleine Autos, andererseits noble Marken<br />
den Markt dominieren. Diese<br />
Trends sind heute schon in den aufstrebenden<br />
Märkten ablesbar: Der winzige<br />
Tata Nano um umgerechnet 2.200 Euro<br />
ersetzt bereits mehr als 200.000 Indern<br />
das Moped. Anderer seits gibt es durch<strong>aus</strong><br />
chinesische Käufer, die direkt vom<br />
Fahrrad auf einen BMW X1 umsteigen.<br />
Wer also die Kompetenz zum Bau<br />
von Kleinstwagen mitbringt oder zu<br />
den Premiummarken zählt, hat gute<br />
Zukunftschancen. Für Marken mit<br />
durchschnittlichem Image könnte es<br />
hingegen eng werden.<br />
Will ein Hersteller von Europa <strong>aus</strong><br />
konkurrenzfähig bleiben, muss er<br />
<strong>Alles</strong> <strong>aus</strong>. <strong>Alles</strong> <strong>neu</strong>.<br />
5
Foto: cepolina.com<br />
Die Nachfrage nach Autos in den Schwellenländern steigt<br />
rapide (im Bild: der Verkehrsalltag der indischen Millionenstadt<br />
Hyderabad). Die Autohersteller werden deshalb immer mehr<br />
Entwicklungskompetenz dorthin verlagern. In der Folge werden<br />
die Innovationen im Automobilsektor künftig auch in Europa<br />
stark von den Bedürfnissen Asiens und Südamerikas inspiriert<br />
sein. Das Design eines Autos muss eine Lösung für die Platznot<br />
der <strong>neu</strong>en Konsumenten bieten, Kosten und Kraftstoffverbrauch<br />
müssen gesenkt werden.<br />
den technologischen Vorsprung<br />
wahren und weiter <strong>aus</strong>bauen. Marc<br />
Lang, TTTech-Verkaufsleiter, einem<br />
österreichischen Vorreiter bei elektronischen<br />
Kontrollsystemen im Auto:<br />
„Den europäischen und japanischen<br />
Vorsprung holt China frühestens in 15<br />
bis 20 Jahren auf, weil bei uns die Entwicklung<br />
ja auch nicht still steht. Und<br />
so einfach lassen sich komplexe elektronische<br />
Systeme nicht nachbauen.<br />
Unser Wachstum ist jedenfalls enorm,<br />
wir suchen derzeit rund 30 Techniker<br />
und Entwickler.“<br />
Open Innovation wird<br />
das tägliche Brot<br />
der Entwickler<br />
Um die immer höheren Entwicklungskosten<br />
abzufedern, die mit der<br />
steigenden Technologisierung einhergehen,<br />
werden Motoren, Getriebe und<br />
Plattformen künftig in allen Märkten<br />
der Welt genutzt, oft auch von konkurrierenden<br />
Herstellern, die gemeinsam<br />
entwickeln. Das war in früheren<br />
Jahren undenkbar. Zusätzlich werden<br />
Autohersteller den Entwicklungsprozess<br />
öffnen und Input von außen,<br />
zum Beispiel von Konkurrenten, Universitäten<br />
und Autokäufern gezielt<br />
hereinholen, was einem Paradigmenwechsel<br />
gleichkommt: Mittels Open<br />
Innovation kann die Entwicklungszeit<br />
dramatisch verkürzt werden, sie ermöglicht<br />
deutlich mehr Klarsicht über<br />
ein künftiges Produkt, das Risiko von<br />
Fehlentwicklungen sinkt. Und die<br />
Zukunft wird deutlich mehr Innovationen<br />
hervorbringen müssen als die<br />
Gegenwart: CO 2-Problematik und<br />
andere Umweltfragen verlangen<br />
verbrauchsgünstigere Autos, die Technologien<br />
dafür (wie etwa Elektro- oder<br />
Hybrid antrieb, Start/Stopp-Auto matik,<br />
Energierückgewinnung beim Brem sen,<br />
Leichtlauföle und -reifen, bedarfs -<br />
ge steuerte Lichtmaschinen und Ölpumpen)<br />
lassen heute nur wenige<br />
Hersteller in die Serie einfließen,<br />
künftig werden es alle sein. Erste<br />
Ansätze für Open Innovation sind<br />
übrigens bereits heute flügge: VW<br />
sammelt über www.mythinkblue.de<br />
Input zur nachhaltigen Entwicklung<br />
und eröffnet sich damit ein weites<br />
Feld für Ideen. Die kreativsten Ideenspender<br />
gewinnen einen potenten<br />
Konzern zur Umsetzung.<br />
Die Autoindustrie wird mit anderen<br />
Sparten enger zusammenarbeiten,<br />
besonders mit der IT-Branche.<br />
Künftig kann ein<br />
Auto wie ein Smartphone<br />
kommunizieren<br />
Denn was Smartphones heute können,<br />
wird künftig auch vom Auto erwartet –<br />
und noch mehr: Anbindung ans Internet,<br />
Kommunikation der Autos<br />
untereinander im Dienste flüssigeren<br />
Verkehrs (Autos, die im Stau stecken,<br />
warnen zum Beispiel die Nachkommenden),<br />
Fahrassistenzsysteme wie<br />
Müdigkeitswarner oder Spurassistent<br />
bis hin zu allen Vernetzungen, die<br />
selbstfahrende Autos benötigen, die<br />
man per Knopfdruck <strong>aus</strong> der Garage<br />
holt und die einen lesend oder dösend<br />
an den Zielort bringen. Diese sind<br />
bereits heute oder in naher Zukunft<br />
möglich. Das Problem: Auto und IT-<br />
Industrie ticken unterschiedlich. Ein<br />
Auto rollt vier bis acht Jahre lang vom<br />
Band, die Elektronikindustrie wechselt<br />
Produkte in Sechs-Monats-Zyklen.<br />
Das heißt natürlich nicht, dass ein<br />
Auto künftig jedes halbe Jahr <strong>neu</strong><br />
entworfen werden muss, um auf dem<br />
<strong>neu</strong>esten Stand zu sein, sondern dass<br />
die Software aktualisiert wird.<br />
Klar ist: Viele der künftigen Innovationen<br />
kommen nicht von den Autoherstellern,<br />
sondern von Zulieferern.<br />
Ein heutiger Pkw stammt zu rund 50<br />
Prozent vom Autohersteller, ein Elektroauto<br />
nur noch zu 10 Prozent. Der<br />
Rest wird zugeliefert. Mit anderen<br />
Worten: Der Autoindustrie droht das<br />
Kerngeschäft abhanden zu kommen.<br />
Die <strong>neu</strong>en Entwicklungen bergen<br />
aber auch riesige Chancen, nicht nur<br />
Kraftfahrzeuge zu verkaufen, sondern<br />
Mobilität in allen Facetten. Michael<br />
Ebner, BMW: „Wir werden künftig<br />
Mobilität im Paket anbieten, beispielsweise<br />
über Carsharing mit Elektroautos,<br />
die unsere E-Fahrräder im<br />
Kofferraum haben, dazu Telematik-<br />
Dienstleistungen wie Navigation für<br />
alle Verkehrsmittel.“<br />
Nur wenige<br />
Autohersteller<br />
und zulieferer<br />
werden überleben<br />
Dennoch wird die Zahl der Zulieferer<br />
und Autohersteller abnehmen.<br />
Frank Gehr vom Fraunhofer Institut<br />
für Produktionstechnik und Automatisierung<br />
schätzt, dass in wenigen<br />
Jahren die Zahl der großen, unabhängigen<br />
Hersteller je nach Zählweise<br />
von derzeit rund 40 auf die zehn erfolgreichsten<br />
gesunken sein wird.<br />
Nur Morgan wird wohl weiterhin<br />
Roadster mit Eschenholz-Karosserierahmen<br />
fertigen – wie 1909. •<br />
6
Ein Kommen und Gehen<br />
In den vergangenen 140 Jahren sind viele Verkehrsmittel<br />
verschwundeN und einige auch wieder zurückgekommen.<br />
Von Katrin Stehrer<br />
daten & fakten<br />
Im Dezember 1872 wurde die längste<br />
Pferdeeisen bahnstrecke Europas,<br />
die 128 km lange Strecke Budweis – Linz –<br />
Gmunden, eingestellt und durch eine<br />
dampfbetriebene Eisenbahn ersetzt.<br />
Noch heute fährt eine Pferdeeisenbahn in<br />
der süd<strong>aus</strong>tralische Stadt Victor Harbor.<br />
Sie hat die 630 Meter lange Strecke zur<br />
Touristenattraktion gemacht und die<br />
ursprünglich 1896 errichtete Bahn durch<br />
Restaurierungsarbeiten im Jahr 1986 zu<br />
Bis 1923 wurden in Großbritannien<br />
mit Koks betriebene, äußerlich an Kutschen<br />
erinnernde Dampfomnibusse eingesetzt,<br />
die hauptsächlich zwischen London und<br />
seinen Vororten fuhren. In den Glanzzeiten<br />
konnten 700 Fahrten am Tag gezählt<br />
werden. Aufgrund häufiger Unfälle wurde<br />
die Maximalgeschwindigkeit auf 3 km/h<br />
beschränkt, weshalb die Dampfomnibusse<br />
zu Beginn des 20. Jahrhunderts von der<br />
elektrisch angetriebenen U-Bahn abgelöst<br />
wurden.<br />
Die weltweit letzte Fahrt eines von<br />
Pferden gezogenen Omnibusses fand<br />
1923 in Berlin statt. Einst die einzigen<br />
innerstädtischen Verkehrsmittel der Stadt,<br />
wurden die Pferdeomnibusse von der 1865<br />
eingeführten, auf Schienen fahrenden Pferdestraßenbahn<br />
schließlich ganz verdrängt.<br />
Im Jahr 1900 stieg der erste Zeppelin<br />
in Friedrichshafen auf, 30 Jahre später waren<br />
Linienflüge für zivile Passagiere von Europa<br />
nach Nord- und Südamerika eingerichtet.<br />
Mit dem Unglück von Lakehurst (New Jersey,<br />
USA) im Jahr 1937, bei dem der LZ 129 bei<br />
der Landung in Flammen aufging, wurde das<br />
Ende der Zeppelin-Luftfahrt eingeleitet –<br />
vorerst. Denn seit 2001 fliegt die LT Zeppelin<br />
Luftschifftechnik GmbH & Co KG mit dem<br />
Zeppelin NT wieder kommerzielle Rundflüge,<br />
bisher aber nur über dem Bodensee. 2<br />
<strong>neu</strong>em Leben erweckt. 1 1 www.tourismvictorharbor.com.au/attractions.html<br />
Bis 1957 wurde in Simbabwe<br />
eine mit menschlicher Muskelkraft<br />
betriebene Straßenbahn eingesetzt.<br />
Weltweit gab es mehr als 100, davon ein<br />
Teil in Afrika, über 80 in Asien (darunter<br />
Japan mit der längsten Trasse von 26 km)<br />
und eine 4 km lange Strecke in<br />
Österreich. Sie befand sich im<br />
Lainzer Geriatriezentrum und wurde<br />
zum Gütertransport von Anfang des<br />
20. Jahrhunderts bis 1925 betrieben.<br />
2 www.zeppelinflug.de<br />
Interessant ist auch die Geschichte des<br />
Elektroautos. Ende des 19. Jahrhunderts<br />
vor allem in den USA sehr beliebt und mit<br />
einem Marktanteil von 38 % durch<strong>aus</strong> begehrt,<br />
wurde es ab 1940 nicht mehr für<br />
den Personenverkehr hergestellt.<br />
Der Siegeszug des Benzinautos war<br />
aufgrund des bequemeren Startens mittels<br />
Anlassers anstelle des Ankurbelns und<br />
des billigen Benzins nicht mehr aufzuhalten.<br />
Seit den 1990er-Jahren gibt es jedoch<br />
wieder kommerzielle Neuentwicklungen.<br />
<strong>Alles</strong> <strong>aus</strong>. <strong>Alles</strong> <strong>neu</strong>.<br />
7
USERSTORY<br />
4MENSCHEN,<br />
WEGE ZU<br />
NEUEN ZIELEN<br />
Die Fremdenführerin, die nach ihrem Jobwechsel<br />
mit ihrem Fahrrad eine <strong>neu</strong>e Her<strong>aus</strong>forderung sucht.<br />
Der Rollstuhlfahrer, der sich dafür einsetzt, dass<br />
auch Behinderte ohne Barrieren Bahn fahren können.<br />
Die Mutter von drei Kindern, die sich über Nacht<br />
als Alleinerzieherin in Wien wiederfindet.<br />
Der Buchhändler, der plötzlich mit der S-Bahn<br />
VON EINEM ENDE VON WIEN ZUM ANDEREN MUSS.<br />
Von Uwe Mauch<br />
Foto: Drahtzieher<br />
8
Eigentlich erstaunlich: Über ihr <strong>neu</strong>es Smartphone, ihren<br />
<strong>neu</strong>en Hund, ihre <strong>neu</strong>en Tapeten, ihre <strong>neu</strong>e Frisur, ihren <strong>neu</strong>en<br />
Chef – über vieles machen sich die Menschen heute Gedanken.<br />
Doch selten denken sie darüber nach, wie sie sich<br />
fortbewegen. Mobilitätsverhalten scheint so fix zu sein wie<br />
die Uhrzeit oder das Brauchtum.<br />
In Vorarlberg weiß man das. Deshalb erhalten Mitarbeiter, die<br />
zu einem der innovativen Unternehmen wechseln, schon vor<br />
ihrem ersten Arbeitstag einen Brief. Darin werden sie höflich<br />
gefragt, ob sie nicht auf die Öffis umsteigen möchten. Wenn<br />
ja, wird ihnen das Ticket bezahlt. Der Jobwechsel eine Zäsur –<br />
und eine Chance für Neues. Kaum jemand hat sein Umsteigen<br />
bis dato bereut. Die Vorarlberger Erfahrungen werden nun<br />
auch von einer repräsentativen Befragung in sechs europäischen<br />
Ländern gestützt. Im Rahmen des EU-Projekts „USEmobility“<br />
1 wurde festgestellt, dass die Menschen am ehesten<br />
dann auf ein anderes Verkehrmittel umsteigen, wenn sie sich<br />
beruflich verändern, wenn sie mehr Sport betreiben möchten<br />
oder ihren Wohnort wechseln. Öffentliche Verkehrsmittel kommen<br />
zum Zug, wenn die Haltestellen gut erreichbar sind, die<br />
Intervalle kurz sind und die Fahrziele möglichst direkt erreicht<br />
werden können. Manchmal sind es auch andere Zäsuren im<br />
Leben. Auch unerfreuliche. Im ersten Moment scheint alles<br />
<strong>aus</strong>, alles anders, alles vorbei zu sein. Doch das Leben geht<br />
weiter. Und wie es weiter geht! Manchmal gibt es auch <strong>neu</strong>e,<br />
erfreuliche Erfahrungen. Genau davon erzählen die vier Menschen,<br />
die auf diesen Seiten zu Wort kommen.<br />
Foto:s: uwe Mauch<br />
REGINA MACHO, staatlich geprüfte Fremdenführerin.<br />
Fährt seit vielen Jahren täglich mit dem Rad von<br />
ihrem H<strong>aus</strong> im Grünen, in Kloster<strong>neu</strong>burg, zur Arbeit<br />
nach Wien. Vor wenigen Wochen hat sie einen verantwortungsvollen<br />
Job in der Hofburg gekündigt, um sich<br />
<strong>neu</strong>en Aufgaben zu widmen. Ihre Entscheidung ist ihr<br />
nicht leicht gefallen, doch vor dem Neuen fürchtet sie<br />
sich nicht.<br />
„Die Fahrt mit dem Auto zur Arbeit kommt für mich schon alleine<br />
deshalb nicht in Frage, weil ich keines besitze. Als Radfahrerin<br />
kann ich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.<br />
Das Rad hält mich fit, bringt mich in der Früh in Schwung.<br />
Außerdem verbindet es mich mit der Natur. Denn ich fahre ja<br />
von draußen, vom Land rein in die Stadt, ein Stück auch<br />
durch die Donauauen. Ich bin früher immer mit dem Auto zur<br />
Arbeit gefahren, nur damals habe ich die Natur nicht so unvermittelt<br />
und intensiv erleben können. Einkaufen? Ist gar<br />
kein Problem. Ich habe Packtaschen fürs Rad. Da passt alles<br />
rein. <strong>Alles</strong> nur eine Frage der Organisation. Ich habe einen<br />
guten Job aufgegeben, um einen sehr guten zu finden. Dabei<br />
geht es mir auch um ein Mehr an Lebensqualität. Zum<br />
Beispiel strebe ich im Moment keinen Fulltime-Job an, weil<br />
ich mir auch noch ein bisschen Raum für die Fremdenführerei<br />
schaffen möchte. Interessant ist, dass ich bereits verschiedene<br />
Jobangebote bekommen habe, ohne dass ich<br />
noch selbst aktiv war. Das tut nicht nur der Seele gut, das<br />
bestätigt mich auch in meiner Entscheidung.“<br />
REINHARD RODLAUER hat einen Gendefekt, der<br />
sich im Alter von elf Monaten bemerkbar machte. Spinale<br />
Muskelatrophie, sagen die Mediziner. Und meinen<br />
damit den Muskelschwund. Der Bewegungsap parat<br />
kann den Anweisungen des Gehirns nicht Folge<br />
leisten. Seine Kindheit und Jugend im niederösterreichischen<br />
Lunz am See war geprägt von Barrieren und<br />
Entbehrungen, auch von vier deprimierenden Jahren<br />
auf Arbeitssuche. <strong>Alles</strong> <strong>aus</strong>? Nein, alles <strong>neu</strong>! Der Rollstuhlfahrer<br />
hat eine schöne berufliche Karriere hingelegt.<br />
Schon als Trafikant ist er in seiner Freizeit als anonymer<br />
Testfahrer durchs Land gefahren. So wurde man<br />
bei den Österreichischen Bundesbahnen auf ihn aufmerksam.<br />
Seit sechs Jahren ist Rodlauer deren Konzernkoordinator<br />
für Barrierefreiheit.<br />
„Es ist ein unglaublich erhebendes Gefühl, wenn man mich<br />
heute mit der Klapprampe in einen Zug oder Bus hebt. Als<br />
Kind konnte ich dem Postbus leider nur beim Davonfahren zuschauen.<br />
Meine Aufgabe bei den ÖBB ist es, Barrierefreiheit<br />
konzernübergreifend zu verwirklichen. Wir sind da auf einem<br />
guten Weg: 75 Prozent unserer Busse sind bereits barrierefrei,<br />
alle <strong>neu</strong>en Nahververkehrszüge sind mit Klapprampen <strong>aus</strong>gestattet,<br />
auch im Railjet gibt es fahrzeuggebundene Hebe lifte.<br />
Und im Jahr 2015 sollen die 140 meist frequentierten Bahnhöfe<br />
in Österreich barrierefrei sein. Warum ich am liebsten mit<br />
der Bahn verreise? Weil für mich die Bahn komfortabler ist als<br />
Flugzeug oder Auto. Im Flugzeug komme ich mit dem Rollstuhl<br />
nicht ins Klo, und eine Autofahrt ist mir zu anstrengend.“<br />
<strong>Alles</strong> <strong>aus</strong>. <strong>Alles</strong> <strong>neu</strong>.<br />
9
TINA BACHMANN, die Frau des österreichischen<br />
Wirtschaftsdelegierten in Tripolis (Libyen) und Mutter<br />
von drei schulpflichtigen Kindern. Im Februar 2011 hat<br />
sich ihr Leben von einem Tag auf den anderen dramatisch<br />
verändert. Nach dem Bürgerkrieg in Libyen lebt<br />
die Familie getrennt: Sie mit den Kindern in Wien, ihr<br />
Mann in Tripolis. Nur mehr alle vier bis sechs Wochen<br />
kann er für wenige Stunden nach Wien kommen.<br />
„Ich muss vor<strong>aus</strong>schicken: Wir haben uns mit der <strong>neu</strong>en<br />
Situa tion so gut als möglich angefreundet. Das liegt auch daran,<br />
dass wir uns gegenseitig Halt geben. Natürlich habe ich<br />
Angst um meinen Mann. In Libyen fallen noch immer Schüsse.<br />
Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass dem David<br />
nichts passieren wird, weil er seine Arbeit und seine Familie<br />
liebt. Wir haben zuvor in Stockholm, in Lissabon, in Mexiko<br />
City, in Wien und in Tripolis gelebt. Seit gut einem Jahr bin<br />
ich mit den Kindern wieder in Wien. Und sie genießen Wien,<br />
wirklich. Weil sie hier zum Beispiel mit der Straßenbahn fahren<br />
und sich frei bewegen können. In Tripolis haben sie in einem<br />
Goldenen Käfig gelebt – in unserem H<strong>aus</strong> gut bewacht,<br />
aber wie in einem Gefängnis eingesperrt. In die Schule und<br />
auch zum Sport wurden sie mit dem Auto gebracht. Ich weiß<br />
nicht, ob das andere Wiener Kinder so stark empfinden – dieses<br />
Gefühl der Freiheit in öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch<br />
ich muss nicht mehr täglich ins Auto steigen. Ein Mal pro Woche<br />
für einen Großeinkauf, und am Wochenende, wenn wir<br />
WALTER KETTNER, gelernter Buchhändler. Verbringt<br />
seit seinem Umzug täglich zwei mal vierzig Minuten<br />
in der S-Bahn, um zwischen seiner Wohnung im<br />
Süden und seiner Buchhandlung im Norden von Wien<br />
hin und her zu pendeln. Der Inhaber der gut sortierten<br />
Buchhandlung „Bücher am Spitz“ im Floridsdorfer<br />
Amtsh<strong>aus</strong> nützt die Zeit, um im Auftrag seiner Kunden<br />
<strong>neu</strong>e Bücher vorab zu lesen.<br />
„Vor vier Jahren bin ich mit meiner Frau und meiner Tochter<br />
von Wien-Währing nach Brunn am Gebirge gezogen. Wir<br />
wollten unbedingt r<strong>aus</strong> <strong>aus</strong> der Stadt. Naturgemäß hat sich<br />
dadurch mein Weg zur Arbeit deutlich verlängert. Jetzt verbringe<br />
ich täglich relativ viel Zeit in der Schnellbahn. Eine<br />
Belastung ist das für mich nicht, ganz im Gegenteil. Von<br />
Brunn am Gebirge bis zum Bahnhof Floridsdorf benötigt die<br />
Bahn exakt 39 Minuten – das würde ich mit dem Wagen nur<br />
selten schaffen. Außerdem kann ich mich in der Bahn gemütlich<br />
zurücklehnen und entspannt lesen. Ich würde sagen,<br />
dass ich an einem Tag so um die 50 Buchseiten im Zug<br />
schaffe. Ich zähle das eigentlich nicht, aber in der Woche<br />
lese ich sicherlich ein ganzes Buch. Ab und zu treffe ich im<br />
Zug auch Kunden, und man hat Zeit, ein wenig zu plaudern.<br />
Und da ist es mir nicht erst einmal passiert, dass ich in der<br />
Schnellbahn eine Bestellung aufgenommen habe.“ •<br />
die Schwiegereltern außerhalb von Wien besuchen.“ 1 http://usemobility.eu/de/project<br />
10
Über und unter der erde<br />
Kein Tag ohne Stau. Den Ballungsräumen Asiens, Amerikas und Europas<br />
scheint der Platz für die Autos ihrer Bewohner <strong>aus</strong>zugehen.<br />
Wie werden wir uns bewegen, wenn die StraSSen endgültig<br />
verstopft sind? Querspur hat sich ober- und unterirdische<br />
Alternativen angesehen. Von Anita Kattinger<br />
////// FLIEGENDE AUTOS ////////////////////////////////////<br />
Sieht unsere Zukunft wie im Film „Das fünfte Element“ <strong>aus</strong>? Wir sitzen in einem fliegenden<br />
Taxi und steigen gleich im passenden Stockwerk <strong>aus</strong>? Dank fliegender Autos bräuchten<br />
wir keine <strong>neu</strong>en Straßen und würden nie wieder im Stau stehen. Utopie? Keineswegs.<br />
Das amerikanische Unternehmen Terrafugia setzt auf einen Auto-ähnlichen Rumpf mit<br />
vier Rädern und einklappbaren Tragflächen. Angetrieben wird das Flugauto von einem<br />
104 PS starken Rotax-Motor, der eine maximale Fluggeschwindigkeit von 185 km/h und eine<br />
Höchstgeschwindigkeit auf der Straße von 105 km/h ermöglicht. Kosten: 210.000 Euro.<br />
Noch hält es sich aber nur acht Minuten in der Luft.<br />
Das EU-Forschungsprojekt „myCopter“ unter Federführung des Max-Planck-Instituts für<br />
biologische Kybernetik in Tübingen forscht indes an einem individualisierten 3D-Luftverkehr<br />
mit Personal Aerial Vehicles (PAVs). Teil der Forschungsarbeit sind die Erwartungen des<br />
Endverbrauchers: Wollen wir selbst fliegen oder vertrauen wir einer computergestützten<br />
Steuerung? Trotz großem Forschungsinteresse der EU-Kommission dauert es wohl noch,<br />
bis wir statt des Führerscheins den Flugschein machen werden. http://mycopter.eu<br />
komplexes einfach erklärt<br />
////// UNTERIRDISCHE HOCHGESCHWINDIGKEIT //////<br />
Für Jules Verne war eine Reise um die Welt in 80 Tagen 1873 schon sehr ambitioniert. In naher<br />
Zukunft brauchen vielleicht Reisende nur noch zwei Stunden von New York nach Peking.<br />
Die Technologie „Evacuated Tube Transport“ (ETT) verbindet die Vorteile einer Magnetschwebebahn<br />
und eines Vakuumtunnels. Diese Vakuum-Züge fahren durch Röhren, <strong>aus</strong><br />
denen die Luft her<strong>aus</strong>gepumpt wurde, um Reibung zu minimieren. Ohne Luftwiderstand und<br />
ohne Reibungsverluste durch Schienen ermöglicht dieses Reisen theoretische Spitzen geschwindigkeiten<br />
von rund 6.400 Stundenkilometern. Weitere Vorteile: geringer Energieverbrauch,<br />
keine Lärmbelästi gung, Entlastung des bestehenden Schienen netzes. Städteplaner<br />
könnten beim Einsatz von ETT selbst entscheiden, ob die Tunnel ober irdisch auf<br />
Stelzen oder unterirdisch gebaut werden sollen. Das Unternehmen „ET3“ <strong>aus</strong> Colorado,<br />
USA, hat bereits zahlreiche Lizenzen für seine „Vactrains“ nach China verkauft.<br />
www.et3.com<br />
Bilder: www.mycopter.eu; www.et3.com; www.cargocap.de<br />
////// VOLLAUTOMATISCHE KAPSELN ////////////////////<br />
Den rasant wachsenden Gütertransport unter die Erde zu verlegen, würde oberirdisch mehr<br />
Platz für den Personenverkehr schaffen. In zahlreichen Städten wird bereits an Konzepten<br />
für unterirdische Rohrleitungen gegen das städtische Verkehrschaos gearbeitet. „CargoCap“,<br />
ein Projekt der Ruhr-Universität Bochum, setzt auf vollautomatische Kapseln auf<br />
Schienen, die in Tunneln unter der Stadt fahren. Der Antrieb erfolgt elektrisch über die<br />
Räder via Drehstrommotoren. Wie im U-Bahnsystem können die Kapseln mittels Weichen<br />
„abbiegen“ und bei einem Schacht stehen bleiben, um die Fracht abzuladen. Jede „Cap“<br />
hat die Größe von zwei Europaletten CCG1 (0,8 × 1,2 × 1,05 m) und bringt die Fracht unabhängig<br />
von der Verkehrslage zu Supermärkten, Warenhäusern und Firmen. Durch eine<br />
spezielle Tunnelbauweise mit Rohren von einem Durchmesser von zwei Metern werden<br />
weder oberirdische Häuser noch das Grundwasser gefährdet, da die Rohre unter oder<br />
über vorhandenen Kanälen verlegt werden können. www.cargocap.de<br />
<strong>Alles</strong> <strong>aus</strong>. <strong>Alles</strong> <strong>neu</strong>.<br />
11
Große<br />
P<strong>aus</strong>e<br />
Foto: Christoph Wisser<br />
12
Vielleicht liegt das Neue nicht in der Turbo-Beschleunigung,<br />
sondern auf einer ganz anderen Strecke? Um das her<strong>aus</strong>zufinden,<br />
ist Innehalten eine probate Strategie.<br />
Von Ruth Reitmeier<br />
Frisch, aktuell, aufregend, jung, origi<br />
nell, modern. Dies sind nur einige<br />
Synonyme für <strong>neu</strong>. Wie man es auch<br />
nennen mag, das Neue ist in unserer<br />
Kultur positiv besetzt, Innovation<br />
gleich bedeutend mit Optimierung.<br />
Das war nicht immer so. Der Paradigmenwechsel<br />
kam mit der Industriellen<br />
Revolution, die eine nie dagewesene<br />
Dynamik und eine im Vergleich mit<br />
den Jahrhunderten davor rasend<br />
beschleunigte Entwicklung von Technik,<br />
Produktivität und Wissenschaft<br />
freisetzte. In zwei Jahrhunderten<br />
wandelte sich unsere Wahrnehmung<br />
der Welt von einer des Seins in eine<br />
des Werdens.<br />
Der Mensch ist zudem ein übermütiges<br />
Wesen, seine Neugierde Ressource<br />
und Antrieb. Er gibt sich mit dem Status<br />
quo nicht zufrieden, probiert und<br />
probiert, auch durch<strong>aus</strong> riskant und<br />
mit ungewissem Ausgang. In der Bibel<br />
greift die Vertreibung <strong>aus</strong> dem Paradies<br />
dieses Thema gleich in den ersten<br />
Kapiteln der Genesis auf und warnt<br />
den Menschen vor seiner Neugierde.<br />
Der Mensch muss<br />
die Kontrolle<br />
über intelligente<br />
Technologien<br />
behalten<br />
Neben dem Spannungsfeld zwischen<br />
Ethik und Wissenschaft liegt heute<br />
die Her<strong>aus</strong>forderung darin, dass sich<br />
die Neugierde nicht verselbständigt.<br />
Globale intelligente Systeme sind<br />
bereits Realität: In Zukunft wird<br />
etwa die gesamte Energieversorgung<br />
von so genannten „smart grids“ gesteuert<br />
werden. Das sind hochkomplexe,<br />
intelligente Netze. Laut Kl<strong>aus</strong><br />
Mainzer, deutscher Philosoph und<br />
Wissenschaftstheoretiker, ist dies<br />
die Art von Intelligenz, von der wir<br />
abhängig werden. Die Bankenkrise<br />
hat dies eindrucksvoll und beunruhigend<br />
vor Augen geführt. Geld- und<br />
Informations ströme sind so komplex<br />
geworden, dass sie Einzelne nicht<br />
mehr durchschauen können. Die<br />
Her<strong>aus</strong>forderung wird darin liegen,<br />
Wege zu finden, diese Systeme in ihrer<br />
Komplexität zu erfassen und die Kontrolle<br />
zu behalten.<br />
In der Philosophie spielen die für das<br />
Neue gewählten Begriffe eine Schlüsselrolle.<br />
Das ist deshalb wichtig, weil<br />
wie wir Dinge nennen, unsere Vorstellung<br />
über sie prägt. Neues wird dabei<br />
üblicherweise mit bereits vorhandenen<br />
Begrifflichkeiten beschrieben. Herbert<br />
Hrachovec, Philosoph an der Universität<br />
Wien, erklärt dies am Beispiel der<br />
E-Mail, der elektronischen Post. Man<br />
hätte sie wohl gen<strong>aus</strong>o elektronische<br />
Kopie nennen können. Denn eine E-<br />
Mail hat ja mit der klassischen Post<br />
wenig gemein. Schließlich ist sie viel<br />
schneller unterwegs und kann gleichzeitig<br />
an beliebig viele Empfänger versandt<br />
werden. Umgekehrt passt heute<br />
die gute, alte Post nicht mehr so richtig<br />
in diese <strong>neu</strong>e Begriffswelt und wird<br />
humorvoll als „Snail-Mail“, als Schneckenpost,<br />
bezeichnet.<br />
Im Anfang schuf Gott Himmel und<br />
Erde, so lautet der erste Satz der Genesis.<br />
In der biblischen Schöpfungsgeschichte<br />
finden sich zwei Begriffe des<br />
Neuen: die Schöpfung <strong>aus</strong> dem Nichts<br />
– ex nihilo – und die Kreation <strong>aus</strong> bereits<br />
vorhandener Materie. So ist die<br />
Schöpfung des Menschen nach dieser<br />
Vorstellung radikal <strong>neu</strong>, Eva hingegen<br />
schafft Gott <strong>aus</strong> einer Rippe Adams.<br />
Das Neue ist immer<br />
ein Kind seiner Zeit<br />
In der Wissenschaft ist es ganz ähnlich.<br />
Der Großteil wissenschaftlicher Forschung<br />
ist eine Weiterentwicklung bereits<br />
vorhandenen Wissens. Viel seltener<br />
und entsprechend spektakulär ist der<br />
Paradigmenwechsel, der das bisherige<br />
Bezugssystem über den Haufen wirft<br />
und einer Revolution des Faches gleichkommt.<br />
„Dass etwas <strong>neu</strong> ist, merkt man,<br />
wenn man auf scharfen Widerspruch<br />
stößt“, sagte Albert Einstein.<br />
Philosophen weisen darauf hin, dass<br />
das Neue nicht zuletzt dann eine<br />
Chance bekommt, wenn die Zeit<br />
dafür reif ist. In der Antike wäre<br />
Galileo Galilei mit ziemlicher Sicherheit<br />
zum Tode verurteilt worden.<br />
Als die Ber li ner Mauer fiel, war der<br />
Kommunis mus bereits am Ende. Der<br />
Arabische Frühling wäre laut Kennern<br />
der Region auch ohne Smartphones<br />
und Twitter gekommen, zumal die<br />
autoritär herr schenden Regime sowie<br />
die politischen und sozialen Strukturen<br />
in diesen Ländern die Grenze zur<br />
Unerträglichkeit überschritten hatten.<br />
<strong>Alles</strong> <strong>aus</strong>. <strong>Alles</strong> <strong>neu</strong>.<br />
13
Management-Berater Peter Drucker<br />
sagte bereits in den 1980er-Jahren, dass<br />
unser Innovationsstreben künftig sozialen<br />
Innovationen gelten müsse. Technologische<br />
Entwicklungen alleine können die Bedürfnisse<br />
einer Weltbevölkerung von <strong>neu</strong>n<br />
Milliarden Menschen nicht befriedigen.<br />
Nobelpreisträger Albert Einstein<br />
erkannte, dass jeder, der etwas Neues<br />
in die Welt bringt, auf Widerstand gefasst<br />
sein muss. Doch weniger das Neue an sich,<br />
sondern eher die Komplexität und die Beschleunigung,<br />
mit der es komme, würden Ablehnung<br />
hervorrufen, sagte Einstein.<br />
Anthropologin Gisela Grupe bezeichnet<br />
den Menschen als Opportunisten. Sein Erfolgsrezept<br />
sei das Neue. Aufgrund veränderter<br />
und wechselnder Lebensbedingungen<br />
sei er gezwungen, Innovationen hervorzubringen.<br />
Nur so könne er sein Überleben<br />
sichern.<br />
Der Mensch der Moderne ist auf das<br />
Neue stets gefasst, es gehört zu seinem<br />
Leben untrennbar dazu. Wobei im<br />
21. Jahrhundert die Beschleunigung<br />
durch das Internet eine <strong>neu</strong>e Dimension<br />
erreicht hat. Der Fortschrittsglaube,<br />
die Überzeugung, dass der<br />
Fortschritt das Leben automatisch<br />
besser macht, ermüdet indessen. „Es<br />
heißt immer, es geht uns heute so gut.<br />
Aber geht es uns denn wirklich so<br />
gut?“, fragt Philosoph Eugen-Maria<br />
Schulak, Gründer des Instituts für<br />
Wertewirtschaft in Wien. Karl Marx’<br />
Vision von einer Welt, in der Maschinen<br />
fast alles erledigen und der vom<br />
Die Suche nach dem<br />
Neuen treibt den<br />
Menschen an seine<br />
Leistungsgrenze<br />
Joch der Arbeit befreite Mensch seine<br />
<strong>neu</strong> gewonnene Freizeit genießt, ist jedenfalls<br />
nicht eingetroffen. Statt „heute<br />
dies, morgen jenes zu tun“, lebt der<br />
Mensch in der modernen Leistungsgesellschaft<br />
gehetzt von vermeintlich<br />
immer weiter steigerbaren Produktivitätszielen.<br />
Könnte Aristoteles eine<br />
Zeitreise in unsere Welt unternehmen,<br />
käme er wohl zu dem Schluss, dass es<br />
sich um eine Form der Sklavenhaltergesellschaft<br />
handle, meint Schulak.<br />
All die Anforderungen und insbesondere<br />
das Affentempo, in dem sie<br />
erledigt werden sollen, machen immer<br />
mehr Menschen ernsthaft zu schaffen,<br />
führen zu Überlastung und Ängsten.<br />
„Burnout ist die Krankheit unserer<br />
Zeit“, betont Schulak. Der Output des<br />
Menschen scheint an die Grenzen des<br />
Machbaren, des Erträglichen gestoßen<br />
zu sein. Verfolge man die menschliche<br />
Produktivität historisch zurück, so<br />
zeigt sich Erstaunliches: Im Mittelalter<br />
haben Menschen höchstens 100 Tage<br />
pro Jahr gearbeitet, die restliche Zeit<br />
verbrachten sie mit der Familie zuh<strong>aus</strong>e.<br />
Eine Menge arbeitsfreie Zeit<br />
beanspruchten nicht zuletzt die 140<br />
kirchlichen Feiertage pro Jahr.<br />
Bewusstes Nichtstun<br />
kann einen<br />
Kreativitätsschub<br />
bringen<br />
Es ist offenbar weniger das Neue an<br />
sich, sondern die Komplexität und die<br />
Beschleunigung mit der es kommt, die<br />
den Menschen fordern. „Man muss<br />
die Welt nicht verstehen, man muss<br />
sich nur darin zurechtfinden“, sagte<br />
Einstein. Wie können also Strategien<br />
gefunden werden, was gibt Halt, wie<br />
bleibt der Mensch handlungsaktiv?<br />
Nichtstun. Werden Fragen zu komplex,<br />
erscheinen Probleme unlösbar,<br />
ist Innehalten wirksamer als hektischer<br />
Aktionismus, langsamer werden<br />
das einzige Mittel gegen die Beschleunigung.<br />
In der Psychologie beschreibt<br />
die Resilienz-Forschung diese<br />
Strategie. Resilienz ist die seelische<br />
Widerstandskraft. Robuste Menschen<br />
bewältigen Lebenskrisen, ohne dass<br />
tiefe seelische Narben zurückbleiben.<br />
In Krisen nehmen sie sich zunächst<br />
einmal Zeit, lassen sich nicht von den<br />
Ereignissen unter Druck setzen. Sie<br />
gehen davon <strong>aus</strong>, dass der Zeitpunkt<br />
kommen wird, wo sie wissen werden,<br />
was zu tun ist.<br />
Taktik ändern. Robuste Menschen<br />
machen nicht immer wieder die gleichen<br />
Fehler, sondern ändern ihre Taktik<br />
und bleiben dadurch im Spiel. Ein<br />
Beispiel <strong>aus</strong> der Kinder- und Jugendpsychiatrie:<br />
Experten berichten von<br />
jungen Patienten, die am Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitässyndrom<br />
leiden –<br />
einer Entwicklungsstörung, die im<br />
Kindesalter beginnt und sich unter<br />
anderem durch Probleme mit der<br />
Aufmerksamkeit <strong>aus</strong>zeichnet –, und<br />
die deshalb permanent im Schul- und<br />
Notenstress sind. Ihr Problem: Sie bewältigen<br />
den Schulstoff nicht, zumindest<br />
nicht so, wie vom Lehrplan vorgesehen.<br />
14
Auf konventionellem Wege, also<br />
durch mehr Arbeit, durch noch mehr<br />
Lernen unterm Schuljahr ist das für<br />
diese Burschen und Mädchen nicht<br />
zu schaffen, sie sind bereits am Limit.<br />
Einige haben deshalb ihre Strategie<br />
geändert: Sie teilen die schulischen<br />
Anforderungen in mehrere „B<strong>aus</strong>tellen“<br />
auf. <strong>Alles</strong>, was ihnen leichter fällt,<br />
schließen sie positiv ab. Mit einer Entscheidungsprüfung<br />
am Jahresende in<br />
einem Problemfach und einer Wiederholungsprüfung<br />
im Herbst in einem<br />
anderen, gewinnen sie Zeit, verteilen<br />
den Lernstoff übers gesamte Jahr und<br />
können ihn so bewältigen.<br />
Angst und<br />
Verzicht treiben<br />
die PERSÖN LICHE<br />
Weiterentwicklung<br />
voran<br />
Seit Ausbruch der Wirtschaftskrise<br />
fühlt sich die Zukunft für viele noch<br />
ungewisser an. Der Umbruch lauert,<br />
so scheint es. Und selbst wenn der<br />
Crash <strong>aus</strong>bleibt, so kommt er leise und<br />
unterschwellig. In den Industrieländern,<br />
den reifen Märkten, ist die<br />
Epoche des Schrumpfens eingeläutet.<br />
Prioritäten definieren. Menschen<br />
schützen sich vor der Ungewissheit,<br />
indem sie Vorsorge treffen. Gegen<br />
die Angst hilft, so heißt es, ihr ins<br />
Auge zu sehen: Wovor habe ich denn<br />
überhaupt Angst? Was ist mir wirklich<br />
wichtig, und wo liegt meine<br />
Schmerzgrenze? Wer einmal zum<br />
Kern dieser Fragen vorgedrungen ist,<br />
wird möglicherweise feststellen, dass<br />
viele Ängste unbegründet sind. Das<br />
allein kann befreiend wirken. Natürlich<br />
will niemand seinen Job oder sein<br />
Unternehmen verlieren, Ersparnisse<br />
in einer Währungskrise verpuffen<br />
sehen. Doch den meisten Menschen<br />
sind andere Dinge wichtiger, zumeist<br />
sind es Beziehungen zu Familie und<br />
Freunden. In unsicheren Zeiten ist das<br />
Investieren in persönliche Beziehungen<br />
deshalb wichtiger denn je.<br />
Selbsttest. Nach der theoretischen<br />
Abklärung der persönlichen Schmerzgrenze<br />
kann die Askese wertvolle<br />
Erkenntnisse über sich selbst liefern<br />
und Verlustängste minimieren. Im<br />
Selbstversuch kann getestet werden,<br />
wie wichtig einem Dinge und Gewohnheiten<br />
wirklich sind. Der Städter,<br />
der eine Zeitlang freiwillig aufs Auto<br />
verzichtet, wird merken, dass es auch<br />
anders gehen kann. Es soll ein Leben<br />
ohne Fernseher geben. Wer meint,<br />
ohne Kaffee nicht funktionsfähig zu<br />
sein, kann sich genau dieser Her<strong>aus</strong>forderung<br />
stellen.<br />
Plan B. Vorbereitet sein ist alles. Vielen<br />
Menschen hilft es, einen Plan B<br />
zu haben. Damit spielen sie sich gedanklich<br />
frei und Ängste vor einer<br />
ungewissen Zukunft schrumpfen. Ein<br />
Wiener Stadtfrisör hat etwa in ein exklusives<br />
Messer- und Scherenset <strong>aus</strong><br />
Japan investiert. Das ist seine Versicherung<br />
für den Tag X, wenn die Bankomaten<br />
kein Geld mehr <strong>aus</strong>geben.<br />
Dann will er mit seinem Handwerk<br />
und seinem erstklassigen Werkzeug<br />
von Tür zu Türe gehen und notfalls<br />
im T<strong>aus</strong>chhandel gegen Lebensmittel<br />
Haare schneiden.<br />
Europa ist<br />
fortschrittsfeindlicher<br />
als Asien<br />
Es gibt natürlich auch gute Gegenargumente<br />
gegen Krisenidyllen und<br />
Parallelwelten, gegen eine solcherart<br />
konsumverweigernde und wachstumsmüde<br />
Kultur. Der deutsche Verleger<br />
Wolfram Weimer argumentierte,<br />
dass sich Europa heute, insbesondere<br />
im Vergleich mit Asien, auf einem<br />
fortschrittsfeindlichen Kurs befinde.<br />
„Wir wollen nicht mehr weiter werden“,<br />
beschreibt er den Zeitgeist im Nachrichtenmagazin<br />
profil 1 .<br />
Vielleicht liegen die Dinge auch ganz<br />
anders, und es verbirgt sich hinter<br />
dieser vermeintlichen Passivität die<br />
Avantgarde. Innehalten ist nicht<br />
gleichbedeutend mit Stillstand. Vielleicht<br />
sind Konkurrenzdenken und<br />
klassisch-technisches Fortschrittsstreben<br />
passé, die Zeit aber reif für<br />
das etwas wirklich Neues. Es spricht<br />
vieles dafür, dass unser Innovationsstreben<br />
künftig sozialer Innovation<br />
gelten muss. Wenn nun in Europa eine<br />
Bereitschaft zur Verhaltensänderung<br />
entsteht – ja, in der wirtschaftlichen<br />
Dauerflaute durch die Macht des Faktischen<br />
entstehen muss –, mag darin ein<br />
enormer (Wettbewerbs-)Vorteil liegen.<br />
Experten für nachhaltige Energie sind<br />
sich weitgehend einig, dass technische<br />
Innovationen allein die Energiewende<br />
nicht herbeiführen werden, dafür<br />
ist eine Veränderung unserer Konsumgewohnheiten<br />
nötig. Windräder<br />
und Solarpaneele allein werden nicht<br />
<strong>aus</strong>reichen, um <strong>neu</strong>n Milliarden Menschen<br />
– dies ist die UN-Bevölkerungsprognose<br />
für 2050 – ein erträgliches<br />
Leben auf der Erde zu ermöglichen.<br />
Alternativen zur fossilen Energie<br />
müssen also von sozialer Innovation<br />
begleitet sein.<br />
In Zukunft werden<br />
vor allem soziale<br />
Innovationen unsere<br />
Nöte befriedigen<br />
Soziale Innovationen, so schreibt<br />
Managementguru Peter F. Drucker in<br />
seinem Buch Innovation and Entrepre<strong>neu</strong>rship,<br />
seien auch in der Vergangenheit<br />
weitreichender als technische<br />
gewesen. So hätten Spitäler, die in ihrer<br />
modernen Form im Zuge der Aufklärung<br />
entstanden, viel größere Auswirkungen<br />
auf das Gesundheitswesen<br />
gehabt als die meisten Medikamente.<br />
Das Fundament der führenden Rolle<br />
Deutschlands als Industrienation<br />
seien nicht primär seine Erfindungen<br />
und technischen Errungenschaften,<br />
sondern die Art der Organisation der<br />
Produktion und Lehrlings<strong>aus</strong>bildung.<br />
Aus dem Blickwinkel der Anthropologie<br />
jedenfalls steht dem Menschen<br />
stets ein Spektrum an Möglichkeiten<br />
offen. Er ist Generalist. Und er ist<br />
laut Anthropologin Gisela Grupe „ein<br />
ewiger Opportunist“, der sich an <strong>neu</strong>e<br />
und wechselnde Lebensbedingungen<br />
rasch anpassen kann. Dieser Zugang<br />
zum und Umgang mit dem Neuen war<br />
und ist sein Erfolgsrezept. •<br />
1 www.profil.at/articles/1225/560/<br />
331996/retro-industrie-so<br />
<strong>Alles</strong> <strong>aus</strong>. <strong>Alles</strong> <strong>neu</strong>.<br />
15
16<br />
Foto: Christoph Wisser
Land<br />
in Sicht<br />
Schrumpfende Regionen müssen sich <strong>neu</strong> erfinden,<br />
um überleben zu können. Manchmal hilft aber nur mehr<br />
die Abrissbirne. Oft nicht die schlechteste Lösung.<br />
Von Daniela Müller<br />
Wenn in einer Metropole nicht mehr Autos<br />
das Straßenbild bestimmen, sondern Gemüsegärten,<br />
ist einiges im Wandel. Detroit ist so<br />
eine Stadt. Einst Hochburg der Autoindustrie,<br />
ist Detroit nach dem Wegfall t<strong>aus</strong>ender<br />
Arbeits plätze heute aufgeteilt in eine „chocolate<br />
city“, eine Innenstadt mit 90 Prozent vielfach<br />
armer und beschäftigungsloser Afroamerikaner<br />
und in „vanilla suburbs“, einem fetten Speckgürtel,<br />
in dem fast <strong>aus</strong>schließlich wohlhabende<br />
Weiße wohnen. Detroit ist eine Stadt, in der<br />
die Einwohnerzahl von einst zwei Millionen<br />
auf 700.000 geschrumpft ist, in der 4.000 verlassene<br />
Bauten stehen und in die Touristen nur<br />
kommen, um Bauruinen zu fotografieren. Eine<br />
Stadt, die lange Zeit vergessen hat, zu handeln.<br />
Detroit ist das stark ramponierte Gesicht der<br />
postindustriellen Zeit.<br />
Dennoch haben sich Bürger, Organisationen<br />
und die Stadtverwaltung zum Handeln entschlossen.<br />
In den letzten Jahren ist eine „Stadtlandschaft“<br />
entstanden. In brach liegenden<br />
Arealen oder dort, wo Häuser abgerissen wurden,<br />
hat man mit Urban Gardening-Projekten<br />
die Landwirtschaft in den urbanen Raum geholt.<br />
Und weil die Stadt pleite ist, erledigen die<br />
Bürger die Reinigung und Beleuchtung ganzer<br />
Straßen, die Müllabfuhr und die Aufgaben der<br />
Polizei selbst. Diese <strong>neu</strong>e Mischung <strong>aus</strong> Kunst,<br />
Kultur und aktivem Bürgertum scheint auch in<br />
der Bevölkerung gut angekommen zu sein:<br />
Die Abwanderung konnte reduziert werden.<br />
Der Niedergang von Wirtschaftszweigen mit<br />
Fabrikschließungen, der Rückgang bäuerlicher<br />
Strukturen, Zersiedlung, Flucht in die Städte<br />
und der demografische Wandel zwingen weltweit<br />
schrumpfende Regionen zum Umdenken.<br />
Schrumpfungsprozesse<br />
sind globale Phänomene,<br />
die auch Österreich<br />
erfasst haben<br />
In Ostdeutschland will man beispielsweise mit<br />
dem „Stadtumbau Ost“ 1 die Bürger zum Umzug<br />
in Innenstädte bewegen und reißt radikal<br />
leerstehende Wohnbauten ab. In Österreich sei<br />
Rückbau noch kein Thema, sagt Elisabeth Stix<br />
von der Österreichischen Raumordnungskonferenz<br />
(ÖROK) 2 . Doch was nicht ist, kann noch<br />
werden: Massiv von Abwanderung bedroht<br />
sind die Obersteiermark, manche Bezirke im<br />
Burgenland und Kärnten sowie das nördliche<br />
Waldviertel. Laut ÖROK werden in Bezug<br />
auf die Bevölkerung die Stadtregionen weiter<br />
wachsen und entlegene Regio nen das Nachsehen<br />
haben. „Man kann sich globalen Trends,<br />
die für Schrumpfungsprozesse verantwortlich<br />
sind, nicht widersetzen“, meint Stix. Hier gilt<br />
es, Alternativen zu finden und Potenziale zu<br />
heben. „Das geht nur, wenn Verwaltung,<br />
Politik, Bevölkerung und Experten gut zusammenarbeiten.<br />
Lösungen brauchen Zeit und<br />
Ressourcen.“<br />
<strong>Alles</strong> <strong>aus</strong>. <strong>Alles</strong> <strong>neu</strong>.<br />
17
Foto: www.stadt-geschichte.tugraz.at<br />
© Marion Schneider & Christoph Aistleitner, Mediocrity<br />
Foto: www.stadt-geschichte.tugraz.at © Oliver Jungwirth<br />
Durch den Rückgang des Bergb<strong>aus</strong> ist in der Region<br />
Eisenerz die Bevölkerung seit den 1960er-Jahren bis heute<br />
um fast zwei Drittel geschrumpft. Das Projekt redesign Eisenerz<br />
setzt sich mit der Problematik <strong>aus</strong>einander.<br />
Eine Lektion, die man in Eisenerz gelernt hat, ist, dass<br />
die Bevölkerung aktiv in den Rückplanungsprozess einbezogen<br />
werden muss. Selbst dann, wenn das in weiterer Folge eine<br />
Umsiedlung von hunderten Bürgern bedeutet.<br />
Während man in Detroit eine weniger dicht<br />
besiedelte Stadt als Chance sieht und dort erfolgreich<br />
<strong>neu</strong>e Konzepte erprobt, steht die postindustrielle<br />
Region Eisenerz erst am Anfang<br />
einer solchen Entwicklung. Dort schrumpfte<br />
nach dem Wegfall t<strong>aus</strong>ender Arbeitsplätze die<br />
Zahl der Einwohner von 13.000 in den 1960er-<br />
Jahren auf aktuell 5.000. 3<br />
In Eisenerz standen<br />
zuletzt zwei Drittel<br />
der Wohnungen leer<br />
Nach vielen Versuchen ab den 1980er-Jahren,<br />
die Region zu beleben, um Wachstum zu erreichen,<br />
kam man Anfang des Jahrt<strong>aus</strong>ends zum<br />
Schluss, dass man sich mit der Schrumpfung<br />
abfinden müsse. Immerhin standen rund zwei<br />
Drittel der Wohnungen leer und die Vereinsamung,<br />
die Alterung und das Geschäftesterben<br />
waren nicht zu übersehen. Die Verkehrsinfrastruktur<br />
wurde schlechter, weil immer weniger<br />
Menschen unterwegs waren. Mit dem Projekt<br />
redesign Eisenerz 4 begann man, die gesamte<br />
Gemeindestruktur und alle Beteiligten – vom<br />
einzelnen Bürger über die Stadtverwaltung bis<br />
zum Land Steiermark – in die Lösung einzubeziehen.<br />
„Umwandlungsprozesse in Regionen<br />
stehen und fallen mit den dort ansässigen<br />
und betroffenen Menschen“, sagt Norbert<br />
Weixlbaumer vom Institut für Geographie<br />
und Regionalforschung an der Universität<br />
Wien. Transformationsprozesse seien stets ein<br />
Mix <strong>aus</strong> Top-down und Bottom-up. Einerseits<br />
müsse die Bevölkerung die Gelegenheit bekommen,<br />
sich einbringen zu können. Andererseits<br />
müssten im Hintergrund vernünftige Rahmen-<br />
bedingungen vorgegeben werden. Vor allem<br />
müsse es lokale Akteure geben, die gewillt<br />
seien, <strong>neu</strong>e Strukturen aufzubauen.<br />
Vielfach komplett <strong>neu</strong> gedacht werden muss dabei<br />
die Verkehrsinfrastruktur. Thomas Klinger<br />
von der Arbeitsgruppe Mobilitätsforschung an<br />
der Goethe-Universität Frankfurt sagt:<br />
„Im Zuge der industriellen Entwicklung wurde<br />
vor allem auf Straßenbau gesetzt und so eine<br />
entfernungsintensive Lebensweise geschaffen.“<br />
Nun zwinge uns die demografische Entwicklung<br />
<strong>neu</strong>e Lösungen zu finden. Denn schließlich hat<br />
jeder Bürger ein Bedürfnis nach individueller<br />
Mobilität.<br />
In Nordeuropa war man schon länger gefordert,<br />
trotz knapper Ressourcen eine bestmögliche<br />
Versorgung zu gestalten: Auf der dänischen<br />
Insel Bornholm ist der Paketdienst der Post<br />
zugleich Nahverkehrsbus und der Rettungsdienst<br />
ist in den öffentlichen Personenverkehr<br />
eingebunden 5 .<br />
Nach nordischem Vorbild wird nun in der<br />
Uckermark in Ostdeutschland versucht, den<br />
Güterverkehr mit dem Personenverkehr zu<br />
bündeln. Und in der dünn besiedelten Region<br />
Odenwald bei Frankfurt will man künftig die<br />
Verbindung zwischen Gemeinden, Gemeindeteilen<br />
und dem Unter- bzw. Mittelzentrum auf<br />
multimodaler Basis – unter Kombination von<br />
Bahn-, Buslinien, Lieferverkehr, Post und Individualverkehr<br />
in nur 30 Minuten garantieren.<br />
In vielen Regionen müssen Verkehrslösungen<br />
komplett <strong>neu</strong> gedacht werden, die Autostadt<br />
Detroit etwa hat nicht einmal einen Bahnhof.<br />
Doch fast überall sind die Kassen knapp. Tobias<br />
18
Foto: www.shrinkingcities.com<br />
Foto: Urban farming, Detroit<br />
Detroit ist eine Stadt, in der die Einwohnerzahl von einst zwei<br />
Millionen auf 700.000 geschrumpft ist, in der 4.000 verlassene<br />
Bauten stehen und in die Touristen nur kommen, um Bauruinen<br />
zu fotografieren.<br />
Bürger, Organisationen und die Stadtverwaltung haben in<br />
den letzten Jahren die Landwirtschaft in den urbanen Raum geholt.<br />
In brach liegenden Arealen oder dort, wo Häuser abgerissen wurden,<br />
werden Urban Gardening-Projekte betrieben.<br />
Schlüter von der Abteilung Hypertransformation<br />
an der Hochschule Zittau-Görlitz schlägt<br />
deshalb ein Genossenschaftsmodell mit Anreizsystem<br />
vor, bei dem Bund und Länder wie<br />
gewohnt Zuschüsse an Mobilitätsanbieter<br />
leisten. Wer es schafft, die Nutzerzahlen zu<br />
steigern, kann sich die so erworbenen Gelder<br />
behalten.<br />
die britische Stadt<br />
Manchester gilt<br />
international als vorbild<br />
Tourismus ist auch ein Stichwort für Transformationsprozesse<br />
in vornehmlich alpinen<br />
Regionen. Dort könnten große Naturschutzgebiete<br />
<strong>neu</strong>e Impulse bringen, glaubt Norbert<br />
Weixlbaumer von der Universität Wien. In den<br />
westfranzösischen Alpen kurbeln diese schon<br />
jetzt den sanften Tourismus an. „Dadurch gewinnt<br />
der Lebensraum an Qualität und wird<br />
für Betriebsansiedlungen attraktiver“, sagt<br />
Weixlbaumer.<br />
Wie Kultur eine Region beleben kann, zeigt das<br />
britische Beispiel Manchester, das neben Detroit<br />
als Good-Practice-Beispiel für erfolgreichen<br />
Stadtumbau gilt. Dort gelang nach dem Verlust<br />
der klassischen Industriezweige durch den Bau<br />
eines großen Shoppingcenters, durch mehrere<br />
Kulturinitiativen sowie die Ansiedlung von<br />
<strong>neu</strong>en Berufsfeldern der Turnover. Mittlerweile<br />
verzeichnet Manchester sogar einen leichten Bevölkerungszuwachs.<br />
Die Stadtverwaltung kam<br />
der Bevölkerung dabei entgegen: Wer konstruktiv<br />
zum Umbau der Stadt beitragen wollte, dem<br />
wurden ohne Verrechnung von Betriebskosten<br />
Gebäude zur Verfügung gestellt.<br />
Die Bereitschaft zum Umbau und der Mut zum<br />
Rückbau müssen in Eisenerz erst vollständig<br />
ankommen. Das 2006 gestartete und noch bis<br />
2021 laufende Projekt redesign Eisenerz beäugte<br />
die Bevölkerung lange Zeit skeptisch. Als das<br />
erste Gebäude abgerissen wurde, seien die Emotionen<br />
hochgegangen, berichtet Elisa Rosegger-<br />
Purkrabek von redesign Eisenerz. Ähnlich dem<br />
Schrumpfen ist<br />
schmerzhaft.<br />
Kultur und Bildung<br />
als Gegenstrategie<br />
deutschen Modell „Stadtumbau Ost“ setzt man<br />
gezielt auf Schrumpfung, indem vornehmlich<br />
peripher gelegene und vielfach leer stehende<br />
Wohnsiedlungen abgerissen und die verbliebenen<br />
Bewohner dazu bewegt werden sollen, in<br />
den Innenstadtbereich zu ziehen. Sieben Wohnhäuser<br />
fielen der Abrissbirne schon zum Opfer,<br />
über 120 H<strong>aus</strong>halte sind umgesiedelt. Weitere<br />
Projektziele von redesign Eisenerz sind, die Region<br />
touristisch als Ganzjahresdestination zu<br />
etablieren, die Betriebe in der Region zu stärken,<br />
mit entsprechendem Schulangebot stärker<br />
auf Bildung zu setzen und kulturelle Angebote<br />
zu etablieren. Bis 2030 soll sich die Einwohnerzahl<br />
von derzeit 5.000 auf 3.500 einpendeln.<br />
Wie vor dem Boom der Industrialisierung. •<br />
1 www.stadtumbau-ost.info<br />
2 www.www.moz.de/galerie/uebersicht/<br />
g3/908/155780<br />
3 www.oerok-atlas.at<br />
4 www.eisenerz.at/redesign<br />
5 http://elpub.bib.uni-wuppertal.de/servlets/<br />
DerivateServlet/Derivate-684/d110401.pdf<br />
<strong>Alles</strong> <strong>aus</strong>. <strong>Alles</strong> <strong>neu</strong>.<br />
19
die welt in 20 jahren<br />
Die Stadt<br />
nach Plan<br />
Der deutsche Architekt Meinhard von Gerkan hat sich eine<br />
ganz <strong>neu</strong>e stadt in china <strong>aus</strong>gedacht, die jetzt auch gebaut wird.<br />
EIN GESPRÄCH zu seinen ÜberlegungeN, Beobachtungen<br />
sowie schlussFolgerungen zur Städteplanung, und wie all<br />
dies dazu führte, dass im Herzen von Lingang nichts<br />
als Wasser ist.<br />
Das Gespräch führte Ruth Reitmeier<br />
Stadtmensch oder Landmensch?<br />
Eindeutig Stadtmensch. Das Leben<br />
in der Stadt ist für mich spannender,<br />
vielseitiger, ansprechender.<br />
Sie planen eine Stadt der Zukunft<br />
für 1,3 Millionen Menschen in China:<br />
Lingang New City.<br />
Dort hatte ich Gelegenheit, das gesamte<br />
Konzept zu entwickeln und nun zu realisieren<br />
und dabei meine theoretischen<br />
und logischen Folgerungen, die ich <strong>aus</strong><br />
anderen Städten entwickelt habe, verbessert<br />
umzusetzen.<br />
Welche Überlegungen standen bei<br />
Lingang am Anfang?<br />
Ganz am Anfang stand die Wahrnehmung<br />
der nicht mehr zu bewältigenden<br />
Verkehrsprobleme in China, die in großen<br />
Städten noch viel drängender sind<br />
als etwa in Europa, und die unglaublich<br />
vielen Fehler, die man dort gemacht<br />
hat und heute noch macht.<br />
Welche?<br />
Es ist ein Irrtum zu glauben, dass der<br />
Verkehr fließt, je mehr Straßen gebaut<br />
werden. Mit jedem Kilometer mehr<br />
Straße wird entsprechend mehr<br />
gefahren. In Shanghai gibt es Hochschnellstraßen.<br />
Die haben nicht nur<br />
einen enorm großen Flächenbedarf,<br />
als Schnellverbindungen bieten sie<br />
nur gelegentliche Anschlusspunkte<br />
zum Stadtorganismus selbst. All das<br />
hat zur Folge, dass die Verkehrsdichte<br />
zunimmt, mehr Energie verbraucht<br />
wird, die Umweltbelastung steigt und<br />
der Stadtorganismus durch Verkehrsschneisen<br />
zerschnitten wird.<br />
Individualverkehr<br />
erzeugt enorme<br />
Probleme in der<br />
Stadt<br />
Hat der motorisierte Individualverkehr<br />
in großen Städten <strong>aus</strong>gedient?<br />
Der Individualverkehr hat zweifellos<br />
Vorzüge, zugleich erzeugt er enorme<br />
Probleme in der Verdichtung des Verkehrs<br />
und des Flächenbedarfs, allein<br />
wegen der Größe der Fahrzeuge. Der<br />
Sättigungsgrad an Autos ist in vielen<br />
Städten erreicht.<br />
Muss auf das Autofahren in der Stadt<br />
künftig verzichtet werden?<br />
Nicht unbedingt, denn es haben sich<br />
zugleich Dinge entwickelt, die vor zehn,<br />
fünfzehn Jahren bestenfalls gedacht<br />
wurden. Ich spreche vom Car-Sharing.<br />
Man muss also gar kein Auto mehr besitzen,<br />
sondern kann es bei Bedarf für<br />
eine gewisse Zeit nutzen. Durch Mehrfachnutzung<br />
wird der fließende Verkehr<br />
durch eine viel geringere Zahl an<br />
Autos möglich.<br />
Was muss sich in alten Städten ändern?<br />
Am wichtigsten ist die Änderung des<br />
Bewusstseins. Dass das Auto nicht das<br />
wichtigste Statussymbol sein muss und<br />
man es viel effizienter, gemeinsam mit<br />
anderen nutzen kann. Gibt es erst genug<br />
Sammelstellen, könnte die Anzahl<br />
der Autos enorm reduziert und Fläche<br />
wieder freigegeben werden. Denn ein<br />
Auto braucht fünfmal soviel Fläche wie<br />
ein Mensch. Das ist ein unglaubliches<br />
Problem, insbesondere in alten Städten.<br />
Als ein Vorbild für Lingang diente eine<br />
sehr alte Stadt, eine berühmte Stadt<br />
der Antike: Alexandria.<br />
Diese Frage führt uns zur Struktur innerhalb<br />
der Stadt, das Zusammengehen<br />
von Verkehrstrassen, von Bewegungsräumen<br />
und Parks. All das setzt eine<br />
20
Foto: © Wilfried Dechau<br />
Meinhard von Gerkan leitet mit Volkwin<br />
Marg das renommierte Architekturbüro gmp<br />
in Hamburg.<br />
Das Unternehmen wurde 1965 gegründet,<br />
betreibt heute weltweit 10 Büros und baut<br />
Kultur- und Infrastrukturbauten, Stadien<br />
und derzeit eine ganze Stadt in China: Rund<br />
60 Kilometer südöstlich von Shanghai entsteht<br />
Lingang New City. Die Bauzeit erstreckt<br />
sich über rund 18 Jahre bis 2020.<br />
Von Gerkan stammt <strong>aus</strong> einer deutschbaltischen<br />
Familie. Als Kriegsvollwaise und<br />
Flüchtling wuchs er als Pflegekind in Hamburg<br />
auf.<br />
Sein Weg zur Architektur sei nicht vorgezeichnet<br />
gewesen, wie er betont: „Ich habe<br />
zwölf verschiedene Schulen besuchen müssen,<br />
wurde hin-und-hergerissen von allen<br />
möglichen Beeinflussungen. Ich wusste also<br />
nicht, was ich werden wollte“.<br />
Seine Wahl fiel schließlich auf das Architekturstudium,<br />
zumal er Freude am Arbeiten<br />
auf Papier, Zeichentalent sowie Interesse<br />
an der Konstruktion hatte. „Und das hat mir<br />
vom ersten Semester an Spaß gemacht.“<br />
<strong>Alles</strong> <strong>aus</strong>. <strong>Alles</strong> <strong>neu</strong>.<br />
21
Abbildung: © Heiner Leiska<br />
Die strahlenförmig<br />
angelegten Straßen Lingangs<br />
führen zum Stadtmittelpunkt –<br />
ein künstlicher See.<br />
Vorbild dafür ist das<br />
ägyptische Alexandria.<br />
Abbildung: google maps; Barbara Wais<br />
Shanghai<br />
Die Planstadt Lingang befindet sich 60 km südöstlich von Shanghai und<br />
soll 2020 fertig sein.<br />
bestimmte logische Erkenntnis vor<strong>aus</strong>.<br />
Dazu muss man wissen, dass die Mitte<br />
chinesischer Großstädte dicht mit<br />
Hochhäusern bebaut ist. Die Mieten<br />
sind dort am höchsten. Deshalb siedeln<br />
sich jene dort an, die es sich leisten können,<br />
und das sind allen voran Banken<br />
und Versicherungen, die allerdings für<br />
das Stadtleben tote Masse sind.<br />
Allein die Tatsache, eine dicht bebaute<br />
Stadtmitte zu schaffen, hat zur Konsequenz,<br />
dass sie wochentags verkehrsmäßig<br />
überfrachtet, am Wochenende aber<br />
menschenleer ist. Und jetzt spanne ich<br />
den Bogen zwischen Alexandria und<br />
Lingang. Wenn man mitten in der<br />
Stadt eine große Wasserfläche hat –<br />
in Alexandria ist das eine Bucht, in<br />
Lingang ein von mir erdachter künstlicher<br />
See mit drei Kilometern Durchmesser<br />
–, kann das nicht passieren.<br />
Pudong<br />
International<br />
Airport<br />
Lingang New City<br />
Yangshan<br />
Container-<br />
Tiefseehafen<br />
Denn der See hat den Vorteil, dass keine<br />
Häuser darauf stehen. Zugleich ist er ein<br />
Ort der Freizeit, des Vergnügens, der<br />
Begegnung.<br />
Die Stadtmitte<br />
bleibt absichtlich<br />
verkehrsfrei<br />
Das Zentrum Lingangs ist also der<br />
See sowie die rundherum verlaufende<br />
Strandpromenade?<br />
Richtig. Dort kann man sich mit Freunden<br />
treffen, eine Runde joggen oder mit<br />
dem Rad fahren. So funktioniert im<br />
Übrigen der gesamte öffentliche Verkehr<br />
der Stadt: Der fährt im Kreis. Die<br />
Struktur ist eine Kreisfigur mit einem<br />
Mittelpunkt, peripheren Kreisen und<br />
strahlenförmig angelegten Straßen.<br />
<strong>Alles</strong> ist so angeordnet, dass sich die<br />
Wege stark verkürzen. Hier hat also<br />
ein ratio nales Moment eine Ordnungsstruktur<br />
geschaffen. Das findet man<br />
auch in anderen Städten, doch so konsequent<br />
umgesetzt wie in Lingang gibt<br />
es das bisher auf der ganzen Welt noch<br />
nicht.<br />
Lingang ist zwar keine autofreie Stadt,<br />
doch Sie haben alles daran gesetzt, die<br />
Autos nicht ins Zentrum zu lassen.<br />
In der Mitte ist der große See und da<br />
gibt es nur Wasser – also keine Autos.<br />
Dann kommt ein Strand, der ist relativ<br />
breit, eine Grün- und Freizeitzone. Ich<br />
habe auch ganz bewusst in die Gestaltungsordnung<br />
hineingeschrieben, dass<br />
man im inneren Ring die Autos nicht<br />
an der Straße abstellen darf, es darf<br />
dort keine freien Parkplätze geben. Die<br />
Autos müssen unter die Erde oder weg.<br />
Man muss andere<br />
Städte durchlaufen,<br />
um <strong>neu</strong>e STädte<br />
planen zu können<br />
Wie entwickelt sich die Idee<br />
einer Stadt der Zukunft?<br />
Es ist zuallererst ein Prozess des Durchlebens.<br />
Man muss einfach andere Städte<br />
erleben, am besten durchlaufen. Nur<br />
dann nimmt man sie wirklich wahr.<br />
Um ein Beispiel zu nennen: Brasilia<br />
war als eine moderne, autogerechte<br />
Stadt konzipiert.<br />
... und genau das war das Problem.<br />
Man war zunächst unheimlich stolz<br />
darauf. Nur, was ist passiert? Als Autofahrer<br />
muss man heute in eingezäunten<br />
Straßen von A nach B fahren. Völlig<br />
unterprivilegiert sind alle nicht motorisierten<br />
Verkehrsteilnehmer. In Wohn-<br />
22
Das Zentrum chinesischer Städte<br />
ist normalerweise von Banken und<br />
Versicherungen besiedelt, die für<br />
das Stadtleben tote Masse sind:<br />
wochentags verkehrsüberlastet,<br />
am Wochenende menschenleer.<br />
In Lingang soll der See eine<br />
solche Entwicklung verhindern.<br />
vierteln kommt man ohne Auto nicht<br />
von der einen Seite auf die andere.<br />
Die autogerechte Stadt war, wie sich<br />
her<strong>aus</strong> stellt, eine unsägliche Erfindung,<br />
denn zugleich wurde damit eine<br />
menschen ungerechte Stadt geschaffen.<br />
Wird Lingang so funktionieren,<br />
wie Sie sich das vorstellen?<br />
Ich kann dazu nur sagen, ich wünsche<br />
mir, dass die Stadt zu 80 Prozent so<br />
funktioniert, wie erdacht. Zu 100<br />
Prozent kann es gar nicht klappen,<br />
weil eine Stadt permanenten Veränderungen<br />
unterliegt, die nicht antizipierbar<br />
sind. Aber natürlich fürchte ich,<br />
dass ich vielleicht zu falschen Schlüssen<br />
gekommen bin. Das wird man erst beurteilen<br />
können, wenn die Stadt voll<br />
belebt ist.<br />
Eine ganze Stadt<br />
zu planen ist<br />
eine enorme<br />
Her<strong>aus</strong>forderung<br />
Welche Vorteile hat die <strong>neu</strong> geplante<br />
Stadt gegenüber der gewachsenen?<br />
Die <strong>neu</strong> geplante Stadt hat den einen<br />
Vorteil, dass sie etwa auf Bedingungen,<br />
die im Mittelalter geherrscht haben,<br />
keine Rücksicht nehmen muss. Dass es<br />
eben keine engen Gassen gibt und dass<br />
viel bessere Verknüpfungen innerhalb<br />
der Stadt hergestellt werden können.<br />
Ist es der Traum jedes Architekten eine<br />
ganze Stadt zu planen?<br />
Es ist eine der größten Her<strong>aus</strong>forderungen,<br />
es ist ein Geschenk, es tun<br />
zu dürfen und es verpflichtet einen,<br />
das Beste dar<strong>aus</strong> zu machen. Es ist<br />
zugleich aber – und das habe ich<br />
lernen müssen – eine nicht aufhören<br />
Foto: © Julia Ackermann / gmp Foto: © wikipedia, Ricky Qi<br />
Lingang ist eine Stadt, die dem menschlichen Bedürfnis nach Begegnung<br />
Rechnung tragen soll.<br />
wollende Dauerbelastung, weil man<br />
ständig aufpassen muss, dass nichts<br />
schief geht.<br />
Freiräume für<br />
die spätere<br />
Stadtentwicklung<br />
zulassen<br />
Muss eine <strong>neu</strong>e Stadt um ein Mobilitätskonzept<br />
herum geplant werden?<br />
Mobilität ist zweifellos ein Grundbedürfnis<br />
der Menschheit, doch es geht<br />
dabei nicht nur um Fortbewegung,<br />
sondern um die Begegnung mit anderen<br />
Menschen. Man meint immer, hat<br />
man erst eine Straßenstruktur geschaffen,<br />
wurde ein Netz über die Fläche<br />
<strong>aus</strong>gebreitet, dann entstehe eine<br />
Grundstruktur und man brauche<br />
nur noch die Häuschen reinzuflicken.<br />
Doch die Netzstruktur, die man vorher<br />
unveränderlich festlegt hat, hat den<br />
Nachteil, dass alles, was mehr Bedeutung<br />
hat, durch solche Raster gefesselt<br />
ist und es keinen Spielraum gibt.<br />
Was hat denn mehr Bedeutung?<br />
Was in der Stadt womit und mit wem<br />
wie verbunden ist, wo ein Schwerpunkt<br />
liegt, wo eine Kulturachse entstehen<br />
kann. Ein Plan muss der Freiheit der<br />
Stadtentwicklung und den menschlichen<br />
Bedürfnissen so gut wie möglich<br />
Rechnung tragen.<br />
Ist Lingang die ideale Stadt?<br />
Lingang ist für mich eine einmalige<br />
Chance, weil hier die Qualität des<br />
urbanen Lebens im Mittelpunkt steht. •<br />
<strong>Alles</strong> <strong>aus</strong>. <strong>Alles</strong> <strong>neu</strong>.<br />
23
Beamen bleibt<br />
vorerst Utopie<br />
Man kann das Rad nicht <strong>neu</strong> erfinden, lautet ein sprichwort.<br />
Die Quantenphysik versucht Es trotzdem. Was genau dar<strong>aus</strong> wird,<br />
weiSS niemand. Es könnte aber alles <strong>neu</strong> werden.<br />
Das Gespräch führte Daniela Müller<br />
Schrödingers Katze<br />
Der Begründer der Quantenmechanik, Erwin Schrödinger, suchte zur<br />
Veranschaulichung des Faches eine originelle Analogie in Form eines<br />
fiktiven Experimentes. Dazu sollte eine Katze mit einem in absehbarer<br />
Zeit radioaktiv zerfallenden Atom in einen nicht einsehbaren Kasten<br />
gesperrt werden. Laut Versuchsanordnung wird die Katze in dem<br />
Moment getötet, in dem das Atom zerfällt und der Geigerzähler<br />
<strong>aus</strong>schlägt. Der nicht einsehbare Kasten ist dabei ein Synonym für<br />
quantenphysikalische Vorgänge: Wenn man prinzipiell nicht wissen<br />
kann, welches der beiden möglichen Ereignisse (Atom ist zerfallen<br />
bzw. nicht zerfallen) eingetreten ist, liegen beide Zustände „gleichzeitig“<br />
vor, die Katze ist tot und lebendig. Sobald der Mensch als<br />
Beobachter eintritt, verändert er die experimentelle Situation:<br />
Durch das Nachsehen, hier durch das Öffnen des Kastens, wird<br />
ein bestimmter Zustand des Atoms und somit der Katze festgelegt.<br />
Die Quantenphysik geht davon <strong>aus</strong>, dass die Welt noch viele<br />
Überraschungen birgt – es im Fall der Katze noch andere Zustände<br />
als „Katze lebt“ oder „Katze ist tot“ geben kann. Welche das sein<br />
könnten, ist wenig definiert.<br />
Markus Aspelmeyer geht an der<br />
Fakultät für Physik der Universität<br />
Wien den Geheimnissen der Quantenphysik<br />
auf den Grund, die möglicherweise<br />
unser Denken radikal verändern<br />
werden.<br />
Wie könnte im quantenmechanischen<br />
Sinne Mobilität <strong>neu</strong> gedacht werden?<br />
Es gibt das Gebiet der Quanteninformation.<br />
Dort wird Information mit<br />
Hilfe der Quantenphysik verarbeitet,<br />
was ungeahnte Möglichkeiten für<br />
Kommunikations- und Rechenanwendungen<br />
eröffnet – sozusagen <strong>neu</strong>e<br />
Wege der „Datenmobilität“. Die Quantenkryptographie<br />
ist nur ein Beispiel.<br />
Dort wird abhörsichere Kommunikation<br />
auf Basis der Quantenphysik<br />
erzielt. In der herkömmlichen Kryptogra<br />
phie ist das schwierig. Jeder L<strong>aus</strong>changriff<br />
wird aufgrund der Gesetze der<br />
Quantenphysik sofort entdeckt. Die<br />
Quantenkryptographie wird auch<br />
schon kommerziell eingesetzt.<br />
Es gibt auch andere Entwicklungen,<br />
beispielsweise Ideen, wie man mit<br />
Hilfe der Quantenphysik die Effizienz<br />
von Solarzellen verbessern könnte.<br />
Sollte das jemals erfolgreich sein,<br />
könnte das durch<strong>aus</strong> die Mobilität beeinflussen,<br />
je nachdem was Solarzellen<br />
eben alles antreiben.<br />
24
Also keine Aussicht auf eine völlig<br />
<strong>neu</strong>e Art, um von A nach B zu kommen?<br />
Das beste Konzept, das ich dazu kenne,<br />
ist der Infinite Improbability Drive<br />
<strong>aus</strong> dem Buch „Hitchhiker’s Guide to<br />
the Galaxy“. Die Idee ist, dass ein Objekt<br />
mittels der quantenmechanischen<br />
Wellenfunktion so weit im Raum verteilt<br />
ist, dass es im Prinzip überall sein<br />
kann. Das Problem ist nur, dass man<br />
vor Antritt der Reise nicht weiß, wo<br />
im Universum man landen wird…<br />
Markus Aspelmeyer ist Professor für Physik an der<br />
Universität Wien. Zuvor war er unter anderem am Institut<br />
für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI)<br />
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften<br />
in Wien tätig. Er ist Gründungsmitglied und derzeitiger<br />
Sprecher des Vienna Center for Quantum Science and<br />
Technology (VCQ). Aspelmeyer wurde national und international<br />
mehrfach für seine Forschungen im Bereich<br />
der Quantenphysik <strong>aus</strong>gezeichnet.<br />
http://aspelmeyer.quantum.at<br />
Hat es Potenzial, umgesetzt zu werden?<br />
Leider nein.<br />
Wie sieht’s mit Beamen <strong>aus</strong>?<br />
Ebenfalls hoffnungslos. Beamen ist<br />
nichts anderes als Informationsübertragung,<br />
allerdings ohne dass das Teilchen,<br />
das die Information ursprünglich<br />
trägt, transportiert wird. Die<br />
Informa tion wird auf ein entferntes<br />
Teilchen übertragen, und am Ausgangsort<br />
unwiderruflich gelöscht. Die<br />
Teleporta tion, die ihren Namen <strong>aus</strong><br />
dem Film Star Trek erhielt, wurde im<br />
Labor erstmals in Österreich mit einzelnen<br />
Lichtteilchen und auch Atomen<br />
erprobt. Dabei wurden schon Distanzen<br />
bis zu 140 Kilometer erreicht. Die<br />
Schwierigkeit liegt darin, mehr Information<br />
als einige wenige Bits zu teleportieren.<br />
Bei einem größeren System,<br />
und sei es auch nur ein Radiergummi,<br />
wird’s prinzipiell unmöglich.<br />
DAS Gedankenexperiment der Quantenphysik,<br />
Schrödingers Katze, zeigt das<br />
Dilemma, dass die uns bekannte Welt<br />
und die der Quantenphysik unvereinbar<br />
sind. Wie kann das Beispiel übersetzt<br />
werden auf gesellschaftliche Prozesse?<br />
Schrödinger wollte damit sagen, dass<br />
die Quantenphysik Zustände von Objekten<br />
zulässt, die sich unserem Alltagsverständnis<br />
völlig entziehen.<br />
(Aspelmeyer entschuldigt sich, um seiner<br />
echten Katze die Türe zu öffnen.)<br />
Wir können heute Experimente durchführen,<br />
deren Ergebnisse im direkten<br />
Widerspruch stehen mit unserer Vorstellung,<br />
dass <strong>aus</strong>schließlich der eine<br />
oder der andere Zustand eines Objekts<br />
vorliegt, zum Beispiel dass ein Objekt<br />
„hier“ oder „dort“ ist. Bei Atomen oder<br />
Lichtteilchen mag einen das wenig stören,<br />
weil man von diesen kleinen Objekten<br />
keine rechte Vorstellung hat,<br />
weil sie ja so klein sind. Aber bei einer<br />
Katze steht das im direkten und ganz<br />
krassen Widerspruch zu dem, was wir<br />
<strong>aus</strong> dem Alltag kennen, nämlich entweder<br />
tot oder lebendig.<br />
Was heißt das alles für unser Denken?<br />
Im Moment ist die größte Her<strong>aus</strong>forderung,<br />
diese Erkenntnis einmal zu<br />
verdauen und klarzumachen, dass<br />
Quantenphysik unser Weltbild radikal<br />
infrage stellt. Da sind <strong>neu</strong>e Denkansätze<br />
gefragt.<br />
Was zeigt uns die Quantenphysik, das wir<br />
bisher nicht vollständig gedacht haben?<br />
Wir wissen mittlerweile, wo wir falsch<br />
liegen. Nämlich zu denken, dass man<br />
einem Objekt Eigenschaften unabhängig<br />
von der Messung der Eigenschaften<br />
zuschreiben kann. Platt formuliert<br />
könnte man sagen: Wir gehen fälschlicherweise<br />
davon <strong>aus</strong>, dass jemand<br />
Schuhe trägt, auch wenn wir nicht hinschauen.<br />
Diese sogenannte Realismusannahme<br />
ist falsch, zusammen mit der<br />
Annahme, dass meine Beobachtung an<br />
meinem Ort keinen Einfluss auf Ihre<br />
Beobachtungen an Ihrem weit entfernten<br />
Ort hat. Das ist ein extrem harter<br />
Brocken, weil diese beiden Annahmen<br />
nahezu intuitiv in unserer Weltanschauung<br />
verankert sind. Was wir<br />
noch nicht wissen, ist, wie man stattdessen<br />
darüber nachdenken sollte.<br />
Kann Quantenphysik ein Umbruch<br />
in unserem naturwissenschaftlichen<br />
Denken sein? Löst es Bisheriges ab oder<br />
ist es eine alternative Denkweise?<br />
Aus unseren Experimenten haben wir<br />
bereits unabänderbare Fakten, die wir<br />
nicht mit den einfachen Annahmen,<br />
auf denen unser Weltbild fußt, erklären<br />
können – unabhängig von der physikalischen<br />
Theorie. Wir wissen also,<br />
dass wir unsere Anschauungen gewaltig<br />
ändern müssen. Wir arbeiten auch<br />
mit Philosophen zusammen, um konsistente<br />
Denkweisen zu finden. Um auf<br />
die Frage zu antworten: Es wird bisheriges<br />
Denken ablösen.<br />
Wie kommen wir her<strong>aus</strong> <strong>aus</strong> unserem<br />
Denkschema: Wir sehen nur, was wir<br />
kennen? Oder um Einstein zu zitieren:<br />
„Der gesunde Menschenverstand ist<br />
nichts anderes, als die Summe der Vorurteile,<br />
die wir bis zum 18. Lebensjahr<br />
erworben haben.“<br />
Man muss die Leute so früh wie möglich<br />
mit der verrückten Welt der Quantenphysik<br />
konfrontieren und sie zum<br />
Denken anregen. Eigentlich dürfte man<br />
das Gymnasium nicht verlassen, ohne<br />
mit diesem Weltbild konfrontiert worden<br />
zu sein. Und vielleicht muss man<br />
ja noch früher ansetzen.<br />
Warum brauchen wir Bilder, um etwas<br />
zu glauben?<br />
Das scheint ein natürliches Bedürfnis<br />
zu sein. Dar<strong>aus</strong> entspringt die menschliche<br />
Neugier. Unsere Erklärungen<br />
beruhen nicht nur auf Hypothesen<br />
über die Welt, diese sollen auch nicht<br />
im Widerspruch mit der Gesamtheit<br />
unserer Beobachtungen stehen.<br />
Wir wollen ein konsistentes Weltbild.<br />
Die Quantenexperimente zwingen uns<br />
dazu, einige dieser Hypothesen, wie<br />
etwa den Realismus, aufzugeben.<br />
Und das ist letztlich gen<strong>aus</strong>o schwer,<br />
wie es sich anhört … •<br />
<strong>Alles</strong> <strong>aus</strong>. <strong>Alles</strong> <strong>neu</strong>.<br />
25
innovatives online & offline<br />
StART-UPs<br />
Spannende Ideen <strong>aus</strong> aller Welt zum Thema <strong>Alles</strong> <strong>neu</strong>.<br />
Von Katrin Stehrer<br />
////// Sag’s mir durch die Nummer ///////////////////<br />
Beim Autofahren sind umfassende Botschaften an andere Verkehrsteilnehmer meist<br />
unmöglich. Getadelt, gelobt und geflirtet wird daher mittels stark verkürzter Zeichensprache.<br />
Ein kostenloser Service zweier Deutscher verspricht das zu ändern:<br />
Auf www.flinyu.com kann man mit anderen Autofahrern in Kontakt treten, ohne deren<br />
Namen zu kennen. Es genügt das Autokennzeichen. Vor<strong>aus</strong>setzung ist, dass der<br />
Adressat auch auf www.flinyu.com registriert ist.<br />
////// Treibstoff gegen den Klimawandel ////////<br />
Den CO 2-Gehalt in der Atmosphäre reduzieren und damit flüssigen Treibstoff produzieren?<br />
Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Laut Climeworks, einem Spin-off der<br />
ETH Zürich, könnte der Traum bald Realität sein. Reines CO 2 kann schon heute mithilfe<br />
des patentierten CO 2-Luftfilter-Materials „Sorbent“ <strong>aus</strong> der Umgebungsluft gewonnen<br />
werden. Bis 2020 soll auch der zweite B<strong>aus</strong>tein für die Spritproduktion geschafft<br />
sein: die Umwandlung von reinem CO 2 in flüssigen Treibstoff.<br />
www.climeworks.com<br />
////// umstiegshilfe in die firma //////////////////////<br />
PocketTaxi und PleaseCycle sind zwei Start-ups mit unterschiedlichen Lösungen für<br />
eine Her<strong>aus</strong>forderung: die hohe Umweltbelastung durch den Berufsverkehr zu reduzieren.<br />
Die PocketTaxi-Software, die in Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Institut<br />
für Technologie entwickelt wurde, ermöglichen mit wenigen Klicks spontanes Bilden<br />
von Fahrgemeinschaften für den Weg von und zur Arbeit. Voranmeldung à la Mitfahrzentrale<br />
ist nicht mehr nötig. Derzeit gibt es PocketTaxi nur für Unternehmen, geplant<br />
ist eine Erweiterung auf Privatpersonen.<br />
www.pockettaxi.de<br />
PleaseCycle ist ein Londoner Start-up, das den Mitarbeitern von Unternehmen den<br />
Umstieg auf das Fahrrad erleichtern will. Neben Umweltgründen führt PleaseCycle<br />
ein originelles Argument ins Treffen: Körperliche Ertüchtigung reduziere die Rate an<br />
Konzentrationsfehlern bei Mitarbeitern um 27 %. Das Angebot beinhaltet unter<br />
anderem Routen planung, ein BikeMile-Programm, das Fahrradkilometer mit Einkaufs<br />
gutschei nen belohnt, sowie einen Bike-Concierge, der sich um technische Angelegenheiten<br />
kümmert, von Parklösungen bis zum Firmenlogo auf dem Rad.<br />
www.pleasecycle.com<br />
26
Fahrschein gegen Muskelkraft /////////////<br />
Im Smart-City-Konzept „Hybrid2“ des Londoner Designers Chiyu Chen erzeugen<br />
Fahrgäste selbst die Energie, mit der Stadtbusse und andere öffentliche Verkehrsmittel<br />
betrieben werden: An Bus- und U-Bahnhaltestellen können mit Bremsrekuperation<br />
<strong>aus</strong>gestattete Fahrräder entlehnt werden. Sie speichern beim Bremsen Energie,<br />
welche nach Rückgabe an der Bikesharing-Stelle in das Verkehrsstromnetz<br />
eingespeist wird. Der Fahrgast erhält dafür Bonus-Punkte, mit denen er andere Verkehrsmittel<br />
kostenlos nutzen kann. Ein funktionierender Prototyp ist vorhanden. Was<br />
noch fehlt, ist eine Stadt, die das fortschrittliche Konzept testen und umsetzen will.<br />
www.chiyuchen.com<br />
////// Spielend unterwegs //////////////////////////////<br />
Seit 2010 sind die öffentlichen Verkehrmittel Londons ein gigantischer Reality-Spielplatz.<br />
Möglich macht das die Firma Dynamic50 mit ihrem Spiel Chromaroma. Wer<br />
eine Netzkarte besitzt, kann allein oder in Gruppen Punkte sammeln. Belohnt werden<br />
Missionen wie die Nutzung möglichst vieler verschiedener Verkehrsmittel oder<br />
die „Eroberung“ von Haltestellen durch besonders häufiges Aus- und Einsteigen.<br />
Das macht Bus- und U-Bahn-Fahren nicht nur kurzweilig, sondern erleichtert auch<br />
die Beobachtung des eigenen Fahrverhaltens. Derzeit ist das Spiel auf London beschränkt.<br />
Das Ziel ist ein globales Chromaroma.<br />
www.chromaroma.com<br />
Auch der schwedische Designer Jiang Qian versucht Unterhaltung in die U-Bahn zu<br />
bringen. Seine Game Straps sind von der Decke hängende Haltegriffe mit Monitoren,<br />
auf denen beispielsweise Tetris gespielt werden kann. Wer besonders ins Spiel vertieft<br />
ist, wird durch einen Vibrationsalarm sowie aktuellen Routeninformationen ans Aussteigen<br />
erinnert. Bis jetzt existieren die Game Straps nur als Idee. Umsetzungspioniere<br />
werden noch gesucht.<br />
www.coroflot.com/jq<br />
////// Den Stau überrollen //////////////////////////////<br />
Für den 3D Express Coach der chinesischen Firma Hashi Future Parking Equipment<br />
sind St<strong>aus</strong> kein Hindernis: Ein Tunnelbus fasst bis zu 1200 Personen und überspannt<br />
eine zweispurige Fahrbahn in zwei Metern Höhe. Er kann normale Fahrzeuge<br />
und St<strong>aus</strong> auf diese Weise überfahren. Die Kosten für den Bau des Busses und der<br />
Führungsbahn betragen nur 10 % einer entsprechenden U-Bahn-Trasse. Realität soll<br />
der 3D Express Coach auf 185 km Länge im Pekinger Mentougou District werden.<br />
http://abcnews.go.com/Travel/beijing-china-3d-express-coach-combat-trafficpollution/story?id=11407858#.UDPvqULzqlU<br />
////// Selbst den Verkehr regeln ////////////////////<br />
Die Feedback-Plattform TrafficCheck, die 2012 als Prototyp für den Raum Graz online<br />
ging, setzt auf die Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Verkehrsplanern. Vor<br />
allem nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer sind eingeladen, via Smartphone die Infrastruktur<br />
zu bewerten: Wie lang muss man vor einer Ampel warten, wie viel Stau<br />
produziert sie, wie oft fällt sie <strong>aus</strong>? Über das direkte Feedback der Kunden soll der<br />
städtische Verkehr verbessert werden. TrafficCheck ist eine Kooperation zwischen<br />
verschiedenen Unternehmen, der TU Wien und der Grazer Stadtverwaltung.<br />
www.trafficcheck.at<br />
<strong>Alles</strong> <strong>aus</strong>. <strong>Alles</strong> <strong>neu</strong>.<br />
27
Mobile Visionen<br />
der Vergangenheit<br />
Besonders eifrig bei Zukunftsvisionen war<br />
stets die Zeitschrift Hobby, in den 50er-Jahren<br />
Zentralorgan atomgetriebener Vollmobilität:<br />
Vom Energieverbrauch war nie die Rede, aber<br />
von mehrstöckigen Autobahnen in Städten,<br />
Privatflugzeugen, unendlich schnellem Schienenverkehr,<br />
und, nicht zu vergessen, die Mobilität in den Meeren,<br />
auf dem und unter Wasser. Die Autos sahen <strong>aus</strong> wie<br />
Raumschiffe, die momentan nicht fliegen, die Passagiere<br />
schwitzten niemals, selbst unter riesigen Glaskuppeln nicht,<br />
und die Autos fanden bereits selbst ans Ziel.<br />
So heftig das Pendel in den 50er-Jahren auch<br />
<strong>aus</strong>schlug, die Technikträume sind dann<br />
doch an der Praxis gescheitert: Irgendwann<br />
dürfte sich her<strong>aus</strong>gestellt haben, dass<br />
der Mensch doch nicht unablässig<br />
in der Stadt unterwegs sein,<br />
sondern auch dort<br />
wohnen will.<br />
Illustration: © Kl<strong>aus</strong> Bürgle: Das <strong>neu</strong>e Universum 76, 1959<br />
28
Von sprechenden<br />
Ampeln und Autos, die<br />
überflüssig werden<br />
Halb so viele Autos wie heute und dennoch schneller am Ziel –<br />
2050 könnten wir uns an diesen Gedanken gewöhnt haben.<br />
Von Martin Strubreiter<br />
Die Verkehrsampeln der Zukunft sehen<br />
die Kolonnen kommen, vermessen deren<br />
Geschwindigkeit, kommunizieren<br />
in Echtzeit miteinander und regeln den<br />
Verkehr durch grüne Wellen deutlich<br />
flüssiger – nicht nur für Autos, sondern<br />
auch für Fußgänger und Radfahrer.<br />
So sieht einer der vielen Mosaiksteine<br />
<strong>aus</strong>, <strong>aus</strong> denen sich Mobilität künftig<br />
zusammensetzen wird. Autos wird es<br />
auch in Zukunft noch geben, aber sie<br />
werden in Europas Städten eine geringere<br />
Rolle spielen als heute. Davon geht<br />
Wolfgang Schade vom Fraunhofer-Institut<br />
für System- und Innovationsforschung<br />
in Berlin <strong>aus</strong>, Autor der Studie<br />
VIVER 1 (VIsion für nachhaltigen<br />
VERkehr in Deutschland): „Bis 2050<br />
wird der PKW-Bestand in Deutschland<br />
von 523 auf rund 250 pro 1000 Einwohner<br />
gesunken sein.“ Für Österreich<br />
(derzeit 537 Pkw je 1000 Einwohner) ist<br />
in Städten Ähnliches zu erwarten.<br />
Dass der bisherige Verkehr vor allem<br />
in den Städten an seine und die Grenzen<br />
der Bewohner stößt, ist schon<br />
heute fühlbar. Vor dem endgültigen<br />
Steckenbleiben wird aber ein Umdenken<br />
einsetzen, das schmerzlich sein<br />
kann, weil ein paar lieb gewonnene Bequemlichkeiten<br />
auf der Strecke bleiben<br />
werden, oder eine freudige Chance,<br />
weil dann doch alles schneller, günstiger<br />
und geschmeidiger gehen wird.<br />
Fest steht: Technik alleine wird St<strong>aus</strong>,<br />
Lärmproblem und CO 2-Emissionen<br />
nicht beseitigen können. Auch der<br />
Mensch wird einen <strong>neu</strong>en Zugang<br />
zur Mobilität entwickeln müssen, um<br />
rasch, umweltfreundlich und unproblematisch<br />
sein Ziel zu erreichen.<br />
Eine einzige<br />
Netzkarte für<br />
viele städte<br />
Die häufigste Frage wird also nicht<br />
mehr jene sein, welches Auto man<br />
fährt. Irene Feige, Leiterin des Münchner<br />
Instituts für Mobilitätsforschung<br />
(IFMO): „Künftig wird die Frage lauten:<br />
Wie komme ich optimal, also<br />
schnell und ressourcenschonend, in<br />
Stadt und Land von A nach B?“ Es geht<br />
also nicht nur um Verkehrswege und<br />
-mittel, sondern um individuelle Mobilität<br />
mit unterschiedlichen Motiven<br />
und Bedürfnissen.<br />
Dazu werden deutlich mehr unterschiedliche<br />
Verkehrsmittel bereit<br />
stehen als bisher. Und auch das Auto<br />
wird es noch immer geben: in verschiedenen<br />
Größen, elektrisch, mittels<br />
Wasserstoff oder als (wahlweise rein<br />
elektrisch oder mittels Verbrennungsmotor<br />
zu fahrender) Plug-in-Hybrid.<br />
Der Stadtbewohner der Zukunft wird<br />
multi modale Mobilität pflegen. Viele<br />
Experten gehen davon <strong>aus</strong>, dass sich<br />
die User der Zukunft wünschen, ohne<br />
jede Hemmschwelle zwischen den Verkehrsmitteln<br />
wechseln zu können. Alle<br />
sollten mit einer einzigen Mobilitätskarte<br />
zugänglich sein, überall in der<br />
Stadt bereit stehen, und die Planung<br />
einer Fahrt sollte einfach sein wie nie<br />
zuvor: Man gibt dem Smartphone oder<br />
einem anderen digitalen Assisten ten das<br />
Ziel an, und schon wird die schnellste,<br />
kostengünstigste und umweltschonendste<br />
Route angezeigt. Die benötigten<br />
Leihautos, -fahr- oder -motorräder<br />
können gleich reserviert werden, der<br />
Fahrplan öffentlicher Verkehrsmittel<br />
wird angezeigt, man wird zum Startpunkt<br />
gelotst, und nach der Fahrt wird<br />
p<strong>aus</strong>chal und automatisch abgerechnet.<br />
Teil dieser Vision ist, dass durch die<br />
perfekte Vernetzung der Anbieter eine<br />
Mobilitätskarte in vielen Städten einsetzbar<br />
ist. Mit anderen Worten: Man<br />
kombiniert einfach jene Verkehrsmittel,<br />
die am besten zur Fahrstrecke passen.<br />
Das private Auto wird dabei überflüssig.<br />
Sobald Carsharing sehr viele<br />
Nutzer hat, wird es auch deutlich flexibler<br />
sein als heute: Jede Autokategorie<br />
wird verfügbar sein, vom wendigen<br />
Elektro-Zweisitzer für die Stadt bis zum<br />
Van für Urlaubsreisen. Die Autos können<br />
überall stehengelassen werden,<br />
weil überall potenzielle User wohnen.<br />
Ein weiterer Clou: Man muss nicht<br />
mehr unbedingt selbst Autofahren.<br />
Das autonome, computergesteuerte<br />
Auto gibt es bereits und wird unseren<br />
Alltag in den nächsten 20 Jahren revolutionieren.<br />
Ein ebenso bekannter Stammgast früherer<br />
Zukunftszenarien ist das fliegende<br />
Auto. Mit dem EU-Projekt<br />
MyCopter (siehe auch Seite 11) wird<br />
aktuell an der praktischen Durchführung<br />
getüftelt. Vor allem die Gefahr<br />
der Kollision mit ober- und unterhalb<br />
<strong>Alles</strong> <strong>aus</strong>. <strong>Alles</strong> <strong>neu</strong>.<br />
29
fliegenden Autos kann durch automatische<br />
Steuerung <strong>aus</strong>gebremst werden.<br />
Somit könnte das fliegende Auto besonders<br />
am Land einen Teil der Mobilität<br />
übernehmen. Dort werden öffentliche<br />
Verkehrsmittel in den nächsten<br />
Jahrzehnten vor<strong>aus</strong>sichtlich mangels<br />
Nachfrage reduziert.<br />
Radikale<br />
Trendbrüche AUF<br />
DEM Weg zur Mobilität<br />
der Zukunft<br />
Man kann von teils sehr radikalen<br />
Trendbrüchen sprechen, schließlich<br />
wird auch die Welt 2050 nicht mehr<br />
jene sein, die wir heute kennen. Fast<br />
drei Viertel der Menschen wird Mitte<br />
des Jahrhunderts in Städten wohnen.<br />
In Europa und den USA wird das<br />
Durchschnittsalter weiter zunehmen<br />
und damit die Zahl der Erwerbstätigen<br />
im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung<br />
sinken – ein steigender Bedarf an Produkten,<br />
die bequemes Fortkommen<br />
ermöglichen, wird die Folge sein.<br />
Wolfgang Schade: „Die Stadt der Zukunft<br />
wird sich enorm verändert haben<br />
und nicht mehr nach den Bedürfnissen<br />
des Autoverkehrs gestaltet sein.<br />
Es wird mehr Grün- und Lebensraum<br />
geben, weil die <strong>neu</strong>e Mobilität weniger<br />
Platz braucht, was dann zu mehr Lebensqualität<br />
führen wird. Beste Vor<strong>aus</strong>setzungen<br />
also, um die Trendumkehr<br />
freudig zu zelebrieren.<br />
Stark verändern wird sich die Mobilität<br />
auch in jenen Ländern, die heute<br />
zu den Wachstumsmärkten der Autoindustrie<br />
zählen. Irene Feige vom Institut<br />
für Mobilitätsforschung: „In den<br />
Schwellenländern ist die Nachfrage<br />
nach Motorisierung derzeit höher als<br />
sie bei uns selbst in Wirtschaftswunder-<br />
Zeiten war. Dort wird die Dichte privater<br />
Pkw noch etwas länger zunehmen.“<br />
Ein positiver Denkansatz geht allerdings<br />
davon <strong>aus</strong>, dass Inder, Chinesen<br />
und andere künftige Autofahrer <strong>aus</strong><br />
den Fehlern der nördlichen Welt lernen<br />
und den Verkehrskollaps gleich<br />
überspringen: Vielleicht werden intelligente<br />
Verkehrsampeln 2050 nicht nur<br />
in Europa deutlich mehr Radfahrer<br />
und Fußgänger als Autofahrer zu erkennen<br />
haben, sondern weltweit. •<br />
1 www.isi.fraunhofer.de/isi-media/<br />
docs/service/de/presseinfos/VIVER.pdf?<br />
WSESSIONID=5230e64b8044d248e71<br />
31389e4ef54ea<br />
„Das Neue ist nur auf den ersten Blick langsamer“<br />
Wolfgang Schade 2 , Fraunhofer Institut<br />
für System- und Innovationsforschung<br />
in Berlin, über nachhaltige<br />
Mobilität im Jahr 2050 und warum<br />
große Veränderungen selbstverständlicher<br />
sein werden als angenommen.<br />
Ihre Studie zeichnet ein durchwegs positives<br />
Bild: Mobilität bleibt leistbar,<br />
die Überalterung bleibt im Rahmen,<br />
wir sind bereit für Entschleunigung<br />
und einen rationaleren, also weniger<br />
von Emotionen gesteuerten Umgang<br />
mit dem Auto. Wird das wirklich so<br />
leicht gehen?<br />
Die positive Grundstimmung ist<br />
bewusst gewählt, wir wollten ein<br />
nachhaltiges, angenehmes, aber<br />
realistisches Bild der Zukunft entwerfen.<br />
Gehen wir von negativen Vor<strong>aus</strong>setzungen<br />
<strong>aus</strong>, dann kommen wir sehr<br />
schnell zu einem sehr negativen Gesamtbild.<br />
Es zeigt sich aber, dass Kampagnen<br />
wie „Kopf an, Motor <strong>aus</strong>. Für<br />
null CO 2 auf Kurzstrecken“ in vielen<br />
deutschen Städten schon heute zum<br />
Umdenken führen. Ich bin auch überzeugt,<br />
dass wir bereit sind für Entschleunigung.<br />
Auch Firmenchefs werden<br />
hoffentlich einsehen, dass es auf<br />
längere Sicht kontraproduktiv ist,<br />
wenn ein Mitarbeiter fünf Jahre lang<br />
über seine Verhältnisse arbeitet, dann<br />
aber für zwei Jahre wegen Burnout<br />
<strong>aus</strong>fällt. Dieses Umdenken wird uns<br />
auch bei der Mobilität bereit machen<br />
für Neues, das nur auf den ersten Blick<br />
langsamer <strong>aus</strong>sieht.<br />
Gibt es kritische Stimmen zu<br />
Ihrer Studie, beispielsweise von<br />
der Autoindustrie?<br />
Die Resonanz ist positiv, lediglich<br />
ältere Menschen reagieren etwas<br />
kritischer. Und die Autoindustrie<br />
war ein wenig irritiert darüber,<br />
dass der Autobestand so drastisch<br />
auf weniger als die Hälfte sinken soll.<br />
Aber die Hersteller haben den Trend<br />
ohnedies schon erkannt, sehen ihre<br />
künftige Rolle im Anbieten von<br />
Mobilität und engagieren sich daher<br />
bei <strong>neu</strong>en Geschäftsmodellen wie<br />
Carsharing. Sogar die Deutsche Bahn<br />
ergänzt ihr Angebot schon jetzt um<br />
E-Bikes.<br />
Da wird der große Durchbruch ja<br />
mit der Vernetzung kommen …<br />
Noch sind die Angebote etwas fragmentarisch,<br />
man muss sich bei jedem<br />
Anbieter extra anmelden und überall<br />
getrennt bezahlen. Künftig wird die<br />
Wegabfrage übers Smartphone laufen<br />
und man wird auf einen Blick erkennen<br />
können, welches Verkehrsmittel<br />
man am besten nimmt, wo es steht<br />
und was es kostet. Die technischen<br />
Möglichkeiten dazu sind sicher schneller<br />
entwickelt als die organisatorischen:<br />
Da werden alle Anbieter zusammenarbeiten<br />
müssen, und es werden<br />
Datenserviceanbieter wie Google dabei<br />
sein, an die man heute bei Mobilität<br />
noch nicht denkt. •<br />
2 www.isi.fraunhofer.de/isi-de/n/<br />
mitarbeiter/ws.php<br />
30
Von allem mehr<br />
Immer mehr Österreicher pendeln zwischen ihrem Wohnort und Arbeitsplatz. Die Anzahl der Jahreskarten<br />
für öffentliche Verkehrsmittel, der PKW sowie der Fahrräder, die in den H<strong>aus</strong>halten vorhanden sind,<br />
nimmt zu. Auch weil Mobilität immer vielseitiger wird, wie die Mobilitätsstudie des ÖAMTC 2011 beweist:<br />
57 % der Österreicher nutzen für ihre täglichen Wege mehr als ein Verkehrsmittel.<br />
Die Zahlen wurden von Silvia Wasserbacher zusammengestellt.<br />
daten & fakten<br />
Pendler sind Erwerbstätige, Schüler oder Studierende, die zwischen<br />
Wohnung und Arbeits- oder Ausbildungsstätte einen Weg zurücklegen und<br />
dabei das Grundstück, auf dem sie wohnen, verlassen. 1<br />
Immer mehr Erwerbstätige in Österreich pendeln 1<br />
~ 2,41 Mio.<br />
1971<br />
+ 12,9 %<br />
~ 2,72 Mio.<br />
1981<br />
+ 9,9 %<br />
~ 2,99 Mio.<br />
1991<br />
+ 11 %<br />
~ 3,33 Mio.<br />
2001<br />
+ 4,8 %<br />
~ 3,49 Mio.<br />
2009<br />
Gesamt von<br />
1971 – 2009:<br />
+ 45 %<br />
Die Anzahl der H<strong>aus</strong>halte steigt, in denen es mindestens eine Jahreskarte für öffentliche Verkehrsmittel<br />
gibt. 1 Im Jahr 1989 besitzen 19% der H<strong>aus</strong>halte Österreichs eine Jahreskarte. 20 Jahre später – 2009 – sind es 24 %.<br />
Keine Jahreskarte<br />
19 % 24 %<br />
Wien<br />
Vorarlberg<br />
Salzburg<br />
Oberösterreich<br />
Niederösterreich<br />
Steiermark<br />
Tirol<br />
Kärnten<br />
Burgenland<br />
40 %<br />
27 %<br />
21 %<br />
21 %<br />
21 %<br />
17 %<br />
16 %<br />
13 %<br />
9 %<br />
Jahreskartenbesitzer in absoluten Zahlen<br />
2006<br />
322.317 Salzbu rg 2006 4.696<br />
2007<br />
334.574 +4 %<br />
2007 4.756 +1 %<br />
2008<br />
341.030 +2 %<br />
2008 5.210 +9,5 %<br />
2009<br />
345.508 +1 %<br />
2009 6.740 +29 %<br />
2010<br />
355.838 +3 %<br />
2010 7.443 +10 %<br />
2011<br />
373.000 +5 %<br />
2011 8.854 +19 %<br />
Juli 2012<br />
447.000 +20 %<br />
Quelle: Salzburger Verkehrsverbund<br />
Quelle: Wiener Linien GmbH & Co KG<br />
1965 hatten 11 % der Geamtbevölkerung<br />
einen PKW, im Juni 2012 bereits 53 % . 1<br />
Wien<br />
Stuttg<br />
art<br />
2002 82.215<br />
2012<br />
108.428 +32 %<br />
Quelle: Verkehrs- & Tarifverbund<br />
Stuttgart GmbH (VVS)<br />
Die Zahl der Fahrradbesitzer hat in den vergangenen<br />
Jahren wieder zugenommen. 2010 gab es in<br />
76 % der H<strong>aus</strong>halte mindestens ein Fahrrad. 1<br />
Angaben in 1000<br />
68 %<br />
4.441<br />
4.513<br />
1 Quelle: Statistik Austria<br />
<strong>Alles</strong> <strong>aus</strong>. <strong>Alles</strong> <strong>neu</strong>.
Querspur Das Zukunftsmagazin des ÖAMTC<br />
Navigation<br />
Kommunikation<br />
Aufbewahrung<br />
Schutz<br />
Energie<br />
Werkzeug<br />
Orientierung<br />
Glück<br />
Wenn alles<br />
<strong>aus</strong> ist!<br />
Was Sie brauchen,<br />
wenn alles <strong>aus</strong> ist,<br />
um etwas<br />
Neues beginnen<br />
zu können.<br />
32