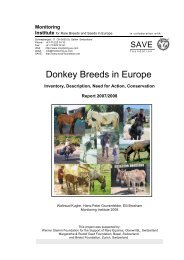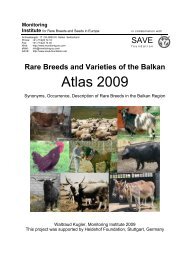- Seite 1 und 2: Landwirtschaftliche Genressourcen d
- Seite 3 und 4: Inhaltsverzeichnis 1. Vorwort 10 2.
- Seite 5 und 6: 12.3. Zusammenfassung des Handlungs
- Seite 7 und 8: 23.2. Wichtige universitäre Einric
- Seite 9 und 10: 1. Vorwort Seit der 1995 erfolgten
- Seite 11 und 12: Aus dieser Erkenntnis heraus entsta
- Seite 13 und 14: Überalterte Obstbaumkulturen sind
- Seite 15 und 16: 2.2.3. Schweiz Rückblick Lücken i
- Seite 17 und 18: • Reben: Das Liechtensteiner Sort
- Seite 19 und 20: Berglandwirtschaft war und ist ein
- Seite 21 und 22: ildung gemacht werden. Die politisc
- Seite 23 und 24: 2.3.2. Italien Vergleich und Rückb
- Seite 25 und 26: Rassen und Schläge mit Gefährdung
- Seite 27 und 28: Rassen und Schläge mit Gefährdung
- Seite 29 und 30: Rassen mit akutem Handlungsbedarf:
- Seite 31 und 32: Schaf Original Steinschaf 40w GP (2
- Seite 33 und 34: Hund Krasevec >1000 GP (2000) ↑ +
- Seite 35: Die in den Jahren 1993/94 erhobenen
- Seite 39 und 40: 3.3.7. Verordnung 1467/94 Die Veror
- Seite 41 und 42: ECP/GR wird durch das IPGRI. koordi
- Seite 43 und 44: Stellen. Es beschafft wissenschaftl
- Seite 45 und 46: Sorten entstanden, die sich zu wahr
- Seite 47 und 48: Selbstversorgerlandwirtschaft brach
- Seite 49 und 50: Die Futterbaubetriebe stellen den g
- Seite 51 und 52: Die Herabsetzung der Preisstützen
- Seite 53 und 54: 4. 2. Schutz der Kulturpflanzen im
- Seite 55 und 56: 4.2.6. Staatliche Institutionen BRG
- Seite 57 und 58: Brassica Arbeitsgruppe: Partner in
- Seite 59 und 60: GENRES 097 - Olive (Olea europea) K
- Seite 61 und 62: 5. Portraits von Organisationen, In
- Seite 63 und 64: EGID Citrus Netzwerk Datenbank Inte
- Seite 65 und 66: Pepinieres Jouve Racamond Adresse:
- Seite 67 und 68: Direktor: Y. Lespinasse Kontaktpers
- Seite 69 und 70: Privatpersonen werden alte Rebensor
- Seite 71 und 72: und Steckrüben (Brassica napus var
- Seite 73 und 74: Frankreich abgedeckt. Die Erhaltung
- Seite 75 und 76: 5.4.3. Handlungsbedarf In den 80er
- Seite 77 und 78: 5.5.4. Akteure Gie Le Biau Germe Ad
- Seite 79 und 80: 5.6.3. Übersicht der Akteure 58 Ö
- Seite 81 und 82: Beschreibung: Die INRA-ENSA in Renn
- Seite 83 und 84: Kontaktperson Schafe und Ziegen: Mm
- Seite 85 und 86: 6.5. Erhaltungsmassnahmen durch die
- Seite 87 und 88:
7. Nutztierrassen im französischen
- Seite 89 und 90:
• Institut de l'Elevage, Mr. Laur
- Seite 91 und 92:
• Institut de l'Elevage, Mme C. D
- Seite 93 und 94:
Initiativen: • Seit 1996 wird dur
- Seite 95 und 96:
7.4.3. Nicht gefährdete Schafrasse
- Seite 97 und 98:
Die Züchtervereinigungen in Frankr
- Seite 99 und 100:
8. Allgemeiner Bericht zu Kulturpfl
- Seite 101 und 102:
genügend (zum Beispiel für Früch
- Seite 103 und 104:
Institutes in Bari ist das Sammeln
- Seite 105 und 106:
Gen Res 97 - Oliven Verantwortlich
- Seite 107 und 108:
• Kartoffeln Verantwortlicher fü
- Seite 109 und 110:
Förderung der Nutzung von alten So
- Seite 111 und 112:
Friaul-J. Ven. 1 2 2 5 Regionen üb
- Seite 113 und 114:
Handlungsbedarf: • Es besteht seh
- Seite 115 und 116:
Brombeeren, Himbeeren, Erdbeeren, M
- Seite 117 und 118:
Birnensorten stammen vermutlich all
- Seite 119 und 120:
Beschreibung: Die Organisation ‘I
- Seite 121 und 122:
Beschreibung: Durch das Südtiroler
- Seite 123 und 124:
ergriffen. Diese sollten auch auf a
- Seite 125 und 126:
Es muss dringend sichergestellt wer
- Seite 127 und 128:
Dort werden Anbauversuche und Sorte
- Seite 129 und 130:
ermöglichen, Suchlisten auf Grund
- Seite 131 und 132:
Adresse: Direttore: Augusto Tocci,
- Seite 133 und 134:
Direktor: Dr. Eugenio Sartori Konta
- Seite 135 und 136:
Lombardei Dipartimento di Produzion
- Seite 137 und 138:
Aostatal 1 1 Piemont 2 1 3 Lombarde
- Seite 139 und 140:
Genauere Informationen zu Slowfood
- Seite 141 und 142:
Peperoni (400 Einträge, 71 aus dem
- Seite 143 und 144:
Übersicht zu Akteuren für die Erh
- Seite 145 und 146:
Beschreibung: Stefan Niederfriniger
- Seite 147 und 148:
Venetien 2 2 Friaul-J. Ven. 1 2 3 R
- Seite 149 und 150:
Aegilops ssp. (Walch) Oryza spp. (R
- Seite 151 und 152:
Beschreibung: In der Region Südtir
- Seite 153 und 154:
Kontaktperson: Prof. Paolo Parrini
- Seite 155 und 156:
Norditalien Land- und Forstwirtscha
- Seite 157 und 158:
10. Allgemeiner Bericht zu Nutztier
- Seite 159 und 160:
und Schweinerassen in dieses Progra
- Seite 161 und 162:
unter verschiedenen Aspekten). Es w
- Seite 163 und 164:
Verantwortlich für Italien: • Un
- Seite 165 und 166:
Schaf- und Ziegenrassen Die Situati
- Seite 167 und 168:
Pinzgauer 938w HB (1999) Vulnerable
- Seite 169 und 170:
hergestellt werden muss, würde ein
- Seite 171 und 172:
• Bayern: Rinderzuchtverband Trau
- Seite 173 und 174:
11.1.5. Autochthone Rinderrassen mi
- Seite 175 und 176:
• Kryokonservierung von Samen und
- Seite 177 und 178:
Initiativen: • Die Population Val
- Seite 179 und 180:
Adresse: ANABoRaPe Rossa Italiana -
- Seite 181 und 182:
Bellunese 130w/m GP (2000) Critical
- Seite 183 und 184:
1991: 30'000 Auen und 215 Widder in
- Seite 185 und 186:
Italienische Alpenregion, Lokalitä
- Seite 187 und 188:
Verbreitung: Region: Lombardei (Pro
- Seite 189 und 190:
Entwicklungstrend: Abnehmend Bewert
- Seite 191 und 192:
Sambucana Synonyme: Demontina, Dema
- Seite 193 und 194:
Bestand: 1994: 34'000 Tiere in der
- Seite 195 und 196:
11.2.7. Schafrassen und -population
- Seite 197 und 198:
Kontaktadressen: • Dipartimento Z
- Seite 199 und 200:
• Associazione della Pecora Brina
- Seite 201 und 202:
chiaro). Von den Camosciata comune
- Seite 203 und 204:
Alpweiden. Im Winter werden sie im
- Seite 205 und 206:
Region: Nördliche Lombardei, Lokal
- Seite 207 und 208:
• Dipartimento Zootechniche, Univ
- Seite 209 und 210:
Entwicklungstrend: Stabil Bewertung
- Seite 211 und 212:
11.3. Pferde und Esel 11.3.1. Allge
- Seite 213 und 214:
Verbreitung: Region: Südtirol, Fri
- Seite 215 und 216:
Cavallo Trottatore Synonyme: Trotta
- Seite 217 und 218:
• Pietrain • Spottet (Synonym:
- Seite 219 und 220:
• Die Organisation Slowfood förd
- Seite 221 und 222:
• ENCI - Ente Nazionale della Cin
- Seite 223 und 224:
12. Allgemeiner Bericht zu Kulturpf
- Seite 225 und 226:
Nutzungsprogrammen vor Ort und die
- Seite 227 und 228:
• Ökologische Ausgleichsflächen
- Seite 229 und 230:
• Zusammenführung und Aktualisie
- Seite 231 und 232:
• GUB (französisch: AOC): Die Ge
- Seite 233 und 234:
12.2.2. Beteiligung der Schweiz an
- Seite 235 und 236:
13. Erhaltung von Kulturpflanzen im
- Seite 237 und 238:
Hochstämmer). Kirschen spielten be
- Seite 239 und 240:
Wildobst Es besteht Handlungsbedarf
- Seite 241 und 242:
• Kirschen: 69 Sorten • Pflaume
- Seite 243 und 244:
Organisationstyp: Privat Landschaft
- Seite 245 und 246:
Zusätzliche Absicherung der erhalt
- Seite 247 und 248:
allen voran die Johannisbeere, welc
- Seite 249 und 250:
Folgende Beerenarten sind im Sorten
- Seite 251 und 252:
13.3.3. Handlungsbedarf Inventarisi
- Seite 253 und 254:
Kontaktperson: C. Blaser, F. Manco
- Seite 255 und 256:
13.4.5. Handlungsbedarf Zentralschw
- Seite 257 und 258:
Rhonegebiet inventarisiert. Es best
- Seite 259 und 260:
Teilen der Innerschweiz. Die damali
- Seite 261 und 262:
Adresse Italienische Schweiz: Voce
- Seite 263 und 264:
Adresse: Case postale, 6, 1292 Cham
- Seite 265 und 266:
13.6.3. Handlungsbedarf Suchaktione
- Seite 267 und 268:
Organisationstyp: Staatlich Eidgen
- Seite 269 und 270:
Handlungsbedarf: • Sortengarten i
- Seite 271 und 272:
Die Hülsenfruchtsammlung von Pro S
- Seite 273 und 274:
• Buchweizen wurde traditionell i
- Seite 275 und 276:
Hand sogenannt unbedeutende Arten E
- Seite 277 und 278:
Verarbeitung geprüft. Ein speziell
- Seite 279 und 280:
Die geförderten Sorten stammen aus
- Seite 281 und 282:
im Rahmen des Nationalen Aktionspla
- Seite 283 und 284:
Beschreibung: Die ArGe Bergkräuter
- Seite 285 und 286:
Adresse: Centre de Recherches sur l
- Seite 287 und 288:
Freilichtmuseum Ballenberg Adresse:
- Seite 289 und 290:
Beschreibung: Im Sortengarten Ersch
- Seite 291 und 292:
14.2.2. Züchterverein für ursprü
- Seite 293 und 294:
14.5. Nationale Organisation Schwei
- Seite 295 und 296:
Förderung von international gefäh
- Seite 297 und 298:
Rasse Bestand** Gefährdungsgrad Tr
- Seite 299 und 300:
Handlungsbedarf: Der Handlungsbedar
- Seite 301 und 302:
15.2.3. Gefährdete Rassen aus dem
- Seite 303 und 304:
Kontaktadresse: • Schweizerischer
- Seite 305 und 306:
Verbreitung: Ganze Schweiz Initiati
- Seite 307 und 308:
15.3.3. Anerkannte, nicht gefährde
- Seite 309 und 310:
Der Handlungsbedarf wird nicht wahr
- Seite 311 und 312:
Pfauenziege Synonyme: Prättigauer
- Seite 313 und 314:
• Im Rahmen des nationalen Aktion
- Seite 315 und 316:
2001: ca. 100 Herdbuchtiere bei 12
- Seite 317 und 318:
Frühere Namen: Einsiedler, Entlebu
- Seite 319 und 320:
In Deutschland und Frankreich gibt
- Seite 321 und 322:
Schweizerisches Veredeltes Landschw
- Seite 323 und 324:
• Der 1999 gegründeten ZUN - Zü
- Seite 325 und 326:
und kulturelle Erbe weiterzüchten
- Seite 327 und 328:
Bestand: 2001: 80-100 reinrassige V
- Seite 329 und 330:
16. Fürstentum Liechtenstein 16. 1
- Seite 331 und 332:
• Landesverwaltung des Fürstentu
- Seite 333 und 334:
17. Allgemeiner Bericht zu Kulturpf
- Seite 335 und 336:
ekommen sie von staatlicher Seite a
- Seite 337 und 338:
Leiter der Genbank: Prof. Dr. Andre
- Seite 339 und 340:
Beta Arbeitsgruppe: Partner in Deut
- Seite 341 und 342:
GEN RES #34-#45: Kartoffel Sub-Koor
- Seite 343 und 344:
Kontakt: Bundesgeschäftsstelle, Me
- Seite 345 und 346:
18. Portraits von Organisationen, I
- Seite 347 und 348:
erwähnen (RSG der LWK in Hannover
- Seite 349 und 350:
grösste Aufmerksamkeit. Die Erhalt
- Seite 351 und 352:
Beschreibung: Anton Bauer in Jarzt
- Seite 353 und 354:
Organisationstyp: parastaatlich Akt
- Seite 355 und 356:
-Untersuchungsauftrag (MLR Baden-W
- Seite 357 und 358:
18.2.4. Handlungsbedarf Im bayerisc
- Seite 359 und 360:
Im östlichen Alpenraum wurden Mohr
- Seite 361 und 362:
Es wäre dringend nötig, diesen Or
- Seite 363 und 364:
Institut für Pflanzengenetik und K
- Seite 365 und 366:
Alpenraum vorhanden. Bei der Erbse
- Seite 367 und 368:
Winterweizen für Gebirgs- und rauh
- Seite 369 und 370:
Institut für biologisch-dynamische
- Seite 371 und 372:
lungen enthalten praktisch keine Pf
- Seite 373 und 374:
Bundesanstalt für Züchtungsforsch
- Seite 375 und 376:
Leiterin: Evelin Willner Kontaktper
- Seite 377 und 378:
Adresse: Bayerisches Staatsminister
- Seite 379 und 380:
• Allgäuer Herdbuchgesellschaft,
- Seite 381 und 382:
• Diese Rasse wird durch das Bund
- Seite 383 und 384:
• Züchterische Betreuung und Her
- Seite 385 und 386:
Gelbvieh Initiativen: • Kryokonse
- Seite 387 und 388:
• Weil es sich um eine grenzüber
- Seite 389 und 390:
• Slowenien: Mag. Drago Kompan, U
- Seite 391 und 392:
20.5. Tauben 20.5.1. Autochthone Ta
- Seite 393 und 394:
21. Allgemeiner Bericht zu Kulturpf
- Seite 395 und 396:
Die Sammlung des Amtes der Tiroler
- Seite 397 und 398:
verloren, wird auch unweigerlich di
- Seite 399 und 400:
Gemüse inklusive Zierpflanzen und
- Seite 401 und 402:
• Zwiebel (Allium cepa): Gelbe La
- Seite 403 und 404:
- Amt der Tiroler Landesregierung,
- Seite 405 und 406:
Weitere Informationen finden sich a
- Seite 407 und 408:
vorhandenen Sortengärten sind nich
- Seite 409 und 410:
22. Portraits von Organisationen, I
- Seite 411 und 412:
22.1.5. Akteure Arche Noah Adresse:
- Seite 413 und 414:
Organisationstyp: Nicht-Regierungs-
- Seite 415 und 416:
22.2.2. Traditionell angebaute Rebe
- Seite 417 und 418:
Von Gatersleben (D) ging eine Samme
- Seite 419 und 420:
Aktiv seit: 1980 Anzahl Mitarbeiter
- Seite 421 und 422:
erwies sich als identisch mit dem a
- Seite 423 und 424:
Versuchsstation für Spezialkulture
- Seite 425 und 426:
Alpenraum. Solche Nacktgersten wurd
- Seite 427 und 428:
Dinkel (Triticum spelta) 10 Sorten
- Seite 429 und 430:
Langzeiterhaltung: ja 22.7. Heilpfl
- Seite 431 und 432:
traditionell im österreichischen A
- Seite 433 und 434:
23. Allgemeiner Bericht zu Nutztier
- Seite 435 und 436:
23.3.4. Aufgabe der Landesverbände
- Seite 437 und 438:
24. Nutztierrassen im österreichis
- Seite 439 und 440:
• Österreichisches Gelbvieh •
- Seite 441 und 442:
• Kärntner Blondviehzuchtverein,
- Seite 443 und 444:
• Der VEGH ist nicht mehr für di
- Seite 445 und 446:
1999: 392 weibliche und 8 männlich
- Seite 447 und 448:
• Verband niederösterreichischer
- Seite 449 und 450:
• Der Verband niederösterreichis
- Seite 451 und 452:
Hintergrund: Wollschweine werden au
- Seite 453 und 454:
24.4.3. Gängige Schweinerassen in
- Seite 455 und 456:
• Italien: Verband Südtiroler Kl
- Seite 457 und 458:
Bestand: 2000: ca. 40 Muttertiere b
- Seite 459 und 460:
Bewertung: Endangered Handlungsbeda
- Seite 461 und 462:
Jahrhundert neben dem Hauptverbreit
- Seite 463 und 464:
Steirische Scheckenziege Hintergrun
- Seite 465 und 466:
Handlungsbedarf: Der Handlungsbedar
- Seite 467 und 468:
• Dänemark: Kennel Pinschergarde
- Seite 469 und 470:
Kärntner Biene Synonyme: Graue Kra
- Seite 471 und 472:
Naturwissenschaft und Technologie f
- Seite 473 und 474:
AJDA - Drustvo za biolosko-dinamicn
- Seite 475 und 476:
Kartoffel Arbeitsgruppe: Partner in
- Seite 477 und 478:
26. Portraits von Organisationen, I
- Seite 479 und 480:
Beschreibung: Die Union of Slovenia
- Seite 481 und 482:
Sorten zu finden, da sie häufig se
- Seite 483 und 484:
Lokalsorte gezüchtet wurde. Danebe
- Seite 485 und 486:
Union of Slovenian Organic Farmers
- Seite 487 und 488:
mit dem Sortiment aus dem österrei
- Seite 489 und 490:
26.5.3. Übersicht zu den Akteuren
- Seite 491 und 492:
Organisationstyp: parastaatlich Akt
- Seite 493 und 494:
Direktor: Slavko Gliha Kontaktperso
- Seite 495 und 496:
Von den in der offiziellen Sortenli
- Seite 497 und 498:
für die Haltung im Ursprungsgebiet
- Seite 499 und 500:
• Slovene Association of Small Ru
- Seite 501 und 502:
28.2. Rinder 28.2.1. Allgemeine Inf
- Seite 503 und 504:
28.3.2. Autochthone Pferderassen Li
- Seite 505 und 506:
Hintergrund: Die Posavski Pferde si
- Seite 507 und 508:
Es existiert kein Erhaltungsprogram
- Seite 509 und 510:
• University of Ljubljana (s. unt
- Seite 511 und 512:
28.7. Hunde 28.7.1. Allgemeine Info
- Seite 513 und 514:
Kontaktadressen: • University of
- Seite 515 und 516:
genetischen Marker zu finden, welch
- Seite 517 und 518:
(16bis, Boulevard Cote Blatin, 6300
- Seite 519 und 520:
- Recchia, E.; Parente, A.: La dive
- Seite 521 und 522:
59) Gandini, G.; Caroli, A.; Catell
- Seite 523 und 524:
• Pro Specie Rara: Herbstaktion S
- Seite 525 und 526:
77) Deutsche Gesellschaft für Züc
- Seite 527 und 528:
106) Körber-Grohne, U.: Nutzpflanz
- Seite 529 und 530:
• Kainz, W.: Österreichische Gen
- Seite 531 und 532:
151) Kompan, D.; Salehar, A.; Holcm
- Seite 533:
• Finger, K.H.: Hirten- und Hüte


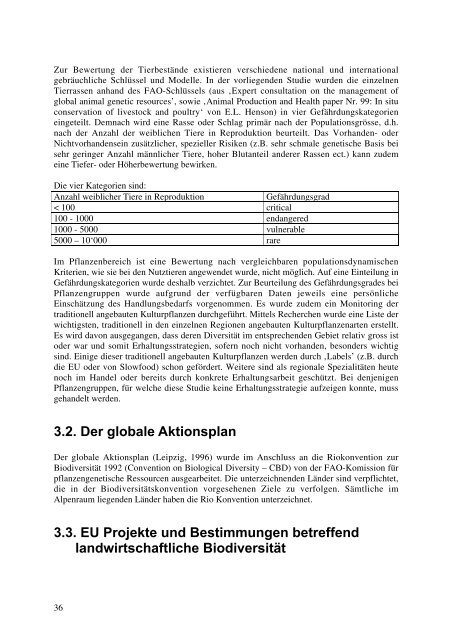
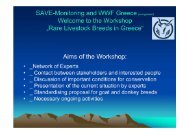

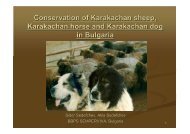


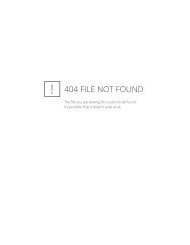
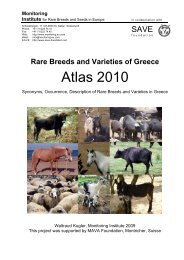


![Busha AL 2013 [Kompatibilitätsmodus] - Agrobiodiversity-Net](https://img.yumpu.com/35252125/1/190x135/busha-al-2013-kompatibilitatsmodus-agrobiodiversity-net.jpg?quality=85)