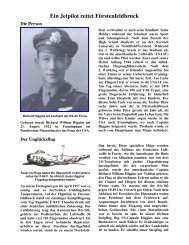„Gina“ – eine heiße Liebe! - Gemeinschaft JaboG 49
„Gina“ – eine heiße Liebe! - Gemeinschaft JaboG 49
„Gina“ – eine heiße Liebe! - Gemeinschaft JaboG 49
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>„Gina“</strong> <strong>–</strong> <strong>eine</strong> <strong>heiße</strong> <strong>Liebe</strong>!<br />
Geschichtliche Hintergründe - ein Beitrag von Henning Remmers<br />
Eine G. 91 R.4 mit den zwei Öffnungen auf der rechten Seite des Rumpfbugs für die Browning MGs.<br />
Insgesamt wurden 50 Flugzeuge dieser <strong>„Gina“</strong>-Variante beschafft und bei der WaSLw 50 eingesetzt.<br />
Die abgebildete Maschine ging mit 39 weiteren R.4s im Frühjahr 1966 an die Portugiesische Luftwaffe.<br />
Jedes Militärflugzeug ist ein Kind s<strong>eine</strong>r Zeit,<br />
Ausdruck wandelbarer Anschauungen über<br />
den Einsatz von Luftstreitkräften und<br />
Umsetzung in anwendbare Formen. Die Fiat<br />
G. 91 war kein Flugzeug <strong>eine</strong>r „klassischen“<br />
Rolle, also kein Jäger oder Bomber, sie war die<br />
Konsequenz aus den Erfahrungen des zweiten<br />
Weltkriegs und des Koreakriegs. „Luftnahunterstützung“<br />
war <strong>eine</strong> neue Einsatzrolle,<br />
wurde aber von den damals existierenden<br />
Flugzeugtypen nur in Nebenfunktion wahrgenommen.<br />
Die Entwicklung favorisierte zunächst<br />
das schwere Jagdbomberflugzeug, z. B.<br />
die F-84 Thunderstreak und F-105 Thunderchief,<br />
dessen Aufgabe darin bestand, Ziele im<br />
Hinterland des Gegners zu bekämpfen. Für<br />
den direkten Unterstützungseinsatz im<br />
taktischen Gefechtsraum im Zusammenwirken<br />
mit den Landstreitkräften waren sie zu<br />
unbeweglich und zu teuer. Aus diesen<br />
Erkenntnissen heraus entstand die Forderung<br />
an die Konstruktion <strong>eine</strong>s leichten Jagdbomberflugzeugs,<br />
das von kl<strong>eine</strong>n, behelfsmäßigen<br />
Plätzen <strong>–</strong> auch mit Grasoberfläche <strong>–</strong><br />
aus operieren sollte. 1953 regte die NATO die<br />
Entwicklung <strong>eine</strong>s solchen Flugzeugs an:<br />
Fluggewicht nicht mehr als 5,5 Tonnen, <strong>eine</strong><br />
Geschwindigkeit von maximal 0,95 Mach,<br />
Start- und Landestrecke auf fester Grasnarbe<br />
von höchstens 800 bis 1.000 Meter, Flugdauer<br />
ca. <strong>eine</strong> Stunde, Bewaffnung vier Maschinengewehre<br />
mit <strong>eine</strong>m Kaliber von 12,7 Millimetern<br />
oder zwei Bordkanonen sowie Außenlasten<br />
bis 500 Kilogramm in Form von<br />
Bomben und/oder Raketen. Am 3. Juni 1955<br />
wurde von <strong>eine</strong>r Beraterkommission aus acht<br />
eingereichten Entwürfen der Vorschlag der<br />
Firma Fiat Aviazione in Turin als Sieger<br />
ermittelt. 14 Monate später, am 9. August<br />
1956, startete der erste von drei gebauten<br />
Prototypen, ein Jahr später begann Fiat mit<br />
der Produktion des Flugzeugs. Im Sommer<br />
1959 fanden in Norditalien die taktischen<br />
Erprobungen statt, die den Wert der G. 91<br />
vom operativen Gesichtspunkt aus unter<br />
Beweis stellten. NATO-Beobachter waren von<br />
den Leistungen dieses leichten Jagdbombers so<br />
beeindruckt, dass sie <strong>–</strong> nach dem ebenfalls abgeschlossenen<br />
Vergleichsfliegen in Frankreich<br />
<strong>–</strong> den NATO-Staaten den Ankauf oder Lizenzbau<br />
des Waffensystems FIAT G. 91 empfahlen.
Die G. 91 R.3 in der Luftwaffe<br />
Die Fiat G. 91 war ursprünglich für den Einsatz<br />
von Graslandeplätzen vorgesehen.<br />
Die Bundesluftwaffe erhielt die ersten beiden -<br />
noch von FIAT gefertigten <strong>–</strong> G. 91 R/3’s im<br />
September 1960. An ihnen wurde das für den<br />
Flugbetrieb erforderliche technische Personal<br />
ausgebildet, gleichzeitig wurde aber auch An-<br />
Frühjahr 1961 mit der Umschulung der ersten<br />
Fluglehrer bei der Waffenschule der Luftwaffe<br />
(WaSLw) 50, damals noch in Erding stationiert,<br />
begonnen. Bereits am 20. Juni 1961<br />
hob die erste in Deutschland gebaute G. 91<br />
mit der militärischen Kennung ED + 101 vom<br />
Werksflugplatz Oberpfaffenhofen bei<br />
München ab. Der erste mit der von den Piloten<br />
bald <strong>„Gina“</strong> genannten G. 91 R.3 aufgestellte<br />
Verband war das Aufklärungsgeschwader 53<br />
(AG 53). Das Geschwader wurde im Oktober<br />
1961 in Erding gegründet, der eigentliche<br />
Standort war jedoch Leipheim bei Ulm, wo es<br />
Das Flugzeug und s<strong>eine</strong> Technik<br />
Anfang 1968 erhielten die Flugzeuge der Bundeswehr<br />
<strong>eine</strong> Vierzahlenkombination, die auch bei<br />
<strong>eine</strong>m Verbandswechsel bestehen blieb.<br />
Die ursprüngliche Forderung bei der Ausschreibung<br />
im Jahre 1953 sah ein r<strong>eine</strong>s<br />
Erdkampfunterstützungsflugzeug in Leicht-<br />
nach Abschluss der Ausbauarbeiten offiziell<br />
im Mai 1962 in Dienst gestellt wurde. Die<br />
Maschinen trugen anfangs die militärischen<br />
Kennungen EC + … mit <strong>eine</strong>m dreistelligen<br />
Zahlencode. Nachdem Griechenland und die<br />
Türkei ihr anfängliches Interesse an der „91“<br />
verloren hatten, erhielt die Luftwaffe 50<br />
Flugzeuge von der G. 91 Version R.4, die von<br />
der Waffenschule der Luftwaffe 50 in Erding<br />
übernommen wurden. Die bis 1966 übrig gebliebenen<br />
40 Maschinen mit vier fest eingebauten<br />
Browning-Maschinengewehren des<br />
Kalibers 12,7 Millimetern wurden an Portugal<br />
verkauft. In den Jahren 1960 bis 1966 erhielt<br />
die Luftwaffe insgesamt 344 G. 91 R/3, mit<br />
denen die WaSLw 50 in Erding, später<br />
Fürstenfeldbruck (Kennungen BD + …), und<br />
die Leichten Kampfgeschwader (LeKG) 41 in<br />
Husum (MA + …), LeKG 42 in Pferdsfeld<br />
(MB + …), LeKG 43 in Oldenburg (MC + …)<br />
und LeKG 44 in Leipheim (MD + …) ausgerüstet<br />
wurden. Ende 1967 änderte sich diese<br />
Buchstaben-/Zahlenkombination mit Zuordnung<br />
für die jeweiligen Verbände in <strong>eine</strong><br />
Vierzahlenkombination, die für die gesamte<br />
Lebensdauer des individuellen Flugzeugs<br />
Bestand hatte. Das Waffensystem G. 91 erhielt<br />
die Kennziffer „3“ als erste Zahl. Sämtliche<br />
Flugzeuge des Typs R/3 führten als zweite<br />
Ziffer die Zahlen „0“, „1“, „2“ oder „3“ <strong>–</strong> nur<br />
die zweisitzige Variante G-91 T/3 führte als<br />
zweite Ziffer ausschließlich die Ziffer „4“.<br />
bauweise vor. Auf Grund der von der<br />
Deutschen Luftwaffe beabsichtigten Doppelrolle<br />
wurden für den Aufklärungszweck<br />
zusätzlich drei Kameras in der Rumpfnase<br />
eingebaut. Wegen weiterer Veränderungen<br />
wurde die deutsche R.3 um fast 500 Kilogramm<br />
schwerer als die italienische Version<br />
R.1. Dieser Gewichtszuwachs rührte zum Teil<br />
auch von der Panzerung her, die den Flugzeugführer<br />
speziell bei leichtem Beschuss von<br />
unten schützen sollte. Das britische Triebwerk<br />
von Bristol-Siddeley, Orpheus MK. 803 D11,<br />
lieferte genügend Schub, um dem Flugzeug<br />
<strong>eine</strong> hohe Unterschallgeschwindigkeit zu<br />
verleihen. Die Feuerkraft der <strong>„Gina“</strong> war<br />
beachtlich, mit ihren zwei DEFA-Bordkanonen<br />
mit <strong>eine</strong>m Kaliber von 30 Millimetern<br />
konnten verschiedene Munitionsarten
verschossen werden. Von den vier Außenstationen<br />
unter den Tragflächen waren die<br />
inneren beiden Pylonen zur Aufnahme von<br />
Zusatztanks ausgelegt und die äußeren beiden<br />
dienten als Träger verschiedener Arten von<br />
Abwurfwaffen, wie Bomben und ungelenkte<br />
Raketen. Wahlweise konnten aber auch an die<br />
inneren Stationen Waffen gehängt werden,<br />
jedoch war damit <strong>eine</strong> geringe Reichweite<br />
Die <strong>„Gina“</strong> aus Sicht des Piloten Fritz Morgenstern<br />
Piloten und ihre besondere Beziehung zur <strong>„Gina“</strong><br />
war allseits bekannt !<br />
Die G. 91 war als durchweg konventionelle<br />
Konstruktion für den Unterschallbereich ein<br />
relativ „schnelles“ Flugzeug s<strong>eine</strong>r Klasse.<br />
Bei recht hoher Flächenbelastung verfügte sie<br />
(außer den Landeklappen für den extremen<br />
Langsamflug) über k<strong>eine</strong>rlei Hochauftriebshilfen<br />
im taktischen Einsatz, wie z. B.<br />
Vorflügel (Slats) oder Manöverklappen.<br />
Für den Piloten hieß das, möglichst „hohe“<br />
Geschwindigkeiten zu halten und bei Unterschreiten<br />
der 300 Knoten Grenze taktische<br />
Manöver abzubrechen, um sie gegebenenfalls<br />
wieder neu anzusetzen. Hinzu kam das Fehlen<br />
<strong>eine</strong>r Anstellwinkelanzeige (AOA) oder <strong>eine</strong>s<br />
künstlichen Strömungsabrißwarners (Stallwarning).<br />
Der Flugzeugführer musste die<br />
<strong>„Gina“</strong> mit ständigem Blick auf den<br />
Fahrtmesser nach Gefühl fliegen und auf<br />
natürliche Stall-Warnungen (die im höheren<br />
Geschwindigkeitsbereich deutlich, aber z. B.<br />
im Landeanflug kaum wahrnehmbar waren)<br />
gefasst sein. Diesen Sachverhalt begriffen zu<br />
haben kennzeichnete den Piloten <strong>eine</strong>r G. 91.<br />
Die hohe Flächenbelastung und die darauf<br />
beruhende „Schnelligkeit“ der Maschine zeigte<br />
sich auch in der hohen Landegeschwindigkeit<br />
von 140 Knoten plus je fünf Knoten pro 500<br />
verbunden. Als Außentanks standen entweder<br />
die kl<strong>eine</strong>ren Behälter mit 260 Litern Inhalt,<br />
oder Tanks mit dem doppelten Volumen von<br />
520 Litern Kerosin der Sorte JP-4 zur<br />
Verfügung. Im Routineflugbetrieb und im<br />
Rahmen der Ausbildung wurden zur<br />
Reichweitenerhöhung nahezu ausnahmslos die<br />
größeren Kraftstoffbehälter (520 Ltr) verwendet.<br />
Pounds Treibstoff (oder sonstige Zuladung) im<br />
Endanflug. Der Pilot hatte für s<strong>eine</strong> Landung<br />
nur den Fahrtmesser und sein Gefühl „im<br />
Hintern“. Obwohl für den taktischen Einsatz<br />
im Tiefflug konzipiert, hatte die G. 91 respektable<br />
Höhenflugeigenschaften. Für Überlandflüge<br />
habe ich prinzipiell versucht, als<br />
Reiseflughöhe 380, entsprechend rund 38.000<br />
Fuß, zu planen, so kam man bei der relativ<br />
geringen Spritzuladung auf brauchbare Reichweiten.<br />
Die Geschwindigkeit in solchen Höhen<br />
betrug Mach 0,86, was zugleich so ziemlich die<br />
Höchstgeschwindigkeit darstellte. Im Tiefflug<br />
erreichte die <strong>„Gina“</strong> ohne Außenlasten bis zu<br />
550 Knoten, mit Außenlasten betrug die<br />
Kampfgeschwindigkeit 400 Knoten. Ursprünglich<br />
war die G. 91 mit <strong>eine</strong>m Triebwerk ausgestattet,<br />
das angeblich für <strong>eine</strong>n Marschflugkörper<br />
vorgesehen und entsprechend einfach<br />
konstruiert war. Näheres ist mir nicht bekannt.<br />
Jedenfalls kam es mit diesem Antrieb<br />
wohl häufig zu Bränden und es wurde bereits<br />
1961/62 ersetzt (bei m<strong>eine</strong>r Ankunft in Erding<br />
Ende 1961 gab es m<strong>eine</strong>s Wissens noch k<strong>eine</strong><br />
einsatzbereiten G. 91 mit neuem Triebwerk).<br />
Der dann verwendete Antrieb Orpheus<br />
MK. 803 D11 war ein großer Spritsäufer<br />
(nach heutigen Maßstäben) und wurde durch<br />
<strong>eine</strong> relativ komplizierte Regeleinstellung<br />
(Fuel-Control) für den Betrieb am Boden bis<br />
in große Höhen recht zuverlässig geregelt. Die<br />
komplexe Regelung machte ein Notregelgerät<br />
erforderlich (Emergency Fuel Control). Zwei<br />
Eigenschaften sind noch als bemerkenswert zu<br />
erwähnen: Einmal die kurze Beschleunigungszeit<br />
des Triebwerks von Leerlauf 35% auf<br />
100% Leistung (Military) in zwei Sekunden im<br />
Stand und in dreieinhalb Sekunden im Langsamflug.<br />
Zum anderen die Triebwerksstarteinrichtung<br />
mittels pyrotechnischer Kartusche,<br />
die das Antriebsaggregat zuverlässig innerhalb<br />
von Sekunden auf Leerlaufbetrieb brachte<br />
ohne dabei die Batterie zu belasten. Das
edeutete <strong>eine</strong> hohe Reaktionsgeschwindigkeit<br />
bei extrem geringem Aufwand. Kartusche in<br />
die <strong>eine</strong>, Büchse Öl in die andere Tasche <strong>–</strong> das<br />
war’s! Es gilt noch die Bremsen zu erwähnen,<br />
die im ursprünglichen Zustand, mit Schlauchreifen<br />
kombiniert, nur ungenügend leistungsfähig<br />
waren. Ohne konstruktionsmäßig an der<br />
Maschine etwas zu ändern, erprobte man<br />
erfolgreich dickere Bremspakete mit höherer<br />
Der Arbeitsplatz des <strong>„Gina“</strong>-Piloten<br />
Einblick in den Arbeitsplatz des <strong>„Gina“</strong>-Piloten.<br />
Das Cockpit der G. 91 war, verglichen mit<br />
anderen Militärflugzeugen wie z. B. Starfighter,<br />
Tornado oder Alpha Jet bei weitem<br />
das bequemste, was ich kennen gelernt habe.<br />
Es war geräumig und der Schleudersitz<br />
(Martin Baker MK 4, später MK 6 mit<br />
Raketenpack) hatte Platz und war vom<br />
Sitzkomfort her (und das war eminent wichtig<br />
beim Einsatzauftrag der G. 91) ausgezeichnet.<br />
Die Anordnung der Instrumente und Bedienelemente<br />
wurde um 1968 herum völlig neu<br />
gestaltet und ergab danach auf diesem Gebiet<br />
ein weitgehend „perfektes“ Cockpit-Layout.<br />
Grund für diese Umgestaltung war u. a. die<br />
sehr ungünstige Anordnung der Kamera-<br />
Wärmeableitung und führte schlauchlose<br />
Reifen ein. Damit war das Flugzeug mit<br />
geringen Mitteln in diesem Punkt ausreichend<br />
leistungsfähig und konnte, wenn man es<br />
richtig machte, ohne Betätigung des Bremsschirmes<br />
auf 3.000 bis 3.500 Fuß Ausrollstrecke<br />
zum Stehen gebracht werden <strong>–</strong> aber<br />
nur, wenn man es richtig machte… !<br />
schaltung (vorn unten, hinter dem Steuerknüppel),<br />
sowie die Anordnung der Waffenschalter<br />
und des Radios. Zugleich wurde die<br />
Anordnung der Hauptfluglage- und Navigationsinstrumente<br />
auf NATO-Standard<br />
(STANAG = Standardization Agreement)<br />
gebracht und es war ein Segen für den Mann<br />
im Cockpit <strong>eine</strong>r völlig manuell zu fliegenden,<br />
wenig stabilen Maschine, wenn er im schweren<br />
Wetter auf <strong>eine</strong>n Punkt konzentriert die<br />
Flugrichtung (Kurs) und die Fluglage (Quer-<br />
und Nicklage) verfolgen und damit halten<br />
konnte. Das wurde erzielt, indem ein großer,<br />
plattformgesteuerter künstlicher Horizont<br />
direkt über der kombinierten Kurs- und<br />
TACAN-Anzeige platziert wurde. Im Übrigen<br />
wurden ein großer Nothorizont und ein großer<br />
Wendezeiger als Ersatz für die bisherigen<br />
mickrigen zwei Wendezeiger eingebaut. Radio<br />
und Hauptwaffenschalter vorn im Blickfeld<br />
und manche andere kl<strong>eine</strong> Verbesserung <strong>–</strong><br />
damit konnte der Pilot etwas anfangen. Hier<br />
hat sich der inzwischen verstorbene damalige<br />
Major Hein Schepke verdient gemacht. Die<br />
Navigationsausstattung ist ein „abendfüllendes“<br />
Thema für sich. Radio (ARC 34)<br />
und IFF/SIF-Gerät waren bewährte, leidlich<br />
zuverlässige Geräte. Das Fehlen <strong>eine</strong>s zweiten<br />
Flugfunkgerätes war allerdings fatal und für<br />
heutige Verhältnisse undenkbar. Das „bodenunabhängige“<br />
Navigationssystem PHI-3b5,<br />
kombiniert mit <strong>eine</strong>m (recht guten!) Dopplerradar<br />
für die Inputs Ground Speed (wahre<br />
Geschwindigkeit über Grund) und Drift durch<br />
Wind konnte nicht zur Einsatzreife gebracht<br />
werden. Neben der damals noch fehlenden<br />
Elektronik war die unzureichende Fehlerentdeckung-<br />
und <strong>–</strong>anzeigemöglichkeit der<br />
wesentliche Grund. Hier ist der inzwischen<br />
verstorbene Navigationslehrer bei der Waffenschule<br />
der Luftwaffe 50, Gerhard Kröchel in<br />
gute Erinnerung zu rufen, der sich außergewöhnlich<br />
um dieses System bemüht hat.
Das PHI konnte nur als Zusatzsystem genutzt<br />
werden und genoss bei den Piloten kein<br />
Vertrauen <strong>–</strong> ganz anders das Doppler-Radargerät,<br />
dessen Abdriftanzeige bei der Tiefflugnavigation<br />
sehr gute Dienste leistete, dessen<br />
Ground-Speed input allerdings nicht angezeigt<br />
wurde und deshalb nicht genutzt werden<br />
konnte. Bemühungen, <strong>eine</strong>n relativ einfach zu<br />
installierenden „Groundspeedindicator“ zu<br />
bekommen, sind leider nie realisiert worden.<br />
Ein trauriges Kapitel war die ursprüngliche<br />
Verwendung des Funkpeilgerätes (Radiokompass)<br />
ADF-102. Das Gerät konnte nicht<br />
zur Einsatzreife in der G. 91 gebracht werden,<br />
was zur Folge hatte, dass die Maschinen jahrelang,<br />
nämlich bis zum Einbau des TACAN-<br />
Gerätes AN/ARN 52, nicht blindflugtauglich<br />
waren. Das dann erfolgreich erprobte<br />
TACAN-Gerät fand s<strong>eine</strong>n Platz im rechten<br />
Bewaffnung des leichten Jabos<br />
Nun zur Bewaffnung, die G. 91 verfügte über<br />
zwei starre Maschinenkanonen des Typs<br />
DEFA 552, Kaliber 30 Millimeter mit je 125<br />
Schuss Munition, <strong>eine</strong> ursprüngliche Mauser-<br />
Entwicklung, die nun in Frankreich gefertigt<br />
wurde. Die doppelsitzige Version der G. 91, die<br />
T.3, hatte zwei Maschinengewehre mit <strong>eine</strong>m<br />
Kaliber von 12,7 Millimetern und die anfänglich<br />
von der Bundesluftwaffe genutzte R.4<br />
hatte deren vier im Rumpfbug eingebaut. Der<br />
Munitionsvorrat, <strong>eine</strong> hohe Feuergeschwindigkeit,<br />
auch Kadenz genannt, und das<br />
wahrhaft respektable Kaliber machte die<br />
DEFA zu <strong>eine</strong>r <strong>–</strong> für ihre Einsatzzwecke der<br />
G. 91 <strong>–</strong> recht brauchbaren Bewaffnung, der<br />
gegenüber der Abwurfmunition aus m<strong>eine</strong>r<br />
Sicht zu wenig Bedeutung beigemessen wurde.<br />
Sie galt als Zusatzbewaffnung und hätte wegen<br />
ihrer Potenz beispielsweise bei der<br />
Bekämpfung von marschierenden Fahrzeugkolonnen<br />
durchaus zur Hauptbewaffnung<br />
Kanonenraum und wurde anstelle des auszuhängenden<br />
Gurtkastens mittels Schnellverschlüssen<br />
eingehängt und angeschlossen <strong>–</strong> <strong>eine</strong><br />
Minutenarbeit ohne Probleme. Diese unter den<br />
Gegebenheiten gute technische Lösung führte<br />
zu der mir unverständlichen „Mär“ (insbesondere<br />
bei den „schweren“ Verbänden, die<br />
gern auf die „Gina-Muckel“ herabsahen), dass<br />
für das TACAN-Gerät die linke Kanone<br />
ausgebaut werden müsse <strong>–</strong> das wäre fürwahr<br />
k<strong>eine</strong> glanzvolle Lösung gewesen. Natürlich<br />
konnte mit eingebautem TACAN-Gerät nicht<br />
geschossen werden und im taktischen Einsatz<br />
musste auf dieses Hilfsmittel verzichtet<br />
werden. Der mit G. 91 vorgesehene taktische<br />
Einsatz musste und konnte bei gutem Training<br />
der Piloten letztlich auf diese Art der<br />
Unterstützung in der Navigation verzichten.<br />
„befördert“ werden können. Als Zusatzbewaffnung<br />
(wahlweise oder kombiniert)<br />
konnten zwei Behälter mit je 19 ungelenkten<br />
Luft-Boden-Raketen vom Kaliber 2,75 inches,<br />
zwei 500 Pfund Mehrzweckbomben und zwei<br />
750 Pfund Feuerbomben an Unterflügelstationen<br />
mitgeführt werden. Die R.3 hatte<br />
vier Unterflügelstationen für Abwurfwaffen<br />
und Raketenbehälter, die T.3 und m<strong>eine</strong>s<br />
Wissens auch die R.4 hatten deren zwei. Hier<br />
ist gleich anzumerken, dass wegen der<br />
„sauberen“ Tragfläche und womöglich wegen<br />
des gestreckten Rumpfes mit der langen<br />
Doppelkabine der zweisitzigen Variante, die<br />
T.3 schneller war als die R/3, was sich<br />
insbesondere in größeren Höhen bemerkbar<br />
machte. Mit ihren vier Unterflügelstationen<br />
konnte die R.3 <strong>eine</strong> beachtliche Feuerkraft<br />
entwickeln, beispielsweise mit 76 ungelenkten<br />
Raketen des Typs FFAR 2,75 „Mighty<br />
Mouse“. Treibstoff konnte nur an den beiden<br />
innen liegenden Lastenträgern, sog. nasse<br />
Stationen, getragen werden. Es standen 500<br />
oder 1.000 Pfund Kraftstoffbehälter zur<br />
Verfügung. Mit letzterem wurde der<br />
Aktionsradius der Maschine nachträglich<br />
gegen Ende der 60er Jahre deutlich verbessert.<br />
Alle drei in der Luftwaffe geflogenen<br />
Versionen hatten <strong>eine</strong> Kameraausrüstung<br />
(R steht für Reconnaissance = Aufklärung und<br />
T für Training). Die sehr funktionstüchtigen,<br />
gleichwohl nur bei Tage einzusetzenden<br />
VINTEN-Kameras waren in den Stellungen
links/rechts geneigt, vorwärts geneigt und<br />
senkrecht einsetzbar. Für die Option Senkrecht<br />
musste <strong>eine</strong>r der quergeneigten<br />
Apparate am Boden in die Senkrechtstellung<br />
geschwenkt werden. Die Kameras konnten<br />
Einzel- und Reihenbilder mit Verschlussgeschwindigkeiten<br />
bis 1/2.000 Sekunde aufnehmen.<br />
Die Bildqualität war gut, Versuche<br />
mit <strong>eine</strong>m Nacht-Blitzgerät in <strong>eine</strong>m gesonderten<br />
Außenbehälter sowie mit <strong>eine</strong>r nach<br />
vorn schräg gerichteten Panoramakamera der<br />
Firma Fairchild führten nicht zur Einsatzreife.<br />
Als Kuriosum wäre zu berichten, dass<br />
mit den beiden quergerichteten Kameras<br />
„nach Gefühl“ visiert werden musste, nachdem<br />
die beiden ursprünglich vorhanden<br />
gewesene klappbaren Fadenkreuzvisiere dem<br />
neuen raketenbestückten Schleudersitz<br />
weichen mussten. Manch <strong>eine</strong>r malte sich sein<br />
Die <strong>„Gina“</strong> im Einsatz<br />
Zwei G. 91 R.3 der WaSLw 50 im engen Verbandsflug.<br />
Bei taktischen Einsätzen war der Abstand der<br />
Maschinen zueinander aber wesentlich größer.<br />
Die G. 91 hatte im taktischen Nahbereich<br />
(Gefechtsfeld) verschiedene Aufgaben zu erfüllen.<br />
Untrennbar verbunden mit der <strong>„Gina“</strong><br />
und ihren Männern sind die Einsatzaufgaben<br />
„Close Air Support“ (Luftnahunterstützung<br />
mit Hilfe <strong>eine</strong>s Fliegerleitoffiziers [FLO]<br />
/Forward Air Controller [FAC]) und „Line<br />
Search“ (Suchen, Aufklären bzw. Bekämpfen<br />
entlang der Marschwege des Gegners). In<br />
diesen Einsatzarten wurde der Pilot mental<br />
und physisch hart gefordert und <strong>–</strong> oft genug <strong>–</strong><br />
überfordert. Alle Beteiligten, nicht zuletzt<br />
auch die FAC’s, können ein Lied davon<br />
singen. Diese außerordentlich fordernde<br />
höchstpersönliches Visier mit Fettstift an das<br />
Kabinendach, aber es ging, bei genügend<br />
Filmdurchlauf, auch ohne. Mit dem Wechsel<br />
der Einsatzrolle von der Aufklärung im AG 53<br />
und AG 54 zum Jagdbombereinsatz wurden<br />
die Kameras nach <strong>eine</strong>r Übergangszeit in der<br />
Zweitrolle Aufklärung entbehrlich. Abschließend<br />
möchte ich anmerken, dass die<br />
Ausbildung und der Einsatz in der Rolle<br />
Aufklärung sehr zum präzisen Fliegen erzogen<br />
und dass ich davon überzeugt bin, insbesondere<br />
auf den nachfolgenden Flugzeugtypen,<br />
sehr profitiert zu haben. Die beiden taktischen<br />
Komponenten der Ausstattung unseres<br />
„Mehrrollen-Flugzeuges“ mit der ursprünglichen<br />
Bezeichnung Light Weight Strike<br />
Reconnaissance = LWSR!) wurden erwähnt,<br />
nun noch einige Worte zum taktischen Einsatz<br />
selbst.<br />
Fliegerei verlangte vom Piloten nicht nur<br />
akrobatische Künste im Tiefflug, sondern auch<br />
das Auge des Adlers und das des Uhus zugleich,<br />
um aus <strong>eine</strong>m Meer von Braun-, Grün-<br />
und Mischtönen <strong>eine</strong>n einzelnen Jeep herauszuschälen,<br />
dem auch noch- möglichst im<br />
Anflug <strong>–</strong> ein präziser Waffen-Pass „zu bieten“<br />
war. Bei dieser Kleinigkeit also kam dem<br />
armen Mann im <strong>„Gina“</strong>- Cockpit die Einfachheit<br />
der Maschine <strong>eine</strong>rseits zupass, denn er<br />
konnte <strong>eine</strong>n Großteil s<strong>eine</strong>r Aufmerksamkeit<br />
der Navigation, dem Ziel und den<br />
Anweisungen des FAC widmen. Andererseits<br />
half ihm das Flugzeug auch nicht, außer dass<br />
es brav funktionierte. Weder irgend<strong>eine</strong><br />
Hochauftriebshilfe, noch <strong>eine</strong> Überziehwarnung<br />
(Stallwarning) hatte sie zu s<strong>eine</strong>r<br />
Unterstützung parat, geschweige denn<br />
Navigationshilfen oder Zielautomaten. Und<br />
vor allem: Es fehlte die Kraftreserve <strong>eine</strong>s<br />
Nachbrenners! Gashebel am Anschlag, gerade<br />
sitzen (gut angeschnallt sowieso!) und „pullen“<br />
war die Devise. Das war ein schneidiges, oft<br />
mit Misserfolgen gewürztes Geschäft, das zu<br />
vielen Stories Anlaß gab. Diejenigen Ginaleute,<br />
die immer nur Erfolg dabei hatten und<br />
dieses lesen, mögen mir m<strong>eine</strong> Ehrlichkeit<br />
nachsehen… .
Abschließende Bemerkungen<br />
Aus m<strong>eine</strong>n Worten über die G. 91 ist<br />
vielleicht herauszulesen, dass man für dieses<br />
einfache, robuste und natürlich häufig überforderte<br />
Flugzeug als Pilot und vielleicht auch<br />
als wackerer Mechaniker, den man bei solchen<br />
Erwägungen nie vergessen darf, durchaus so<br />
etwas wie <strong>eine</strong> stille <strong>Liebe</strong> entwickeln kann.<br />
Die <strong>„Gina“</strong> war prinzipiell gut und ein „Pilot’s<br />
Aircraft“. Sie war <strong>eine</strong> späte Vertreterin der<br />
Flugzeuge der sog. „ersten Generation“ und<br />
musste sich mit den ersten Flugzeugen der<br />
zweiten Generation messen. Sie war für das,<br />
was man von ihr erwartete, zu klein und zu<br />
leicht konzipiert, sie hatte kein Entwicklungspotential,<br />
das noch hätte genutzt werden<br />
können. Diese Eigenschaft hatten übrigens<br />
viele Flugzeuge der damaligen Zeit, auch<br />
solche mit wesentlich „klangvolleren“ Namen.<br />
Die Flugzeuge waren, bis auf Nuancen, zusehends<br />
entwickelt, wenn sie an die Truppe<br />
ausgeliefert wurden. Heute ist das anders.<br />
Beispielsweise ist das Waffensystem Tornado<br />
ein typischer Vertreter <strong>eine</strong>r Flugzeugge-<br />
neration mit „eingebautem Entwicklungspotential“,<br />
d. h. bei s<strong>eine</strong>r Indienststellung hat<br />
es <strong>eine</strong>n bestimmten Entwicklungsstand, der<br />
im Laufe s<strong>eine</strong>r Nutzungszeit beim Militär<br />
kontinuierlich und planmäßig weiterentwickelt<br />
wird. Diese Eigenschaft ist Bestandteil<br />
der Gesamtkonzeption und bedeutet, dass das<br />
Flugzeug den technischen Entwicklungen, die<br />
zur Zeit s<strong>eine</strong>r Auslieferung noch gar nicht<br />
erreicht waren, während s<strong>eine</strong>r Lebensdauer<br />
angepasst werden kann. Das verlängert die<br />
Einsatzzeit und verzögert den technischen<br />
Alterungsprozess erheblich. Trotzdem gab es<br />
auch für die G. 91 die Notwendigkeit, technische<br />
Verbesserungen im kl<strong>eine</strong>n Rahmen<br />
anzustreben und möglichst einzuführen. Für<br />
solche Zwecke gab es bei der Waffenschule der<br />
Luftwaffe 50 in Fursty von 1965 bis 1970 <strong>eine</strong>n<br />
„Lehr- und Versuchsschwarm G. 91“.<br />
Nach der Landung konnte der Pilot mit dem<br />
sog. „aerodynamic braking“ den Einsatz des<br />
Bremsschirmes (Foto unten) vermeiden.<br />
Text: Fritz Morgenstern und Henning Remmers, Fotos: Meyer und Remmers