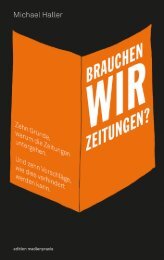200 Jahre
CZ_Jubilaeumsbeilage
CZ_Jubilaeumsbeilage
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Freitag, 7. April 2017<br />
<strong>200</strong> <strong>Jahre</strong> Cellesche Zeitung 17<br />
Die zweite Generation<br />
Johanna Heuer<br />
geb. Schweiger<br />
Johanna Schweiger (1805–1888) wurde als<br />
Tochter von Ignaz und Christine Wilhelmine<br />
Schweiger in Celle geboren. Sie heiratete den<br />
Buchdrucker Friedrich Wilhelm Heuer aus<br />
Hannover, der die Firma Schweiger & Pick 1833<br />
übernahm. Den Titel der Zeitung änderte er<br />
1834 in „Cellesche Anzeigen“. Heuer investierte<br />
ein Vermögen in den oneubau des Hauses und<br />
die oneuausstattung der Druckerei. Doch bereits<br />
1837 starb er im 27. Lebensjahr. Das Paar hatte<br />
zwei Töchter.<br />
Die junge Witwe übernahm nun die<br />
Verantwortung für den Betrieb. Mithilfe eines<br />
Faktors (Werkmeisters), zunächst L. Anholt und<br />
dann K. E. Harder, führte sie das Geschäft über<br />
30 <strong>Jahre</strong> lang. Ernst Pfingsten schrieb dazu<br />
einst: „Sie leitete es in stiller, weiblicher Art,<br />
ohne selbst dabei hervorzutreten. Sie war in<br />
ihrem Wesen behutsam, aber doch umsichtig,<br />
sparsam, aber nicht kleinlich.“<br />
In den politisch aufregenden <strong>Jahre</strong>n 1848<br />
und 1849 öffnete Witwe Heuer das Blatt für<br />
Meinungsbeiträge und Versammlungsberichte,<br />
kehrte aber schnell wieder zur Form des<br />
„braven Intelligenzblattes“ zurück. Erst ab 1862<br />
wurden kurze lokale onachrichten gebracht.<br />
Seit April 1861 erschien der Anzeiger<br />
wöchentlich dreimal: dienstags, donnerstags<br />
und samstags. 1865 wurde eine Schnellpresse<br />
von König & Bauer aufgestellt, die zunächst<br />
aber noch von Hand betrieben wurde.<br />
Dennoch beschleunigte sie den Druckvorgang<br />
entscheidend. Ab Dezember 1866 erschien der<br />
„Cellesche Anzeiger“ auch sonntags, also<br />
viermal pro Woche.<br />
Mittlerweile war das Königreich<br />
Hannover von den Preußen<br />
annektiert und Celle nun<br />
preußische Provinzstadt.<br />
Witwe Heuer mochte es<br />
sich weder mit den neuen<br />
Machthabern noch mit den<br />
welfentreuen Einwohnern<br />
verderben. Sie holte ihren<br />
Schwiegersohn in das<br />
Familienunternehmen und<br />
zog sich zurück. Ab dem<br />
23. Juni 1868 stand Georg<br />
Heinrich Pfingsten als verantwortlicher<br />
Redakteur im<br />
Impressum.<br />
Die dritte Generation<br />
Georg Heinrich Pfingsten<br />
Georg Heinrich Pfingsten wurde am 19. Januar<br />
1813 in Ipswich/England geboren. Sein Vater<br />
Friedrich war Offizier in der „King’s German<br />
Legion“. 1819 wurde Friedrich Pfingsten in den<br />
Ruhestand versetzt und zog mit der Familie<br />
nach Celle. Sie wohnten an der Blumlage. Der<br />
damals sechsjährige Georg Heinrich soll zu<br />
dieser Zeit noch kein Wort Deutsch gesprochen<br />
haben. Mutter Anna starb bereits 1826.<br />
Georg Heinrich wollte Soldat werden, doch der<br />
Vater schickte ihn stattdessen nach Hannover<br />
in eine kaufmännische Lehre. onach fünf harten<br />
Lehrjahren ging er als Gehilfe nach Hamburg,<br />
kehrte dann aber nach Celle zurück. Dort<br />
arbeitete er bei onasemann und Schultz,<br />
bevor er in der Lachendorfer Papierfabrik<br />
anfing. Mit einer der sieben Töchter von<br />
Georg und Elisabeth Drewsen war er sogar vorübergehend<br />
verlobt.<br />
In Lachendorf lief 1846 die erste Papier maschine<br />
an und vervielfachte die Produktion. Georg Heinrich<br />
war 1848 als Handelsreisender für Drewsens<br />
in Kassel. Dann kaufte er ein Haus in Celle und<br />
eröffnete dort ein Papiergeschäft. 1855 heiratete<br />
er die damals 19-jährige Clara Heuer. Sie hatten<br />
drei Kinder: Georg Wilhelm, Hermann und Anna.<br />
Seine Schwiegermutter holte ihn 1868 als<br />
Geschäftsführer zu Schweiger & Pick. Trotz<br />
Pfingstens Hannovertreue bekam die „Cellesche“<br />
im Februar 1869, unter preußischer Regierung,<br />
den wichtigen Status des Kreisblatts. Der<br />
Leserkreis vervielfachte sich.<br />
Georg Heinrich Pfingsten erweiterte<br />
das Blatt in vielerlei Hinsicht<br />
und führte am 2. Februar<br />
1869 den Titel „Cellesche<br />
Zeitung und Anzeigen“<br />
ein. Im April 1869 erschien<br />
die Cellesche erstmals im<br />
sogenannten „Berliner<br />
Format“. Der Lokalteil<br />
wurde weiterentwickelt<br />
und die Rubriken<br />
„Politische onachrichten“<br />
und „Aus der Provinz“<br />
eingeführt. Seit oneujahr<br />
1881 erschien die Zeitung<br />
täglich, außer montags.<br />
Georg Heinrich Pfingsten starb<br />
am 15. Mai 1883.<br />
VVon<br />
Die erste Ausgabe vom Celleschen Anzeiger, erschienen am 2. April 1817. Sie hatte vier Seiten, etwa im Format DIN A5.<br />
Intelligenzblatt<br />
unter Zensur<br />
FloriAon Friedrich<br />
Georg Ernst Friedrich<br />
Schulze versuchte, vermutlich<br />
im Jahr 1814,<br />
das alte Privileg gegen Schweiger<br />
und Pick einzuklagen, hatte<br />
aber versäumt, es zwischenzeitlich<br />
verlängern zu lassen<br />
und wurde abgewiesen. In den<br />
folgenden <strong>Jahre</strong>n wurden vor<br />
allem lokale und juristische<br />
Schriften bei Schweiger & Pick<br />
gedruckt.<br />
Das herausragende Produkt<br />
des Verlages erschien erstmalig<br />
am Mittwoch, den 2. April<br />
1817: Die Erstausgabe der heutigen<br />
Celleschen Zeitung trug<br />
den Namen „Zellescher Anzeiger“<br />
und wies mit etwa 22 mal<br />
17 Zentimetern noch kein heute<br />
übliches Zeitungsformat auf.<br />
Auch der Umfang des Anzeigers<br />
war mit vier Seiten überschaubar.<br />
Den Inhalt bildeten<br />
Inserate, die in verschiedene<br />
Rubriken untergliedert waren.<br />
61091501_17040700300030316<br />
Aktuelle oder gar politische Berichte<br />
fehlten völlig. Allerdings<br />
bekamen die Abonnenten eine<br />
Beilage mitgeliefert mit dem<br />
Titel „Zellesche Beyträge zur<br />
heiteren und würdigen Unterhaltung“,<br />
die schöngeistige<br />
Texte und Abhandlungen enthielt<br />
und zur Bildung und geistigen<br />
Erbauung dienen sollte.<br />
Die Beilage hatte mit acht Seiten<br />
den doppelten Umfang des<br />
Anzeigers.<br />
Der „Zellesche Anzeiger“<br />
war ein sogenanntes Intelligenzblatt.<br />
Die Obrigkeit<br />
fürchtete die Verbreitung von<br />
umstürzlerischen, sprich: demokratischen<br />
Gedanken. Gedruckte<br />
Publikationen unterlagen<br />
darum strenger Zensur.<br />
Laut Konzession hatte sich der<br />
Herausgeber „darauf zu beschränken,<br />
bloße Privat-Anzeigen,<br />
keineswegs aber gerichtliche<br />
oder sonstige obrigkeitliche<br />
Bekanntmachungen und eben<br />
so wenig politische Nachrichten<br />
aufzunehmen“. Darüber<br />
wachte in Celle Oberappellationsrat<br />
Strohmeyer.<br />
Kurhannover verfolgte weiterhin<br />
ein restriktives Pressekonzept<br />
und lehnte die meisten<br />
Gesuche auf Zeitungskonzessionen<br />
ab. Der „Zellesche Anzeiger“<br />
war eine der wenigen<br />
Ausnahmen.<br />
Dass überhaupt so früh eine<br />
Genehmigung erteilt wurde,<br />
war Pastor Georg Beneken zu<br />
verdanken. Ihm traute die Regierung<br />
in Hannover offenbar<br />
und gestattete die Herausgabe<br />
eines „Celleschen Wochenblattes“.<br />
Er sollte garantieren,<br />
dass ausschließlich unverfänglich<br />
Schöngeistiges veröffentlicht<br />
wurde.<br />
Beneken gab die Konzession<br />
am 12. März 1818 an Schweiger<br />
und Pick weiter, schrieb<br />
aber weiterhin Unterhaltungsbeiträge.<br />
Seit dem 1. April 1818<br />
erschien das nun „Zellescher<br />
Anzeiger nebst Beiträgen“ genannte<br />
Blatt zweimal pro Woche:<br />
mittwochs und samstags.<br />
Die Beilage wurde eingestellt<br />
und die Unterhaltungsbeiträge<br />
stattdessen in den Anzeiger<br />
aufgenommen, der weiterhin<br />
mit vier Seiten auskam.<br />
Von April 1826 bis Juni<br />
1827 druckten und verlegten<br />
Schweiger und Pick das von<br />
Professor Schütz aus Hamburg<br />
herausgegebene „Mittagsblatt<br />
für gebildete Leser<br />
aus allen Ständen“. Es war<br />
als Unterhaltungsblatt für das<br />
Königreich Hannover konzipiert<br />
und brachte auch überregionale<br />
Nachrichten. Wegen<br />
mangelnder Nachfrage wurde<br />
es wieder eingestellt. Die Leser<br />
waren offensichtlich noch nicht<br />
so weit.<br />
Mit dem „Zelleschen Anzeiger“<br />
setzte die Firma ihre<br />
Erfolgsgeschichte jedoch fort<br />
und etablierte eine der langlebigsten<br />
Zeitungen in Niedersachsen.<br />
AschauTeiche<br />
<strong>200</strong> <strong>Jahre</strong> CZ – das steht für Ansporn und Verpflichtung,<br />
sorgfältige Recherche und Qualität.<br />
Wir gratulieren und wünschen alles Gute für die Zukunft!