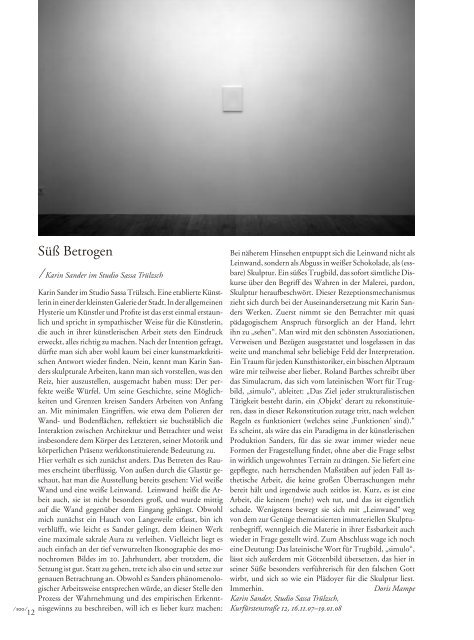Ausgabe 02-2008 als PDF vonhundert_2008-02_komplett.pdf
Ausgabe 02-2008 als PDF vonhundert_2008-02_komplett.pdf
Ausgabe 02-2008 als PDF vonhundert_2008-02_komplett.pdf
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
⁄ 100 ⁄ 12<br />
Süß Betrogen<br />
⁄ Karin Sander im Studio Sassa Trülzsch<br />
Karin Sander im Studio Sassa Trülzsch. Eine etablierte Künstlerin<br />
in einer der kleinsten Galerie der Stadt. In der allgemeinen<br />
Hysterie um Künstler und Profite ist das erst einmal erstaunlich<br />
und spricht in sympathischer Weise für die Künstlerin,<br />
die auch in ihrer künstlerischen Arbeit stets den Eindruck<br />
erweckt, alles richtig zu machen. Nach der Intention gefragt,<br />
dürfte man sich aber wohl kaum bei einer kunstmarktkritischen<br />
Antwort wieder finden. Nein, kennt man Karin Sanders<br />
skulpturale Arbeiten, kann man sich vorstellen, was den<br />
Reiz, hier auszustellen, ausgemacht haben muss: Der perfekte<br />
weiße Würfel. Um seine Geschichte, seine Möglichkeiten<br />
und Grenzen kreisen Sanders Arbeiten von Anfang<br />
an. Mit minimalen Eingriffen, wie etwa dem Polieren der<br />
Wand- und Bodenflächen, reflektiert sie buchstäblich die<br />
Interaktion zwischen Architektur und Betrachter und weist<br />
insbesondere dem Körper des Letzteren, seiner Motorik und<br />
körperlichen Präsenz werkkonstituierende Bedeutung zu.<br />
Hier verhält es sich zunächst anders. Das Betreten des Raumes<br />
erscheint überflüssig. Von außen durch die Glastür geschaut,<br />
hat man die Ausstellung bereits gesehen: Viel weiße<br />
Wand und eine weiße Leinwand. �Leinwand� heißt die Arbeit<br />
auch, sie ist nicht besonders groß, und wurde mittig<br />
auf die Wand gegenüber dem Eingang gehängt. Obwohl<br />
mich zunächst ein Hauch von Langeweile erfasst, bin ich<br />
verblüfft, wie leicht es Sander gelingt, dem kleinen Werk<br />
eine maximale sakrale Aura zu verleihen. Vielleicht liegt es<br />
auch einfach an der tief verwurzelten Ikonographie des monochromen<br />
Bildes im 20. Jahrhundert, aber trotzdem, die<br />
Setzung ist gut. Statt zu gehen, trete ich <strong>als</strong>o ein und setze zur<br />
genauen Betrachtung an. Obwohl es Sanders phänomenologischer<br />
Arbeitsweise entsprechen würde, an dieser Stelle den<br />
Prozess der Wahrnehmung und des empirischen Erkenntnisgewinns<br />
zu beschreiben, will ich es lieber kurz machen:<br />
Bei näherem Hinsehen entpuppt sich die Leinwand nicht <strong>als</strong><br />
Leinwand, sondern <strong>als</strong> Abguss in weißer Schokolade, <strong>als</strong> (essbare)<br />
Skulptur. Ein süßes Trugbild, das sofort sämtliche Diskurse<br />
über den Begriff des Wahren in der Malerei, pardon,<br />
Skulptur heraufbeschwört. Dieser Rezeptionsmechanismus<br />
zieht sich durch bei der Auseinandersetzung mit Karin Sanders<br />
Werken. Zuerst nimmt sie den Betrachter mit quasi<br />
pädagogischem Anspruch fürsorglich an der Hand, lehrt<br />
ihn zu „sehen“. Man wird mit den schönsten Assoziationen,<br />
Verweisen und Bezügen ausgestattet und losgelassen in das<br />
weite und manchmal sehr beliebige Feld der Interpretation.<br />
Ein Traum für jeden Kunsthistoriker, ein bisschen Alptraum<br />
wäre mir teilweise aber lieber. Roland Barthes schreibt über<br />
das Simulacrum, das sich vom lateinischen Wort für Trugbild,<br />
„simulo“, ableitet: „Das Ziel jeder strukturalistischen<br />
Tätigkeit besteht darin, ein ‚Objekt‘�derart zu rekonstituieren,<br />
dass in dieser Rekonstitution zutage tritt, nach welchen<br />
Regeln es funktioniert (welches seine ‚Funktionen‘�sind).“<br />
Es scheint, <strong>als</strong> wäre das ein Paradigma in der künstlerischen<br />
Produktion Sanders, für das sie zwar immer wieder neue<br />
Formen der Fragestellung findet, ohne aber die Frage selbst<br />
in wirklich ungewohntes Terrain zu drängen. Sie liefert eine<br />
gepflegte, nach herrschenden Maßstäben auf jeden Fall ästhetische<br />
Arbeit, die keine großen Überraschungen mehr<br />
bereit hält und irgendwie auch zeitlos ist. Kurz, es ist eine<br />
Arbeit, die keinem (mehr) weh tut, und das ist eigentlich<br />
schade. Wenigstens bewegt sie sich mit „Leinwand“�weg<br />
von dem zur Genüge thematisierten immateriellen Skulpturenbegriff,<br />
wenngleich die Materie in ihrer Essbarkeit auch<br />
wieder in Frage gestellt wird. Zum Abschluss wage ich noch<br />
eine Deutung: Das lateinische Wort für Trugbild, „simulo“,<br />
lässt sich außerdem mit Götzenbild übersetzen, das hier in<br />
seiner Süße besonders verführerisch für den f<strong>als</strong>chen Gott<br />
wirbt, und sich so wie ein Plädoyer für die Skulptur liest.<br />
Immerhin. Doris Mampe<br />
Karin Sander, Studio Sassa Trülzsch,<br />
Kurfürstenstraße 12, 16.11.07–19.01.08