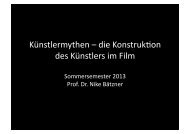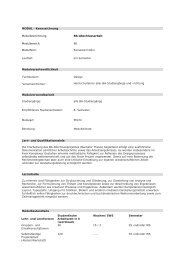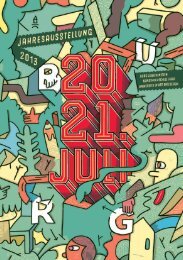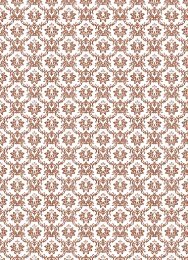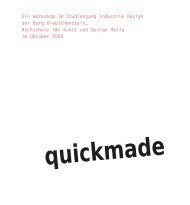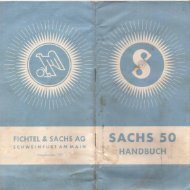Die Mode als Spiegel des Wertewandels der Gesellschaft - am ...
Die Mode als Spiegel des Wertewandels der Gesellschaft - am ...
Die Mode als Spiegel des Wertewandels der Gesellschaft - am ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
einen <strong>der</strong> Vorläufer <strong>des</strong> Chemisenklei<strong>des</strong> verstehen, das wie<strong>der</strong>um zum Empirekleid<br />
führt. <strong>Die</strong>se „Chemise à la reine“ ist eine <strong>als</strong> Oberbekleidung gedachte Neuinterpretatition<br />
<strong>der</strong> Chemise, <strong>des</strong> Unterkleids <strong>des</strong> Rokoko. <strong>Die</strong>ses Kleid, das Marie Antoinette<br />
noch <strong>als</strong> „Schauspielerin” auf <strong>der</strong> Bühne ihres eigenen Lebens, mit <strong>der</strong>selben Verspieltheit<br />
und Unernsthaftigkeit wie zuvor ihre großen Galaroben trägt, verkörpert durch<br />
die Farb- und Stoffwahl und in seiner Einfachheit schon die Ideale, die später auch<br />
die Französische Revolution begleiten. Gerade dieses Gedankengut, das von Marie<br />
Antoinette und ihrem Umfeld noch ganz in <strong>der</strong> Form <strong>des</strong> Rokoko ausgelebt wird,<br />
führt schließlich zu ihrem Untergang, zur französischen Revolution und zu einer neuen<br />
mo<strong>der</strong>nen <strong>Gesellschaft</strong>sform.<br />
<strong>Die</strong> „Chemise à la reine“ bestand im Vergleich zu seinem Nachfolger noch aus<br />
wesentlich mehr Stoff, und auch seine Taille lag an <strong>der</strong> natürlichen Stelle. Im Vergleich<br />
zu seinem Vorgänger, <strong>der</strong> „Robe à la française“, zeigt sich jedoch schon<br />
eine richtungweisende Tendenz auf, nämlich die Verringerung <strong>der</strong> Stoffmenge<br />
und das Höherrutschen <strong>der</strong> Taille, die im Barock eher tiefer gesetzt war. Der<br />
Ausschnitt war für d<strong>am</strong>alige wie für folgende Zeiten nicht sehr tief, was natürliche<br />
Unschuld darstellen sollte. Auch in <strong>der</strong> Bekleidung zeigt sich was Stefan<br />
Zweig <strong>als</strong> den letzten Reiz <strong>des</strong> Rokoko bezeichnet, „das Spiel mit <strong>der</strong> Naivität,<br />
die Perversion <strong>der</strong> Unschuld [und] das Maskenkleid <strong>der</strong> Natürlichkeit“ 6 .<br />
<strong>Die</strong> Lage spitzt sich zu<br />
Durch das politische Desinteresse <strong>der</strong> mächtigsten Personen Frankreichs, <strong>des</strong> Königs<br />
und <strong>der</strong> Königin, wobei <strong>der</strong> König aus Gedankenschwere und Phlegmatismus und die<br />
Königin aus Vergnügungssucht und kindlicher Unernsthaftigkeit allen politischen Fragen<br />
und Entscheidungen aus dem Weg geht, verliert <strong>der</strong> Hof nach und nach das Vertrauen<br />
<strong>des</strong> Volkes. Marie Antoinette verhilft zudem zu Beginn ihrer Herrschaft vielen<br />
ihrer listigen Günstlingen zu machtreichen Positionen, die diese aber nur zu eigenen<br />
Zwecken und zur Vermehrung ihres Reichtums einsetzen, ohne die ges<strong>am</strong>tpolitische<br />
Wirkung ihres Tuns zu bedenken. Ihr unverantwortliches Handeln entspricht dennoch<br />
ganz dem Zeitgeist <strong>des</strong> Rokoko. Carpe diem und Vergnügungssucht prägen die <strong>Gesellschaft</strong>,<br />
kein Gedanke wird an Morgen verschwendet, bloß keine Zukunftsängste.<br />
1777 besucht Joseph II. seine Schwester Marie Antoinette. Während seiner Reise<br />
durch Frankreich, die er inkognito <strong>als</strong> Graf Falkenstein antritt, lernt er Land und<br />
Leute kennen. Er rüffelt in einem Gespräch Marie Antoinettes unvernünftiges,<br />
gedankenloses Benehmen: „In was mengst du dich ein. Du lässt Minister absetzten<br />
(...), Du schaffst neue kostspielige Ämter bei Hof! (...) mit welchem Rechte [mengst]<br />
du dich in die Angelegenheiten <strong>des</strong> Hofes und <strong>der</strong> französischen Monarchie? Was für<br />
Kenntnisse hast Du Dir erworben, um (...) Dir einzubilden, Deine Meinung könnte<br />
6 Zweig, Stefan: Marie Antoinette. Frankfurt <strong>am</strong> Main, 27. Aufl. 2007 (1932), S. 138<br />
in irgendeiner Hinsicht wichtig sein und beson<strong>der</strong>s in jener <strong>des</strong> Staates, die doch ganz<br />
beson<strong>der</strong>e vertiefte Kenntnisse erfor<strong>der</strong>t?“ 7 In seinem Abschiedsbrief, in dem er ihr<br />
all ihre Fehler anhand eines Fragenkataloges aufzeigt, schreibt er: „Ich zitter jetzt für<br />
Dich, denn so kann es nicht weitergehen; la révolution sera cruelle si vous ne la préparez.“<br />
Obwohl er selbst nicht, auch nur annähernd, die ganze Tragweite <strong>der</strong> Probleme<br />
vorhersehen kann, die über Marie Antoinette hereinbrechen werden, ist er <strong>der</strong> erste <strong>der</strong><br />
das Wort Revolution benutzt und Marie Antoinette <strong>der</strong>art vorwarnt. Erst ein ganzes<br />
Jahrzehnt später wird sie den Sinn dieses Wortes begreifen, ja das Wort selbst erst<br />
seine ges<strong>am</strong>mte, heutige Bedeutung erhalten.<br />
Ein weiteres Problem ist die schwierige Beziehung Marie Antoinettes zu Ludwig dem<br />
XVI. <strong>Die</strong> Enttäuschung <strong>der</strong> nicht vollzogenen Ehe und die charakterlichen Unterschiede<br />
gefährden das Gleichgewicht <strong>des</strong> Hofes. Anstatt den entscheidungsschwachen<br />
König in seinen Aufgaben zu unterstützen, untergräbt Marie Antoinette die nicht<br />
beson<strong>der</strong>s hoch geachtete Autorität <strong>des</strong> Königs bei Hofe indem sie ihn aus dem Kreis<br />
ihrer engsten Vertrauten ausschließt. So stellt sie beispielsweise einmal heimlich eine<br />
Uhr um eine Stunde vor, d<strong>am</strong>it <strong>der</strong> König eine Stunde früher zu Bett geht und sie mit<br />
ihren Vertrauten früher auf einen Maskenball ausfahren kann. <strong>Die</strong> ganze <strong>Gesellschaft</strong><br />
verspottet den übertölpelten Herrscher.<br />
Zusätzlich zu den politischen und höfischen Ränkespielen und Machtverschiebungen<br />
k<strong>am</strong> natürlich noch, dass die immensen Ausgaben <strong>des</strong> Hofstaates und die Hungersnot<br />
das Volk allmählich aushöhlten. Schon das Imperium <strong>des</strong> Sonnenkönigs Ludwig XIV.<br />
hatte an den Kräften <strong>des</strong> Volkes gezehrt und unvorstellbare Summen verschlungen,<br />
aber dieses Imperium stand in Zus<strong>am</strong>menhang mit einem zielstrebigen Charakter,<br />
einem Autokraten, <strong>der</strong> die unvorstellbare Macht, für die Versailles das Symbol darstellte,<br />
zu behaupten und darzustellen, ja sogar zu erschaffen wusste. Unter seinen Erben<br />
ist keiner, <strong>der</strong> den schöpferischen Willen Ludwig <strong>des</strong> XIV. geerbt hat und so verliert<br />
Versailles nach und nach seine Macht und das Kräftegleichgewicht, das hun<strong>der</strong>te Jahre<br />
lang in eine Richtung gebogen war, beginnt zurückzupendeln und endet schließlich<br />
in <strong>der</strong> totalen Machtübernahme <strong>des</strong> Volkes während <strong>der</strong> französischen Revolution.<br />
<strong>Die</strong> Französische Revolution - Politische Hintergründe<br />
<strong>Die</strong> H<strong>als</strong>bandaffäre, die 1790 durch die Gräfin de la Motte ausgelöst wird, zieht die<br />
Aufmerks<strong>am</strong>keit <strong>des</strong> unzufriedenen Volkes auf die schon lange <strong>als</strong> hinterhältig und<br />
tyrannisch verschriene Königin. Das unterdrückte und ausgebrannte Volk hat nun<br />
endlich einen Sündenbock gefunden. <strong>Die</strong>, durch die Werke von Rousseau und Voltaire,<br />
nun gebildetere Bürgerschaft beginnt selbstständig zu denken und diese Gedanken<br />
durch Zeitungen und Karikaturblätter zu verbreiten. <strong>Die</strong> Enthüllungen <strong>des</strong> Finanzministers<br />
Calonnes über das Staatsdefizit und das bisher unbekannte Ausmaß <strong>der</strong><br />
7 Zweig, Stefan: Marie Antoinette. Frankfurt <strong>am</strong> Main, 27. Aufl. 2007 (1932), S. 163<br />
11 12