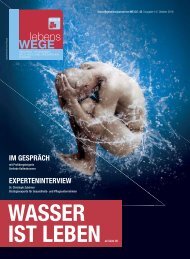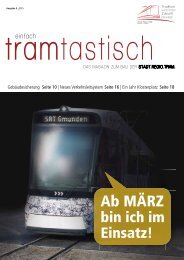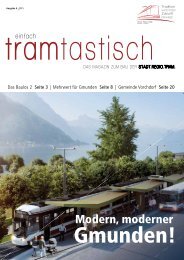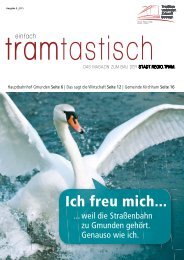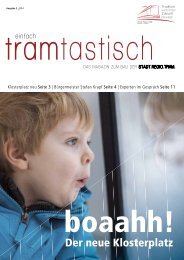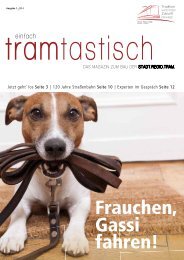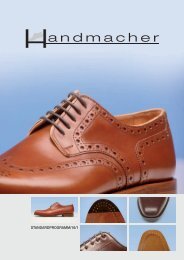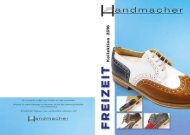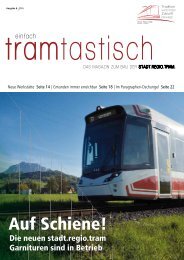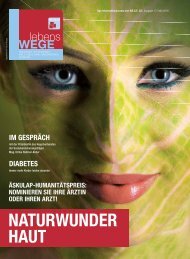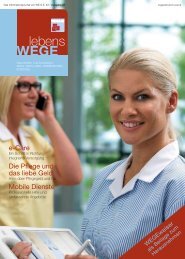WEGE_01_2017_web
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Das Informationsjournal von WE.G.E. 42 | Ausgabe 15 | April 2<strong>01</strong>7<br />
Zugestellt durch Post.at-Gruppe<br />
lebens<br />
<strong>WEGE</strong><br />
Gesundheits- und Sozialregion<br />
WELS, WELS-LAND, GRIESKIRCHEN,<br />
EFERDING<br />
iM gesPräch<br />
Dr. Sophie Karmasin<br />
JeDe Menge<br />
allergene<br />
besser gesunD<br />
leben<br />
tu jeden tag was<br />
gutes für dich!
Kurz notiert<br />
Inhalt<br />
03 Aktuell<br />
06 Im Gespräch<br />
08 Jede Menge Allergene<br />
14 MY WAY<br />
16 Sozialressort 2021+<br />
18 Berufe mit Zukunft<br />
20 Soziales Wels 2030<br />
22 Der „sanfte“ Heimeinzug<br />
25 Pflege & Betreuung<br />
28 Kinder & Jugendliche<br />
32 Bonebridge-Implantat<br />
34 Stimmen aus der Region<br />
36 Ernährung & Gesundheit<br />
38 G'sunde Küche<br />
40 Bereit für den Sommer<br />
42 Aktiv<br />
Impressum: Medieninhaber und Herausgeber:<br />
PKA Private Krankenanstalt Wels Betriebsgmbh,<br />
Grieskirchner Straße 49, 4600 Wels; Redaktionsteam:<br />
Maximilian Aichinger, MSc Dipl. KH-Bw. (VKD) (Klinikum<br />
Wels-Grieskirchen, Koordinator ARGE und Projekte<br />
WE.G.E. 42), Mag. a Renate Maria Gruber, MLS,<br />
Mag. a Kerstin Pindeus, MSc (Klinikum Wels-Grieskirchen),<br />
Tanja Mollner (STADT WELS, Sozialservice und Frauen),<br />
Celia Ritzberger (Ärztekammer für Oberösterreich),<br />
Mag. Harald Schmadlbauer (OÖ Gebietskrankenkasse,<br />
Forum Gesundheit, Referat für Öffentlichkeitsarbeit und<br />
Kommunikation), Ing. Harald Scheiblhofer (Presse- und<br />
Öffentlichkeitsarbeit, Büro Landesrätin Birgit Gerstorfer),<br />
Judith Resch (Sozialhilfeverband Eferding),<br />
Maria Gabriele Kerschhuber (Sozialhilfeverband Grieskirchen),<br />
Karina Huber (Sozialhilfeverband Wels-Land),<br />
Ulrike Wazek (wazek & partner Linz); Layout: wazek &<br />
partner Linz; Druck: OÖN Druckzentrum GmbH & Co KG;<br />
Bildnachweis: Klinikum Wels-Grieskirchen, Stadt Wels,<br />
BH Wels-Land, BH Grieskirchen, BH Eferding,<br />
OÖ Gebietskrankenkasse, Forum Gesundheit,<br />
Ärztekammer für Oberösterreich, shutterstock;<br />
Offenlegung nach § 25 Mediengesetz: Informationen<br />
über die Gesundheits- und Sozialregion Wels, Wels-Land,<br />
Grieskirchen und Eferding (WE.G.E. 42);<br />
P.b.b. Erscheinungsort Wels, Verlagspostamt 4600 Wels;<br />
Kontakt: redaktion@lebenswege-online.at<br />
Nicole Sonnleitner vom Unabhängigen LandesFreiwilligenzentrum<br />
(ULF) im Gespräch über Menschen,<br />
die sich in ihrer Freizeit in vielen gesellschaftlichen<br />
Bereichen freiwillig engagieren.<br />
Welche Bedeutung hat<br />
freiwilliges Engagement?<br />
Während der Flüchtlingsbewegung<br />
im Jahr 2<strong>01</strong>5 ist die<br />
enorme Bedeutung des freiwilligen<br />
Engagements für<br />
viele Menschen sicht- und<br />
spürbar geworden. Fast die<br />
Hälfte der über 15-jährigen<br />
OberösterreicherInnen engagiert<br />
sich freiwillig. Allerdings<br />
ändern sich die Motive<br />
und die Erwartungen.<br />
Wohin geht<br />
die Entwicklung?<br />
Vielen geht es nicht mehr um<br />
ein „Amt“ der Ehre halber,<br />
sondern um Teilhabe, Mitge-<br />
Der unschätzbare Wert<br />
von freiwilligem Engagement<br />
staltung und vor allem um<br />
sinnstiftende Tätigkeiten. Sie<br />
wollen Verantwortung übernehmen<br />
und sich mit ihren<br />
Kompetenzen einbringen.<br />
Dieses Engagement ist von<br />
unschätzbarem Wert und unverzichtbar.<br />
Wie kann man sich die Tätigkeitsfelder<br />
vorstellen?<br />
Genauso unterschiedlich wie<br />
die einzelnen Freiwilligen<br />
sind die Tätigkeiten. Sie reichen<br />
von Besuchsdiensten<br />
in Alten- und Pflegeheimen<br />
über Freizeitgestaltung mit<br />
Kindern und Jugendlichen<br />
bis hin zu Aktivitäten mit<br />
Unabhängiges Landes-<br />
Freiwilligenzentrum<br />
Martin-Luther-Platz 3/3,<br />
4020 Linz<br />
E-Mail: ulf@vsg.or.at,<br />
www.ulf-ooe.at<br />
Menschen mit Beeinträchtigung.<br />
Wichtig ist, dass jeder<br />
und jede das Richtige für<br />
sich findet!<br />
Warum ist freiwilliges<br />
Engagement beliebt,<br />
wenn doch alle über<br />
Zeitmangel klagen?<br />
Es stimmt: Zeitnot und das<br />
Gefühl, getrieben zu sein,<br />
sind allgegenwärtig. Aber<br />
genau da bietet freiwilliges<br />
Engagement eine Alternative:<br />
Ich entscheide mich ganz<br />
bewusst, einen Teil meiner<br />
Zeit, oft nur ein, zwei Stunden<br />
in der Woche, einem anderen<br />
Menschen zu widmen.<br />
Das hat eine besondere Qualität,<br />
daraus kann man viel<br />
Kraft schöpfen – das berichten<br />
uns Freiwillige immer<br />
wieder. Freiwilliges Engagement<br />
ist eine sinnvolle Pause<br />
vom Alltag. Die Menschen<br />
wollen etwas tun. Viele setzen<br />
mit ihrem Engagement<br />
bewusst ein Zeichen: gegen<br />
den Stress und den Materialismus<br />
und für Solidarität<br />
und Zusammenhalt. Was<br />
auch immer dahintersteht,<br />
wir von ULF sind für Freiwillige<br />
da – in ganz Oberösterreich.<br />
Das Unabhängige<br />
LandesFreiwilligenzentrum<br />
ist eine Initiative des Sozialressorts<br />
des Landes Oberösterreich<br />
und wurde 2008<br />
gegründet.<br />
02 | lebens<strong>WEGE</strong>
Aktuell<br />
PlaKatKaMPagne<br />
„schau auf´s geld“<br />
Das Sozialressort des<br />
Landes OÖ und die<br />
SCHULDNERHILFE OÖ<br />
wollen mit einer<br />
Plakatkampagne an<br />
oberösterreichischen<br />
Schulen die Auseinandersetzung<br />
mit Geldfragen<br />
anregen. Gemeinsam mit<br />
Schülerinnen und Schülern<br />
der HBLA für künstlerische<br />
Gestaltung wurden im<br />
vergangenen Schuljahr<br />
vier Plakatsujets entwickelt,<br />
die nun an Schulen<br />
in ganz Oberösterreich<br />
verschickt werden.<br />
„Jugendliche wachsen in einer von Konsum<br />
geprägten Gesellschaft auf, in der Geld gleichzeitig<br />
ein Tabuthema ist“, meint Ferdinand<br />
Herndler, Geschäftsführer der SCHULD-<br />
NERHILFE OÖ. „Sie stehen unter großem<br />
Kaufdruck, sind aber gleichzeitig unerfahren<br />
und kennen oft ihre finanziellen Grenzen<br />
noch nicht. Dazugehören heißt für sie auch<br />
in Sachen Ausstattung mithalten zu können,<br />
was für viele aufgrund ihrer geringen finanziellen<br />
Möglichkeiten aber schwer ist/erschwert<br />
wird. Teure Verträge, überzogene Konten, unreflektierte<br />
Ausgaben und Ratenzahlungen<br />
sind die häufigsten Auswirkungen.“ In der<br />
Statistik der SCHULDNERHILFE OÖ machen<br />
junge Menschen bis 25 fast ein Fünftel<br />
der KlientInnen aus.<br />
„Für das Sozialressort des Landes OÖ ist<br />
Schuldenprävention daher mehr als nur ein<br />
Schlagwort“, so Sozial-Landesrätin Birgit<br />
Gerstorfer. „Seit vielen Jahren schon werden<br />
junge Menschen in Oberösterreich mit dem<br />
OÖ Finanzführerschein oder im Rahmen von<br />
Workshops auf das selbstständige Geldleben<br />
vorbereitet. Und diese Präventionsarbeit rechnet<br />
sich: Die Zahl der jungen Verschuldeten<br />
ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken.“<br />
Präventionsarbeit geschieht bei der<br />
SCHULDNERHILFE OÖ auch in Form von<br />
Schulprojekten. Im Schuljahr 2<strong>01</strong>5/2<strong>01</strong>6 wurde<br />
ein solches gemeinsam mit der HBLA für<br />
künstlerische Gestaltung Linz durchgeführt.<br />
Unter der Anleitung von Prof. Leopold Kislin-<br />
ger sollten die Schülerinnen und Schüler der<br />
zweiten Klassen Plakate zum Thema Geld aus<br />
Sicht von Jugendlichen für Jugendliche gestalten<br />
– mit dem Ziel, die besten Ergebnisse<br />
auch für die weitere Präventions- und Aufklärungsarbeit<br />
der SCHULDNERHILFE OÖ zu<br />
verwenden. Aus mehr als 50 Plakatentwürfen<br />
und Ideen wurden schlussendlich jene vier<br />
Plakate ausgewählt und prämiert, die nun an<br />
Schulen in ganz Oberösterreich ausgeschickt<br />
werden. Ziel der Plakataktion ist es, an Oberösterreichs<br />
Schulen eine kritische Auseinandersetzung<br />
mit dem eigenen Umgang mit<br />
Geld anzuregen und der Tabuisierung entgegenzuwirken.<br />
Die Angebote der SCHULD-<br />
NERHILFE OÖ werden über das Sozialressort<br />
des Landes OÖ finanziert. Nähere Infos<br />
zu den Angeboten der SCHULDNERHILFE<br />
OÖ finden Sie unter www.schuldner-hilfe.at.<br />
Mag. (FH) Ferdinand Herndler<br />
(Geschäftsführung)<br />
SCHULDNERHILFE OÖ<br />
Zentrale: Stockhofstraße 9, 4020 Linz<br />
Tel.: 0732 777734, www.schuldner-hilfe.at<br />
Sie sind<br />
auf Jobsuche<br />
und bringenIT-Berufserfahrungmit?<br />
x-tention befindetsichseit der Gründung<br />
20<strong>01</strong> als erfolgreichesIT-Unternehmen im<br />
kontinuierlichen Wachstum.<br />
Heutebetreuen über 190 qualifizierte<br />
Mitarbeiter vonsieben Standorteninder<br />
DACH-Region mehr als 300 Kunden in<br />
Österreich, Deutschland und der Schweiz.<br />
Wirbietenumfassende Leistungen, von<br />
der IT-Planung bis zur IT-Betriebsführung<br />
in den Bereichen Healthcare, Socialcare,<br />
Integration und e-Health.<br />
Dann senden SieIhreBewerbung an<br />
bewerbung@x-tention.at<br />
x-tention Informationstechnologie GmbH<br />
Römerstraße 80A, 4600 Wels<br />
tel+43 7242 /2155; mail office@x-tention.at<br />
www.x-tention.at<br />
lebens<strong>WEGE</strong> | 03
Aktuell<br />
„Volle<br />
Klangbreite“<br />
AUSZEICHNUNG<br />
Birgit Laux-Flajs ist taub – hören kann sie trotzdem:<br />
Zwei Cochlea-Implantate ermöglichen ihr ein Leben<br />
in vollem Klang. Im Interview spricht die 49-jährige<br />
Unternehmerin über die neue Art zu hören.<br />
Frau Laux-Flajs, Sie leben<br />
seit Ihrem zwölften Lebensjahr<br />
mit einer genetisch<br />
bedingten Innenohrschwerhörigkeit,<br />
die seither immer<br />
weiter vorangeschritten ist.<br />
Heute sind Sie ohne Ihre<br />
Cochlea-Implantate (CI) gehörlos.<br />
Wie kann man sich<br />
das Leben mit Implantat<br />
vorstellen?<br />
Birgit Laux-Flajs: Meine Implantate<br />
haben mir eine Welt<br />
zu den Tönen eröffnet, die<br />
mir sonst ein Leben lang verwehrt<br />
geblieben wäre. Früher<br />
habe ich viele alltägliche Dinge<br />
nicht gehört: das Piepsen,<br />
wenn ein LKW zurückfährt,<br />
Uhrenticken oder das Tapsen<br />
von Hundepfoten auf dem<br />
Fußboden. Ich bin Unternehmerin,<br />
führe Telefonate und<br />
Kundengespräche. Mit Hörgerät<br />
hätte ich beruflich nicht<br />
weitermachen können. Jetzt<br />
ist es viel besser, aber ich habe<br />
auch einen Aufwand.<br />
Welchen Aufwand?<br />
Birgit Laux-Flajs: Mit CI bin<br />
ich zwar weniger müde; ich<br />
muss mich nicht so sehr konzentrieren.<br />
Aber auch ein<br />
Mensch mit CI bleibt hörbeeinträchtigt.<br />
Es braucht eine<br />
gewisse Zeit, bis das Gehirn<br />
verstanden hat: Okay, diesen<br />
und jenen Ton muss ich jetzt<br />
so verarbeiten. Es ist manchmal<br />
anstrengend, aber immer<br />
noch besser, als in der Stille zu<br />
verharren.<br />
Wie ging es Ihnen nach der<br />
Implantation?<br />
Birgit Laux-Flajs: Ich habe<br />
damals in unserem Verein<br />
„Von Ohr zu Ohr“ ambulante<br />
Reha gemacht. Auf meinem<br />
zuerst implantierten, rechten<br />
Ohr konnte ich sechs Wochen<br />
nach der Operation schon Sprache<br />
verstehen. Beim zweiten<br />
Implantat habe ich nur mehr<br />
Telefontraining gemacht.<br />
Was darf man sich als<br />
CI-Träger vom Hören mit<br />
Implantat erwarten?<br />
Birgit Laux-Flajs: Ein CI eröffnet<br />
einem die Welt in der<br />
vollen Klangbreite. Man hört<br />
wieder alles und ist vollständig<br />
ins Leben integriert. Verstehen<br />
muss man lernen und<br />
das braucht Initiative und es<br />
braucht seine Zeit.<br />
Alles in allem wird die Lebensqualität<br />
enorm verbessert.<br />
Ich bin sehr begeistert, aber<br />
das Leben mit CI ist nicht nur<br />
rosarot: Im Restaurant sind<br />
die Klappergeräusche störend.<br />
Doch ohne CI würde ich gar<br />
nichts hören. So habe ich eben<br />
die Nebengeräusche, bin aber<br />
im Leben dabei.<br />
Zur<br />
Person<br />
plus<br />
Aufklären, vorsorgen & beraten<br />
zum Thema Hören & Hörverlust.<br />
> Sonderpreis für akustische Barrierefreiheit<br />
> MED-EL Preis für Innovationen rund ums Hören<br />
GALA<br />
19. OKTOBER 2<strong>01</strong>7<br />
LENTOS, Linz<br />
BEWERBEN<br />
SIE SICH<br />
JETZT<br />
Besser HÖREN - vonohrzuohr<br />
www.das-goldene-ohr.at<br />
Birgit Laux-Flajs, gebürtige Kölnerin, lebt in Wels und führt dort mit<br />
ihrem Mann das Unternehmen „Kaffee & Tee Erleben“. Seit 2009<br />
trägt sie auf dem rechten Ohr, seit 2<strong>01</strong>3 auf dem linken Ohr je ein<br />
Cochlea-Implantat des österreichischen Herstellers MED-EL.<br />
Laux-Flajs ist begeisterte Tänzerin und seit der Implantation wieder<br />
beim Ballett- und Stepptanzen zu treffen. Die Diplomfachwirtin ist<br />
stellvertretende Obfrau des Vereins „Von Ohr zu Ohr“, der<br />
hörbeeinträchtigte Menschen jeden Alters unterstützt und berät.<br />
Falls Sie Fragen zum Thema Hören, Hörverlust oder Cochlea-<br />
Implantate haben, kontaktieren Sie den Verein „Von Ohr zu Ohr“<br />
unter office@vonohrzuohr.or.at oder 0732 700833.<br />
04 | lebens<strong>WEGE</strong>
Herz-, Gefäß- und<br />
Thoraxchirurgie<br />
OÖ REFERENZZENTRUM<br />
KLINIKUMnews<br />
Aktuell<br />
Das Kepler Universitätsklinikum<br />
und das Klinikum<br />
Wels-Grieskirchen arbeiten<br />
zukünftig zusammen und<br />
sichern gemeinsam als<br />
standortübergreifendes<br />
Referenzzentrum für Herz-,<br />
Gefäß- und Thoraxchirurgie<br />
eine gebündelte Versorgung<br />
für die oberösterreichische<br />
Bevölkerung.<br />
Leiter des Referenzzentrums<br />
ist seit 1. März<br />
2<strong>01</strong>7 Prim. Univ. Prof.<br />
Dr. Andreas Zierer. Er<br />
ist zugleich Inhaber des<br />
Lehrstuhls für Herzchirurgie<br />
an der medizinischen<br />
Fakultät Linz. Der geborene<br />
Welser war vorher an der<br />
Klinik für Thorax-, Herz- und<br />
thorakale Gefäßchirurgie am<br />
Klinikum der Johann Wolfgang<br />
Goethe-Universität in Frankfurt<br />
am Main als stellvertretender<br />
Direktor und zuletzt als Chefarzt<br />
der Abteilung für Herz- und<br />
Thoraxchirurgie im HELIOS<br />
Klinikum Siegburg beschäftigt.<br />
Die Abteilung für Chirurgie I<br />
am Klinikum Wels-Grieskirchen<br />
ist mit rund 1.700 Patienten im<br />
Jahr bekannt für ihre hohe herz-,<br />
thorax- und gefäßchirurgische<br />
Versorgungsqualität. Als über<br />
Jahrzehnte etabliertes Kompetenzzentrum<br />
stellt der Standort<br />
Wels nun durch die Zusammenarbeit<br />
mit dem Kepler Universitätsklinikum<br />
und der Medizinischen<br />
Fakultät Behandlungen<br />
nach dem neuesten Stand<br />
der Wissenschaft nachhaltig<br />
sicher. Standortleiter in<br />
Wels ist seit 1. März oA<br />
Prof. Dr. Hans Joachim<br />
Geißler. Der mehrfach zertifizierte<br />
und ausgezeichnete<br />
Herzspezialist ist Mitglied<br />
in nationalen und internationalen<br />
Fachgesellschaften und auch in<br />
der Forschung stark verankert.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Herz-, Gefäß- und Thoraxchirurgie OÖ Referenzzentrum<br />
Neues Service im Klinikum Free Lounge<br />
Die Größe des Klinikums in Zahlen<br />
Free lounge<br />
Neues Service im Klinikum<br />
ZeiTuNGeN uND<br />
MAGAZiNe<br />
GRATiS LeSeN<br />
So einfach funktioniert’s:<br />
1. Mit WLAN verbinden<br />
2. www.kiosk.at in Ihrem<br />
Browser aufrufen<br />
3. Über 300 Zeitungen und<br />
Magazine gratis online lesen<br />
Die Klinikum Free Lounge ist eine E-Paper-Plattform mit über 300 der<br />
wichtigsten Zeitungen, Zeitschriften und Magazine: Angefangen vom<br />
Standard bis zur Krone, von News zu Woman, Falstaff bis Profil,<br />
der New York Times bis hin zur Münchner Abendzeitung – ab sofort kann<br />
jedes mobile Gerät, das mit dem Klinikum-WLAN verbunden ist,<br />
auf die originale Printversion der aktuellen Ausgaben zugreifen.<br />
Die Größe des Klinikums spiegelt sich in beeindruckenden<br />
Zahlen wider, die Sie so vielleicht noch nie gelesen haben.<br />
Internationalität im klinikum<br />
wels-grieskirchen – die mitarbeiter vertreten<br />
insgesamt 39 verschiedene nationalitäten. *<br />
zahlen<br />
& FaKten<br />
das hauseigene Kraftwerk<br />
produziert 69,17 % des<br />
benötigten stroms von insgesamt<br />
22.950.740 kilowattstunden in<br />
eigenleistung. (2<strong>01</strong>6) **<br />
* stand: Jänner 2<strong>01</strong>7<br />
** zeitraum: Jänner bis dezember 2<strong>01</strong>6<br />
rund 500.000 eier und<br />
140.000 liter Milch werden<br />
pro Jahr verbraucht. **<br />
In der ver- und entsorgung sind<br />
täglich 570 transportwägen<br />
mit Wäsche und 480 Wägen<br />
mit essen unterwegs. **<br />
von den rund 3.700 Mitarbeitern<br />
sind 18 % Männer. *<br />
40<br />
Jahre, also ziemlich genau in<br />
der Mitte des lebens, sind die<br />
Mitarbeiter durchschnittlich alt. *<br />
ca. 2.300 tonnen Wäsche<br />
werden pro Jahr gewaschen. **<br />
4.500 bis 6.000<br />
Mahlzeiten werden pro<br />
tag an beiden klinikumstandorten<br />
zubereitet. **<br />
18 %<br />
lebens<strong>WEGE</strong> | 05
Im Gespräch<br />
„Gesunde Kinder von<br />
heute sind gesunde<br />
Erwachsene von morgen.“<br />
iM gesPräch<br />
mit Dr. Sophie Karmasin<br />
Familien- und Jugendministerin<br />
Familien- und Jugendministerin Sophie Karmasin<br />
über das Gesundheitsbewusstsein von Kindern und<br />
Jugendlichen, Präventionsmaßnahmen und<br />
aktuelle Handlungsfelder.<br />
Gesundheit ist ein umfangreiches<br />
und politikübergreifendes Thema, das<br />
jeden Österreicher und jede Österreicherin<br />
betrifft. Welche Anknüpfungspunkte<br />
bieten sich für das Bundesministerium<br />
für Familien und Jugend<br />
(BMFJ) in diesem Bereich?<br />
Dr. Sophie Karmasin: Gesundheit darf<br />
nicht isoliert betrachtet werden, sondern<br />
ist ein Zusammenspiel vieler Politikbereiche.<br />
Für mich ist entscheidend, dass<br />
wir neben den Familien besonders bei<br />
den Kindern und Jugendlichen in der Gesundheitsprävention<br />
ansetzen. Denn gesunde<br />
Kinder und Jugendliche sind nicht<br />
nur leistungsfähiger, sondern verfügen<br />
auch über eine bessere Lebensqualität<br />
06 | lebens<strong>WEGE</strong>
Im Gespräch<br />
und sind die gesunden Erwachsenen von<br />
morgen. Unser Ziel ist es auch, das Gesundheitsbewusstsein<br />
nachhaltig zu steigern.<br />
Das BMFJ bietet und fördert hier<br />
eine Vielzahl an Projekten, Workshops<br />
und Initiativen, die besonders junge Menschen<br />
ansprechen sollen.<br />
Wie kann das Bewusstsein für<br />
Gesundheit vor allem bei den kleinen<br />
Kindern gestärkt werden?<br />
Dr. Sophie Karmasin: Die Grundlagen<br />
für den späteren Gesundheitszustand werden<br />
in der frühen Kindheit gelegt, das ist<br />
hinlänglich bekannt. Je früher Kinder und<br />
Jugendliche Unterstützung erhalten, umso<br />
besser entwickeln sie sich in ihrem späteren<br />
Gesundheitsverhalten.<br />
Gesundheitsbewusstsein sollte so früh<br />
wie möglich gefördert werden, am besten<br />
auf spielerische Art und Weise bereits im<br />
Kindergarten. Es geht darum, den Kindern<br />
zu vermitteln, dass Ernährung und<br />
Bewegung sich nachhaltig auf das eigene<br />
Wohlbefinden auswirken und beides auch<br />
Spaß machen kann. Den Eltern kommt<br />
hier auch eine große Verantwortung zu –<br />
deshalb bieten wir in unseren Familienberatungsstellen<br />
und über die Elternbildung<br />
Beratung und Erziehungstipps zu Gesundheitsthemen<br />
an.<br />
Gestaltet sich der Zugang zu<br />
Jugendlichen bei diesem Thema<br />
schwieriger als zu Kindern?<br />
Dr. Sophie Karmasin: Wir sehen, dass<br />
Gesundheit ein relevantes Thema für die<br />
Jungen ist und besonders Sport und Ernährung<br />
für viele wichtig sind. Es gibt<br />
aber auch Herausforderungen, wie erhöhten<br />
Alkohol- oder Tabakkonsum bei<br />
den Jugendlichen. Es ist wichtig, die<br />
Jungen in ihrem Alltag mit Themen rund<br />
um Körperbewusstsein und ihr eigenes<br />
Wohlergehen abzuholen und sie aktiv<br />
mit einzubinden. Freizeit und Sport sind<br />
dafür beispielsweise gute Anknüpfungspunkte.<br />
Unsere Netzwerke, wie die außerschulische<br />
Jugendarbeit, die Jugendinformation<br />
oder Jugendorganisationen,<br />
sind hier wichtige Partner. Sie vermitteln<br />
den Jugendlichen vor Ort zielgerichtete<br />
Angebote zur Förderung von Prävention<br />
und Gesundheit.<br />
Wo sehen Sie aktuell den größten<br />
Handlungsbedarf an gesundheitspolitischen<br />
Maßnahmen im Kinderund<br />
Jugendbereich?<br />
Dr. Sophie Karmasin: Ein für mich<br />
besonders wichtiges Thema ist das Rauchen<br />
bei Jugendlichen. Wir sind leider<br />
Europameister, rund 25 % rauchen regelmäßig.<br />
Wir müssen dieser Entwicklung<br />
entgegenwirken und diese hohe<br />
Zahl sowie das Einstiegsalter senken. Ich<br />
freue mich, dass auf unsere Initiative im<br />
Rahmen der LandesjugendreferentInnenkonferenz<br />
Ende März die Anhebung<br />
des Schutzalters auf 18 Jahre sowie ein<br />
Präventionsschwerpunkt einstimmig beschlossen<br />
wurden. Dieser Beschluss ist<br />
ein Meilenstein für die österreichische<br />
Jugendpolitik und ein klares Bekenntnis<br />
zur nachhaltigen Gesundheitsförderung<br />
von Jugendlichen.<br />
Handlungsbedarf sehe ich auch im Schulbereich.<br />
Wir wissen, dass 24 % aller 7-<br />
bis 14-Jährigen übergewichtig sind und<br />
die Zahl der Kinder mit chronischen Erkrankungen<br />
steigt, hier sind es rund 16 %<br />
bei den 11- bis 15-Jährigen. Diese Entwicklung<br />
zeigt, dass wir Prävention und<br />
Information in den Schulen noch mehr<br />
fördern müssen. Daher sehe ich im Bereich<br />
der Schulärzte Optimierungsbedarf.<br />
Denn um Präventionsprogramme auch<br />
gezielter einsetzen und auf ihre Wirkung<br />
überprüfen zu können, braucht es eine<br />
ZUR PERSON<br />
bundesweite Auswertung der schulärztlichen<br />
Daten und einen „Gesundheitskompass“<br />
für Schülerinnen und Schüler.<br />
Dieser Kompass könnte die Gesundheitsentwicklung<br />
der Kinder dokumentieren<br />
und ihnen auch lange nach dem Schulabschluss<br />
zur Verfügung stehen.<br />
Seit 1.3.2<strong>01</strong>7 gilt das neue Kindergeldkonto<br />
– die Reform soll vor<br />
allem Väter dazu motivieren, sich<br />
noch aktiver in die Kinderbetreuung<br />
einzubringen. Wie soll das gelingen?<br />
Dr. Sophie Karmasin: Durch die Reform<br />
des Kindergeldkontos ist es uns<br />
gelungen, den Familien neben mehr Flexibilität<br />
und Transparenz auch ein Mehr<br />
an Partnerschaftlichkeit zu ermöglichen<br />
– das war der Wunsch vieler Eltern und<br />
ist auch mir ein persönliches Anliegen.<br />
Durch die Einführung des Familienzeitund<br />
Partnerschaftsbonus können Väter<br />
nun die besondere Zeit nach der Geburt<br />
mit dem Kind und der Familie verbringen<br />
und die Kinderbetreuung noch partnerschaftlicher<br />
gestalten. Ich bin überzeugt,<br />
dass das ein wichtiger Schritt in Richtung<br />
mehr Väterbeteiligung ist und viele Väter<br />
diese neuen Angebote nutzen werden.<br />
Dr. Sophie Karmasin wurde 1967 in Wien geboren und studierte<br />
Psychologie und Betriebswirtschaft an der Universität Wien und dissertierte<br />
zum Thema „Konsumentenverhalten im Gesundheitsmarkt“.<br />
In ihrer beruflichen Laufbahn war sie zunächst als Produktmanagerin<br />
bei Henkel in Wien, Belgien und den Niederlanden tätig.<br />
1995 übernahm sie die Leitung der empirischen Abteilung des Instituts<br />
für Motivforschung, sowie ab 2006 die Geschäftsführung der Karmasin<br />
Motivforschung GmbH. Von 2009 bis 2<strong>01</strong>3 war sie im Beratungsunternehmen<br />
Sophie Karmasin Market Intelligence GmbH tätig, von 2<strong>01</strong>1<br />
bis 2<strong>01</strong>3 geschäftsführende Gesellschafterin des Österreichischen<br />
Gallup Institutes, der Dr. Karmasin Marktforschung GmbH und der<br />
Karmasin Motivforschung GmbH. Seit Dezember 2<strong>01</strong>3 ist Dr. Sophie<br />
Karmasin Bundesministerin für Familien und Jugend.<br />
Dr. Sophie Karmasin ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Wien.<br />
lebens<strong>WEGE</strong> | 07
Allergie<br />
Jede menge<br />
allergene<br />
Um den Körper zu schützen, reagiert<br />
das Abwehrsystem auf fremde Stoffe.<br />
Dies macht Sinn, wenn es sich bei den<br />
Eindringlingen um Viren, Bakterien oder<br />
andere Krankheitserreger handelt. Problematisch<br />
wird es hingegen, wenn sich<br />
der Körper gegen ungefährliche Stoffe<br />
wehrt. Solch überschießende Reaktion<br />
des Immunsystems nennt man Allergie.<br />
Die Neigung dazu ist vermutlich angeboren,<br />
ca. 15 Prozent der Erwachsenen<br />
und bis zu 25 Prozent der Kinder leiden<br />
daran. Beim primären Kontakt mit dem<br />
auslösenden Stoff wird das Immunsystem<br />
aktiviert, bei jedem weiteren<br />
Kontakt mit dem Allergen erinnert sich<br />
der Körper daran und wiederholt die<br />
Abwehrmaßnahmen. Innerhalb von Minuten<br />
oder bis zu einer Stunde danach<br />
kommt es zur allergischen Reaktion.<br />
InJektIonsallergene<br />
Zu Allergenen, die durch Insektenstiche<br />
oder Injektionen in den Körper gelangen,<br />
zählen Bienen- und Wespengift.<br />
InhalatIonsallergene<br />
Viele Allergene, wie Gräserpollen,<br />
Pilzsporen, Wohnungsstaub oder Tierhaare,<br />
werden über die Atmung aufgenommen.<br />
nahrungsmIttelallergene<br />
Sie gelangen über Nahrung oder Arzneimittel<br />
über den Mund in den Körper: Milch, Eier,<br />
Krebse, Fisch, Schmerzmittel und Antibiotika.<br />
kontaktallergene<br />
Bei Allergenen, die mit der Haut in<br />
Berührung kommen, kann es sich zum<br />
Beispiel um Nickel, Duftstoffe oder<br />
Konservierungsmittel handeln.<br />
08 | lebens<strong>WEGE</strong>
Allergie<br />
Wenn es beißt und kratzt<br />
„GESUNDHEIT!“<br />
In den letzten 20 Jahren hat sich die Zahl der Allergiker verdoppelt.<br />
Insgesamt gibt es rund 1,6 Millionen Allergiker in Österreich – und<br />
damit etwa doppelt so viele wie noch im Jahr 1986. „HNO-Ärzte<br />
sind oft die erste Anlaufstelle für Patienten mit Allergiesymptomen“,<br />
unterstreicht Thomas Keintzel die Frequenz der Patienten mit<br />
allergischen Beschwerden im HNO-Bereich.<br />
Die bekannteste Form ist die allergische<br />
Rhinitis, der sogenannte Heuschnupfen,<br />
und damit verbunden das<br />
orale Allergiesyndrom. Diese allergischen<br />
Erkrankungen beruhen auf<br />
einer IgE*-vermittelten Reaktion vom<br />
Soforttyp auf Proteine in Pollen und<br />
Nahrungsmitteln. Sie bewirken eine<br />
vermehrte Schwellung und Sekretion<br />
an den Schleimhäuten des Nasenrachens<br />
bis hin zum Kehlkopf. „Zu<br />
unterscheiden sind die ganzjährigen<br />
Allergien, vor allem jene auf Tierhaare<br />
und Hausstaubmilbenkot, von den saisonalen<br />
Pollenallergien“, erklärt Thomas<br />
Keintzel, Leiter der Abteilung für<br />
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten<br />
am Klinikum Wels-Grieskirchen..<br />
Definitionsgemäß ist der Heuschnupfen<br />
(Allergische Rhinokonjunktivitis)<br />
eine allergisch bedingte Erkrankung<br />
der Nasenschleimhaut und der<br />
Augenbindehaut, die nach Allergenexposition<br />
durch eine Entzündungsreaktion<br />
entsteht. Symptome sind vermehrter<br />
Niesreiz sowie eine rinnende<br />
und verstopfte Nase, häufig auch eine<br />
Bindehautentzündung. Rund 40 Prozent<br />
der Betroffenen leiden auch unter<br />
allergischem Asthma bronchiale.<br />
Das orale Allergiesyndrom tritt häufig<br />
bei Pollenallergikern im Sinne<br />
einer allergischen Kreuzreaktion des<br />
Mund- und Rachenraums auf. Auf<br />
Nüsse, Gemüse oder Gewürze reagiert<br />
die Schleimhaut dann mit Juckreiz,<br />
Zungenbrennen, Halskratzen und Nesselsucht.<br />
Zum Beispiel geben etwa 60<br />
Prozent aller Birkenpollenallergiker<br />
auch eine Unverträglichkeit von Nüssen<br />
und Äpfeln an.<br />
„Für die Diagnose ist die ausführliche<br />
Anamnese des Patienten wegweisend,<br />
um Auslöser für die Beschwerden<br />
dingfest zu machen“, erklärt Keintzel.<br />
„Ein Allergietagebuch kann dabei<br />
helfen.“ Der Prick-Test ermöglicht ein<br />
schnelles Screening des Patienten auf<br />
gängige Allergene. Bei der Durchführung<br />
wird jeweils ein kleiner Tropfen<br />
einer Allergenlösung, zum Beispiel<br />
Gräsermix, Hausstaubmilbe oder Katze,<br />
auf die Haut aufgetragen und mit<br />
einer Lanzette eingeritzt. Eine positive<br />
Reaktion auf ein Allergen zeigt<br />
sich durch Rötung, Juckreiz und Ausbildung<br />
einer sogenannten Quaddel.<br />
Zur Auswertung der Testergebnisse<br />
wird der Durchmesser der Reaktion in<br />
*IgE (IGE) Antikörper vom Typ Immunglobulin-E (IgE) sind für die Vermittlung bestimmter allergischer Reaktionen verantwortlich und spielen deshalb in der Allergiediagnostik eine wichtige Rolle.<br />
lebens<strong>WEGE</strong> | 09
Allergie<br />
Prim. Dr. Thomas Keintzel,<br />
Leiter der Abteilung für Hals-, Nasen- und<br />
Ohrenkrankheiten am Klinikum Wels-Grieskirchen<br />
„Zu unterscheiden sind die<br />
ganzjährigen Allergien, vor<br />
allem jene auf Tierhaare und<br />
Hausstaubmilbenkot, von den<br />
saisonalen Pollenallergien.“<br />
Millimetern bzw. im Vergleich zu einer<br />
Positivkontrolle gemessen. Eine weitere<br />
Testmöglichkeit ist der RAST: Nach<br />
Blutabnahme werden hier spezifische<br />
IgE-Antikörpertiter für Allergene bestimmt,<br />
zusätzlich kann man auch das gesamte<br />
IgE bestimmen. Jedoch beweist ein<br />
positiver Allergietest (Hauttest oder spez.<br />
IgE-Bestimmung) nicht in jedem Fall<br />
die klinische, aktuelle Sensibilisierung.<br />
Diagnostisch überzeugend ist die Bestätigung<br />
des Allergietests nur durch eine<br />
entsprechende klinische Beobachtung in<br />
der allergenrelevanten Zeit oder bei allergenrelevanter<br />
Exposition.<br />
Wenn Patienten in herkömmlichen Sensibilisierungstests<br />
auf alle möglichen<br />
Pollenallergene positiv reagieren, könnte<br />
es sein, dass nicht Kreuzreaktionen die<br />
Ursache sind, sondern sogenannte Panallergene.<br />
Dabei handelt es sich um Allergene,<br />
die in mehreren Allergenquellen<br />
enthalten sind. Im Haut- oder IgE-Test<br />
können sie viele Sensibilisierungen zeigen.<br />
Warum Panallergene in herkömmlichen<br />
Sensibilisierungstests zu positiven<br />
Ergebnissen führen, weiß Keintzel: „Das<br />
liegt daran, dass Panallergene Proteine<br />
sind, die in sämtlichen Pollenarten vorkommen<br />
können – egal ob in Baum-,<br />
Gräser oder Kräuterpollen.“ Mit der<br />
Komponentendiagnostik ist es möglich,<br />
das Allergen genauer zu bestimmen, als<br />
dies mit der traditionellen Allergiediagnostik<br />
möglich ist. Dabei kann anhand<br />
spezifischer Majorallergene, sprich gewisser<br />
Hauptallergene in den Pollen, die<br />
allergische Sensibilisierung einem bestimmten<br />
Allergen zugeordnet werden.<br />
Nasaler Provokationstest<br />
Geht aus vorangegangenen Testungen<br />
nicht einwandfrei hervor, wodurch die<br />
Allergie ausgelöst wird, verweist der<br />
Experte auf die Möglichkeit des nasalen<br />
Provokationstests mit Rhinomanometrie:<br />
„Hierbei wird nach nasaler Allergenapplikation<br />
die Änderung der Druckverhältnisse<br />
anhand des intranasalen Flows<br />
gemessen und auch ob allergische Symptome<br />
ausgelöst werden können.“<br />
Der Pricktest<br />
ermöglicht<br />
ein schnelles<br />
Screening<br />
des Patienten<br />
auf gängige<br />
Allergene.<br />
10 | lebens<strong>WEGE</strong>
Allergie<br />
Die besten Therapien<br />
Allergenkarenz im Sinne einer Meidung<br />
des Auslösers ist nach wie vor die beste<br />
Therapie. Bei ganzjährigen Allergien,<br />
wie jener auf Milbenkot, Tierhaare oder<br />
Pilzsporen, müssen die Auslöser beseitigt<br />
werden. Im Falle der Hausstaubmilbe<br />
geschieht das durch spezielle Überzüge<br />
Prim. Dr. Josef eckmayr,<br />
Leiter der Abteilung für Lungenkrankheiten<br />
am Klinikum Wels-Grieskirchen<br />
„Das allergische Asthma ist mit<br />
rund sechzig Prozent die häufigste<br />
Form des Asthma bronchiale.“<br />
für die Matratze und durch regelmäßiges<br />
Waschen der Bettwäsche, sowie auch<br />
der Trocknung im Trockner, da hierbei<br />
die Milbeneier platzen. Bei Pilzbefall<br />
im Wohnraum muss eine Wohnraumsanierung<br />
oder ein Wohnungswechsel erfolgen.<br />
Eine Oberflächenbehandlung der<br />
Schimmelflecken reicht hier nicht aus.<br />
Für die allergischen Symptome kann im<br />
Akutfall ein abschwellendes Nasenspray<br />
für maximal zehn Tage verordnet werden.<br />
Als längerfristige Therapie stehen Nasensprays<br />
mit lokalen Antihistaminika<br />
und Kortikosteroiden zur Verfügung,<br />
die klinisch eine gute Wirksamkeit zeigen.<br />
Orale Antihistaminika können die<br />
Beschwerden deutlich lindern, die neueren<br />
Präparate zeigen keine sedierenden<br />
Nebenwirkungen mehr. In ausgeprägten<br />
Fällen können auch<br />
orale Kortikosteroide<br />
gegeben<br />
werden, insbesondere<br />
bei akuter,<br />
massiver Symptomatik,<br />
ohne<br />
Besserung auf die<br />
vorhergehende lokale Therapie.<br />
Bei saisonalen Allergien besteht die<br />
Möglichkeit der Hyposensibilisierung<br />
mittels subkutaner Injektionen (SCIT)<br />
oder sublingualer Tabletten (SLIT). Bei<br />
der SCIT wird das auslösende Allergen<br />
in steigender Konzentration dem Patienten<br />
verabreicht, um so eine Anpassung<br />
der Immunantwort zu erreichen. Dies<br />
ist vor allem bei Heuschnupfen eine geeignete<br />
Therapie. Eine solche Therapie<br />
wird grundsätzlich über mehrere Jahre<br />
angelegt und kann zu einer deutlichen<br />
Symptombesserung führen. Auch über<br />
die SLIT ist hier eine gute Wirksamkeit<br />
belegt, sie kann auch bei Hausstaubmilbenallergien<br />
durchgeführt werden. Bei<br />
beiden Verfahren muss eine ärztliche<br />
Überwachung während der Behandlung<br />
erfolgen, ein Notfallset zur Sicherung<br />
der Atemwege und symptomatischen Behandlung<br />
bei Akutreaktionen muss vorhanden<br />
sein.<br />
Allergisches Asthma<br />
Zahlreiche Allergene werden über die Atmung<br />
aufgenommen, wie zum Beispiel<br />
Gräserpollen, Pilzsporen, Hausstaub<br />
oder Tierhaare. Eine Allergieform, die<br />
besonders die Atmung in Mitleidenschaft<br />
zieht, ist das allergische Asthma. „Es ist<br />
mit rund sechzig Prozent die häufigste<br />
allergologische<br />
DiagnostiK<br />
an der abteilung für<br />
lungenerkrankungen<br />
Prick-Test und Blutabnahme<br />
zur Allergietestung<br />
Kleine und große<br />
Lungenfunktionsmessung<br />
(inkl. Atemwegswiderstand u. v. m.)<br />
Überempfindlichkeitstestung<br />
an den Bronchien<br />
inhalative und nasale<br />
Provokationstestung<br />
mit Allergenlösung<br />
orale Provokationstestung<br />
No-Messung (Stickstoffmonoxid,<br />
Hinweis für „asthmatische“<br />
Reaktion der Bronchien)<br />
Form des Asthma bronchiale“, erklärt<br />
Josef Eckmayr, Leiter der Abteilung für<br />
Lungenkrankheiten. „Asthma ist dadurch<br />
gekennzeichnet, dass sich die Bronchien<br />
anfallsartig stark verkrampfen, sodass es<br />
zu einer Verengung der unteren Atemwege<br />
kommt. Das Gefühl der Atemnot kann<br />
zu Panik bei den Betroffenen führen, was<br />
die Beschwerden wiederum verstärken<br />
kann.“ Die Auslöser eines allergischen<br />
Asthmas können vielfältig sein, sehr<br />
oft tritt es im Zusammenhang mit Heuschnupfen<br />
auf.<br />
Die Therapiemöglichkeiten an der Abteilung<br />
für Lungenerkrankungen basieren<br />
vor allem auf einer umfassenden Allergieberatung:<br />
„Jeder sollte Bescheid wissen,<br />
wie er auslösende Allergene am besten<br />
meiden kann. Dazu ist es manchmal<br />
ratsam, den Wohnraum oder selbst die<br />
Situation am Arbeitsplatz zu verbessern<br />
bzw. zu verändern“, gibt Eckmayr zu bedenken.<br />
Allergien und Asthma empfiehlt<br />
er zudem medikamentös zu behandeln,<br />
sinnvoll sind auch orale Hyposensibilisierungsbehandlung<br />
und als Injektion<br />
subkutan.<br />
lebens<strong>WEGE</strong> | 11
Allergie<br />
Heuschnupfeen<br />
Das allergische Auge<br />
Bei über der Hälfte aller<br />
Heuschnupfenpatienten zeigen<br />
sich Symptome zuerst am Auge.<br />
Vor allem im Frühling und<br />
im Frühsommer sind die<br />
Betroffenen dadurch stark in<br />
Mitleidenschaft gezogen.<br />
Wie auch in anderen Bereichen des Körpers<br />
stellt die allergische Reaktion des<br />
Auges eine überschießende Immunantwort<br />
auf einen Reiz dar. Die Abwehrzellen<br />
finden sich in der Bindehaut ebenso<br />
wie in der Tränenflüssigkeit. „Grundsätzliche<br />
Erstsymptome sind heftiges Beißen,<br />
Schwellungen und Rötungen, begleitet<br />
von einem Tränen“, erklärt Ali Abri, Leiter<br />
der Abteilung für Augenheilkunde und<br />
Optometrie. „Bei längerer Dauer zählen<br />
dazu auch Brennen oder Verkleben bzw.<br />
Verkrusten der Augen.“ In der Regel ist<br />
eine Allergie an den Augen zumeist beidseitig,<br />
außer es handelt sich um eine Kontaktallergie,<br />
etwa direkt ausgelöst durch<br />
Katzenhaare oder einen Bienenstich.<br />
Die Ausprägungen der allergischen Reaktionen<br />
am Auge können sehr unterschiedlich<br />
ausfallen und von leichten<br />
Reizzuständen bis zu schweren Vernarbungen<br />
der Hornhaut führen.<br />
FORMEN DER<br />
ALLERGIEN AM AUGE<br />
Die allergische Bindehautentzündung<br />
(Rhinokonjunktivitis)<br />
„Hierbei handelt es sich in der klassischen<br />
Form um den Heuschupfen, der zu bestimmten<br />
Jahreszeiten auftritt und in der<br />
Regel mit einer Nasenschleimhautentzündung<br />
verbunden ist“, sagt Abri. „Auslösender<br />
Fremdstoff sind die durch Wind,<br />
Wasser und Tiere übertragenen Blütenpollen.<br />
Die ganzjährige Form rufen eher<br />
Stoffe aus dem häuslichen Umfeld, wie<br />
Hausstaubmilben, Tierhaare (vor allem<br />
Katzenhaare), Bettfedern und Schimmelpilze,<br />
hervor.“ Typisches Symptom<br />
ist der Juckreiz, auch Brennen, Lichtempfindlichkeit<br />
und klarer Tränenfluss<br />
können auftreten. Trüber Schleim spricht<br />
eher für eine Infektion.<br />
12 | lebens<strong>WEGE</strong>
Allergie<br />
Prim. Dr. Ali Abri,<br />
Leiter der Abteilung für<br />
Augenerkrankungen und Optometrie<br />
am Klinikum Wels-Grieskirchen<br />
Hornhaut- und Bindehautentzündung<br />
im Frühling<br />
Diese stark juckende beidseitige Entzündung<br />
des äußeren Auges tritt während<br />
des Frühlings verstärkt auf, obwohl sie<br />
nicht an den direkten Kontakt mit einem<br />
bestimmten Auslöser, wie zum Beispiel<br />
Pollen, gebunden ist. Häufig ist die Hornhaut<br />
beteiligt, was im Extremfall sogar zu<br />
Vernarbungen führen kann. Meist muss<br />
hier mit Cortisonpräparaten behandelt<br />
werden.<br />
Die Kontaktallergie bzw. -dermatitis<br />
Im Vergleich zur übrigen Haut ist die<br />
Lidhaut extrem dünn und dehnbar, der<br />
Aufbau der einzelnen Schichten und<br />
die Ausstattung mit Drüsen sind anders.<br />
Hier können Reizungen und Reizstoffe<br />
in wesentlich geringerer Ausprägung<br />
bzw. Konzentration als sonst schon zur<br />
Hautentzündung (Dermatitis) bzw. sogar<br />
zu einer allergischen Reaktion der Haut<br />
(Lidekzem) führen. Typische Zeichen<br />
sind Rötung, Schwellung, Bläschen- und<br />
Krustenbildung, begleitet von Brennen<br />
und Juckreiz. Wer betroffen ist, sollte<br />
empfindliche Haut mit speziellen Lidcremes<br />
schützen.<br />
Das hilft<br />
Der Weg zur Behandlung führt auch beim<br />
allergischen Auge über einen Hauttest<br />
und, wenn die Auslöser bekannt sind,<br />
über die Allergenkarenz. Auch Antiallergika,<br />
beispielsweise Antihistaminika,<br />
helfen. Reicht die Wirkung nicht aus,<br />
muss manchmal auf cortisonhaltige Augentropfen<br />
zurückgegriffen werden. Eine<br />
erfolgversprechende Methode ist auch<br />
die Desensibilisierungstherapie.<br />
„Die Desensibilisierungstherapie ist erfolgversprechend:<br />
Über drei Jahre wird das Allergen in ansteigender Dosierung<br />
verabreicht, damit sich der Körper daran gewöhnen kann.“<br />
Tipp<br />
Pollenwarn-Apps<br />
Pollen-App: Mit der mobilen Hilfe für<br />
Allergiker stellt der Österreichische<br />
Pollenwarndienst in Kooperation<br />
mit dem Deutschen Wetterdienst und<br />
der Zentralanstalt für Meteorologie<br />
und Geodynamik (ZAMG) eine<br />
Pollenvorhersage für die nächsten drei<br />
Tage der Regionen zur Verfügung.<br />
www.pollenwarndienst.at<br />
Allergien<br />
sind auch<br />
Hautsache<br />
Viele Österreicher sind von Allergien<br />
auf der Haut betroffen. Zahlreiche<br />
mögliche, unterschiedliche Auslöser<br />
für ein allergisches Kontaktekzem<br />
erschweren die Identifikation des<br />
„Übeltäters“.<br />
„Zu den typischen Symptomen einer<br />
Kontaktallergie zählen Hautrötungen, die<br />
Bildung von Bläschen sowie ein starkter<br />
Juckreiz“, erklärt Dermatologe Werner Saxinger.<br />
Der Leiter der Abteilung für Hautund<br />
Geschlechtskrankheiten rät: „Bei den<br />
ersten Allergieanzeichen reinigt man die<br />
betroffene Stelle zuerst mit Wasser und<br />
einer milden Seife. Dann muss abgeklärt<br />
werden, was die Reaktion der Haut verursacht<br />
hat.“ Einer der häufigsten Auslöser<br />
für Kontaktekzeme ist Nickel. Die Atome<br />
des Metalls gehen dabei eine Verbindung<br />
mit den Eiweißen der Rezeptoren bestimmter<br />
Immunzellen ein – bei sensibilisierten<br />
Menschen führt dies dann zu einer überschießenden<br />
Reaktion der Körperabwehr.“<br />
Auch das Tragen von Latex kann allergische<br />
Reaktionen der Haut auslösen: Ausschlag<br />
und Rötungen, aber auch Atemnot<br />
und Übelkeit sind die Folge. Latexallergie<br />
ist heute als Berufskrankheit anerkannt –<br />
besonders häufig sind aufgrund des Tragens<br />
von Einmalhandschuhen Reinigungskräfte<br />
und Krankenhauspersonal davon<br />
betroffen. Weitere Auslöser von Hautallergien<br />
können Haarfärbemittel, Pflanzen,<br />
medizinische Salben und Sonnenschutzmittel<br />
sein.<br />
Prim. Dr.<br />
Werner Saxinger, MSc,<br />
Leiter der Abteilung<br />
für Haut- und<br />
Geschlechtskrankheiten am<br />
Klinikum Wels-Grieskirchen<br />
lebens<strong>WEGE</strong> | 13
My Way<br />
„Dank dem Programm kann ich die Behandlungsschritte besser nachvollziehen und mich auch<br />
selbst mehr einbringen“, sagt Georg P., Schlaganfallpatient im Gespräch mit Prim. Topakian<br />
Prim. Priv.-Doz. Dr. Raffi Topakian<br />
Leiter der Abteilung für Neurologie inkl. Stroke Unit,<br />
Klinikum Wels-Grieskirchen<br />
My Way<br />
Neue Wege, um Diagnose und<br />
Behandlung besser zu verstehen<br />
Die Erfahrung im klinischen Alltag zeigt, dass Patienten, die bereit<br />
sind, selbst etwas zu ihrer Genesung beizutragen, schneller gesund<br />
werden. Daraus hat das Klinikum Wels-Grieskirchen 2<strong>01</strong>6 ein spezielles<br />
Programm entwickelt: Durch „My Way“ soll die Beziehung zum<br />
Patienten im größten Ordensspital Österreichs intensiviert werden.<br />
Durch eine aktive Einbeziehung verstehen kranke Menschen ihre<br />
Diagnose und Behandlung besser, wodurch sich die Chancen auf den<br />
Heilungserfolg positiv beeinflussen lassen.<br />
„Die Philosophie hinter ‚My Way‘ ist<br />
einfach: Wir signalisieren den Patienten,<br />
dass sie zusätzlich zu Medizin und Pflege<br />
auch selbst Verantwortung für sich übernehmen<br />
können und sollen. Sie werden<br />
angeregt, selbstbestimmt und selbstwirksam<br />
nachzudenken, zum Beispiel zu fragen,<br />
was sie in ihrem Leben verändern<br />
können“, erläutert Klinikum-Geschäftsführer<br />
Dietbert Timmerer das innovative<br />
Konzept, das auf Freiwilligkeit beruht.<br />
„Unsere Patienten können frei entscheiden,<br />
ob sie am Programm teilnehmen<br />
möchten oder nicht.“<br />
Nach dem Start in der Kardiologie wurde<br />
das Pilotprojekt mit November auf die<br />
neurologische Station ausgeweitet. Die<br />
wesentlichen Bausteine von „My Way“<br />
sind ein persönliches Tagebuch sowie<br />
eine Diagnose- und eine Visite-Karte.<br />
14 | lebens<strong>WEGE</strong>
My Way<br />
Selbstbewusstes Krankenhaus<br />
Im Zuge des Markenbildungsprozesses<br />
der Ordensspitäler Österreichs hat das<br />
Klinikum das Profilthema „Selbstbewusstes<br />
Krankenhaus“ aufgegriffen und<br />
„My Way – Mein Weg zur Gesundheit“<br />
entwickelt. Das Programm basiert auf<br />
der Erkenntnis, dass Mitarbeit, Eigenleistung<br />
und Motivation der Patienten zu<br />
einer Verkürzung des Krankheitsverlaufs<br />
führen können.<br />
Genutzt werden dafür neueste wissenschaftliche<br />
Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie,<br />
begleitet wird das Pilotprojekt<br />
durch eine Studie der Grazer Forschungsgesellschaft<br />
Joanneum Research.<br />
Mag. Dietbert Timmerer<br />
Geschäftsführung / Verwaltungsleitung<br />
Klinikum Wels-Grieskirchen<br />
„Patienten, die bereit sind, selbst etwas<br />
zu ihrer Genesung beizutragen, werden<br />
schneller gesund. Mit diesem Programm<br />
verstehen Patienten ihre Diagnose und<br />
Behandlung besser und übernehmen<br />
dadurch selbst Verantwortung.“<br />
DIE „MY WAY“-TOOLS FÜR PATIENTEN:<br />
Gemeinsam Ziele festlegen mit der<br />
Diagnose-Karte<br />
„Ein Krankenhausaufenthalt ist oft mit<br />
vielen Fragezeichen verbunden: Was<br />
ist passiert? Welche Therapie erhalte<br />
ich? Wie lange muss ich hier bleiben?“,<br />
gibt Dr. Topakian zu bedenken.<br />
„Für die Genesung ist es aber wichtig,<br />
dass der Patient Diagnose und Therapie<br />
gut nachvollziehen kann. Das gemeinsame<br />
Bestimmen des Krankheitsbildes<br />
sowie das Festlegen von Zielen<br />
mithilfe der Diagnose-Karte geben<br />
dabei Unterstützung.“<br />
Auf der Diagnose-Karte kann der<br />
Patient notieren, was er aus dem<br />
Gespräch mit dem therapeutischen<br />
Team mitgenommen hat.<br />
Viele Fragen stellen anhand<br />
der Visite-Karte<br />
Patienten tragen sich manchmal mit<br />
der Sorge, von den Ärzten als aufdringlich<br />
eingestuft zu werden, wenn<br />
sie viele Fragen stellen. Die Klinikum-Ärzte<br />
sind anderer Meinung. „Je<br />
mehr wir voneinander wissen, desto<br />
besser können wir die Therapie einstellen“,<br />
versichert Raffi Topakian,<br />
Leiter der Abteilung für Neurologie<br />
am Klinikum Wels-Grieskirchen.<br />
„Die Visite-Karte leitet den Patienten<br />
dazu an, Fragen zu sammeln<br />
und zu notieren, die er im Rahmen<br />
der Visite ohne Scheu stellen kann.“<br />
Auf der Visite-Karte kann der Patient<br />
Fragen vorbereiten, die er seinem<br />
Therapieteam im Rahmen der Visite<br />
stellen möchte.<br />
Gedanken und Gefühle ordnen<br />
mit dem „My Way“-Tagebuch<br />
Im Krankenhaus hat man Zeit zum<br />
Nachdenken. Für den Heilungsprozess<br />
ist es wichtig, Erinnerungen und Emotionen<br />
aufzuarbeiten. In einem persönlichen<br />
Tagebuch kann der Patient Tag<br />
für Tag aufschreiben, wie es ihm geht,<br />
was er erlebt und wie er den Fortschritt<br />
der Genesung selbst einstuft.<br />
Mit seinem „My Way“-Tagebuch hat<br />
der Patient Tag für Tag die Möglichkeit,<br />
aufzuschreiben,wie es ihm geht,<br />
was er erlebt und welchen Weg in<br />
Richtung Genesung er schon<br />
zurückgelegt hat.<br />
lebens<strong>WEGE</strong> | 15
Sozialressort 2021+<br />
Mein ziel sinD<br />
verBesserungen<br />
Im sozIalBereIch<br />
Seit vergangenem Herbst arbeiten<br />
die Projektgremien an dem<br />
von Sozial-Landesrätin Birgit<br />
Gerstorfer initiierten Projekt<br />
Sozialressort 2021+. Was genau<br />
hinter dem Projekt Sozialressort<br />
2021+ steckt, hat die Lebenswege-Redaktion<br />
direkt bei Landesrätin<br />
Birgit Gerstorfer erfragt.<br />
Ihr erstes großes Projekt wurde<br />
gleich als „Jahrhundertprojekt für<br />
Oberösterreich“ bezeichnet und<br />
positiv bewertet. Freut Sie das Lob?<br />
Birgit Gerstorfer: Ja natürlich, denn es<br />
bestätigt meinen Weg. Gerade in einer<br />
sensiblen Materie wie der Sozialpolitik<br />
ist die Suche nach Konsens eine Herausforderung.<br />
Zwar reden alle Parteien<br />
davon, soziale Dienstleistungen, beispielsweise<br />
im Bereich der Betreuung<br />
von Menschen mit Beeinträchtigungen,<br />
ausbauen zu wollen, aber natürlich gibt<br />
es unterschiedliche Sichtweisen, auf welchen<br />
Wegen wir zu diesem Ziel gelangen<br />
können. Mein Projekt gibt einen solchen<br />
Weg vor. Bisher nehme ich den Willen aller<br />
wahr, diesen Weg gemeinsam mit mir<br />
zu gehen.<br />
Können Sie die Ziele des Projektes<br />
nochmals für uns zusammenfassen?<br />
Birgit Gerstorfer: Das SozialRessort<br />
wird zum Vorreiter in Sachen Transpa-<br />
16 | lebens<strong>WEGE</strong>
Sozialressort 2021+<br />
renz und Wirkungsorientierung. Ich will<br />
alle Zahlen auf den Tisch legen und dokumentieren,<br />
welche Leistungen für die<br />
OberösterreicherInnen mit den eingesetzten<br />
Geldern erbracht werden.<br />
Diese Offenheit nimmt nicht zuletzt jenen<br />
den Wind aus den Segeln, die fortlaufend<br />
nach Einsparungen rufen, ohne die Folgen<br />
für die Menschen zu bedenken oder<br />
auch nur konkret benennen zu können.<br />
Insofern will ich einen Beitrag zur Versachlichung<br />
politischer Debatten leisten.<br />
Gleichzeitig suchen wir nach Möglichkeiten,<br />
noch effizienter und effektiver zu<br />
arbeiten, damit freiwerdende Mittel dort<br />
hinfließen können, wo das Geld dringend<br />
gebraucht wird. Gerade im Bereich der<br />
Versorgung, Förderung und Inklusion<br />
von Menschen mit Beeinträchtigungen<br />
gibt es derzeit mehr Bedarf als Angebote.<br />
Das will ich ändern.<br />
Wie sachlich laufen die<br />
Debatten bisher?<br />
Birgit Gerstorfer: Sehr konstruktiv und<br />
zielorientiert. Es geht darum, ein gemeinsames<br />
Verständnis für die Herausforderungen<br />
zu entwickeln. Bleiben wir beim<br />
Chancengleichheitsgesetz für Menschen<br />
mit Beeinträchtigungen. Wir wissen, dass<br />
mehr Mittel für den Abbau der Wartelisten<br />
– beispielsweise beim Wohnen für<br />
Menschen mit Beeinträchtigungen – notwendig<br />
sind.<br />
Die Frage ist also: Bekennen wir uns zur<br />
Chancengleichheit oder nicht? Wenn ja,<br />
dann muss das Land auch die notwendigen<br />
Mittel dafür zur Verfügung stellen.<br />
Schlussendlich müssen alle Parteien Farbe<br />
bekennen. Mein Ziel sind Verbesserungen<br />
und nicht Einsparungen auf dem<br />
Rücken der OberösterreicherInnen.<br />
Dr. Michael Slapnicka<br />
Leitung der Abteilung<br />
Soziales OÖ Landesdienst<br />
Bedarfsorientierte<br />
Angebotsentwicklung<br />
Das Sozialressort hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten das<br />
Leistungsspektrum für ältere Menschen und Menschen mit<br />
Beeinträchtigung massiv ausgebaut. Trotzdem kann der Bedarf<br />
bei manchen Leistungsangeboten nicht im ausreichenden Maß<br />
gedeckt werden.<br />
Es bedarf daher dringender Überlegungen<br />
für eine strategische Neuorientierung<br />
mit dem Ziel, einerseits die sich<br />
öffnende Schere zwischen steigendem<br />
Bedarf und sich nicht weiter entwickelbaren<br />
Leistungsangeboten schrittweise<br />
zu schließen, damit mit den vorhandenen<br />
Budgetmitteln künftig mehr<br />
Menschen mit relevanten Bedürfnissen<br />
Leistungen erhalten können. Andererseits<br />
ist es notwendig, das Leistungsangebot<br />
an die gesellschaftspolitischen<br />
Entwicklungen, die geänderten Bedürfnisse<br />
der Menschen und an die demografische<br />
Entwicklung anzupassen.<br />
Aus diesem Grunde wurde im Herbst<br />
2<strong>01</strong>6 das Projekt „Sozialressort 2021+“<br />
gestartet, mit dem Ziel der Evaluierung<br />
des Leistungsspektrums im Sozialressort<br />
mit Fokus auf eine bedarfsorientierte<br />
Angebotsentwicklung bis 2021<br />
und darüber hinaus.<br />
Unser Projektzugang orientiert sich am<br />
Wunsch der Bürgerinnen und Bürger,<br />
auch im Pflege- und Betreuungsfall<br />
möglichst lange zu Hause sein zu können.<br />
Wir verfolgen daher die Strategie,<br />
Pflege- und Betreuungsleistungen auszubauen,<br />
ohne die Anzahl der bestehenden<br />
stationären Plätze zu erweitern.<br />
Die Basisversorgung der Oberösterreicherinnen<br />
und Oberösterreicher ist<br />
durch die bestehenden Einrichtungen<br />
gewährleistet, zusätzlich soll verstärkt<br />
auf altersgerechtes Wohnen und alternative<br />
Wohnformen gesetzt werden.<br />
Kurzzeitpflegeleistungen sollen im<br />
Sinne einer Remobilisationsstrategie<br />
stärker zur temporären Inanspruchnahme<br />
genutzt werden. Ziel ist die gesundheitliche<br />
Stabilisierung und Wiedererlangung<br />
der Selbstständigkeit.<br />
Angesichts des Rückgangs der informellen<br />
Pflege kommt auch dem weiteren<br />
Ausbau der mobilen Versorgung<br />
eine besondere Bedeutung zu, allerdings<br />
soll der Fokus nicht nur auf eine<br />
quantitative Steigerung, sondern auch<br />
auf die Entwicklung neuer, vor allem<br />
flexiblerer Angebote gelegt werden.<br />
Im Rahmen des Projektes „Sozialressort<br />
2021+“ wollen wir darüber hinaus<br />
Maßnahmen setzen, damit Menschen<br />
mit Behinderung vermehrt auch ein<br />
selbstbestimmtes Leben und Wohnen<br />
– sei dies in Gemeinschaft oder auch<br />
alleine – ermöglicht werden kann.<br />
Ein weiteres grundlegendes Ziel dieses<br />
Projektes ist, Menschen mit Behinderung<br />
vermehrt eine Arbeit in integrativen<br />
Betrieben zu ermöglichen.<br />
Zusammenfassend erwarten wir uns<br />
mit diesem Projekt die richtigen Weichenstellungen,<br />
damit in Zukunft mit<br />
den vereinbarten Budgetmitteln das<br />
Angebot der Sozialabteilung bedarfsgerecht<br />
weiterentwickelt werden kann.<br />
lebens<strong>WEGE</strong> | 17
Berufsausbildung<br />
beruFe<br />
mIt zukunft<br />
Die Arbeit in einem Sozial- und Gesundheitsberuf<br />
ist nicht irgendein Job. Es ist ein Beruf, der jeden<br />
Augenblick Sinn macht, denn es geht um das<br />
Erkennen, Verstehen und Eingehen auf die älteren<br />
oder hilfsbedürftigen Menschen, die man betreut.<br />
Wer sein Leben nicht nur mit neuem Sinn erfüllen,<br />
sondern durch den täglichen Umgang mit reifen<br />
Persönlichkeiten bereichern möchte, muss kein<br />
Mathematik- oder Sprachengenie sein.<br />
Denn „SinnstifterInnen“ zeichnen sich vor allem<br />
durch Verlässlichkeit, Einfühlungsvermögen und<br />
Vertrauenswürdigkeit aus. Soziales Engagement<br />
ist für sie selbstverständlich.<br />
ausbilDungsstätten<br />
in Der region:<br />
Ausbildungszentrum für Gesundheitsund<br />
Pflegeberufe<br />
Grieskirchnerstr. 42, 4600 Wels/www.klinikum-wegr.at<br />
Berufsförderungsinstitut oÖ wels<br />
Roseggerstraße 14, 4600 Wels/www.bfi-ooe.at<br />
Schule für Sozialbetreuungsberufe<br />
Dr. Schauerstraße 5, 4600 Wels<br />
www.zukunftsberufe.diakoniewerk.at<br />
Altenbetreuungsschule des Landes oÖ Gaspoltshofen<br />
Klosterstraße 12, 4673 Gaspoltshofen<br />
www.altenbetreuungsschule.at<br />
Altenbetreuungsschule des Landes oÖ Andorf<br />
Winertshamer Weg 1, 4770 Andorf<br />
www.altenbetreuungsschule.at<br />
Vinzentinum - Krankenhaus der<br />
Barmherzigen Schwestern Ried<br />
Schlossberg 1, 4910 Ried im Innkreis<br />
www.vinzentinum-ried.at<br />
18 | lebens<strong>WEGE</strong>
Unter dem Titel „Sinnstifter gesucht“<br />
werden Personen gesucht, die einen Beruf<br />
wählen, in dem sie etwas bewegen<br />
können. Eine Tätigkeit in diesem Bereich<br />
ist geprägt von Vielfalt, Abwechslung<br />
und nicht zuletzt von Verantwortung.<br />
Hinter Berufen in der Altenarbeit stecken<br />
ein hoher Grad an Fachwissen und eine<br />
fundierte Ausbildung Die Attraktivität<br />
dieser Berufe liegt in der Vereinbarkeit<br />
von Beruf und Familie, in der Arbeitsplatzsicherheit<br />
mit einem Arbeitsplatz<br />
vor Ort, was gerade in einem frauendominierten<br />
Beruf sehr von Vorteil ist. In<br />
der Region Wels/Eferding/Grieskirchen<br />
gibt es 23 Alten- und Pflegeheime, Mobile<br />
Dienste, Krankenhäuser sowie weitere<br />
Sozialeinrichtungen, die Praktikumsstellen<br />
anbieten und als zukünftiger Arbeitgeber<br />
infrage kommen.<br />
Diplomierte Gesundheits- und<br />
KrankenpflegerInnen (DGKP)<br />
Fachübergreifend, eigenverantwortlich<br />
und mitverantwortlich arbeitet dieser<br />
Beruf eng mit anderen Berufsgruppen<br />
zusammen, um die Gesundheit und das<br />
Wohl der PatientenInnen zu fördern.<br />
Als DGKP erwirbt man grundlegende<br />
Kenntnisse über die Gesundheits- und<br />
Krankenpflege und über ausgewählte<br />
Bereiche der Medizin. Damit ist die Pflegefachkraft<br />
in der Lage, die Pflege von<br />
Menschen aller Altersstufen zu planen,<br />
zu evaluieren und in Zusammenarbeit mit<br />
ÄrztenInnen und anderen Berufsgruppen<br />
durchzuführen.<br />
Fach-SozialbetreuerIn<br />
Altenarbeit (FSB „A“)<br />
Das ist ein Beruf für und mit Menschen.<br />
In der Ausbildung steht daher die Förderung<br />
der fachlichen und persönlichen<br />
Kompetenz im Mittelpunkt. Das Berufsbild<br />
FSB „A“ ist auf die Anliegen<br />
von betreuungs- und pflegebedürftigen<br />
alten Menschen abgestimmt und beinhaltet<br />
einen pflegerischen und sozialbetreuerischen<br />
Teil. Bei dem pflegerischen<br />
Teil geht es beispielsweise um die Körperpflege<br />
oder um die Mobilisation, im<br />
sozialbetreuerischen Teil wird das eigenständige<br />
und selbstbestimmte Leben<br />
gefördert. Wesentliche Tätigkeiten sind<br />
Aktivierungsmaßnahmen zur Förderung<br />
der Selbstständigkeit und der kompetente<br />
Umgang mit Menschen mit Demenz.<br />
HeimhelferIn<br />
Dies ist ein wichtiges Bindeglied zwischen<br />
BewohnerInnen und KlientInnen,<br />
dessen/deren sozialem Umfeld und allen<br />
anderen Bezugspersonen. Der/die HeimhelferIn<br />
unterstützt betreuungsbedürftige<br />
Menschen (das sind Personen aller Altersstufen,<br />
die durch Alter, gesundheitliche<br />
Beeinträchtigung oder schwierige<br />
soziale Umstände nicht in der Lage sind,<br />
sich selbst zu versorgen) bei der Haushaltsführung<br />
und den Aktivitäten des täglichen<br />
Lebens im Sinne der Unterstützung<br />
von Eigenaktivitäten und der Hilfe<br />
zur Selbsthilfe. Diese Tätigkeit schließt<br />
die Unterstützung bei der Basisversorgung<br />
unter Anleitung und Aufsicht von<br />
Angehörigen der Gesundheitsberufe mit<br />
ein. Mit dieser Ausbildung lernt man, alte<br />
Menschen in Alten- und Pflegeheimen,<br />
aber auch in ihrem gewohnten Umfeld zu<br />
Hause zu unterstützen, was für die Würde<br />
der Menschen sehr wichtig ist.<br />
Wenn Sie Interesse an einer Ausbildung<br />
haben, nehmen Sie Kontakt mit<br />
einem Alten- und Pflegeheime oder<br />
mit einem der Mobilen Dienste in<br />
Ihrer Umgebung auf und vereinbaren<br />
Sie einen Schnuppertag. Es gibt in der<br />
Region Wels/Grieskirchen/Schärding<br />
fünf Ausbildungsstätten für Sozialund<br />
Gesundheitsberufe. Unter www.<br />
sinnstifter.at findet man dazu weitere<br />
Informationen.<br />
SoNe Soziales Netzwerk<br />
Eduard-Bach-Straße 5, 4540 Bad Hall<br />
07258 29300, E-Mail: office@sone.co.at<br />
www.sone.co.at<br />
Ausbildungsbeginn FSB „A“<br />
BFI Ried – Herbst 2<strong>01</strong>7<br />
Beratungstermine jeden Dienstag<br />
von 9:00-12:00 Uhr<br />
im BFI Ried - Akademiehaus<br />
SOB Wels am 13.9.2<strong>01</strong>7<br />
Altenbetreuungsschule<br />
Gaspoltshofen am 25.9.2<strong>01</strong>7<br />
Infotermin: 11.5.17 um 18:00 Uhr<br />
Altenbetreuungsschule Andorf<br />
am 6.11.2<strong>01</strong>7<br />
Infotermin: 8.6.17 um 18:00 Uhr<br />
Ausbildungsbeginn DGKP<br />
Ausbildungszentrum am<br />
Klinikum Wels Grieskirchen<br />
am 1.10.2<strong>01</strong>7<br />
Schule für allgemeine Gesundheitsund<br />
Krankenpflege Schärding<br />
am 2.11.2<strong>01</strong>7<br />
Ausbildungszentrum<br />
Wels<br />
Berufsausbildung<br />
Berufe in den Bereichen<br />
Gesundheit und Soziales sind<br />
sehr zukunftsorientiert. Dazu<br />
ist es notwendig, eine gute und<br />
qualifizierte Ausbildung anzubieten.<br />
Das Ausbildungszentrum<br />
für Gesundheit und Pflege hat<br />
langjährige Erfahrung, Fachkompetenz<br />
und kann auf eine<br />
professionelle Weiterentwicklung<br />
zurückblicken.<br />
Ein engagiertes Team von Pflegelehrpersonen,<br />
Ärzten und Vortragenden ist<br />
darum bemüht, den Auszubildenden<br />
eine Ausbildung auf hohem Niveau zu<br />
ermöglichen. Derzeit bietet das Ausbildungszentrum<br />
die Module „Gehobener<br />
Dienst für Gesundheits- und<br />
Krankenpflege“ und „2in1-Modell<br />
Pflege“ an, ab Oktober auch die Aufschulung<br />
zur „Pflegefachassistenz“ für<br />
ausgebildete Pflegehelfer bzw. Pflegeassistenten.<br />
Die enge Zusammenarbeit<br />
mit Praktikumsstellen im Klinikum<br />
Wels-Grieskirchen sowie mit<br />
Alten- und Pflegeheimen und anderen<br />
Einrichtungen im Gesundheitswesen<br />
ermöglicht den Auszubildenden, sich<br />
fundiertes Wissen anzueignen.<br />
Ausbildungszentrum<br />
für Gesundheit und Pflege<br />
Klinikum Wels-Grieskirchen<br />
Telefon 07242 41592128<br />
ausbildungszentrum@klinikum-wegr.at<br />
www.klinikum-wegr.at<br />
lebens<strong>WEGE</strong> | 19
Soziales Wels 2030<br />
Wenn die siebtgrößte Stadt<br />
Österreichs eines ihrer wichtigsten<br />
Politikfelder durch externe<br />
ExpertInnen analysieren lässt,<br />
kann das als Zeichen von Weitblick<br />
gewertet werden. Die FH Oberösterreich<br />
in Linz erarbeitete für Wels<br />
eine umfassende Studie zur Zukunft<br />
des Sozialwesens.<br />
„Unsere Analysen machten rasch deutlich,<br />
dass die Stadt Wels im Sozialbereich<br />
sehr zeitgemäße Ansätze verfolgt“, streut<br />
FH-Prof. Dr. Brigitta Nöbauer vom Department<br />
für Gesundheits-, Sozial- und<br />
Public Management der FH Oberösterreich<br />
in Linz den Welser Verantwortlichen<br />
Rosen. Sie hat im Zeitraum von rund eineinhalb<br />
Jahren jenes Forschungsprojekt<br />
geleitet, mit dem die FH Oberösterreich<br />
die Stadt Wels bei der langfristigen Sozialplanung<br />
unterstützt. Das GSP-Department<br />
der Linzer FH-Fakultät ist eines der<br />
wenigen Kompetenzzentren in Österreich,<br />
die sich intensiv mit dem Thema Sozialplanung<br />
wissenschaftlich beschäftigen.<br />
„Wir werden diesen Bereich noch weiter<br />
ausbauen“, sagt Nöbauer und weist darauf<br />
hin, dass manche andere europäische<br />
Länder sich schon wesentlich intensiver<br />
mit Sozialplanung auseinandersetzen.<br />
Ausgangspunkt Zielgruppen<br />
Die Wissenschaftler stellten eine Analyse<br />
der wichtigsten Zielgruppen und ihrer<br />
Bedürfnisse an den Anfang. „Dieses<br />
Vorgehen eröffnete uns die Chance, neue<br />
Lösungen vorzuschlagen oder die Weiterentwicklung<br />
bestehender Angebote durch<br />
neue Ideen anzuregen“, erläutert die Projektleiterin,<br />
die ExpertInnen aus der Stadt<br />
Wels und von außen, potenzielle NutzerInnen<br />
sowie „Best Practice“-Beispiele<br />
aus dem In- und Ausland in ihre Arbeit<br />
einbezog. Die wissenschaftliche Arbeit<br />
galt vor allem den Zielgruppen:<br />
• Kinder und Jugendliche<br />
• Alte Menschen<br />
• Menschen mit Beeinträchtigungen<br />
• Armutsgefährdete oder bereits<br />
von Armut betroffene Personen<br />
Als wichtigste Datengrundlagen wurden<br />
die Sozialstruktur der Bevölkerung, die<br />
Soziale Infrastruktur, die Struktur der<br />
NutzerInnen sozialer Leistungen, aktuelle<br />
Trends und Entwicklungen sowie<br />
das Sozialbudget herangezogen – jeweils<br />
bezüglich des Ist-Standes sowie<br />
der prognostizierten Entwicklung. Neben<br />
Perspektiven für die inhaltliche Weiterentwicklung<br />
des Sozialbereichs wurden<br />
auch Perspektiven für die Sozialplanung<br />
in Wels selbst erarbeitet. Die Verankerung<br />
der Partizipation durch Bürgerinnen<br />
und Bürger, sozialräumliche und abteilungsübergreifende<br />
Planungsprozesse<br />
sollen beibehalten und weiter ausgebaut<br />
werden.<br />
20 | lebens<strong>WEGE</strong>
Soziales Wels 2030<br />
Ergebnisse: Künftige strategische soziale<br />
Entwicklungsplanung<br />
Die Ergebnisse der Analyse durch die FH Oberösterreich<br />
liegen nun seit Anfang des Jahres 2<strong>01</strong>7 vor.<br />
Sie integrieren die Empfehlungen zu den einzelnen<br />
Handlungsfeldern in eine „Strategische<br />
soziale Entwicklungsplanung“. Dabei gilt<br />
vor allem das Motto ‚Vorhandene Stärken<br />
stärken‘.<br />
Quartierskonzepte<br />
weiterentwickeln<br />
Quartierskonzepte setzen an der<br />
Lebenswelt der Menschen vor<br />
Ort an. So existiert in Wels seit<br />
2<strong>01</strong>4 das „Quartier Gartenstadt“,<br />
das in den letzten Jahren<br />
zahlreiche Aktivitäten in<br />
der Otto-Löwi-Siedlung initiierte.<br />
Gemeinwesenarbeit im<br />
unmittelbaren Wohn- und<br />
Lebensumfeld gilt nach aktuellen<br />
Trends als Erfolgsfaktor.<br />
Bestehende Aktivitäten<br />
von Bürgern, Vereinen<br />
und der Wirtschaft sind die<br />
wichtigsten Ressourcen für<br />
Quartiersarbeit. Wenn Quartiere<br />
weiter verankert und weiter ausgebaut<br />
werden sollen, wäre mit<br />
Perspektive 2030 an folgenden<br />
Themen zu arbeiten: einheitliches<br />
Quartiersverständnis, vereinbarte<br />
Schwerpunkte für die einzelnen<br />
Quartiere, eine ressortübergreifende<br />
Steuerung in Form eines Beirates und eine<br />
entsprechende Finanzierung.<br />
Partnern, um gemeinsam das Zusammenleben in den Stadtteilen<br />
zu gestalten.<br />
Neue Technologien nutzen<br />
Auch im Sozialwesen warten neue Technologien auf eine noch<br />
stärkere Nutzung. Sie können intern die Dienstleistungserbringung<br />
unterstützen, aber auch den Zielgruppen das breite Angebot<br />
in zeitgemäßer Form, beispielsweise in Form einer Jugend-App<br />
oder einer Plattform für Senioren, näherbringen. Der<br />
Einsatz assistierender Technologien für ältere Menschen kann<br />
ein längeres Verbleiben in den eigenen vier Wänden ermöglichen.<br />
Forschungsteam – Forschung und Lehre<br />
Auf ProfessorInnenebene fand Projektleiterin FH-Prof. Dr.<br />
Brigitta Nöbauer Unterstützung in FH-Prof. Dr. Renate Kränzl-<br />
Nagl und FH-Prof. Dr. Anton Konrad Riedl. Dazu arbeiteten<br />
zwei wissenschaftliche MitarbeiterInnen in Teilzeit für dieses<br />
Projekt. Insgesamt wurden rund 2200 Stunden an wissenschaftlicher<br />
Arbeit erbracht.<br />
Zusätzlich wurden Studierende der Linzer Fakultät der FH Oberösterreich<br />
im Rahmen wissenschaftlicher Abschluss- und Projektarbeiten<br />
in Teilaspekte eingebunden, was auch der Qualität<br />
des Studiums dienlich war.<br />
Strategien für die Stadt Wels<br />
Die FH Oberösterreich hat mit diesem Projekt den Welser Verantwortlichen<br />
in Politik und Verwaltung eine Entscheidungsgrundlage<br />
für strategische Weichenstellungen in die Hand gegeben.<br />
An welchen Leitideen und Zielen will die Stadt Wels<br />
ihre sozialen Agenden mit der Perspektive auf das Jahr 2030<br />
ausrichten? Welche Schwerpunkte werden gesetzt, welche Prioritäten<br />
formuliert? Auf dieser Basis können dann auch Entscheidungen<br />
über die weitere Entwicklung konkreter sozialer Dienste<br />
und Einrichtungen reflektiert und verantwortungsbewusst<br />
getroffen werden.<br />
Freiwilliges Engagement<br />
Vorweg: Mit dem „Freiwilligenzentrum“ verfügt Wels<br />
über eine gute Grundlage, die es weiter- zuentwickeln<br />
gilt. Für eine ausgeweitete Freiwilligenarbeit spricht, dass<br />
neue Leistungen abseits gesetzlicher Kernaufgaben nachgefragt<br />
werden. Außerdem wächst die Altersgruppe der „jüngeren Senioren“,<br />
also einer der zentralen potenziellen Anbietergruppen<br />
von freiwilligen Leistungen. Vor allem in den Bereichen Alter,<br />
Menschen mit Beeinträchtigungen sowie Kinder und Jugendliche<br />
gibt es viele Tätigkeiten, die sinnvoll von Freiwilligen erbracht<br />
werden können.<br />
Netzwerke forcieren<br />
Mit Perspektive 2030 sollten etablierte und neu hinzugekommene<br />
Angebote im Sozialraum weiter vernetzt werden. Beispiele<br />
wären im Seniorenbereich die Vernetzung der Generationentreffs<br />
mit Sport-, Bildungs- und Kultureinrichtungen in<br />
Wels, ein Abgehen von Sonder-Wohnformen für ältere und<br />
beeinträchtigte Menschen – aufgrund des Inklusionsgedankens,<br />
aber auch aufgrund der Kosten. Oder der Ausbau gemeinsamer<br />
Aktivitäten mit den Wohnbaugenossenschaften und anderen<br />
Dr. Andreas Rabl<br />
Bürgermeister der Stadt Wels<br />
„Die Ergebnisse des Forschungsprojektes ‚Soziales Wels<br />
2030‘ zeichnen ein sehr detailliertes Bild der Ist-Situation<br />
und geben gleichzeitig wichtige Handlungsempfehlungen<br />
für die Zukunft ab.“<br />
lebens<strong>WEGE</strong> | 21
Altenbetreuung<br />
„Der<br />
sanfte<br />
heImentzug<br />
“<br />
22 | lebens<strong>WEGE</strong>
Altenbetreuung<br />
Alte Menschen sind oft Jahrzehnte<br />
in der gleichen Wohnung,<br />
im gleichen Haus, oftmals sind sie<br />
dort schon geboren, haben dort<br />
wiederum ihre Kinder geboren und<br />
großgezogen – es ist ihr ZUHAUSE.<br />
Umso verständlicher ist die Gratwanderung,<br />
von zu Hause ins Heim<br />
zu ziehen.<br />
Aufgrund von Krankheit, Gebrechlichkeit<br />
und damit einhergehender Pflegebedürftigkeit<br />
ist es aber eines Tages soweit,<br />
das vertraute Zuhause verlassen zu müssen,<br />
manchmal weil die Pflege von Angehörigen<br />
nicht mehr geleistet werden kann<br />
oder weil alte, pflegebedürftige Menschen<br />
völlig alleine sind. Die Übersiedelung<br />
in ein Alten- und Pflegeheim stellt<br />
für ältere Menschen eine große Zäsur dar.<br />
Es gibt viele Veränderungen in der Umwelt<br />
und dem Alltag: Betagte Menschen<br />
müssen ihr vertrautes Zuhause aufgeben<br />
und sich einem neuen, teils fremdbestimmten<br />
Tagesablauf im Heim anpassen.<br />
„Zeige mir, wie du wohnst, und<br />
ich sage dir, wer du bist!“<br />
Maria Gabriele Kerschhuber, MBA,<br />
Sozialkoordinatorin und<br />
Gertrude Höftberger Koordinatorin<br />
für Betreuung und Pflege vom<br />
SHV Grieskirchen haben einige<br />
hilfreiche Tipps:<br />
Wann sollte man sich mit dem<br />
Gedanken auseinandersetzen,<br />
in eine Betreuungseinrichtung<br />
zu ziehen?<br />
Huber: Je früher, desto stressfreier.<br />
Am besten zu einem Zeitpunkt, an<br />
dem das Thema Betreuung noch gar<br />
keines ist. Meistens ist es aber so, dass<br />
sich der Gesundheitszustand eines<br />
Menschen so verschlechtert, dass rascher<br />
Handlungsbedarf gegeben ist.<br />
Was ist, wenn der Betroffene<br />
keine Veranlassung sieht, das<br />
Umfeld aber schon?<br />
Höftberger: Diese Entscheidung<br />
kann nur gemeinsam getroffen werden.<br />
Alle Beteiligten sollten sich an<br />
einen Tisch setzen und reden. Es ist<br />
für ältere Menschen oft schwer einzusehen,<br />
dass sie einen Bedarf an Pflege<br />
und Betreuung haben. Sie haben den<br />
Eindruck, dass alles funktioniert. Sie<br />
übersehen dabei, dass vieles längst<br />
von Angehörigen, Nachbarn oder von<br />
sozialen Diensten übernommen wird.<br />
Was kann also getan werden,<br />
um einem betagten Menschen<br />
diesen Schritt zu erleichtern,<br />
ihm den Übergang von seinem<br />
Zuhause ins Heim möglichst<br />
sanft zu gestalten?<br />
Huber: Wichtig ist, dass sich betagte<br />
Menschen rechtzeitig an professio-<br />
„Ich will euch keine Arbeit machen.<br />
Ihr wisst ja, ich bin unkompliziert!“<br />
nelle Hilfe gewöhnen – Mobile Altenpflege,<br />
Tageszentren, Betreubares<br />
Wohnen und ein „offener Mittagstisch“<br />
in Heimen bieten sich sehr gut<br />
dazu an, um Ängste vor Fremden abzubauen<br />
und Hilfe von außen, zusätzlich<br />
zur familiären Fürsorge, zu akzeptieren.<br />
Die Inanspruchnahme einer Kurzzeitpflege<br />
für einige Tage bis zu drei Monaten<br />
bietet sich an, die Scheu vor dem<br />
Heim abzubauen. Betagte Menschen<br />
erleben den Heimalltag im Wissen,<br />
dass sie wieder nach Hause zurückkehren.<br />
Die beste Variante ist, im künftigen<br />
Wunschheim zu „schnuppern“.<br />
Oft sogar gehen Kurzzeitgäste schweren<br />
Herzens wieder nach Hause, da sie<br />
die Vorzüge des Heimes und die sozialen<br />
Kontakte zu Mitbewohnern und<br />
Personal schätzen gelernt haben.<br />
Eine integrierte Tagesbetreuung in<br />
den Alten- und Pflegeheimen, wiederum<br />
im bevorzugten Wunschheim,<br />
hilft, Ängste und Zweifel abzubauen.<br />
Kontakte zu Heimbewohnern werden<br />
oft durch gemeinsame Aktivitäten<br />
geknüpft. Ein Tagesgast fasste es so<br />
zusammen: „Ich möchte hier auch ein<br />
Zimmer haben und bei euch bleiben!“<br />
Dies alles sind Maßnahmen, die lange<br />
vor einem Heimeintritt gesetzt werden<br />
können und sollen, um einen betagten<br />
Menschen „sanft“ auf die mögliche Situation<br />
einer Betreuung und Pflege im<br />
Heim vorzubereiten.<br />
lebens<strong>WEGE</strong> | 23
Altenbetreuung<br />
Haben Menschen, die lange allein<br />
gelebt haben, größere Probleme mit<br />
dem Einzug ins Heim?<br />
Huber: Einige haben durchaus das Bedürfnis,<br />
in eine Einrichtung zu ziehen,<br />
um wieder mehr unter Leute zu kommen.<br />
Waren sie allerdings schon sehr lange<br />
allein, kann es schwierig werden, sie zu<br />
motivieren. Die Vorstellung, plötzlich in<br />
einem Speisesaal voller Menschen Mittag<br />
zu essen, kann großen Stress verursachen.<br />
Belastend kann außerdem sein, dass<br />
man als Bewohner einer betreuten Einrichtung<br />
sehr viel mit Themen konfrontiert<br />
wird, vor denen man vielleicht Angst<br />
hat. Man ist, umgeben von vielen alten<br />
Menschen, sieht wie manche krank und<br />
kränker werden, irgendwann sterben.<br />
Angehörige übersehen diesen Punkt oft.<br />
Was kann getan werden, wenn die<br />
Pflegebedürftigkeit eintritt, wenn die<br />
formalen Dinge erledigt, der Heimund<br />
Sozialhilfeantrag bereits gestellt<br />
und das Zimmer zugesagt ist?<br />
Höftberger: Manche Einrichtungen laden<br />
zwecks Kennenlernen von Bewohner<br />
und Angehörigen zum „Angehörigencafè“,<br />
wo Vorlieben, Besonderheiten in<br />
der Biografie, Erwartungen, Hoffnungen<br />
und Ängste angesprochen werden können.<br />
Welche Form des Kennenlernens,<br />
auch gewählt wird: Den Mitarbeitern und<br />
Mitarbeiterinnen der Alten- und Pflegeheime<br />
ist es ein Anliegen, den betagten<br />
und pflegebedürftigen Menschen in dieser<br />
besonderen Lebenslage zur Seite zu<br />
stehen und dort Unterstützung anzubieten,<br />
wo der Heimbewohner sie braucht.<br />
Gib es typische Fehler,<br />
die Angehörigen passieren?<br />
Höftberger: Zu viel Druck auszuüben,<br />
ist sehr ungünstig. Es geht um eine einschneidende<br />
Veränderung. Man muss damit<br />
leben können, dass ältere Menschen<br />
oft mehrere Anläufe brauchen, bis sie<br />
sich zu einem Heimeinzug entschließen.<br />
Mit welchen Wartezeiten ist<br />
zu rechnen?<br />
Huber: In der stationären Pflege in einem<br />
Pflegeheimen hängen die Wartezeiten<br />
von der Dringlichkeit, dem Zeitpunkt der<br />
Anmeldung sowie von speziellen Wünschen<br />
ab.<br />
UNTERSTÜTZUNG FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE<br />
„TAGESBETREUUNG IM BSH LEUMÜHLE“<br />
Im Bezirksseniorenheim Leumühle wird von Montag<br />
bis Sonntag von 07:30 bis 17:30 Uhr in den<br />
Wohnbereichen eine integrierte Tagesbetreuung<br />
angeboten. „Alle Interessierten haben ab sofort<br />
die Möglichkeit, in Form von Ganz- bzw. Halbtagesbetreuungen<br />
(inkl. Verpflegung) alle Vorzüge einer<br />
qualifizierten Pflege in Anspruch zu nehmen und<br />
parallel dazu das Leben des Bezirksseniorenheimes<br />
Leumühle getreu unserem Leitbild ‚Beziehung<br />
schafft Vertrauen’ kennenzulernen“, versichert<br />
Nina Spale, B.A., Heimleitung.<br />
Bei der integrierten Tagesbetreuung<br />
wird der zu betreuende<br />
Gast aktiv in das Alltagsgeschehen<br />
des Seniorenheimes<br />
eingebunden. Dabei wird auf<br />
die individuelle Lebenssituation<br />
und die Biografie des<br />
Gastes eingegangen und die<br />
Erhaltung bzw. Wiedergewinnung<br />
einer möglichst selbstständigen<br />
Lebensführung gefördert.<br />
Dieser Grundstein soll<br />
den pflegenden Angehörigen<br />
das Vertrauen und das Behagen<br />
vermitteln, den zu Betreuenden<br />
in der integrierten<br />
Tagesbetreuung des Bezirksseniorenheimes<br />
Leumühle gut<br />
versorgt zu wissen. Die Betreuung<br />
wirkt unterstützend<br />
und entlastend.<br />
Die Kosten für eine Ganztagesbetreuung<br />
belaufen sich auf<br />
€ 52,-, für eine Halbtagesbetreuung<br />
auf € 26,- (inkl. Verpflegung).<br />
Um als Tagesgast aufgenommen<br />
zu werden, bedarf es einer<br />
persönlichen Vorbesprechung<br />
(Anamneseerhebung, Kostenerklärung,<br />
Hausführung) mit<br />
dem zu Betreuenden und seinen<br />
Angehörigen.<br />
„Die pflegenden<br />
Angehörigen haben<br />
somit die Möglichkeit,<br />
dem eigenen Beruf<br />
nachzugehen oder einzelne<br />
pflegefreie Tage zu<br />
gewinnen, die für die<br />
Regeneration und das<br />
Aufrechterhalten des<br />
eigenen Lebens sehr<br />
wichtig sind.“<br />
Terminvereinbarung:<br />
Bezirksseniorenheim<br />
Leumühle<br />
Leumühle 1, 4070 Eferding<br />
Nina Spale, B.A.<br />
Tel.: 07272 236715<br />
E-Mail: nina.spale@shvef.at<br />
24 | lebens<strong>WEGE</strong>
Altenbetreuung<br />
A MENSCH<br />
MECHT<br />
I BLEIM!<br />
Im Bezirksalten- und Pflegeheim Lambach<br />
wird seit Anfang 2<strong>01</strong>5 die Mäeutik gelebt.<br />
Nur was genau bedeutet das? DGKP Sabine Waser<br />
ist die Leitung des Betreuungs- und Pflegedienstes<br />
in Lambach und gibt uns einen Einblick in die<br />
Philosophie des Heims.<br />
Mäeutik bedeutet „Hebammenkunst“.<br />
Sie bezeichnet die Art und Weise, wie<br />
jemandem durch einfühlsames, gezieltes<br />
Fragen und/oder Handeln zu einer Einsicht<br />
verholfen wird, ohne ihm eine vorgefertigte<br />
Antwort aufzuerlegen.<br />
Aus diesem Ansatz heraus ergibt sich<br />
auch die Freiheit im Handeln sowie die<br />
Notwendigkeit, sich auf das Gegenüber<br />
einzulassen und hineinzufühlen. Um ein<br />
besseres Einfühlen zu ermöglichen, ist<br />
es äußerst wichtig, die Vorgeschichte des<br />
Menschen zu kennen, was einen persönlichen,<br />
fließenden Austausch mit den Angehörigen<br />
erfordert.<br />
Bei uns werden die Angehörigen eingebunden<br />
und eingeladen, sich am<br />
Heimleben zu beteiligen, da sie ein sehr<br />
wichtiger Teil des Bewohners sind. Aus<br />
diesem Grund bitten wir auch um Mithilfe<br />
beim Erstellen einer Lebensgeschichte.<br />
So können manche Verhaltensweisen,<br />
Ängste oder Aussagen eines Menschen<br />
gedeutet und verstanden werden, damit<br />
in angemessener Art und Weise darauf<br />
reagiert werden kann. Um einen guten Informationsfluss<br />
und Austausch zwischen<br />
Angehörigen und Pflegepersonal zu gewährleisten,<br />
gibt es in der Mäeutik den<br />
sogenannten Bezugsbetreuenden.<br />
Ein Bezugsbetreuender ist im Besonderen<br />
für zwei bis drei Bewohner seines Bereiches<br />
da. Er dient als Sprachrohr bzw.<br />
Anlaufstelle in allen Belangen dieser Bewohner<br />
und deren Angehörigen.<br />
Dieser Bezugsbetreuende stellt sich mit<br />
Namen sowie Funktion beim Bewohner<br />
und dessen Angehörigen vor. Es wird<br />
auch immer weitestgehend auf zwischenmenschliche<br />
Sympathien geachtet und<br />
Rücksicht genommen. Er kann im Falle<br />
von Fragen eines Angehörigen oder auch<br />
einfach nur für eine nette Unterhaltung<br />
kontaktiert werden. Sollte dieser Mitarbeiter<br />
gerade nicht im Haus sein, stehen<br />
andere Mitarbeiter des Pflegepersonals<br />
zur Verfügung. Im Rahmen dieser mäeutischen<br />
Pflege wird auch pro Bewohner<br />
ein- bis zweimal im Jahr eine Bewohnerbesprechung<br />
abgehalten. Hierzu werden<br />
alle, die an der Pflege und dem Alltag des<br />
Bewohners beteiligt sind, eingeladen, um<br />
aus allen Blickwinkeln ein möglichst detailliertes<br />
Bild zu erstellen. Auch die Angehörigen<br />
sind ein wichtiger Teil dieses<br />
Gefüges. Daher werden auch sie ersucht,<br />
daran teilzunehmen.<br />
Es ist uns sehr wichtig, dass Angehörige<br />
das Gefühl haben, weiterhin ein Teil des<br />
Lebens ihres pflegebedürftigen Verwandten<br />
zu sein. Um eine mäeutische und<br />
somit gefühlte und erlebensorientierte<br />
Pflege praktizieren zu können, ist es unerlässlich,<br />
dass sich alle Beteiligten eingeschlossen<br />
fühlen.<br />
Funktioniert die Pflege Hand in Hand,<br />
kann der pflegebedürftige Mensch von<br />
allen Seiten gestützt und aufgefangen<br />
werden, aber auch wieder guten Mutes<br />
einige Schritte selbstständig tun, in dem<br />
sicheren, verstandenen Wissen, rundherum<br />
geborgen zu sein.<br />
lebens<strong>WEGE</strong> | 25
Altenbetreuung<br />
Weil Weil<br />
es um<br />
es um<br />
Menschen Menschen<br />
geht!<br />
geht!<br />
Das Das OÖ OÖ Hilfswerk ist ist ein ein Anbieter von sozialen Dienstleistungen rund um um<br />
Das OÖ Hilfswerk ist ein Anbieter von sozialen Dienstleistungen rund um<br />
Kinder, Kinder, Jugend und und Familie, ältere Menschen, Haushalt, Gesundheit und<br />
Kinder, Jugend und Familie, ältere Menschen, Haushalt, Gesundheit und<br />
Pflege. Pflege.<br />
Pflege.<br />
Hilfe, Hilfe, Unterstützung Unterstützung und und Beratung: Beratung: im im Haushalt, mobile Betreuung und und Hilfe Hilfe<br />
Hilfe, Unterstützung und Beratung: im Haushalt, Betreuung Hilfe<br />
für<br />
für<br />
ältere<br />
ältere<br />
Menschen,<br />
Menschen,<br />
mobiler<br />
mobiler<br />
Mittagstisch,<br />
Mittagstisch,<br />
mobile<br />
mobile Therapie,<br />
Therapie,<br />
24-Stunden-<br />
24-Stundenfür<br />
ältere Menschen, mobiler Mittagstisch, mobile Therapie, 24-Stunden-<br />
Betreuung,<br />
Betreuung,<br />
Notruftelefon,<br />
Notruftelefon,<br />
mobile<br />
mobile<br />
Frühförderung,<br />
Frühförderung,<br />
Krabbelstube,<br />
Krabbelstube, Kindergarten,<br />
Kindergarten,<br />
Betreuung, Hort, Schülernachmittagsbetreuung Notruftelefon, mobile Frühförderung, für Kinder, Krabbelstube, Institut Legasthenie, Kindergarten, Lern-<br />
Hort, Schülernachmittagsbetreuung für Kinder, Institut Legasthenie, Lern-<br />
Hort, Schülernachmittagsbetreuung begleitung, Arbeitsbegleitung für für Jugendliche. Kinder, Institut Möglichkeiten Legasthenie, ehrenamtlicher<br />
Lernbegleitung,<br />
Arbeitsbegleitung für Jugendliche. Möglichkeiten ehrenamtlicher<br />
begleitung, Mitarbeit. Arbeitsbegleitung für Jugendliche. Möglichkeiten ehrenamtlicher<br />
Mitarbeit.<br />
Mitarbeit.<br />
Service und Info zu unseren Diensten erhalten Sie unter:<br />
Service und Info zu unseren Diensten erhalten Sie unter:<br />
Service Telefon und Info 0732/775111-0 zu unseren Diensten erhalten Sie unter:<br />
Telefon 0732/775111-0<br />
Telefon www.hilfswerk.at<br />
0732/775111-0<br />
www.hilfswerk.at<br />
www.hilfswerk.at<br />
QUALITÄT VON MENSCH ZU MENSCH.<br />
QUALITÄT VON MENSCH ZU MENSCH.<br />
QUALITÄT VON MENSCH ZU MENSCH.<br />
„DaheiM“<br />
Mit großem Pioniergeist haben Mag. Ulrike Pjeta und Ihr<br />
Mann Dr. Otto Pjeta vor 27 Jahren den Sozialmedizinischen<br />
Betreuungsring „DAHEIM“ für die Gemeinden Bad Wimsbach-<br />
Neydharting, Eberstalzell, Fischlham, Sattledt und Steinerkirchen<br />
an der Traun aufgebaut.<br />
Mehr als 3000 Menschen haben<br />
in den vergangenen Jahren die angebotenen<br />
Dienste des professionellen<br />
Pflegeteams in Anspruch<br />
genommen. Ziel ist die Bewahrung<br />
hoher Lebensqualität und sozialer<br />
Kontakte pflegebedürftiger<br />
Mitbürgerinnen und Mitbürger<br />
im eigenen Zuhause. Ihnen allen<br />
wurde ein längeres Verbleiben im<br />
eigenen Zuhause und im Kreise<br />
ihrer Familien ermöglicht. Auch<br />
mit kurzfristiger Betreuung nach<br />
unvorhergesehenen Ereignissen<br />
konnte geholfen werden. Die Hilfeleistungen<br />
und Pflegeangebote<br />
reichen von der Hauskrankenpflege,<br />
Altenbetreuung, Heimhilfe,<br />
Essen auf Rädern bis zu Betreubaren<br />
Wohnen.<br />
vereindaheim.at<br />
26 | lebens<strong>WEGE</strong>
hIlfe fÜr<br />
PFlegenDe angehÖrige<br />
Derzeit leben in Oberösterreich rund 80.000 pflege- und betreuungsbedürftige<br />
Personen. Laut Berechnungen wird sich diese Zahl in den kommenden zehn Jahren auf<br />
94.000 Personen erhöhen – 2030 dürften bereits über 100.000 Oberösterreicherinnen<br />
und Oberösterreicher auf Pflegedienstleistungen angewiesen sein. „Speziell für<br />
pflegende Angehörige bietet das Sozialressort des Landes Oberösterreich ein<br />
umfassendes Informationsangebot. Unter www.pflegeinfo-ooe.at finden sich alle Informationen<br />
zum Thema Pflege auf einen Blick“, betont Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer.<br />
Altenbetreuung<br />
Bereits heute gibt es in Oberösterreich eine Vielzahl an Unterstützungsmöglichkeiten<br />
für pflegebedürftige ältere Menschen<br />
sowie für deren Angehörige. „Mein Ziel ist es, diese Unterstützungsmöglichkeiten<br />
bekannter zu machen und alle notwenigen<br />
Informationen auf einen Blick zur Verfügung zu stellen“, so Birgit<br />
Gerstorfer.<br />
Alle Informationen auf einen Blick<br />
Die Informationsplattform www.pflegeinfo-ooe.at ermöglicht<br />
ein rasches und einfaches Auffinden aller relevanten Angebote<br />
zur Pflege. Die Plattform beantwortet Fragen zu den Themenbereichen<br />
der Unterstützung in der Betreuung und Pflege, zu Unterstützungsleistungen<br />
speziell für pflegende Angehörige sowie<br />
zu finanziellen und rechtlichen Aspekten der Pflege.<br />
Dabei werden nicht nur die jeweiligen Leistungen beschrieben,<br />
sondern auch konkrete Berechnungsmodelle angeboten – beispielsweise<br />
um den auf die eigene Situation zutreffenden Kostenbeitrag<br />
für einen mobilen Pflegedienst zu berechnen.<br />
Alle diese Themen finden<br />
Sie auf der Pflegeinfo-oÖ,<br />
Plattform Unterstützung<br />
in der Pflege und<br />
Betreuung<br />
• Mobile Pflegedienste<br />
• Alten- und Pflegeheime<br />
• Kurzzeitpflege<br />
• Tagesbetreuung<br />
• Wohnformen im Alter<br />
• 24-Stunden-Betreuung<br />
• Mobile Hospiz- und<br />
Palliativteams<br />
• Mahlzeitendienste<br />
• Rufhilfe<br />
• Wohnraumadaptierung<br />
• Demenz<br />
Unterstützung für<br />
pflegende Angehörige<br />
• Angehörigen-<br />
Entlastungsdienst<br />
• Sozialberatungsstelle<br />
• BürgerInnenservice des<br />
Sozialministeriums<br />
(vormals Pflegetelefon)<br />
• Psychosoziale Beratung<br />
• Onlineberatung<br />
• Stammtisch für<br />
pflegende Angehörige<br />
• Entlassungsmanagement,<br />
Überleitungspflege<br />
Krankenhaus<br />
• Erholungstage<br />
• Demenz<br />
Finanzielles und<br />
Rechtliches<br />
• Pflegegeld<br />
• Finanzielle Unterstützung<br />
für Ersatzpflege<br />
• Senioren-, Erholungsoder<br />
Kurzuschuss<br />
• Förderung zur<br />
24-Stunden-Betreuung<br />
• Beruf und Pflege<br />
• Rezeptgebührenbefreiung<br />
• Unterstützungsfonds für<br />
die Wohnraumadaptierung<br />
• Förderung für behindertengerechten<br />
Umbau<br />
• Steuerliche Absetzbarkeit<br />
• Behindertenpass<br />
• Parkausweis<br />
• Rechtsberatung<br />
Einmal<br />
Alles.<br />
Strom<br />
Gas<br />
Wärme<br />
Wasser<br />
Abwasser<br />
Elektrotechnik<br />
Haustechnik<br />
Kommunaltechnik<br />
ITandTEL<br />
Solar<br />
Voller Energie für morgen: eww.at<br />
lebens<strong>WEGE</strong> | 27
Kinder & Jugendliche<br />
sozialPäDagogisches tagesWohnen<br />
kInder und JugendlIche<br />
Die teilstationäre, sozialpädagogische Einrichtung bekommt Kinder<br />
und Jugendliche im Alter von 6 – 12 Jahren (in Ausnahmefällen bis<br />
14 Jahren) über die Kinder- und Jugendhilfe zugewiesen. Die Einrichtung<br />
bietet Platz für acht Kinder und Jugendliche, die von Montag<br />
bis Freitag in der Zeit nach der Schule bis 18 Uhr betreut werden.<br />
Kontakt:<br />
E-Mail: daniela.eglseder@wels.gv.at<br />
wels.gv.at<br />
Der sozialpädagogische Arbeitsalltag<br />
orientiert sich an den Bedürfnissen,<br />
Fähigkeiten und Möglichkeiten der<br />
Kinder und Jugendlichen. Den jungen<br />
KlientenInnen bieten sich in der<br />
Interaktion mit den anderen Kindern/Jugendlichen<br />
und Erwachsenen<br />
Lernchancen für die Entwicklung<br />
eines adäquaten Sozialverhaltens.<br />
Durch die Stärkung der Kommunikationsfähigkeit<br />
der Kinder und Jugendlichen<br />
können in Kooperation<br />
und Partizipation eigene Handlungsmuster<br />
entwickelt, bearbeitet, besprochen<br />
und ausprobiert werden. Im<br />
sozialpädagogischen Tageswohnen<br />
ermöglichen klar strukturierter Tagesablauf<br />
und verbindlich geltende<br />
Regeln ein soziales Miteinander<br />
und geben dem Kind ein Gefühl der<br />
Sicherheit. Die Kinder und Jugendlichen<br />
setzen sich mit ihren Gefühlen<br />
auseinander, erlernen einen angemessenen<br />
Umgang mit diesen und<br />
lernen ihre eigenen Grenzen kennen<br />
und diese zu wahren. Ein weiterer<br />
Schwerpunkt der Einrichtung<br />
liegt in der Elternarbeit. Die Aufgabe<br />
besteht darin, die Eltern in ihrer<br />
Erziehungskompetenz zu stärken,<br />
gemeinsam ihre Ressourcen zu erkennen<br />
und positiv zu nutzen, einen<br />
neuen Blickwinkel auf das eigene<br />
Kind zu bekommen und es in allen<br />
Belangen zu unterstützen, zu fordern<br />
und zu fördern. Die gesammelten Informationen<br />
werden in schriftlicher<br />
und mündlicher Form an die Kinderund<br />
Jugendhilfe, im Speziellen an<br />
die zuständigen SozialarbeiterInnen<br />
weitergegeben.<br />
ZIELE DES TEILSTATIONÄREN<br />
SOZIALPÄDAGOGISCHEN<br />
TAGESWOHNENS DES MAGISTRATS<br />
DER STADT WELS:<br />
• Individuelle Förderung in der Kleingruppe<br />
• Förderung einer positiven<br />
Persönlichkeitsentwicklung<br />
• Verbesserung der Erziehungsbedingungen<br />
in der Herkunftsfamilie<br />
„Angenommen zu werden, Sicherheit<br />
und Stabilität zu spüren sind die Basis<br />
einen stabilen, tragfähigen Beziehung.<br />
Gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten<br />
versuchen wir eine Umgebung des<br />
Miteinanders zu schaffen.“<br />
Daniela eglseder, Bereichsleitung<br />
28 | lebens<strong>WEGE</strong>
Kinder & Jugendliche<br />
Die SozialarbeiterInnen sind an bestimmten<br />
Tagen in „ihren“ Schulen anwesend<br />
und haben ein offenes Ohr für die Kinder<br />
und Jugendlichen. Aber auch die Eltern und<br />
die PädagogenInnen können sich an SuSA<br />
wenden, wenn sie sich um ein Kind Sorgen<br />
machen. Gemeinsam mit den Kindern und<br />
Eltern wird dann besprochen, welche Hilfen<br />
Schulsozialarbeit<br />
(SuSA)<br />
Susa ist eine besondere Form der Zusammenarbeit der<br />
Kinder- und Jugendhilfe mit Schulen. Soziale und familiäre<br />
Belastungen können dazu führen, dass Kinder und Jugendliche in der<br />
Schule weniger erfolgreich sind. An mehr als 200 Pflichtschulen<br />
Oberösterreichs unterstützen SozialarbeiterInnen der Kinderund<br />
Jugendhilfe Familien, damit ihre Kinder den Schulalltag gut<br />
bewältigen und zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen<br />
Erwachsenen heranwachsen können.<br />
cc_Nachhaltigkeit_88x128_5_Layout 1 08.03.2<strong>01</strong>7 14:39 Seite 1<br />
erforderlich sind. Wenn die Eltern das wollen,<br />
können die SozialarbeiterInnen auch zu<br />
ihnen nach Hause kommen.<br />
SuSA ist ein präventiver sozialer Dienst<br />
der Kinder- und Jugendhilfe. Die Teilnahme<br />
ist freiwillig.<br />
Liste der Präsenzschulen<br />
Schuljahr 2<strong>01</strong>6/2<strong>01</strong>7<br />
Wels Land<br />
• VS Lambach<br />
• VS I & II Marchtrenk<br />
• VS Pichl<br />
• VS Sattledt<br />
• NMS I & II Lambach<br />
• NMS Pichl<br />
• NMS I & II Marchtrenk<br />
• NMS Sattledt<br />
• NMS Stadl Paura<br />
Wels Stadt<br />
• VS 8 Wels – Vogelweide<br />
• VS 9 Wels – Vogelweide<br />
• VS 10 Wels – Lichtenegg<br />
• VS 11 Wels – Lichtenegg<br />
• IBMS 1 – Stadtmitte<br />
• NMS 2 – Pernau<br />
• SMS – Wels<br />
• NMS 5 – Mozartschule<br />
• NMS 8 – Lichtenegg<br />
• PTS Wels<br />
Eferding<br />
• VS Alkoven<br />
• VS Aschach<br />
• VS Eferding Süd<br />
• NMS Alkoven<br />
• NMS Aschach<br />
• NMS Eferding Nord<br />
• NMS Eferding Süd<br />
• NMS Hartkirchen<br />
• PTS Eferding<br />
• Martin Buber<br />
LASO Hartheim<br />
fair gehandelt.<br />
nah versorgt.<br />
Grieskirchen<br />
• VS Gallspach<br />
• VS Grieskirchen<br />
• VS Haag<br />
• VS Natternbach<br />
• VS Waizenkirchen<br />
• NMS Bad Schallerbach<br />
• NMS Grieskirchen I<br />
• NMS Grieskirchen II<br />
• NMS Gaspoltshofen<br />
• NMS Neumarkt/Kallham<br />
• SNMS Peuerbach<br />
• NMS Pram<br />
kinder-jugendhilfe-ooe.at<br />
lebens<strong>WEGE</strong> | 29
Kinder & Jugendliche<br />
sPrachunterricht<br />
für Kinder<br />
Im stressigen Familienalltag<br />
wird oft nur mehr in Schlagwörtern<br />
statt in vollständigen Sätzen<br />
gesprochen und ältere<br />
Generationen mit langsamerem<br />
Sprachtempo sind nicht mehr<br />
so intensiv in die Familie<br />
eingebunden. Kinder entwickeln<br />
daher oft ihre eigene Sprache.<br />
Die Ursachen dafür können<br />
vielfältig sein, zum Beispiel<br />
in der Hörwahrnehmungsverarbeitung<br />
liegen oder sie können<br />
auch motorische Ursachen<br />
haben. Denken Sie daran: Das<br />
passive Berieseln über das<br />
Fernsehgerät kann echte verbale<br />
Kommunikation nicht ersetzen.<br />
STANDoRTe<br />
VH eferding<br />
Bahnhofstraße 24 | 4070 Eferding<br />
VS Peuerbach<br />
Schulplatz 1 | 4722 Peuerbach<br />
Kindergarten wels<br />
Herderstraße 60 | 4600 Wels<br />
integrationsbüro wels<br />
Traunaustraße 11 | 4600 Wels<br />
edt b. L<br />
Trefflingerstraße 3<br />
4650 Edt bei Lambach<br />
Verein Vital<br />
Starhemberg 19 | 4680 Haag/H<br />
Martina Bernegger<br />
Martina.bernegger@volkshilfe-ooe.at<br />
0676 87341142<br />
Die Volkshilfe OÖ ist der größte Logopädie-Anbieter<br />
im Kindersprachbereich<br />
und heißt seit letztem Jahr Volkshilfe<br />
Gesundheits- und Soziale Dienste<br />
GmbH – kurz GSD GmbH. In den Kindergärten<br />
werden im Auftrag des Landes<br />
OÖ – Abteilung Kinder- und Jugendhilfe<br />
– lückenlose Sprachscreenings und<br />
Hörtests mit einem tragbaren Audiometer<br />
durchgeführt. Der Fokus liegt bei<br />
Kindern zwischen 4 und 6 Jahren.<br />
Bei den Sprachtests werden Sprachauffälligkeiten<br />
erkannt. Es kann sein,<br />
dass ein Kind noch Schwierigkeiten<br />
hat, richtige Sätze zu bilden, alle Laute<br />
richtig auszusprechen, stottert, eine<br />
heisere Stimme oder andere Probleme<br />
hat. Nach der Untersuchung kommen<br />
die Eltern zu einem kurzen Beratungsgespräch<br />
in den Kindergarten. Dabei<br />
bespricht die Logopädin mit den Eltern<br />
das Untersuchungsergebnis und ob das<br />
Kind Logopädieunterricht benötigt.<br />
9 von 10 Kindern lernen durch die Logopädische<br />
Therapie richtig zu sprechen.<br />
So werden sprachliche Defizite möglichst<br />
vor dem Schuleintritt behoben<br />
und den Kindern wird ein guter Start in<br />
die Schullaufbahn zu ermöglicht.<br />
tiPP<br />
Sie können Ihren Nachwuchs fördern,<br />
indem Sie beispielsweise Gedichte,<br />
Geschichten und Märchen vorlesen<br />
oder Reime erfinden.<br />
Was kostet Logopädie?<br />
Zum ersten Termin sollen die Eltern<br />
eine Überweisung von einer Ärztin oder<br />
einem Arzt mitbringen. Dann wird die<br />
Therapie mit der jeweiligen Krankenkasse<br />
verrechnet und ist für die Eltern<br />
kostenlos.<br />
30 | lebens<strong>WEGE</strong>
lebens<strong>WEGE</strong> | 31
Hörimplantat<br />
oPtiMales Verstehen<br />
trotz hÖrBeeInträchtIgung<br />
In der Implantologie von Hörhilfen<br />
zählt die HNO-Abteilung am Klinikum<br />
Wels-Grieskirchen zu den Vorreitern<br />
in Österreich. Gelungen ist<br />
hier vor sechs Jahren auch erstmals<br />
die zeitgleiche Versorgung beider<br />
Ohren mit einem Bonebridge-<br />
Implantat in nur einem Eingriff – die<br />
Ergebnisse bestärken die HNO-Spezialisten<br />
heute, dass es sich hierbei<br />
um eine zuverlässige Lösung für<br />
optimales Sprachverständnis und<br />
Richtungshören handelt.<br />
Knochenleitungsimplantate sind eine<br />
Versorgungsalternative für Patienten mit<br />
Schallleitungsschwerhörigkeit und kombinierter<br />
Schwerhörigkeit, die aufgrund<br />
von Fehlbildungen des Außen- oder Mittelohrs<br />
nicht mit einem konventionellen<br />
Hörgerät versorgt werden können.<br />
So funktioniert die Bonebridge<br />
„Beim aktiven semi-implantierbaren<br />
Knochenleitungsimplantat Bonebridge<br />
wird der Schall vom Sprachprozessor<br />
hinter dem Ohr aufgenommen und induktiv<br />
auf das Implantat übertragen“, erklärt<br />
Thomas Keintzel, Leiter der Abteilung<br />
für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten.<br />
„Der BC-FMT, ein magnetischer Schwinger,<br />
welcher mit zwei Schrauben in der<br />
Schädelkalotte verankert ist, überträgt<br />
den Schall unter Umgehung der Mittelohrstrukturen,<br />
indem der Schädelknochen<br />
in Schwingung versetzt wird, auf<br />
die Hörschnecke.“ Bei der Schallübertragung<br />
über die Knochenleitung werden<br />
durch das Implantat immer beide Hörschnecken<br />
stimuliert. Da dies mit einer<br />
zeitlichen Verzögerung geschieht, ist es<br />
Patienten auch bei beidseitiger Verwendung<br />
eines Knochenleitungsimplantats<br />
möglich, den Ort einer Schallquelle zu<br />
lokalisieren.<br />
Verbessertes Sprachverstehen für<br />
mehr Lebensqualität<br />
Eine weitere Indikation für Knochenleitungsimplantate<br />
ist die transkranielle<br />
CROS*-Versorgung von Patienten mit<br />
einseitiger Ertaubung und Normalgehör<br />
auf der entgegengesetzten Körperseite,<br />
deren Hörvermögen nicht durch ein<br />
Cochlea-Implantat wiederhergestellt werden<br />
kann. „Wie wir in einer Vergleichsstudie<br />
mit CI-Patienten zeigen konnten,<br />
profitieren einseitig taube Patienten von<br />
einer transkraniellen CROS-Versorgung<br />
durch eine Verbesserung des Sprachver-<br />
1. 2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
stehens in geräuschvoller Umgebung und<br />
haben durch die Reduktion der Höranstrengung<br />
einen signifikanten Zugewinn<br />
an Lebensqualität“, zieht Keintzel ein positives<br />
Resümee.<br />
Prim. Dr. Thomas Keintzel,<br />
Leiter der Abteilung für<br />
Hals-, Nasen- und<br />
Ohrenkrankheiten am<br />
Klinikum Wels-Grieskirchen<br />
So HÖReN wiR<br />
Ob laut oder leise, hoch oder tief, unsere Ohrmuscheln fangen alle Geräusche<br />
aus unserer Umgebung als Schallwellen auf und leiten sie an das<br />
Trommelfell weiter. Die dort entstehenden Schwingungen werden auf die<br />
kleinen Gehörknöchelchen (Hammer, Amboss und Steigbügel) übertragen<br />
und bis zum eigentlichen Hörorgan, der mit Flüssigkeit gefüllten Hörschnecke,<br />
weitergeleitet, wo wiederum feine Haarzellen die mechanischen<br />
Schwingungen in elektrische Nervenimpulse umwandeln. Über den Hörnerv<br />
gelangen diese Informationen zum Gehirn, wo sie schließlich verarbeitet<br />
werden. Durch einen zu hohen Lärmpegel können die Haarzellen auf Dauer<br />
geschädigt werden. Wenn diese Zellen absterben, können sie sich nicht<br />
mehr erneuern – so beginnt eine Schwerhörigkeit!<br />
So LAUT iST UNSeR TAG<br />
Absolut still ist es eigentlich nie: Die Bandbreite der Lautstärke, der wir<br />
beinahe rund um die Uhr ausgesetzt sind, wird in Dezibel (dB) gemessen<br />
und reicht von niedrig bis sehr hoch. So läutet zum Beispiel unser Wecker<br />
mit durchschnittlich 75 dB, das Baby schreit manchmal mit über 100 dB,<br />
während Presslufthammer und Baustelle von nebenan mit guten 90 dB<br />
lärmen. Während wir mit ca. 30 dB flüstern, sprechen wir mit 60 dB normal<br />
und mit 70 dB laut. In der Diskothek tanzen wir bei 100 dB. Der Lärm eines<br />
Verkehrsflugzeugs in unmittelbarer Nähe trifft uns mit 120 dB. Achtung!<br />
Die Schmerzschwelle liegt bei 130 dB.<br />
1. Sprachprozessor<br />
2. Der Schall wird vom Sprachprozessor<br />
aufgenommen und auf das Knochenleitungsimplantat<br />
übertragen.<br />
3. Bone Conduction-Floating Mass<br />
Transducer (BC-FMT)<br />
4.<br />
5.<br />
Der BC-FMT, der mit zwei Schrauben<br />
in der Schädelkalotte verankert ist,<br />
versetzt dann den Schädelknochen in<br />
Schwingung und die Information wird<br />
auf beide Hörschnecken übertragen.<br />
Innenohr<br />
In den letzten acht Jahren wurden an der HNO-Abteilung des Klinikum Wels-Grieskirchen über<br />
430 Implantationen erfolgreich durchgeführt. Seit 2<strong>01</strong>2 wurden 39 Erwachsene und 11 Kinder<br />
mit einer Bonebridge versorgt.<br />
* Contralateral Routing of Signal<br />
32 | lebens<strong>WEGE</strong>
Hearing Implant Systems<br />
SYNCHRONY<br />
Cochleaimplantat-System<br />
SYNCHRONY EAS<br />
Hörimplantat-System<br />
VIBRANT SOUNDBRIDGE ®<br />
Mittelohrimplantat-System<br />
BONEBRIDGE ®<br />
Knochenleitungsimplantat-System<br />
ADHEAR<br />
Knochenleitungshör-System<br />
MED-EL Niederlassung Wien | ZENTRUM HÖREN<br />
Fürstengasse 1 | 1090 Wien | Tel. +43(0)1-317 24 00<br />
office@at.medel.com | medel.com<br />
medel.com<br />
Solutions for Hearing Loss<br />
lebens<strong>WEGE</strong> | 33
Stimmen aus der Region<br />
stiMMen aus<br />
der regIon<br />
„Zur Zeit sauge ich alle Pollen an<br />
und bin abends ziemlich erledigt.<br />
Gerade jetzt leide ich sehr.<br />
Ich wasche mir täglich am Abend<br />
die Haare, bevor ich ins Bett gehe,<br />
um die Pollen zu entfernen.<br />
Das hilft mir sehr und ich kann<br />
einfach besser schlafen.“<br />
Miriam H., Grieskirchen<br />
„Da ich im Frühling gerne<br />
draußen unterwegs bin, trage ich<br />
im Freien immer eine Brille bzw.<br />
Sonnenbrille. Das schützt die<br />
Augen vor zu vielen Pollen.<br />
Schauen Sie sich einfach mal<br />
Ihre Brillengläser an, wenn Sie<br />
heimkommen.“<br />
Karin G., Fraham<br />
34 | lebens<strong>WEGE</strong>
Wussten sIe ...<br />
... dass beim Niesen winzige Sekrettröpchen<br />
mit einer Geschwindigkeit von bis zu<br />
150 km/h aus Mund und Nase geschleudert<br />
werden. Diese fliegen dann bis zu zwölf<br />
Meter weit. Nur ein „Hatschi“ ins Taschentuch<br />
stoppt die Geschosse.<br />
„Mir helfen am besten Nasenspülungen<br />
mit Kochsalzlösung.<br />
Das wirkt Wunder und ich kann<br />
wieder frei durchatmen.“<br />
David H., Wels<br />
Stimmen aus der Region<br />
FrÜhling Ist ...<br />
... wenn die Fenster von einem Tag auf den anderen<br />
furchtbar schmutzig aussehen und der Staub in<br />
den Sonnenstrahlen tanzt, wenn auf den Bänken<br />
im Park wieder Leute sitzen und Spaziergänger<br />
sich beim Vorbeigehen grüßen. Im Frühling beginnt<br />
auch die Pollenflugsaison und dauert bis in den<br />
Herbst. Die meisten Pflanzen blühen jedoch im<br />
Frühling und Frühsommer: Somit beginnt jetzt die<br />
Hochsaison für Pollenallergiker.<br />
„So schön der Frühling auch ist,<br />
für mich ist es eine anstrengende<br />
Zeit. Meine Augen jucken, ich muss<br />
immer niesen und in der Nacht<br />
schlafe ich ganz schlecht. Jedes<br />
Jahr nehme ich mir vor, schon im<br />
Winter mit einer Therapie zu beginnen<br />
und vergess es dann. Nächstes<br />
Jahr mache ich es aber wirklich so,<br />
wie es mir mein Arzt gesagt hat.“<br />
Caroline O., eferding<br />
Wer versucht, den Kontakt mit Pollen so gut wie möglich zu<br />
meiden, leidet weniger unter den typischen Beschwerden.<br />
Wir haben Menschen aus der Region befragt, welche Tipps<br />
sie Leidensgenossen geben können:<br />
„Mein Mann hat im Alter erst die<br />
Allergie bekommen. Wir sind ja<br />
schon in Pension und können unsere<br />
Zeit frei einteilen, deshalb fahren<br />
wir gerne im Frühling ans Meer<br />
nach Mallorca. Dort hat mein Mann<br />
gar keine Probleme, da die Pollenkonzentration<br />
sehr gering ist.“<br />
Kurt und Angelika M., Grieskirchen<br />
„Während der Pollensaison<br />
saugt nur mein Mann, er hat<br />
keine Allergieprobleme. Das ist<br />
sehr lieb von ihm und zusätzlich<br />
tut er etwas für seine Fitness.“<br />
Maria und Johann e., vöcklabruck<br />
Ihr starker PARTNER durch‘s<br />
ganze Jahr<br />
Baum- uNd StrauchSchNitt<br />
BaumaBtraguNg<br />
grüNraumpflege<br />
WiNter- uNd SommerdieNSt<br />
garteN- uNd laNdSchaftSgeStaltuNg<br />
Maschinenring Wels<br />
Neinergutstr. 4, 4600 Wels<br />
07242/71230<br />
wels@maschinenring.at<br />
www.maschinenring.at/wels<br />
lebens<strong>WEGE</strong> | 35
Ernährung & Gesundheit<br />
Genuss trotz<br />
Nahrungsmittelunverträglichkeiten<br />
Joghurt, Müsli und frisches Obst zum Frühstück, ein Abendessen beim<br />
Italiener mit einem guten Gläschen Wein – was gibt es Schöneres.<br />
Doch nicht alle Menschen können sorglos essen und genießen.<br />
Auf bestimmte Lebensmittel reagieren sie mit äußerst unangenehmen<br />
Symptomen: Es kribbelt im Mund, die Haut juckt, Bauchschmerzen<br />
und Durchfall lassen nicht lange auf sich warten.<br />
Statistiken zeigen, dass bereits ein Fünftel<br />
der österreichischen Bevölkerung vermutet,<br />
an einer Nahrungsmittelallergie<br />
zu leiden. Allerdings bestätigt sich diese<br />
Selbstdiagnose nur bei rund zwei bis drei<br />
Prozent der Österreicher. Die Ursache für<br />
die hohe Diskrepanz ist einfach: Nicht<br />
jede Unverträglichkeit ist eine Allergie!<br />
Am Anfang steht die korrekte<br />
Diagnose<br />
„Auch wenn sich die Symptome oft ähneln<br />
und für den Laien nicht zu unterscheiden<br />
sind, folgt die Behandlung von<br />
nicht-allergischen Reaktionen, wie zum<br />
Beispiel bei Pseudoallergien, Laktoseintoleranz<br />
oder Fruktosemalabsorption,<br />
einem gänzlich anderen Regelwerk als<br />
bei Allergien“, weiß Barbara Schatzl,<br />
Diätologin am Klinikum Wels-Grieskirchen.<br />
„Deshalb ist die präzise Diagnose<br />
am Anfang das Um und Auf.“ Diese<br />
selbst zu stellen, ist dabei unmöglich<br />
– zu viele Nahrungsmittel mit zu vielen<br />
Inhaltsstoffen sind verfügbar. Der erste<br />
Ansprechpartner ist der Hausarzt, der<br />
nächste Weg führt zum Facharzt, dem<br />
Experten für die notwendigen Untersuchungen.<br />
Dies sind zum Beispiel Gastroenterologen,<br />
die Spezialisten für den Magen-Darm-Bereich,<br />
oder Allergologen.<br />
Geduld bei der Diagnose<br />
Die Diagnose erfordert von Arzt und<br />
Patient viel Geduld und detektivischen<br />
Spürsinn. Anamnese sowie ein Ernährungs-<br />
und Symptomtagebuch stehen am<br />
Anfang, es folgen Tests und eine Diät.<br />
Ob Intoleranz, Malabsorption, Pseudooder<br />
klassische Allergie, die Ursachen<br />
von Nahrungsmittelunverträglichkeiten<br />
können äußerst unterschiedlich sein. Eine<br />
Barbara Schatzl,<br />
Diätologin am<br />
Klinikum Wels-Grieskirchen<br />
„Mit vielen praktischen Tipps<br />
und Anregungen für den Alltag<br />
bleibt der Speiseplan trotz<br />
Unverträglichkeit abwechslungsreich<br />
und der Genuss beim<br />
Essen erhalten – und einem<br />
durch einseitige Ernährung<br />
entstehenden Mangel an<br />
Nährstoffen wird vorgebeugt.“<br />
individuelle Ernährungsberatung ist der<br />
erste Schritt in Richtung Beschwerdefreiheit.<br />
„Dafür müssen bei Allergien und<br />
Zöliakie die Auslöser komplett gemieden<br />
werden. Nur wer lernt, Zutatenlisten<br />
richtig zu lesen, kann versteckte Zutaten<br />
erkennen“, betont Barbara Schatzl. Bei<br />
anderen Unverträglichkeiten, wie Laktoseintoleranz<br />
und Fruktosemalabsorption,<br />
wird am Klinikum Wels-Grieskirchen gemeinsam<br />
mit der Diätologin die individuelle<br />
Verträglichkeit ermittelt.<br />
36 | lebens<strong>WEGE</strong>
Ernährung & Gesundheit<br />
„ratgeber ernährung“<br />
allergenen BIs zÖlIakIe<br />
Soja boomt, Veganismus blüht, Unverträglichkeiten steigen:<br />
Spielen Ernährung und Gesundheit immer komplexer zusammen?<br />
Die neuen OÖGKK-Broschüren „Ratgeber Ernährung“ bringen<br />
Licht ins Dunkel: Kompakt erklären sie die Wirkung verschiedener<br />
Nährstoffe auf den Körper. Sie geben Rat bei Unverträglichkeiten<br />
oder Erkrankungen, die – teilweise oder gänzlich –<br />
nahrungsbedingt sind.<br />
Wissen, das Sicherheit gibt<br />
„Die neuen ‚Ratgeber Ernährung‘ sind<br />
Teil der OÖGKK-Gesundheitsstrategie:<br />
Wir wollen unserer Versichertengemeinschaft<br />
durch kompetente Beratung Sicherheit<br />
geben, so OÖGKK-Direktorin Mag.<br />
Dr. Andrea Wesenauer zum Projekt.<br />
Mit jedem Ratgeber halten die Leser geprüftes<br />
und verständlich aufbereitetes<br />
Wissen in der Hand – über Nährstoffe,<br />
Unverträglichkeiten, ernährungsbedingte<br />
Krankheiten und natürlich: über eine gesündere<br />
Lebensführung in der Zukunft!“<br />
Alle Ratgeber gratis –<br />
online und gedruckt<br />
www.ooegkk.at > Ernährung<br />
bzw. ab August als kostenlose<br />
Broschüren in jedem<br />
OÖGKK-Kundenservice<br />
neue ratgeber<br />
71. Bluthochdruck<br />
Bluthochdruck kann verschiedene Ursachen haben.<br />
Er ist entweder die Folge einer Grunderkrankung<br />
(Niere oder Herz) oder das Ergebnis von Bewegungsmangel,<br />
falscher Ernährung und Übergewicht. Der<br />
Ratgeber zeigt, welche Nährstoffe einen hohen Blutdruck<br />
begünstigen, und zeigt Gegenstrategien durch<br />
richtiges Essen. Die wichtigsten Hebel sind: weniger<br />
Salz, Fett und Alkohol.<br />
2. erhöhter Harnsäurespiegel und Gicht<br />
Gicht tritt als angeborener Stoffwechseldefekt auf oder<br />
wird durch Erkrankungen oder Störungen verursacht.<br />
Bei Gicht produziert der Körper vermehrt Harnsäure<br />
bzw. hemmt deren Abgabe. Harnsäure entsteht als Abbauprodukt<br />
von Purinen (Eiweißbestandteilen) in der<br />
Nahrung. Eine wichtige Strategie für Gichterkrankte:<br />
Tierische Nahrungsmittel, wie Fleisch, Wurst, Milch,<br />
Käse oder Fisch, reduzieren. Der Ratgeber zeigt, wie.<br />
3. Fruchtzucker-Unverträglichkeit<br />
Die Ursachen von Fruchtzucker-Unverträglichkeit sind<br />
(noch) nicht geklärt. Die Symptome: Bauchschmerzen,<br />
Völlegefühl, Blähungen, Zittern – bis zu Schwindel<br />
und Schock. Der Ratgeber bringt eine Art „Ernährungskompass“,<br />
um kritische Lebensmittel erkennen und<br />
vermeiden zu können.<br />
4. Soja – Pro und contra<br />
Der Markt an Sojaprodukten ist in den letzten Jahrzehnten<br />
stark gewachsen. Objektiv gesehen sind weder Hype noch<br />
Alarmismus rund um Soja angezeigt. Entscheidend ist, zu<br />
wissen, dass eine stark verarbeitete Sojabohne andere Wirkungen<br />
auf den Körper entfalten kann als in der Rohform.<br />
Der Ratgeber lotst daher durch den Dschungel der vielen<br />
populären Sojaerzeugnisse.<br />
5. Sorbit-Unverträglichkeit<br />
Sorbit ist ein natürlicher Zuckeraustauschstoff und dient<br />
auch als Süßungsmittel und Feuchthaltemittel in der Nahrungsindustrie.<br />
Warum manche, Sorbit nicht vertragen, ist<br />
(noch) nicht geklärt. Betroffene leiden unter möglichen<br />
Symptomen wie Blähungen, Durchfall, Bauschmerzen,<br />
Völlegefühl, Übelkeit oder Müdigkeit. Der Ratgeber nimmt<br />
gängige Lebensmittel unter die Sorbit-Lupe und gibt Tipps.<br />
6. Vegetarismus und Veganismus<br />
Nach Schätzungen verzichtet jeder 10. Österreicher auf<br />
Fleisch. Der Ratgeber beleuchtet das Für und Wider von<br />
Ernährungsweisen ohne Fleisch. Zudem erklärt er Unterschiede<br />
zwischen Vegetariern, Veganern, Flexitariern,<br />
Rohköstlern, Fructanern und „Pudding-Vegetariern“.<br />
7. Zöliakie<br />
Auch als „Einheimische Sprue“ bekannt, ist Zöliakie eine<br />
chronische Erkrankung der Dünndarmschleimhaut.<br />
Ursache ist die Unverträglichkeit von Gluten. Die einzige<br />
Behandlungsmöglichkeit ist die konsequente Vermeidung<br />
von glutenhaltigen Lebensmitteln. Der Ratgeber beleuchtet<br />
viele gängige Lebensmittel auf deren Glutengehalt und zeigt<br />
ebenso schmackhafte, glutenfreie Alternativen.<br />
lebens<strong>WEGE</strong> | 37
G’sunde Küche<br />
allergenFrei<br />
Bei Rezepten für<br />
Menschen mit Allergien oder<br />
Nahrungsmittelunverträglichkeiten<br />
geht es oft<br />
nur um das Vermeiden – um<br />
das Vermeiden von<br />
Auslöserstoffen. Dass mit<br />
etwas kulinarischem Knowhow<br />
aber auch allergenfreier<br />
Genuss möglich ist,<br />
zeigen uns die Küchenchefs<br />
des Welser Klinikum-Standorts<br />
Christoph Mayrhofer<br />
und Michael Cervek.<br />
fÜr genIesser<br />
BRUSCHETTO von Auberginen<br />
und marinierten Tomaten<br />
Zubereitung:<br />
0,5 kg Auberginen in ca. 1 cm dicke Scheiben<br />
schneiden und in 1cl Olivenöl braten. Danach<br />
mit Salz, Pfeffer und wenig gehacktem Knoblauch<br />
würzen. 5 Tomaten schälen und Kerne<br />
entfernen, Fruchtfleisch in Würfel von 0,5 cm<br />
schneiden. Aus frischem Basilikum und Petersilie,<br />
Olivenöl und 50 g Pinienkernen ein Pesto<br />
zubereiten. Tomatenwürfel mit Pesto und Limettensaft<br />
marinieren und die gebratenen<br />
Auberginen damit bestreichen.<br />
Vorspeise<br />
ToMATeN ScHÄLeN LeicHT GeMAcHT<br />
Strunk ausschneiden, Haut kreuzförmig einritzen. Geben Sie die Tomaten für ca.<br />
30 Sekunden in kochendes Wasser. Dann legen Sie die Tomaten mit einer Schöpfkelle<br />
vorsichtig in Eiswasser. Nun löst sich die Haut fast wie von alleine von der Tomate.<br />
38 | lebens<strong>WEGE</strong>
Suppe<br />
PASTINAKEN-ROTE-RÜBEN-SUPPE<br />
G’sunde Küche<br />
ROSA GEBRATENE LAMMKRONE<br />
auf Caponata a' Muntagnola,<br />
Thymianjus und feiner Polenta<br />
Zubereitung:<br />
100 g Zwiebel in 25 g pflanzlicher Margarine (milchfrei!)<br />
anziehen lassen, 100 g geschälte Äpfel, 0,5 kg geschnittene<br />
Pastinaken und 12,5 g rohe geschälte Rote Rüben mitsautieren,<br />
mit Wasser aufgießen, salzen, Pfeffer, Kümmel,<br />
Lorbeerblätter und Koriander in einen Teefilter geben und<br />
mitdünsten. Gemüse weichkochen und Suppe fein mixen.<br />
12,5 g kleine Rote-Rüben-Würfel und Pastinaken-Chips<br />
(feine Pastinaken-Scheiben einfach in Öl frittieren) als<br />
Einlage beigeben.<br />
Hauptspeise<br />
Thymianjus, Zubereitung:<br />
Karrees aus 1 kg ganzem Lammrücken auslösen (oder vom Fachmann<br />
auslösen lassen), restliche ausgelöste Knochen, 1 Karotte, 1 Zwiebel<br />
und 1 Petersilienwurzel nussgroß hacken. Gehackte Knochen<br />
gut anrösten, später Gemüse mitrösten, 1 Esslöffel Tomatenmark<br />
beigeben und mit Wasser mehrmals ablöschen. Frischen Thymian,<br />
Salz, Pfefferkörner, Wacholderbeeren und Lorbeerblatt hinzufügen,<br />
danach Ansatz einige Stunden köcheln lassen, abseihen<br />
und einkochen lassen (eventuell mit etwas Maizena binden),<br />
abschmecken.<br />
caponata a' Muntagnola, Zubereitung:<br />
1 Paprika rot, 1 Paprika gelb, 1 Zucchino und 1 Zwiebel in grobe<br />
Würfel schneiden, 50 g Oliven halbieren, 2 Knoblauchzehen in<br />
feine Scheiben schneiden. Chilischote, Blattpetersilie und Ingwer<br />
in feine Streifen schneiden, Paprika und Zwiebel in 1 cl Olivenöl<br />
sautieren, die Oliven und 50 g Kapern beigeben. Kernig dünsten,<br />
1 Esslöffel Tomatenmark hinzufügen und mit Salz, Pfeffer, Petersilie,<br />
Ingwer und Chilischote würzen. Polenta in 0,5 l Wasser<br />
aufkochen, salzen, 250 g Maisgrieß einrühren, 20 Minuten ziehen<br />
lassen, mit 1 cl Trauben-Kernöl verfeinern, mit Salz, Kardamom<br />
und Pfeffer abschmecken.<br />
Rosa gebratene Lammkrone, Zubereitung:<br />
Ganzes Lammkarree in Olivenöl anbraten, 1 frischen Thymianzweig<br />
beigeben und mitbraten, mit Salz und frisch gemahlenen<br />
Pfefferkörnern würzen, im Backrohr bei 130 °C zur gewünschte<br />
Garstufe fertigziehen lassen. Zum Anrichten aufschneiden.<br />
Nachspeise<br />
REISTEIG-APFELTASCHE<br />
Zubereitung:<br />
5 Äpfel schälen, Kerne entfernen und in Würfel schneiden,<br />
mit etwas Piment oder Zimt würzen. 3 EL Honig<br />
in einer Pfanne erhitzen und mit etwas Apfelsaft verdünnen,<br />
Äpfel beimengen, kurz dünsten und etwas eindicken<br />
und abkühlen lassen. Äpfel auf 4 Blätter befeuchtetem<br />
Reisteig (gibt es fertig in fast jedem Supermarkt zu kaufen)<br />
verteilen und zu einer Tasche zusammenschlagen.<br />
In 0,5 l heißem Rapsöl goldgelb backen. Abtropfen lassen<br />
und mit Staubzucker anrichten.<br />
lebens<strong>WEGE</strong> | 39
Reisemedizin<br />
bereit FÜr<br />
den sommer!<br />
Eben noch hatte man das Gefühl, der kalte und finstere Winter würde niemals aufhören und<br />
plötzlich werden die Jacken leichter, die Sonnenbrille kommt wieder in Verwendung und man<br />
plant schon den Sommerurlaub. Doch nicht nur die Urlaubsdestination, auch die medizinische<br />
Vorbereitung und Reiseapotheke sollen wohlüberlegt sein.<br />
OA Dr. Kinga Rigler-Hohenwarter, MBA<br />
Oberärztin am Institut für Hygiene und<br />
Mikrobiologie im Klinikum Wels-<br />
Grieskirchen und Fachgruppenstellvertreterin<br />
für Hygiene und Mikrobiologie<br />
der Ärztekammer für OÖ.<br />
Sie wissen schon, in welches Land es<br />
heuer gehen soll? Haben Sie auch an eine<br />
reisemedizinische Beratung gedacht?<br />
Besonders bei Fernreisen sollte man sich<br />
vor Krankheiten wie Dengue-Fieber,<br />
Malaria oder Chikungunya in Lateinamerika<br />
in Acht nehmen. Eine reisemedizinische<br />
Beratung muss auf die Urlaubsdestination<br />
abgestimmt werden. Braucht<br />
man vorab eine Impfung und welchen<br />
Mückenspray soll ich mitnehmen? Der<br />
Reisemediziner ist der beste Ansprechpartner<br />
bei solchen Fragen.<br />
Reisemediziner finden<br />
Die Ärztekammer für Oberösterreich unter<br />
Präsident Dr. Peter Niedermoser und<br />
DDr. Martin Haditsch, Facharzt für Hygiene,<br />
Mikrobiologie, Infektiologie und<br />
Tropenmedizin im Travel Med Center<br />
in Leonding konnten gemeinsam mit der<br />
Arbeitsgruppe Reisemedizin Oberösterreich,<br />
einer Tochtergruppe der Gesellschaft<br />
für Reise- und Touristikmedizin,<br />
einen entscheidenden Erfolg verbuchen.<br />
Seit 2<strong>01</strong>5 können Ärztinnen und Ärzte<br />
das ÖÄK-Zertifikat „Reisemedizin“ in 32<br />
Unterrichtseinheiten erwerben. Sollten<br />
Sie also auf der Suche nach einem Reisemediziner<br />
sein, achten Sie auf das Zertifikat<br />
der Österreichischen Ärztekammer.<br />
Ein Reisemediziner checkt Sie je nach<br />
Urlaubsziel und personenbezogenen Informationen<br />
genau durch: Reisedauer,<br />
Saison, Ziel und Zweck der Reise werden<br />
genauso betrachtet wie Alter, Grundkrankheiten<br />
inklusive Abwehrschwäche<br />
und Allergien sowie das Sicherheitsbedürfnis,<br />
die Reiseerfahrung und die Kondition.<br />
Über die Webseite www.gesundin-ooe.at<br />
und den Button „Ärztefinder“<br />
können Sie in der Profisuche nach einem<br />
Mediziner mit diesem Diplom suchen.<br />
Mit Impfungen vorbereiten<br />
Wem für die Reise eine Impfung empfohlen<br />
wird, der muss bedenken, dass Impfstoffe<br />
oft mehrere Wochen brauchen, um<br />
ihre volle Wirkung zu entfalten. Andere<br />
Kulturen und Länder weisen andere<br />
Krankheiten auf, auf die das „österreichische<br />
Immunsystem“ nicht eingestellt<br />
ist. „Wir bieten im Klinikum Wels-Grieskirchen<br />
eine reisemedizinische Beratung<br />
an und informieren über die wichtigsten<br />
Impfungen“, sagt Dr. Kinga Rigler-Hohenwarter,<br />
MBA, Oberärztin am Institut<br />
für Hygiene und Mikrobiologie im<br />
Klinikum Wels-Grieskirchen und Fachgruppenstellvertreterin<br />
für Hygiene und<br />
Mikrobiologie der Ärztekammer für OÖ.<br />
„Die Immunisierung gegen Hepatitis,<br />
Typhus und Polio-Diphtherie-Tetanus ist<br />
die Grundausstattung für viele Reisen in<br />
Länder mit anderen klimatischen beziehungsweise<br />
hygienischen Verhältnissen“,<br />
sagt die Medizinerin. „Darüber hinaus<br />
40 | lebens<strong>WEGE</strong>
Reisemedizin<br />
werden je nach Region andere Impfungen<br />
empfohlen, etwa gegen Meningokokken,<br />
also Gehirnhautentzündung, Gelbfieber<br />
oder Tollwut. Gegen Malaria gibt es keinen<br />
hundertprozentigen Schutz, Tabletten<br />
senken das Risiko.“ Wer geimpft ist, soll<br />
sich aber nicht in absoluter Sicherheit<br />
wähnen und natürlich bei Lebensmitteln<br />
achtsam sein, Mückenschutz auftragen<br />
und Informationen zur Gesundheitsversorgung<br />
vor Ort wahrnehmen.<br />
Medikamente für unterwegs<br />
Neben geeigneten Mückensprays sind<br />
gut wirkende Mittel gegen Verstopfung<br />
oder Durchfall ratsam.<br />
Um einem Sonnenbrand vorzubeugen,<br />
darf natürlich nicht auf die Sonnencreme<br />
verzichtet werden. Gegen Migräne,<br />
Menstruationsbeschwerden oder<br />
Zahnschmerzen helfen unter anderem<br />
Präparate wie Acetylsalicylsäure, Ibuprofen<br />
oder Paracetamol. Und nachdem ein<br />
Urlaub alle möglichen Überraschungen<br />
parat haben kann, ist die Mitnahme von<br />
Pflastern, Verbandszeug oder Desinfektionsmitteln<br />
zudem empfehlenswert.<br />
Klären Sie auf jeden Fall noch ab, ob<br />
weitere Medikamente in Ihrer Reiseapotheke<br />
Platz finden sollen. Dann können<br />
Sie perfekt vorbereitet in den Sommerurlaub<br />
starten!<br />
lebens<strong>WEGE</strong> | 41
Aktiv<br />
hinter den kulIssen<br />
Buntes Gemüse und Obst macht gute Laune!<br />
Das beweist auch unser Team rund um Visagistin<br />
Diana Mayrhuber und Meisterfotograf Nik Fleischmann.<br />
Die beiden haben unserem Covermodel Lara das<br />
gesundheitsmagazin_hochformat.pdf 1 21.02.17 11:29<br />
Gemüse direkt vom Kopf gegessen!<br />
C<br />
M<br />
Y<br />
CM<br />
MY<br />
CY<br />
CMY<br />
K<br />
IHR SCHUH & FUSS SPEZIALIST<br />
www.stockinger.co.at<br />
IHR INDIVIDUELLER MASS-SCHUH!<br />
✔ PERFEKTE PASSFORM<br />
✔ INDIVIDUELLE MODELLE<br />
✔ MODERNES DESIGN<br />
✔ LEICHT<br />
✔ 100 % MADE IN<br />
GRIESKIRCHEN<br />
✔ ZUFRIEDENHEITSGARANTIE<br />
Nach ärztlicher Verordnung!<br />
Alle Krankenkassen!<br />
Keine Zusatzkosten für Sie<br />
(nur Kassenselbstbehalt)<br />
GmbH<br />
Wir freuen uns auf ein<br />
unverbindliches Beratungsgespräch.<br />
Tel.: +43 (0) 7248 63775-0<br />
Oberer Stadtplatz 8<br />
4710 Grieskirchen<br />
Jeden Mittwoch<br />
Fussberatung<br />
kostenlos.<br />
20.000 BIS 30.000<br />
GENE CODIEREN<br />
DAS ERBGUT DES<br />
MENSCHEN.<br />
Das sind gar nicht so viele,<br />
wenn man bedenkt, dass<br />
ein Gemüsekohl 100.000<br />
Gene braucht, damit aus<br />
ihm ein ansehnliches<br />
Gemüse wird.<br />
Kompetenzzentrum für Gesundheits- und Sozialberufe<br />
Jetzt Ist dIe beste zeIt, um anzufangen<br />
Ihre VorteIle am BFI OÖ – Wir begleiten Sie.<br />
• Von der Basisausbildung bis zum Masterstudienlehrgang<br />
• Gesetzlich anerkannte Abschlüsse und Berufsberechtigungen<br />
• Theorie-Praxis-Transfer durch Lernwerkstätten und<br />
Abstimmung mit Praktikumsstellen<br />
• Unterstützung bei der Suche nach Praktikumsstellen<br />
(z.B. Krankenhäuser, Kindergärten etc.)<br />
• Kostenlose Nostrifikationsberatung im Gesundheitsbereich<br />
Abwechslungsreich und informativ<br />
erscheint das „lebens<strong>WEGE</strong>“<br />
Magazin zweimal jährlich als<br />
Beilage in der Rundschau.<br />
Aktuelle Beiträge finden Sie<br />
das ganze Jahr über unter<br />
www.lebenswege-online.at.<br />
Für Fragen oder Anregungen<br />
schicken Sie uns bitte ein Mail<br />
unter redaktion@lebenswege.at<br />
Pflege<br />
berufe<br />
ObduktiOns<br />
AssistEnZ<br />
SOzIAl Pflegefachassistenz<br />
BeTreuunGS<br />
BeruFe massage<br />
ausbildungen<br />
medizinische<br />
assistenz<br />
berufe<br />
Mehr Infos unter www.bfi-ooe.at oder unter der<br />
BFI Serviceline 0810 004005.<br />
42 | lebens<strong>WEGE</strong>
Aktiv<br />
rätsel lÖsen & gewInnen<br />
Welser einkaufsgulden gewinnen!<br />
Mit Welser Einkaufsgulden können Sie in über<br />
300 Geschäften und Lokalen einkaufen bzw. sich in<br />
Gastronomiebetrieben kulinarisch verwöhnen lassen!<br />
1. PReiS<br />
€ 100,-<br />
2. & 3. PREIS<br />
€ 50,-<br />
4.–10. PREIS<br />
€ 10,-<br />
11.–15. PREIS<br />
Diverse Bücher<br />
LÖSUNG:<br />
Die Auflösung gibt es in der<br />
nächsten Ausgabe von lebens<strong>WEGE</strong>!<br />
Lösungswort aus Ausgabe 14: „Wasserflasche“.<br />
Senden Sie bitte bis spätestens 30. August 2<strong>01</strong>7 das Lösungswort an:<br />
wazek & partner, Kennwort „lebens<strong>WEGE</strong> aktiv“, Bürgerstraße 6, 4020 Linz<br />
oder per E-Mail an aktiv@lebenswege-online.at | Absender nicht vergessen!<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />
lebens<strong>WEGE</strong> | 43
PollenKalender<br />
Alternaria<br />
Aspergillus<br />
Beifuss<br />
Birke<br />
Buche<br />
Cladosporium<br />
Eiche<br />
Erle<br />
Esche<br />
Gänsefuß<br />
Goldrute<br />
Gräser<br />
Hafer<br />
Hasel<br />
Holunder<br />
Honigbiene<br />
Hornisse<br />
Hummel<br />
Löwenzahn<br />
Mais<br />
Nessel<br />
Penicillin<br />
Ragweed<br />
Raps<br />
Roggen<br />
Sauerampfer<br />
Spitzwegerich<br />
Ulme<br />
Weizen<br />
Wespe<br />
Jänner Februar März April Mai Juni Juli<br />
August September Oktober November Dezemeber<br />
Ausschneiden und aufbewahren!!!<br />
Belastung: sporadisch Belastung: mäßig Belastung: stark Belastung durch Schimmelpilze<br />
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen<br />
Perioden wetterabhängig sind.<br />
10 Tipps zur Prävention bei Heuschnupfen<br />
1.<br />
Pollen können an den<br />
Haaren haften, deshalb<br />
Abends regelmäßig die<br />
Haare waschen.<br />
Beachten Sie die aktuellen<br />
Polleninformationen für Ihre Region.<br />
pollenwarndienst.at<br />
Wäsche nicht im Freien trocknen!<br />
2.<br />
3. 4.<br />
5.<br />
6.<br />
Kein Sport im Freien<br />
bei starkem Pollenflug.<br />
Die Ferienzeit auf den Pollenflug<br />
abstimmen, um der Pollensaison<br />
zu entkommen.<br />
Im Freien eine Sonnenbrille tragen:<br />
Sie hält einen Teil der Pollen<br />
von Ihren Augen fern und<br />
schützt Ihre bereits irritierte<br />
Augenschleimhaut!<br />
Im Gebirge oder am Meer<br />
7. ist der Pollenflug allgemeinen<br />
viel schwächer.<br />
10.<br />
Den Rasen in Gärten durch<br />
regelmäßiges Mähen kurz halten.<br />
9.<br />
Hygienestaubsauger<br />
mit Filter verwenden.<br />
8.<br />
In geschlossenen Räumen<br />
geht die Pollenkonzentration<br />
bereits nach zehn Minuten<br />
auf etwa 1% des<br />
Außenwertes zurück.<br />
Ausschneiden und aufbewahren!!!