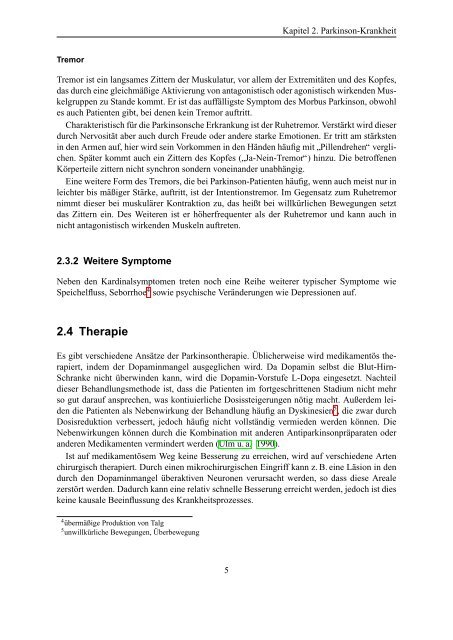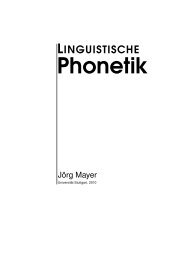Die Intonation von Entscheidungsfragen bei Morbus Parkinson unter ...
Die Intonation von Entscheidungsfragen bei Morbus Parkinson unter ...
Die Intonation von Entscheidungsfragen bei Morbus Parkinson unter ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Tremor<br />
Kapitel 2. <strong>Parkinson</strong>-Krankheit<br />
Tremor ist ein langsames Zittern der Muskulatur, vor allem der Extremitäten und des Kopfes,<br />
das durch eine gleichmäßige Aktivierung <strong>von</strong> antagonistisch oder agonistisch wirkenden Muskelgruppen<br />
zu Stande kommt. Er ist das auffälligste Symptom des <strong>Morbus</strong> <strong>Parkinson</strong>, obwohl<br />
es auch Patienten gibt, <strong>bei</strong> denen kein Tremor auftritt.<br />
Charakteristisch für die <strong>Parkinson</strong>sche Erkrankung ist der Ruhetremor. Verstärkt wird dieser<br />
durch Nervosität aber auch durch Freude oder andere starke Emotionen. Er tritt am stärksten<br />
in den Armen auf, hier wird sein Vorkommen in den Händen häufig mit ” Pillendrehen“ verglichen.<br />
Später kommt auch ein Zittern des Kopfes ( ” Ja-Nein-Tremor“) hinzu. <strong>Die</strong> betroffenen<br />
Körperteile zittern nicht synchron sondern <strong>von</strong>einander unabhängig.<br />
Eine weitere Form des Tremors, die <strong>bei</strong> <strong>Parkinson</strong>-Patienten häufig, wenn auch meist nur in<br />
leichter bis mäßiger Stärke, auftritt, ist der Intentionstremor. Im Gegensatz zum Ruhetremor<br />
nimmt dieser <strong>bei</strong> muskulärer Kontraktion zu, das heißt <strong>bei</strong> willkürlichen Bewegungen setzt<br />
das Zittern ein. Des Weiteren ist er höherfrequenter als der Ruhetremor und kann auch in<br />
nicht antagonistisch wirkenden Muskeln auftreten.<br />
2.3.2 Weitere Symptome<br />
Neben den Kardinalsymptomen treten noch eine Reihe weiterer typischer Symptome wie<br />
Speichelfluss, Seborrhoe 4 sowie psychische Veränderungen wie Depressionen auf.<br />
2.4 Therapie<br />
Es gibt verschiedene Ansätze der <strong>Parkinson</strong>therapie. Üblicherweise wird medikamentös therapiert,<br />
indem der Dopaminmangel ausgeglichen wird. Da Dopamin selbst die Blut-Hirn-<br />
Schranke nicht überwinden kann, wird die Dopamin-Vorstufe L-Dopa eingesetzt. Nachteil<br />
dieser Behandlungsmethode ist, dass die Patienten im fortgeschrittenen Stadium nicht mehr<br />
so gut darauf ansprechen, was kontiuierliche Dosissteigerungen nötig macht. Außerdem leiden<br />
die Patienten als Nebenwirkung der Behandlung häufig an Dyskinesien 5 , die zwar durch<br />
Dosisreduktion verbessert, jedoch häufig nicht vollständig vermieden werden können. <strong>Die</strong><br />
Nebenwirkungen können durch die Kombination mit anderen Antiparkinsonpräparaten oder<br />
anderen Medikamenten vermindert werden (Ulm u. a. 1990).<br />
Ist auf medikamentösem Weg keine Besserung zu erreichen, wird auf verschiedene Arten<br />
chirurgisch therapiert. Durch einen mikrochirurgischen Eingriff kann z. B. eine Läsion in den<br />
durch den Dopaminmangel überaktiven Neuronen verursacht werden, so dass diese Areale<br />
zerstört werden. Dadurch kann eine relativ schnelle Besserung erreicht werden, jedoch ist dies<br />
keine kausale Beeinflussung des Krankheitsprozesses.<br />
4 übermäßige Produktion <strong>von</strong> Talg<br />
5 unwillkürliche Bewegungen, Überbewegung<br />
5