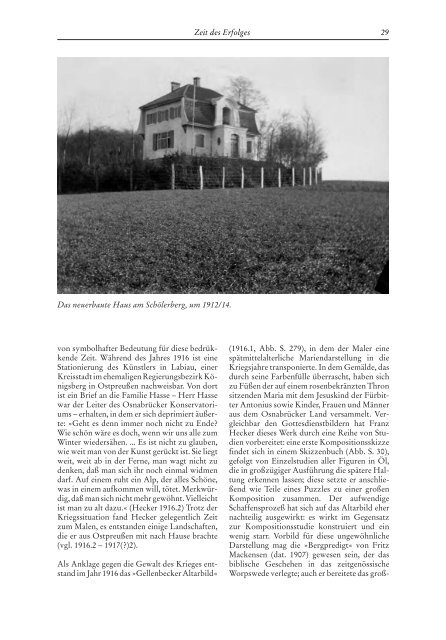Ulrike Hamm - H. TH. WENNER · Antiquariat
Ulrike Hamm - H. TH. WENNER · Antiquariat
Ulrike Hamm - H. TH. WENNER · Antiquariat
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Das neuerbaute Haus am Schölerberg, um 1912/14.<br />
von symbolhafter Bedeutung für diese bedrükkende<br />
Zeit. Während des Jahres 1916 ist eine<br />
Stationierung des Künstlers in Labiau, einer<br />
Kreisstadt im ehemaligen Regierungsbezirk Königsberg<br />
in Ostpreußen nachweisbar. Von dort<br />
ist ein Brief an die Familie Hasse – Herr Hasse<br />
war der Leiter des Osnabrücker Konservatoriums<br />
– erhalten, in dem er sich deprimiert äußerte:<br />
»Geht es denn immer noch nicht zu Ende?<br />
Wie schön wäre es doch, wenn wir uns alle zum<br />
Winter wiedersähen. ... Es ist nicht zu glauben,<br />
wie weit man von der Kunst gerückt ist. Sie liegt<br />
weit, weit ab in der Ferne, man wagt nicht zu<br />
denken, daß man sich ihr noch einmal widmen<br />
darf. Auf einem ruht ein Alp, der alles Schöne,<br />
was in einem aufkommen will, tötet. Merkwürdig,<br />
daß man sich nicht mehr gewöhnt. Vielleicht<br />
ist man zu alt dazu.« (Hecker 1916.2) Trotz der<br />
Kriegssituation fand Hecker gelegentlich Zeit<br />
zum Malen, es entstanden einige Landschaften,<br />
die er aus Ostpreußen mit nach Hause brachte<br />
(vgl. 1916.2 – 1917(?)2).<br />
Als Anklage gegen die Gewalt des Krieges entstand<br />
im Jahr 1916 das »Gellenbecker Altarbild«<br />
Zeit des Erfolges 29<br />
(1916.1, Abb. S. 279), in dem der Maler eine<br />
spätmittelalterliche Mariendarstellung in die<br />
Kriegsjahre transponierte. In dem Gemälde, das<br />
durch seine Farbenfülle überrascht, haben sich<br />
zu Füßen der auf einem rosenbekränzten Thron<br />
sitzenden Maria mit dem Jesuskind der Fürbitter<br />
Antonius sowie Kinder, Frauen und Männer<br />
aus dem Osnabrücker Land versammelt. Vergleichbar<br />
den Gottesdienstbildern hat Franz<br />
Hecker dieses Werk durch eine Reihe von Studien<br />
vorbereitet: eine erste Kompositionsskizze<br />
findet sich in einem Skizzenbuch (Abb. S. 30),<br />
gefolgt von Einzelstudien aller Figuren in Öl,<br />
die in großzügiger Ausführung die spätere Haltung<br />
erkennen lassen; diese setzte er anschließend<br />
wie Teile eines Puzzles zu einer großen<br />
Komposition zusammen. Der aufwendige<br />
Schaffensprozeß hat sich auf das Altarbild eher<br />
nachteilig ausgewirkt: es wirkt im Gegensatz<br />
zur Kompositionsstudie konstruiert und ein<br />
wenig starr. Vorbild für diese ungewöhnliche<br />
Darstellung mag die »Bergpredigt« von Fritz<br />
Mackensen (dat. 1907) gewesen sein, der das<br />
biblische Geschehen in das zeitgenössische<br />
Worpswede verlegte; auch er bereitete das groß-