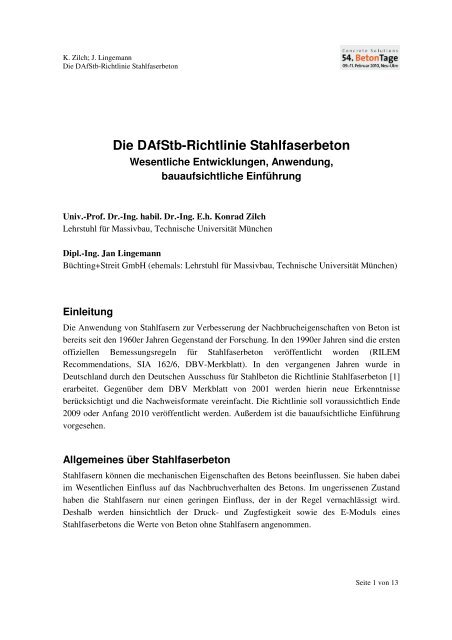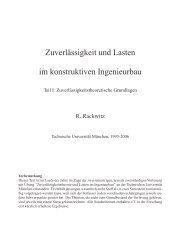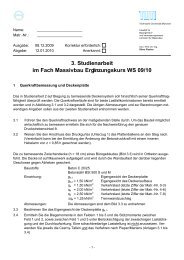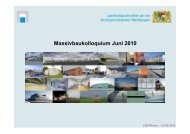Die DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton - Lehrstuhl für Massivbau
Die DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton - Lehrstuhl für Massivbau
Die DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton - Lehrstuhl für Massivbau
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
K. Zilch; J. Lingemann<br />
<strong>Die</strong> <strong>DAfStb</strong>-<strong>Richtlinie</strong> <strong>Stahlfaserbeton</strong><br />
<strong>Die</strong> <strong>DAfStb</strong>-<strong>Richtlinie</strong> <strong>Stahlfaserbeton</strong><br />
Wesentliche Entwicklungen, Anwendung,<br />
bauaufsichtliche Einführung<br />
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E.h. Konrad Zilch<br />
<strong>Lehrstuhl</strong> <strong>für</strong> <strong>Massivbau</strong>, Technische Universität München<br />
Dipl.-Ing. Jan Lingemann<br />
Büchting+Streit GmbH (ehemals: <strong>Lehrstuhl</strong> <strong>für</strong> <strong>Massivbau</strong>, Technische Universität München)<br />
Einleitung<br />
<strong>Die</strong> Anwendung von Stahlfasern zur Verbesserung der Nachbrucheigenschaften von Beton ist<br />
bereits seit den 1960er Jahren Gegenstand der Forschung. In den 1990er Jahren sind die ersten<br />
offiziellen Bemessungsregeln <strong>für</strong> <strong>Stahlfaserbeton</strong> veröffentlicht worden (RILEM<br />
Recommendations, SIA 162/6, DBV-Merkblatt). In den vergangenen Jahren wurde in<br />
Deutschland durch den Deutschen Ausschuss <strong>für</strong> Stahlbeton die <strong>Richtlinie</strong> <strong>Stahlfaserbeton</strong> [1]<br />
erarbeitet. Gegenüber dem DBV Merkblatt von 2001 werden hierin neue Erkenntnisse<br />
berücksichtigt und die Nachweisformate vereinfacht. <strong>Die</strong> <strong>Richtlinie</strong> soll voraussichtlich Ende<br />
2009 oder Anfang 2010 veröffentlicht werden. Außerdem ist die bauaufsichtliche Einführung<br />
vorgesehen.<br />
Allgemeines über <strong>Stahlfaserbeton</strong><br />
Stahlfasern können die mechanischen Eigenschaften des Betons beeinflussen. Sie haben dabei<br />
im Wesentlichen Einfluss auf das Nachbruchverhalten des Betons. Im ungerissenen Zustand<br />
haben die Stahlfasern nur einen geringen Einfluss, der in der Regel vernachlässigt wird.<br />
Deshalb werden hinsichtlich der Druck- und Zugfestigkeit sowie des E-Moduls eines<br />
<strong>Stahlfaserbeton</strong>s die Werte von Beton ohne Stahlfasern angenommen.<br />
Seite 1 von 13
K. Zilch; J. Lingemann<br />
<strong>Die</strong> <strong>DAfStb</strong>-<strong>Richtlinie</strong> <strong>Stahlfaserbeton</strong><br />
Das Verhalten von <strong>Stahlfaserbeton</strong> im Nachbruchbereich ist in Bild 1 dargestellt. Beim<br />
unbewehrten Beton führt das stark entfestigende Nachbruchverhalten zu einem spröden<br />
Versagen. Im Prüfkörper aus Stahlbeton kann, abhängig vom Bewehrungsgrad, die Last<br />
deutlich über die Risslast hinaus gesteigert werden. <strong>Stahlfaserbeton</strong> hingegen zeigt im<br />
Nachbruchbereich bei üblichen Faserarten und -dosierungen in der Regel auch ein<br />
entfestigendes Materialverhalten. Allerdings ist gegenüber unbewehrtem Beton eine deutlich<br />
gesteigerte Restfestigkeit vorhanden.<br />
Bild 1: Verhalten von unbewehrtem Beton, Stahlbeton und <strong>Stahlfaserbeton</strong> im<br />
Biegezugversuch<br />
Das Tragverhalten von <strong>Stahlfaserbeton</strong> wird unter anderem durch folgende Faktoren<br />
beeinflusst:<br />
• Verankerung bzw. Ausziehverhalten der Stahlfasern<br />
• Streuung der Nachrisszugfestigkeit von <strong>Stahlfaserbeton</strong><br />
• Orientierung der Stahlfasern<br />
Verankerung bzw. Ausziehverhalten der Stahlfasern<br />
Zur Herstellung von <strong>Stahlfaserbeton</strong> können die unterschiedlichsten Arten von Stahlfasern<br />
eingesetzt werden. Bild 2 gibt einen Überblick über die meisten gebräuchlichen Faserarten. In<br />
der ersten Spalte sind Stahldrahtfasern mit Endverankerungen dargestellt. <strong>Die</strong> heute üblichste<br />
Art der Endverankerung sind Endabkröpfungen. Das unterste Bild zeigt eine Endverankerung<br />
in Form von abgeplatteten Enden. In der mittleren Spalte sind Stahldrahtfasern mit<br />
kontinuierlicher Verankerung dargestellt. Hier sind heute im Wesentlichen gewellte Fasern<br />
üblich. Im mittleren Bild ist die kontinuierliche Verankerung mit einer Endverankerung<br />
kombiniert. Im unteren Bild sind profilierte Fasern dargestellt. In der rechten Spalte sind<br />
Seite 2 von 13
K. Zilch; J. Lingemann<br />
<strong>Die</strong> <strong>DAfStb</strong>-<strong>Richtlinie</strong> <strong>Stahlfaserbeton</strong><br />
Faserarten dargestellt, die <strong>für</strong> normalfeste Faserbetone in der Regel nur selten verwendet<br />
werden, wie Blechfasern, gespante Fasern oder Mikrofasern.<br />
Bild 2: Übliche Formen von Stahlfasern (aus [2])<br />
Der Einfluss der Stahlfasern auf das Nachbruchverhalten von Beton ist dadurch zu erklären,<br />
dass die Stahlfasern im Nachbruchbereich Risse im Beton überbrücken und somit Zugkräfte<br />
über Risse hinweg übertragen können (Bild 3). Hier<strong>für</strong> ist eine ausreichende Verankerung der<br />
Fasern im Beton erforderlich. <strong>Die</strong> Lastübertragung vom Beton in die Fasern erfolgt zum Teil<br />
im Bereich des Rissufers, an dem die Stahlfasern umgelenkt werden. Der maßgebende Teil der<br />
Lastübertragung erfolgt bei Endverankerten Fasern jedoch im Bereich der Endverankerung.<br />
<strong>Die</strong> Wirksamkeit der Fasern hängt wesentlich von der Verankerung ab. <strong>Die</strong>se wiederum ist<br />
stark von der Faserart, dem Beton sowie dem Zusammenwirken von Fasern und Beton<br />
abhängig.<br />
Seite 3 von 13
K. Zilch; J. Lingemann<br />
<strong>Die</strong> <strong>DAfStb</strong>-<strong>Richtlinie</strong> <strong>Stahlfaserbeton</strong><br />
Bild 3: „Vernadelung“ von Rissen durch Stahlfasern und Lastweiterleitung vom<br />
Beton in die Fasern<br />
Aufgrund der zahlreichen Einflussparameter hinsichtlich der Wirksamkeit der Stahlfasern ist<br />
<strong>für</strong> jede Betonrezeptur mit einer speziellen Betonzusammensetzung und einer speziellen<br />
Faserart eine neue Erstprüfung erforderlich. Anhand einer pauschalen Angabe von<br />
Fasergehalten ist keine Beurteilung der Leistungsfähigkeit von <strong>Stahlfaserbeton</strong> möglich. <strong>Die</strong><br />
Gleichung<br />
höherer Fasergehalt = höhere Nachrisszugfestigkeit<br />
ist ebenso nicht in allen Fällen korrekt.<br />
Streuung der Nachrisszugfestigkeit von <strong>Stahlfaserbeton</strong><br />
Bei der Bestimmung der Nachrisszugfestigkeit an balkenartigen Prüfkörpern mit<br />
Querschnitten von 15 cm x 15 cm werden häufig relativ große Streuungen mit<br />
Variationskoeffizienten von ca. 25 % festgestellt. <strong>Die</strong> Ursache hier<strong>für</strong> liegt in der Verteilung<br />
der Fasern. Bei kleinen Querschnittsflächen ist es leicht möglich, dass entweder sehr viele<br />
oder sehr wenige Fasern den Rissquerschnitt kreuzen. Hier werden daher häufig große<br />
Streuungen der Nachrisszugfestigkeiten beobachtet. Mit zunehmender Querschnittsgröße<br />
nimmt die Wahrscheinlichkeit ab, dass über den ganzen Querschnitt entweder sehr hohe oder<br />
sehr geringe Faseranzahlen vorhanden sind. Bei größeren Querschnitten ist die Streuung der<br />
Nachrisszugfestigkeit daher deutlich geringer. <strong>Die</strong>ser Zusammenhang wurde durch<br />
experimentelle Untersuchungen am <strong>Lehrstuhl</strong> <strong>für</strong> <strong>Massivbau</strong> der Technischen Universität<br />
München belegt [4] (Bild 4).<br />
Seite 4 von 13
K. Zilch; J. Lingemann<br />
<strong>Die</strong> <strong>DAfStb</strong>-<strong>Richtlinie</strong> <strong>Stahlfaserbeton</strong><br />
Fasern/cm²<br />
1,2<br />
1,0<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,2<br />
0,0<br />
0 200 400 600 800 1000 1200<br />
Fläche [cm²]<br />
Messwerte<br />
Mittelwert der<br />
Messwerte<br />
Bild 4: In Sägeschnittoberflächen ermittelte Faseranzahl je cm² in Abhängigkeit der<br />
Bezugsfläche<br />
Bei der Entwicklung der <strong>Richtlinie</strong> führte dieses zu kontroversen Diskussionen. Würde man<br />
die Nachrisszugfestigkeit an größeren Prüfkörpern ermitteln, würden sich bei gleichen<br />
Mittelwerten der Nachrisszugfestigkeit der Nachrisszugfestigkeit höhere 5 %-Quantilwerte<br />
ergeben als in kleinformatigen Prüfkörpern. <strong>Die</strong> Ermittlung der Nachrisszugfestigkeit an<br />
größeren Prüfkörpern ist jedoch unhandlicher, aufwändiger und unwirtschaftlicher.<br />
Andererseits würde der Ansatz der in den kleinformatigen Prüfkörpern ermittelten<br />
5 %-Quantilwerte der Nachrisszugfestigkeit bei der Bemessung von größeren Bauteilen zu<br />
sehr unwirtschaftlichen Ergebnisse führen.<br />
In die <strong>Richtlinie</strong> <strong>Stahlfaserbeton</strong> wurden die <strong>für</strong> die Durchführung der Prüfungen günstigeren<br />
kleinformatigen Prüfkörper gewählt. Um dennoch auch <strong>für</strong> größere Bauteile eine<br />
wirtschaftliche Bemessung sicherzustellen, wird bei der Ermittlung des Rechenwertes der<br />
Nachrisszugfestigkeit f f ctR,Li der Korrekturfaktor κ f G eingeführt. Am <strong>Lehrstuhl</strong> <strong>für</strong> <strong>Massivbau</strong><br />
der Technischen Universität München wurde wissenschaftlich bestätigt, dass der Ansatz des<br />
Korrekturfaktors κ f G eine wirtschaftlichen Bemessung sowie die Einhaltung des erforderlichen<br />
Sicherheitsniveaus ermöglicht [4] (Bild 5).<br />
Seite 5 von 13
K. Zilch; J. Lingemann<br />
<strong>Die</strong> <strong>DAfStb</strong>-<strong>Richtlinie</strong> <strong>Stahlfaserbeton</strong><br />
κκκκ f G bzw. κκκκ f G,cal [-]<br />
1,8<br />
1,6<br />
1,4<br />
1,2<br />
1<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,2<br />
0<br />
genauer Ansatz <strong>für</strong> kfG (bei Normalverteilung)<br />
genauer Ansatz <strong>für</strong> kfG (bei Log-Normalverteilung)<br />
κ f G<br />
κ f G,cal<br />
κ f G,cal<br />
gemäß <strong>Richtlinie</strong> ''<strong>Stahlfaserbeton</strong>''<br />
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6<br />
gezogene Querschnittsfläche A ct [m²]<br />
Bild 5: Analytisch ermittelter Faktor κκκκ f G zur Einhaltung des erforderlichen<br />
Zuverlässigkeitsniveaus sowie vereinfachter linearer Ansatz gemäß <strong>Richtlinie</strong><br />
Berücksichtigung der Orientierung der Stahlfasern<br />
<strong>Die</strong> Orientierung der Stahlfasern hat wesentlichen Einfluss auf die Wirksamkeit der Fasern.<br />
<strong>Die</strong>s zeigt sich z. B. beim Vergleich der Nachrisszugfestigkeiten von liegend und stehend<br />
hergestellten Prüfkörpern. Bei liegend hergestellten, flächigen Prüfkörpern werden in den<br />
Richtungen parallel zur Bauteilebene i. d. R. die höchsten Nachrisszugfestigkeiten gemessen.<br />
In allen anderen Fällen (nicht liegend hergestellte oder nicht flächige Bauteile) wird die<br />
Anrechenbare Nachrisszugfestigkeit f f ctR,Li gemäß <strong>Richtlinie</strong> um den Faktor κ f F = 0,5<br />
reduziert. Hiermit wird die Unsicherheit der Faserorientierung ausreichend berücksichtigt.<br />
Allgemeines zur <strong>DAfStb</strong> <strong>Richtlinie</strong> <strong>Stahlfaserbeton</strong><br />
Bearbeitungsstand der <strong>Richtlinie</strong><br />
<strong>Die</strong> Schlussfassung der <strong>Richtlinie</strong> wurde vom Vorstand des <strong>DAfStb</strong> verabschiedet und wird in<br />
Kürze veröffentlicht und voraussichtlich Anfang 2011 bauaufsichtlich eingeführt werden. <strong>Die</strong><br />
bauaufsichtliche Einführung im Hinblick auf Bauproduktenanforderungen ist in der<br />
Bauregelliste A und im Hinblick auf die Ausführungs- und Bemessungsregeln in der Liste der<br />
technischen Baubestimmungen vorgesehen.<br />
Seite 6 von 13
K. Zilch; J. Lingemann<br />
<strong>Die</strong> <strong>DAfStb</strong>-<strong>Richtlinie</strong> <strong>Stahlfaserbeton</strong><br />
Gliederung der <strong>Richtlinie</strong><br />
<strong>Die</strong> Gliederung der <strong>Richtlinie</strong> entspricht exakt der Gliederung von DIN 1045:2008-08.<br />
Allerdings werden in der <strong>Richtlinie</strong> nur solche Abschnitte aufgeführt, in denen Änderungen<br />
gegenüber DIN 1045:2008-08 vorhanden sind. Unveränderte Abschnitte aus DIN 1045:2008-<br />
08 gelten unverändert und werden in der <strong>Richtlinie</strong> daher nicht erneut aufgeführt. <strong>Die</strong> <strong>DAfStb</strong>-<br />
<strong>Richtlinie</strong>n „Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“ und<br />
„Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton“ gelten unverändert parallel zur <strong>Richtlinie</strong><br />
„<strong>Stahlfaserbeton</strong>“.<br />
Geltungsbereich<br />
Der Geltungsbereich der <strong>Richtlinie</strong> umfasst:<br />
• Bemessung und Konstruktion von Tragwerken des Hoch- und Ingenieurbaus aus<br />
<strong>Stahlfaserbeton</strong> sowie <strong>Stahlfaserbeton</strong> mit Betonstahlbewehrung.<br />
• <strong>Stahlfaserbeton</strong> bis einschließlich zur Druckfestigkeitsklasse C50/60.<br />
• Verwendung von Stahlfasern mit formschlüssiger, mechanischer Verankerung. Glatte,<br />
gerade Stahlfasern sind somit nicht zulässig. Als verankert gelten gewellte Fasern, Fasern<br />
mit Endabkröpfungen und Fasern mit aufgestauchten Köpfchen.<br />
<strong>Die</strong> <strong>Richtlinie</strong> gilt nicht <strong>für</strong>:<br />
• Bauteile aus vorgespanntem <strong>Stahlfaserbeton</strong><br />
• gefügedichten und haufwerksporigen Leichtbeton<br />
• hochfesten Beton der Druckfestigkeitsklassen ab C55/67<br />
• selbstverdichtenden Beton<br />
• Stahlfaserspritzbeton<br />
• <strong>Stahlfaserbeton</strong> ohne Betonstahlbewehrung in den Expositionsklassen XS2, XD2, XS3<br />
und XD3, bei denen die Stahlfasern rechnerisch in Ansatz gebracht werden<br />
Grund <strong>für</strong> diese Einschränkungen ist, dass bislang nur wenig Experimentelle und praktische<br />
Erfahrungen mit den ausgeschlossenen Anwendungsbereichen vorliegen. <strong>Die</strong> letztgenannte<br />
Einschränkung ist durch den Ausfall der Stahlfasern infolge von Korrosion bei Einwirkung<br />
von Chloriden aus Meerwasser bzw. aus Tausalzen begründet.<br />
Seite 7 von 13
K. Zilch; J. Lingemann<br />
<strong>Die</strong> <strong>DAfStb</strong>-<strong>Richtlinie</strong> <strong>Stahlfaserbeton</strong><br />
Bemessung von Bauteilen nach Teil 1 der <strong>Richtlinie</strong><br />
Grundsätzliches<br />
Wie oben gezeigt weist <strong>Stahlfaserbeton</strong> in der Regel ein entfestigendes Materialverhalten auf.<br />
Da die Risslast nicht allein durch die Stahlfasern aufgenommen werden kann, gilt gemäß der<br />
<strong>Richtlinie</strong> folgender Grundsatz <strong>für</strong> die Bemessung:<br />
Nach Ausbildung von Rissen bis zum Erreichen des Grenzzustandes der<br />
Tragfähigkeit am Gesamttragsystem (Systemgleichgewicht) muss ein<br />
Gleichgewichtssystem nachgewiesen werden, z.B. durch:<br />
- Schnittgrößenumlagerung innerhalb statisch unbestimmter Systeme<br />
- Kombination mit Betonstahlbewehrung<br />
- Normaldruckkräfte infolge äußerer Einwirkungen<br />
<strong>Die</strong> Anwendung von <strong>Stahlfaserbeton</strong> ohne Betonstahlbewehrung wird hierdurch auf Fälle<br />
eingeschränkt, in denen nach einer Momentenumlagerung ein Systemgleichgewicht<br />
nachweisbar ist oder in denen die Zugzone durch Normaldruckkräfte klein gehalten wird<br />
(insbesondere im Hinblick auf Tübbinge aus <strong>Stahlfaserbeton</strong>). Im Regelfall werden<br />
Stahlfasern als Ergänzung zur Betonstahlbewehrung vorgesehen.<br />
Materialien und Herstellung<br />
Wie im Geltungsbereich der <strong>Richtlinie</strong> definiert, dürfen nur Stahlfasern mit mechanischer<br />
Verankerung verwendet werden. <strong>Die</strong> Fasern müssen den Anforderungen von DIN 14899<br />
genügen.<br />
Für <strong>Stahlfaserbeton</strong> müssen die Fasern nach Teil 2 der <strong>Richtlinie</strong> im Herstellwerk zugegeben<br />
werden. Hierdurch soll eine kontrollierte Zugabe der Fasern mit exakter Dosierung und unter<br />
Verhinderung von lokalen Faseransammlungen (Igeln) sichergestellt werden.<br />
Da die Abstimmung der Fasern auf den Beton wesentlich <strong>für</strong> die Leistungsfähigkeit eines<br />
<strong>Stahlfaserbeton</strong>s ist, darf <strong>Stahlfaserbeton</strong> nicht als Beton nach Zusammensetzung geliefert<br />
werden. <strong>Stahlfaserbeton</strong> ist somit grundsätzlich Beton nach Eigenschaften. <strong>Die</strong> Eigenschaften<br />
des Betons – im Fall des <strong>Stahlfaserbeton</strong>s die Leistungsklassen – sind durch den<br />
Betonhersteller sicherzustellen. <strong>Die</strong>ser muss <strong>für</strong> jede Betonsorte eine Erstprüfung durchführen.<br />
<strong>Die</strong> Einhaltung der Anforderungen entsprechend der Erstprüfung wird durch jährliche erneute<br />
Prüfung sichergestellt.<br />
Seite 8 von 13
K. Zilch; J. Lingemann<br />
<strong>Die</strong> <strong>DAfStb</strong>-<strong>Richtlinie</strong> <strong>Stahlfaserbeton</strong><br />
Expositionsklassen und Betondeckung<br />
Hinsichtlich des Korrosionsschutzes sind Stahlfasern im Allgemeinen günstiger zu beurteilen<br />
als Betonstahlbewehrung. <strong>Die</strong>s ist darauf zurückzuführen, dass bei Fasern aufgrund der<br />
geringen Ausdehnung keine Ausbildung von Korrosions-Elementen auftritt. Fasern können<br />
zwar oberflächennah korrodieren und gegebenenfalls Rostverfärbungen verursachen. Eine<br />
Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit ist damit nach Definition in der <strong>Richtlinie</strong> nicht gegeben.<br />
Außerdem sind die Sprengdrücke infolge der Korrosion der Fasern so gering, dass in der<br />
Regel keine Betonabplatzungen auftreten.<br />
Es ist zu beachten, dass <strong>Stahlfaserbeton</strong> als Beton mit eingebettetem Metall eingestuft wird<br />
und daher nicht der Expositionsklasse X0 zugeordnet werden darf. In den Expositionsklassen<br />
XS2, XD2, XS3 und XD3 darf die Stahlfaserwirkung nach der <strong>Richtlinie</strong> nicht angesetzt<br />
werden.<br />
Hinsichtlich des konstruktiven Brandschutzes müssen <strong>für</strong> <strong>Stahlfaserbeton</strong> nach der <strong>Richtlinie</strong><br />
die Anforderungen nach DIN 4102-4:1994-03, Abschnitte 3 oder 4 (Wände) bzw.<br />
DIN 4102-22:2004-11 eingehalten werden.<br />
Bemessungswert der Nachrisszugfestigkeit<br />
Im Rahmen der Erstprüfung von <strong>Stahlfaserbeton</strong> wird die Nachrisszugfestigkeit in<br />
weggesteuerten Biegezugversuchen ermittelt. Im Unterschied zum DBV-Merkblatt [3], nach<br />
dem aus der Fläche unter der Last-Verformungslinie des Versuchskörpers die äquivalente<br />
Nachrisszugfestigkeit ermittelt wurde, werden nach der <strong>DAfStb</strong>-<strong>Richtlinie</strong> <strong>Stahlfaserbeton</strong><br />
residuale Nachrisszugfestigkeiten ermittelt. Hier<strong>für</strong> werden die vom Prüfkörper aufnehmbaren<br />
Lasten bei Durchbiegungen von 0,5 mm bzw. 3,5 mm direkt aus der Last-Verformungslinie<br />
abgelesen und die Nachrisszugfestigkeiten <strong>für</strong> die Leistungsklassen L1 und L2 hieraus<br />
ermittelt (Bild 6).<br />
Bild 6: Ermittlung der Nachrissbiegezugfestigkeit im Biegezugversuch<br />
Seite 9 von 13
K. Zilch; J. Lingemann<br />
<strong>Die</strong> <strong>DAfStb</strong>-<strong>Richtlinie</strong> <strong>Stahlfaserbeton</strong><br />
Mit der Angabe der Leistungsklassen des <strong>Stahlfaserbeton</strong>s kann aus Tabelle R.3 der <strong>Richtlinie</strong><br />
(Bild 7) der Grundwert der ansetzbaren zentrischen Nachrisszugfestigkeit f f ct0,Li <strong>für</strong> die<br />
jeweilige Leistungsklasse Li ermittelt werden. Hieraus wird der Rechenwert der zentrischen<br />
Nachrisszugfestigkeit f f ctR,Li gemäß Bild 8 ermittelt.<br />
Bild 7: Grundwerte der Nachrisszugfestigkeiten <strong>für</strong> die einzelnen Leistungsklassen<br />
(aus [1])<br />
f f ctR,Li= κ f F · κ f G · f f ct0,Li<br />
Bild 8: Ermittlung des Rechenwertes der zentrischen Nachrisszugfestigkeit aus dem<br />
Grundwert der zentrischen Nachrisszugfestigkeit (aus [1])<br />
Seite 10 von 13
K. Zilch; J. Lingemann<br />
<strong>Die</strong> <strong>DAfStb</strong>-<strong>Richtlinie</strong> <strong>Stahlfaserbeton</strong><br />
Der Bemessungswert der Nachrisszugfestigkeit wird gemäß Bild 9 aus dem Rechenwert der<br />
Nachrisszugfestigkeit bestimmt. Für die Bemessung darf einerseits eine Spannungs-<br />
Dehnungs-Linie mit einem von abfallendem Ast entsprechend dem tatsächlichen Verhalten<br />
von <strong>Stahlfaserbeton</strong> angesetzt werden. Hierbei ist bei kleinen Dehnungen die<br />
Nachrisszugfestigkeit der Leistungsklasse 1 (Index L1) und bei höheren Dehnungen die<br />
Nachrisszugfestigkeit der Leistungsklasse 2 (Index L2) ansetzbar. Alternativ darf mit einem<br />
rechteckigen Spannungsblock gerechnet werden (Index u bzw. s).<br />
Bild 9: Ansatz der Nachrisszugfestigkeit bei der Bemessung (aus [1])<br />
Ansatz der Nachrisszugfestigkeit bei der Bemessung<br />
<strong>Die</strong> Nachrisszugfestigkeit darf bei den Nachweisen der Tragfähigkeit sowie bei den<br />
Nachweisen der Gebrauchstauglichkeit angesetzt werden. Beim Nachweis von<br />
knickgefährdeten Bauteilen oder stabilitätsgefährdeten schlanken Trägern darf die<br />
Stahlfaserwirkung jedoch nicht berücksichtigt werden.<br />
Biegebemessung<br />
Bei der Biegebemessung von Bauteilen aus <strong>Stahlfaserbeton</strong> darf die rechnerische Spannungs-<br />
Dehnungs-Linie gemäß Bild 9 angesetzt werden (siehe auch Bild 10). Es muss jedoch darauf<br />
hingewiesen werden, dass die Wirkung der Stahlfasern bei der Biegebemessung im Vergleich<br />
zur Betonstahlbewehrung sehr gering ist.<br />
Seite 11 von 13
K. Zilch; J. Lingemann<br />
<strong>Die</strong> <strong>DAfStb</strong>-<strong>Richtlinie</strong> <strong>Stahlfaserbeton</strong><br />
Bild 10: Ansatz der Nachrisszugfestigkeit Biegebemessung von Bauteilen aus<br />
<strong>Stahlfaserbeton</strong> (aus [1])<br />
Querkraftbemessung<br />
Bei der Bemessung <strong>für</strong> Querkraft darf der Stahlfasertraganteil VRd,cf zu den Tragfähigkeiten<br />
des Betons ohne Bügel VRd,ct bzw. des Betons mit Bügeln VRd,sy hinzuaddiert werden (Bild 11).<br />
Bei Verwendung von <strong>Stahlfaserbeton</strong> darf auch bei balkenartigen Bauteilen (b ≤ 5h) die<br />
Mindestquerkraftbewehrung aus Betonstahl auf null reduziert werden. Bei der Ermittlung des<br />
Mindestquerkraftbewehrungsgrades darf die Stahlfasertragwirkung nach Bild 11 angesetzt<br />
werden.<br />
mit:<br />
Bild 11: Formeln <strong>für</strong> die Querkraftbemessung von Bauteilen aus <strong>Stahlfaserbeton</strong><br />
(aus [1])<br />
Seite 12 von 13
K. Zilch; J. Lingemann<br />
<strong>Die</strong> <strong>DAfStb</strong>-<strong>Richtlinie</strong> <strong>Stahlfaserbeton</strong><br />
Rissbreitenbeschränkung<br />
Bei den Nachweisen der Rissbreitenbeschränkung wird die Stahlfasertragwirkung durch den<br />
Ausdruck (1 - αf) berücksichtigt. Hierin ist αf das Verhältnis zwischen dem Rechenwert der<br />
zentrischen Nachrisszugfestigkeit und dem Mittelwert der zentrischen Zugfestigkeit des<br />
Betons. Der Ausdruck (1 - αf) beschreibt somit den Anteil der Beanspruchung, der nicht durch<br />
die Stahlfasern aufgenommenen werden kann und mit Betonstahlbewehrung abzudecken ist.<br />
mit:<br />
Bild 12: Ermittlung der Mindestbewehrung zur Beschränkung der Rissbreite (aus [1])<br />
Zusammenfassung<br />
<strong>Die</strong> <strong>Richtlinie</strong> „<strong>Stahlfaserbeton</strong>“ des Deutschen Ausschusses <strong>für</strong> <strong>Stahlfaserbeton</strong> steht kurz vor<br />
der Veröffentlichung. Im Anschluss ist die bauaufsichtliche Einführung der <strong>Richtlinie</strong> geplant.<br />
<strong>Die</strong> Gliederung der <strong>Richtlinie</strong> ist direkt an die Gliederung der DIN 1045 angelehnt. In der<br />
<strong>Richtlinie</strong> werden dabei nur solche Absätze ausformuliert, in welchen sich durch<br />
Berücksichtigung der Stahlfasertragwirkung Änderungen gegenüber der DIN 1045 ergeben.<br />
Mit der <strong>Richtlinie</strong> wird somit ein durchgehend konsistentes Konzept sowohl zur Bemessung<br />
als auch zur Überwachung des Baustoffes <strong>Stahlfaserbeton</strong> verfügbar sein.<br />
Literatur<br />
[1] Deutscher Ausschuss <strong>für</strong> Stahlbeton (<strong>DAfStb</strong>): <strong>Richtlinie</strong> <strong>Stahlfaserbeton</strong>.<br />
Schlussfassung Juli 2009<br />
[2] Holschemacher, K.; Klug, Y.; Dehn, F.; Wörner, J.-D.: Faserbeton. In: Betonkalender<br />
2006, Band 1. Berlin: Ernst und Sohn<br />
[3] Deutscher Betonverein: Merkblatt <strong>Stahlfaserbeton</strong>. 2001<br />
[4] Lingemann, J.; Zilch, K.: Zum Einfluss der Bauteilgröße auf das Tragverhalten von<br />
Bauteilen aus <strong>Stahlfaserbeton</strong>. In: Münchener <strong>Massivbau</strong> Seminar 2009<br />
Seite 13 von 13