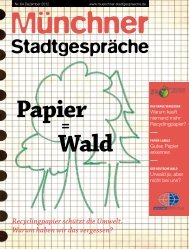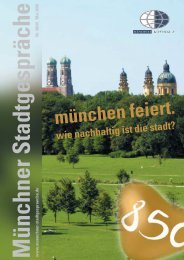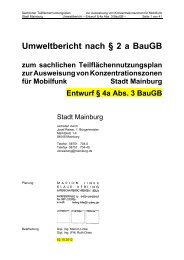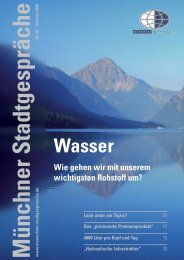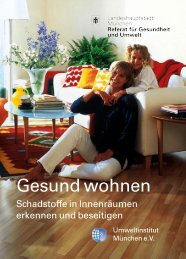Fairer Handel - Umweltinstitut München e.V.
Fairer Handel - Umweltinstitut München e.V.
Fairer Handel - Umweltinstitut München e.V.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
DOSSIER<br />
Münchner Stadtgespräche Nr. 31 11/2003<br />
6<br />
Kinder von Schuldknechten werden oft<br />
selbst Schuldknechte. Gesellschaften<br />
mit einem überdurchschnittlich hohen<br />
Anteil schlecht ausgebildeter und damit<br />
für Marktgesellschaften unter den Bedingungen<br />
der Globalisierung unzureichend<br />
qualifizierter Menschen haben<br />
unterdurchschnittliche Möglichkeiten<br />
zur Bekämpfung von Armut. Solche komplexen<br />
Zusammenhänge von Kinderarbeit<br />
und Armut kommen nur dann in den<br />
Blick, wenn erstens die mit Kinderarbeit<br />
bezeichneten Wirklichkeiten ausreichend<br />
differenziert werden und nicht<br />
nur nach dem Ausmaß, sondern vor<br />
allem nach den Formen von und Bedingungen<br />
für Kinderarbeit gefragt wird.<br />
Zweitens ist es erforderlich, Armut als<br />
vielschichtige (multidimensionale) Realität<br />
zu begreifen, die sich nicht nur<br />
durch eine gänzlich unzureichende Ausstattung<br />
mit materiellen Ressourcen,<br />
sondern durch soziale Ausgrenzung<br />
auszeichnet. Wird diese Ausgrenzung<br />
als Verletzung der wirtschaftlichen,<br />
sozialen und kulturellen Menschenrechte<br />
bestimmt, wird sichtbar, dass die<br />
Verletzung eines Rechtes mit der Verletzung<br />
weiterer Rechte einhergeht: Wird<br />
arbeitenden Kindern das Recht auf Organisation<br />
und wirksame Interessenvertretung<br />
vorenthalten, ist eine Verletzung<br />
des Rechtes auf Schutz vor wirtschaftlicher<br />
Ausbeutung nahe liegende<br />
Folge. Werden arbeitende Kinder extrem<br />
wirtschaftlich ausgebeutet, wird<br />
ihre Selbstorganisation nahezu unmöglich.<br />
Angesichts dieser Wirklichkeiten ist es<br />
sicher richtig, dass die wirtschaftlichen,<br />
sozialen, kulturellen und bürgerlichen<br />
Rechte des Kindes nur dann nachhaltig<br />
verwirklicht werden können, wenn Armut<br />
bekämpft wird. Andererseits aber<br />
muss Arbeitsbekämpfung so gestaltet<br />
werden, dass sie der Verwirklichung der<br />
Rechte des Kindes dient.<br />
Produkte, die mit ausbeuterischer<br />
Kinderarbeit hergestellt werden<br />
Produkte Herkunft<br />
Orangensaft<br />
Kaffee und Tee<br />
Kakao/Schokolade<br />
Shrimps<br />
Teppiche<br />
Bälle<br />
Spielzeug<br />
Coltan (für Handys)<br />
Baumwollsaatgut<br />
Gold<br />
Diamanten<br />
Steine/Grabsteine<br />
Blumen<br />
Brasilien<br />
afrikanische und asiatische Länder<br />
afrikanische Länder<br />
asiat. und lateinamerikanische Länder<br />
Indien, Pakistan, Nepal<br />
Pakistan<br />
China<br />
Kongo<br />
Indien<br />
Kongo<br />
Indien, Thailand, Angola<br />
Indien<br />
Kolumbien, Ecuador, Guatemala, Kenia<br />
Dies ist eine Auswahl von Produkten, die mit ausbeuterischer Kinderarbeit hergestellt<br />
werden. Weitere Produkte sind: Tomaten, Leder, Feuerwerkskörper, Textilien.<br />
Auch das Problem des Sextourismus mit der brutalen Ausbeutung von Kindern ist<br />
hier nicht enthalten. Weitere ausführliche Informationen wie die Broschüre „Kinder<br />
sind keine Sklaven“(Schutzgebühr 3 Euro) gibt es bei: Agendakoordination Eine<br />
Welt, c/o RGU, Implerstr. 9, 81371 <strong>München</strong>, Tel: 233-39 658 oder mail:<br />
agendeeinewelt.rgu@muenchen.de<br />
»Die« Kinderarbeit gibt es nicht<br />
Bereits der erste Vergleich der Arbeit<br />
eines sechsjährigen Jungen, der im<br />
indischen Bundesstaat Uttar Pradesh in<br />
Schuldknechtschaft Teppiche knüpfen<br />
muss, mit der Arbeit eines dreizehnjährigen<br />
Mädchens, das in Managua bei<br />
den Eltern wohnt, (zeitweise) zur Schule<br />
geht und als Straßenhändlerin arbeitet,<br />
zeigt, wie unterschiedlich die Bedingungen<br />
sind, unter denen Kinder arbeiten.<br />
Dieser Sachverhalt ist so selbstverständlich,<br />
dass wenige Hinweise zur<br />
Verdeutlichung genügen mögen: Mädchen<br />
haben oft schlechtere Chancen als<br />
Jungen, ihre Rechte durchzusetzen.<br />
Dies gilt fast immer für Mädchen, die –<br />
oft verdeckt und fast immer sozial isoliert<br />
– in privaten Haushalten als<br />
Dienstmädchen und teilweise als Sklavinnen<br />
arbeiten müssen.<br />
Manche Kinder arbeiten zu Hause oder<br />
doch zumindest in ihrem Heimatdorf,<br />
andere als Wanderarbeiterinnen und<br />
-arbeiter in der informellen Wirtschaft<br />
städtischer Gebiete, wieder andere<br />
werden in ferne Länder verschleppt.<br />
Unterschiedlich ist das Alter der arbeitenden<br />
Kinder, bereits Fünfjährige arbeiten.<br />
Strittig ist, ob die Arbeit Jugendlicher<br />
im Alter von vierzehn oder<br />
fünfzehn bis achtzehn Jahren<br />
überhaupt noch mit dem Begriff »Kinderarbeit«<br />
umschrieben werden kann<br />
(wie dies die Übereinkommen der Internationalen<br />
Arbeitsorganisation und das<br />
Übereinkommen über die Rechte des<br />
Kindes tun).<br />
Unterschiedlich sind Dauer, Schwere<br />
und Gefährlichkeit der Arbeit – auch<br />
und gerade in der Landwirtschaft. Unterschiedlich<br />
ist der Rechtsstatus der<br />
arbeitenden Kinder und der faktische<br />
Grad ihrer Freiheit, der sich jenseits<br />
einer Rechtsordnung und damit in der<br />
Illegalität festgesetzt hat: Einige Kinder<br />
arbeiten in jeder Hinsicht freiwillig und<br />
können ihre Arbeitsbedingungen mit<br />
bestimmen. Andere Kinder werden<br />
durch sozioökonomische Verhältnisse<br />
zur Arbeit gezwungen – sie sind häufig<br />
faktisch in ihren Entscheidungen selbst<br />
dann nicht frei, wenn sie dies rechtlich<br />
wären.<br />
Versklavte Kinder sind jeder faktischen<br />
Freiheit beraubt, wobei im Falle der<br />
Schuldknechte diese rechtswidrige Freiheitsberaubung<br />
durch (in der Regel<br />
mündliche) Vereinbarungen quasi-vertraglich<br />
festgeschrieben ist.<br />
Unterschiedlich ist auch, ob Kinder für<br />
ihre Arbeit bezahlt werden oder nicht.<br />
Ein Teil der arbeitenden Kinder geht<br />
regelmäßig zur Schule, ein anderer Teil