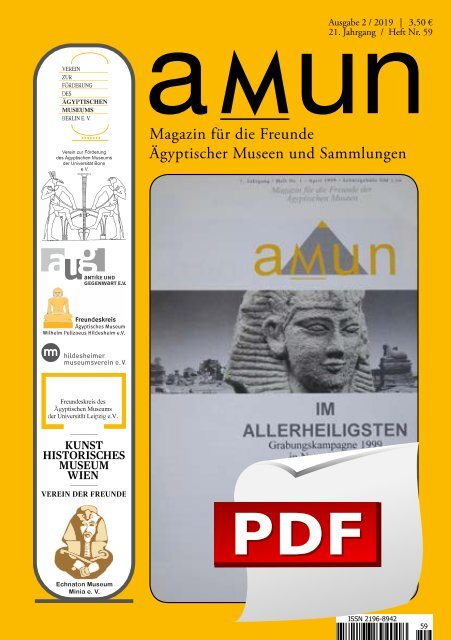aMun Magazin Nr. 59
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ausgabe 2 / 2019 | 3,50 €<br />
21. Jahrgang / Heft <strong>Nr</strong>. <strong>59</strong><br />
<strong>Magazin</strong> für die Freunde<br />
Ägyptischer Museen und Sammlungen<br />
ISSN 2196-8942<br />
<strong>59</strong>
E D I T O R I A L<br />
Dr. Thomas<br />
Ritter<br />
Horst<br />
Creutz<br />
Klaus<br />
Suckow<br />
Prof. Dr. Ludolf<br />
Pelizaeus<br />
Dr. Hartmut<br />
Häger<br />
Dr. Angela<br />
Onasch<br />
Dr. Andreas<br />
Brandstetter<br />
Verehrte Freunde und Förderer der Ägyptischen Museen und Sammlungen,<br />
Dr. Eva<br />
Eggebrecht<br />
im vorigen Heft ist es schon thematisiert worden: Das – <strong>Magazin</strong> für die Freunde<br />
Ägyptischer Museen und Sammlungen hatte zwanzigjähriges Jubiläum. Und wie Sie aus<br />
den Heften 58 und <strong>59</strong> des 21. Jahrgangs schließen können: Es geht weiter!<br />
In dieser Jubiläumsausgabe sei ein kurzer Rückblick auf den Werdegang des –<br />
<strong>Magazin</strong>s gestattet.<br />
Die Initialzündung ging von Berlin aus, genauer: von Herrn Winfried Stolze, der den damaligen<br />
Direktor des Berliner Ägyptischen Museums, Herrn Professor Dietrich Wildung,<br />
überzeugen konnte, ein Mitteilungsblatt für den Verein zur Förderung des Ägyptischen<br />
Museums Berlin und für den Freundeskreis des Ägyptischen Museums München ins Leben<br />
zu rufen. Es sollte überwiegend von den Mitarbeitern der Museen getragen werden, um aus<br />
erster Hand kompetent und aktuell über das Museumsgeschehen (Projekte, Konzeptionen)<br />
und über Sonderausstellungen und Grabungen zu informieren sowie Einzelobjekte und<br />
Objektgruppen der eigenen Museen bekannt zu machen.<br />
Das erste Heft erschien im April 1999. Es gab vier Hefte pro Jahrgang – eine äußerst beachtliche<br />
Leistung, wie wir „Nachkommen“ neidlos zugeben. Die Redaktion hatten Herr<br />
Stolze und Herr Professor Wildung übernommen; als Herausgeber firmierten die Vorsitzenden<br />
der beteiligten Vereine.<br />
Der Erfolg wirkte anziehend. 2001 stieß der Freundeskreis des Ägyptischen Museums der<br />
Universität Leipzig dazu, 2006 der Freundeskreis Ägyptisches Museum Wilhelm Pelizaeus<br />
Hildesheim und etwas später der Hildesheimer Museumsverein. Die Kartusche mit den<br />
Logos der Vereine auf der vorderen Titelseite musste gestreckt werden.<br />
Das Heft 43 des 12. Jahrgangs vom Januar 2010 war das letzte in der genannten personellen<br />
Konstellation des Redaktionsteams. Das Ausscheiden der Herren Stolze und Wildung<br />
aus der Redaktion erforderte jetzt nicht nur eine Neubesetzung, sondern führte auch zu<br />
Überlegungen bezüglich struktureller Veränderungen.<br />
Aber zunächst konnte die erste so erfolgreiche – Periode mit einem Gesamtverzeichnis<br />
der Hefte 1–43 gekrönt werden. Es erschließt die ca. 2 000 Druckseiten durch<br />
hilfreiche Indices, so dass das Gesamtverzeichnis nicht nur Suchinstrument ist, sondern<br />
auch eine kleine Chronik der Museen und Fördervereine darstellt.<br />
2
In Vorbereitung der Weiterführung des – <strong>Magazin</strong>s wurden in einem Vertrag<br />
„Freunde Ägyptens – Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)“ Aufgaben und Verantwortlichkeiten<br />
von Herausgebern und Redaktion festgelegt.<br />
Die zweite – Periode konnte endlich 2012 starten. Mit Heft 44 vom April 2012<br />
schlossen Redaktion und Herausgeber nicht nur in der Heftzählung an die Vorgänger an,<br />
sondern suchten Kontinuität und Neuerungen zu verbinden.<br />
Die Redaktion ging nach Leipzig, wo sie Frau Ute Terletzki, Mitglied des Leipziger Freundeskreises,<br />
übernahm. Sie erstellte das neue Layout im oben angesprochenen Sinn. Unter<br />
ihrer Regie erschienen die Hefte 44/2012 bis 53/2016.<br />
Leider waren nun die Münchner nicht mehr dabei. Kurz nach dem Neubeginn 2012<br />
schloss sich der Verein zur Förderung des Ägyptischen Museums der Universität Bonn dem<br />
– Bund an; es folgte 2013 der Freundes- und Förderkreis Antike & Gegenwart des<br />
Museums August Kestner Hannover. Im gleichen Jahr kamen der Verein der Freunde des<br />
Kunsthistorischen Museums Wien und der Verein Freunde des Echnaton Museums Minia<br />
hinzu. Die Mitgliederkartusche auf dem Titelblatt nahm das langgezogene ptolemäische<br />
Format an. Desgleichen wuchs auch die Fotogalerie der Herausgeber auf der ersten Innenseite.<br />
Das bedeutet aber nicht, dass für eventuelle weitere Beitrittskandidaten kein Platz<br />
mehr ist. Vieles ist möglich — auch typographisch.<br />
E D I T O R I A L<br />
Wechselnde Redaktionsstandorte waren bei der Neuetablierung des <strong>Magazin</strong>s schon<br />
mitgedacht worden. Es wurde akut, als Frau Terletzki aus beruflichen Gründen 2016 die<br />
– Redaktion abgeben musste.<br />
Ein häufiges Epitheton unseres Namenspatrons lautet: „Amun, der hört, wenn man ihn<br />
ruft“. Wie auch immer: Zum Januar 2017 war das neue Redaktionsteam in Berlin startklar.<br />
Die Redaktion ging wieder zum Berliner Freundeskreis. Herr Mike Berger übernahm<br />
Satz und Layout, Frau Erika Böning-Feuß das Lektorat. Diesmal schloss das erste Heft der<br />
neuen Redaktion (54/2017) zeitlich lückenlos an das Vorgängerheft an.<br />
Auch unter dieser Redaktion wurde die wiederholt aufgeworfene Frage nach der Heftanzahl<br />
pro Jahr – 4, 3 oder 2 – zugunsten von zwei Heften entschieden. Trotz Computer und<br />
raffinierter Programme ist der Arbeitsaufwand für die ehrenamtlich arbeitende Redaktion<br />
und für die Verantwortlichen in den Museen, die die Beiträge besorgen und häufig auch die<br />
Autoren sind, sehr groß. In der Diskussion ist auch der Veranstaltungskalender gewesen,<br />
der die Übersicht über die Sonderausstellungen der ersten – Periode abgelöst hat.<br />
Allgemein als nützlich empfunden wurden sehr umfangreiche Ankündigungen durch eine<br />
empfohlene Obergrenze pro Museum eingehegt. Es wird niemanden wundern, dass auch<br />
eine Internet-Ausgabe im Gespräch ist. Ein Arbeitskreis beschäftigt sich damit. Sie soll aber<br />
auf keinen Fall die Printausgabe verdrängen. Deren hohe Wertschätzung zeigt sich auch in<br />
dem Plan, alle bisherigen Hefte in mehreren Bänden als Bücher zusammenzufassen.<br />
3
E D I T O R I A L<br />
Alle Ideen, Pläne und Probleme werden neuerdings in einem neuen „Format“ zusammengetragen:<br />
dem Arbeitstreffen von Redaktion, Museumsverantwortlichen und Herausgebern.<br />
Wegen seiner zentralen Lage war 2017 und 2019 Hannover Gastgeber; 2020 wird<br />
es Leipzig sein. Nach zweimaligem Treffen kann man sagen: Es ist sinnvoll, produktiv und<br />
anregend.<br />
Ein Rückblick auf die Themen der Hefte beider – Perioden kann hier aus Platzgründen<br />
nicht gegeben werde. Zusammenfassend kann man sagen, dass Themenvielfalt die<br />
treffende Charakterisierung ist. Nur zwei Themen seien herausgegriffen:<br />
Einen herausragenden Platz in der ersten –Periode nimmt die enge Berichterstattung<br />
über die großen Bauprojekte ein. In Berlin war es der Wiederaufbau des Neuen<br />
Museums auf der Museumsinsel, in München der Neubau, in Leipzig der Umzug in das<br />
Kroch-Hochhaus und in Hildesheim der Umbau des Hauses. An allen Standorten präsentierten<br />
sich die Museen danach mit neuen Konzeptionen.<br />
Wie eine spannende Fortsetzungsgeschichte ziehen sich die Berichte über zwei Grabungen<br />
durch die – Hefte. War es in der ersten – Periode die Grabung des Ägyptischen<br />
Museums Berlin im sudanesischen Naga, ist es nun die ägyptisch-deutsche Grabung<br />
in Heliopolis, wo ein Team des Leipziger Museums auf einer Müllhalde sensationelle Funde<br />
macht.<br />
Im vorliegenden Jubiläumsheft erwartet Sie wie gewohnt ein bunter Themenmix. Hervorzuheben<br />
wären die Berichte über zwei weitere Jubiläen: 175 Jahre Hildesheimer Museumsverein<br />
(S. 14) und das 40jährige Doppeljubiläum Hildesheim und Minia (S. 18).<br />
Der Dank, den wir, die Herausgeber, am Schluss dieses Editorials aussprechen, geht an<br />
mehrere Adressaten. Er gilt zunächst Ihnen, den Lesern der – Hefte, für Ihre Treue,<br />
Ihr Interesse und Ihre Anregungen. Bleiben Sie uns weiterhin – auch kritisch – gewogen!<br />
Unser Dank, dem sich die – Leserschaft der Freundes- und Fördervereine anschließt,<br />
gilt den Autoren der –Beiträge, die bereit sind, über ihre wissenschaftlichen<br />
Forschungen zu berichten und Freuden und Probleme im Museumsgeschehen mit<br />
den Lesern zu teilen.<br />
In ganz besonderem Maße möchten wir uns bei den Redakteuren aller Hefte bedanken. Sie<br />
mussten und müssen es allen recht machen: den Autoren, den – Verantwortlichen<br />
der Museen und Vereine, der Druckerei und vor allem den Lesern. Ihre ehrenamtliche Arbeit<br />
neben ihren beruflichen Verpflichtungen verdient unsere Hochachtung und Dankbarkeit.<br />
Nach diesem Rückblick wünsche ich Ihnen mit dem neuen Heft viele interessante Informationen<br />
und Anregungen!<br />
Ihre Angela Onasch<br />
4
Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02<br />
Inhaltsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05<br />
Dietrich Wildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06<br />
Rückblick<br />
20 Jahre<br />
Gunnar Sperveslage / Frank Förster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09<br />
Kaiserliche Pharaonen – Pharaonische Kaiser<br />
Eine Sonderausstellung im Ägyptischen Museum der Universität Bonn<br />
Hartmut Häger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14<br />
175 Jahre<br />
Hildesheimer Museumsverein e. V.<br />
Regine Schulz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16<br />
Neuer Vorsitzender<br />
des Freundeskreises Ägyptisches Museum Wilhelm Pelizaeus Hildesheim e. V.<br />
Helmut Brandl / Sven Kielau / Oliver Rösner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18<br />
Doppel-Jubiläum!<br />
Hildesheim und Minia feiern ihre langjährige Partnerschaft<br />
Thomas Ritter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25<br />
Ein Ma’at-Impuls für Europa!<br />
Veranstaltungskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />
Dina Faltings / Anna-Maria Begerock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32<br />
Ein Rum-Baron und seine Mumie<br />
Neukonzeption der Ägyptenausstellung im Bacardí-Museum Santiago de Cuba<br />
Daniela Rutica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42<br />
Arbeiter – Künstler – Pharaonen<br />
Die 12. Tage der Ägyptologie im koptischen Kloster Brenkhausen<br />
Thomas Ritter / Daniela Vandersee-Geier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48<br />
Toutânkhamon le Trésor du Pharaon<br />
Reise des Vereins zur Förderung des Ägyptischen Museums in Berlin nach Paris zur Ausstellung<br />
Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51<br />
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S<br />
Unsere Museen im Internet:<br />
http://www.smb.museum<br />
http://www.aegyptisches-museum.uni-bonn.de<br />
http://www.museum-august-kestner.de<br />
http://www.rpmuseum.de<br />
http://www.gko.uni-leipzig.de/aegyptisches-museum<br />
http://www.khm.at<br />
5
Rückblick<br />
20 Jahre<br />
Am 11. Oktober 2019 feiert die Stiftung<br />
Preußischer Kulturbesitz den zehnten<br />
Jahrestag der Eröffnung des renovierten<br />
Neuen Museums. Die Mitglieder des Vereins<br />
zur Förderung des Ägyptischen Museums<br />
Berlin haben das Privileg, die Vorgeschichte,<br />
die zehn überaus spannenden Jahre von 1999<br />
bis 2009 geradezu live noch einmal erleben<br />
zu können. Regelmäßig berichtete<br />
direkt aus den Planungssitzungen und später<br />
von der Baustelle über das Wiedererstehen<br />
des Ägyptischen Museums an seinem historischen<br />
Ort auf der Museumsinsel.<br />
Dietrich Wildung<br />
Schade, dass das für die Zukunft des<br />
Ägyptischen Museums so entscheidende<br />
Jahrzehnt nach dem Fall der Mauer nicht<br />
ebenso authentisch nacherlebt werden kann.<br />
Die Initialzündung für das Projekt<br />
fand erst im November 1998 statt. Ein mir<br />
bis dahin unbekannter Wilfried Stolze (im<br />
Branchenbuch mit seiner Firma „Preußenwerbung“<br />
verzeichnet) hatte mich um einen<br />
Termin gebeten, und bei unserem ersten<br />
Gespräch in meinem Büro im Pergamonmuseum<br />
trug er mir seine erstaunliche Idee<br />
vor, für den Förderverein ein <strong>Magazin</strong> zu<br />
publizieren, das einen aktuellen Kontakt<br />
zwischen Museum und Verein bilden sollte.<br />
Schon einen Monat später einigten sich Herr<br />
Stolze, der Vereinsvorsitzende, Dr. Wilm<br />
Tegethoff, und ich bei einem Treffen im<br />
Stülerbau mit Blick auf Schloss Charlottenburg<br />
auf die Eckdaten der Gründung von<br />
: Vier Hefte pro Jahr, Finanzierung<br />
ausschließlich durch Werbeanzeigen, Layout,<br />
Gestaltung und Druck durch W. Stolze,<br />
redaktionelle und fachliche Betreuung durch<br />
das Museum, Herausgeberschaft beim Vereinsvorstand.<br />
Durch seine Konzentration<br />
auf die Arbeit des Museums und des Vereins<br />
sollte neben populären Zeitschriften<br />
wie Kemet, Antike Welt oder Archäologie<br />
in Deutschland ein klares eigenes Profil<br />
zeigen, formuliert im Untertitel „<strong>Magazin</strong><br />
für die Freunde der Ägyptischen Museen“.<br />
Im April 1999 erschien pünktlich zum<br />
Quartalsbeginn das erste Heft. Die von<br />
Herrn Stolze mit unerbittlicher Präzision<br />
anberaumten Redaktionsbesprechungen im<br />
Museum entwickelten sich im Lauf des<br />
folgenden Jahrzehnts zu einem festen Element<br />
meines Terminkalenders. Ich plante<br />
immer einen ganzen Vormittag ein, denn die<br />
Gespräche mit dem redefreudigen Wilfried<br />
Stolze beschränkten sich nicht auf die Themen<br />
und die Gestaltung des nächsten Heftes,<br />
sondern beleuchteten auch die Befindlichkeit<br />
von Berlin und der Welt. Für mich wurden<br />
die – Sitzungen alsbald zum Anlass,<br />
ein Vierteljahr Museumsbetrieb Revue passieren<br />
zu lassen, mir Rechenschaft über den<br />
Weg des Museums abzulegen und über die<br />
nächsten Planungsphasen nachzudenken.<br />
Die Essenz dieser Überlegungen fand ihren<br />
6
Niederschlag in Beiträgen in<br />
als 150 sind es geworden.<br />
; mehr<br />
Das Konzept von fand alsbald das<br />
Interesse anderer Museen; bereits Heft 2<br />
zeigt auf dem Titel neben dem Berliner auch<br />
das Münchener Vereinslogo; Leipzig und<br />
Hildesheim schlossen sich später an.<br />
In elf Jahren wuchs die stattliche Reihe<br />
von 43 Ausgaben auf fast 2 000<br />
Druckseiten an. Als im Sommer 2009 Wilfried<br />
Stolze von Berlin ins Emsland umzog<br />
und meine Zeit am Ägyptischen Museum<br />
zu Ende ging, war der Herausgabe der „Mitteilungen<br />
für die Freunde der Ägyptischen<br />
Museen“ die wichtigste Grundlage entzogen,<br />
der regelmäßige persönliche Kontakt zwischen<br />
den Museen und Herrn Stolze, dem<br />
unermüdlichen Motor des Projekts. Ihm ist<br />
das 2010 erschienene „Gesamtverzeichnis<br />
1–43“ gewidmet, in dem alle Beiträge<br />
bibliographisch erfasst und inhaltlich<br />
erschlossen sind – eine Fundgrube für einen<br />
Rückblick auf eine unvergessliche Zeit des<br />
Aufbruchs.<br />
Abb. 1: Cover vom Gesamtverzeichnis<br />
7
Kaiserliche Pharaonen<br />
AUTOKRATOR<br />
KAISAROS<br />
Pharaonische Kaiser<br />
Die Herrschaft der römischen Principes<br />
zwischen Republik und ägyptischem Königtum<br />
Ägyptisches Museum der Universität Bonn<br />
18. Juni bis 30. November 2019<br />
gefördert durch die<br />
Öffnungszeiten: Di-Fr 13-17 Uhr; Sa-So 13-18 Uhr
Kaiserliche Pharaonen –<br />
Pharaonische Kaiser<br />
Eine Sonderausstellung<br />
im Ägyptischen Museum der Universität Bonn<br />
In der Schlacht bei Actium, einer Halbinsel<br />
im Ionischen Meer an der Westküste Griechenlands,<br />
besiegte Octavian, der spätere<br />
Augustus, die von Kleopatra und Marcus<br />
Antonius befehligte Flotte und zwang Antonius’<br />
Landtruppen zur Kapitulation. Zwar<br />
vergingen noch zehn Monate, ehe Octavian<br />
an der nordafrikanischen Küste landete und<br />
Alexandria einnahm; auch entsprang die<br />
Einnahme Ägyptens nicht römischen Expansionsbestrebungen,<br />
sondern resultierte aus<br />
einem römischen Bürgerkrieg, in dem sich<br />
Octavian und Marcus Antonius als Kontrahenten<br />
gegenüberstanden. Dennoch gilt die<br />
Schlacht als das historische Ereignis, das zur<br />
Eingliederung Ägyptens in das Römische<br />
Reich führte.<br />
Gunnar Sperveslage / Frank Förster<br />
Für das Land am Nil brach damit eine<br />
neue Ära an. Die Herrschaft der Ptolemäer<br />
war nach rund 300 Jahren beendet, Ägypten<br />
wurde fortan vom römischen Kaiser<br />
beherrscht. Entsprechend der ägyptischen<br />
Königsideologie waren Augustus (31 v. Chr.<br />
– 14 n. Chr.) und seine Nachfolger nicht nur<br />
römischer Kaiser, sondern auch ägyptischer<br />
Pharao. Zu Beginn der Regierungszeit des<br />
Augustus wurden die Grundlagen der römischen<br />
Herrschaftsrepräsentation in Ägypten<br />
gelegt, wobei die Darstellungsweise auf den<br />
ägyptischen Monumenten der ägyptischen<br />
Tradition folgte. Der Kaiser erhielt eine<br />
pharaonische, in Hieroglyphenschrift umgesetzte<br />
Titulatur, bestehend aus Horusnamen,<br />
Thronnamen und Eigennamen. Bemerkenswert<br />
ist dabei, dass, anders als bei seinen<br />
Nachfolgern, der Name Augustus nicht in<br />
Hieroglyphen geschrieben wurde. Stattdessen<br />
wurden die Titel „Autokrator“ und „Kaisaros“<br />
in Kartuschen geschrieben. Ebenfalls<br />
belegt sind die Bezeichnungen „Herrscher<br />
der Herrscher, erwählt von Ptah“ und „Der<br />
Römer“. Bei den Titeln „Autokrator“ und<br />
„Kaisaros“ handelt es sich um die griechischen<br />
Entsprechungen zu den römischen<br />
Titeln „Imperator“ und „Caesar“. Demnach<br />
war offenbar die griechisch sprechende Priesterschaft<br />
in Ägypten, vermutlich konkret in<br />
Alexandria, für den Entwurf der Titulatur<br />
verantwortlich.<br />
In Rom verlieh Augustus seinem Machtanspruch<br />
über Ägypten durch die Verschleppung<br />
ägyptischer Monumente sichtbaren<br />
Ausdruck. Ein konkretes Beispiel dafür ist<br />
der Obelisco Flamino, der heute auf der<br />
Piazza del Popolo in Rom steht. Ursprünglich<br />
stand der 24 m hohe Obelisk, der von<br />
Sethos I. begonnen und unter Ramses II.<br />
vollendet wurde, in Heliopolis. Augustus<br />
ließ ihn auf der Spina des Circus Maximus<br />
aufstellen. Auch der Obelisk auf der Piazza<br />
Montecitorio wurde von Augustus nach<br />
Rom gebracht und auf dem Marsfeld wiedererrichtet,<br />
wo er als Schattenstab einer<br />
riesigen Sonnenuhr gedient haben soll.<br />
9
Die Darstellung und Inszenierung des<br />
Herrschers befindet sich in einem ideologischen<br />
Spannungsfeld zwischen dem<br />
römischen Principat und dem ägyptischen<br />
Königtum. Im Kontext des ägyptisch-römischen<br />
Kulturkontaktes hat der römische<br />
Kaiser zwei verschiedenen Rollen und übt<br />
unterschiedliche Funktionen aus. Entsprechend<br />
wurden andere Wege der Herrschaftsrepräsentation<br />
entwickelt. Die Ausstellung<br />
„Kaiserliche Pharaonen – Pharaonische Kaiser:<br />
Die Herrschaft der römischen Principes<br />
zwischen Republik und ägyptischem Königtum“<br />
thematisiert nun einerseits, wie der<br />
römische Kaiser auf ägyptischen Monumenten<br />
inszeniert wird, und ist andererseits der<br />
Frage gewidmet, mittels welcher ägyptischen<br />
Bild- und Formsprache der römische Kaiser<br />
seinen Herrschaftsanspruch über Ägypten<br />
in Rom erhebt. Umgesetzt ist dies durch<br />
thematische Poster und ausgewählte Einzelobjekte.<br />
Neben Objekten aus der Sammlung<br />
des Ägyptischen Museums sind Leihgaben<br />
aus dem Akademischen Kunstmuseum der<br />
Universität Bonn, aus dem LVR-Landes-<br />
Museum Bonn sowie aus mehreren Privatsammlungen<br />
zu sehen.<br />
Exemplarisch werden die Herrschaftsinszenierungen<br />
für die drei Kaiser Augustus<br />
(31 v. Chr. – 14 n. Chr.), Domitian (81–96<br />
n. Chr.) und Hadrian (117–138 n. Chr.)<br />
dargestellt. Augustus nimmt allein dadurch<br />
eine Sonderstellung ein, dass er nach der Eingliederung<br />
Ägyptens in das Römische Reich<br />
der erste römische Herrscher über Ägypten<br />
war. Seine Repräsentation in Ägypten und<br />
die für ihn entworfene pharaonische Titulatur<br />
waren Vorbild für alle folgenden Kaiser.<br />
Unter den Flaviern gewinnt der Isis-Kult im<br />
Abb. 1: Relieffragment mit Teil einer Königskartusche, die die hieroglyphisch geschriebenen Titel „Autokrator“<br />
und „Kaisaros“ enthält (Ägyptisches Museum Bonn, Inv.-<strong>Nr</strong>. BoSAe o. <strong>Nr</strong>. © Foto: Jutta Schubert; leicht<br />
schematisierte Umzeichnung: Dominic Jacobs).<br />
10
Römischen Reich an Bedeutung; erstmals<br />
stellt sich nun auch der Kaiser unter den<br />
Schutz der ägyptischen Göttin. Ein zentrales<br />
Objekt ist der hieroglyphisch beschriftete<br />
Obelisk des Domitian (heute auf der Piazza<br />
Navona in Rom), auf dem Domitian als<br />
„geliebt von Isis“ bezeichnet wird und auf<br />
dem seine Krönung durch die Göttin Isis<br />
dargestellt ist. Auch unter Hadrian finden<br />
sich neben den ägyptischen Elementen in<br />
seiner Villa in Tivoli einzigartige Ägyptenbezüge.<br />
Hieroglyphische Inschriften aus seiner<br />
Zeit enthalten Übersetzungen römischer<br />
Termini ins Ägyptische und auf der Nilinsel<br />
Philae wurde eine mythologisch hochgradig<br />
aufgeladene Darstellung des Nil-Ursprungs<br />
angebracht.<br />
In römischer Zeit wurden in der Repräsentation<br />
von ägyptischen Gottheiten die<br />
Bildtypen der Ptolemäerzeit fortgeführt.<br />
Oft lässt sich schwer entscheiden, ob eine<br />
Götterfigur in die ptolemäische oder in die<br />
römische Zeit zu datieren ist. Nur wenige<br />
Bildtypen wurden in der römischen Zeit neu<br />
entwickelt. Eine davon ist die schlangenleibige<br />
Isis-Thermouthis, die ab dem 1. Jh.<br />
n. Chr. auftritt (Abb. 2). Sie wurde nach dem<br />
Vorbild der ägyptischen Schlangengöttin<br />
Renenutet geschaffen, deren Hauptkultort<br />
im Fayum lag.<br />
Nachfolgend seien einige ausgewählte<br />
Exponate kurz besprochen, die als Kostproben<br />
Appetit auf die Ausstellung machen<br />
sollen. Diese ist auf insgesamt sechs Vitrinen<br />
verteilt, wozu noch einführende Poster zu den<br />
genannten drei Kaisern kommen, die im Korridorbereich<br />
des Museums aufgehängt sind.<br />
Ein Highlight und zugleich eine Art Logo<br />
der Ausstellung ist ein kleines Relieffragment<br />
unbekannter Herkunft, das im Ägyptischen<br />
Museum aufbewahrt wird (Abb. 1). Es zeigt<br />
in eine Kartusche geschrieben den Doppeltitel<br />
„Autokrator Kaisaros“. Dabei ist der<br />
Titel, wie in der ägyptischen Schrifttradition<br />
zur Notation fremdländischer Namen üblich,<br />
in Einkonsonantenzeichen geschrieben. Eine<br />
genaue Zuordnung des Fragmentes zu einem<br />
bestimmten römischen Kaiser ist kaum möglich;<br />
sicher ist nur, dass es einem Nachfolger<br />
des Augustus zuzuweisen ist. Denn unter<br />
Augustus wurden die Titel „Autokrator“ und<br />
„Kaisaros“ noch nicht zusammen in eine<br />
Kartusche geschrieben.<br />
Abb. 2: Terrakotta mit Darstellung der Göttin<br />
Isis-Thermouthis in Schlangengestalt mit Menschenkopf.<br />
Auf dem Kopf trägt sie eine Krone, die aus den<br />
ägyptischen Elementen Kuhhörnern, Sonnenscheibe<br />
und Federn besteht (Akademisches Kunstmuseum<br />
Bonn, Inv.-<strong>Nr</strong>. D 56; © Foto: Wolfgang Klein).<br />
11
In der Götterwelt wurde bereits unter<br />
den Ptolemäern in vielen Bereichen der<br />
ägyptische Totengott Osiris durch den neugeschaffenen<br />
Gott Serapis verdrängt. Serapis<br />
vereinigt in sich Aspekte der ägyptischen<br />
Götter Osiris und Apis sowie des griechischen<br />
Vatergottes Zeus, des Totengottes<br />
Hades und des Asklepios, des Gottes der<br />
Heilkunst. Dargestellt wird er entsprechend<br />
der griechischen Vatergottheiten als bärtiger<br />
Mann. Ein besonderes Kultbild des Gottes<br />
Serapis stellt ein bronzener Fuß aus der<br />
Privatsammlung Lisa Schwarz dar, die als<br />
Dauerleihgabe im Ägyptischen Museum aufbewahrt<br />
wird (Abb. 3). In die Aussparung im<br />
oberen Bereich war ursprünglich vermutlich<br />
eine kleine Büste des Serapis eingelassen.<br />
Dieses Motiv ist von Münzen und Gemmen<br />
bekannt und symbolisiert die heilenden<br />
Fähigkeiten des Gottes.<br />
Amulettplättchen (1,5 x 1,2 cm) aus dem<br />
LVR-LandesMuseum Bonn, das im Jahre<br />
1924 oder 1925 in der Nähe des römischen<br />
Militärlagers in Bonn gefunden und von<br />
Alfred Wiedemann, dem Begründer der<br />
Bonner Ägyptologie, 1925 in den „Bonner<br />
Jahrbüchern“ publiziert wurde (Bd. 130,<br />
S. 193–198). Gefertigt aus weißem Glasfluss,<br />
zeigt es auf der einen Seite ein Udjat-<br />
Auge als schutzbringendes Symbol, auf der<br />
anderen ein Pferd zusammen mit einigen<br />
Hieroglyphen (Abb. 4). Darstellungen von<br />
Pferden finden sich eher selten auf ägyptischen<br />
Amuletten. Anders als im Römischen<br />
Die Verbreitung ägyptischer Objekte<br />
im Römischen Reich illustriert ein kleines<br />
Abb. 3: Kultstatuette des Gottes Serapis in Form eines<br />
Fußes (Ägyptisches Museum Bonn, Leihgabe Sammlung<br />
Lisa Schwarz <strong>Nr</strong>. 39; © Foto: Norbert Böer).<br />
Abb. 4: Ägyptisches Amulett mit Darstellung eines<br />
Udjat-Auges auf der einen sowie eines Pferdes mit<br />
Hieroglyphen auf der anderen Seite, gefunden 1924/25<br />
nahe des römischen Militärlagers in Bonn (LVR-LandesMuseum,<br />
Inv.-<strong>Nr</strong>. 30825; © Fotos: Jürgen Vogel).<br />
12
Reich wurde das Pferd in Ägypten kaum als<br />
Reittier, sondern nahezu ausschließlich als<br />
Zugtier von zweirädrigen Streitwagen eingesetzt.<br />
Die Frage, ob der Träger des Amuletts<br />
vielleicht Anhänger eines im Römischen<br />
Reich verbreiteten ägyptischen (Isis?-)Kultes<br />
war, muss offenbleiben. In jedem Falle dürfte<br />
es sich bei dem Glücksbringer um das erste<br />
Objekt aus dem alten Ägypten handeln, das<br />
nach Bonn gelangte – vor rund 2 000 Jahren.<br />
Universität Bonn als ein Gemeinschaftsprojekt<br />
der beteiligten Fächer Alte Geschichte<br />
und Ägyptologie unter Leitung von Prof.<br />
Konrad Vössing und Prof. Ludwig Morenz<br />
realisiert wurde (vgl. auch 57, 2018,<br />
S. 64–70), ist noch bis zum 30. November<br />
2019 zu sehen. Und die Chancen stehen gut,<br />
dass sie sogar noch um einige Monate verlängert<br />
wird!<br />
Auf den ersten der kaiserlichen Pharaonen<br />
und pharaonischen Kaiser, nämlich Augustus,<br />
gehen spezielle Münzprägungen zurück,<br />
die auf einer Seite ein Krokodil zeigen, das<br />
oft wie hier als an eine Palme gekettet dargestellt<br />
ist (Abb. 5). Das Krokodil ist ein<br />
Symbol für den Nil und damit für Ägypten,<br />
dessen Eroberung hierdurch bildhaft zum<br />
Ausdruck gebracht werden soll. Manche<br />
Münzen weisen zudem noch eine Aufschrift<br />
AEGYPTO CAPTA auf, was ganz konkret<br />
„Ägypten ist bezwungen“ zu lesen ist.<br />
Bei unserem Beispiel verrät der Schriftzug<br />
COL(onia) NEM(ausus), dass die Münze<br />
aus dem gallischen Nîmes stammt. Das<br />
Motiv des gefangenen Krokodils war in<br />
Nîmes besonders beliebt, da dort zahlreiche<br />
Veteranen aus der Schlacht bei Actium angesiedelt<br />
waren. Noch heute sind das Krokodil<br />
und die Palme Teil des Stadtwappens von<br />
Nîmes. Auf der Vorderseite der Münze ist<br />
Augustus mit seinem engen Vertrauten und<br />
Stellvertreter Agrippa zu sehen.<br />
Freunde des interkulturellen Kontakts zwischen<br />
Ägypten und dem alten Rom werden<br />
noch für einige Zeit auf ihre Kosten kommen:<br />
Die Sonderausstellung, die im Rahmen<br />
des Sonderforschungsbereiches 1167 „Macht<br />
und Herrschaft – Vormoderne Konfigurationen<br />
in transkultureller Perspektive“ an der<br />
Abb. 5: Das gefangene Krokodil auf der Rückseite<br />
der Münze aus der Regierungszeit des Augustus<br />
symbolisiert die römische Eroberung Ägyptens. Auf<br />
der Vorderseite ist eine Darstellung des Augustus mit<br />
seinem Stellvertreter Agrippa zu sehen (Akademisches<br />
Kunstmuseum Bonn, Inv.-<strong>Nr</strong>. R 10.010;<br />
© Fotos: Akademisches Kunstmuseum Bonn).<br />
13
175 Jahre<br />
Hildesheimer Museumsverein e. V.<br />
Am 29. Juli 1844 wurde der Museumsverein<br />
unter dem Namen „Verein für<br />
Kunde der Natur und der Kunst im Fürstenthume<br />
Hildesheim und in der Stadt<br />
Goslar“ gegründet. Gründungsmitglieder<br />
waren Gottlob Heinrich Bergmann (1781–<br />
1861), Johannes Leunis (1802–1873), Hermann-Adolf<br />
Lüntzel (1799–1850), Clemens<br />
Praël (1800–1878) und Hermann Roemer<br />
(1816–1894). 14 Tage später, am 12. August<br />
1844, genehmigte die hierfür zuständige<br />
Verwaltungsstelle der königlich-hannoveranischen<br />
Landdrostei die Satzung, und am<br />
1. September 1844 stellte sich der Verein in<br />
der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung vor.<br />
Nun begann eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte,<br />
und schon am 20. März 1845<br />
konnte die erste Ausstellung in zwei Räumen<br />
der Boos’schen Kurie am Domhof 26<br />
der Öffentlichkeit präsentiert werden. Da<br />
das Museum sowohl natur- als auch kulturkundliche<br />
Gegenstände sammeln wollte,<br />
gab es zwei Direktoren: Für die Geschichte<br />
und Kunst war Hermann-Adolf Lüntzel<br />
zuständig und für die Naturkunde Johannes<br />
Leunis. Der Geschäftsführer („Secretaer“)<br />
war Hermann Roemer. Zum Zeitpunkt<br />
der Ausstellungseröffnung hatte der Verein<br />
bereits 178 Mitglieder, 6 Ehrenmitglieder<br />
(Fördermitglieder) und 31 korrespondierende<br />
Mitglieder (Sammler und Stifter). Um<br />
weitere Unterstützer zu begeistern, erging<br />
Hartmut Häger<br />
noch im selben Jahr ein erneuter Aufruf zur<br />
Beteiligung am Museumsverein.<br />
Bereits zehn Jahre nach seiner Gründung<br />
gelang es dem Museumsverein, die Martinikirche<br />
zu kaufen und sie von 1857 bis 18<strong>59</strong><br />
von Conrad Wilhelm Hase zum Museum<br />
umbauen zu lassen. Wiederum zehn Jahre<br />
später konnte der Verein die benachbarten<br />
Gebäude des Waisenhauses und der Kapelle<br />
(Portiuncula) erwerben und durch Stadtbaumeister<br />
Gustav Schwartz in das nun<br />
„Städtische Museum“ integrieren lassen.<br />
Die Erweiterungen zeugen vom raschen<br />
Anwachsen der Sammlung durch Stifter mit<br />
unterschiedlichen Interessen, so dass viele<br />
qualitativ hochwertige Bereiche entstanden:<br />
Paläontologie, Geologie, Völkerkunde,<br />
Ägyptologie, Heimatgeschichte, jeweils mit<br />
weiteren Ausdifferenzierungen. Die Familie<br />
Roemer steuerte eigene Sammlungen bei,<br />
aber vor allem erhebliche Vermächtnisse,<br />
die den Unterhalt des Museums absicherten.<br />
Eineinhalb Monate nach Hermann Roemers<br />
Tod am 24. Februar 1894 wurde das<br />
Städtische Museum in „Roemer-Museum“<br />
umbenannt.<br />
14
Danach kamen weitere bedeutende<br />
Sammlungen nach Hildesheim – zum Beispiel<br />
durch Museumsdirektor Rudolf Hauthal,<br />
der nach 1906 für das Hildesheimer<br />
Museum eine bedeutende Alt-Peru-Sammlung<br />
erwarb und durch Wilhelm Pelizaeus,<br />
der bis 1911 der Stadt über 2 000 altägyptische<br />
Objekte schenkte. Für das „Pelizae us-<br />
Museum, archäologische Sammlung“ wurde<br />
eine erneute bauliche Erweiterung er forderlich,<br />
deren Eröffnung am 29. Juli 1911 ein<br />
Wechsel der Trägerschaft vom Museumsverein<br />
auf die Stadt vorausging.<br />
Seitdem begleitet und berät der Museumsverein<br />
das Museum und die Stadt in den<br />
jeweiligen Aufsichtsgremien, früher der<br />
Gemeindevertretung, heute der gGmbH.<br />
Er tritt öffentlich für die Belange „seines“<br />
Museums ein und bietet seinen Mitgliedern<br />
eine Fülle interessanter Angebote.<br />
Der Museumsverein – die älteste noch<br />
aktive Bürgerinitiative der Stadt Hildesheim<br />
– hat zurzeit 1 100 Mitglieder, darunter über<br />
200 junge Mitglieder von 8 bis 18 Jahren<br />
– die JuMis. Seit dem 16. Juni 1977 gibt<br />
es einen zweiten Verein, den Freundeskreis<br />
Ägyptisches Museum Wilhelm Pelizaeus, mit<br />
dem der Hildesheimer Museumsverein aufs<br />
engste zusammenarbeitet. Während sich der<br />
Museumsverein verstärkt auf die Aktivitäten<br />
und Sammlungsbereiche des Roemer-Museums<br />
(Naturkunde, Ethnologie, Kunst- und<br />
Regionalgeschichte) konzentriert, stehen<br />
beim Freundeskreis die Antiken-/Ägyptensammlungen<br />
und die Projekte des Pelizaeus-Museums<br />
im Vordergrund. Unterstützt<br />
werden das Museum und die beiden Vereine<br />
außerdem (Roemer- und Pelizaeus-Museum<br />
zusammen mit dem Stadtmuseum Hildesheim)<br />
von ca. 100 ehrenamtlichen Helferinnen<br />
und Helfern, die in vielen verschiedenen<br />
Bereichen aktiv mitwirken.<br />
Danke an alle Mitglieder für 175 Jahre!<br />
UNSERE<br />
JUMIS<br />
_jungblut<br />
_wissensdurst<br />
_teamwork<br />
GEBURTSTAG<br />
15
Neuer Vorsitzender<br />
des Freundeskreises Ägyptisches Museum<br />
Wilhelm Pelizaeus Hildesheim e.V<br />
Nach dem plötzlichen Ableben des<br />
langjährigen Vorsitzenden, Dr. Jürgen<br />
Kroneberg, hat der Vorstand Herrn Prof. Dr.<br />
Ludolf Pelizaeus als neuen Vorsitzenden des<br />
Freundeskreises Ägyptisches Museum Wilhelm<br />
Pelizaeus Hildesheim e. V. berufen.<br />
Regine Schulz<br />
Prof. Dr. Ludolf Pelizaeus ist ein Nachfahre<br />
von Wilhelm Pelizaeus (1851–1930),<br />
dem Begründer des Pelizaeus-Museums in<br />
Hildesheim, das 1911 eröffnet wurde und<br />
jetzt Bestandteil des Roemer- und Pelizae us-<br />
Museums (RPM) Hildesheim ist.<br />
16
Ludolf Pelizaeus ist seit 2014 Professor für<br />
Ideengeschichte, Kultur- und Interkulturelle<br />
Geschichte im Fachbereich Fremdsprachen<br />
und Kulturen an der Université de Picardie<br />
Jules Verne in Amiens (Frankreich). Vorher<br />
war er außerplanmäßiger Professor an<br />
der Johannes Gutenberg Universität Mainz<br />
und lehrte an der Karl Franzens Universität<br />
Graz (Österreich), der National University of<br />
Ireland in Galway und arbeitete am Leibniz<br />
Institut für Europäische Geschichte. Er studierte<br />
Geschichte, Kunstgeschichte und Kulturanthropologie,<br />
wurde 1998 promoviert<br />
und habilitierte sich 2003 mit einer Arbeit<br />
zum Städtischen Widerstand im Reich<br />
Karls V.<br />
Im Zentrum seiner Forschungen steht die<br />
Entstehung des Modernen Staates, aber auch<br />
die Beziehungen zu Lateinamerika und Nordafrika.<br />
Einer der Forschungsschwerpunkte in<br />
diesem Rahmen sind die UNESCO–Welterbezonen.<br />
In diesem Zusammenhang hat er<br />
im April 2019 als Vorsitzender der Stiftung<br />
Wissensraum Europa Mittelmeer zusammen<br />
mit dem Institut für Auslandbeziehungen<br />
in Stuttgart und dem RPM eine Tagung<br />
zum Thema „Pflege und Inwertsetzung des<br />
Architekturerbes der Kolonialzeit. Herausforderungen<br />
und Perspektiven in Tetuan<br />
(Marokko)“ organisiert.<br />
HERMANN<br />
ROEMER<br />
WILHELM<br />
PELIZAEUS<br />
Seit vielen Jahren ist Prof. Pelizaeus dem<br />
Roemer- und Pelizaeus-Museum eng verbunden<br />
und unterstützt sowohl das Museum<br />
im Aufsichtsrat der gGmbH als auch die Fördervereine.<br />
Der Vorstand des Freundeskreises<br />
und das RPM insgesamt sind glücklich,<br />
ihn als neuen Vorsitzenden gewonnen zu<br />
haben und freuen sich sehr auf die Zusammenarbeit<br />
mit ihm.<br />
17
Doppel-Jubiläum!<br />
Hildesheim und Minia feiern ihre langjährige<br />
Partnerschaft<br />
Die Stadt Hildesheim und das Roemerund<br />
Pelizaeus-Museum freuen sich in<br />
diesem Jahr über ein besonderes Jubiläum:<br />
Genau 40 Jahre ist es her, seit die Städtepartnerschaft<br />
mit der mittelägyptischen Stadt<br />
Minia und dem gleichnamigen Gouvernorat<br />
begründet wurde. Dieses Jubiläum wird mit<br />
einem intensivierten Austausch auf mehreren<br />
Ebenen begangen, zu dem auch gegenseitige<br />
Besuche gehören.<br />
Auf Einladung der Stadt besuchte aus diesem<br />
Grund eine ägyptische Delegation vom<br />
Helmut Brandl / Sven Kielau / Oliver Rösner<br />
15. bis 19. Juli 2019 Hildesheim. Angeführt<br />
wurde sie vom Gouverneur von Minia, S. E.<br />
General Qassem Mohamed Hussein Qassem<br />
und dem Präsidenten der Universität Minia,<br />
Prof. Mostafa Abd el-Naby Abd el-Rahman<br />
Ahmed. In ihrer Begleitung befanden sich<br />
Damen und Herren aus dem ägyptischen<br />
Entwicklungsministerium, Spezialisten der<br />
Universität Minia für Umweltschutz und<br />
kulturelle Bildung, Tourismusfachleute<br />
und die Leiterin der Medienabteilung des<br />
Gouvernorates Minia.<br />
Abb. 1: Unterzeichnung<br />
des Abkommens zur Fortsetzung<br />
der kommunalen<br />
Partnerschaft im Hildesheimer<br />
Rathaus. Links: Der<br />
Gouverneur von Minia,<br />
General Qassem Mohamed<br />
Hussein Qassem, rechts:<br />
Oberbürgermeister Dr.<br />
Ingo Meyer;<br />
© Foto: H. Brandl<br />
18
Die Koordination dieses Besuches lag<br />
auf der Seite der ägyptischen Gäste in den<br />
bewährten Händen von Prof. Hussein<br />
Mohamed Ali Ibrahim, einem Restaurierungs-<br />
und Denkmalpflegespezialisten der<br />
Universität Minia, der seit vielen Jahren mit<br />
dem Hildesheimer Museum und der Hochschule<br />
für Angewandte Wissenschaft und<br />
Kunst in Hildesheim (HAWK, Abteilung<br />
Bauen und Erhalten, Fachbereich Stein)<br />
zusammenarbeitet. Auf deutscher Seite war<br />
Oliver Rösner vom Fachbereich Büro des<br />
Oberbürgermeisters, Internationale Beziehungen<br />
und Fördermittelberatung, für den<br />
Ablauf verantwortlich.<br />
Zum Abschluss des erfolgreichen Besuches<br />
wurde ein Dokument unterzeichnet, das die<br />
Bedeutung der Beziehungen auf sozialem<br />
und kulturellem Gebiet unterstreicht uns<br />
ihre Fortsetzung in den kommenden Jahren<br />
umreißt (Abb. 1). Von nicht zu unterschätzender<br />
symbolischer Bedeutung war dazu<br />
die Benennung einer Hildesheimer Brücke<br />
unweit des Roemer- und Pelizaeus-Museums<br />
als „Minia-Brücke“, denn es ist das erste<br />
Mal, dass eine Hildesheimer Partnerstadt in<br />
dieser Weise geehrt wird (Abb. 2).<br />
Der Gegenbesuch einer Hildesheimer<br />
Delegation, angeführt von Oberbürgermeis-<br />
Abb. 2: Einweihung der „Minia-Brücke“ in Hildesheim. Vordere Reihe (von li. nach re.): Prof. Regine Schulz<br />
(Direktorin und Geschäftsführerin der Roemer- und Pelizaeus-Museum gGmbH), Dr. Tharwat Fathy el-Azhary<br />
(Leiter des Tourismus-Referates in Minia), Prof. Mostafa Abd el-Naby (Präsident der Universität Minia), Prof.<br />
Hussein Mohamed Ali (Koordinator des Ägyptisch-Deutschen Begegnungsprojektes), Prof. Mohamed Galal<br />
Hassan Shehata (Vize-Präsident der Universität Minia), General Qassem Mohamed Hussein Qassem (Gouverneur<br />
von Minia); © Foto: H. Brandl<br />
19
ter Dr. Ingo Meyer, ist für den November<br />
dieses Jahres vorgesehen. Eine Gruppe von<br />
etwa 20 interessierten Bürgerinnen und Bürgern<br />
wird sie voraussichtlich begleiten und<br />
dabei Gelegenheit haben nicht nur Land und<br />
Leute sondern auch die wichtigsten Kulturstätten<br />
in Minia und Umgebung kennenzulernen.<br />
(Es sind noch Plätze frei!). Diese<br />
Reise wird ohne Zweifel dazu beitragen die<br />
freundschaftlichen Bande zwischen beiden<br />
Städten noch enger zu flechten.<br />
Den wesentlichen Anstoß zu dieser beispielhaften<br />
kommunalen Partnerschaft gab<br />
der vormalige Direktor des Pelizaeus-Museums,<br />
Prof. Arne Eggebrecht, dessen Interesse<br />
an Minia vor allem von seiner Begeisterung<br />
für die Kunst und Kultur der Amarna-Periode<br />
getragen wurde. Bekanntlich liegt Tell<br />
el-Amarna, die Stadtruine von Achet-Aton,<br />
der kurzlebigen Residenzstadt des Echnaton<br />
und der Nofret-ete im Gouvernorat Minia.<br />
Hildesheims Beziehungen zu Minia sind<br />
heutzutage vielfältig. Aktuelle Themen,<br />
die unter Experten beider Städte diskutiert<br />
werden, umfassen Energie-Management und<br />
Abfallwirtschaft ebenso wie Tourismus und<br />
Abb. 3: Ankündigung eines Vortrages von Prof. G.<br />
Roeder über den Fortgang der ersten Hildesheimer<br />
Grabungen in Hermopolis, 1930.<br />
© Roemer- und Pelizaeus-Museum / Stadtarchiv<br />
Hildesheim<br />
Marketing. Am weitesten reichen jedoch die<br />
kulturellen Beziehungen zurück.<br />
Anlässlich des 40-Jahre-Jubiläums erinnert<br />
das Roemer- und Pelizaeus-Museum derzeit<br />
an den bereits 90 Jahre zurückliegenden<br />
Beginn der deutschen Ausgrabungen<br />
in El-Aschmunein, dem pharaonischen<br />
„Schmunu“, das von den alten Griechen<br />
Hermopolis (bzw. Hermoupolis) genannt<br />
wurde und das ebenfalls im Gouvernorat<br />
Minia liegt.<br />
Bereits zwischen 1903 und 1906 grub<br />
hier der Archäologe Otto Rubensohn nach<br />
Papyri der griechisch-römischen Periode;<br />
das war jedoch bevor er 1914 Gründungsdirektor<br />
des Pelizaeus-Museums wurde. Erst<br />
sein Nachfolger im Amt, Günther Roeder,<br />
konnte auf der Basis einer vertraglichen<br />
Vereinbarung mit der ägyptischen Antikenbehörde<br />
und mit finanzieller Unterstützung<br />
eines speziell zu diesem Zweck ins Leben<br />
gerufenen Fördervereins zwischen 1929 und<br />
1939 systematische Ausgrabungen durchführen<br />
(Abb. 3). In neuerer Zeit widmete<br />
sich eine Gruppe von Archäologen um die<br />
frühere RPM-Direktorin und derzeitigen<br />
Leiterin des Niedersächsischen Landesmuseums<br />
in Hannover, Dr. Katja Lembke, der<br />
Erforschung der hermopolitanischen Nekropole<br />
aus der römischen Kaiserzeit.<br />
Aktuell wird vom Roemer- und Pelizaeus-Museum<br />
(RPM) in Kooperation mit der<br />
Universität Minia (Faculty of Fine Arts) die<br />
Wiederaufnahme der Arbeiten in der antiken<br />
Stadt selbst betrieben (Projektleitung Prof.<br />
Regine Schulz und Prof. Hussein Mohamed<br />
Ali Ibrahim) – in enger Zusammenarbeit mit<br />
der Hochschule für Angewandte Wissenschaft<br />
und Kunst (HAWK) Hildesheim.<br />
20
Das Projekt trägt den Namen „Hermopolis<br />
Magna: Wiederaufnahme der archäologischen<br />
und restauratorischen Arbeit<br />
und Forschung in der Stadt des Thot<br />
– eine deutsch-ägyptische Kooperation“<br />
und soll 2020 beginnen. Ein Fokus wird<br />
unter der Leitung des Klassischen Archäologen<br />
Dr. Sven Kielau (RPM) auf dem in<br />
der Fachwelt zwar bekannten, aber nur<br />
ansatzweise erforschten Heiligtum aus der<br />
Zeit Ptolemaios III. und seiner Gemahlin<br />
Berenike II. liegen (spätes 3. Jh. v. Chr.). In<br />
diesem Heiligtum befanden sich Bauwerke<br />
klassisch griechischen Stils, in dorischer,<br />
ionischer und korinthischer Ordnung. Eine<br />
gut erhaltene griechische Giebelinschrift<br />
berichtet davon, dass es die vor Ort stationierten<br />
„Reiter“ waren, die „wegen der ihnen<br />
erwiesenen Wohltat“ das Heiligtum und<br />
seine Kultbilder dem König Ptolemaios und<br />
seiner Gemahlin weihten (Abb. 4). Hier will<br />
das RPM zudem mit Masterstudierenden des<br />
Fachbereichs Bauforschung der Ostbayerischen<br />
Technischen Hochschule Regensburg<br />
zusammenarbeiten (OTH, betreut von Prof.<br />
Ulrike Fauerbach), die vor Ort an der Bauaufnahme<br />
mitwirken sollen.<br />
Auch restauratorisch und konservatorisch<br />
sind in Hermopolis dringend Maßnahmen<br />
erforderlich. Das Antikengelände ist zwar<br />
nicht modern überbaut, aber bereits ergrabene<br />
Bauteile und Tempelmauern sind ungeschützt<br />
der Bodenfeuchtigkeit, Witterung<br />
und Versalzung ausgesetzt (Abb. 5). Besonders<br />
bedroht sind die zahlreichen Reliefblöcke<br />
aus den Aton-Tempeln von Achet-Aton/<br />
Tell el-Amarna, die bald nach dem Ende von<br />
Echnatons Regierung als Steinbruch genutzt<br />
wurden. In Hermopolis wurden Tausende<br />
dieser reliefgeschmückten Blöcke in Fundamenten<br />
wiederverwendet. Sie stellen einen<br />
extrem interessanten und bisher nur zum Teil<br />
gehobenen Schatz dar. Diesem Themenfeld<br />
wird sich der Amarna-Experte Dr. Christian<br />
Bayer (RPM) widmen, der ebenfalls an dem<br />
Projekt beteiligt ist. Gemeinsam mit der Universität<br />
Minia und der Hildesheimer HAWK<br />
wird auch die Abteilung Restaurierung des<br />
RPM vor Ort an den Dokumentations- und<br />
Schutzmaßnahmen mitwirken.<br />
Aus Anlass dieser beiden Jubiläen und der<br />
bedeutenden wissenschaftlichen Vorhaben<br />
wurde die große Wandvitrine im Foyer des<br />
Abb. 4: Giebelinschrift des<br />
Heiligtums für Ptolemaios III. in<br />
Hermopolis<br />
© Foto: H. Brandl<br />
21
Abb. 5: Ruine des Pylons und der sich anschließenden Hypostyl-Halle des Amun-Re-Tempels von Schmunu<br />
(Hermopolis) aus der Zeit Sethos‘ II., 19. Dynastie, um 1200 v. Chr.<br />
© Foto: H. Brandl<br />
Abb. 6: Aktuelle „Minia-Vitrine“ im Foyer des Roemer und Pelizaeus-Museums, Hildesheim (Detail)<br />
© Foto: D. Warnecke<br />
22
Roemer- und Pelizaeus-Museums neu eingerichtet.<br />
Die temporäre Installation, die noch<br />
bis Mitte Oktober 2019 zu sehen ist, stellt<br />
den Museumsbesuchern wichtige archäologische<br />
Stätten und Museen in Minia vor und<br />
gibt einen komprimierten Überblick über<br />
die dortigen archäologischen Aktivitäten des<br />
RPM im 20. Jahrhundert (Abb. 6).<br />
Im Zentrum steht dabei einer der frühen<br />
Funde G. Roeders aus El-Aschmunein, der<br />
im Rahmen der damals möglichen Fundteilung<br />
nach Hildesheim gelangte: Es handelt<br />
sich um ein Relieffragment, das aufgrund<br />
seines Formates und des bewegten Stils<br />
seiner Darstellung wohl zu einem amarnazeitlichen,<br />
sogenannten „Talatat“-Block (d.<br />
h. „Dreier“-Block, eine Handspanne hoch,<br />
drei Handspannen breit) gehört. Es fand<br />
sich verbaut in einer Tempelmauer der 19.<br />
Dynastie (Abb. 7). Der vorhandene Rest der<br />
Darstellung zeigt, gestaffelt auf Hockern mit<br />
gekreuzten Beinen sitzend, drei Figuren. Von<br />
der Gestalt ganz links sind zwar nur noch<br />
wenige Linien der Unterschenkel erhalten,<br />
doch genügt dies um eine dritte Person als<br />
gesichert anzusehen (Abb. 8). Dass es sich<br />
um männliche Figuren handelt, bezeugen<br />
Abb. 7: Mauer im südlichen Tempelbezirk<br />
von Schmunu / Hermopolis;<br />
der Pfeil zeigt die Fundlage des Blockes<br />
Hildesheim, Roemer- und Pelizaeus-Museum,<br />
PM 4573;<br />
© Roemer- und Pelizaeus-Museum<br />
Hildesheim<br />
Foto: G. Roeder (1930)<br />
Abb. 8: Sekundär verbauter Reliefblock,<br />
Sandstein, Amarna-Zeit, Mitte des 14.<br />
Jh. v. Chr., H. 21,7 cm, aus El-Aschmunein<br />
(Hermopolis), Hildesheim,<br />
Roemer- und Pelizaeus-Museum, PM<br />
4573;<br />
© Roemer- und Pelizaeus-Museum<br />
Hildesheim<br />
Foto: Sh. Shalchi<br />
23
neben den kurzen Schurzen vor allem die<br />
roten Farbreste im Bereich der Haut aller<br />
drei Personen. Bisher ist es nicht gelungen,<br />
den Kontext der Darstellung zu zweifelsfrei<br />
zu ermitteln. Aufgrund des Materials,<br />
Sandstein, ist eine ursprüngliche Herkunft<br />
des Reliefs aus einem südlicher als Amarna<br />
gelegenen Bauwerk zu vermuten. Möglicherweise<br />
handelt es sich dabei um ein Aton-Heiligtum<br />
in Theben (Karnak?). Die Größe der<br />
Figuren, ihre Sitzposition und nicht zuletzt<br />
ihre durch körperliche Berührung erkennbare,<br />
enge Verbindung lassen an männliche<br />
Personen aus dem Umfeld der königlichen<br />
Familie denken. Die Figur ganz rechts<br />
scheint wegen ihrer Proportionen und der<br />
unruhigen Körperhaltung ein Jugendlicher<br />
zu sein. Ein Name, der hier so manchem<br />
in den Sinn kommt, ist – Tutanchaton, der<br />
spätere Pharao Tutanchamun.<br />
Darüber hinaus werden in dieser Vitrine<br />
Archivalien, Fotos und eine Filmsequenz von<br />
den Grabungen aus dem Jahr 1930 gezeigt<br />
und zusammen mit Realien, kaiserzeitlichen<br />
Terrakotten, präsentiert. Bei einer davon<br />
handelt es sich um eine eigentümliche Lampe<br />
in Form des hockenden, Pavian- gestaltigen<br />
Gottes Thot mit Mondsichel und –scheibe<br />
auf dem Kopf. Augen, Schnauze, Pfoten<br />
und Fellstruktur des Tieres sind weitgehend<br />
deutlich angegeben, so dass es eindrücklich<br />
als Affe erkennbar ist (Abb. 9). Thot wurde<br />
schon im Neuen Reich nicht nur als Weisheitsgott<br />
verehrt, sondern auch als nächtlicher<br />
Lichtbringer, dessen Lebenskraft sich<br />
auf magische Weise zyklisch erneuert. Vielleicht<br />
wurde auch deshalb der hauptsächliche<br />
Verehrungsort des universalen Sonnengottes<br />
Aton unter Echnaton gegenüber der altehrwürdigen<br />
Stätte des Mondkultes errichtet.<br />
Aufgrund der bedeutenden Rolle, die das<br />
RPM nicht allein im Kulturleben der Stadt<br />
Hildesheim spielt, sondern weil es mit seiner<br />
international berühmten Ägypten-Sammlung,<br />
den ethnologischen und naturkundlichen<br />
Sammlungen und nicht zuletzt mit<br />
seinen Sonderausstellungen viele kulturbegeisterte<br />
Menschen aus dem In- und Ausland<br />
anzieht, ist zu erwarten, dass Hildesheims<br />
Bewerbung als Kulturhauptstadt des Jahres<br />
2025 auch von dieser Seite eine eindrucksvolle<br />
Unterstützung erfährt. – Durch Ihren<br />
Besuch unterstützen Sie uns auf diesem Weg.<br />
Wir freuen uns darauf!<br />
Abb. 9: Lampe: Gott Thot als Pavian mit „Mondkrone“,<br />
Terrakotta, römisch-kaiserzeitlich, H. 17 cm,<br />
Herkunft unbekannt (Hermopolis?), Hildesheim,<br />
Roemer- und Pelizaeus-Museum, PM 833; © Roemerund<br />
Pelizaeus-Museum Hildesheim<br />
© Foto: Sh. Shalchi<br />
24
Ein Ma’at-Impuls für Europa!<br />
In Europa wie auch in der Welt gewinnen<br />
diversifizierende Kräfte an Bedeutung. Es sind<br />
viele der sogenannten Populisten auf dem Plan.<br />
Thematisch geht es nicht mehr um das Öffnen<br />
von Grenzen und die Entwicklung gemeinsamer<br />
politischer und kultureller Räume sondern<br />
im Gegenteil um die Errichtung von Mauern<br />
und Zäunen zwischen Menschengruppen. Es<br />
werden Kriterien zur Unterscheidung und zur<br />
Heraustellung und Markierung der Differenzen<br />
der Kulturen und der Menschen gesucht, um<br />
über die kulturelle Identifizierung für jeden<br />
einzelnen Mensch eine politische Identität<br />
zu konstituieren, die wiederum bestimmten<br />
Staaten – oder besser einem bestimmten Staatsgebiet<br />
– zugeordnet wird. In Europa sind diese<br />
diversifizierenden Kräfte so weit zur Macht<br />
gelangt, dass trotz den Erfahrungen des zweiten<br />
Weltkriegs und trotz der jahrezehntelang friedenssichernden<br />
Funktion und Bedeutung der<br />
Europäischen Union mit aller Kraft („komme,<br />
was wolle” (so der aktuelle britische Premierrminister))<br />
ein Bre xit durchgesetzt werden soll.<br />
Bei Ma’at geht es nicht um das Diversifizierende<br />
und das Trennende sondern um eine nicht<br />
nur die menschliche „Gesellschaft” sondern die<br />
ganze „Welt” tragende Einheit. Unabhängig<br />
von den vielen Fragen, die in der Wissenschaft<br />
z. B. von J. Assmann oder von J. Dittmer – von<br />
letzterem auch unter dem Gesichtspunkt der<br />
Zusammenhänge zur griechischen Eunomia<br />
bzw. zum Logos – gestellt werden, kann mit<br />
Thomas Ritter<br />
H. Brümmer gesagt werden, „dass mit dem<br />
Konzept der Ma’at eine vergleichsweise sehr<br />
frühe Kultur auf höchster Abstraktionsstufe<br />
einen Begriff geprägt hat, der menschliches<br />
Handeln und kosmische Ordnung miteinander<br />
verknüpft, und damit Recht, Moral, Staat, Kult<br />
und religiöses Weltbild auf eine gemeinsame<br />
Grundlage stellt … Im Begriff der Ma’at liegt<br />
ungeschieden nebeneinander, was später in<br />
Staats-, Moral- und Naturphilosophie und<br />
Theologie auseinandertreten wird”.<br />
Im Blick auf die eingangs dargestellten<br />
Kräfte der Diversifizierung und der Gefahr der<br />
Schwächung und der Erosion der in Europa<br />
erreichten politischen und friedenssichernden<br />
Einheit wünsche ich mir einen „Ma’at-Impuls”<br />
für Europa. Nicht nur im politischen und<br />
kulturellen Bereich sollte es vorrangig wieder<br />
mehr darum gehen danach zu fragen, was<br />
uns in unseren Verschiedenheiten verbindet<br />
und wie aus dieser Einheit unter Bewahrung<br />
kultureller Unterschiede erreichte politische<br />
Einheiten wie die Europäische Union weiterentwickelt<br />
und gestärkt werden können. Einen<br />
solchen „Ma’at-Impuls” gibt und unterstützt<br />
seit Jahrzehnten das <strong>Magazin</strong>, indem<br />
es staatenübergreifend kulturelle Wurzeln und<br />
Zusammenhänge aufgrund eines entsprechenden<br />
Zusammenwirkens von Menschen<br />
darstellt. Dafür gebührt allen im Rahmen des<br />
Beteiligten, von den Initiatoren bis zu<br />
allen heute Aktiven ein besonderer Dank.<br />
25
V E R A N S T A L T U N G E N<br />
BERLIN<br />
Kunstwerk des Monats 2019<br />
Neues Museum<br />
Pädagogikraum im 3. OG<br />
Anschließend Führung am Objekt im Raum<br />
1.09 („Dreißig Jahrhunderte“)<br />
6. Oktober 2019 – 11:00 Uhr<br />
„Original und Fälschung“<br />
Drei Malereifragmente und<br />
ihre thebanische Vorlage<br />
Prof. Dr. Friederike Seyfried<br />
3. November 2019 – 11:00 Uhr<br />
„Haus und Hof“<br />
Altägyptische Lebenswelt im Modell<br />
Dr. Olivia Zorn<br />
1. Dezember 2019– 11:00 Uhr<br />
„Auszug aus einem Schulbuch“<br />
Ein kursivhieroglyphisches<br />
Ostrakon der Kemit<br />
Prof. Dr. Verena Lepper<br />
Vorträge<br />
Forschung im Museum II<br />
Brugsch-Pascha-Saal<br />
15. Oktober 2019– 19:00 Uhr<br />
Objekte lesen und verstehen.<br />
Zur Methodik der Aufarbeitung<br />
mykenischer Keramik aus Amarna<br />
Saskia Nehls, M.A.<br />
19. November 2019– 19:00 Uhr<br />
Herr Petepiphis – ein Ägypter<br />
mit Fremdsprachenkenntnissen<br />
in Elephantine<br />
PD Jan Moje & Dr. Ruth Duttenhöfer<br />
10. Dezember 2019– 19:00 Uhr<br />
Eine Königin auf Reisen – Erwerbungen<br />
und Ausstellungen ägyptischer<br />
Kunst im 19. Jahrhundert<br />
Mariana Jung, M.A.<br />
BONN<br />
Sonderausstellungen<br />
Noch bis zum 30. November 2019<br />
Di – Fr: 13:00 Uhr – 17:00 Uhr<br />
Sa + So: 13:00 Uhr – 18:00 Uhr<br />
Kaiserliche Pharaonen –<br />
Pharaonische Kaiser<br />
Die Herrschaft der römischen<br />
Principes zwischen Republik<br />
und ägyptischem Königtum<br />
(Siehe Beitrag in diesem Heft, ab Seite 9)<br />
Verlängert auf unbestimmte Zeit:<br />
Sinnüberschuss und Sinnreduktion<br />
von, durch und mit Objekten:<br />
Materialität von Kulturtechniken zur<br />
Bewältigung von Außergewöhnlichem<br />
Eine Arbeitsausstellung zum BMBF-<br />
Verbundprojekt „SiSi“<br />
Haben Sie auch einen Glücksbringer in Ihrer<br />
Tasche oder um den Hals hängen? Oder einen<br />
Kugelschreiber, ein T-Shirt oder einen anderen<br />
Gegenstand, der Ihnen Glück bringen soll?<br />
Wir alle besitzen solche mit Sinn aufgeladenen<br />
Gegenstände – ein quasi universelles<br />
Phänomen, das nun im Rahmen eines neuen<br />
Projekts in verschiedenen Zeiten und Kulturen<br />
untersucht werden soll: „Sinnüberschuss und<br />
Sinnreduktion von, durch und mit Objekten.<br />
Materialität von Kulturtechniken zur<br />
Bewältigung von Außergewöhnlichem“ (kurz:<br />
„SiSi“). Neben der Bonner Ägyptologie, die<br />
in den nächsten drei Jahren sicher spannende<br />
Ergebnisse rund um Amulette, Glücksbringer<br />
und böse Omen im Alten Ägypten zu<br />
berichten haben wird, sind in diesem<br />
fachübergreifenden Projekt noch die Bonner<br />
Altamerikanistik sowie die Medizinische<br />
Hochschule Brandenburg und die Heinrich-<br />
Heine-Universität Düsseldorf (‚Mad Studies’/<br />
Medizingeschichte) vertreten. Das Ägyptische<br />
Museum der Universität Bonn zeigt ab dem<br />
14.1.2019 eine erste kleine Arbeitsausstellung<br />
zum Thema.<br />
Trotz aktueller Baumaßnahmen im Ostflügel<br />
des Universitätshauptgebäudes bleibt<br />
das Museum bis auf weiteres geöffnet.<br />
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!<br />
26
Vorträge<br />
16. Oktober 2019 – 18:30 Uhr<br />
Aegypto capta:<br />
Wie Ägypten römisch und der<br />
Kaiser ein Pharao wurde<br />
Dr. Gunnar Sperveslage<br />
6. November 2019 – 18:30 Uhr<br />
„Von Pyramiden, Göttern<br />
und Hieroglyphen“<br />
Zu einigen Exlibris von Ägyptologen<br />
Dr. Kirsten Konrad<br />
11. Dezember 2019 – 18:30 Uhr<br />
Akhenaten’s seat of government:<br />
the Central City at Amarna<br />
Prof. em. Dr. Barry J. Kemp<br />
Dauerausstellung<br />
Drei Wege nach Ägypten<br />
Die Dauerausstellung ist in drei Bereiche<br />
gegliedert, die drei Wege beschreiben, das<br />
Alte Ägypten zu erkunden: Reichtum und<br />
Vielfalt der pharaonischen Kultur werden in<br />
Vitrinen zu den Themen Keramik, Werkzeuge,<br />
Leben und Luxus, Schrift, Pharao, Götter,<br />
Mythen und Tod sowie Kunst gezeigt, die<br />
gemeinsam ein Kulturhistorisches Panorama<br />
des Alten Ägypten entwerfen. In der<br />
Studiensammlung werden Amulette, Gefäße,<br />
Uschebtis und zahlreiche weitere Objekte<br />
nach Material, Form und Funktion geordnet<br />
präsentiert. Dadurch lassen sich Formen und<br />
Gattungen unterschiedlicher Herkunft aus<br />
verschiedenen Epochen vergleichen. In der<br />
Studiensammlung befinden sich auch die<br />
Grabausstattungsobjekte aus den Bonner<br />
Ausgrabungen auf der Qubbet el-Hawa<br />
bei Assuan. Das Kabinett des Sammelns<br />
schließlich stellt einzelne Kollektionen und<br />
ihre Sammler vor. Sie stehen beispielhaft<br />
für die Auseinandersetzung mit und<br />
Aneignung der pharaonischen Kultur im<br />
Heute. In der Dauerausstellung finden sich<br />
zudem in der neuen „Forschungsvitrine“<br />
Informationen zu Objekten, die Gegenstand<br />
von Abschlussarbeiten, von Aufsatzund<br />
Buchprojekten oder von laufenden<br />
Forschungsarbeiten sind.<br />
Sonderausstellung<br />
im Museum Koenig<br />
14. November 2019 bis 22. März 2020<br />
Objektwelten als Kosmos:<br />
Von Alexander von Humboldt<br />
zum Netzwerk Bonner<br />
Wissenschaftssammlungen<br />
Die Universität Bonn und das Zoologische<br />
Forschungsmuseum Alexander Koenig zeigen<br />
in einer Sonderausstellung, auf welche Weise<br />
universitäre Sammlungen, Museen sowie<br />
ihre Objekte und Wissenschaftsdisziplinen<br />
miteinander verwoben sind. Die Ausstellung<br />
spielt mit ihrem Titel auf „die ganze<br />
materielle Welt“ an, die nach Alexander von<br />
Humboldt keine Grenzen zwischen Geistesund<br />
Naturwissenschaften kennt und sich<br />
von daher in vernetzten Objektwelten als<br />
Kosmos widerspiegelt. Der Blick richtet sich<br />
damit auf die vielschichtigen Verbindungen<br />
zwischen mehr als 100 ausgewählten Objekten<br />
der Sammlungen und Museen und die<br />
einhergehenden, sich zeitlich verändernden<br />
Vorstellungen von Wissenschaft und<br />
Forschung.<br />
An der Ausstellung beteiligt sind auf Seiten<br />
der Universität Bonn das Ägyptische Museum,<br />
das Akademische Kunstmuseum, das BASA-<br />
Museum der Altamerikanistik und Ethnologie,<br />
das Goldfuß-Museum der Paläontologie,<br />
das Mineralogische Museum und die Vorund<br />
Frühgeschichtliche Studiensammlung<br />
sowie von Seiten des Museums Koenig das<br />
Biohistoricum. Die Ausstellung ist Teil des seit<br />
Dezember 2016 vom Bundesministerium für<br />
Bildung und Forschung (BMBF) geförderten<br />
Verbundprojektes und wird ebenfalls vom<br />
Landschaftsverband Rheinland (LVR) über<br />
sein Programm der Museumsförderung<br />
unterstützt.<br />
Die Sonderausstellung kann im Rahmen<br />
der normalen Öffnungszeiten des Museums<br />
Koenig auf der Museumsmeile Bonn<br />
(Adenauerallee 160) besichtigt werden. Zur<br />
Ausstellung erscheint ein Katalog, erhältlich im<br />
Museum. Weitere Informationen hierzu unter<br />
https://www.zfmk.de<br />
V E R A N S T A L T U N G E N<br />
27
V E R A N S T A L T U N G E N<br />
HANNOVER<br />
Stadtspaziergänge<br />
Exklusiv, nur für Mitglieder des Freundes- und<br />
Förderkreises „Antike & Gegenwart e. V.“<br />
Neben Exkursionen und anderen<br />
Unternehmungen erschließt der Freundesund<br />
Förderkreis „Antike & Gegenwart e. V.“ des<br />
Museum August Kestner die Sammlung des<br />
Hauses auch an anderen Orten, z.B. bei den<br />
Stadtspaziergängen. Werden Sie Mitglied, dann<br />
können auch Sie teilnehmen!<br />
18. Oktober 2019<br />
Kestnerschätze im Landesmuseum<br />
Führung durch die Gemäldegalerie und das<br />
Kupferstichkabinett mit<br />
Dr. Thomas Andratschke<br />
22. November 2019<br />
Musikalisches Erbe von Hermann<br />
Kestner in der Stadtbibliothek<br />
Vortrag mit Blick auf Noten und Hörgenuss<br />
Dr. Anne Viola Siebert<br />
Vorträge<br />
Öffentliche Vorträge des Freundes- und<br />
Förderkreises Antike & Gegenwart e. V.<br />
16. Oktober 2019 – 18:30 Uhr<br />
Zeitenwende 1400<br />
Hildesheim als europäische Metropole<br />
Prof. Dr. Claudia Höhl<br />
Für den 11.01.2020 ist eine Exkursion des<br />
Freundeskreises zu dieser Ausstellung geplant.<br />
Schulangebote<br />
„Kestner to go“<br />
22. Oktober 2019 – 30. März 2020<br />
Das Museum kommt in Ihre Schule<br />
Auch während unserer Schließzeit möchten wir<br />
Schüler*innen für das Alte Ägypten und Rom<br />
begeistern!<br />
Sie können bei uns 2 Angebote buchen<br />
(jeweils 90 Min.).<br />
„Frag den Ägyptologen“ oder<br />
„Frag die Archäologin“<br />
Kuratoren unserer ägyptischen, der römischen<br />
und griechischen Abteilung stellen sich den<br />
Fragen Ihrer Schüler*innen.<br />
Für mehrere Klassen oder eine Jahrgangsstufe<br />
(Aula oder ähnliche Räumlichkeit erforderlich)<br />
1,00 € pro Schüler*in (mindestens 80,00 €)<br />
„Altes Ägypten“ und „Antikes Rom“<br />
Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen des<br />
museumspädagogischen Teams gestalten eine<br />
Doppelstunde mit Beamer-Präsentation,<br />
Fragestunde und Gruppenarbeit. Auf spezielle<br />
Wünsche oder Erfordernisse Ihrer Lerngruppe<br />
gehen wir gerne ein!<br />
Für eine Klasse, 2,00 € pro Schüler*in<br />
Schüler*innen mit einem Hannover-Aktiv-<br />
Pass sind bei allen Angeboten von Gebühren<br />
befreit.<br />
Informationen zu<br />
„Das Museum kommt in Ihre Schule“:<br />
https://www.hannover.de/Museum-August-<br />
Kestner/ Bildung-Kommunikation/Schulen<br />
20. November 2019 – 18:30 Uhr<br />
Computergestützte Maßvergleiche<br />
an antiker Skulptur<br />
Prof. Dr. Martin Langner<br />
Mittwoch, 18.12.2019, 18.30 Uhr<br />
Die Voodoo-Religionen in<br />
Westafrika und in der Karibik<br />
Oliver Gauert, M.A.<br />
Achtung! Von Oktober 2019 bis einschließlich<br />
März 2020 ist das Museum<br />
wegen dringender Baumaßnahmen<br />
geschlossen.<br />
Die Vorträge finden deshalb im<br />
Historischen Museum Hannover statt!<br />
28
HILDESHEIM<br />
Vorträge<br />
14. Oktober 2019 – 18:30 Uhr<br />
Conrad Wilhelm Hase.<br />
Der Architekt als Kirchenrestaurator<br />
PD Dr. Christian Scholl<br />
Universität Hildesheim<br />
21.Oktober 2019 – 18:30 Uhr<br />
The Voodoo Religion in Haiti –<br />
Die Voodoo-Religion in Haiti<br />
Erol Josué – Direktor des Ethnologischen<br />
Museums in Port-au-Prince<br />
28. Oktober 2019 – 18:30 Uhr<br />
Das Tagebuch (1822–1833) von<br />
Hermann Adolf Lüntzel<br />
Dr. Helga Stein – Hildesheim<br />
4. November 2019 – 18:30 Uhr<br />
Edgar Walden – ein Berliner<br />
Ethnologe in Hildesheim<br />
Dr. Sabine Lang – RPM<br />
11. November 2019 – 18:30 Uhr<br />
Faszination Vogelflug – Eine<br />
spannende Bionik-Bildpräsentation<br />
Sven Achtermann – OVH Hildesheim<br />
18. November 2019 – 18:30 Uhr<br />
Die Geschichte des historischen<br />
Markplatzes in Hildesheim<br />
Dr. Stefan Bölke<br />
RPM und Stadtmuseum<br />
25. November 2019 – 18:30 Uhr<br />
Neuigkeiten aus dem Leiden-Turiner<br />
Grabungsprojekt in Saqqurra<br />
Lara Weiss – Universität Leiden<br />
13. Januar 2020 – 18:30 Uhr<br />
Im Land der lebenden Toten – Zombies<br />
und Zombifikation in Haiti<br />
Oliver Gauert – M.A. RPM<br />
20. Januar 2020 – 18:30 Uhr<br />
Günther Roeder – Die<br />
archäologischen Ausgrabungen des<br />
Museums um 1930 in Ägypten<br />
Dr. Christian Bayer – Dr. Sven Kielau –<br />
RPM<br />
27. Januar 2020 – 18:30 Uhr<br />
Jüdische Mitglieder im<br />
Hildesheimer Museumsverein<br />
Dr. Hartmut Häger –<br />
Museumsverein Hildesheim<br />
3. Februar 2020 – 18:30 Uhr<br />
Das Roemer-Museum – Sammlungen<br />
im Dornröschen Schlaf<br />
Antje Spiekermann – M.A. – RPM<br />
10. Februar 2020 – 18:30 Uhr<br />
Die Welt der einheimischen Insekten<br />
Burkhard Rasche – OVH Hildesheim<br />
17. Februar 2020 – 18:30 Uhr<br />
Taiwanesisches Schattentheater – ein<br />
Projekt der Kooperaration des Centers<br />
for World Music und des RPM<br />
Pei-Shan Wu – M.A.<br />
RPM und CWM Hildesheim<br />
2. März 2020 – 18:30 Uhr<br />
Benin und Haiti – Berichte über<br />
Forschungsreisen des RPM im<br />
Vorfeld der Voodoo-Ausstellung<br />
Oliver Gauert – M.A. und<br />
Kristin Kschuk – M.A.<br />
9. März 2020 – 18:30 Uhr<br />
Cosmos in Motion – The gods of the<br />
Yoruba-Religion in Westafrika,<br />
Irene Hübner – M.A. – Nijmegen<br />
16. März 2010 – 18:30 Uhr<br />
Johannes Leunis – Geistlicher und<br />
Lehrer – Botaniker und Museumsdirektor<br />
Benno Haunhorst – OStDr. i.R.<br />
Josephinum<br />
V E R A N S T A L T U N G E N<br />
29
V E R A N S T A L T U N G E N<br />
IPHOFEN<br />
Sonderausstellungen<br />
Noch bis zum 10. November 2019<br />
Di–Sa: 10:00 Uhr – 17:00 Uhr<br />
So: 11:00 Uhr – 17:00 Uhr<br />
Mo: geschlossen<br />
ELEFANT<br />
Graue Riesen in Natur und Kultur<br />
Der Elefant ist das gewaltigste und großartigste<br />
Landtier – und steht auf der Liste der<br />
bedrohten Tierarten. Seine Ahnenreihe<br />
reicht rund 7 Millionen Jahre zurück.<br />
Wissenschaftler sind bis heute fasziniert von<br />
seinen Fähigkeiten, sich große Wegenetze zu<br />
merken und zählen zu können. Trotz ihrer<br />
großen Kräfte sind Elefanten ihrem Wesen<br />
nach sanftmütige Geschöpfe, sie setzen ihre<br />
Stärke gegen andere Lebewesen nur bei Gefahr<br />
ein, missbrauchen sie aber nicht.<br />
Kabinettausstellung<br />
Noch bis zum 10. November 2019<br />
Klänge Alt Amerikas<br />
Musikinstrumente in Kunst und Kult<br />
Dauerausstellungen<br />
Die Reliefsammlung –<br />
Kultur lebendig erleben<br />
Das Kunstschaffen der alten Weltkulturen<br />
erleben - dazu wäre eine Reise zu den<br />
Stätten der antiken Weltkunst oder zu den<br />
Museen Europas und Amerikas nötig, denn<br />
keine Publikation kann den Eindruck des<br />
Kunstwerks in Originalgröße ersetzen, kein<br />
Bild die Griffigkeit einer Reliefwand oder<br />
Dreidimensionalität einer Statue vermitteln.<br />
Das Knauf-Museum bietet jedoch eine<br />
einmalige Alternative: Meisterwerke des alten<br />
Ägypten, Mesopotamiens, Persiens und des<br />
Hethiterreiches, weltberühmte Spitzenwerke<br />
griechischer und römischer Kunst, des<br />
alten Indien und der dem Europäer wenig<br />
bekannten Kulturen Altamerikas und der<br />
Osterinsel sind in den weitläufigen Räumen<br />
und dem großen Innenhof des historischen,<br />
ehemaligen Amtshauses in meisterlichen<br />
Abformungen ausgestellt.<br />
Weitere Infos unter: www.knauf-museum.de<br />
LEIPZIG<br />
Sonderausstellungen<br />
Noch bis zum 17. November 2019<br />
„Landschaft“ von Marion Wenzel<br />
Gezeigt werden Fotografien, die Landschaften<br />
in ihrem zeitlichen und räumlichen Wandel<br />
abbilden. Es handelt sich dabei einerseits<br />
um industrielle Tagebaulandschaften<br />
in Deutschland (Leipzig, Lausitz)<br />
und andererseits um den ägyptischen<br />
Tempelkomplex von Heliopolis in Matariya/<br />
Kairo, der seit 2012 von einem ägyptischdeutschen<br />
Grabungsteam unter der Leitung<br />
von Dr. Aiman Ashmawy und PD Dr. Dietrich<br />
Raue freigelegt wird.<br />
16. Januar 2020 – 3. Mai 2020<br />
„Heliopolis – Kulturzentrum<br />
unter Kairo“<br />
Die Ausstellung zeigt die Entwicklung des<br />
größten religiösen Zentrums Ägyptens sowie<br />
die Geschichte seiner Erforschung bis heute.<br />
Vorträge<br />
Campus Augustusplatz<br />
10. Oktober 2019 – 18:15 Uhr, Hörsaal 8<br />
Übersetzerische Stilblüten –<br />
Vom Grünen Leiden, Hebungen des<br />
Hustens und vom Bohren in der Nase<br />
Dr. Susanne Radestock<br />
17. Oktober 2019 – 18:15 Uhr, Hörsaal 8<br />
The Powers of Hell: The Pharaonic<br />
Landscape in Christian Magic<br />
Dr. Korshi Dosoo<br />
7. November 2019 – 18:15 Uhr, Hörsaal 8<br />
„Weiße Pharaonen“ - Ägyptologische<br />
Migrationstheorien im 20. Jahrhundert<br />
Dr. Susanne Voss<br />
5. Dezember 2019 – 18:15 Uhr, Hörsaal 8<br />
Von der Nacktschnecke zur Hornviper<br />
– Entwirrungen der Hieroglyphen<br />
Josephine Hensel M.A.<br />
30
19. Dezember 2019 – 18:15 Uhr, Hörsaal 8<br />
Kharga Oasis: An Edge of Empire<br />
Dr. Salima Ikram<br />
Führungen<br />
12. Oktober 2019 – 14:00 Uhr<br />
Ideal & Wirklichkeit – Ägypten, wie<br />
es sein soll und wie es wirklich war<br />
Dr. Marc Brose<br />
27. Oktober 2019 – 14:00 Uhr<br />
Wiedergänger, Dämonen &<br />
in Vergessenheit geraten –<br />
Angst im Alten Ägypten<br />
Klara Dietze M.A.<br />
9. November 2019 – 14:00 Uhr<br />
Führung durch die Dauerausstellung<br />
Celine Rose<br />
24. November 2019 – 14:00 Uhr<br />
Fest und Alltag im Alten Ägypten<br />
PD Dr. Dietrich Raue<br />
14. Dezember 2019 – 14:00 Uhr<br />
Führung durch die Dauerausstellung<br />
PD Dr. Dietrich Raue<br />
22. Dezember 2019 – 16:00 Uhr<br />
Taschenlampenführung für<br />
Kinder von 6 bis 13 Jahren<br />
Anna Grünberg M.A.<br />
Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl bitte mit<br />
vorheriger Anmeldung unter 0341-9737015<br />
Sonstige Veranstaltungen<br />
13. November 2019, ab 14:15 Uhr, Hörsaal 8<br />
9. Steindorff-Tag zu Ehren des 158.<br />
Geburtstages von Georg Steindorff<br />
Am Nachmittag finden Vorträge zu<br />
verschiedenen aktuellen Forschungen an<br />
Objekten des Leipziger Museums statt.<br />
Abendvortrag (18:15 Uhr): Himmlisch! Die<br />
Eisenobjekte aus dem Grab des Tutanchamun,<br />
Katja Broschat<br />
WIEN<br />
Sonderausstellungen<br />
Kunsthistorisches Museum Wien<br />
Noch bis zum 6. Oktober 2019<br />
Maurizio Cattelan<br />
In Fortsetzung unserer Reihe von<br />
Ausstellungen zeitgenössischer Kunst im<br />
Theseustempel zeigen wir heuer ein Werk des<br />
italienischen Künstlers Maurizio Cattelan.<br />
Noch bis zum 13. Oktober 2019<br />
Zuhanden Ihrer Majestät<br />
Medaillen Maria Theresias<br />
Das Münzkabinett des Kunsthistorischen<br />
Museums bewahrt sowohl in quantitativer<br />
als auch qualitativer Hinsicht die exquisiteste<br />
Sammlung an Medaillen Maria Theresias.<br />
Noch bis zum 20. Oktober 2019<br />
grey time – Bruchteile aus dem Museum<br />
Eine künstlerische Auseinandersetzung von<br />
Jeremias Altmann und Andreas Tanzer<br />
Mein König, die Welt ist nicht mehr.<br />
Zeugen der Vergangenheit und Trümmer<br />
unserer Zukunft.<br />
Ein verfrühtes Resümee, solange es noch<br />
Menschen gibt.<br />
Noch bis zum 20. Oktober 2019<br />
Jan van Eyck – „Als Ich Can“<br />
Die Kabinettausstellung zeigt drei von rund<br />
zwanzig erhaltenen Werken Jan van Eycks<br />
und bietet BesucherInnen einen Einblick<br />
in die Kunst zur Zeit Herzog Philipps des<br />
Guten, als die Burgundischen Niederlande im<br />
15. Jahrhundert eine einmalige Blütezeit der<br />
höfischen und städtischen Kultur erlebten.<br />
15. Oktober 2019 bis 19. Januar 2020<br />
Caravaggio & Bernini<br />
Die international angelegte Ausstellung<br />
präsentiert erstmals ein großes und<br />
überwältigendes, visuelles Barockspektakel im<br />
Kunsthistorischen Museum. Im Zentrum steht<br />
dabei das bahnbrechende Werk des Malers<br />
Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–<br />
1610) und des Bildhauers Gian Lorenzo<br />
Bernini (1<strong>59</strong>8–1680).<br />
V E R A N S T A L T U N G E N<br />
31
Ein Rum-Baron und seine Mumie<br />
Neukonzeption der Ägyptenausstellung im<br />
Bacardí-Museum Santiago de Cuba<br />
Im Jahr 1912 begab sich Don Emilio<br />
Bacardí-Moreau mit seiner Gattin Elvira<br />
Capé nach Ägypten, um im Land der Pharaonen<br />
eine Mumie und diverse altägyptische<br />
Objekte zu kaufen. Bacardí hatte die Rumfabrik<br />
seines Vaters geerbt und war in seiner<br />
Heimatstadt Santiago de Cuba zum Bürgermeister<br />
aufgestiegen. Nun, als Mittfünfziger,<br />
zog er sich aus den ihm übertragenen<br />
Ämtern zurück und reiste nach Kairo und<br />
Luxor. Die auf einem Markt in Luxor erworbenen<br />
Stücke sollten das von ihm geplante<br />
Dina Faltings / Anna-Maria Begerock<br />
Museum in Santiago de Cuba bereichern.<br />
Zunächst aber bereitete insbesondere der<br />
Erhalt aller erforderlichen Ausfuhrpapiere<br />
große Schwierigkeiten und finanziellen Aufwand,<br />
wie Bacardí umfangreich und recht<br />
humorvoll dem zukünftigen Museumsdirektor<br />
Bofill brieflich berichtete.<br />
Zahlreiche Stempel und Telegramme<br />
später konnten Mumie und Objekte über<br />
Hamburg und New York nach Santiago<br />
de Cuba, in die Heimatstadt Bacardís ver-<br />
Abb. 1: Das Museo Bacardí in Santiago de Cuba beherbergt in seiner untersten Etage ethnologische Schätze, die<br />
in unserem Seminar teilweise gehoben werden konnten, und die einzige ägyptische Mumie Kubas.<br />
© Foto: Anna-Maria Begerock<br />
32
schifft werden. Sie werden heute im Museo<br />
Provincial Don Emilio Bacardí-Moreau im<br />
Herzen Santiagos ausgestellt, und sogar im<br />
Lonely Planet ist die Mumie als must-see<br />
verzeichnet – sie ist eben die einzige ägyptische<br />
Mumie in ganz Kuba. Bacardí selbst<br />
hat die Eröffnung des (von ihm finanzierten)<br />
imposanten Baus nicht mehr erlebt.<br />
Das Museum beherbergt neben europäischer<br />
Malerei und Reliquien von Revolutionsführern<br />
einen ethnographischen Saal mit<br />
den von Bacardí gekauften Ägyptiaca sowie<br />
zahlreichen Objekten aus anderen Kulturen,<br />
die von Weltreisenden gestiftet worden sind,<br />
und zwar auf Bacardís Aufruf hin.<br />
In einem der letzten Jahrzehnte hat man<br />
das Museum aufwändig renoviert und sich<br />
dabei für eine minimalistische Präsentation<br />
entschieden. Ein Teil des Ethnographie-Saales<br />
erhielt weiße Wände und beherbergt den<br />
ägyptischen Fundus. Der andere Teil wurde<br />
hellgrün gestrichen und enthält die übrigen<br />
Ausstellungsstücke. Dieser gegenwärtige<br />
Zustand wird aber dem kulturhistorischen<br />
Wert der Objekte nicht gerecht. Die jeweilige<br />
Objektbeschreibung ist oft begrenzt auf<br />
ein Wort oder fehlt ganz. Die einleitenden<br />
großen Bilder zu den beiden Bereichen des<br />
Saales sind ebenfalls nur spärlich mit Text<br />
versehen. Auf Unterbereiche und kulturspezifische<br />
Thematiken wird ganz verzichtet.<br />
Zu einem Teil mag dies einer gewollten<br />
Konzeption entsprechen, zum anderen<br />
aber ist es wohl auch der prekären wirtschaftlichen<br />
und finanziellen Lage Kubas<br />
geschuldet, die sich seit den 1990er Jahren<br />
deutlich verschärft hat. Der Austausch mit<br />
ausländischen Wissenschaftlern ist auf ein<br />
Minimum begrenzt, was den Zufluss an<br />
Abb. 2: Der Blick in die derzeitige Ausstellungssituation zeigt den spärlichen Informationsgehalt, der dem Alten<br />
Ägypten mit all seinen Facetten und auch den von Bacardí gekauften Objekten nicht gerecht wird.<br />
© Foto: Anna-Maria Begerock<br />
33
Informationen, insbesondere Büchern und<br />
Wissen über neue Erkenntnisse zu alten<br />
Kulturen der Welt einschränkt. Ein großer<br />
Teil der vorhandenen Bücher ist auf Russisch<br />
abgefasst und spiegelt den Wissensstand der<br />
1970er Jahre wider. Russisch versteht jedoch<br />
kaum einer der kubanischen Wissenschaftler<br />
und Museologen aus der heute heranwachsenden<br />
Generation. Auch im Internet<br />
sind neue Erkenntnisse zu den ausgestellten<br />
Stücken kaum zu gewinnen. Es ist wegen<br />
des US-amerikanischen Embargos nicht<br />
umfänglich nutzbar, überdies ist es sehr langsam<br />
und enorm teuer. Hinzu kommt die<br />
Ungunst der geografisch-meteorologischen<br />
Bedingungen vor Ort. Im Jahr 2012 tobte<br />
der tropische Wirbelsturm Sandy über der<br />
Bucht von Santiago. Große Teile der Stadt<br />
wurden zerstört und auch die Museen Santiagos<br />
erlitten schweren Schaden, vor allem<br />
ihre Archive. Viele Archivalien und damit<br />
Informationen zu den einzelnen Ausstellungsstücken<br />
sind seither unwiederbringlich<br />
verloren.<br />
Für das Museum Bacardí schien die Lage<br />
damals hoffnungslos. Aber aufgrund des<br />
international gestiegenen Interesses an der<br />
Erforschung von Mumien in musealen<br />
Sammlungen entstand 2015 eine kubanisch-spanische<br />
Kooperation zur Erforschung<br />
der in Kuba befindlichen Mumien.<br />
2017 wurden die Mumien im Ethnographie-Saal<br />
des Bacardí-Museums in Santiago<br />
de Cuba von der Forschergemeinschaft des<br />
Instituto des Estudios Científicos en Momias<br />
(IECIM) in Spanien untersucht. Bei dieser<br />
Gelegenheit baten die kubanischen Museumsleute<br />
auch um Hilfe bei der Bestimmung<br />
der weiteren Objekte und bei der Konzipierung<br />
einer moderneren, dem aktuellen Stand<br />
angepassten Ausstellung.<br />
So wurde im Herbst 2017 in einem<br />
Gespräch zwischen den Autorinnen dieses<br />
Berichts die Idee geboren, gemeinsam die<br />
Ägyptenabteilung neu zu konzipieren und<br />
umzugestalten. Da das Heidelberg Center<br />
for Cultural Heritage (HCCH) u.a. zum<br />
Ziel hat, die museale Präsentation von kulturellem<br />
Erbe zu verbessern und die diesbezüglichen<br />
Fähigkeiten auch Studierenden<br />
zu vermitteln, kamen wir überein, das im<br />
Rahmen eines dort angesiedelten Seminars<br />
zu tun. Studierende der Ägyptologie und<br />
verwandter Fächer sollten lernen, ihr Wissen<br />
für ein Museumspublikum interessant aufzubereiten.<br />
Dabei gingen wir schrittweise vor. Die vorhandenen<br />
Objekte wurden vorbestimmt in<br />
Bezug auf Alter, Echtheit und einstige Funktion.<br />
Die Studenten bekamen die Aufgabe,<br />
Ausstellungsthemen zu entwickeln, Unterthemen<br />
zu formulieren und die Objekte<br />
darin zu verorten. Darüber hinaus sollten die<br />
Texte auf Englisch konzipiert werden, damit<br />
die Ausstellung zukünftig zweisprachig (Englisch<br />
und Spanisch) präsentiert werden kann.<br />
Vor allem die finanziellen Einschränkungen<br />
in Kuba erschienen uns Dozentinnen als<br />
eine besondere, aber doch sehr praxisnahe<br />
Herausforderung - auch deutsche Museen<br />
sind oft genug von Geldknappheit betroffen,<br />
sodass die vorhandenen Vitrinen ausreichen<br />
müssen, weil unter solchen Zwängen<br />
keine neuen gebaut werden können.<br />
Außerdem entfallen teure Installationen. In<br />
Kuba kommt erschwerend der Mangel an<br />
Druckereien und Druckmaterialien hinzu,<br />
sodass alle Träger, Raumteiler etc. zur Not in<br />
Europa zu drucken und leicht transportierbar<br />
sein müssen, damit sie als Fluggepäck<br />
nach Kuba gebracht werden können. Dem<br />
34
abgewandelten Ausspruch „Wir sind arm,<br />
aber kreativ” folgend, gestaltete sich das in<br />
Blockveranstaltungen durchgeführte Seminar<br />
am HCCH überraschend erfolgreich.<br />
Hier einige Auszüge aus dem Seminar-Tagebuch:<br />
Block-Tag 1 (20.10.018):<br />
Besuch der Ägypten-Ausstellung in den<br />
Reiss-Engelhorn-Museen in der Nachbarstadt<br />
Mannheim. Anhand eines vorher<br />
gemeinsam erarbeiteten Fragebogens sollen<br />
die Studierenden Denkanstöße bekommen<br />
und auf Konzeption, Design, Ausdrucksmöglichkeiten,<br />
Präsentationsebenen sowie<br />
die damit verbundenen Chancen der Informationsübertragung<br />
achten.<br />
Triumph, Triumph! Sie bleiben bereits im<br />
Vorraum stehen und diskutieren schon dort<br />
ca. 40 Minuten lang über Farben, Grafik,<br />
Licht und Schriften! So war es zwar nicht<br />
gemeint und erwartet, aber schon das ist ein<br />
voller Erfolg. Der Gang durch den Rest des<br />
Museums muss immer wieder mal „angeschubst“<br />
werden, weil die Diskussionen sehr<br />
hohe Wellen schlagen und nicht enden wollen.<br />
Es scheint großen Spaß zu bringen und<br />
über den Umweg der Fragen viele Erkenntnisse<br />
zum Thema Museumsdesign zu bewirken.<br />
We are delighted.<br />
Nach der Mittagspause geht es in die<br />
Ausstellung „Musikwelten“ – in ein völlig<br />
anderes Ausstellungskonzept, ganz ohne<br />
Einleitung oder Hinführung zum Thema<br />
und ausschließlich als Audio-Führung angeboten<br />
- was zumindest bei einigen von uns<br />
helle Begeisterung auslöst. Hausaufgabe ist,<br />
eine vergleichende Bewertung dieser beiden<br />
Konzepte zu erstellen, die beim nächsten<br />
Mal (in einer Woche) diskutiert werden soll.<br />
Block-Tag 2 (27.10.2018):<br />
Oha, verpennt! Das fängt ja gut an! Schnell<br />
frühstücken und los. Die Studis stehen<br />
schon unten vor der Glastür zu den Seminarräumen,<br />
die samstags natürlich zu ist.<br />
Immerhin sind wir genau pünktlich! Anfangs<br />
werden die Museumseindrücke von letzter<br />
Woche besprochen und verglichen. Heute<br />
soll es zunächst um die Themen Konzeption<br />
(innerer Zusammenhang, Szenografie, Vitrinenaufbau),<br />
Raumgestaltung (Raumfarben,<br />
Besucherführung, Leitsysteme) und Textgestaltung<br />
(Schriften, Textinhalt, Grafiken)<br />
gehen, später noch um Besonderheiten, wie<br />
die Einbeziehung von Minderheiten (Kindund<br />
Behindertengerechtigkeit). Es geht<br />
heiß her, u.a. auch beim Thema Ethik, und<br />
wir müssen irgendwann leider abbrechen.<br />
Anschließend bekommen die Studis noch<br />
etwas Input von uns zu diesen Themen, mit<br />
Bildbeispielen aus anderen Museen.<br />
Unser Hauptziel in Santiago soll sein:<br />
Interesse wecken und dadurch „nebenbei“<br />
Information vermitteln. Dann geht es nach<br />
kurzer Pause an die Stücke selbst:<br />
Zuerst werden die in Santiago de Cuba<br />
vorhandenen Objekte einmal „durchgekaut“<br />
– Jedes Stück wird bildlich vorgestellt und<br />
diskutiert - was es ist, ob es echt ist und ob<br />
man es aus konservatorischen oder ethischen<br />
Gründen überhaupt ausstellen kann. So vergehen<br />
die Stunden wie im Flug. Nach der<br />
Kaffeepause: Auftritt Marc Schumacher, seines<br />
Zeichens langjährig museumserfahrener<br />
Grafiker. Er erklärt uns, welche Druckmaterialien<br />
sich wofür am besten eignen, wie teuer<br />
35
und stabil oder auch wie leicht im Koffer sie<br />
über den Ozean zu transportieren sind und<br />
geht dann vor allem auf die Textgestaltung<br />
ein: semantische Optimierung, Anschläge<br />
pro Zeile, Textgröße, Fonts, Farben usw. Wir<br />
nehmen alle viel Neues mit.<br />
Am Schluss: Vorstellung der Gegebenheiten,<br />
Räumlichkeiten und Vitrinen vor<br />
Ort sowie Aufteilung der Objekte zwecks<br />
Recherche entsprechend der vorhandenen<br />
Interessen. Wir haben einen L-förmigen<br />
Raum, 5 kleine ca. würfelförmige Vitrinen<br />
und 2 große, in denen die Mumie und der<br />
Kartonagesarg liegen müssen. Eine weitere,<br />
hängende ist fest an der Wand installiert.<br />
Es bilden sich ganz ohne unser Zutun<br />
anhand der Stücke 4 Themengruppen heraus:<br />
1. Einleitung (Ägypten – Nil, Land und<br />
Leute, Bacardí als Reisender und Sammler,<br />
auf dem Basar), 2. Tägliches Leben (Soziale<br />
Struktur, Lebensbedingungen, Berufe und<br />
Einzelthemen wie Kosmetik, Magie und<br />
Medizin etc.), 3. Religion (Götter, Tempel,<br />
Tierkult) sowie 4. Bestattung und Jenseits<br />
(Mumie, Sarg, Grabausstattung).<br />
Die Arbeit kann losgehen. Hausaufgabe ist<br />
eine erste Recherche zu den übernommenen<br />
Objekten und (als Übung gedacht:) ein erster,<br />
beispielhafter, übergreifender Text zum<br />
Themenbereich Totenkult sowie Bildrecherche<br />
nach gemeinfreien Abbildungen dazu,<br />
die wir benutzen könnten.<br />
4 Wochen später, Block-Tag 3<br />
(24.11.2018):<br />
Termin im IWR (Institut für Wissenschaft-<br />
Abb. 3: Die Seminargruppe diskutiert angeregt und manche Idee ruft Erstaunen hervor. © Foto: Dina Faltings<br />
36
liches Rechnen in Heidelberg) bei Hubert<br />
Mara, der schon mehrfach mit der Sammlung<br />
und dem Ägyptologischen Institut<br />
kooperiert hat und unseren Studierenden<br />
auch schon im Rahmen eines anderen Seminares<br />
das Scannen mit dem 3-D-Scanner<br />
beigebracht hat.<br />
Wir wollen zwecks Ergänzung der teilweise<br />
schwach besetzten Themen (Bacardí<br />
war schließlich kein Ägyptologe) Objekte aus<br />
der Heidelberger Sammlung in 3-D scannen,<br />
um diese evtl. als Kunststoff-Ausdrucke auf<br />
Kuba auszustellen – als hands-on-Objekte.<br />
Noch haben wir Hoffnung auf die Bewilligung<br />
unseres Vorhabens als VW-Teilprojekt.<br />
Das würde 3-D-Ausdrucke finanziell möglich<br />
machen und auch so einiges Andere,<br />
das schön zu haben wäre. Das 3-D-Scannen<br />
wird uns in 2 Gruppen in Theorie und Praxis<br />
beigebracht (sehr interessant und alles kein<br />
Hexenwerk!).<br />
Nach der Mittagspause, die im beneidenswert<br />
schick und teuer eingerichteten<br />
Pausenraum der hier angestellten Mathematiker<br />
verbracht wird: Geplant ist eine erste<br />
Vorstellung und Diskussion der Hausaufgaben<br />
sowie die Verteilung der Bereiche in<br />
dem (leider knapp bemessenen) Raum des<br />
Museums Don Emilio Bacardí-Moreau in<br />
Santiago de Cuba (kleiner als der Pausenraum<br />
der Mathematiker im IWR!).<br />
Leider hat kein einziger die Hausaufgabe<br />
gemacht, so dass man an keinem Beispiel die<br />
Abb. 4: Die Objekte müssen während des 3D-Scans immer wieder gedreht werden, sodass der Scanner sie von<br />
allen Seiten erfassen kann. Am Bildschirm werden die Scans und mögliche Fehlstellen überprüft.<br />
© Fotos: Dina Faltings<br />
37
Praxis der Texte üben bzw. demonstrieren<br />
kann. Das Semester läuft auf Hochtouren<br />
und jede/r hat eine andere „Ausrede“ parat.<br />
Dann muss es eben ohne Übung gehen und<br />
alle eben gleich ins kalte Wasser springen.<br />
Mit Fehlerbesprechung und Korrekturen ist<br />
sowas eigentlich leichter – naja.<br />
Nach einer kleinen Kaffeepause gehen wir<br />
in die letzte Runde – die Raumverteilung.<br />
Interessant! Man sieht, wer Teamplayer<br />
ist und wer die Ellenbogen ausfährt. Stille<br />
Wasser sind tief und sogar die eher Ruhigen<br />
lassen sich mit dem Funken der Begeisterung<br />
anstecken…<br />
Das Raumdesign und damit der Parcours<br />
durch die Ausstellung werden – in den eng<br />
gesteckten finanziellen und räumlichen<br />
Grenzen – festgelegt. Auch dieses ergibt sich<br />
mehr oder weniger von selbst, denn die Einleitung<br />
muss an den Eingang. An die Gegebenheiten<br />
wie Nil und Jahreszeiten schließt<br />
sich das Tägliche Leben fast schon von allein<br />
an, danach gibt es noch ein wenig Gerangel<br />
um die größere Fläche bei der Entscheidung,<br />
wer dann kommt – die Religion mit Tempeln<br />
und Göttern oder das Thema Grab und Jenseits.<br />
Die Größe der Vitrinen für Mumie und<br />
Sarg sowie die unverrückbare, an der Wand<br />
hängende Vitrine geben den Ausschlag, denn<br />
sie müssen dort bleiben, wo sie schon jetzt<br />
Abb. 5: Detailbesprechungen am<br />
Grundrissplan.<br />
© Fotos: Dina Faltings<br />
38
stehen bzw. hängen. Es folgt also im hinteren<br />
Teil des Langraumes die Religion mit dem<br />
Thema Tempel, Götter und Tierkulte und<br />
dann am Ende das Thema Jenseits.<br />
Erschöpft machen wir mit ca. 1 Stunde<br />
Überziehung Schluss und geben jeder<br />
Gruppe schon mal als Hausaufgabe die<br />
Bereichstexte auf.<br />
Block-Tag 4 (01.12.2018):<br />
Als erstes wird am Morgen ein korrekter<br />
Raumplan im Maßstab 1:20 gezeichnet und<br />
an die Tafel gehängt, danach in verschiedenen<br />
Farben die Planungen der einzelnen<br />
Gruppen in Form von beschrifteten Kärtchen<br />
an den Plan geheftet, vorgestellt und<br />
mit allen diskutiert, ob das ausstellungstechnisch<br />
gut oder schlecht ist, was das erwartete<br />
Ziel ist und ob das Ergebnis dann so auch zu<br />
erreichen ist. Es kommen gute und sehr gute<br />
Vorschläge – wir müssen sehen, wie wir diese<br />
Idealvorstellungen dann realisieren.<br />
Mittagspause - und wir beginnen mit der<br />
Besprechung der unter der Woche erstellten<br />
Bereichs-Texte. Die Gruppen stellen ihre<br />
Ergebnisse vor, indem sie ihre Texte vorlesen.<br />
Sie sind noch eher mittelprächtig, aber es ist<br />
ja noch kein Meister vom Himmel gefallen<br />
und Übung macht den nun mal. Wir einigen<br />
uns darauf, zumindest hier und da etwas<br />
Lustiges einzuflechten, um die Besucher<br />
vom Einschlafen abzuhalten. Z.B. soll der<br />
erste, faktenträchtige Textentwurf zu dem<br />
Götterpaar Isis und Osiris, der sich extrem<br />
trocken liest, in eine Gelbe-Seiten-Anzeige<br />
umgeschrieben werden. Später bekommt<br />
sogar jeder erwähnte Gott eine humorvolle<br />
Gelbe-Seiten-Anzeige.<br />
Hier die beiden Textentwürfe: links die erste, noch deutsche Version, rechts die neue,<br />
Gelbe-Seiten-Version:<br />
Osiris:<br />
Wichtige Kultorte: Heliopolis, Athribis,<br />
Abydos, Busiris,<br />
Hauptverehrungszeit: Neues Reich<br />
Ein Fruchtbarkeitsgott, dem Mythos nach<br />
von seinem eifersüchtigen Bruder Seth<br />
ermordet, zerstückelt und über das ganze<br />
Land verteilt, von seiner Gemahlin Isis<br />
und deren Schwester Nephtys aufgesammelt,<br />
zusammengesetzt und wiederbelebt<br />
und daraufhin zum König der Unterwelt<br />
gemacht. Es war auch üblich, den verstorbenen<br />
König mit Osiris gleichzusetzen.<br />
Außerdem wurde er als Gegenstück des Re<br />
in der Unterwelt gesehen.<br />
Osiris:<br />
You think you’ve got problems?<br />
I was killed by my brother Seth, dismembered<br />
and thrown all over Egypt.<br />
Then my wife Isis and her sister Nephtys<br />
brought me back to life and after that I was<br />
made king of the underworld and incarnation<br />
of deceased rulers.<br />
I’ve been judging billions of men for ages<br />
and ages.<br />
So if you ever need an experienced lawyer,<br />
I’m your man.<br />
Call me when you’re lost in the mazes of<br />
the netherworld.<br />
39
Isis:<br />
Wichtige Kultorte: Dendera, Behbeit<br />
el-Hagar,Philae, Deir el-Shelwit<br />
Hauptverehrungszeit: Spätere Perioden<br />
Obwohl Isis lange Zeit kein spezifischer,<br />
eigener Kultort geweiht war, wurde sie<br />
später zu einer der wichtigsten ägyptischen<br />
Gottheiten überhaupt. Zu ihren zahlreichen<br />
Teilaspekten gehörten vor allem die<br />
Zauberei, für die sie noch heute bekannt<br />
ist, aber auch als Schwester des Osiris und<br />
Mutter des Horus erlangte sie Bekanntheit.<br />
Diese Verwandtschaften machten<br />
sie außerdem symbolisch zur Mutter des<br />
Königs. Die enge Verbindung zu ihrem<br />
Gatten Osiris ließ sie bald auch als Beschützerin<br />
der Verstorbenen eine wichtige<br />
Rolle in den Jenseitsvorstellungen der<br />
Menschen spielen.<br />
Isis:<br />
Abracadabra! I´m the sorceress of your<br />
choice!<br />
As mother of Horus people worship me as<br />
the mother of all kings.<br />
If you ever find yourself in a situation and<br />
don´t know what to do, maybe a little magic<br />
can help save the day (or your dismembered<br />
husband).<br />
Abb. 6: Im Maßstab 1:1 wird der Aufbau innerhalb der Vitrinen simuliert. Was ist optisch interessant? – keine<br />
leichte Aufgabe. © Foto: Dina Faltings<br />
40
Die Gruppen stellen auch nach der Mittagspause<br />
zunächst weiterhin ihre Ergebnisse<br />
vor. Parallel dazu läuft übers Internet die Bildrecherche.<br />
Auch hier gilt wieder zu bedenken:<br />
wir sind in Kuba und haben kein Geld. Sind<br />
die Bilder gemeinfrei und dort nutzbar? Im<br />
letzten Block nach der Kaffeepause: konzentrierte<br />
Gruppenarbeit an den Texten.<br />
Etwas Input zum Thema Didaktik in<br />
Museen wie z. B. Sonderführungen, Sonderausstellungen,<br />
Einsatz von Filmen und Interaktivität<br />
rundet am Ende das Bild noch ab.<br />
Block 5, letzter Termin (15.12.2018):<br />
Endspurt! In der ersten Stunde werden die<br />
bisher gelieferten, teilweise auch schon die<br />
neu geänderten Texte vorgelesen. Vortrag<br />
Gelbe Seiten der Götterwelt: Wir sind highly<br />
amused! Die 2. Textvariante ist so lustig, dass<br />
man immer mehr hören will.<br />
Die Fakten zum Tätigkeitsbereich des<br />
Gottes XYZ kommen genauso gut rüber,<br />
sind aber so verpackt, dass man auch noch<br />
den nächsten und den nächsten Gott kennenlernen<br />
möchte. Wir beömmeln uns alle<br />
über die Reklametexte und von allen Seiten<br />
hagelt es weitere Vorschläge für Gelbe-(Götter-)<br />
Seiten.<br />
Am Nachmittag herrscht bei hochkonzentrierter<br />
Gruppenarbeit eine gute und<br />
ruhige Arbeitsatmosphäre: Die Vitrinen<br />
werden in 1:1 mit selbstgebastelten Dummies<br />
aus Pappe bestückt, um die Wirkung<br />
der Objekte und ihrer Platzierung innerhalb<br />
der Vitrinen vorab ausprobieren und begutachten<br />
zu können. Wir müssen die Zweisprachigkeit<br />
bedenken und entscheiden uns<br />
für jeweils einen Textblock in Spanisch links<br />
und einen auf Englisch rechts. Das verringert<br />
den möglichen zu schreibenden Objekt-Text<br />
und macht die Vitrinen extrem voll. Erste<br />
Objekttexte werden fertig und gleich parallel<br />
zur Gruppenarbeit in den einzelnen Gruppen<br />
von uns begutachtet und diskutiert.<br />
Nach der Kaffeepause: Überlegungen<br />
dafür, wie wir Kindern die Informationen<br />
spielerisch verpackt übermitteln können,<br />
führen zu verschiedenen Auswahlmöglichkeiten.<br />
Unser Heidelberger Anubis aus Holz,<br />
der in 3-D gescannt wurde, wird zu unserem<br />
Maskottchen erkoren, der den Kindern am<br />
Sockel jeder Vitrine lustige Fragen stellen<br />
und fun facts vermitteln soll. Das Spielerische<br />
kommt uns ansonsten zu kurz, aber wir<br />
müssen es leider dem Platzmangel und der<br />
Tatsache, dass es in Kuba nichts gibt und<br />
alles Lose bald weg wäre, opfern. Immerhin<br />
kriegen wir noch eine Pappfigur mit<br />
Gesichtsausschnitten unter, wo man sich zu<br />
dritt als Mykerinostriade fotografieren lassen<br />
kann.<br />
Anhand der gebastelten 1:1-Vitrinen wird<br />
den jeweils anderen Gruppen am Schluss das<br />
eigene Ergebnis vorgestellt.<br />
Am Schluss sind wir noch nicht ganz<br />
durch, manche Gruppe hat noch nicht<br />
alle Objekttexte und gewünschten Bilder<br />
geliefert, verspricht aber, bis zum Ende des<br />
Semesters alles zu schicken. So gehen wir mit<br />
einem Gefühl, etwas geschafft zu haben, auseinander.<br />
Leider kommt einige Wochen später die<br />
Nachricht von VW, dass das Projekt, zu dem<br />
wir gehörten, abgelehnt wurde. Nun müssen<br />
wir andere Wege finden, unsere guten Ideen<br />
in die Wirklichkeit umzusetzen….<br />
41
Arbeiter – Künstler – Pharaonen<br />
Die 12. Tage der Ägyptologie im<br />
koptischen Kloster Brenkhausen<br />
Die diesjährigen Tage der Ägyptologie<br />
standen unter dem Motto „Arbeiter –<br />
Künstler – Pharaonen“. Bereits zum 12. Mal<br />
fand die Tagung im koptischen Kloster statt,<br />
zu der wieder Ägyptologen, Studierende und<br />
Ägyptenfreunde aus ganz Deutschland und<br />
der Schweiz angereist waren. Zwei Monate<br />
vor der diesjährigen Veranstaltung zeichnete<br />
sich bereits ein neuer Besucherrekord<br />
ab. Nun ist das Kloster Brenkhausen alles<br />
andere als klein, doch der größere der beiden<br />
Tagungsräume im koptischen Südflügel<br />
bietet nur Platz für maximal 100 Besucher,<br />
bisher war das ausreichend, doch in diesem<br />
Jahr sollten es 140 Besucher werden. Im Vorfeld<br />
der Tagung begann deshalb die Suche<br />
nach einem neuen Veranstaltungsraum. Die<br />
Daniela Rutica<br />
Lösung kam schließlich von der katholischen<br />
Gemeinde St. Johannes Baptist, die ihren<br />
großen Saal im Pfarrheim, im gotischen<br />
Ostflügel des Klosters, zur Verfügung stellte.<br />
Bei der ersten Besichtigung des Raumes entstand<br />
dann sofort die Idee, Ausstellerbereich,<br />
Bühne und Vortragsraum zu kombinieren<br />
und den Saal passend zum diesjährigen<br />
Thema zu dekorieren. Die Umsetzung übernahmen<br />
Daniela Rutica M.A. (Ägyptologin<br />
und Künstlerin, koptisches Kloster Brenkhausen)<br />
und Angela Kaiser (Dipl. Designerin,<br />
Himmelsmalerin und Kulissenbauerin)<br />
aus Potsdam. Beide Künstlerinnen arbeiten<br />
gemeinsam an zahlreichen Malereiprojekten<br />
rund um das koptische Kloster und stellten<br />
für die Dekoration des Raumes Arbeiten aus<br />
Abb. 1: Gruppenfoto mit Bischof Damian vor dem koptischen Kloster, © Foto: Maxime Armgardt<br />
42
Abb. 2: Angela Kaiser bei der Aufhängung der geflügelten<br />
Sonnenscheibe, © Foto: Daniela Rutica<br />
ihrem Fundus zur Verfügung. Tatkräftig<br />
unterstützt wurden die beiden von Maxime<br />
Armgardt, die gerade ein Freiwilliges Soziales<br />
Jahr im Kloster bzw. in der koptischen Akademie<br />
in Bad Grund absolviert. Die Anbringung<br />
der Bühnenbilder erforderte einiges an<br />
Vorbereitung: Allein um die 9 m lange und<br />
1,5 m hohe geflügelte Sonnenscheibe über<br />
dem Bühnenvorhang anzubringen, musste<br />
mit Hilfe eines Rollgerüstes in 4 m Höhe eine<br />
eigens dafür entworfene Lattenkonstruktion<br />
montiert werden. Hinter dem Vorhang entstand<br />
eine Theaterbühne, die als Kulisse für<br />
das künstlerische Rahmenprogramm der<br />
Gruppe Ebers‘ Erben aus Leipzig dienen<br />
sollte. Tatkräftige Unterstützung erhielt das<br />
Aufbauteam von den freiwilligen Tagungshelfern,<br />
die extra deshalb schon am Donnerstag<br />
angereist waren. Auch ein Basarbereich rund<br />
ums Alte Ägypten wurde vorbereitet. Mit<br />
dabei waren in diesem Jahr: Carina Felske<br />
(Selket-Shop), Begga Rolfsmeyer (Ägyptenreisen<br />
mit Begga-Tours), Silvia Kreye (Buchkunst-Werkstatt),<br />
Orell Witthuhn M.A. mit<br />
dem Büchertisch der göttinger Ägyptologie<br />
und Ausstellungs-Stände der Künstlerinnen<br />
Angela Kaiser (Kaiserhimmel), Daniela<br />
Rutica und Anne Hesmer.<br />
Am Freitagmorgen war dann alles vorbereitet<br />
und viele ehrenamtliche Tagungshelfer<br />
standen bereit, um die Besucher in<br />
Empfang zu nehmen oder vom Bahnhof<br />
Höxter abzuholen. Bischof Anba Damian<br />
hatte es sich nicht nehmen lassen, mit<br />
seinem Küchenteam ein festliches Begrüßungsbuffet<br />
im schattigen Klostergarten<br />
vorzubereiten und so begann die Tagung<br />
mit einem kulinarischen Meeting auf der<br />
Klosterwiese. Danach begaben sich die Gäste<br />
in den neuen Vortragsraum, der zu Beginn<br />
der Tagung, trotz des heißen Wetters, dank<br />
der dicken Klostermauern noch angenehm<br />
kühl war. Die Äußerungen der Freude und<br />
des Erstaunens über den geschmückten Saal<br />
gaben der Idee des Planungsteams recht –<br />
der Aufwand hatte sich gelohnt. Nach der<br />
Begrüßung durch die Veranstalter Bischof<br />
Anba Damian (Diözesanbischof der kopt.<br />
Kirche in Norddeutschland) und Prof. Dr.<br />
Rainer Hannig (Ägyptologie Marburg)<br />
stellte sich das Organisationsteam vor<br />
(Daniela Rutica, Angela Kaiser und Maxime<br />
Armgardt). Außerdem wurden die Gäste von<br />
Matthias Goeken MdL und Pastor Tobias<br />
Spittmann begrüßt, dessen Gemeinde den<br />
Raum für das Wochenende zur Verfügung<br />
gestellt hatte; beide betonten dabei die gute<br />
ökumenische Zusammenarbeit im Kloster<br />
43
Brenkhausen, das aus einem koptischen<br />
und katholischen Teil besteht. Thematisch<br />
begann das Programm mit einem Vortrag<br />
von Alexandra Küffer lic. phil. (Historisches<br />
und Völkerkundemuseum St. Gallen). In<br />
ihrem Vortrag „7 Mumien für den Bundesrat”<br />
referierte die Ägyptologin über die Särge<br />
aus dem Versteck von Bab-Gasus, die im späten<br />
19. Jahrhundert in die Schweiz gelangt<br />
waren und berichtete über die anschließende<br />
Präsentation und Bearbeitung in den jeweiligen<br />
Sammlungen. Dabei machte sie auf<br />
Innovationen bei der Gestaltung von Privatsärgen<br />
während der 21. und 22. Dynastie<br />
aufmerksam und stellte ihre Forschungen zu<br />
dieser Blütezeit der ägyptischen Sargmalerei<br />
vor. Im anschließenden Vortrag von Joachim<br />
Willeitner M.A. (München) ging es ebenfalls<br />
um kunstgeschichtliche Aspekte. Der<br />
Ägyptologe, Archäologe und Sachbuchautor<br />
referierte über die Stilistik der Amarnazeit<br />
und den langen Schatten des Atonkults,<br />
der sich bis in die ramessidische Zeit und<br />
später nachverfolgen lässt. In der Pause vor<br />
dem Abendessen bestand die Möglichkeit<br />
zu einer Führung mit dem Holzbildhauer<br />
Gunter Schmidt-Riedig, der den Besuchern<br />
viele Neuerungen im koptischen Kloster<br />
zeigte. Von den Wappenpflanzen Ägyptens<br />
handelte der Vortrag von Ulrike Jungnickel<br />
M.A. (Universität Mainz). Ein Schwerpunkt<br />
lag dabei auf der botanischen Identifikation<br />
der sogenannten Südpflanze, die bis heute<br />
nicht eindeutig geklärt werden konnte. Den<br />
thematischen Abschluss des Abends bildete<br />
der Vortrag von Dr. Helmut Brandl (Roemer-<br />
und Pelizaeus-Museum, Hildesheim).<br />
Der Ägyptologe nahm die Besucher mit<br />
auf eine virtuelle Reise ins archäologische<br />
Museum von Ismaelia (Ägypten) und zeigte<br />
dabei viele herausragende, aber hierzulande<br />
weitgehend unbekannte Exponate. Viele<br />
der Teilnehmer ließen den Abend bei einem<br />
Umtrunk im neuen, ägyptisch gestalteten<br />
Restaurant St. Markus gemütlich ausklingen.<br />
Nach dem optionalen Morgenweihrauchgebet<br />
und dem Frühstück im Speisesaal des<br />
Klosters startete das Programm am Samstagmorgen<br />
mit dem Thema „Spuren des Alten<br />
Ägypten in Mozarts Zauberflöte – wieviel<br />
Ägypten steckt in der Oper“ von Volker<br />
Semmler M.A. (Museum August Kestner,<br />
Hannover). Der Ägyptologe und Musiker<br />
untersuchte die ursprüngliche Inszenierung<br />
auf ihre ägyptischen Einflüsse und kam<br />
Abb. 3: Der Vortrag von<br />
Alexandra Küffer „7 Mumien<br />
für den Bundesrat” handelte<br />
von Särgen aus dem Versteck<br />
von Bab-Gasus in der Schweiz<br />
© Foto: Daniela Rutica<br />
44
dabei zu teilweise überraschenden Ergebnissen.<br />
Um die Wiedererweckung des Alten<br />
Ägypten in der Literatur ging es im Vortrag<br />
von Judith Mathes. Die Autorin der hochgelobten<br />
Ägypten-Romane „Tage des Ra“ und<br />
„Tage des Seth“ referierte über das Thema<br />
„Erforschtes lebendig machen, Unbekanntes<br />
erschließen“ und ging dabei auf die Frage<br />
ein, inwieweit historische Romane zum Verständnis<br />
einer weit entfernten Vergangenheit<br />
beitragen können. Anhand von ausgewählten<br />
Textpassagen zeigte die Referentin dabei<br />
auf, wie der Balanceakt zwischen ägyptologischen<br />
Fakten und künstlerischer Fiktion<br />
und Dramaturgie gelingen kann. Der Vortrag<br />
von Karin Stephan M.A. (Universität<br />
Mainz) handelte von Ramses II. und dem<br />
Parfümeur Bichara. Die Ägyptologin berichtete<br />
dabei über einen neuzeitlichen Flakon<br />
im Hessischen Landesmuseum Darmstadt<br />
und die kriminalistische Suche nach dem<br />
Ursprung der dort verwendeten Hieroglyphentexte.<br />
Nach der Mittagspause referierte<br />
die Ägyptologin Dr. Heidi Köpp-Junk (Universität<br />
Trier) über das Thema „Wasser“ und<br />
erläuterte die Funktion von Wasserver- und<br />
Entsorgungssystemen in Pyramidenbezirken,<br />
Tempeln und Wohnkomplexen in pharaonischer<br />
Zeit. Nach einem Überblick über<br />
ägyptische Ableitungssysteme von der Zeit<br />
des Alten Reiches bis in die griechisch-römische<br />
Zeit stellte die Referentin ihre aktuellen<br />
Forschungen zu Wasserentsorgungssystemen<br />
im Tempelbezirk von Athribis vor und zog<br />
einen Vergleich zu modernen Umsetzungen.<br />
Im Vortrag „Per Anhalter durchs Mittelmeer<br />
– Wenamun als komischer Held“ präsentierte<br />
Dr. Katharina Stegbauer (Universität<br />
Leipzig) ihre Forschungen zum Reisebericht<br />
des Wenamun (pMoskau 120). Der Papyrus<br />
berichtet von der Reise des Tempelbeamten<br />
Wenamun, der von Smendes und Tanutamun<br />
nach Byblos geschickt wurde, um<br />
Zedernholz einzukaufen, was sich jedoch<br />
als schwierig erweisen sollte. Die Referentin<br />
machte in ihrem Vortrag auf die im Text enthaltene<br />
Ironie und Satire aufmerksam und<br />
zeigte auf, inwieweit sich daraus Anspielungen<br />
auf die politischen Veränderungen zu<br />
Beginn der 3. Zwischenzeit ableiten lassen.<br />
In seinem Vortrag „Die Erfindung der Farbherstellung<br />
in der Antike“ referierte Prof. Dr.<br />
Robert Fuchs (Technische Hochschule Köln)<br />
über Farbmittel und Maltechniken im Alten<br />
Ägypten. Der Chemiker und Ägyptologe<br />
präsentierte dabei eigene Forschungsergeb-<br />
Abb. 4: „Sound of Silence“, das abendliches Konzert<br />
von Heidi Köpp, © Foto: Daniela Rutica<br />
Abb. 5: Anne Hesmer entwarf und fertigte die Geierhaube<br />
der Nefertari, © Foto: Begga Rolfsmeyer<br />
45
nisse in Bezug auf die Herkunft der zur pharaonischen<br />
Zeit verwendeten Pigmente und<br />
zeigte innovative Maltechniken, die bei der<br />
Papyrusmalerei im Alten Ägypten von einzelnen<br />
Künstlern erprobt wurden. Das Vortragsprogramm<br />
am Samstag endete mit der<br />
Präsentation „Nicht nur zu Gast in der Ramses-Stadt<br />
- Internationale Beziehungen einer<br />
Altägyptischen Residenz” von Dr. Edgar<br />
Pusch (Roemer-und Pelizaeus Museum, Hildesheim).<br />
Der Ägyptologe und langjährige<br />
Grabungsleiter von Piramesse gab einen Einblick<br />
in seine 36jährige Forschungstätigkeit<br />
über die Rekonstruktion der Ramses-Stadt,<br />
referierte über den internationalen Charakter<br />
der antiken Metropole und zeigte Funde,<br />
die auf ausländische Besucher, Botschafter<br />
und Würdenträger hinweisen. Nach dem<br />
Abendessen begann das künstlerische Rahmenprogramm<br />
mit dem vergnüglichen<br />
Theaterstück „Der kurze Weg zum Frieden“,<br />
das die Gruppe Ebers‘ Erben (Universität<br />
Leipzig) exklusiv für die Tagung einstudiert<br />
hatte. Das Stück handelt von einem geheimen<br />
Treffen zwischen Pharao Ramses II.<br />
(Joost Hagen) und dem hethitischen Großkönig<br />
Hattusilis III. (Helmar Wodtke) nach<br />
der Schlacht von Kadesh und präsentiert<br />
in erfrischend frechen Dialogen eine alternative<br />
Variante der Geschichte, nach der es<br />
in Wirklichkeit die beiden Königsgemahlinnen,<br />
Nefertari (Ursula Selzer) und Puduchepa<br />
(Katharina Stegbauer) waren, die den<br />
ersten Friedensvertrag der Menschheitsgeschichte<br />
schlossen. Ein optischer Hingucker<br />
war dabei die golden glänzende Krone der<br />
Königin Nefertari – eine Geierhaube, die in<br />
monatelanger Feinarbeit von Anne Hesmer<br />
aus 220 echten Messing- und Bronzeplättchen<br />
entworfen und angefertigt worden war.<br />
Der Abend endete mit dem stimmungsvollen<br />
musikalischen Entertainment-Programm<br />
von Heidi Köpp. Die aus Funk und Fernsehen<br />
bekannte Sängerin, Ägyptologin und<br />
Musikarchäologin nahm das Publikum mit<br />
auf eine Reise durch die Musikgeschichte.<br />
Ihr abendliches Konzert „Sound of Silence<br />
– Musik im Alten Ägypten und heute“<br />
begeisterte das Publikum mit antiken Instrumenten<br />
und altägyptischen Texten bis zu<br />
modernen Chansons mit Gitarrenbegleitung<br />
bis tief in die Nachtstunden.<br />
Abb. 6: Die Gruppe Ebers‘<br />
Erben (Universität Leipzig)<br />
zeigte am Samstag abend<br />
ihr neues Stück „Ramses II.<br />
und Hattusilis - Der kurze<br />
Weg zum Frieden“<br />
© Foto: Daniela Rutica<br />
46
Am Sonntagmorgen bestand die Möglichkeit<br />
zur Teilnahme am koptisch-orthodoxen<br />
Gottesdienst. Nach dem anschließenden<br />
Agape-Mahl und Mittagessen begann das<br />
Vortragsprogramm mit dem Thema „Die<br />
verlorene Mumie von Alexander dem Großen“<br />
von Dr. Michael E. Habicht (Universität<br />
Zürich). Der schweizer Ägyptologe<br />
referierte in seinem spannenden Vortrag<br />
über die Spurensuche nach dem Verbleib der<br />
Mumie des großen Makedonenkönigs und<br />
zeigte auf, welche Rolle dabei koptische und<br />
mittelalterliche Heiligenlegenden spielen<br />
könnten und was Alexander den Großen<br />
mit dem Hl. Markus verbindet. Dr. Irmtraut<br />
Munro (Universität Bonn) präsentierte in<br />
ihrem Vortrag.„Ein nützliches Puzzle: Das<br />
Zusammenführen von Totenbuch-Fragmenten”<br />
ihre langjährige Forschungsarbeit am<br />
Bonner Totenbuchprojekt und berichtete<br />
über die Suche nach weltweit verstreuten<br />
Papyrusfragmenten. In der anschließenden<br />
Diskussion wurden von Seiten der Besucher<br />
großes Bedauern und Bestürzung über die<br />
Einstellung des Projektes geäußert. Den<br />
Abschluss der Tagung bildeten traditionell<br />
zwei koptologische Vorträge. Joost Hagen<br />
M.A. (Universität Leipzig) stellte in seinem<br />
Vortrag „Einzigartig, doppelt und dreifach“<br />
die koptischen Texte aus Kasr Ibrim vor und<br />
im Anschluss referierte Julien Delhez M.A.<br />
(Universität Göttingen) zum Thema „Schenute,<br />
Mönch und Lehrer“ über die Klosterregeln<br />
in den Aufzeichnungen des bekannten<br />
koptischen Autors und Klostervorstehers aus<br />
dem 5. Jahrhundert. Die Tagung endete mit<br />
Kaffee und Kuchen im Klostergarten, zu<br />
dem Bischof Damian die Besucher herzlich<br />
einlud. Einige Gäste nutzten die Gelegenheit<br />
und verbrachten noch ein paar Urlaubstage<br />
länger in Brenkhausen oder besuchten<br />
die ägyptische Sammlung im Roemer-und<br />
Pelizaeus Museum in Hildesheim. Und die<br />
Gespräche und kreativen Ideen beim abendlichen<br />
Ausklang im Restaurant St. Markus<br />
drehten sich bereits um die nächste Tagung<br />
und weitere ägyptologische Veranstaltungen<br />
und Themen-Events im Kloster. Geplant<br />
sind die nächsten Tage der Ägyptologie<br />
unter dem Motto „Helden, Heilige und Hieroglyphen“<br />
übrigens für das Wochenende<br />
31.07.–02.08.2020.<br />
Abb. 7: Angela Kaiser (Kaiserhimmel) zeigte an ihrem<br />
Stand in den Pausen Mal- und Vergoldungstechniken<br />
© Foto: Daniela Rutica<br />
Abb. 8: Künstlerstand von Daniela Rutica und Angela<br />
Kaiser bei den Tagen der Ägyptologie<br />
© Foto: Daniela Rutica<br />
47
Toutânkhamon<br />
le Trésor du Pharaon<br />
Reise des Vereins zur Förderung des Ägyptischen<br />
Museums in Berlin nach Paris zur Ausstellung<br />
Die vom 16. Februar 1980 bis zum 26.<br />
Mai 1980 im heutigen Bröhan-Museum<br />
durchgeführte Tutanchamun-Ausstellung war<br />
und ist schon allein im Blick auf die damaligen<br />
655 900 Besucher eines der prägenden<br />
Großereignisse in der Geschichte des Fördervereins<br />
des Ägyptischen Museums Berlin.<br />
Thomas Ritter / Daniela Vandersee-Geier<br />
und Gäste – geführt von Frau Dr. Zorn – auf<br />
den Weg nach Paris, um sich die Ausstellung<br />
anzusehen. In Paris kamen 2 Mitglieder zum<br />
Besuch der Ägyptischen Abteilung des Louvre<br />
hinzu. Die Gruppe umfasste dabei alle<br />
Generationen. Die jüngste Mitreisende war<br />
11 Jahre alt.<br />
Nunmehr fand 2019 die Ausstellung „Tutanchamun.<br />
Der Schatz des Pharao“ in Paris<br />
statt. Ausgestellt wurden darin 150 Objekte,<br />
wobei 60 dieser Objekte erstmals außerhalb<br />
Ägyptens zu sehen waren. Anfang August<br />
2019 machten sich 26 Vereinsmitglieder<br />
Das Reise- und Besuchsprogramm in Paris<br />
umfasste nicht nur die dortige Tutanchamun-<br />
Ausstellung, sondern auch einen Besuch in<br />
der Ägyptischen Abteilung des Louvre sowie<br />
den Besuch der Hethiter-Ausstellung, die<br />
ebenfalls im Louvre stattfand.<br />
Abb. 1: Die Pyramide am Vorabend des Louvre-Besuchs © Foto: Bettina Ritter<br />
48
Die Reisenden trafen sich am Samstag,<br />
den 3. August 2019, zur Mittagszeit, an der<br />
großen Glaspyramide im Hof des Louvre.<br />
Die Besuchermassen waren immens, aber<br />
unter besonderem Einsatz der Leitung<br />
bekam die Gruppe den Zutritt über einen<br />
Nebeneingang, so dass die Führung beginnen<br />
konnte. Diese dauerte dann zum einen<br />
wegen der unzähligen interessanten Ausstellungsstücke<br />
aber auch wegen der bereichernden<br />
und inspirierenden Erläuterungen von<br />
Frau Dr. Zorn bis zum Schließungszeitpunkt<br />
des Louvre an. Der zur freien Gestaltung<br />
stehende Samstagabend klang für einen Teil<br />
der Gruppe in einem sehr guten und gediegenen<br />
Restaurant in der Nähe des Boulevard<br />
Haussmann aus, während andere Reisende<br />
sich für einen individuellen Abend in Paris<br />
entschieden.<br />
Am Sonntag, den 4. August 2019, traf die<br />
Gruppe wieder zusammen und ging – nach<br />
einem gemeinsamen Stadtrundgang – wieder<br />
in den Louvre zum Besuch der Ausstellung<br />
„Vergessene Königreiche – Die Erben des<br />
Hethitischen Reiches”. Mit dem Besuch dieser<br />
Ausstellung und der kompetenten Führung<br />
durch den Kurator dieser Ausstellung,<br />
Herrn Dr. Vincent Blanchard, wurde das<br />
Verständnis für die Hethiter als große rivalisierende<br />
Macht des alten Ägypten sowie die<br />
Bemühungen des Louvres für die Erhaltung<br />
und den Schutz des Kulturerbes in Konfliktgebieten<br />
vertieft. Der Sonntagabend klang<br />
bei einem gemeinsamen Abendessen aus.<br />
Am Montag, den 5. August 2019, ging<br />
es dann zur Ausstellung „Toutânkhamon,<br />
le Trésor du Pharaon”, die nicht im Louvre,<br />
Abb. 2: Frau Dr. Zorn bei der Führung im Louvre © Foto: Bettina Ritter<br />
49
sondern in der Grande Halle in La Villette<br />
im Norden von Paris stattfand. Es handelt<br />
sich um die ehemalige Große Halle des<br />
Schlachthofes von Paris. Durch die Ausstellung,<br />
die das ägyptische Antikenministerium<br />
mit der Eventfirma IMG Exhibitions unter<br />
fachlicher Beratung des Louvre bis 2022 auf<br />
eine Weltreise schickte, um an Carters Jahrhundertfund<br />
zu erinnern, sollte wieder Frau<br />
Dr. Zorn führen. Nicht zuletzt aufgrund der<br />
Besuchermassen, die durch die Ausstellung<br />
– wohl gemäß dem Ausstellungskonzept –<br />
hindurchorganisiert wurden bzw. hindurchorganisiert<br />
werden mussten, erwies sich<br />
das Vorhaben einer Führung allerdings als<br />
nicht realisierbar. Die Führung hat Frau Dr.<br />
Zorn, der an dieser Stelle nochmals herzlich<br />
gedankt wird, unter Verwendung der von<br />
Herrn Schröder gemachten Bilder nach der<br />
Rückkehr nach Berlin in einer „Paris-Nachlese“<br />
in dem den „Berlinern“ vertrauten<br />
Museumsformat im Brugsch-Pascha-Saal<br />
nachgeholt.<br />
Die Reise nach Paris war für alle – nicht<br />
zuletzt wegen der zahlreichen menschlichen<br />
Begegnungen und der guten Gespräche<br />
– vielfältig und insbesondere für das Vereinsleben<br />
bereichernd und hat einen tiefen<br />
Einblick in die oben dargestellten Themen<br />
gegeben. Unmittelbar erfahrbar wurde<br />
dabei auch, wie eine „moderne“ und von<br />
Event-Firmen mitorganisierte Museumsund<br />
Ausstellungsorganisation abläuft.<br />
Abb. 3: Ägyptische Abteilung des Louvre<br />
© Foto: Daniela Vandersee-Geier<br />
50
<strong>Magazin</strong> für die Freunde<br />
Ägyptischer Museen und Sammlungen<br />
V.I.S.D.P.:<br />
Mike Berger, Berlin<br />
mike.berger@amun-magazin.de<br />
Herausgeber und Redaktion:<br />
Verein zur Förderung des Ägyptischen<br />
Museums Berlin e.V.<br />
Geschwister-Scholl-Straße 6<br />
10117 Berlin<br />
Tel.: +49 30 266 42 5029<br />
(Mi 09:30 – 14:30 Uhr)<br />
E-Mail: info@vaemp.de<br />
Verein zur Förderung des Ägyptischen<br />
Museums der Universität Bonn e.V.<br />
Regina-Pacis-Weg 7<br />
53113 Bonn<br />
Tel.: +49 228 73 75 87<br />
E-Mail: info@verein-ägyptisches-museum.de<br />
Antike & Gegenwart e.V.<br />
c/o Museum August Kestner<br />
Trammplatz 3<br />
301<strong>59</strong> Hannover<br />
Tel.: +49 511 168-42120<br />
Freundeskreis Ägyptisches Museum<br />
Wilhelm Pelizaeus Hildesheim e.V.<br />
c/o Roemer- und Pelizaeus-Museum<br />
Hildesheim GmbH<br />
Am Steine 1–2<br />
31134 Hildesheim<br />
Tel.: +49 5121 9369-0<br />
E-Mail: freundeskreis@rpmuseum.de<br />
Echnaton Museum Minia e.V.<br />
c/o Roemer- und Pelizaeus-Museum<br />
Hildesheim GmbH<br />
Am Steine 1–2<br />
31134 Hildesheim<br />
Tel.: +49 5121 9369-0<br />
E-Mail: echnaton-minia@rpmuseum.de<br />
Ausgabe Oktober 2019<br />
Heft-<strong>Nr</strong>. <strong>59</strong> / 21. Jahrgang<br />
ISSN: 2196-8942 (Print)<br />
ISSN: 2513-0161 (eBook)<br />
Hildesheimer Museumsverein<br />
c/o Roemer- und Pelizaeus-Museum<br />
Hildesheim GmbH<br />
Am Steine 1–2<br />
31134 Hildesheim<br />
Tel.: +49 5121 9369-24<br />
E-Mail: museumsverein@rpmuseum.de<br />
Freundeskreis des Ägyptischen Museums der<br />
Universität Leipzig e.V.<br />
Goethestraße 2<br />
04109 Leipzig<br />
Tel.: +49 341 9737014<br />
E-Mail: fk_aeg.mus@uni-leipzig.de<br />
Verein der Freunde des<br />
Kunsthistorischen Museums<br />
Hanuschgasse 3, Stiege 1<br />
1010 Wien, Österreich<br />
Tel.: +43 1525 24 6901<br />
E-Mail: freunde@khm.at<br />
Lektorat:<br />
Erika Böning-Feuß, Berlin<br />
erika.boening-feuss@amun-magazin.de<br />
Satz und Layout:<br />
Mike Berger, Berlin<br />
Auflage:<br />
3 000<br />
Druck:<br />
PRIMUS international printing GmbH<br />
Hochstraße 14<br />
56307 Dernbach<br />
Titelbild:<br />
Heft <strong>Nr</strong>. 1 / 1999<br />
© Foto: Daniela Vandersee-Geier<br />
I M P R E S S U M<br />
Die Verwendung von Texten, Bildern, Zeichnungen oder grafischen Arbeiten jeder Art ist ohne Genehmigung<br />
der Herausgeber urheberrechtswidrig und untersagt. Es dürfen weder Auszüge noch Artikel oder Abbildungen<br />
jeder Art fotokopiert, vervielfältigt oder elektronisch verwertet werden. Das Scannen von Seiten ohne Genehmigung<br />
der Herausgeber ist untersagt. Zitate bedürfen der Genehmigung der Redaktion und der Herausgeber.<br />
51