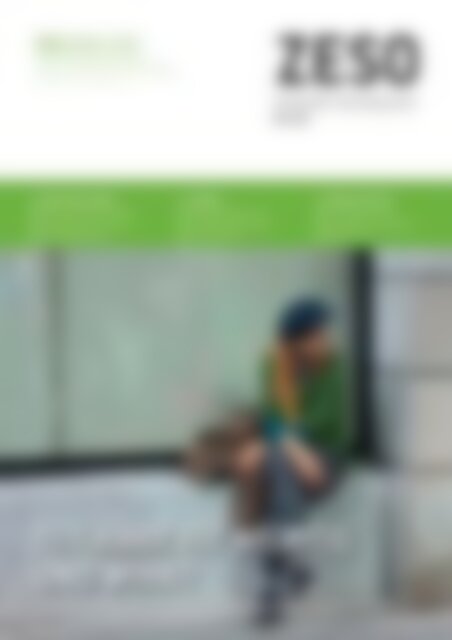ZESO 2/20
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
SKOS CSIAS COSAS<br />
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe<br />
Conférence suisse des institutions d’action sociale<br />
Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale<br />
Conferenza svizra da l’agid sozial<br />
<strong>ZESO</strong><br />
ZEITSCHRIFT FÜR SOZIALHILFE<br />
02/<strong>20</strong><br />
SKOS-RICHTLINIEN<br />
Neues Online-Portal dient<br />
als Arbeitsinstrument für<br />
die Sozialberatung<br />
CORONA<br />
Wie Sozialdienste und<br />
Hilfsorganisationen die<br />
Krise meistern<br />
TANDEM 50 PLUS<br />
Ein Programm hilft<br />
Personen über 50 bei der<br />
Stellensuche<br />
TEILHABE IST WICHTIG<br />
UND WIRKT<br />
Die Expertise von Armutsbetroffenen einzuholen, lohnt sich
Bieler Tagung, 2. November <strong>20</strong><strong>20</strong><br />
Der steinige Weg in den ersten<br />
Arbeitsmarkt<br />
Die berufliche Integration von unterstützten Personen ist eine wichtige<br />
Aufgabe der Sozialdienste. Doch gelingt die nachhaltige Integration in den<br />
ersten Arbeitsmarkt trotz aller Massnahmen und Anstrengungen oft<br />
nicht. Gibt es für arbeitsfähige Personen, die von der Sozialhilfe unterstützt<br />
werden, Platz im ersten Arbeitsmarkt? Welche Bedingungen stellen<br />
Arbeitgeber an die Anstellung der meist gering qualifizierten Personen?<br />
Wie können existenzsichernde Jobs und Tätigkeitsfelder für Menschen mit<br />
Leistungseinschränkungen oder Sprachschwierigkeiten aussehen?<br />
Die Bieler Tagung <strong>20</strong><strong>20</strong> bietet eine Plattform für Präsentationen und Diskussionen.<br />
Praktikerinnen und Praktiker erhalten Inputs und Impulse für ihre<br />
tägliche Arbeit.<br />
Anmeldung bis 16. Oktober <strong>20</strong><strong>20</strong><br />
Programm und Anmeldungen unter www.skos.ch/Veranstaltungen<br />
Soziale Arbeit<br />
Bildung ist die<br />
beste Referenz.<br />
www.zhaw.ch/sozialearbeit<br />
Hochschulcampus Toni-Areal, Zürich<br />
Infoabend<br />
30. September <strong>20</strong><strong>20</strong><br />
Jetzt anmelden!<br />
In welchem Bereich der<br />
Sozialen Arbeit Sie auch<br />
tätig sind: Eine Weiterbildung<br />
erhöht Ihre Kompetenzen<br />
für künftige<br />
Aufgaben. Die ZHAW<br />
bietet CAS, DAS, MAS<br />
und Kurse, bei denen<br />
sich Theorie und Praxis<br />
die Hand geben. Was Sie<br />
bei uns lernen, vertiefen<br />
Sie in Ihrem<br />
Berufsalltag –<br />
und umgekehrt.<br />
Machen Sie<br />
den nächsten<br />
Schritt.<br />
In welchem Handlungsfeld<br />
möchten Sie<br />
sich weiterbilden?<br />
• Kindheit, Jugend<br />
und Familie<br />
• Delinquenz und<br />
Kriminalprävention<br />
• Soziale Gerontologie<br />
• Community<br />
Development und<br />
Migration<br />
• Sozialrecht<br />
• Sozialmanagement<br />
• Supervision<br />
und Beratung<br />
Inserat_<strong>ZESO</strong>_halbseitig_2_<strong>20</strong><strong>20</strong>.indd 4 21.04.<strong>20</strong><strong>20</strong> 09:39:18
Ingrid Hess<br />
Redaktionsleitung<br />
EDITORIAL<br />
PARTIZIPATION – EIN WIRKSAMER<br />
ANSATZ<br />
Die aktuelle Zeso entstand unter besonderen Umständen -<br />
mehrheitlich im Home Office – wie so viele andere Arbeiten<br />
auch, die sicher auch Sie in den letzten Wochen unter vielleicht<br />
nicht immer ganz einfachen Bedingungen erledigt oder neu organisiert<br />
haben. Das Schwerpunktthema hatten wir kurz vor<br />
Beginn der Corona-Krise und der ausserordentlichen Lage gewählt.<br />
Wir beschlossen daran festzuhalten, auch wenn uns alle<br />
zur Zeit die Auswirkungen der Krise sehr beschäftigen. Doch<br />
das Thema Partizipation oder Teilhabe erschien uns wichtig und<br />
richtig, denn auch oder gerade in der Corona-Krise zeigt sich,<br />
wie wesentlich es eigentlich wäre, die Menschen einzubeziehen,<br />
die betroffen sind, deren Schwierigkeiten im Umgang mit<br />
der Krise aber weniger sichtbar sind. Die Experten mit Armutserfahrung,<br />
die in Belgien in der Verwaltung mitarbeiten (S.24),<br />
sind da ein Beispiel für einen innovativen und wirksamen Ansatz,<br />
aber auch das Projekt «Gemeinsam/Ensemble» in Biel<br />
(S.18).<br />
Natürlich hat uns die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen<br />
auf die Menschen, Organisationen und die Arbeit in und für die<br />
Sozialen Dienste auch ganz konkret beschäftigt (S.30). Christine<br />
Kopp, stv. Direktorin des SRK, beschreibt im Interview, wie<br />
das grösste Schweizer Hilfswerk die Krise erlebt und welche<br />
Lehren es aus ihr zieht (S.8).<br />
Wenn Sie Anregungen haben, Kritik äussern oder einen Kommentar<br />
zu einem der Artikel verfassen möchten, dann schreiben<br />
Sie uns: zeso@skos.ch oder schreiben Sie einen Kommentar<br />
auf www.skos.ch/zeitschrift-zeso.<br />
2/<strong>20</strong> <strong>ZESO</strong><br />
1
SCHWERPUNKT<br />
Teilhabe von<br />
armutsbetroffenen<br />
Menschen wirkt<br />
Wenn Armutsbetroffene<br />
oder Sozialhilfeempfänger<br />
bei der Ausgestaltung<br />
von sie betreffenden<br />
Themen, Projekten und<br />
Rahmenbedingungen<br />
involviert sind, hat das für<br />
die Involvierten wie auch<br />
für das Ergebnis positive<br />
Wirkung. Das zeigen eine<br />
Reihe von Praxisbeispielen<br />
und die Forschung. Diese hat<br />
sich mit den verschiedenen<br />
Modellen von Teilhabe und den<br />
Gelingensbedingungen<br />
befasst.<br />
12–23<br />
14–27 12–27<br />
<strong>ZESO</strong><br />
ZEITSCHRIFT FÜR SOZIALHILFE HERAUSGEBERIN Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe SKOS, www.skos.ch REDAKTIONSADRESSE<br />
© SKOS. Nachdruck nur mit Genehmigung der Herausgeberin<br />
Die <strong>ZESO</strong> erscheint viermal jährlich<br />
ISSN 1422-0636 / 117. Jahrgang<br />
Erscheinungsdatum: 1. Juni <strong>20</strong><strong>20</strong><br />
Die nächste Ausgabe erscheint am 7. September <strong>20</strong><strong>20</strong><br />
Redaktion <strong>ZESO</strong>, SKOS, Monbijoustrasse 22, Postfach, CH-3000 Bern 14, zeso@skos.ch, Tel. 031 326 19 19<br />
REDAKTION Ingrid Hess, Regine Gerber MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER DIESER AUSGABE Emanuela<br />
Chiapparini, Emilie Clavel, Karine Donzallaz, Christoph Eymann, Palma Fiacco, Stefan Gribi, Sophie Guerry,<br />
Debra Hevenstone, Lukas Hobi, Muriel Christe Marchand, Caroline Reynaud, Meinrad Schade, Max Spring, Alexander<br />
Suter, Barbara Spycher, Michael Zeier TITELBILD Palma Fiacco LAYOUT Marco Bernet, Projekt Athleten<br />
GmbH Zürich KORREKTORAT Karin Meier DRUCK UND ABOVERWALTUNG rubmedia AG, Postfach, 3001 Bern,<br />
zeso@rubmedia.ch, Tel. 031 740 97 86 PREISE Jahresabonnement CHF 89.– (SKOS-Mitglieder CHF 74.–),<br />
Jahresabonnement Ausland CHF 125.–, Einzelnummer CHF 25.–.<br />
2 <strong>ZESO</strong> 2/<strong>20</strong>
INHALT<br />
8<br />
5 KOMMENTAR<br />
Sozialhilfe in Zeiten von Corona<br />
6 PRAXIS<br />
Wie sind freiwillige Zuwendungen Dritter zu<br />
berücksichtigen?<br />
7 SOZIALHILFE<br />
Neues Richtlinien-Portal ab September <strong>20</strong><strong>20</strong><br />
8 INTERVIEW: CHRISTINE KOPP<br />
Die grossen Belastungen für Sozialwerke<br />
und soziale Institutionen werden erst kommen,<br />
sagt Christine Kopp, stv. Direktorin des<br />
SRK über die Corona-Krise<br />
28<br />
30<br />
12–27 TEILHABE VON ARMUTSBETROFFENEN<br />
14 Die Teilhabe von armutsbetroffenen Personen<br />
in Projekten der Sozialdienste ist<br />
wirkungsvoll<br />
18 Die Betroffenen beeinflussen die<br />
Prioritäten des Managements<br />
<strong>20</strong> Sozialhilfebeziehende als Ausbildner für<br />
Soziale Arbeit<br />
23 Gemeinsam mit Menschen mit<br />
Armutserfahrung forschen<br />
24 Wie Experten mit Armutserfahrung<br />
Zugang und Qualität der öffentlichen<br />
Dienste optimieren<br />
26 Pilotprojekt zur Beteiligung von Langzeit-<br />
Sozialhilfeempfänger: Nachgefragt bei der<br />
Verantwortlichen und einem Teilnehmer<br />
32<br />
34<br />
35<br />
28 SOCIAL IMPACT BONDS<br />
Sozialdienstleister machen unterschiedliche<br />
Erfahrungen mit Wirkungsverträgen<br />
30 CORONA-PANDEMIE<br />
Die Corona-Krise ist auch in Caritas-<br />
Märkten und der Caritas-Sozialberatung<br />
spürbar. Mittelfristig muss sich das Sozialsystem<br />
auf mehr Bedürftige vorbereiten<br />
32 TANDEM 50 PLUS<br />
Ein Programm im Kanton Aargau hilft<br />
Arbeitslosen über 50 beim Wiedereinstieg<br />
34 TÜRE AUF<br />
Muriel Christin Marchand, Co-Leiterin des<br />
Sozialdienstes Delémont, über die Herausforderungen<br />
während der Corona-Krise<br />
35 PORTRÄT<br />
Georg Raguth hat die Besuchsbox für<br />
Coronazeiten erfunden<br />
36 LESETIPPS UND VERANSTALTUNGEN<br />
2/<strong>20</strong> <strong>ZESO</strong><br />
3
NACHRICHTEN<br />
Revision Sozialhilfegesetz<br />
Basel-Landschaft<br />
Ende Januar eröffnete der Kanton Basel-<br />
Landschaft die Vernehmlassung für eine<br />
Teilrevision des Sozialhilfegesetzes. Die<br />
vorgeschlagenen Massnahmen stehen<br />
in wichtigen Punkten im Widerspruch zu<br />
den SKOS-Richtlinien. Insbesondere erachtet<br />
die SKOS das in der Gesetzesvorlage<br />
enthaltene Stufensystem als kompliziert,<br />
ungerecht und kontraproduktiv<br />
in Bezug auf die Arbeitsintegration. Es<br />
bietet zudem keinen Mehrwert gegenüber<br />
dem bestehenden System mit einheitlichem<br />
Grundbedarf.<br />
www.skos.ch Publikationen <br />
Vernehmlassungen<br />
Chancengleichheit und<br />
Gesundheit<br />
Chancengleichheit ist ein wichtiges Ziel<br />
der Gesundheitspolitik, in der Praxis<br />
aber noch nicht verwirklicht. Wer sozial<br />
benachteiligt ist, leidet häufiger unter<br />
schlechter Gesundheit und hat eine tiefere<br />
Lebenserwartung als sozial Bessergestellte.<br />
Ein neuer Grundlagenbericht<br />
zeigt auf, welche Interventionsansätze<br />
und Erfolgskriterien sich in der Praxis<br />
bewährt haben, um die gesundheitliche<br />
Chancengleichheit zu erhöhen.<br />
www.gesundheitsfoerderung.ch <br />
Grundlagen Publikationen<br />
SKOS-Grundlagenpapier:<br />
Armut und Armutsgrenzen<br />
Die Definitionen von Armut und sozialem<br />
Existenzminimum der SKOS sind zu<br />
zentralen Richtgrössen in der schweizerischen<br />
Sozialpolitik geworden. Sie<br />
berücksichtigen einerseits materielle<br />
und immaterielle Grundbedürfnisse,<br />
andererseits orientieren sie sich an den<br />
vorherrschenden Lebenskosten. Es existieren<br />
aber noch weitere Armutsdefinitionen<br />
und Existenzminima. Das aktualisierte<br />
Grundlagenpapier der SKOS zeigt<br />
die verschiedenen Modelle und Ansätze<br />
auf.<br />
www.skos.ch Publikationen <br />
Grundlagendokumente<br />
Einmal im Leben Sozialhilfe beziehen zu müssen, ist nicht so unwahrscheinlich. Bild: Palma Fiacco<br />
Jede 11. Person bezieht einmal im Leben<br />
Sozialhilfe<br />
In der Schweiz werden pro Jahr rund 3<br />
Prozent der ständigen Wohnbevölkerung<br />
von der Sozialhilfe unterstützt. Wird jedoch<br />
eine längere Zeitperiode von mehreren<br />
Jahren betrachtet, sind weit mehr Personen<br />
einmal auf Sozialhilfe angewiesen.<br />
Dies zeigt eine neue Studie des Bundesamtes<br />
für Sozialversicherungen.<br />
Zwischen <strong>20</strong>11 bis <strong>20</strong>17 bezogen 6,1<br />
Prozent zumindest einmal Sozialhilfe. Damit<br />
ist dieser Anteil rund doppelt so hoch<br />
wie bei der Betrachtung eines einzelnen<br />
Jahres. Bekannte Risikofaktoren für einen<br />
Sozialhilfebezug bestätigen sich in der<br />
Mehrjahresbetrachtung: Bei Alleinerziehenden<br />
steigt die Quote auf gut 26 Prozent,<br />
bei Einpersonenhaushalten auf 10 Prozent.<br />
Weiter werden in der Studie Modelle<br />
geprüft, um die Wahrscheinlichkeit eines<br />
Sozialhilfebezugs im Verlauf des Lebens<br />
zu schätzen. Die Analysen zeigen, dass<br />
zwischen 8,7 und 9,1 Prozent aller 25-<br />
bis 63-jährigen in der Schweiz geborenen<br />
Menschen einmal in ihrem Erwerbsleben<br />
Sozialhilfe beziehen. Das ist rund jede 11.<br />
Person. Bei im Ausland geborenen Personen<br />
liegt die Schätzung zwischen 15,2<br />
und 17,2 Prozent. <br />
•<br />
Beschäftigungsaussichten brechen ein<br />
Wegen der COVID-19-Pandemie haben<br />
sich die kurzfristigen Aussichten auf dem<br />
Schweizer Arbeitsmarkt stark verschlechtert.<br />
Anfangs Mai liegt der Beschäftigungsindikator<br />
der Konjunkturfachstelle der<br />
ETH Zürich (KOF) tiefer als während des<br />
Höhepunktes der Finanz- und Wirtschaftskrise<br />
<strong>20</strong>08/<strong>20</strong>09.<br />
Die im April <strong>20</strong><strong>20</strong> von der KOF befragten<br />
Firmen gehen von einem markanten<br />
Stellenabbau in den nächsten<br />
Monaten aus. Eine deutliche Mehrheit<br />
der 4635 Firmen schätzt den aktuellen<br />
Beschäftigungsstand als zu gross ein und<br />
plant in den nächsten drei Monaten Stellen<br />
zu reduzieren.<br />
Am stärksten eingebrochen ist der<br />
Beschäftigungsindikator für das Gastgewerbe.<br />
Aber auch in fast allen anderen<br />
Wirtschaftsbranchen haben sich die Beschäftigungsaussichten<br />
massiv verschlechtert.<br />
So gehen etwa auch der Detailhandel<br />
und der Bausektor von einem Stellenabbau<br />
in den nächsten Monaten aus. Einzig im<br />
Versicherungssektor sind die Beschäftigungserwartungen<br />
weiterhin positiv. •<br />
4 <strong>ZESO</strong> 2/<strong>20</strong>
KOMMENTAR<br />
Sozialhilfe in Zeiten von Corona<br />
Seit bald drei Monaten beherrscht die<br />
Corona-Pandemie unseren Alltag. Die Sozialdienste<br />
im ganzen Land haben Mitte März<br />
sehr schnell auf die neue Situation reagiert.<br />
Beratungsgespräche finden jetzt vermehrt<br />
telefonisch statt, neue digitale Formen der<br />
Arbeit mit Klienten wurden eingeführt, die<br />
Räume neu eingerichtet, damit die Hygieneund<br />
Abstandsregeln eingehalten werden<br />
können. Vor allem zu Beginn der Krise verzeichneten<br />
viele Sozialdienste einen starken<br />
Anstieg der Neuanmeldungen. Menschen,<br />
die sich bisher mit Stellen im Tieflohnbereich<br />
oder mit Arbeit auf Abruf die Existenz<br />
gesichert hatten, meldeten sich bei der Sozialhilfe.<br />
Vielen von ihnen fiel dieser Schritt<br />
sehr schwer. Mit den Hilfspaketen des<br />
Bundesrates für Selbständigerwerbende<br />
und der erweiterten Kurzarbeit gab es eine<br />
zumindest vorübergehende Entlastung für<br />
die Betroffenen und die Sozialdienste.<br />
In der Krise zeigte sich, wie wichtig jene<br />
Berufsleute sind, die an der Front arbeiten,<br />
insbesondere im Sozial- und Gesundheitswesen.<br />
Die Sozialdienste haben den<br />
Härtetest mit Bravour bestanden. Die<br />
Existenzsicherung und die Begleitung<br />
der Sozialhilfebeziehenden waren nie in<br />
Frage gestellt. Der Anstieg bei den Neuanmeldungen<br />
konnte bewältigt werden. Für<br />
die enormen Leistungen, die Sie in den<br />
Sozialdiensten erbracht<br />
haben, möchte ich Ihnen<br />
an dieser Stelle<br />
ganz herzlich<br />
danken.<br />
Zurzeit können wir noch kaum abschätzen,<br />
wie die Corona-Pandemie unsere Gesellschaft<br />
verändern wird und welche Auswirkungen<br />
dies auf die Sozialhilfe hat. Im<br />
Moment machen wir vorsichtige Schritte hin<br />
zu einer Normalisierung. Die Geschichte der<br />
Epidemien lehrt uns aber, dass es jederzeit<br />
zu neuen Wellen kommen kann und wir<br />
dann wieder zwei Schritte zurückgeworfen<br />
werden.<br />
Zweifelsohne werden die wirtschaftlichen<br />
Folgen zu einer zumindest vorübergehenden<br />
höheren Arbeitslosigkeit führen.<br />
Das Sicherungsnetz der Arbeitslosenversicherung<br />
muss in dieser Phase gestärkt<br />
werden. Die Überbrückungsleistungen für<br />
ältere Arbeitnehmende, die im Parlament<br />
entscheidungsreif sind, werden helfen,<br />
zusätzliche Härtefälle in dieser Krise zu<br />
verhindern. Sie sollten jetzt rasch und<br />
ohne weitere Abstriche verabschiedet und<br />
so schnell wie möglich in Kraft gesetzt<br />
werden.<br />
Auch wenn die vorgelagerten Systeme ausgebaut<br />
werden: Die Sozialhilfe steht in den<br />
nächsten Jahren vor grossen Herausforderungen.<br />
Es wird schwieriger werden, unterstützte<br />
Personen in den ersten Arbeitsmarkt<br />
abzulösen. Es wird mehr Menschen<br />
geben, die durch die Maschen fallen.<br />
Und die Integration von Flüchtlingen<br />
bleibt eine Daueraufgabe.<br />
Führt die Corona-Krise dazu, dass<br />
wir als Gesellschaft stärker zusammenstehen<br />
und dass der Nutzen<br />
der Sozialwerke und der Sozialhilfe<br />
wieder besser anerkannt werden?<br />
Oder driften Arm und Reich stärker<br />
auseinander? Niemand kann das<br />
heute voraussagen. Das Zusammenstehen<br />
der Gesellschaft in den letzten<br />
Wochen macht mich aber zuversichtlich,<br />
dass wir unsere Errungenschaften im<br />
sozialen Bereich wieder stärker zu schätzen<br />
wissen. Dies im Bewusstsein, dass<br />
ohne ein funktionierendes Sozialsystem<br />
in einer solchen Krise, wie wir sie jetzt<br />
durchleben, eine gesellschaftliche Katastrophe<br />
logische Konsequenz wäre.<br />
Christoph Eymann<br />
SKOS-Präsident<br />
2/<strong>20</strong> <strong>ZESO</strong><br />
5
Wie sind freiwillige Zuwendungen<br />
Dritter zu berücksichtigen?<br />
PRAXIS Frau Bucher wird mit Sozialhilfe unterstützt. Ihr Grossvater möchte ihr einen Zuschuss<br />
geben, damit sie einen überhöhten Mietzins finanzieren kann. Grundsätzlich müssen freiwillige<br />
Leistungen Dritter bei der Bemessung der Bedürftigkeit als Einnahmen berücksichtigt werden.<br />
Frau Bucher (26) ist nach einer abgebrochenen<br />
Erstausbildung auf Sozialhilfe angewiesen.<br />
Ihre Eltern leben getrennt, sie<br />
hat mit beiden ein schwieriges Verhältnis<br />
und es ist nicht möglich, dass sie bei einem<br />
von ihnen wieder einzieht. Bis zum Abbruch<br />
der Erstausbildung wurde sie finanziell<br />
von beiden Elternteilen unterstützt,<br />
die Eltern haben ihr auch die Wohnung bezahlt.<br />
Der Mietzins dieser Wohnung liegt<br />
rund 300 Franken pro Monat über den<br />
örtlich geltenden Mietzinsrichtlinien. Frau<br />
Bucher erklärt, dass ihr Grossvater bereit<br />
sei, ihr die fehlenden 300 Franken pro<br />
Monat zu bezahlen, damit sie bis zum Abschluss<br />
der neu begonnenen Erstausbildung<br />
in der Wohnung bleiben kann.<br />
FRAGE<br />
Sind die 300 Franken des Grossvaters im<br />
Unterstützungsbudget von Frau Bucher als<br />
Einnahmen anzurechnen?<br />
GRUNDLAGEN<br />
Bei der Feststellung der Bedürftigkeit und<br />
der Bemessung von Unterstützungsleistungen<br />
werden alle verfügbaren Einnahmen<br />
berücksichtigt. Darunter fallen auch<br />
freiwillige Zuwendungen Dritter, sofern<br />
keine Ausnahme gewährt wird (SKOS-RL<br />
D.1, mit Erläuterungen). Diese Empfehlung<br />
basiert auf dem Prinzip der Bedarfsdeckung<br />
(SKOS-RL A.3 Abs. 4).<br />
Es ist dabei unerheblich, ob es sich um<br />
Geld- oder Naturalleistungen handelt.<br />
PRAXIS<br />
In dieser Rubrik werden exemplarische Fragen, die<br />
an die «SKOS-Line»gestellt werden, beantwortet<br />
und publiziert. Die «SKOS-Line» ist ein Beratungsangebot<br />
für SKOS-Mitglieder.<br />
Der Zugang erfolgt über www.skos.ch Mitgliederbereich<br />
(einloggen) Beratungsangebot<br />
Deshalb können beispielsweise auch jene<br />
Leistungen als Einnahmen angerechnet<br />
werden, die eine Drittperson direkt an einen<br />
Gläubiger der unterstützten Person<br />
leistet, etwa wenn ein Teil der überhöhten<br />
Wohnkosten von Dritten direkt an den Vermieter<br />
gezahlt werden.<br />
Unterstützte Personen haben grundsätzlich<br />
alle Zuwendungen, die sie erhalten,<br />
gegenüber der Sozialhilfe korrekt zu<br />
deklarieren. Dies ist Ausdruck ihrer allgemeinen<br />
Auskunfts- und Meldepflicht<br />
(SKOS-RL A.4.1 Abs. 5ff.).<br />
Ob eine Ausnahme von der Anrechnung<br />
gemacht wird, liegt im Ermessen des Sozialhilfeorgans.<br />
Empfohlen sind Ausnahmen<br />
von einer Anrechnung dann, wenn<br />
die Zuwendungen von bescheidenem<br />
Umfang sind und ausdrücklich zusätzlich<br />
zu den Sozialhilfeleistungen erbracht<br />
werden. Beispiele sind Gelegenheitsgeschenke<br />
in angemessenem Umfang (z.B.<br />
an Feiertagen oder am Geburtstag). Auch<br />
bei Zuwendungen zur Tilgung von nachweislich<br />
bestehenden Schulden kann auf<br />
eine Anrechnung verzichtet werden. Keine<br />
Ausnahmen sind dann möglich, wenn mit<br />
den Zuwendungen überhöhte Miet- oder<br />
Lebenshaltungskosten oder Luxusausgaben<br />
finanziert werden sowie wenn eine<br />
Nichtanrechnung wegen des Umfangs der<br />
Zuwendung stossend wäre.<br />
Es können somit folgende Kategorien<br />
unterschieden werden:<br />
1. Regelmässig erbrachte freiwillige Leistungen<br />
sind anzurechnen, wenn sie<br />
für eine im Unterstützungsbudget enthaltene<br />
Ausgabenposition ausgerichtet<br />
werden oder der Finanzierung von Luxus<br />
dienen.<br />
2. Einmalige, nicht zweckgebundene<br />
Leistungen sind anzurechnen. Ausgenommen<br />
sind übliche Gelegenheitsgeschenke<br />
oder Leistungen von bescheidenem<br />
Umfang.<br />
3. Einmalige, zweckgebundene Leistungen,<br />
die nicht für eine im Unterstützungsbudget<br />
enthaltene Ausgabenposition<br />
ausgerichtet werden, sind in der<br />
Regel nicht anzurechnen. Eine Anrechnung<br />
kommt nur in Betracht, wenn<br />
eine Zuwendung zur Finanzierung von<br />
Luxus geleistet wird und eine Nichtanrechnung<br />
stossend wäre.<br />
Bei der Frage, ab welchem Zeitpunkt<br />
eine regelmässig erbrachte Zuwendung<br />
für überhöhte Fixkosten anzurechnen ist,<br />
muss die individuelle Situation gewürdigt<br />
werden. Um eine Verschuldung zu vermeiden<br />
und die Notlage von unterstützten Personen<br />
nicht zu verschlimmern, kann auf<br />
die Anrechnung während einer angemessenen<br />
Frist verzichtet werden.<br />
ANTWORTEN<br />
Beim freiwilligen Zuschuss des Grossvaters<br />
in der Höhe von 300 Franken für die überhöhte<br />
Miete handelt es sich um eine regelmässig<br />
erbrachte freiwillige Leistung. Der<br />
Zuschuss erfolgt für eine im Unterstützungsbudget<br />
enthaltene Ausgabenposition.<br />
Daher sind die 300 Franken im Unterstützungsbudget<br />
der Frau grundsätzlich<br />
als Einnahmen anzurechnen. Dies würde<br />
auch dann gelten, wenn nur die gemäss<br />
Mietzinsrichtlinien maximal zulässigen<br />
Ausgaben anerkannt würden. •<br />
Dr. iur. Alexander Suter<br />
SKOS-Fachbereich Recht und Beratung<br />
WICHTIGER HINWEIS<br />
Die Verweise auf die SKOS-Richtlinien<br />
beziehen sich bereits auf die ab <strong>20</strong>21 neu<br />
geltende Richtlinien-Struktur.<br />
6 <strong>ZESO</strong> 2/<strong>20</strong>
Neues Richtlinien-Portal<br />
ab September <strong>20</strong><strong>20</strong><br />
SOZIALHILFE Mit der Nachführung der SKOS-Richtlinien wird ein neues Online-Portal geschaffen, um<br />
die Richtlinien, Erläuterungen und Praxishilfen besser zugänglich zu machen. Durch die Möglichkeit<br />
einer Integration von Kantonalen Handbüchern und kommunalen Hilfsmitteln wird das neue Web-<br />
Portal zu einem effizienten Arbeitsinstrument für die Sozialberatung.<br />
Die SKOS-Publikationen in Form von<br />
Grundlagendokumenten, Merkblättern<br />
und Praxishilfen werden auf der neuen<br />
Website den betreffenden Richtlinien zugeordnet.<br />
Beim Kapitel «Anspruchsvoraussetzungen»<br />
sind beispielsweise Erläuterungen<br />
zur Budgetberechnung, zu den<br />
Unterstützungseinheiten usw. zu finden<br />
sowie Hinweise zu relevanten Dokumenten,<br />
von Berechnungstabellen bis zu Praxishilfen<br />
zur Unterstützung von Selbstständigerwerbenden.<br />
Alle Inhalte lassen sich einzeln oder als<br />
gesamtes Richtlinien-Paket in ein PDF<br />
(A4) formatieren und bei Bedarf ausdrucken.<br />
Ein neuer A4-Ordner für die Richtlinien<br />
ist auf Bestellung erhältlich. Nachträge<br />
der SKOS-Richtlinien müssen nicht<br />
mehr bestellt, sondern können selber ausgedruckt<br />
und im Ordner ersetzt werden.<br />
Das System orientiert sich an den Richtlinien<br />
für barrierefreie Webinhalte, sodass<br />
es auch von Personen mit Beeinträchtigungen<br />
benutzt werden kann, wenn diese entsprechende<br />
Hilfsmittel nutzen.<br />
Integration von kantonalen und<br />
kommunalen Handbüchern<br />
Die meisten Kantone veröffentlichen heute<br />
bereits Handbücher zur Sozialhilfe. Auch<br />
dazu kann das Portal der SKOS verwendet<br />
werden. Eigene Empfehlungen, Grafiken,<br />
Dokumente, Links auf Stichwörter etc. zu<br />
den Kapiteln der Richtlinien lassen sich in<br />
einer eigenen Version des Portals darstellen.<br />
Auch wird es möglich sein, das Portal<br />
mit den Logos und Farben des jeweiligen<br />
Kantons oder der jeweiligen Gemeinde anzupassen<br />
und in deren Web-Auftritt zu integrieren.<br />
Auf Wunsch kann in einer zusätzlichen<br />
Spalte kommunalen Ebenen des Sozialhilfevollzugs<br />
Platz für weiterführende Erläuterungen<br />
und Musterdokumente gegeben<br />
werden.<br />
Einfache Pflege der eigenen Inhalte<br />
Auch ohne besondere IT-Kenntnisse können<br />
eigene Inhalte aktualisiert und den Bedürfnissen<br />
entsprechend angepasst werden.<br />
Öffentlich oder nur für Mitarbeitende<br />
zugänglich<br />
Interne Handbücher und Richtlinien, Vollzugsweisungen,<br />
Musterdokumente oder<br />
weitere Informationen lassen sich durch<br />
Passwortschutz nur für Mitarbeitende zugänglich<br />
machen. Dadurch eignet sich das<br />
System auch als interne Know-how-Datenbank<br />
für Sozialdienste.<br />
Für eine Integration von eigenen Handbüchern<br />
und Weisungen fallen einmalige<br />
Kosten für die Realisierung an sowie jährliche<br />
Folgekosten für die Lizenzierung der<br />
verwendeten Software. Die SKOS trägt einen<br />
Teil der Realisierungs- und Lizenzkosten,<br />
weshalb den Mitgliedern die Plattform<br />
zu günstigen Konditionen angeboten werden<br />
kann. Die Kosten sind von der Grösse<br />
des Gemeinwesens oder der Organisation<br />
abhängig. Sie belaufen sich auf einmalig<br />
5000 bis 10 000 Franken für die Realisierung<br />
und jährlichen <strong>20</strong>00 bis 4000<br />
Franken für den Betrieb.<br />
•<br />
Dr. iur. Alexander Suter<br />
SKOS-Fachbereich<br />
Recht und Beratung<br />
In einer zusätzlichen Spalte<br />
können weitere Erläuterungen<br />
und Musterdokumente<br />
platziert werden.<br />
2/<strong>20</strong> <strong>ZESO</strong><br />
7
«Die Zahl der Anfragen ist in den<br />
letzten Wochen explodiert»<br />
INTERVIEW Auch ein in Sachen Katastrophen erfahrenes Hilfswerk wie das SRK, sah sich durch die<br />
Corona-Krise sehr gefordert, wie Christine Kopp, stv. Direktorin des SRK sagt. 5000 neue Freiwillige<br />
haben sich beim SRK gemeldet. «Diese Solidarität ist eindrücklich», sagt Kopp. Sie geht davon aus,<br />
dass als Folge der Corona-Krise sehr viele Menschen auf Hilfe angewiesen sein werden.<br />
«<strong>ZESO</strong>»: Das SRK als das grösste<br />
Schweizer Hilfswerk hat den Menschen<br />
in seiner über 150-jährigen Geschichte<br />
schon in vielen Katastrophen<br />
geholfen. War man also beim SRK auf<br />
die Corona-Krise gut vorbereitet?<br />
Christine Kopp: Es wäre sicher übertrieben<br />
zu sagen, wir wären gut vorbereitet gewesen.<br />
Natürlich haben wir eine Krisenplanung,<br />
wir haben auch Krisenstabsübungen<br />
gemacht. Aber dass wir eine solche Krise in<br />
der Schweiz tatsächlich erleben würden, damit<br />
hatte doch niemand wirklich gerechnet.<br />
Was uns vorbereitet hat, sind neben den<br />
Stabsübungen unsere Erfahrungen bei internationalen<br />
Einsätzen. Beim Ausbruch<br />
des Ebola-Virus in Westafrika beispielsweise,<br />
oder wenn wir die Grundversorgung<br />
nach Naturkatastrophen organisieren. Natürlich<br />
lassen sich diese Erfahrungen nicht<br />
einfach auf die Schweiz übertragen.<br />
Was war die grösste Herausforderung<br />
für das SRK in den letzten Wochen?<br />
Es mussten ganz neue Formen der Zusammenarbeit<br />
innerhalb des SRK generiert<br />
werden. Wir haben bereits Anfang<br />
März den Krisen-Führungsstab einberufen,<br />
um die Zusammenarbeit zu koordinieren.<br />
Unsere Fachleute aus der internationalen<br />
Katastrophenhilfe unterstützen uns<br />
jetzt bei der nationalen Arbeit. Wir haben<br />
die Zusammenarbeit mit den Rotkreuz-<br />
Rettungsorganisationen in den letzten<br />
Jahren intensiviert. Davon profitieren wir<br />
jetzt. Wir können die Samariterinnen und<br />
Samariter und Mitglieder des Militär-Sanitäts-Verbands<br />
des SRK, die über Kenntnisse<br />
in Pflege und Hygiene verfügen, im<br />
neuen Corona-Testzentrum in Bern einsetzen.<br />
Die meisten von ihnen sind beruflich<br />
nicht Gesundheitsfachleute; das hat den<br />
Vorteil, dass sie nun nicht im Gesundheitswesen<br />
fehlen. Das SRK verfügt über viele<br />
wichtige Kompetenzen, aber sie mussten<br />
für den aktuellen Bedarf koordiniert und<br />
eingesetzt werden. Das war die grosse Herausforderung<br />
der letzten Wochen.<br />
Eine Schwierigkeit bestand für das SRK<br />
wohl auch darin, dass viele freiwillige<br />
DAS SRK<br />
Das Schweizerische Rote Kreuz vereinigt wie<br />
kein anderes Hilfswerk eine Vielfalt von Aktivitäten<br />
in den Bereichen Gesundheit, Integration<br />
und Rettung unter einem Dach. Das SRK<br />
umfasst 24 Kantonalverbände, vier Rettungsorganisationen<br />
sowie die Geschäftsstelle SRK.<br />
Nur dank der rund 53 000 Freiwilligen kann<br />
das SRK seine humanitären Aufgaben erfüllen.<br />
Die soziale Integration der Verletzlichen ist<br />
einer der Schwerpunkte der Arbeit des SRK in<br />
der Schweiz.<br />
Helferinnen und Helfer zur Risikogruppe<br />
gehören. Hatten Sie noch genug<br />
Freiwillige zur Verfügung, um Ihre<br />
Dienstleistungen aufrechtzuerhalten<br />
und auf die Krise zu reagieren?<br />
Das war wirklich eine grosse Herausforderung.<br />
Vor allem der SRK-Fahrdienst<br />
wird fast ausschliesslich von Pensionierten<br />
übernommen – vor allem von Männern.<br />
Wir wollten diese für viele Menschen in<br />
der Schweiz wichtige Dienstleistung aufrechterhalten,<br />
haben uns auf medizinisch<br />
notwendige Fahrten konzentriert und eine<br />
Plattform eingerichtet, über die sich jüngere<br />
Freiwillige melden können. Wir unterstützen<br />
auch die App «Five up», die Freiwillige<br />
und Personen, die Hilfe benötigen,<br />
direkt miteinander in Kontakt bringt. Es<br />
engagieren sich neu viele Menschen als<br />
Freiwillige, die aufgrund des Lockdowns<br />
nicht arbeiten können. Rund 5000 neue<br />
Freiwillige haben sich bei uns gemeldet.<br />
Diese Solidarität ist eindrücklich.<br />
8 <strong>ZESO</strong> 2/<strong>20</strong>
Gab es Angebote, die das SRK nicht<br />
mehr durchführen konnte?<br />
Manche Angebote wie die Kurse dürfen<br />
zur Zeit nicht stattfinden. Der Besuchsdienst<br />
– Freiwillige gehen zu Betagten, reden<br />
mit ihnen oder machen ein Spiel mit<br />
ihnen – wurde weitgehend eingestellt. Diese<br />
Besuche sind natürlich nicht mehr sinnvoll,<br />
wenn die Älteren nicht einmal mehr<br />
von ihren Enkeln besucht werden dürfen.<br />
Unsere Rotkreuz-Kantonalverbände haben<br />
das Angebot angepasst. Freiwillige rufen<br />
jetzt an und sprechen am Telefon mit den<br />
Menschen, fragen nach, wie es ihnen geht<br />
und ob sie etwas brauchen. Und wir haben<br />
auch neue Dienstleistungen aufgebaut,<br />
den Einkaufsdienst zum Beispiel für Leute,<br />
die im Moment nicht einkaufen gehen<br />
können, weil sie krank oder in Quarantäne<br />
sind oder weil sie zur Risikogruppe gehören.<br />
Hier engagieren sich jetzt auch viele<br />
junge Leute.<br />
Gibt es eine grosse Nachfrage nach<br />
diesen Angeboten? Im Rahmen der<br />
Nachbarschaftshilfe entstanden<br />
schnell viele Angebote, die wenig<br />
wahrgenommen wurden.<br />
Das SRK hat via seine Dienstleistungen<br />
schon viele Kontakte mit Leuten, die Hilfe<br />
benötigen. Das SRK ist in diesem Sinne<br />
etabliert, da ist die Schwelle, das Angebot<br />
anzunehmen, wohl tiefer. In einer Kooperation<br />
mit unserem Partner Coop, der uns<br />
unter anderem bei «2 x Weihnachten» unterstützt,<br />
kaufen zum Beispiel unsere Freiwilligen<br />
für Risikogruppen ein und liefern<br />
die Einkäufe bis vor die Haustüre.<br />
Die Schwächsten der Gesellschaft<br />
bekommen die Auswirkungen der Corona-Krise<br />
mit voller Wucht zu spüren.<br />
Viele sind auf Unterstützung angewiesen.<br />
Sie fallen durch alle Maschen,<br />
trotz des Unterstützungspakets des<br />
Bundes. Viele haben sich mit existenziellen<br />
Problemen an die Sozialdienste<br />
gewandt, undsicher auch an das SRK.<br />
Ja, das SRK bietet mit der Einzelhilfe<br />
finanzielle Unterstützung für Menschen,<br />
die existentielle Probleme haben: Die eine<br />
Zahnarztrechnung nicht bezahlen können,<br />
Christine Kopp ist stv. Direktorin des Schweizerischen Roten Kreuz und Leiterin des<br />
Departements Gesundheit und Integration. <br />
Bilder: Palma Fiacco<br />
«Das SRK hat via<br />
seine Dienstleistungen<br />
schon<br />
viele Kontakte mit<br />
Leuten, die Hilfe<br />
benötigen.»<br />
die keine Wohnung haben und akut Hilfe<br />
benötigen. Die Zahl dieser Anfragen ist<br />
in den letzten Wochen explodiert. Es sind<br />
viele Niedriglohn-Branchen, wie Verkauf<br />
und Gastronomie, die auf Kurzarbeit umgestellt<br />
haben. Wenn der ohnehin schon<br />
tiefe Lohn durch Kurzarbeit noch tiefer<br />
wird, bekommen diese Menschen finanzielle<br />
Probleme. Das ist klassisch. In jeder<br />
Krise kommen diejenigen besonders unter<br />
Druck, die ohnehin in prekären Verhältnissen<br />
leben. Hier setzen wir mit unserer Einzelfallhilfe<br />
an.<br />
<br />
2/<strong>20</strong> <strong>ZESO</strong><br />
9
Eigentlich ist die Sozialhilfe das<br />
unterste Netz im Sozialversicherungsbereich.<br />
Doch auch durch dieses Netz<br />
fallen Menschen – offenbar immer<br />
öfter. Das wird gerade jetzt wieder<br />
deutlich spürbar.<br />
Die Sozialhilfe ist ein zentrales Element<br />
zur Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung.<br />
Unsere Einzelhilfe ist immer ergänzend<br />
zur Sozialhilfe und soll ein Leben in<br />
Würde unterstützen. Wir sind deshalb im<br />
Kontakt mit den Sozialdiensten und sprechen<br />
uns ab. Wir wollen die Leistungen<br />
der öffentlichen Sozialhilfe nicht duplizieren,<br />
sondern ergänzen. Das gleiche gilt für<br />
die Angebote von anderen Organisationen<br />
wie der Caritas. Dazu gehört auch, dass wir<br />
uns manchmal dafür einsetzen, dass die<br />
Sozialhilfe bestimmte Leistungen übernehmen<br />
muss.<br />
Eine Studie von SRK, Caritas und<br />
Heilsarmee zeigte vor ein paar Jahren,<br />
dass die private Hilfe immer mehr<br />
Aufgaben der Sozialhilfe übernimmt.<br />
Wie nimmt das SRK diese Entwicklung<br />
wahr?<br />
Wir ersetzen die Sozialhilfe nicht systematisch,<br />
das hat auch diese Studie gezeigt.<br />
Aber der finanzielle Spielraum wird<br />
für die Sozialhilfe kleiner und Handlungsspielräume<br />
werden weniger genutzt. Die<br />
Betroffenen werden in der Folge weniger<br />
beraten und unterstützt, wenn es darum<br />
geht, Möglichkeiten auszuschöpfen und<br />
Chancen zu nutzen im Hinblick auf die<br />
Arbeitsintegration. Hier ist eine Lücke entstanden.<br />
Das spüren wir. Diese Lücke füllen<br />
nun wir teilweise auf. Das betrifft auch<br />
gerade den Migrationsbereich. Die Sozialhilfe<br />
für vorläufig Aufgenommene wurde<br />
reduziert und ermöglicht kaum noch ein<br />
menschenwürdiges Leben.<br />
Eine andere Studie hat gezeigt, dass<br />
viele aus Scham keine Sozialhilfe beziehen,<br />
weil Sozialhilfebezug sehr negativ<br />
konnotiert ist. Auch das könnte<br />
«Sozialhilfe zu<br />
beziehen ist ein<br />
neuer Status, der<br />
für viele schwierig<br />
ist.»<br />
ein Grund dafür sein, dass sich Bedürftige<br />
häufig eher ans SRK wenden.<br />
Es ist sicher weniger stigmatisierend<br />
zum SRK zu gehen, und dort um Unterstützung<br />
zu ersuchen, als Sozialhilfe zu<br />
beantragen. Sozialhilfe zu beziehen ist<br />
ein neuer Status, der für viele schwierig<br />
ist. Aber wer nicht nur punktuell Hilfe benöti<br />
gt, sollte sich natürlich dennoch möglichst<br />
frühzeitig an die Sozialhilfeinstitutionen<br />
wenden.<br />
Wie beurteilen Sie grundsätzlich das<br />
System der Sozialhilfe? Erlaubt die<br />
Sozialhilfe ein Leben in Würde? Oder<br />
sehen Sie Bedarf für Verbesserungen?<br />
Die Sozialhilfe ist ein notwendiger und<br />
wirkungsvoller Grundpfeiler, damit Menschen<br />
nicht in die Bedürftigkeit gelangen.<br />
Das SRK ist deshalb im Vorstand der SKOS<br />
und engagiert sich auch öffentlich. Eine<br />
verlässliche Sozialhilfe ist für eine funktionierende<br />
Gesellschaft unabdingbar. Alle<br />
profitieren davon. Studien zeigen, dass die<br />
Gesundheit der reicheren Menschen in<br />
den Ländern besser ist, in denen es den Armen<br />
besser geht. Man muss also wirklich<br />
kein Altruist sein, um sich für das System<br />
Sozialhilfe auszusprechen.<br />
Bei den Sozialdiensten gingen im April<br />
die Gesuche um Unterstützung wieder<br />
zurück. Wie schätzen Sie die weitere<br />
Entwicklung ein?<br />
Wir gehen davon aus, dass die gesundheitlichen<br />
Auswirkungen des Coronavirus<br />
und die damit verbundenen Einschränkungen<br />
sicher noch länger spürbar sein<br />
werden. Die grossen Belastungen für die<br />
Sozialwerke und die sozialen Institutionen<br />
kommen erst auf uns zu. Viele hangeln sich<br />
wohl im Moment erst mal durch und versuchen<br />
irgendwie mit Einschränkungen<br />
über die Runden zu kommen. Ich gehe davon<br />
aus, dass die Krise über mehrere Jahre<br />
spürbar sein wird und vielen Menschen<br />
über längere Zeit zu schaffen machen wird.<br />
In 30 Ländern ist das SRK langfristig<br />
präsent und leistet jetzt vielerorts Nothilfe.<br />
Man ist also in der schwierigen<br />
Das SRK konnte dank guter Beziehungen<br />
Millionen von Schutzmasken importieren,<br />
die dann via Grossverteiler der<br />
Bevölkerung zur Verfügung stehen.<br />
10 <strong>ZESO</strong> 2/<strong>20</strong>
Situation, dass es sowohl im Inland als<br />
auch in den ärmsten Ländern gleichzeitig<br />
brennt.<br />
Wir sind international ebenfalls auf<br />
dem Gebiet der Gesundheit engagiert und<br />
müssen aktuell viele Programme umbauen.<br />
Es braucht jetzt zusätzliche Massnahmen:<br />
Nothilfe, Prävention, Information.<br />
Neu ist, dass wir zuerst hier in der Schweiz<br />
die hohen Ansteckungsraten hatten. Damit<br />
haben wir etwas Vorlauf. Falls sich<br />
die Pandemie in Afrika verbreitet, werden<br />
die dortigen Gesundheitssysteme nicht in<br />
der Lage sein, die Krise alleine zu bewältigen.<br />
Das gleiche gilt für die sozialen Systeme,<br />
die durch die Folgen der wirtschaftlichen<br />
Auswirkungen überfordert werden.<br />
Da wird noch viel auf uns zukommen. Wir<br />
hoffen, dass die Bereitschaft zu spenden,<br />
die sich im Moment natürlich aufs Inland<br />
konzentriert, auch für die Bewältigung der<br />
Krise im Ausland vorhanden ist.<br />
«Die grossen<br />
Belastungen für<br />
die Sozialwerke<br />
und die sozialen<br />
Institutionen kommen<br />
erst auf<br />
uns zu.»<br />
Die letzte grosse Pandemie erlebten<br />
wir vor 100 Jahren. Das SRK hat auch<br />
während der Spanischen Grippe viel<br />
medizinische Hilfe geleistet. War das<br />
damals ganz anders?<br />
Die Armee hatte damals 700 Rotkreuz-<br />
Krankenschwestern für die Notversorgung<br />
in den Spitälern aufgeboten. 70 von ihnen<br />
starben bei diesem Einsatz an der Spanischen<br />
Grippe. Auch damals fehlte es an<br />
Schutzmaterial, viele Rotkreuz-Organisationen<br />
nähten selbst Schutzmasken. Da sind<br />
wir heute wieder in einer ähnlichen Situation.<br />
Welche Lehren kann das SRK aus den<br />
Ereignissen und Erfahrungen der Krise<br />
schon ziehen, auch wenn sie noch<br />
nicht durchgestanden ist?<br />
Als SRK mussten oder durften wir mal<br />
wieder lernen, was es heisst zu improvisieren,<br />
schnell zu reagieren, neue Zusammenarbeitsformen<br />
zu suchen und unter<br />
prekären Bedingungen zu funktionieren.<br />
Der Markt der Schutzmasken ist ausser<br />
Kontrolle, die Preise sind enorm gestiegen<br />
und die Länder reissen sie sich gegenseitig<br />
aus den Händen. Hier konnte die Logistikeinheit<br />
des SRK als Teil der internationalen<br />
Rotkreuzbewegung den Bund bei der<br />
Bestellung und beim Einkauf von Schutzmaterial<br />
unterstützen. Die Knappheit an<br />
wichtigen Gütern ist für uns, anders als für<br />
viele andere Länder, eine ungewohnte Situation.<br />
Da muss man auch in der reichen<br />
Schweiz improvisieren, man kann nicht<br />
alles von Beginn weg perfekt machen, ein<br />
schrittweises Vorgehen ist sinnvoll. Gelernt<br />
haben wir meiner Meinung auch mal<br />
wieder, das sich eine gute, organisationsübergreifende<br />
Zusammenarbeit lohnt. Eine<br />
weitere Lehre, die wir aus der Krise ziehen<br />
können, ist die Bedeutung der internationalen<br />
Solidarität. Globale Probleme<br />
wie Pandemien machen nicht Halt an der<br />
Schweizer Grenze. Wir haben also ein ureigenes<br />
Interesse daran, weltweit zusammenzuarbeiten,<br />
um im Idealfall solche Krisensituationen<br />
verhindern zu können.<br />
Es gibt auch noch andere Krisen auf<br />
der Welt. Fehlt nun das Engagement<br />
für sie?<br />
Wir dürfen vor lauter Corona-Krise<br />
nicht vergessen, dass es auf der Welt noch<br />
viele andere Krisen gibt, wie zum Beispiel<br />
die Flüchtlingskrise. Die Zustände in den<br />
Flüchtlingslagern in Griechenland sind<br />
schrecklich, ebenso ist es die Situation vieler<br />
Geflüchteter zum Beispiel in Italien.<br />
Hier ist Covid nur ein weiteres Problem.<br />
Wir dürfen nicht die Augen verschliessen<br />
vor dieser humanitären Katastrophe. •<br />
Das Gespräch führte am 29.4.<strong>20</strong><strong>20</strong><br />
Ingrid Hess<br />
2/<strong>20</strong> <strong>ZESO</strong><br />
11
Bild: Palma Fiacco<br />
12 <strong>ZESO</strong> 2/<strong>20</strong> SCHWERPUNKT
Die Teilhabe von armutsbetroffenen<br />
Personen in Projekten der Sozialdienste<br />
ist wirkungsvoll – vorausgesetzt, dass ...<br />
Die Praxis zeigt: Massnahmen zur Armutsvorsorge und -bekämpfung wirken besser, wenn<br />
armutsgefährdete und -betroffene Personen an Massnahmen teilhaben, respektive wenn ihre<br />
Anliegen, Erfahrungen, Ideen und Expertisen (stärker) berücksichtigt werden. Eine Studie der<br />
Berner Fachhochschule für Soziale Arbeit zeigt unter welchen Bedingungen dies möglich ist.<br />
In Belgien begann die nationale Verwaltung des Sozialen und der<br />
Gesundheit im Jahr <strong>20</strong>04 armutsbetroffene Personen als «Experts<br />
du vécu» anzustellen. Daraufhin folgten zahlreiche lokale und regionale<br />
Sozialdienste diesem Ansatz: Armutsbetroffene Personen<br />
werden in die (Weiter-)Entwicklungen und Umsetzung von Massnahmen<br />
und Prozesse der Armutsbekämpfung durch befristete<br />
und unbefristete Anstellungen einbezogen (vgl. Seite 22). Solche<br />
und andere Projekte, die armutsbetroffene und -gefährdete Personen<br />
in die (Weiter-) Entwicklung und Umsetzung von Massnahmen<br />
und Prozesse der Armutsbekämpfung einbeziehen, gibt es in<br />
vielfältigen Gestaltungen und auf unterschiedlichen politischen<br />
Ebenen in Europa und weltweit.<br />
Allerdings fehlte bisher ein Instrumentarium, um diese Projekte<br />
zu identifizieren und um zu verstehen, unter welchen Voraussetzungen<br />
sie tatsächlich wirksam sind bzw. wann «echte»<br />
Teilhabe stattfindet. Auf Mandat des Bundesamts für Sozialversicherungen<br />
führte das Departement Soziale Arbeit der Berner<br />
Fachhochschule (BFH) in Kooperation mit den Fachhochschulen<br />
HES-SO Fribourg und Genf eine Studie durch, um einen Beitrag<br />
zur Schliessung dieser Forschungslücke zu leisten (vgl. Kasten).<br />
Ziel der Studie<br />
Ziel der Studie war es, eine breite Vielfalt an Projekten im Bereich<br />
der Prävention und Bekämpfung von Armut zu identifizieren, die<br />
unter Einbezug von betroffenen Personen realisiert wurden. Darauf<br />
basierend sollten Modelle der Systematisierung solcher Projekte<br />
entwickelt werden.<br />
In der Studie wurde auf Projekte fokussiert, die mit einer Reihe<br />
von Massnahmen darauf abzielen, Mängel in verschiedenen Lebensbereichen<br />
der Betroffenen zu beseitigen oder zu verhindern<br />
respektive die Handlungsspielräume der Betroffenen zu vergrössern.<br />
Solche Massnahmen umfassen Geld- oder Sachleistungen,<br />
immaterielle Unterstützung wie Beratungs- und Bildungsangebote,<br />
Sensibilisierungsmassnahmen sowie Massnahmen für spezifische<br />
Risikogruppen von Armut.<br />
Wirkungsvolle und «echte» Teilhabe<br />
Armut hat unterschiedliche Dimensionen, wozu insbesondere die<br />
finanzielle und materielle Dimension, sowie die soziale, kulturelle<br />
und gesundheitliche Dimension zählen. Zudem ist Armut oftmals<br />
mit fehlenden Möglichkeiten der politischen und gesellschaftlichen<br />
Teilhabe sowie mit gesellschaftlicher Stigmatisierung ver-<br />
bunden. Armut bedeutet in der Regel einen Mangel an Erfahrung<br />
von Selbstwirksamkeit und einen Mangel des Gefühls, in der Gesellschaft<br />
eine Stimme zu haben.<br />
Teilhabe von armutsbetroffenen Personen an Projekten bedeutet<br />
die aktive Beteiligung von Einzelnen und Gruppen an Entscheidungen,<br />
die das eigene Leben, eigene Angelegenheiten oder<br />
das Leben in der Gemeinschaft betreffen, respektive an der Suche,<br />
(Weiter-) Entwicklung und Umsetzung von damit verbundenen<br />
Massnahmen oder Lösungen. Teilhabe wird im Allgemeinen auf<br />
der Grundlage von Menschenrechten, demokratischen Rechten<br />
und Selbstbestimmungsrechten eingefordert.<br />
Diese Definition von Teilhabe innerhalb von Projekten lässt<br />
sich anhand unterschiedlicher Dimensionen fassen. Folgende zentrale<br />
Dimensionen werden mit Bezug auf Sozialdienste aufgelistet<br />
und veranschaulicht:<br />
• Gegenstand, an dem Betroffene teilhaben können<br />
Dazu zählt beispielsweise Teilhabe an der (Weiter-)Entwicklung<br />
von Strukturen und Prozessen von Sozialdiensten.<br />
• Zeithorizont und strukturelle Einbettung der Teilhabe<br />
Dies können in Sozialdiensten befristete oder permanente Gremien<br />
oder befristete oder unbefristete Anstellungen sein.<br />
• Projektverantwortung<br />
In Sozialdiensten übernehmen diese die Projektverantwortung<br />
selbst.<br />
• Intensität der Teilhabe<br />
In Sozialdiensten sind dies die Konsultation, Co-Konstruktion<br />
und/oder Mitentscheidung.<br />
• Übergeordnete Ziele der Teilhabe<br />
In Sozialdiensten werden Organisationsstrukturen und -prozesse<br />
und professionelle Praktiken bewertet und Verbesserungs-/<br />
Lösungsvorschläge eingebracht oder bei einer Anstellung von<br />
Betroffenen gleich umgesetzt.<br />
• Staatsebene bzw. Verortung<br />
Je nach Projekt findet die Teilhabe an (Weiter-)Entwicklung<br />
von Strukturen und Prozessen von Sozialdiensten kommunal,<br />
kantonal/regional oder national statt.<br />
Je nachdem, wie diese Dimensionen in der Praxis ausgestaltet<br />
werden, ist die Teilhabe von armutsbetroffenen Personen an Projekten<br />
mehr oder weniger wirksam. Deshalb ist es zentral, dass die<br />
Projektleitung zusammen mit den Beteiligten klärt, wie diese Dimensionen<br />
in einem einzelnen Projekt definiert werden sollen.<br />
14 <strong>ZESO</strong> 2/<strong>20</strong> SCHWERPUNKT
PARTIZIPATION<br />
Unterschiedliche Modelle von Teilhabe<br />
In der BSV-Studie wurden sechs Modelle der Teilhabe in der Armutsbekämpfung<br />
und -prävention, basierend auf einer Analyse<br />
von Beispielprojekten und auf den genannten zentralen Dimensionen<br />
von Teilhabe, gebildet.<br />
Armutsbetroffene und -gefährdete Personen haben die Möglichkeit,<br />
in sechs Politik- und Handlungsbereichen der Armutsprävention<br />
und -bekämpfung teilzuhaben:<br />
• an der Evaluation und (Weiter-)Entwicklung von Strukturen<br />
und Prozessen von öffentlichen und privaten Dienstleistungsorganisationen<br />
(Modell 1)<br />
• an der Ausbildung von Fachpersonen, die für die Implementierung<br />
von Armutspolitiken zuständig sind (Modell 2)<br />
• an der (Weiter-)Entwicklung von politischen und rechtlichen<br />
Grundlagen (Modell 3)<br />
• an öffentlichen/politischen Diskursen (Modell 4)<br />
• an gemeinschaftlichen Selbsthilfestrukturen (Modell 5)<br />
• an der Erarbeitung von Grundlagen der Teilhabe (Modell 6)<br />
Während es im Modell 6 darum geht, Grundlagen der Teilhabe<br />
bereitzustellen, die für die Umsetzung der anderen Modelle genutzt<br />
werden können, nehmen armutsbetroffene und -gefährdete<br />
Personen bei den ersten fünf Modellen an Strukturen, Prozessen<br />
und Grundlagen teil, die für das Handeln in verschiedenen Bereichen<br />
der Armutsprävention und -bekämpfung relevant sind,<br />
sowie an deren Entwicklung und Optimierung; an der Sensibilisierung<br />
der relevanten Akteure und der Öffentlichkeit für die Armutsproblematik<br />
und am Einfluss auf politische Entscheide.<br />
Beteiligung von armutsbetroffenen Personen in<br />
Sozialdiensten<br />
In den Sozialdiensten bieten sich drei Möglichkeiten (Untermodelle)<br />
für armutsbetroffene Personen an, sich an Prozessen und<br />
Massnahmen zu beteiligen:<br />
• in befristeten Gremien<br />
• in permanenten Gremien<br />
• in (un-)befristeten Anstellungen<br />
Zu den Gremien zählen beispielsweise die Kundenkonferenz<br />
in Basel oder das Austauschgefäss «Gemeinsam/Ensemble» (vgl.<br />
Seite 18). Sie sind je nach Entwicklungsstadium in der Pilotphase<br />
als befristet und bei einer Institutionalisierung als permanent zu<br />
bezeichnen sind.<br />
(Un-)befristete Anstellungen sind in der Schweiz bislang nicht<br />
bekannt, sodass das eingangs erwähnte Beispiel der «Experts du<br />
vécu en matière de pauvreté» aus Belgien als Referenzgrösse genannt<br />
werden kann.<br />
Ziel bei allen drei Beteiligungsmöglichkeiten ist es, die Wirksamkeit<br />
von Massnahmen, Prozessen und Projekten im Bereich<br />
der Armutsprävention oder -bekämpfung zu steigern. Die Hauptverantwortung<br />
für die Umsetzung dieser drei Projektmodelle liegt<br />
beim Sozialdienst (Projektverantwortung). Gleichzeitig können<br />
Betroffene oder Betroffenenvertretungen (zum Beispiel NGOs)<br />
ebenso die Umsetzung von entsprechenden Projekten anregen.<br />
Die ersten zwei Projektmodelle sind auf kommunaler Ebene<br />
verortet und das dritte zusätzlich auch auf nationaler Ebene<br />
(Staatsebene bzw. Verortung von Teilhabe). Allen Projektmodellen<br />
gemeinsam ist das Ziel, durch die Teilhabe von armutsbetroffenen<br />
Personen Organisationsstrukturen und -prozesse, sowie professionelle<br />
Praktiken zu bewerten und Verbesserungs- und Lösungsvorschläge<br />
einzubringen. Diese werden bei einer Anstellung von<br />
Betroffen mit ihnen zugleich umgesetzt (übergeordnete Ziele der<br />
Teilhabe). Parallel dazu können armutsbetroffene Personen in<br />
den ersten beiden Projektmodellen ihre Meinung oder Verbesserungsvorschläge<br />
einbringen (Konsultation) und teilweise auch<br />
enger mit den jeweiligen Fachpersonen zusammenarbeiten (Co-<br />
Konstruktion). Darüber hinaus ermöglicht die Anstellung in sozialen<br />
Organisationen armutsbetroffenen Personen, dass sie über die<br />
Konsultation und Co-Konstruktion bei bestimmten Diskussionspunkten<br />
mitentscheiden können (Intensitäten von Teilhabe). <br />
Dimensionen der Teilhabe und Mitwirkung veranschaulicht<br />
an Beispielmodellen in Sozialen Diensten<br />
Projektbeispiele<br />
Sechs Dimensionen<br />
von Teilhabe/Einbezug<br />
1 Zeithorizont und<br />
strukturelle Einbettung<br />
der Teilhabe<br />
2 Politik-/ Handlungsbereich<br />
3 Projektverantwortung<br />
4 Staatsebene bzw.<br />
Verortung<br />
5 Übergeordnete Ziele<br />
der Teilhabe<br />
6 Intensität der<br />
Partizipation<br />
Kundenkonferenz in<br />
Basel, «Gemeinsam/Ensemble»,<br />
in Biel<br />
Befristete und permanente<br />
Gremien<br />
( Weiter-)Entwicklung von Strukturen und<br />
Prozessen in Sozialen Diensten<br />
Soziale Dienste<br />
(top-down)<br />
· kommunal<br />
· kantonal/regional<br />
· Konsultation und/<br />
oder<br />
· Co-Konstruktion<br />
SCHWERPUNKT 2/<strong>20</strong> <strong>ZESO</strong><br />
Anstellung von<br />
«Experts du vécu<br />
en matière de pauvreté»<br />
(Belgien)<br />
(Un-) befristete<br />
Anstellung<br />
· kommunal<br />
· kantonal/regional<br />
· national<br />
· Bewertung von Organisationsstrukturen<br />
und -prozessen sowie von professionellen<br />
Praktiken<br />
· Einbringen von Verbesserungs-/Lösungsvorschlägen<br />
· z.T. Konsultation<br />
· Co-Konstruktion<br />
· Mitentscheidung<br />
15<br />
Wirkungspotential, Herausforderungen und Voraussetzungen<br />
bei befristeten Gremien<br />
Laut Erfahrungsberichten enthält der Einbezug von armutsbetroffenen<br />
Personen in Sozialdiensten verschiedene Wirkungspotenziale.<br />
Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass solche Prozesse mit Herausforderungen<br />
und Stolpersteinen verbunden sind. Damit kann das<br />
Wirkungspotential eingeschränkt werden. Dies kann vermieden<br />
werden, wenn notwendige Voraussetzungen geschaffen und garantiert<br />
werden.<br />
Zu den zentralen Wirkungspotentialen von befristeten Gremien<br />
zählen:<br />
1. Strukturen und Prozesse einer sozialen Organisation werden<br />
verbessert, indem ein besserer gegenseitiger Zugang von<br />
Fachpersonen und Betroffenen durch die befristeten Gremien<br />
ermöglicht wird. Dadurch werden andere Perspektiven auf<br />
Herausforderungen in der sozialen Organisation und Kenntnis<br />
derer Gründe gewonnen.<br />
2. Armutsbetroffene Personen werden von Massnahmen und Prozessen<br />
in sozialen Organisationen weniger ausgeschlossen.<br />
3. Das Wissen, die Erfahrung und Sichtweise von armutsbetroffenen<br />
Personen werden genutzt, indem deren Erfahrungswissen<br />
direkt eingeholt wird. Blinde Flecken in Massnahmen und Prozessen<br />
werden aufgedeckt und damit zielgerichtete Arbeiten,<br />
Interventionen und Programme geschaffen. Schliesslich können<br />
durch solche Gremien mehr armutsbetroffene Personen<br />
erreicht werden.<br />
4. Gegenseitiges Verständnis gegenüber Personengruppen aus<br />
Armutserfahrung und Politik kann gefördert und Missverständnisse<br />
können geklärt werden.<br />
5. Weiter können eine bessere Zusammenarbeit und Kommunikation<br />
zwischen armutsbetroffenen Personen und Fachkräften/<br />
Politik/Administration unterstützt werden.<br />
Zu den Herausforderungen bei befristeten Gremien zählen:<br />
1. Mangelnde zeitlichen Ressourcen, fehlende Unterstützung<br />
durch die Leitung, starre Verwaltungswege, die einzuhalten<br />
sind, oder fehlendes Wissen im konstruktiven Umgang mit armutsbetroffenen<br />
Personen.<br />
2. Eine weitere Herausforderung ist das Machtverhältnis und der<br />
Paternalismus, der in sozialen Organisationen besteht. Beispielsweise<br />
ist es für viele Fachpersonen herausfordernd, auf<br />
Augenhöhe zu kommunizieren, ohne die bestehenden Machtverhältnisse<br />
zu verschleiern.<br />
3. Zudem besteht die Gefahr, die armutsbetroffenen Personen auf<br />
ihre Armutserfahrungen zu reduzieren und damit zu stigmatisieren.<br />
4. Schliesslich zeichnen sich soziale Organisationen durch eine<br />
eher starre Planung und fehlende Flexibilität aus.<br />
Die Beteiligung von Armutsbetroffenen in den Sozialen Diensten hat<br />
Entwicklungspotenzial. <br />
Um diese Herausforderungen gezielt anzugehen und echte<br />
Teilhabe zu ermöglichen, können folgende Voraussetzungen als<br />
Orientierung dienen. Diese sind als Fragen formuliert und aufgelistet,<br />
welche die Fachpersonen und Leitungen von Sozialdiensten,<br />
angepasst an die jeweiligen Rahmenbedingungen eines geplanten<br />
Projekts, beantworten und für sich klären können:<br />
1. Repräsentanz: Wer repräsentiert wen? Wer wird repräsentiert?<br />
Für wen wird gesprochen?<br />
2. Gegenstand der Teilhabe: Woran wird teilgenommen?<br />
3. Rollen/Erwartungen: Was wird von einzelnen Personen erwartet?<br />
4. Intensität der Teilhabe: Ist eine Mitsprache, ein Mitentscheid<br />
oder sind andere Formen der Teilhabe vorgesehen?<br />
5. Ziele, die erreichbar sind: Was wird sich durch die Teilhabe der<br />
armutsbetroffenen Personen ändern?<br />
6. Prozesse/Form der Information: Wie werden alle Beteiligten regelmässig<br />
und nachvollziehbar über den Verlauf und den Stand<br />
bezüglich der Bearbeitung von Anliegen informiert?<br />
7. Evaluationen/Auswertungsprozesse: Wie wird über mögliche<br />
Hürden, Erfolge, Lernergebnisse etc. reflektiert? Wie werden<br />
gesetzte Ziele überprüft? Wie werden diese Resultate kommuniziert?<br />
8. Nutzen/Resultate der Teilhabe: Was hat sich tatsächlich geändert?<br />
Wie können Erfolgserlebnisse sichtbar gemacht werden,<br />
um dadurch die Motivation zur Teilhabe weiter zu stärken und<br />
den entsprechenden Prozess zu legitimieren?<br />
16 <strong>ZESO</strong> 2/<strong>20</strong> SCHWERPUNKT
PARTIZIPATION<br />
STUDIE UND TAGUNG<br />
Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) vergab<br />
an die BFH zwei Mandate: Im ersten Forschungsprojekt<br />
in Kooperation mit der HES-SO Fribourg und Genf wird der<br />
Begriff «Partizipation» geklärt. Weiter werden nationale und<br />
internationale Beispielprojekte identifiziert, analysiert und<br />
zu Teilhabemodellen verdichtet. Zudem wurden Wirkungspotentiale,<br />
Herausforderungen und Voraussetzungen für eine<br />
erfolgreiche Umsetzung formuliert. Die daraus resultierenden<br />
Empfehlungen zur Umsetzung der Modelle werden im zweiten<br />
Projekt «Praxishilfen» mit politischen Gemeinden und<br />
Betroffenen erarbeitet und an der nationalen Tagung «Einbezug<br />
und Beteiligung armutsbetroffener Menschen» nicht wie<br />
ursprünglich vorgesehen im September <strong>20</strong><strong>20</strong> sondern neu<br />
am 4. Februar <strong>20</strong>21 vorgestellt und diskutiert. Der Schlussbericht<br />
erscheint im Juni:<br />
Chiapparini, E., Schuwey, C., Beyeler, M., Reynaud, C., Guerry,<br />
S., Blanchet, N., & Lucas, B. (<strong>20</strong><strong>20</strong>). Modelle der Partizipation<br />
armutsbetroffener und -gefährdeter Personen in der Armutsbekämpfung<br />
und -prävention: Schlussbericht: Bundesamt für<br />
Sozialversicherungen (BSV).<br />
www.gegenarmut.ch<br />
Bild: Mila Hess<br />
Insbesondere in der Einführungs-/Aufbauphase eines befristeten<br />
Gremiums ist auf drei wichtige Aspekte zu achten:<br />
1. Genügend (finanzielle, personelle, fachliche und zeitliche) Ressourcen<br />
stehen zur Verfügung.<br />
2. Genügendes Durchhalte- und Überzeugungsvermögen aller<br />
Beteiligter ist nötig.<br />
3. Schliesslich ist zentral, das institutionelle Commitment eingeholt<br />
zu haben.<br />
Schlussfolgerungen<br />
Grundsätzlich lohnen sich Projekte in Sozialdiensten, in denen armutsbetroffene<br />
Personen in Prozesse und Massnahmen einbezogen<br />
werden. Dennoch ist nicht zu verkennen, dass deren Umsetzung<br />
voraussetzungsvoll ist. Für eine gelingende Umsetzung sind,<br />
abgeleitet von der Praxiserfahrung, drei Schritte zu empfehlen:<br />
1. Eine sorgfältige Planung und klare Kommunikation von Zielen,<br />
Rollen und Mitbestimmungsmöglichkeiten (Vorbereitungsprozess)<br />
2. Aufbau von Fachkompetenzen mit Blick auf den Einbezug von<br />
armutsbetroffenen Personen in Projekte (Weiterbildungen)<br />
3. Evaluation der Umsetzung und der Wirkungen von Teilhabeprozessen<br />
(Überprüfung der Ziele)<br />
Um armutsbetroffene und gefährdete Personen stärker in Prozesse<br />
und Massnahmen der Armutsbekämpfung zu beteiligen,<br />
ist es grundsätzlich nötig, dass dies in verschiedenen Politik- und<br />
Handlungsbereichen geschieht. Dazu zählt die Beteiligung an der<br />
Gründung und Stärkung von Interessenorganisationen, an der<br />
(Weiter-)Entwicklung von politischen und rechtlichen Grundlagen,<br />
an der (Weiter-)Ausbildung von Fachpersonen in sozialen,<br />
gesundheitlichen und politischen Bereichen, am öffentlichen Diskurs<br />
und Lobbying und an der Erarbeitung von Grundlagen der<br />
Teilhabe (vgl. Kasten). Insgesamt ist festzustellen, dass die Beteiligung<br />
in den Sozialen Diensten in der Schweiz vielversprechend ist<br />
und Entwicklungspotential hat.<br />
•<br />
Prof. Dr. Emanuela Chiapparini<br />
Berner Fachhochschule Departement Soziale Arbeit<br />
SCHWERPUNKT 2/<strong>20</strong> <strong>ZESO</strong><br />
Die Betroffenen beeinflussen die<br />
Prioritäten des Managements<br />
In Biel wird seit drei Jahren die betriebliche Realität in der Sozialhilfe zusammen mit<br />
Sozialhilfebeziehenden diskutiert und positiv verändert. Im Projekt «Gemeinsam/Ensemble» sitzen<br />
Sozialarbeitende und Sozialhilfebeziehende gleichberechtigt am Tisch und diskutieren im Auftrag<br />
der Abteilungsleitung zuvor gemeinsam definierte Themenkreise. Ziel ist, realisierbare Optimierungs-<br />
Vorschläge zu entwickeln. Für die Teilnehmenden ist dies sehr bereichernd und die Resultate der<br />
ersten zwei Runden führen für Mitarbeitende wie Sozialhilfebeziehende zu Optimierungen.<br />
Die Partizipation von Sozialhilfebeziehenden zur Mitgestaltung<br />
der Zusammenarbeit ist nicht neu. Für sehr kleine Sozialdienste<br />
war es durchaus üblich, dass Verbesserungsvorschläge kurze Wege<br />
hatten und in die Ausgestaltung der Alltagsrealität einfliessen<br />
konnten. Heute sind die Dienste grösser und die Wege etwas komplexer.<br />
Üblich und gut bekannt ist der Weg im Rahmen des Qualitätsmanagements.<br />
Durch «Befragungen» in Bezug auf die «Zufriedenheit»<br />
sowie durch «Ideen- und Kritik-Boxen» oder auch im<br />
Rahmen von Evaluationen werden Anliegen gesammelt und dann<br />
«inhouse» durch die betroffenen Dienste gewertet und in umsetzbare<br />
Massnahmen gewandelt. Das alles machen viele und ist auch<br />
nicht weiter neu. In der zweisprachigen Stadt Biel ist man einen<br />
Schritt weitergegangen. Ausschlag daür waren eine grössere Reorganisation<br />
der Abteilung Soziales und ein Leitungswechsel.<br />
«Ich wollte auch den Betroffenen<br />
eine Stimme geben und von ihnen<br />
lernen, was aus ihrer Sicht im machbaren<br />
Bereich positiv verändert werden<br />
könnte, um die Zusammenarbeit<br />
zwischen Sozialdienst und Sozialhilfebeziehenden<br />
zu verbessern.»<br />
Thomas Michel, Leiter Abteilung Soziales Biel<br />
Eine Anfrage für eine Masterarbeit von zwei Studierenden<br />
kam Thomas Michel, dem Leiter der Abteilung Soziales in Biel,<br />
gerade recht: Er beauftragte diese, das Thema «Partizipation» in<br />
Form eines Projektvorschlages auszuarbeiten. Die beiden haben<br />
diese Herausforderung angenommen und gemeinsam mit Betroffenen<br />
eine Auslegeordnung und Projektideen entwickelt. Diese<br />
Ideen wurden der Leitung der Abteilung durch die Sozialhilfebeziehenden<br />
präsentiert und übergeben. Leicht adaptiert wurde<br />
aus diesen Basisideen das kleine wirkungsorientierte Projekt «Gemeinsam/Ensemble».<br />
Im Herbst geht es jeweils mit dem Aufruf zur Mitwirkung los:<br />
Es ist gar nicht so einfach, Sozialhilfebeziehende zur Umgestaltung<br />
der Beratungs-Rahmenbedingungen zu motivieren. Das ist<br />
verständlich – schliesslich gibt es vielerlei Befürchtungen oder<br />
gar Ängste zu überwinden. Als guter Weg zur Rekrutierung von<br />
Betroffenen bieten sich die zahlreichen institutionellen Partner<br />
der Sozialhilfe an: kirchliche oder präventiv tätige Stellen, Arbeitsintegrations-Anbieter<br />
sowie andere Beratungsstellen sind aktive<br />
Partner im Sozialhilfeprozess. Sie beraten Sozialhilfebeziehende<br />
ergänzend oder subsidiär vorgelagert und Kritik am bestehenden<br />
System gehört bei ihnen zum Beratungsalltag. Ziel des Aufrufs:<br />
Eine überschaubare Gruppe von direkt betroffenen Einzelpersonen<br />
sollte in einen mehrteiligen Aushandlungs-Prozess einsteigen.<br />
Im ersten Durchlauf <strong>20</strong>18/<strong>20</strong>19 stand die Frage im Zentrum:<br />
«Was kann rund um die Anmeldung und die ersten Kontakte optimiert<br />
werden?» Der aktuelle Durchlauf von «Gemeinsam/Ensemble»<br />
<strong>20</strong>19/<strong>20</strong><strong>20</strong> bearbeitet die komplexere Frage «Was wären<br />
hilfreiche Angebote, um den Sozialhilfe-Alltag selbstbestimmt<br />
und kompetent zu bewältigen?»<br />
In fünf Sitzungen je à 3 Stunden wird unter der sachkundigen<br />
Leitung eines zweisprachigen und neutralen «externen» Moderators<br />
die Frage bearbeitet. Die Gruppe besteht aus einer Mehrheit<br />
von Sozialhilfebeziehenden und 2-3 Mitarbeitenden des Sozialdienstes.<br />
Am Start-Anlass nimmt der Abteilungsleiter selbst kurz<br />
teil. Einerseits um die Teilnehmenden kurz kennenzulernen und,<br />
wichtiger, um den Auftrag zu klären. Er erläutert also die Fragestellungen<br />
und verlässt dann den Kreis, damit sich die Runde frei<br />
von Management-Einflüssen den eigenen Ideen widmen kann.<br />
Nach einer Auslegeordnung der Anwesenden werden Themen<br />
festgelegt, an denen in den Blöcken 2 und 3 diskutiert wird. Der<br />
Moderator sorgt für die in Biel nötige Übersetzung und die Ausrichtung<br />
auf das Ziel.<br />
Am Ende des 4. Blockes kehrt der Abteilungsleiter zurück und<br />
die teilnehmenden Sozialhilfebeziehenden stellen ihre Vorschläge<br />
mutig und hoffnungsvoll im Rahmen einer Präsentation vor.<br />
Zwischen Block 4 und 5 braucht es etwas Abstand, weil die Vorschläge<br />
da in der Abteilung diskutiert und im Management auf<br />
ihre Umsetzbarkeit bewertet werden. Der Block 5 ist dazu da, dass<br />
der Abteilungsleiter den Teilnehmenden mitteilt, was umgesetzt<br />
werden soll und was nicht. Dieser Block steht dieses Jahr infolge<br />
18 <strong>ZESO</strong> 2/<strong>20</strong> SCHWERPUNKT
PARTIZIPATION<br />
«Ich freue mich auf jedes Treffen von<br />
Gemeinsam/Ensemble. Ich darf mitgestalten<br />
und erleben, wie sich Menschen<br />
mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten<br />
und Lebensgeschichten gemeinsam in<br />
gegenseitiger Achtung aufmachen, einen<br />
Teil ihrer Lebensrealität für andere und<br />
sich selbst zu verbessern. Dies gelingt<br />
auch, weil die erarbeiteten Vorschläge<br />
vom Sozialdienst ernsthaft aufgenommen<br />
und wenn immer möglich weiterbearbeitet<br />
und umgesetzt werden.»<br />
Martin Zeller, Moderator und Coach, Triaspect AG, Biel<br />
der Corona-Massnahmen noch aus. Letztes Jahr konnten aber 12<br />
Massnahmen umgesetzt werden, welche die Zusammenarbeit<br />
während der Startphase für alle Betroffenen angenehmer machen.<br />
Die zweite Hälfte des 5. Blockes gehört – wiederum ohne Abteilungsleitung<br />
– einer Evaluation des Prozesses sowie der Sammlung<br />
von möglichen Themen für künftige Durchführungen von<br />
«Gemeinsam/Ensemble».<br />
Damit dieses kleine Gebilde nicht nur in der Theorie, sondern<br />
auch in der Praxis funktioniert, braucht es jemanden, der die Ausschreibung,<br />
die Organisation und die Aktennotizen übernimmt<br />
sowie einen guten «neutralen» Ort für die Durchführung. Die<br />
Organisation in Biel wird jeweils einer Praktikantin übertragen,<br />
welche für dieses Projekt direkt mit der Abteilungsleitung zusammenwirkt.<br />
Eine zentrale Rolle hat die Person, welche von aussen<br />
kommend die Moderation übernimmt. Es obliegt ihr, mit der<br />
Gruppe auf dem Weg zu bleiben und dafür zu sorgen, dass die<br />
« J'ai été agréablement surpris par<br />
l'entrain des bénéficiaires de l'aide<br />
sociale à participer dans un bon esprit<br />
et aux organisateurs d'avoir mis en<br />
œuvre une structure et une ambiance<br />
plus que favorable au bon déroulement<br />
des réunions. »<br />
Participant anonyme de « Gemeinsam/Ensemble »<br />
generellen Fragestellungen konkretisiert werden, ohne in der Diskussion<br />
bei Einzelfällen zu landen. Von den Mitwirkenden wurde<br />
dies sehr gut verstanden und es war erstaunlich, wie engagiert<br />
Ideen entwickelt und erarbeitet wurden.<br />
Die erste Runde von «Gemeinsam/Ensemble» hat sich mit<br />
der Startphase in der Sozialhilfe befasst und Veränderungen im<br />
Empfangsraum in Biel bewirkt. Es wurden Ideen zur Gestaltung<br />
und zum Zugang zu Informationen umgesetzt. Vom optimierten<br />
Internet-Auftritt bis zum Wasserspender, der die Wartezeit erträglich<br />
macht, wurden Vorschläge der Betroffenen realisiert. Noch<br />
in Arbeit ist die Einführung eines Ticketing-Systems. Auch im<br />
Laufe der zweiten Durchführung kamen gute Ideen zusammen.<br />
Diese werden zurzeit noch auf ihre Umsetzbarkeit hin geprüft.<br />
Es kann aber davon ausgegangen werden, dass der Informationsfluss<br />
durch gezielte Massnahmen weiter verbessert werden kann,<br />
womit die Mitwirkung und die Autonomie aller Betroffenen aus<br />
Sicht der Mitwirkenden im Projekt «Gemeinsam/Ensemble» gestärkt<br />
werden können. Beeindruckend im Projekt sind nicht nur<br />
die Resultate, sondern auch der Umgang der Betroffenen untereinander<br />
sowie die Erkenntnisse, welche im Dialog gegenseitig<br />
erlangt werden.<br />
«Worte und Gehör finden, Meinungen<br />
austauschen, ernst genommen werden<br />
– Gemeinsam/Ensemble trägt<br />
dazu bei, Abläufe zu verbessern. Die<br />
Teilnahme bedeutet für viele aber auch<br />
Anerkennung und Befähigung.»<br />
Martin Zeller, Moderator und Coach, Triaspect AG, Biel<br />
Ziel ist, «Gemeinsam/Ensemble» weiterzuführen. Evaluationen<br />
von aussen, via die Berner Fachhochschule BFH, helfen, dieser<br />
Entwicklung eine Stossrichtung zu geben. So wurden mit allen<br />
Betroffenen <strong>20</strong>19 ausserhalb des Projektes Einzelgespräche zur<br />
Evaluation geführt mit dem Ziel, ein Instrument zur Bewertung<br />
des Partizipations-Vorganges zu entwickeln. Bisher wurde auf jegliche<br />
Medienarbeit bewusst verzichtet. Die Mitwirkenden sollten<br />
nicht im Rampenlicht stehen, sondern ihre Wirkung auf Basis von<br />
Vertrauen und gegenseitigem Verstehen gemeinsam aufbauen.<br />
Wichtig dafür ist die Bereitschaft der Leitung, sich auf diesen Prozess<br />
einzulassen. Dann erhalten die gemachten Vorschläge die im<br />
Alltag oft fehlende Priorität, um tatsächlich umgesetzt zu werden.<br />
So entsteht Wirkung. <br />
•<br />
Emilie Clavel<br />
Abteilung Soziales Biel-Bienne<br />
SCHWERPUNKT 2/<strong>20</strong> <strong>ZESO</strong><br />
Sozialhilfebeziehende als<br />
Ausbildner für Soziale Arbeit<br />
Schon seit <strong>20</strong>04 propagiert die Internationale Vereinigung der Schulen für Sozialarbeit die Teilnahme<br />
von Armutserfahrenen an der Ausbildung als Qualitätskriterium. Das <strong>20</strong>12 gegründete internationale<br />
Netzwerk PowerUs unterstützt und veröffentlicht die Projekte mehrerer Länder. In der Schweiz hat<br />
die Hochschule für Soziale Arbeit Freiburg in einem Pilotprojekt Armutsbetroffene als Ausbildner<br />
eingestellt.<br />
In Nordeuropa und Kanada sind Betroffene seit vielen Jahren in<br />
der Lehre involviert, an der Ausarbeitung oder der Beurteilung von<br />
Programmen, der Durchführung von Prüfungen, den Zulassungsverfahren,<br />
der Supervision oder auch als Studierende oder Mitforschende.<br />
Erste Studien deuten darauf hin, dass eine solche Entwicklung<br />
einen bedeutenden Mehrwert sowohl für die<br />
Studierenden als auch für die Klientinnen und Klienten und die<br />
Lehrpersonen mit sich bringt. Die stärkere Gewichtung des Erfahrungswissens,<br />
das heute von vielen Analysten als unabdingbar in<br />
der Sozialen Arbeit betrachtet wird, erweist sich also auch bereits<br />
als entscheidend für die Ausbildung der zukünftigen Fachleute.<br />
Trotz der äusserst ermutigenden Ergebnisse und des Interesses<br />
an diesem Ansatz haben die Schulen für Soziale Arbeit in der<br />
Schweiz jedoch offenbar noch Mühe, Betroffenen einen über einen<br />
punktuellen Erfahrungsbericht hinausgehenden Platz in der<br />
Ausbildung zu geben. Die stärkere Teilhabe von Betroffenen bei<br />
der Ausbildung bedeutet einen eigentlichen Paradigmenwechsel,<br />
der diverse Anpassungen erfordert: von den Lehrpersonen<br />
die Ausarbeitung von neuen pädagogischen Methoden sowie die<br />
Übernahme neuer Rollen und von den Ausbildungsstätten die Anpassung<br />
ihrer administrativen Rahmenbedingungen und die Bereitstellung<br />
von zusätzlichen Mitteln. Ferner ist ein solcher Ansatz<br />
mit zahlreichen Herausforderungen verbunden. Dies durch die<br />
Infragestellung der Hierarchie zwischen den verschiedenen Wissenstypen<br />
oder in ethischer Hinsicht beispielsweise die Gefahr der<br />
Instrumentalisierung oder der stärkeren Stigmatisierung.<br />
Die durchgeführten Versuche in Sachen Partizipation von<br />
Klientinnen und Klienten an der Ausbildung müssen zwingend<br />
sichtbar gemacht werden, damit die gewonnenen Erfahrungen<br />
eine breitere Umsetzung dieses Ansatzes fördern können. Dieser<br />
Artikel berichtet über ein im Studienjahr <strong>20</strong>18-<strong>20</strong>19 an der<br />
Hochschule für Soziale Arbeit Freiburg (HSA-FR) durchgeführtes<br />
Pilotprojekt und stellt die wichtigsten Ergebnisse der Beurteilung<br />
durch sämtliche mitbeteiligten Personen vor.<br />
Das Projekt in Kürze<br />
Acht Sozialhilfebeziehende wurden für ein Semester als Ausbildner<br />
für ein Ausbildungsmodul eingestellt. Die Referentinnen und<br />
Referenten konnten ihr Erfahrungswissen an zehn Studierende im<br />
3. Bachelor-Jahr weitergeben, zusammen mit ihnen über den Nutzen<br />
dieses Wissens für die Berufspraxis sowie über mögliche Verbesserungen<br />
nachdenken. Sie beteiligten sich auch an der Evaluation<br />
der Studierenden bei der mündlichen Schlussprüfung.<br />
Mit Unterstützung von Berufsleuten aus dem Netzwerk der<br />
HSA-FR und drei Sozialdiensten aus der Agglomeration Freiburg<br />
konnte eine Gruppe von Leistungsbeziehenden für die Teilnahme<br />
am Projekt zusammengestellt werden. Bei den Abklärungsgesprächen<br />
konnten sie ihre Motivationen zur Teilnahme am Projekt<br />
darlegen. Genannt wurde: Sich durch die Vermittlung ihrer sehr<br />
konkreten Wirklichkeit an die «allzu oft nur theoretisch ausgebildeten»<br />
Studierenden nützlich machen; die seltene Gelegenheit ergreifen,<br />
ihre Gefühle bezüglich ihrer Situation oder der Haltung<br />
von Sozialarbeitenden mitzuteilen oder Anerkennung für ihre<br />
Kompetenzen und Erfahrungen zu erhalten:<br />
«Dass die Sozialarbeiterin der Meinung<br />
war, wir könnten etwas Sinnvolles<br />
zur Ausbildung beitragen, hat unser<br />
Selbstwertgefühl gestärkt.»<br />
Betroffener<br />
Doch der Einsatz hat bei den zukünftigen Referentinnen und Referenten<br />
auch Angst hervorgerufen: Einige zweifelten anfänglich<br />
daran, dass sie in einem solchen Kontext ihren Platz finden würden,<br />
oder dass sie als Betroffene tatsächlich etwas beitragen und<br />
den Diskussionen folgen könnten.<br />
Wichtigste Etappen des Ausbildungsmoduls<br />
Das ersten Treffen hatte zum Ziel, einen für den Austausch günstigen<br />
Rahmen zu schaffen: Zunächst ging es darum, sich persönlich<br />
kennenzulernen, um den Status als Studierende, Leistungsbeziehende<br />
oder Lehrende zu überwinden, dann darum, gemeinsam<br />
eine Charta für eine freie und vertrauensvolle Meinungsäusserung<br />
(insbesondere bezüglich Verschwiegenheit, Wertfreiheit und<br />
Recht zu schweigen) zu gestalten, und schliesslich darum, die<br />
Gleichwertigkeit des Wissens aller zu betonen.<br />
Die Erfahrungsberichte standen im Zentrum des Moduls. Jeder<br />
Referent, jede Referentin konnte sich dazu äussern, was er oder<br />
sie im Zusammenhang mit der Sozialhilfe positiv oder negativ beurteilte.<br />
Anschliessend wurden diese individuellen Realitäten gemeinsam<br />
von den Studierenden und den Referierenden analysiert<br />
mit dem Ziel, gemeinsam zentrale Themen herauszuarbeiten. Auf<br />
<strong>20</strong> <strong>ZESO</strong> 2/<strong>20</strong> SCHWERPUNKT
PARTIZIPATION<br />
Als erstes mussten die Beteiigten ihren jeweiligen Status als Studierende, Lehrende, Sozialhilfeempfangende zu überwinden.<br />
<br />
dieser Grundlage einigten sie sich dann auf zwei Themen, die sie<br />
vertiefen wollten und von denen aus sie mögliche Verbesserungen<br />
für die Berufspraxis entwickeln konnten. In diesem Prozess zur<br />
Festlegung der Prioritäten zeigte sich der gemeinsame Wunsch,<br />
die Bedeutung der Haltung der Sozialarbeitenden in der Zusammenarbeit<br />
sowie die Auswirkungen der Sozialhilfe auf die vielseitigen<br />
Aspekte des Lebens der betroffenen Personen besser zu<br />
verstehen.<br />
In einem letzten Schritt wurden die Studierenden und die<br />
Referierenden aufgefordert, relevante Aktionen im Sinn der festgestellten<br />
Verbesserungsmöglichkeiten zu entwickeln. So zeigte<br />
beispielsweise eine Gruppe auf, dass es im Kanton Freiburg für<br />
Menschen mit grossen Schwierigkeiten in der Beziehung zum<br />
Sozialarbeiter keinen neutralen Gesprächspartner gibt. Aufgrund<br />
dieser Erkenntnis wandte sich die Gruppe an den Berufsverband<br />
Trait d’Union, um mit dessen Mitgliedern über die Einrichtung<br />
einer kostenlosen Anlaufstelle nachzudenken.<br />
Ergebnisse<br />
Bei der Beurteilung des Prozesses haben die Studierenden insbesondere<br />
hervorgehoben, was sie bezüglich Abbau ihrer Vorurteile<br />
gegenüber den betroffenen Menschen und Legitimitität von Erfahrungswissen<br />
in den Referaten gelernt hatten:<br />
«Der Austausch mit den Referentinnen<br />
und Referenten hat uns bewiesen,<br />
dass sie Wissen einbringen, dass sie Experten<br />
ihrer Situation sind.»<br />
Studierender<br />
Die Studierenden sind sich auch bewusst geworden, was es konkret<br />
heisst, von der Sozialhilfe zu leben, was das institutionelle System<br />
für Gewalt hervorbringen kann und was für Auswirkungen<br />
berufliche Haltungen auf das Leben und die Gefühle der Leistungsbeziehenden<br />
haben können:<br />
«Wir haben schon vorher in der<br />
Ausbildung gelernt, dass wir<br />
empathisch sein müssen, doch dieses<br />
Modul bringt einen dazu, weiter zu gehen,<br />
es tatsächlich zu verstehen.»<br />
Studierender<br />
Die Referierenden ihrerseits hoben hervor, dass das Projekt eine<br />
Quelle der Weiterentwicklung war, sowohl für sie selbst als auch<br />
für die Studierenden. Es brachte ihnen Achtung und Wertschätzung<br />
und erlaubte ihnen, der Zeit in der Sozialhilfe einen Sinn zu<br />
geben:<br />
«Als Sozialhilfebezüger ist man<br />
abhängig, unselbständig; deshalb war<br />
es sehr wichtig, an einem solchen Projekt<br />
teilzunehmen.»<br />
Betroffene<br />
SCHWERPUNKT 2/<strong>20</strong> <strong>ZESO</strong><br />
Bild: Palma Fiacco<br />
21<br />
Aus ihren Worten geht hervor, welche Macht das Teilen von Erfahrungen<br />
hat in Sachen gegenseitige Hilfe und Anerkennung oder<br />
Befreiung von Schuldgefühlen:<br />
«Dank der Teilnahme an diesem Projekt<br />
fühlen wir uns weniger allein, weniger<br />
schuldig, dass es so weit gekommen ist.<br />
Wir konnten den Studierenden zeigen,<br />
dass wir das Leben in der Sozialhilfe<br />
nicht gewählt haben».<br />
Betroffene<br />
Die Leiterinnen des Moduls schliesslich mussten ihre Unterrichtsmethoden<br />
anpassen, ihre Rolle weiterentwickeln weg von<br />
der reinen Wissensvermittlung hin zur Schaffung von Rahmenbedingungen,<br />
die echte Mit- bzw. Aufbauarbeit ermöglichen. Ihrer<br />
Meinung nach hat das Projekt bestätigt, wie bedeutsam das Erfahrungswissen<br />
der Leistungsbeziehenden ist. Bisweilen wirft dieses<br />
theoretische und/oder fachliche Kenntnisse über den Haufen, vor<br />
allem wenn diese nicht genügend in der Wirklichkeit verankert<br />
sind. Das Modul hat sie auch vom Potenzial eines solchen Prozesses<br />
bezüglich Abbau der sozialen Schranken und der Ungleichheiten<br />
zwischen den Akteuren der Sozialarbeit überzeugt, dies sogar über<br />
die Grenzen der Ausbildung hinaus. So wurde denn die Gruppe<br />
von Klienten, die im Modul referiert hatten, von der Direktion für<br />
Gesundheit und Soziales des Kantons Freiburg eingeladen, an der<br />
kantonalen Sozialhilfe-Tagung zu sprechen. In diesem Rahmen<br />
hatten die Leistungsbeziehenden zum ersten Mal die Möglichkeit,<br />
mit den zahlreichen Akteuren der Sozialhilfe auszutauschen. Offenbar<br />
hat ihnen die Bildung eines Kollektivs innerhalb einer Ausbildungsstätte<br />
die nötige Sichtbarkeit und Legitimität verschafft,<br />
um zu neuen Gesprächspartnern auf politischer Ebene zu werden.<br />
Herausforderungen<br />
Die von allen Beteiligten festgestellte wichtigste Schwierigkeit für<br />
das Projekt war der Mangel an Zeit für manche Etappen. Grund<br />
für die knappen Zeitressourcen waren in erster Linie finanzielle<br />
Zwänge. Der Wunsch, das individuelle Wissen in kollektives Wissen<br />
überzuführen, erforderte, dass mehrere Referierende für die<br />
gleiche Unterrichtsperiode entlohnt werden mussten. Somit musste<br />
die Anzahl Sitzungen eingeschränkt werden, wenn das zur Verfügung<br />
stehenden Budget (das gegenüber den traditionellen Modulen<br />
allerdings aufgestockt wurde) eingehalten werden sollte. Die<br />
Literatur bestätigt, dass die Zeit bei einem solchen Vorgehen ein<br />
entscheidender Faktor ist, insbesondere um Vertrauensbeziehungen<br />
herzustellen und Alibi-Teilnahmen zu verhindern. Mit Blick<br />
auf die Fortführung des Projekts im Herbst <strong>20</strong><strong>20</strong> müssen methodische<br />
und finanzielle Lösungen gefunden werden.<br />
Die Studierenden gaben an, dass sie sehr unsicher waren bezüglich<br />
des Verhaltens gegenüber den Referierenden in den Momenten<br />
der Diskussion oder des Mit-Aufbaus. Sie befürchteten oft,<br />
zu viel Platz einzunehmen, etwas von den Leistungsbeziehenden<br />
als unpassend oder verletzend Empfundenes zu sagen oder zu tun.<br />
Die Leiterinnen teilten diese Besorgnis, denn für sie war es<br />
zentral, dass die Teilnahme am Modul keine Stigmatisierung oder<br />
zusätzlichen Schwierigkeiten für die Betroffenen mit sich brachte.<br />
Letztere sollten gleich behandelt werden wie alle anderen schulexternen<br />
Dozenten. Doch dieser Grundsatz stiess oft an Grenzen. So<br />
war es beispielsweise gar nicht so harmlos, Hilfe anzubieten oder<br />
einen Kaffe zu spendieren, da dies als Herablassung oder Nicht-<br />
Wahrnehmung ihrer Selbständigkeit hätte interpretiert werden<br />
können. Desgleichen war das Anliegen nach Wahrung ihrer Anonymität<br />
innerhalb der Schule oft verbunden mit der Angst, dass<br />
gewisse Referierende dies als mangelnde Wertschätzung empfinden<br />
könnten.<br />
Angesichts solcher Fragen ist entscheidend, zu kommunizieren,<br />
sich kennenzulernen, um den bisweilen widersprüchlichen<br />
Wünschen und Bedürfnissen gerecht werden zu können. Dank<br />
den Beziehungen, die insbesondere auch in den wertvollen informellen<br />
Momenten geknüpft wurden, konnte die ganze Gruppe am<br />
Schluss mit viel Humor mit der zu Beginn der Zusammenarbeit<br />
sehr präsenten Angst vor einem Fauxpas umgehen.<br />
Zukunftsaussichten<br />
Trotz der bewältigten oder noch zu bewältigenden Herausforderungen<br />
bestätigt dieses Projekt, wie wichtig es ist, dem Erfahrungswissen<br />
der Leistungsbeziehenden in der Ausbildung in Sozialer<br />
Arbeit mehr Gewicht zu geben. Wenn das Stadium der<br />
vereinzelten Versuche überwunden werden soll, muss dieser Ansatz<br />
unbedingt nachhaltiger und struktureller in den (Grund- und<br />
Weiter-) Bildungs- und Forschungsprogrammen verankert werden.<br />
So könnten beispielsweise in den Lehranstalten permanente<br />
Gremien mit Betroffenen geschaffen werden, die den längerfristigen<br />
Aufbau von Partnerschaften für schrittweise, vielfältige und<br />
gegenseitig bildende Kooperationen ermöglichen.<br />
Und schliesslich müssten auch die leitenden Instanzen der<br />
Schulen angepasst werden, damit Klientinnen und Klienten<br />
sich mit dem gleichen Status daran beteiligen können wie die<br />
Fachleute oder die Studierenden. Denn die Ausbildungen können<br />
nur besser werden, wenn sie sich auch auf die Sichtweise<br />
der Klientinnen und Klienten der Sozialen Arbeit stützen. Eine<br />
stärkere Handlungsfähigkeit der Betroffenen erfordert echte Veränderungen<br />
auf der Ebene der Machtverhältnisse über die Stärkung<br />
der individuellen Ressourcen hinaus. Deshalb sollten die<br />
Sozialarbeitenden unbedingt schon bei der Ausbildung mit den<br />
Leistungsbeziehenden zusammenarbeiten, um ein für die Kooperation<br />
offenes berufliches Selbstverständnis zu entwickeln. •<br />
Sophie Guerry & Caroline Reynaud (Leiterinnen),<br />
Karine Donzallaz (Referentin)<br />
22 <strong>ZESO</strong> 2/<strong>20</strong> SCHWERPUNKT
Gemeinsam mit Menschen mit<br />
Armutserfahrung forschen<br />
PARTIZIPATION<br />
Die Bewegung ATD Vierte Welt stellt fest, dass gerade im Bereich der Armutsbekämpfung und<br />
-forschung in vielen Fällen weiterhin über statt mit armutsbetroffenen Menschen entschieden wird.<br />
So werden sie für Forschungsarbeiten zwar regelmässig über ihre Meinung und Erfahrungen befragt,<br />
die Schlüsse werden jedoch meist von anderen Personen gezogen.<br />
Mit dem partizipativen Forschungsprojekt «Armut – Identität –<br />
Gesellschaft» (<strong>20</strong>19 – <strong>20</strong>21) versucht ATD Vierte Welt einen neuen<br />
Weg zu gehen. Was dieses Projekt von herkömmlichen Forschungsprojekten<br />
im Bereich der Armutsbekämpfung<br />
unterscheidet, ist die Tatsache, dass die Forschung nie über, sondern<br />
mit jenen Menschen durchgeführt wird, die am direktesten<br />
mit dem Thema konfrontiert sind. So sind in jeder Phase des Projekts<br />
Menschen mit Armutserfahrung beteiligt – von der Definition<br />
der Forschungsfrage bis zur Analyse und Interpretation der Ergebnisse.<br />
Die langjährige Erfahrung der internationalen Bewegung<br />
ATD Vierte Welt zeigt, dass nur durch die gemeinsame Herangehensweise<br />
und den vollwertigen Miteinbezug direkt betroffener<br />
Personen Wege gefunden werden können, um würdevolle und<br />
nachhaltige Verbesserungen zu erreichen.<br />
Aus der Geschichte lernen<br />
Unter dem Begriff «fürsorgerische Zwangsmassnahmen» wurden<br />
bis ca. 1981 in der Schweiz behördliche Massnahmen praktiziert,<br />
die zu drastischen Eingriffen in das Leben der betroffenen Personen<br />
führten. Stark davon betroffen waren insbesondere Menschen<br />
und Familien, die in Armut lebten. Obwohl sich die Gesetzeslage<br />
seither geändert hat, zeigen die Erfahrungen von Mitgliedern von<br />
ATD Vierte Welt, dass es auch heute Menschen gibt, die seit Jahren<br />
nicht aus der Armut herauskommen und die heutigen «fürsorgerischen»<br />
Massnahmen als Kontrolle und Abhängigkeit erleben, die<br />
sie in ihrer Würde verletzen und daran hindern als vollwertige Akteure<br />
wahrgenommen zu werden.<br />
DIE BEWEGUNG ATD VIERTE WELT<br />
Die internationale Bewegung ATD Vierte Welt («Agir Tous pour<br />
la Dignité», Gemeinsam für die Menschenwürde) ist eine<br />
Nichtregierungsorganisation ohne religiöse oder politische Zugehörigkeit.<br />
Ihr Ziel ist die Überwindung der Armut zusammen<br />
mit Menschen, die diese erleben. Seit 1967 in der Schweiz<br />
präsent, bringt die Bewegung Menschen mit unterschiedlichem<br />
sozialem und kulturellem Hintergrund zusammen, um<br />
gemeinsam über Armut und soziale Ausgrenzung nachzudenken,<br />
zu lernen und zu handeln. Die Bewegung beruht auf einer<br />
horizontalen Organisationskultur, bei der zudem in möglichst<br />
allen grundlegenden Entscheidungen armutserfahrene Menschen<br />
beteiligt sind.<br />
www.atd-viertewelt.ch<br />
Das Projekt «Armut – Identität – Gesellschaft» setzt an dieser<br />
Stelle an. Es versucht die Beziehung zwischen Gesellschaft, Institutionen<br />
und Menschen in Armut besser zu verstehen und dazu<br />
beizutragen, dass sich Armut und erlebte Gewalt im Zusammenwirken<br />
mit Institutionen nicht mehr von Generation zu Generation<br />
wiederholt. Das vom Bundesamt für Justiz mitunterstützte<br />
Projekt dauert drei Jahre.<br />
Echte Partizipation braucht Zeit und Ressourcen<br />
Was auf den ersten Blick simpel klingen mag, ist in der Realität ein<br />
aufwändiger und langwieriger Prozess. Um echte Partizipation<br />
möglich zu machen, braucht es viel Zeit und Ressourcen von freiwilligen<br />
Mitarbeitenden, welche die involvierten Personen begleiten<br />
und gegenseitiges Vertrauen aufbauen können. Dies zeigt sich<br />
bei der Durchführung der «Volksuniversität Vierte Welt», einem<br />
zentralen Anlass des Projektes. Armutsbetroffene Jugendliche und<br />
Erwachsene können zusammenkommen und sich darin üben, ihre<br />
Erfahrungen und Gedanken auszudrücken und so ein kollektives<br />
Wissen aufzubauen. Die Durchführung einer solchen jährlichen<br />
nationalen, zweisprachigen «Volksuniversität Vierte Welt», bei der<br />
<strong>20</strong>19 rund 80 armutsbetroffene Personen aus verschiedenen<br />
Landesteilen der Schweiz zusammenkamen, ist nur möglich dank<br />
einer akribischen thematischen Vorbereitung in verschiedenen<br />
kleineren regionalen Gruppen.<br />
Das kollektive Wissen, das dabei erarbeitet wird, ist die Grundlage<br />
für eine kleinere Delegation von Personen mit Armutserfahrung,<br />
welche Ende jeden Jahres mit Gruppen von Fachleuten aus<br />
der Praxis und mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an<br />
einer «Wissenswerkstatt» («Atelier du Croisement des Savoirs») zusammenkommen,<br />
um ihr Wissen zu verbinden und zu kreuzen.<br />
An der Wissenswerkstatt im Jahr <strong>20</strong>19 nahmen 36 Personen<br />
teil: 12 aus der Wissenschaft, 12 aus der Berufspraxis und 12<br />
Personen mit unterschiedlichen Erfahrungen von Prekarität oder<br />
umfassender Armut.<br />
Dieser Prozess mit den beiden genannten Anlässen im Verlauf<br />
eines Jahres wird sich bis zum Ende des Projekts <strong>20</strong>22 noch<br />
zweimal wiederholen. Durch den Einbezug der verschiedenen<br />
Wissensarten und Perspektiven werden politische, institutionelle<br />
und akademische Partnerschaften geschaffen, mit dem Ziel, dass<br />
das gemeinsam erarbeitete, emanzipatorische Wissen tatsächlich<br />
anerkannt und aufgenommen wird und zu nachhaltigen Veränderungen<br />
führen kann.<br />
•<br />
SCHWERPUNKT 2/<strong>20</strong> <strong>ZESO</strong><br />
Michael Zeier<br />
ATD Vierte Welt<br />
Wie Experten mit Armutserfahrung<br />
Zugang und Qualität der öffentlichen<br />
Dienste optimieren<br />
In Belgien hat die Bundesstelle für die sozialen Integrationsprogramme einen äusserst innovativen<br />
Weg der Zusammenarbeit mit den schwächsten Mitgliedern der Gesellschaft beschritten. Dies mit<br />
dem Ziel, den offenbar tiefen Graben zwischen den Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung und<br />
den von Armut Betroffenen zu schliessen. Seit <strong>20</strong>04 werden in Belgien die sogenannten Experten<br />
mit Armutserfahrung (EmA) angestellt, um die sie betreffenden staatlichen Dienstleistungen zu<br />
verbessern.<br />
«Unser Ziel muss sein, allen in Armut lebenden Personen – einschliesslich<br />
denjenigen, die durch alle Maschen des sozialen Netzes<br />
fallen – ein Leben in Würde zu garantieren.» Mit diesen Worten<br />
verabschiedete die belgische Regierung <strong>20</strong>04 eine ehrgeizige<br />
Strategie. Das Thema Armut ist in Belgien zwar sehr präsent, Kontakte<br />
und Gespräche mit den Betroffenen sind jedoch rar. Entsprechend<br />
wenig ist über Erfahrungen, Schwierigkeiten und Hindernisse<br />
dieser Personen bekannt. Dem Regierungsbeschluss<br />
vorangegangen war ein weitreichendes Forschungsprojekt. Die<br />
wissenschaftliche Studie war zu dem Schluss gekommen, dass viele<br />
von den Behörden eingeführten Massnahmen inadäquat sind<br />
und zu einer Vertiefung der Kluft zwischen den staatlichen Behörden<br />
und der betroffenen Bevölkerung geführt haben.<br />
Um das zu ändern, beschlossen die belgischen Sozialbehörden<br />
neue Ansätze auszuprobieren und mit der Zielgruppe gemeinsam<br />
an der Verbesserung der staatlichen Dienstleistungen zu arbeiten.<br />
Das innovative Projekt hatte primär zwei Ziele: den Zugang zu den<br />
nationalen staatlichen Stellen zu verbessern und damit allen in<br />
Belgien lebenden Personen den Zugang zu den sozialen Grundrechten<br />
gemäss der Deklaration der Menschenrechte, welche jedem<br />
Menschen ein Recht auf ein Leben in Würde einräumt, zu<br />
garantieren.<br />
Beteiligung der Experten an der Projektdefinition<br />
Während der ersten Phase des Projekts stellte die mit der Umsetzung<br />
betraute Stelle für soziale Integration zunächst zwei Personen<br />
ein, die selbst in Armut lebten. Sie wurden aus einer grossen Gruppe<br />
von Betroffenen ausgewählt. Diese sogenannten «Experten mit<br />
Armutserfahrung» (EmA) wurden auf ihre neue Aufgabe gezielt<br />
vorbereitet und ausgebildet.<br />
Die Vertreterinnen und Vertreter der Stelle für soziale Integration<br />
zogen die EmA zunächst hinzu, um den Projektrahmen zu<br />
definieren. Nach dieser Initiationsphase wurden weitere EmA<br />
eingestellt und auch in andere Dienststellen der Verwaltung entsandt.<br />
Die Stelle für soziale Integration ist für die Koordination<br />
des Projekts zuständig, aber auch für die Unterstützung der EmA<br />
und anderer involvierter Personen. Ein Mentor und ein Coach<br />
werden den in anderen Verwaltungseinheiten beschäftigten EmA<br />
zugeteilt, um ihnen die Integration in den entsprechenden Abteilungen<br />
zu ermöglichen. Während der Mentor in erster Linie persönliche<br />
Unterstützung bietet, steht der Coach vor allem für Fragen<br />
im Zusammenhang mit der Arbeit zur Verfügung.<br />
Die EmA absolvierten vor ihrem Einsatz ein spezielles Ausbildungsprogramm,<br />
das sie auf die spezifischen Aufgaben vorbereitet,<br />
die sie in den jeweiligen Abteilungen übernehmen sollen. Die<br />
Ausbildung wird in Zusammenarbeit mit den verantwortlichen<br />
Behörden und der Bildungsabteilung der öffentlichen Verwaltung<br />
ausgearbeitet. Die EmA erhalten einen Arbeitsvertrag für eine Vollzeitanstellung.<br />
Ihr Gehalt entspricht dem eines Staatsbeamten.<br />
Ihre Arbeit leistet einen wichtigen Beitrag, um den Zugang von<br />
Armutsbetroffenen zu den staatlichen Leistungen zu verbessern.<br />
Im Einzelnen heisst das:<br />
• Die Schnittstelle im Kontakt mit der Zielgruppe wird neu gestaltet.<br />
Konkret sollten mehr zeitliche Ressourcen und mehr<br />
Raum für Rückzug zur Verfügung gestellt werden.<br />
• Die Betroffenen werden bei administrativen Problemen unterstützt,<br />
beispielsweise beim Ausfüllen der Formulare oder bei<br />
Anträgen um Unterstützung, beispielsweise nach einem Krankenhausaufenthalt,<br />
sowie die Begleitung bei Problemen mit<br />
dem Verwaltungsgericht.<br />
• Verbesserung der Qualität der staatlichen Leistungen. Hierzu<br />
sollen die EmA Dokumente und andere Kommunikationsmittel<br />
analysieren und verbessern.<br />
DER SPP INTÉGRATION SOCIALE<br />
Die Stelle für soziale Integration in der belgischen Verwaltung<br />
(service public fédéral de programmation intégration sociale,<br />
SPP IS) wurde <strong>20</strong>03 ins Leben gerufen. Ihre Aufgabe ist es, eine<br />
würdige Existenz für jeden in Armut lebenden Menschen sicherzustellen.<br />
Seither setzt sich der SPP IS für das Recht auf soziale<br />
Integration ein, indem er auch den Menschen ein Leben in<br />
Würde ermöglicht, die durch alle Maschen des sozialen Netzes<br />
gefallen sind und die unter prekären Umständen leben müssen.<br />
Er bekämpft Armut und sozialen Ausschluss in all seinen<br />
Erscheinungsformen, setzt sich für sozialen Zusammenhalt<br />
und Entwicklung der Grossstädte ein und sichert die soziale<br />
Integration durch die Sicherstellung der Sozialhilfe.<br />
24 <strong>ZESO</strong> 2/<strong>20</strong> SCHWERPUNKT
PARTIZIPATION<br />
Ziel des Projekts ist, den tiefen Graben zwischen den staatlichen<br />
Dienstleistungen und den von Armut Betroffenen zu überbrücken. <br />
Bild: Hape Bolliger, pixelio <br />
• Die Information der Öffentlichkeit über die Rechte von Obdachlosen.<br />
Definitive Einführung der Partizipation<br />
Die Arbeiten mit den EmA zeitigten Erfolge. Nach zwei Programmperioden<br />
wurde das Projekt daher abgeschlossen und die Methode<br />
in einen dauerhaften Betrieb übergeführt, der sich nun «Stelle für<br />
Experten mit Armutserfahrung 2.0» nennt. Seither ist der Ansatz<br />
der Partizipation – also die Zusammenarbeit mit den Experten mit<br />
Armutserfahrung – Teil der staatlichen Verwaltung Belgiens.<br />
Hindernisse<br />
Dennoch begegnete das Projekt im Laufe der Umsetzung auch einer<br />
Reihe von Hindernissen:<br />
Die Sparpolitik bei den öffentlichen Haushalten liess wenig<br />
Spielraum für Investitionen in innovative Experimente. Auch<br />
stiessen sich die Neuerungen an der in der Verwaltung eher verbreiteten<br />
Zurückhaltung gegenüber Veränderungen. Viele Beamte<br />
taten sich schliesslich auch schwer, die Expertise und die meist<br />
nicht akademisch fundierten Kenntnisse der EmA anzuerkennen.<br />
Sorgen bereitete den Projektverantwortlichen ferner die überdurchschnittlichen<br />
Absenzen der EmA von der Arbeit. Im Jahr<br />
<strong>20</strong>18 wiesen die EmA durchschnittlich 36 Krankentage auf. Vier<br />
EmA fehlten während Monaten. Es wurde im <strong>20</strong>19 daher eine<br />
Untersuchung eingeleitet, welche die psychosozialen Effekte, die<br />
mit der Arbeit als EmA verbunden sind, untersuchen sollte. Eine<br />
weitere Erschwernis ist die Tatsache, dass der Beitrag der Arbeit<br />
der EmA zu den Neuerungen schwer zu erkennen, geschweige<br />
denn zu quantifizieren ist. Auch die Veränderungen der Organisationskultur<br />
innerhalb der involvierten Stellen als Folge der Zusammenarbeit<br />
des Personals mit den EmA zu bemessen, war nicht<br />
einfach. Dennoch: Die betroffenen Nutzer wie auch die involvierten<br />
Stellen und Organisationen, die ihre Prozesse und Dienstleistungen<br />
erneuert hatten, bewerteten die Arbeit der EmA positiv.<br />
Studien bestätigen positive Wirkung<br />
Auch mehrere Forschungsarbeiten zur Methode der Partizipation<br />
kamen zu dem Schluss, dass die Zusammenarbeit mit den EmA<br />
positive Effekte zeigte und eine Reihe von Resultaten brachte. Eine<br />
Bilanz einer Fallstudie, die auf der Website der Beratungsorganisation<br />
«Governance International» publiziert wurde, listet eine Reihe<br />
von Erfolgen auf:<br />
Die beteiligten Organisationen sind sich der Schwierigkeiten,<br />
denen Personen mit Armutserfahrung begegnen, deutlich bewusster;<br />
die Qualität der Dienstleistung der bürgernahen Stellen<br />
wurde erheblich verbessert. So wurde im Informationsdienst der<br />
belgischen Finanzverwaltung ein EmA angestellt, damit Ratsuchende<br />
in schwierigen Lagen bei ihm Hilfe und Tipps erhalten<br />
können. Ferner wurden die im Wartesaal verfügbaren Informationen<br />
verbessert und vereinfacht. Per Video erhalten die Wartenden<br />
hier bereits viele Informationen, was die Beratung am Ende vereinfacht.<br />
Die Angestellten betrachten die Besucher jetzt nicht<br />
mehr als Fälle, sondern vielmehr als Personen, die das Recht auf<br />
diese Dienstleistung haben. Und schliesslich konnten zahlreiche<br />
Personen dank der Arbeit der EmA ihr Recht auf Leistungen der<br />
Sozial-, Renten- oder anderer Versicherungen wahrnehmen. Inzwischen<br />
wurde auch noch ein Projekt der Zusammenarbeit mit<br />
EmA im Gesundheitsbereich lanciert. Ziel des Projekts ist es, den<br />
Zugang zur Gesundheitsversorgung von Armutsbetroffenen sowie<br />
ihre Kenntnisse zu Gesundheitsfragen zu verbessern. •<br />
SCHWERPUNKT 2/<strong>20</strong> <strong>ZESO</strong><br />
Ingrid Hess<br />
25<br />
«Es hat mich dazu gebracht, über<br />
mich selbst hinauszuwachsen»<br />
NACHGEFRAGT Artias hat in Zusammenarbeit mit der Loterie romande, den Sozialämtern der<br />
Westschweizer und Berner Kantone sowie einigen Westschweizer Sozialdiensten ein Pilotprojekt<br />
zur Beteiligung von Langzeit-Sozialhilfeempfängern durchgeführt. Die Artias-Zentralsekretärin<br />
Martine Kurth und Stéphane, getrennt lebender Vater, kaufmännischer Angestellter und ergänzend<br />
Sozialhilfeempfänger, sagen, was das gebracht hat.<br />
«<strong>ZESO</strong>»: Was wollte die Artias mit dem Partizipationsprojekt<br />
erreichen?<br />
Martine Kurth: Die ersten Überlegungen verfolgten ein zweifaches<br />
Ziel: Einerseits wollten wir von den Betroffenen erfahren,<br />
was man bei der Begleitung auf Distanz anders bzw. besser machen<br />
könnte; andererseits waren wir überzeugt, dass mit einer<br />
Gruppenarbeit das Zugehörigkeitsgefühl für die Teilnehmenden<br />
gestärkt werden könnte, ihr Gefühl als Staatsbürgerinnen und<br />
Staatsbürger und damit das gesellschaftliche und demokratische<br />
Engagement von Menschen in prekären Lebenslagen<br />
gefördert würde.<br />
Wie wurde das Projekt angegangen?<br />
Martine Kurth: Es wurden etwa 60 Sozialhilfebeziehende ausgewählt<br />
und auf freiwilliger Basis von den Partnersozialdiensten<br />
des Projekts und den Mitgliedern des Projektausschusses<br />
eingestellt. Es wurden dann vier Gruppen an verschiedenen Orten<br />
der Westschweiz gebildet, die in der ersten Phase des Projekts<br />
während etwa neun Monaten mit einem Animationsteam<br />
zusammenarbeiteten. Es stellte sich dann schnell heraus,<br />
dass in allen Gruppen immer wieder die Frage auftauchte, was<br />
mit ihren Vorschlägen geschehen würde.<br />
Und wie konnten die Vorschläge umgesetzt werden?<br />
Martine Kurth: Die Artias schlug zunächst vor, dass die interessierten<br />
Gruppen die Organisation der Jahrestagung der Artias<br />
übernehmen sollten. Etwa zwanzig Projektteilnehmer griffen<br />
den Vorschlag spontan auf und arbeiteten mehrere Monate<br />
«Eine Beurteilung des Projekts<br />
und seiner Konsequenzen wird<br />
derzeit von der Hochschule<br />
für Soziale Arbeit in Freiburg<br />
durchgeführt.»<br />
Martine Kurth<br />
hart daran, die Tagung, die am 28. November <strong>20</strong>19 stattfinden<br />
würde, zu gestalten. Das ermöglichte es ihnen, die von den<br />
einzelnen Gruppen entwickelten konkreten Vorschläge zur Verbesserung<br />
der Begleitung von Sozialhilfeempfängern bekannt<br />
zu machen.<br />
Wie beurteilen Sie als Projektteilnehmer dieses Engagement?<br />
Stéphane: Sehr positiv, weil ich die Möglichkeit hatte, neue<br />
Kontakte zu knüpfen, neue Perspektiven zu erhalten und die<br />
Sozialhilfe anders zu sehen, was mir erlaubt hat, eine begleitete<br />
Arbeit zu finden, die mir mittelfristige Ausbildungsperspektiven<br />
bietet.<br />
Auf welche Schwierigkeiten sind Sie gestossen?<br />
Stéphane: Für mich gab es keine, denn wir waren eine fantastische<br />
Gruppe, solidarisch und vereint. Es war eine grossartige<br />
Erfahrung für mich.<br />
Welche Schlussfolgerungen werden aus dem Projekt gezogen, gibt es<br />
eine Fortsetzung?<br />
Martine Kurth: Eine Beurteilung des Projekts und seiner Konsequenzen<br />
wird derzeit von der Hochschule für Soziale Arbeit<br />
in Freiburg durchgeführt. Eine Synthese der Berichte zu den<br />
Vorschlägen der vier Gruppen wird von den Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmern des Projekts in Zusammenarbeit mit der Artias<br />
und dem Lenkungsausschuss des Projekts erstellt. Die Synthese<br />
wird dann in verschiedenen Dienststellen vorgestellt.<br />
Darüber hinaus wurden mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
im Laufe des Projekts in andere Aktivitäten integriert, wie<br />
z.B. Konferenzen oder Kurse der Artias, Lenkungsausschüsse<br />
von wissenschaftlichen Projekten, eine Radiosendung, eine<br />
nationale Projektgruppe usw. Einige haben auch den Verein<br />
«Construire demain» gegründet, um den Blick auf die Sozialhilfe<br />
und die Menschen, die sie zum Überleben brauchen, zu<br />
verändern.<br />
Was hat das Projekt Ihnen als Teilnehmer gebracht?<br />
Stéphane: Eine der Lehren ist für mich die Bedeutung des sozialen<br />
Zusammenhalts, die Tatsache, nicht allein dazustehen,<br />
festzustellen, dass andere Menschen ähnliche Situationen<br />
26 <strong>ZESO</strong> 2/<strong>20</strong> SCHWERPUNKT
PARTIZIPATION<br />
Positiv bewerteten Teilnehmende, dass ihnen das Projekt die Möglichkeit gab, neue Kontakte zu knüpfen.<br />
Bild: Uwe Duwald, pixelio<br />
erleben. Eine weitere Lehre ist die Erkenntnis, dass sich Sozialarbeiterinnen<br />
und Sozialarbeiter «zwischen Hammer und<br />
Amboss» befinden und wir uns als Begünstigte angewöhnen<br />
müssen, einen Beitrag zu leisten, indem wir Lösungen suchen.<br />
Wir sollten keine problematischen Fälle sein. Wenn wir etwas<br />
von den Sozialarbeitenden wollen, müssen wir auch unseren<br />
Beitrag leisten. Eine dritte Lehre war festzustellen, dass die Sozialhilfe<br />
das Leben einengt und mich dieses Projekt aus meiner<br />
Komfortzone – mit Sozialhilfe eher sehr relativ – gelockt hat.<br />
Es hat mich dazugebracht, über mich selbst hinauszuwachsen,<br />
etwas anderes sehen zu wollen. Der Beginn meiner Teilnahme<br />
am Artias-Projekt ging einher mit dem Aufsuchen einer<br />
psychiatrischen Beratungsstelle.<br />
Martine Kurth: Die Tatsache, in einer Gruppe zu sein, zu erkennen,<br />
dass alle anderen dieselbe Situation erleben und dass<br />
man sich innerhalb der Gruppe gegenseitig vertrauen muss,<br />
hat unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu starken<br />
Bindungen geführt. Sie stellt für viele so etwas wie ein Momentum<br />
dar, um sich neu zu positionieren.<br />
Was war für Sie das Schwierigste am Projekt?<br />
Stéphane: Der Morgen des 29. November, dem Tag nach der<br />
jährlichen Artias-Herbsttagung, die wir gemeinsam aufgebaut<br />
hatten und für die wir seit dem Sommer hart gearbeitet haben.<br />
Am nächsten Tag fühlt man sich leer, es ist vorbei... und obwohl<br />
man weiss, dass andere Dinge geschehen werden, gibt es im<br />
Moment eine Leere.<br />
«Eine der Lehren ist für mich<br />
die Bedeutung des sozialen<br />
Zusammenhalts, die Tatsache,<br />
nicht allein dazustehen, festzustellen,<br />
dass andere Menschen<br />
ähnliche Situationen erleben.»<br />
Stéphane<br />
Würden Sie sich in Zukunft gerne wieder in dieser Art engagieren?<br />
Stéphane: Ich bin in Verbänden in meiner Region bereits sehr<br />
aktiv. Und ich bin Mitglied von «Construire demain», dem Verein,<br />
den die Teilnehmer des Artias-Projekts im Jura gegründet<br />
haben, um das Unmögliche möglich zu machen. Und dort habe<br />
ich berufliche Ausbildungsprojekte im sozialen Bereich (MSP),<br />
die mich Zeit und Energie kosten werden. Aber ich stehe der Artias<br />
für ein neues ähnliches Projekt gerne zur Verfügung, denn<br />
es ist wichtig, dass wir unserer Situation Gehör verschaffen<br />
und die mit der Sozialhilfe verbundenen Vorurteile «ausmerzen»<br />
können.<br />
•<br />
Das Gespräch führte<br />
Ingrid Hess<br />
Social Impact Bonds:<br />
Unterschiedliche Erfahrungen<br />
von Sozialdienstleistern<br />
FACHBEITRAG Social Impact Bonds (SIBs) sind wirkungsorientierte Leistungsverträge, bei denen ein<br />
privater Investor die Dienstleistung vorfinanziert. Die Erfahrungen der Dienstleister unterstreichen<br />
bereits bekannte Vor- und Nachteile von wirkungsorientierten Leistungsverträgen. Dies zeigt ein Forschungsprojekt,<br />
an dem die Berner Fachhochschule für Soziale Arbeit beteiligt ist.<br />
Im Verlauf der letzten Jahrzehnte haben<br />
Regierungen eine Vielfalt von Verträgen<br />
getestet, etwa die Finanzierung abhängig<br />
von der Anzahl Klienten, der angebotenen<br />
Dienstleistungen oder der erzielten Wirkung.<br />
In den letzten zehn Jahren hat sich<br />
der Social Impact Bond (SIB) als eine neue<br />
Vertragsform verbreitet, insbesondere in<br />
den angelsächsischen Ländern und den<br />
Niederlanden. Dabei stellt ein Investor<br />
Mittel für ein Sozialprojekt zur Verfügung<br />
und wird vom Staat für dessen Erfolg ausbezahlt.<br />
Je nachdem, wie weit die definierten<br />
Programmziele erreicht werden, ergibt<br />
sich für den Investor ein Gewinn oder Verlust.<br />
Social Impact Bonds in der Praxis<br />
In der frühen SIB-Literatur hiess es, dass<br />
Regierungen diese Vertragsform anwenden<br />
würden, um das Risiko von neuen, experimentellen<br />
Programmen in den Privatsektor<br />
zu verlagern. Gleichzeitig hätten<br />
Dienstleister so die Möglichkeit zu flexibler<br />
und dynamischer Arbeitsweise und würden<br />
mit Fachwissen rund um Datenmanagement<br />
und Evaluation unterstützt.<br />
In der Praxis handelt es sich jedoch bei<br />
SIB-Programmen meist nicht um experimentelle,<br />
sondern um weit verbreitete Interventionen,<br />
für die es reichlich Praxiserfahrung<br />
und Evaluationsforschung gibt.<br />
Dies hängt damit zusammen, dass für neuartige<br />
Projekte mit entsprechend hohen<br />
Risiken keine Investoren gefunden werden<br />
könnten. In der Praxis scheint ausserdem<br />
kein «Risikotransfer» stattzufinden. Nur<br />
bei einem einzigen SIB weltweit kam es<br />
zu keiner positiven Auszahlung. In den<br />
Fallstudien zeigt sich denn auch, dass die<br />
28 <strong>ZESO</strong> 2/<strong>20</strong><br />
Vertragsbedingungen so formuliert sind,<br />
dass eine positive Auszahlung sehr wahrscheinlich<br />
ist.<br />
Viele Dienstleister berichten, dass die<br />
Investoren Einfluss auf das Tagesgeschäft<br />
nehmen können und dass die Handlungsfreiheit<br />
zunehmend beschnitten wird, je<br />
näher der Zeitpunkt der Auswertung und<br />
Auszahlung kommt. Was die Evaluation<br />
und Transparenz betrifft, haben SIBs die<br />
Dienstleister klar zur Erhebung von mehr<br />
Daten angetrieben. Dennoch haben SIBs<br />
in der Regel keine Evaluationen hervorgebracht,<br />
welche Dienstleistern zu verstehen<br />
helfen, was wirkt oder wie sie ihren Klienten<br />
helfen können.<br />
Welche Verträge sich Dienstleister<br />
wünschen<br />
Im Rahmen einer vom Schweizerischen<br />
Netzwerk für Internationale Studien<br />
(SNIS) finanzierten Forschungskooperation<br />
kamen im vergangenen Herbst gemeinnützige<br />
Organisationen aus Grossbritannien,<br />
Deutschland und der Schweiz in Bern<br />
Was die Evaluation<br />
und Transparenz<br />
betrifft, haben SIBs<br />
die Dienstleister klar<br />
zur Erhebung von<br />
mehr Daten angetrieben.<br />
zusammen, die u.a. durch SIB finanzierte<br />
Arbeitsmarktprogramme durchführen.<br />
Am Ende des zweitägigen Workshops wurden<br />
die Anbieter gebeten, den für sie idealen<br />
Vertrag zu beschreiben, unabhängig<br />
davon, ob dies ein SIB oder eine andere<br />
Vertragsform sei. Alle Anbieter nannten<br />
folgende für sie wichtige Punkte:<br />
1. Eine längerfristige stabile Finanzierung<br />
mit Zwischenetappen und der<br />
Möglichkeit, erfolgreiche Programme<br />
erneuern oder erweitern zu können.<br />
Die Dienstleister waren sich einig, dass<br />
«Finanzierungsklippen» mit plötzlicher<br />
Abnahme der Finanzierung nachteilhaft<br />
seien.<br />
2. Flexibilität und professionelles Vertrauen,<br />
die es ermöglichen, effektive, individuell<br />
zugeschnittene Lösungen für die<br />
Klientel zu entwickeln.<br />
3. Ganzheitliche Interventionen für ihre<br />
Klienten, die sich an den Zielen der an<br />
der Finanzierung beteiligten Behörden<br />
orientieren. Eine regierungsinterne<br />
Koordination dieser Ziele würde dabei<br />
bessere und effizientere Lösungen ermöglichen<br />
und den Dienstleistern ersparen,<br />
gleichzeitig viele unterschiedliche<br />
Verträge zu bewirtschaften, die<br />
letztlich im Inhalt der angebotenen<br />
Dienstleistung und der Auswertung<br />
sehr ähnlich sind.<br />
Diese drei Vorschläge, die von den<br />
Dienstleistern länderübergreifend geteilt<br />
werden, unterstreichen die unterschiedlichen<br />
Perspektiven der Entscheidungsträger<br />
der Sozialpolitik und der Sozialdienstleister.<br />
Aus Regierungssicht wird ein<br />
Programm durch eine Behörde gestaltet,
SIBs: Werden vereinbarte Ziele<br />
nicht erreicht, werden sie oft<br />
einfach neu verhandelt.<br />
Bild: Palma Fiacco<br />
um die spezifischen Ziele dieser Behörde<br />
zu erfüllen. Auf bisheriger Erfahrung beruhend<br />
werden kurz- oder mittelfristige<br />
Verträge abgeschlossen, um neue Ideen zu<br />
testen und deren Wirksamkeit zu messen.<br />
Was die Behörden als kreativen Prozess des<br />
Experimentierens und Lernens betrachten,<br />
kann bei den Dienstleistern zur Unterbrechung<br />
der angebotenen Dienstleistung<br />
führen, beispielsweise wenn ein Programm<br />
nicht verlängert wird. Dem Dienstleister<br />
wird so die Möglichkeit genommen,<br />
auf seiner Erfahrung aufzubauen, und es<br />
fallen Anpassungen beim Personaleinsatz<br />
und administrative Kosten an.<br />
Unterschiedliche Bewertungen der<br />
Anreize<br />
Die Meinungen von Dienstleistern bezüglich<br />
Anreize waren gemischt. Generell<br />
schätzten die Dienstleister, dass die Anreize<br />
mehr Informationen über Programmeffekte<br />
hervorbrachten und zur Reflexion der<br />
Dienstleistung anregten. Während die erhöhten<br />
finanziellen Risiken, welche von<br />
den Anreizen ausgehen, als negativ betrachtet<br />
wurden oder als etwas, dass es zu<br />
umgehen galt.<br />
Die Dienstleister lernten mehr über ihre<br />
Prozesse und Ergebnisse und konnten ihre<br />
Vorgehensweisen mit dem Hintergrund<br />
dieser Informationen reflektieren. Zudem<br />
führten die Wirkungsziele zu einem Dialog<br />
mit externen Partnern, was die Perspektive<br />
der Dienstleister erweiterte. Zum Teil wurden<br />
Dienstleister mit der Datenerhebung<br />
überlastet – dies könnte jedoch durch zusätzliche<br />
Finanzierung zwecks Datenerhebung<br />
oder der Nutzung von bestehenden<br />
administrativen Datenquellen verbessert<br />
werden.<br />
Risiken betreffend Auszahlungen und<br />
Planung stellen negative Aspekte der Anreize<br />
dar. Wenn diese als unüberwindbare<br />
Hürden wahrgenommen werden, werden<br />
sie wenn möglich umgangen. In einer der<br />
Fallstudien konnte ein Dienstleister sicherstellen,<br />
dass die Verhaltensziele der Teilnehmer<br />
flächendeckend positiv bewertet<br />
wurden. In einem zweiten Fall führte ein<br />
Dienstleister parallel ein bezüglich des Inhaltes<br />
und der Teilnehmer sehr ähnliches<br />
SIB und ein anderes Programm durch<br />
und konnte so leistungsstärkere Teilnehmer<br />
in den SIB transferieren. Wenn Auszahlungen<br />
nicht ausreichend gesichert<br />
werden konnten, konnten Dienstleister<br />
die Verträge neu verhandeln. Sowohl Neuverhandlungen<br />
als auch unerwünschtes<br />
Verhalten der Dienstleister ist aus Sicht der<br />
politischen Entscheidungsträger negativ.<br />
Interessanterweise betrachten die<br />
Dienstleister dieses strategische Verhalten<br />
nicht als verwerflich. Sie schätzen die<br />
Möglichkeit zur Neuverhandlung, weil sie<br />
diese als Ausgleichsmöglichkeit für unzureichende<br />
Finanzierung oder unerreichbar<br />
harte Wirkungsziele ansehen.<br />
Positive Wirkung und bekannte<br />
Probleme<br />
Zusammenfassend können wir sagen, dass<br />
Sozialdienstleister positive Veränderungen<br />
im Zusammenhang mit SIBs erlebt haben,<br />
die allgemein auf Leistungsverträge übertragen<br />
werden können. Gleichzeitig scheinen<br />
SIBs bekannte Probleme von Leistungsverträgen<br />
nicht gelöst zu haben,<br />
sondern verstärken diese möglicherweise<br />
sogar.<br />
• Von den Dienstleistern positiv betrachtet<br />
werden Aspekte wie längere Vertragsdauer,<br />
Flexibilität, Grosszügigkeit<br />
und mehr erhobene Information.<br />
• Im Rahmen einer SIB-Finanzierung<br />
wird mehr Risiko auf den Dienstleister<br />
übertragen, was zu unerwünschtem<br />
Verhalten der Dienstleister und Neuverhandlungen<br />
von Verträgen führen<br />
kann.<br />
Politische Entscheidungsträger müssen<br />
ein Mass an Anreizen finden, das sowohl<br />
wünschenswert als auch umsetzbar ist. Aktuell<br />
haben SIBs und wirkungsorientierte<br />
Leistungsverträge tendenziell zu starke Anreize,<br />
wodurch sich diese selbst aushebeln.<br />
Letztlich bestimmen die Entscheidungsträger<br />
der Sozialpolitik die Spielregeln für<br />
Leistungsverträge. Ein Einbezug der Sichtweisen<br />
der Sozialdienstleister ist jedoch<br />
wichtig, um möglichst effektive Sozialdienstleistungen<br />
anbieten zu können. Die<br />
zu SIBs gewonnenen Erkenntnisse können<br />
auf weitere wirkungsorientierte Leistungsverträge<br />
übertragen werden.<br />
•<br />
Prof. Dr. Debra Hevenstone<br />
Berner Fachhochschule Soziale Arbeit<br />
Lukas Hobi<br />
Berner Fachhochschule Soziale Arbeit<br />
2/<strong>20</strong> <strong>ZESO</strong><br />
29
Sozialsystem muss sich auf steigende<br />
Zahl Bedürftiger vorbereiten<br />
CORONA-PANDEMIE Die Massnahmen des Bundesrats zum Schutz der Bevölkerung und des Gesundheitssystems<br />
waren und sind einschneidend – auch für die Sozialdienste. Diese haben mit erheblichem<br />
Einsatz dafür gesorgt, ihre Aufgaben trotz erschwerten Bedingungen zu erfüllen. Die Zahl der Sozialhilfeempfänger<br />
blieb bis Anfang Mai weitgehend stabil. Das wird aber voraussichtlich nicht so bleiben.<br />
Kaum waren die Massnahmen am 16.<br />
März verhängt und in Kraft getreten, meldeten<br />
die Sozialdienste eine starke Zunahme<br />
der Neuanmeldungen für Sozialhilfe.<br />
«Es kommen sehr viele Anfragen von all<br />
den Selbstständigerwerbenden, die durch<br />
die Maschen fallen, die nicht wissen, an<br />
wen sie sich wenden sollen, die hin und her<br />
geschoben werden von den Ämtern und<br />
um ihre Existenz bangen. Die Ungewissheit,<br />
wie lange dieser Zustand andauern<br />
wird, macht Angst. Unsere Klienten sorgen<br />
sich um ihre Arbeit, ihre Lehrstelle», so beschreibt<br />
die Leiterin eines Sozialdienstes<br />
im Kanton Zürich die Situation wenige<br />
Tage, nachdem die ausserordentliche Lage<br />
ausgerufen worden war.<br />
Die Zahl der von der Sozialhilfe unterstützten<br />
Personen stieg in den Monaten<br />
März und April kaum an. Das jedoch vor<br />
allem dank der Anfang April beschlossenen<br />
Massnahmen des Bundes, mit denen die<br />
wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie<br />
abgefedert werden sollten. Ferner<br />
ist davon auszugehen, dass viele Teile der<br />
Bevölkerung, die mit erheblichen Einkommenseinbussen<br />
zurechtkommen müssen,<br />
über gewisse Reserven verfügen, die sie<br />
zuerst aufbrauchen müssen, bevor sie Anspruch<br />
auf Sozialhilfe haben.<br />
Besonders betroffen sind Personen<br />
ohne Aufenthaltsbewilligung. Auch verzichten<br />
Personen mit ausländischem Pass<br />
oft auf den Bezug auf Sozialhilfe, weil sie<br />
negative Folgen für ihre Aufenthaltsberechtigung<br />
in der Schweiz befürchten.<br />
Besonders im Kanton Genf sind viele Personen<br />
betroffen. Nothilfe leisten für diese<br />
Menschen vor allem private Hilfswerke.<br />
Sozialhilfequote von 4 Prozent<br />
Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der<br />
Personen, die Sozialhilfe benötigen, in den<br />
nächsten zwei Jahren stark ansteigen wird.<br />
Ende April bezogen 1,9 Mio. Personen<br />
Kurzarbeitsentschädigung, 153 000 Arbeitslosentaggelder<br />
und rund <strong>20</strong>0 000<br />
Erwerbsersatzentschädigung, das entspricht<br />
rund 45 Prozent der 5,1 Mio. Erwerbstätigen.<br />
Kurzfristig werden viele<br />
Selbständigerwerbende auf Sozialhilfe angewiesen<br />
sein, wenn der Erwerbsersatz<br />
Mitte Mai ausläuft. Mittelfristig werden<br />
von der Arbeitslosenversicherung Ausgesteuerte<br />
in diese Situation kommen.<br />
Gleichzeitig werden sich weniger Personen<br />
von der Sozialhilfe wegen der zu erwartenden<br />
Rezession ablösen können. Zudem<br />
wird auch die Integration der grossen<br />
Gruppe von Flüchtlingen und vorläufig<br />
Aufgenommen, die in den Jahren <strong>20</strong>14-<br />
16 in die Schweiz kamen, schwieriger. Gesamthaft<br />
rechnet die SKOS daher mit einem<br />
Anstieg bei der Sozialhilfequote von<br />
3,2 auf 4 Prozent bis <strong>20</strong>22. Das entspricht<br />
einer Zunahme von 77 000 Personen, von<br />
heute 273 000 auf 350 000. Das würde<br />
Coronakrise auch in Caritas-Märkten<br />
und -Sozialberatung spürbar<br />
Anfang Mai berichteten Medien von einer<br />
Lebensmittelabgabe in Genf. Weit über<br />
1000 Menschen standen für ein Paket<br />
Grundnahrungsmittel Schlange. Solche Bilder<br />
sind wir aus Katastrophengebieten in<br />
ärmeren Ländern gewohnt. Aber in der<br />
Schweiz? Die wirtschaftlichen Einschränkungen<br />
treffen Menschen, die an der Armutsgrenze<br />
leben, mit besonderer Härte. Es<br />
ist eine Entwicklung, die angesichts von<br />
660 000 Armutsbetroffenen und mehr als<br />
einer Million armutsgefährdeten Menschen<br />
in der Schweiz zu Besorgnis Anlass gibt.<br />
In den 21 Caritas-Märkten in der<br />
Schweiz wirkten sich die Einschränkungen<br />
des öffentlichen Lebens bereits Mitte März<br />
stark aus. Mehr Menschen kauften grössere<br />
Mengen ein. Bei Grundnahrungsmitteln<br />
wie Mehl, Milch, Speiseöl oder Teigwaren<br />
stieg die Nachfrage um mehr als<br />
die Hälfte an. Die Lebensmittelgutscheine<br />
im Wert von insgesamt 100 000 Franken,<br />
die mit Unterstützung der Glückskette<br />
abgegeben wurden, waren schnell<br />
vergriffen. Eine zweite Tranche von Gutscheinen<br />
wurde Anfang Mai verteilt. Für<br />
das Gesamtsortiment pendelten sich die<br />
Umsätze wieder nahe dem gewohnten Niveau<br />
ein. Doch das Kaufverhalten hat sich<br />
verändert: Während der Fokus stärker auf<br />
haltbaren Grundnahrungsmitteln liegt, ist<br />
die Nachfrage nach Früchten und Gemüse<br />
sowie nach nicht dringend benötigten Artikeln<br />
gesunken. Der Durchschnittseinkauf<br />
stieg – nicht zuletzt dank der Gutscheine –<br />
von 13 auf 17 Franken an. Und der Kreis<br />
der berechtigten Kundinnen und Kunden<br />
wird grösser: Die regionalen Caritas-Organisationen<br />
stellten im Lauf des Aprils<br />
auf Antrag der Sozialämter Hunderte von<br />
neuen Einkaufskarten für Kundinnen und<br />
Kunden aus.<br />
Zunahme der Gesuche in<br />
Sozialberatungen<br />
Auch in der Sozialberatung zeigte sich der<br />
höhere Bedarf, wenn auch später. Die finanziellen<br />
Überbrückungshilfen, die Cari-<br />
30 <strong>ZESO</strong> 2/<strong>20</strong>
zu einem Anstieg der Sozialhilfekosten der<br />
Kantone und Gemeinden um 870 Millionen<br />
führen. Zentral ist in dieser unsicheren<br />
Situation, Veränderungen in der Sozialhilfe<br />
rasch zu erkennen, um zeitnah reagieren<br />
zu können. Die SKOS will deshalb ab Juni<br />
<strong>20</strong><strong>20</strong> ein Monitoring einrichten.<br />
Sozialhilfe funktioniert auch unter<br />
erschwerten Bedingungen<br />
Neben den Sorgen um die Zahl von Betroffenen,<br />
die auf den Sozialdiensten eintreffen,<br />
erforderten die Einschränkungen des<br />
öffentlichen Lebens und der Arbeitswelt<br />
auch rasch Massnahmen, um das Funktionieren<br />
der Dienstleistungen, der Abwicklung<br />
der Verfahren zur Unterstützung der<br />
betroffen Sozialhilfeempfangenden, bei<br />
Auflagen und Sanktionen sicherzustellen.<br />
Fragen stellten sich unter anderem im Hinblick<br />
auf die Subsidiarität der Sozialhilfe<br />
und wie sie unter den gegebenen Umständen<br />
rechtzeitig sein kann. Um ihre Mitglieder<br />
bei dieser anspruchsvollen Aufgabe zu<br />
unterstützen, verfasste die Schweizerische<br />
Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) vier Tage<br />
nach dem Entscheid des Bundesrates<br />
tas unter anderem mit Geldern der Glückskette<br />
individuell leisten konnte, wurden<br />
zunächst nicht in allen Regionen im gleichen<br />
Mass beansprucht. Ende April stiegen<br />
die Gesuche bei den Sozialberatungen<br />
deutlich an. Für viele war die Auszahlung<br />
der Aprillöhne ein einschneidender Moment.<br />
Wer Arbeit auf Stundenlohnbasis,<br />
auf Abruf, in ungeregelten Verhältnissen<br />
leistet, spürte empfindliche Einbussen.<br />
Ebenso trifft die Kurzarbeitsentschädigung,<br />
die nur 80 Prozent des Lohnes<br />
deckt, Personen mit tiefen Einkommen besonders.<br />
In den Beratungen zeigte sich,<br />
dass die Wohnkosten für viele Familien<br />
und Alleinlebende nicht mehr tragbar waren.<br />
Andere sehen sich mit Steuerrechnungen<br />
oder Arztkosten konfrontiert, für die<br />
das Geld fehlt.<br />
Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung<br />
Alleinerziehende Mütter stehen vor<br />
besonderen Herausforderungen, ihre Erwerbsarbeit<br />
wenn immer möglich aufrecht<br />
zu erhalten und gleichzeitig die Kinder zu<br />
betreuen. Auch Sans-Papiers oder Sexarbeiterinnen<br />
melden sich bei der Caritas.<br />
Ihre Einkünfte sind weggebrochen. Die<br />
Empfehlungen für die Arbeit auf den Sozialdiensten<br />
während der ausserordentlichen<br />
Lage.<br />
Mancherorts konnten Lösungen rasch<br />
gesucht und umgesetzt werden: In einer<br />
kleinen Zürcher Gemeinde wurde der Betrieb<br />
des Sozialdienstes im Home-Office<br />
aufrechterhalten, Beratungen wurden telefonisch<br />
oder per Mail gemacht. «Alle Klienten,<br />
die einen Scanner zu Hause haben,<br />
können die nötigen Formulare, Dokumente<br />
etc. scannen oder fotografieren und der Leiterin<br />
des Sozialdienstes elektronisch zustellen.<br />
Da ich von zu Hause aus auf alles zugreifen<br />
kann, sind die Auszahlungen und die<br />
Weiterführung des Betriebs sichergestellt»,<br />
versicherte die Leiterin des Sozialdienstes.<br />
Ungewissheit ist für viele eine grosse zusätzliche<br />
Belastung.<br />
Das Auffangen dieser Notlagen kann<br />
trotz der grossen Solidarität aus der Bevölkerung<br />
von privaten Organisationen<br />
nicht nachhaltig geleistet werden. Caritas<br />
Schweiz hat deshalb auf politischer Ebene<br />
an Bundesrat und Parlament appelliert, ein<br />
Unterstützungsprogramm für Menschen<br />
und Haushalte mit kleinen Einkommen<br />
auszuarbeiten. Caritas schlägt eine einmalige<br />
Direktzahlung in der Höhe von 1000<br />
Franken für Haushalte und Einzelpersonen<br />
vor, deren Einkommen unter dem Niveau<br />
liegt, das zu Ergänzungsleistungen berechtigt.<br />
Caritas fordert ferner kostenlose<br />
Krippenplätze für Familien mit tiefen Einkommen,<br />
eine Erhöhung der Verbilligung<br />
von Krankenkassenprämien durch Bund<br />
und Kantone um 50 Prozent sowie Kurzarbeitsentschädigungen,<br />
die bei tiefen Einkommen<br />
keine Kürzung vorsehen, sondern<br />
100 Prozent des Lohnes betragen. •<br />
Stefan Gribi<br />
Leiter Abteilung Kommunikation, Caritas Schweiz<br />
www.caritas.ch/corona<br />
Kontakte hinter Plexiglas<br />
Man sei bemüht, den Betrieb wie gewohnt<br />
aufrechtzuerhalten, schrieb ein Thurgauer<br />
Sozialdienst. Dazu habe man das Team aufgeteilt,<br />
und nun wechsle man sich ab, immer<br />
eine Woche im Büro, eine Woche im<br />
Homeoffice. Hinter einem speziellen Schalter<br />
mit einer Plexiglasscheibe werden die<br />
wenigen Klientenkontakte, welche persönlich<br />
notwendig sind (nur Neuanmeldungen,<br />
maximal 15 Minuten) abgehalten. Alle<br />
weiterführenden Kontakte fänden per Telefon,<br />
Mail und Post statt. Arbeitsvermittlung,<br />
Integrationsprojekte, sämtliche externen<br />
Termine seien sofort ausgesetzt worden. •<br />
SRK VERTEILT 3 X 1000<br />
FRANKEN AN BEDÜRFTIGE<br />
Ingrid Hess<br />
Das Schweizerische Rote Kreuz hat entschieden,<br />
dass Bedürftige für die Monate April, Mai undJuni<br />
pro Familie oder Einzelperson einen Betrag von<br />
maximal CHF 1000 pro Monat zur Überbrückung<br />
beantragen können. Mit der finanziellen Unterstützung<br />
werden Rechnungen bezahlt und es<br />
wird unkomplizierte Hilfe geleistet. Darunter fallen<br />
in diesen schwierigen Zeiten auch immer mehr<br />
Güter des täglichen Bedarfs wie zum Beispiel<br />
Lebensmittel oder Hygieneprodukte wie Windeln.<br />
Diese Soforthilfe leistet das SRK rasch und<br />
unkompliziert seit mehreren Wochen. Personen in<br />
einer akuten Notlage können sich beim Rotkreuz-<br />
Kantonalverband in ihrem Kanton melden. Je<br />
nach Entwicklung der Krise und verfügbaren<br />
Spendengeldern wird das SRK überprüfen, ob die<br />
Soforthilfe auch nach Juni weitergeführt werden<br />
kann.<br />
Das SRK setzt für die Corona-Soforthilfe Spenden<br />
ein, die es von Unternehmen und über die Sammlung<br />
der Glückskette erhalten hat. Dank der grossen<br />
Solidarität der Schweizer Bevölkerung kann<br />
das SRK noch mehr von der Corona-Pandemie<br />
betroffenen Menschen in der Schweiz helfen.<br />
Das System der Sozialversicherungen ist ein<br />
Werk, auf das die Schweizerinnen und Schweizer<br />
mit Recht stolz sind. Das SRK fordert Massnahmen<br />
für die systematische Unterstützung von<br />
Armutsbetroffenen und Menschen mit tiefstem<br />
Einkommen in der Schweiz, die aufgrund der<br />
Coronakrise in Not geraten sind. Hier müssen<br />
Bund und Kantone einspringen,und zwar nicht<br />
nur punktuell, sondern nachhaltig während der<br />
ganzen Krise.<br />
Einmal- oder Mehrfachbeiträge wie die Soforthilfe<br />
des SRK können helfen, Engpässe zu überbrücken<br />
und durchzuatmen. Doch dies reicht nicht<br />
aus, denn die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie<br />
treffen jene am härtesten, die bereits vorher<br />
ein sehr knappes Budget hatten: Wenn Working<br />
Poor vorher knapp durchkamen, dann reicht es<br />
mit Arbeitslosengeld, Kurzarbeitsentschädigung<br />
oder Taggeld nicht mehr, auch wenn nur ein Fünftel<br />
des Einkommens fehlt. (SRK)<br />
2/<strong>20</strong> <strong>ZESO</strong><br />
31
Ältere Arbeitslose: Mit Präzision und<br />
Passion zur neuen Stelle<br />
REPORTAGE Ältere Erwerbslose haben es schwer auf dem Arbeitsmarkt. Das Programm Tandem 50 plus<br />
im Aargau hilft ihnen bei der Stellensuche. Vielfach ist das Erkennen des eigenen Potenzials der Schlüssel<br />
zum Erfolg.<br />
Es war eine schwierige Lebensphase für<br />
Erich Camenisch. Er befand sich in einer<br />
privaten Krise, als auch noch die Kündigung<br />
kam. Der damals 55-Jährige fiel in<br />
ein tiefes Loch. Er schrieb zwar Bewerbungen,<br />
bekam aber Absage um Absage. «Ich<br />
konnte mich über Monate zu nichts mehr<br />
motivieren», sagt der Aargauer.<br />
Schwer vorstellbar, wenn man Erich Camenisch<br />
heute anschaut: Mit strahlendem<br />
Gesicht und voller Energie erzählt er, wie<br />
er diesen März – kurz vor der Aussteuerung<br />
– eine neue Anstellung gefunden hat. «Die<br />
Stelle passt haargenau zu meinem Profil»,<br />
sagt der 57-Jährige, «und sie ist sogar noch<br />
einmal ein Karriereschritt.» In einem grossen<br />
Unternehmen der Lebensmittelindustrie<br />
hat er eine Leitungsstelle gefunden.<br />
Nun führt er ein Team von 10 Mitarbeitenden.<br />
Seiner Freude tut keinen Abbruch,<br />
dass er fast zeitgleich zum Stellenantritt<br />
wegen der Corona-Krise ins Home Office<br />
wechseln musste. Rückblickend sagt Camenisch<br />
über die Zeit der Stellensuche: «Die<br />
Hindernisse waren vor allem in meinem<br />
Kopf.» Er habe selber geglaubt, sein Alter<br />
sei ein Problem. Gleichzeitig habe er potenzielle<br />
Arbeitgeber oft mit der Vielzahl<br />
und Breite seiner Berufserfahrungen überfordert.<br />
Präzise Bewerbung ist entscheidend<br />
Diese Einschätzung teilt Frankpeter Himmel.<br />
Als freiwilliger Mentor coachte er<br />
Erich Camenisch im Rahmen des Programms<br />
Tandem 50 plus (s. Kasten). Das<br />
Mentoring war für Camenisch der Wendepunkt<br />
in seiner Stellensuche. Er sagt:<br />
«Frankpeter Himmel half mir, mich neu zu<br />
sortieren.»<br />
Himmel, der sich auch beruflich auf<br />
die Beratung von älteren Stellensuchenden<br />
spezialisiert hat, erlebt es häufig, dass Personen<br />
über 50 zu viele Erfahrungen und<br />
Kompetenzen in ihre Bewerbung packen<br />
32 <strong>ZESO</strong> 2/<strong>20</strong><br />
TANDEM 50 PLUS –<br />
UNTERSTÜTZUNG BEI DER<br />
STELLENSUCHE<br />
Tandem 50 plus Kanton Aargau ist ein Mentoring-<br />
Angebot, bei dem Stellensuchende über 50 von<br />
freiwillig engagierten Mentorinnen und Mentoren<br />
bei der Rückkehr in den Arbeitsmarkt unterstützt<br />
und begleitet werden. Während vier Monate coachen<br />
die berufserfahrenen und in der Arbeitswelt<br />
gut verankerten Persönlichkeiten ihre Mentees<br />
dabei, eine neue Stelle zu finden. <strong>20</strong>19 waren<br />
in dem im Auftrag vom Kanton geführten Programm<br />
87 Tandems unterwegs: 35 Frauen und<br />
52 Männer mit einem Durchschnittsalter von 56<br />
Jahren. 80 Prozent der Programmteilnehmenden<br />
fanden wieder eine Stelle, über die Hälfte einen<br />
unbefristeten Arbeitsvertrag. Das Programm<br />
Tandem 50 plus gibt es auch in den Kantonen<br />
Baselland, Schaffhausen und St. Gallen.<br />
www.tandem-ag.ch<br />
«Die Passion für<br />
das, was man tut<br />
oder tun will, ist viel<br />
wichtiger als das<br />
Alter.»<br />
wollen. Dabei zähle, was für alle Stellensuchenden<br />
wichtig ist, bei älteren Personen<br />
doppelt, sagt er. «Präzision ist das Wichtigste<br />
– die Qualifikationen müssen passen.»<br />
Daneben müssen die Erfahrungen<br />
aber auch neu präsentiert werden. «Ich<br />
helfe, eine Storyline in die Bewerbung zu<br />
bringen», sagt der Mentor.<br />
Nebstdem, dass Frankpeter Himmel<br />
beim Erstellen eines zeitgerechten Dossiers<br />
und bei der Analyse des Arbeitsmarktes<br />
hilft, macht er mit seinen Mentees<br />
beispielsweise Interview- und Social Media<br />
Training. «Manchmal ist es aber genauso<br />
wichtig, einfach zuzuhören und die Person<br />
im richtigen Moment aufmuntern oder<br />
herausfordern zu können», sagt der Bewerbungsspezialist.<br />
Frankpeter Himmel<br />
weiss, wovon er spricht. «Ich bin selber mit<br />
über 50 arbeitslos geworden und kenne<br />
das tiefe Loch, das die einfachsten Erledigungen<br />
zum unüberwindbaren Hindernis<br />
werden lässt.»<br />
Dass es für Personen über 50 generell<br />
schwieriger ist, eine Stelle zu finden als für<br />
jüngere (s. Kasten), verschweigt Himmel<br />
nicht. «Dennoch bin ich überzeugt», sagt<br />
er, «dass die Passion für das, was man tut<br />
oder tun will, viel wichtiger ist als das Alter.»<br />
Auf Chancen fokussieren<br />
Begeisterung für sein Metier hätte auch<br />
Markus Suter genug. Er ist ebenfalls Teilnehmer<br />
des Programms Tandem 50 plus<br />
und aktuell Mentee von Frankpeter Himmel.<br />
Der 59-jährige Berufstrainer hat zuletzt<br />
als Geschäftsführer eines grossen<br />
Sportvereins gearbeitet. Aktuell führt er ein<br />
Trainingscenter, das er schon früher als<br />
Hobby betrieb. Mit Blick auf seine Altersvorsorge<br />
müsse er aber einen Ergänzungsjob<br />
oder Mandate finden, sagt Suter und<br />
fügt an: «Der Arbeitsmarkt in der Sportbranche<br />
ist jedoch – auch wegen Corona –<br />
völlig stagniert.» Markus Suter schildert
Über 50-jährige Arbeitslose haben es oft nicht einfach, auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuss zu fassen. <br />
Bild: Keystone<br />
seine Erfahrung im Bewerbungsprozess<br />
völlig anders als Erich Camenisch. «In<br />
meinem Alter hat man auf herkömmlichem<br />
Weg kaum eine Chance. Meine<br />
Kompetenzen werden nicht wahrgenommen»,<br />
sagt er. In der Regel würden Absagen<br />
erfolgen und diese untergraben schleichend<br />
das Selbstvertrauen.<br />
Dank seiner wöchentlichen Gespräche<br />
mit Frankpeter Himmel bleibt Suter dennoch<br />
motiviert. Zusammen versuchen<br />
sie neue Wege bei den Bewerbungen<br />
einzuschlagen. «Ich muss mich auf meine<br />
Chancen fokussieren», sagt Suter. In<br />
seinem Fall sei das etwa die Flexibilität,<br />
dass verschiedene Tätigkeiten und Erwerbsmodelle<br />
in Frage kommen. Daher<br />
wird auch der Aufbau seiner Teilzeitselbstständigkeit<br />
als Gesundheitstrainer für<br />
Menschen über 50 weiter vorangetrieben.<br />
DIE SITUATION VON ÄLTEREN<br />
ERWERBSLOSEN<br />
Das Risiko, arbeitslos zu werden, ist bei älteren<br />
Arbeitnehmenden unterdurchschnittlich. Die<br />
Arbeitslosenquote der Personen ab 50 Jahren ist<br />
niedriger als jene der 25- bis 49-jährigen. Aber:<br />
Wer arbeitslos wird, hat es schwieriger, wieder<br />
in der Arbeitswelt Fuss zu fassen. Auffallend ist,<br />
dass mit dem Alter die Dauer der Arbeitslosigkeit<br />
zunimmt. Entsprechend sind ältere Personen bei<br />
den Langzeitarbeitslosen übervertreten.<br />
Häufig müssen ältere Personen Kompromisse<br />
eingehen, wenn sie eine neue Stelle finden. Sie<br />
müssen Lohneinbussen, tiefere Funktionen<br />
oder mehrere Teilzeitbeschäftigungen in Kauf<br />
nehmen. Gründe für die Schwierigkeiten, eine<br />
neue Stelle zu finden, können etwa mangelnde<br />
berufliche Ausbildung, überholte Qualifikationen<br />
oder gesundheitliche Einschränkungen sein.<br />
Informationen:<br />
• www.seco.admin.ch Arbeit Arbeitslosenversicherung<br />
Arbeitslosigkeit Ältere<br />
Arbeitslose<br />
• www.skos.ch Publikationen Positionen<br />
<strong>20</strong>18 Alternativen zur Sozialhilfe für über<br />
55-Jährige<br />
Fehlende Weiterbildung<br />
Um das Bewusstwerden des eigenen Potenzials<br />
und die Stärkung des Selbstbewusstseins<br />
geht es in den Tandem-Gesprächen<br />
immer wieder. «Oft braucht es<br />
jemanden, der einem den Spiegel vorhält»,<br />
sagt Brigitte Basler, Programmleiterin von<br />
Tandem 50 plus Kanton Aargau. Die Mentees<br />
müssten die Bereitschaft haben, sich<br />
auf einen Begleitprozess einzulassen.<br />
Basler erzählt aber auch von konkreten<br />
Hindernissen, die älteren Personen bei<br />
der Stellensuche im Weg stehen können.<br />
«Mich erstaunt immer wieder, dass<br />
viele unserer Programmteilnehmenden<br />
seit dem ersten Bildungsabschluss kein<br />
«Schulhaus» mehr von innen gesehen haben»,<br />
sagt sie. Nebst der fehlenden Weiterbildung<br />
sei auch mangelnde Bereitschaft<br />
auf der Karriereleiter oder beim Salär<br />
einen Schritt rückwärts zu machen, regelmässig<br />
ein Thema.<br />
Probleme ortet Brigitte Basler aber<br />
auch in der Denkweise mancher Arbeitgeber.<br />
Die Vorurteile gegenüber Personen<br />
über 50 würden lauten: unflexibel, nicht<br />
mehr up to date, schwer fügbar oder zu gut<br />
qualifiziert. Basler sagt: «Hier ist eine klare<br />
Haltung der Arbeitgeber nötig, jemanden<br />
über 50 einstellen zu wollen.» Sei dies aus<br />
Gründen der Teamzusammensetzung,<br />
weil genau die berufliche Sozialisation dieser<br />
Generation erwünscht ist, oder einfach,<br />
weil Menschen über 50 sehr viel Potenzial<br />
mitbringen. <br />
•<br />
Regine Gerber<br />
2/<strong>20</strong> <strong>ZESO</strong><br />
33
TÜRE AUF<br />
BEI MURIEL CHRISTE MARCHAND<br />
Sozialdienst:<br />
Sozialamt des Kantons Jura, Delémont<br />
Anzahl Mitarbeitende: 33<br />
Funktion:<br />
lic. Sc. sociales UNIL, master adm. publique IDHEAP,<br />
Leitung Sozialdienst – im Jobsharing mit Julien Cattin<br />
Angestellt seit: Dezember <strong>20</strong>16<br />
Alter:<br />
49 Jahre<br />
«Ich bin sicher, dass diese neuen Formen<br />
der Zusammenarbeit weitergehen und neue<br />
Perspektiven eröffnen werden!»<br />
Bild: zvg<br />
Was zeichnet den Sozialdienst<br />
Delémont aus?<br />
Kanton und Gemeinden sind für die<br />
Sozialhilfe via die regionalen Sozialdienste<br />
gemeinsam zuständig. Der<br />
kantonale Dienst des Sozialamts entscheidet<br />
zentral über die Gewährung<br />
von Sozialhilfe. Derzeit wird daran gearbeitet,<br />
das System zu überdenken:<br />
Durch eine effizientere Bereitstellung<br />
von materieller Hilfe sollen mehr Mittel<br />
für die soziale Unterstützung zur Verfügung<br />
gestellt werden.<br />
Die Corona-Krise hat alle Sozialdienste<br />
vor enorme Herausforderungen<br />
gestellt. Was hat Sie in diesem<br />
Zusammenhang speziell beschäftigt?<br />
Unsere Priorität war es, dafür zu sorgen,<br />
dass Sozialhilfe geleistet werden<br />
kann und dass soziale Unterstützungsdienste<br />
zugänglich bleiben,<br />
während wir uns gleichzeitig um die<br />
Gesundheit der Beschäftigten und<br />
Leistungsempfänger kümmern.<br />
Welcher Ansatz oder welches<br />
Konzept hat Ihnen geholfen, die<br />
Schwierigkeiten zu meistern?<br />
Die jurassische Regierung beschloss,<br />
die Sozialhilfe in vereinfachter und<br />
standardisierter Form zu gewähren,<br />
indem sie die Unterhaltspauschale<br />
um 15 Prozent erhöhte. Wir sind überzeugt,<br />
dass diese erleichterten Verfahren<br />
dazu beigetragen haben, die<br />
Sorgen einer ohnehin schwachen Bevölkerungsgruppe<br />
zu beruhigen.<br />
Haben Sie in dieser schwierigen Zeit<br />
eine besonders positive Erfahrung<br />
gemacht?<br />
In dieser Krisenzeit wurden eine<br />
kantonale Solidaritätsplattform und<br />
ein Projekt geschaffen, das sich mit<br />
Menschen in gefährdeten Situationen<br />
vernetzen will. Ich bin sicher,<br />
dass diese neuen Formen der Zusammenarbeit<br />
weitergehen und<br />
neue Perspektiven eröffnen werden!<br />
Was haben Sie an Ihrer Arbeit in<br />
den letzten Wochen am meisten<br />
geschätzt?<br />
Das Vorhandensein eines echten Spirits<br />
zur Zusammenarbeit zwischen<br />
den verschiedenen Partnern, mit denen<br />
wir zusammenarbeiten, sowohl<br />
den öffentlichen als auch den privaten.<br />
Alle haben ihre ganze Energie in die Suche<br />
nach Lösungen gesteckt, um der<br />
Bevölkerung den bestmöglichen Nutzen<br />
zu bieten.<br />
Wie sind Sie mit einer besonders<br />
belastenden Situation umgegangen?<br />
Jobsharing ist eine grossartige Ressource,<br />
ebenso wie intensive Kommunikation<br />
und regelmässiger Austausch<br />
innerhalb des Arbeitsteams.<br />
Was hat Ihnen persönlich in letzter Zeit<br />
am meisten Schwierigkeiten gemacht?<br />
Zweifellos der Mangel an gemeinsamen<br />
Momenten mit Freunden und<br />
Familie.<br />
Was wünschen Sie sich für die Zukunft<br />
in Bezug auf Ihre Arbeit?<br />
Ein Schritt hin zu einem System, das<br />
die Bedürfnisse des Einzelnen berücksichtigt,<br />
indem es ihn befähigt, insbesondere<br />
bei der Definition von Zielen<br />
zur Integration.<br />
» dieser<br />
In der Schweiz gibt es Hunderte von Sozialdiensten mit unzähligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie unterstützen Kinder, Jugendliche<br />
und Erwachsene in unterschiedlichen Lebenslagen und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. In<br />
Serie berichten sie aus ihrem Berufsalltag, den schönen und den schwierigen Seiten ihrer Arbeit.<br />
34 <strong>ZESO</strong> 2/<strong>20</strong>
«Ich hätte da eine Idee»<br />
PORTRÄT Dank seinem<br />
Ideenreichtum und seiner<br />
Umsetzungsstärke können in<br />
der ganzen Schweiz zahlreiche<br />
Angehörige ihre Liebsten im<br />
Altersheim besuchen: Georg<br />
Raguth, Leiter des Alters- und<br />
Pflegeheims Risi, hat die<br />
Besuchsbox für Coronazeiten<br />
erfunden.<br />
Es war an einem Montagabend Ende März,<br />
als Georg Raguth eine seiner Blitzideen<br />
hatte. Diese sollte die Lebensqualität Hunderter<br />
alter Menschen in der Schweiz verbessern.<br />
Er selber leitet das Alters- und<br />
Pflegeheim Risi in Wattwil (SG) und hatte<br />
dort am Nachmittag miterlebt, wie die Bewohnerinnen<br />
und Bewohner mit ihren Angehörigen<br />
skypten. Für manche hatte das<br />
gut funktioniert, doch viele empfanden es<br />
als unheimlich, wenn der Sohn oder die<br />
Tochter aus dem Bildschirm sprach. Zuhause<br />
studierte Raguth an einer anderen<br />
Lösung rum, wie die alten Menschen trotz<br />
coronabedingtem Besuchsverbot ihre<br />
Liebsten treffen könnten. Da tauchten vor<br />
seinem inneren Auge Filmszenen mit Gefängnisbesuchen<br />
auf, in denen über zwei<br />
Telefone durch eine Trennscheibe kommuniziert<br />
wird. «Es ist eigentlich ganz simpel»,<br />
dachte sich der 56-Jährige und skizzierte,<br />
wie man etwas Ähnliches im Risi<br />
umsetzen könnte. Am nächsten Morgen<br />
rief er die Mitarbeiter des Betriebsunterhalts<br />
zusammen – am Abend stand die<br />
«Bsuechsbox». Eigentlich sind es zwei Boxen,<br />
eine aussen, die andere innen an der<br />
Hausmauer. Im Fenster dazwischen wurde<br />
eine Plexiglasscheibe eingepasst. So können<br />
die alten Menschen ihre Angehörigen<br />
sehen und über ein Telefon miteinander<br />
kommunizieren.<br />
Bis nach China<br />
Die Idee schlug hohe Wellen, weit über das<br />
Toggenburg hinaus, nachdem Zeitungen,<br />
TV- und Radiostationen darüber berichtet<br />
hatten. Risi erhielt zig Anfragen von interessierten<br />
Altersheimen, nicht nur aus der<br />
Georg Raguth liebt es, Ideen rasch und spontan umzusetzen.<br />
Schweiz, sondern auch aus Deutschland,<br />
Tschechien oder China. Seither haben viele<br />
Heime ihre eigene Besuchsbox gebaut.<br />
«Das freut mich enorm und erfüllt mich<br />
mit Befriedigung und Stolz», sagt Georg<br />
Raguth. Im eigenen Heim erlebt er, welche<br />
Emotionen diese «banale Installation» auslöst.<br />
«Wenn ich unsere Bewohnenden sehe,<br />
die vor Freude zu weinen beginnen, weil<br />
sie ihren Sohn oder ihre Tochter nun doch<br />
richtig sehen können, dann verdrücke ich<br />
jeweils selber eine Träne.»<br />
Ideen spontan umsetzen<br />
Dass gerade Georg Raguth der Erfinder dieser<br />
Besuchsbox ist, ist kein Zufall: Er sprudelt<br />
nur so vor Einfällen. Wenn er seinen<br />
Mitarbeitenden sage, er habe da eine Idee,<br />
denke der eine oder die andere: «Oha, was<br />
kommt jetzt wohl wieder?» Doch dann würden<br />
sie engagiert mitmachen beim Brainstormen.<br />
Raguth liebt das: Ideen potenzierten<br />
sich im Gespräch – und dann müsse<br />
man irgendwann entscheiden, ob man die<br />
Idee umsetze oder ad acta lege. Sein Credo:<br />
Einen Einfall rasch und spontan umsetzen,<br />
ohne alle Pro und Contra zu analysieren. So<br />
ist vor drei Jahren eine Risi-Ferienreise<br />
nach Amsterdam zustande gekommen. Raguth<br />
selber war gerade aus der holländischen<br />
Hauptstadt zurückgekehrt, hatte am<br />
Mittagstisch davon erzählt, worauf ein<br />
Heimbewohner meinte, er würde Amsterdam<br />
auch gerne mal sehen. Raguth dachte<br />
sich: «Warum eigentlich nicht?» Und so<br />
reisten schliesslich 35 Heimbewohner, Angehörige<br />
und Mitarbeiterinnen eine Woche<br />
Bild: Meinrad Schade<br />
nach Amsterdam. «Manche dachten im<br />
Vorfeld, ich spinne, mit Betagten im Rollstuhl<br />
oder mit Rollatoren in ein grosses Hotel<br />
in einer fremden Stadt zu reisen.» Doch<br />
es habe alles wunderbar geklappt und sei<br />
eine der tollsten Wochen geworden, die er<br />
je erlebt habe. Klar ist für ihn: «Solche Ideen<br />
kann man nur umsetzen, wenn die Führungsgremien<br />
einen stützen – auch dann<br />
noch, wenn Gegenwind kommen sollte.»<br />
Ferien trotz Corona<br />
Um diesen Rückhalt wusste Raguth auch<br />
im Hitzesommer <strong>20</strong>15, als er innert zwei<br />
Tagen ein Schwimmbad aufstellen liess.<br />
Mit einem Kran wurden die alten Menschen<br />
ins Wasser gehoben, am Bassinrand<br />
standen Liegestühle – «es sah aus wie in<br />
der Badi». Diesen Sommer ist das Motto im<br />
Risi: Ferien trotz Corona. Die Bewohnerinnen<br />
und Bewohner werden vor einem<br />
Greenscreen fotografiert, dann wird statt<br />
des grünen Hintergrunds das Bild einer<br />
Feriendestination hineinmontiert, und so<br />
erhalten die Angehörigen Postkarten aus<br />
imaginären Ferien. «Mich reizt es, nicht<br />
alltägliche Sachen zu machen, und ich<br />
empfinde es als wichtig für die alten Menschen»,<br />
sagt Raguth. Diese Überzeugung<br />
unterstreicht er aktuell auch äusserlich: Jeden<br />
Montag kommt er mit einer neuen,<br />
aussergewöhnlichen Haarfarbe, mal blau,<br />
mal rot, dann violett. «Ich will in diesen<br />
Zeiten zeigen, dass das Leben weitergeht<br />
und dass es mit Humor leichter ist.» •<br />
Barbara Spycher<br />
2/<strong>20</strong> <strong>ZESO</strong><br />
35
LESETIPPS<br />
Beraten in der Sozialen Arbeit<br />
Beraten gehört zum Standardrepetoire von<br />
Fachkräften in der Sozialen Arbeit. Für einen gelingenden<br />
Beratungsprozess müssen sie in der<br />
Lage sein, eine differenzierte Auftragsklärung<br />
vorzunehmen und die Beziehung zu ratsuchenden<br />
Personen professionell zu gestalten. Es<br />
gilt, die mit Beratung einhergehenden Veränderungsprozesse<br />
zu erkennen und gemeinsam<br />
zu bearbeiten. Dieses Fachbuch bietet dazu einen systematischen<br />
Überblick.<br />
Michael Zwilling, Caroline Pulver, Stephanie Disler et al.(Hrsg.). Beraten in der<br />
Sozialen Arbeit, Haupt Verlag, <strong>20</strong><strong>20</strong>, CHF 37.−, ISBN-13: 9783825253479<br />
Soziale Arbeit und<br />
Digitalisierung<br />
Mit welchen Fragen und Herausforderungen<br />
ist die Soziale Arbeit im Kontext gesellschaftlicher<br />
Digitalisierungsprozesse konfrontiert?<br />
Das Handbuch behandelt das allgegenwärtige<br />
Thema der Digitalisierung erstmals umfassend<br />
mit Bezug auf Disziplin und Praxis der Sozialen<br />
Arbeit. Beleuchtet werden unterschiedliche<br />
Perspektiven, gesellschaftliche Entwicklungen und Diskurse. Zudem<br />
werden digitalisierte Formen der Dienstleistungserbringung und die<br />
Digitalisierung im Kontext von Profession, Organisation und Forschung<br />
thematisiert.<br />
Nadia Kutscher, Thomas Ley, Udo Seelmeyer et al. (Hrsg.), Handbuch Soziale<br />
Arbeit und Digitalisierung, <strong>20</strong><strong>20</strong>, 658 Seiten, CHF 59.− , ISBN 978-3-7799-3983-2<br />
Politik in der digitalen<br />
Gesellschaft<br />
Die Bedeutung der Digitalisierung für Politik und<br />
Gesellschaft wird vermehrt auch aus politikwissenschaftlicher<br />
Sicht behandelt. Die Beiträge<br />
des Buches versammeln dazu programmatische<br />
Positionen, die zentrale Aspekte und<br />
Perspektiven der sozialwissenschaftlichen<br />
Digitalisierungsforschung diskutieren. Hierzu<br />
zählen u.a. Forschungsfelder aus den Bereichen Partizipations- und<br />
Parteienforschung, Governance der Digitalisierung, methodische Reflexionen<br />
über Computational Social Science und die Analyse von Demokratie<br />
und Öffentlichkeit unter den Bedingungen der Digitalisierung.<br />
Jeanette Hofmann, Norbert Kersting, Claudia Ritzi, Politik in der digitalen Gesellschaft,<br />
Zentrale Problemfelder und Forschungsperspektiven, Transcript Verlag,<br />
<strong>20</strong>19, 332 Seiten, CHF 90.−, ISBN 978-3-8376-4864-5<br />
Herausforderung Kinderarmut<br />
Auf das Problem der Kinderarmut gibt es keine<br />
einfachen Antworten - vielmehr bestehen<br />
vielfältige Theorien und Ansätze diverser<br />
Disziplinen. Dieses Handbuch leistet eine<br />
differenzierte Darstellung von Gesellschaftsanalysen<br />
und Präventionsvorschlägen aus den<br />
Sozial-, Politik- und Erziehungswissenschaften,<br />
der Pädagogik, Sozialen Arbeit sowie Psychologie.<br />
Die interdisziplinäre Ausrichtung lässt grössere Zusammenhänge<br />
sichtbar und verständlich werden. Sie ermöglicht Lesenden, einen Überblick<br />
über ein weites Forschungsfeld zu gewinnen, und sensibilisiert<br />
nachhaltig für die Problematik.<br />
Peter Rahn, Karl August Chassé (Hrsg.), Handbuch Kinderarmut, UTB Verlag,<br />
<strong>20</strong><strong>20</strong>, 380 Seiten, CHF 53.−, ISBN 978-3-8252-5356-1,<br />
VERANSTALTUNGEN<br />
Forum: «Digitalisierung in der<br />
Sozialen Arbeit»<br />
Wie steht es um die Digitalisierung in der Sozialen<br />
Arbeit und insbesondere in der Sozialhilfe?<br />
Mit dieser hochaktuellen Frage befasst sich das<br />
SKOS-Forum/die Städteinitiative-Tagung der<br />
leitenden Angestellten, die am 14. September in<br />
Olten stattfindet. Es werden ein Überblick über<br />
Begriffe und Technologien vermittelt sowie konkrete<br />
Projekte vorgestellt, die sich dem Thema<br />
«Soziale Arbeit und Digitalisierung» annähern.<br />
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe<br />
Montag, 14. September, Olten<br />
www.skos.ch/veranstaltungen<br />
Luzerner Tagung zum<br />
Sozialhilferecht<br />
Die diesjährige Luzerner Tagung zum Sozialhilferecht<br />
thematisiert relevante Änderungen für die<br />
Praxis der Sozialhilfe. Was hat sich in der Gesetzgebung<br />
verändert? Welche aktuellen Änderungen<br />
bei der Rechtsprechung und den SKOS-Richtlinien<br />
sind relevant? Das detaillierte Programm ist<br />
noch in Erarbeitung. Interessensanmeldungen<br />
sind bereits möglich.<br />
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit<br />
Donnerstag, 22. Oktober, Luzern<br />
www.hslu.ch Soziale Arbeit Agenda<br />
Die Familie im System der<br />
sozialen Sicherheit<br />
Der Familienbegriff verändert sich, neue Familienformen,<br />
Individualisierung und veränderte Rollen<br />
tragen zum Wandel der herkömmlichen Familie<br />
bei. An welchen Bildern orientiert sich das soziale<br />
Sicherungssystem in der Schweiz? Welche Auswirkungen<br />
haben neue Familienkonstellationen auf<br />
die soziale Sicherung und welche Bedeutung hat<br />
die Familie im heutigen System? Diesen Fragen<br />
geht der Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik<br />
nach und eruiert die Auswirkungen auf verschiedene<br />
Bereiche.<br />
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit<br />
Dienstag, 1. Dezember <strong>20</strong><strong>20</strong>, Luzern<br />
www.hslu.ch Soziale Arbeit Agenda<br />
36 <strong>ZESO</strong> 2/<strong>20</strong>
Certificate of Advanced Studies<br />
CAS Sozialhilferecht<br />
Start: 22. Juni <strong>20</strong><strong>20</strong><br />
Nutzen Sie diese<br />
Zeit der Veränderung<br />
und starten Sie mit<br />
Ihrer Weiterbildung.<br />
Fachkurs<br />
Sozialhilfeverfahren<br />
Start: 22. Juni <strong>20</strong><strong>20</strong><br />
Sachbearbeitung im Sozialbereich<br />
Start: 10. September <strong>20</strong><strong>20</strong><br />
Weitere Informationen unter<br />
hslu.ch/weiterbildung-sozialearbeit<br />
Integration und Partizipation<br />
Beratung und Coaching<br />
Kinder- und Jugendhilfe<br />
Management, Recht und Ethik<br />
Gesundheit<br />
Alle Weiterbildungsangebote zu diesen und vielen<br />
weiteren interessanten Themen finden Sie online:<br />
Neue Impulse für Ihren professionellen Berufsalltag<br />
Die Weiterbildungen an der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW in Olten und Muttenz unterstützen Sie<br />
dabei, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Sie erhalten neustes Wissen aus der Forschung<br />
und verknüpfen dieses mit Ihren Erfahrungen aus dem Berufsalltag.<br />
www.fhnw.ch/soziale-arbeit/weiterbildung
-<br />
Weiterbildung,<br />
die wirkt!<br />
Fachkurs Arbeitsintegration<br />
6 Studientage, August bis Oktober <strong>20</strong><strong>20</strong><br />
Fachkurs Beratung von jungen Erwachsenen<br />
In Kooperation mit der Hochschule Luzern<br />
6 Studientage, Oktober bis November <strong>20</strong><strong>20</strong><br />
Fachkurs Beratung von Menschen mit<br />
Migrationshintergrund<br />
In Kooperation mit der Hochschule Luzern<br />
6 Studientage, November bis Dezember <strong>20</strong><strong>20</strong><br />
Einführung Sozialhilfe<br />
In Kooperation mit der Hochschule Luzern<br />
4 Kurstage, Oktober bis Dezember <strong>20</strong><strong>20</strong><br />
Weitere Informationen unter<br />
bfh.ch/soziale-sicherheit<br />
‣ Soziale Arbeit<br />
Hier bilden sich Fachleute<br />
der Sozialen<br />
Arbeit für Praxis und<br />
Wissenschaft aus.<br />
Der Master mit der Kompetenz<br />
von 3 Hochschulen<br />
Berner Fachhochschule BFH I Soziale Arbeit<br />
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit<br />
FHS St.Gallen, Fachbereich Soziale Arbeit<br />
masterinsozialerarbeit.ch<br />
MSA_Inserat_<strong>ZESO</strong>_170x130_<strong>20</strong>0107.indd 2 07.01.<strong>20</strong> 16:18