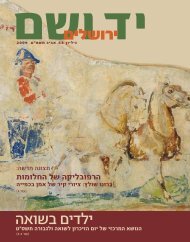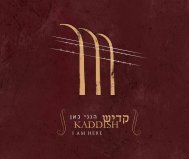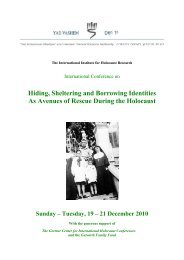yad vashem magazin yad vashem magazin
yad vashem magazin yad vashem magazin
yad vashem magazin yad vashem magazin
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die Archivabteilung von Yad Vashem verantwortet die<br />
Erhaltung der Millionen von Dokumenten aus der Zeit<br />
des Zweiten Weltkriegs, darunter auch hunderte von<br />
persönlichen Tagebüchern, die während des Holocaust<br />
geschrieben wurden. Eines dieser Tagebücher stammt<br />
aus der Feder von Rabbi Uri Feivish Tauber aus der Zeit<br />
von 1941-44 in Mogilev-Podolski. Geboren 1911 im<br />
rumänischen Cerepcauti wurde der Rabbi im Oktober 1941<br />
nach Mogilev deportiert und blieb dort bis zur Befreiung der<br />
Stadt durch die Rote Armee. Das Tagebuch wurde kürzlich<br />
von seiner Witwe Ruth Tauber Yad Vashem in der Hoffnung<br />
übergeben, dass es hier für immer bewahrt bleiben möge.<br />
Das Tagebuch von Rabbi Uri Feivish Tauber<br />
Sicherung der Erinnerungen<br />
von Efrat Komisar, Mitarbeiterin im Archiv<br />
Das schon zerbröselte Tagebuch wurde dem Archiv zunächst<br />
zur Restauration übergeben. Einige Seiten waren von Säure<br />
angefressen und in einem Auflösungsprozess von Klebeband<br />
zusammengehalten, dessen chemische Bestandteile weitere<br />
Schäden verursacht hatten. Das Labor, das sich um die<br />
Erhaltung bemüht, hat in schwieriger Arbeit die Seiten zu<br />
retten versucht (siehe Foto), so dass nach der vollständigen<br />
Restaurierung das Tagebuch der Öffentlichkeit zugänglich<br />
ist.<br />
Mogilev an der Dniester in der ukrainischen Provinz<br />
Vinnitsa wurde am 19. Juli 1941 von den Deutschen<br />
besetzt. Es wurde bald ein Sammelplatz für die aus<br />
Bessarabien und der Bukovina deportierten Juden und einer<br />
der fünf Zugänge nach Transnistrien, dem Gebiet in der<br />
Westukraine, das Hitler an Rumänien als Gegengabe für<br />
seine Beteiligung am Krieg gegen die Sowjetunion abtreten<br />
wollte. Zehntausende von Juden zogen durch die Stadt, aber<br />
nur etwa 12.000 – 15.000 konnten dort zusammen mit den<br />
etwa 3.700 örtlichen Juden bleiben. Im Juli 1942 wurde dort<br />
hinter Mauer und Stacheldraht ein Ghetto eingerichtet. Die<br />
Lebensbedingungen waren wegen Überfüllung, Hunger<br />
und Armut sehr hart. An einer Typhusepidemie starben in<br />
wenigen Monaten viele Menschen.<br />
Die jüdische Lagerleitung richtete ein jüdisches<br />
Zentralkomitee für die ganze Provinz ein, das verschiedene<br />
Wohlfahrtseinrichtungen aufbaute, darunter drei<br />
Waisenhäuser. Die Kinder lebten unter sehr schwierigen<br />
Bedingungen, elend, hungernd und krank. Erst nach<br />
11<br />
mehreren Monaten besserte sich ihr Zustand, so dass die<br />
Leitung der Waisenhäuser auch der Erziehung mehr Zeit<br />
widmen konnte. Rabbi Tauber beteiligte sich an dieser<br />
Aufgabe im Waisenhaus 1, das im April 1942 öffnete und<br />
im August 450 Kinder hatte. Er kam in die Leitung des<br />
Hauses, lehrte Hebräisch und die Bibel bis 1944, als das<br />
Haus geschlossen wurde und die Kinder nach Eretz Israel<br />
auswandern konnten. In einem Notizbuch, das der Rabbi als<br />
Andenken erhielt, haben ihn die Kinder als „guten Vater“<br />
bezeichnet. Eine Frau, die als Kind in dem Waisenhaus<br />
gelebt hatte, berichtete später, dass der Rabbi ihnen die<br />
Hoffnung auf Eretz Israel nach dem Krieg vermittelt habe.<br />
Rabbi Tauber begann mit seinem Tagebuch – in<br />
Deutsch mit hebräischer Schrift – im Oktober 1941.<br />
Darin schreibt er über das tägliche Unrecht im<br />
Ghetto, die von anderen erfahrenen Geschichten<br />
und Ereignissen: Juden in Verstecken; einem<br />
Kind, das seine Mutter gerettet hatte; dem Tod des<br />
15jährigen Poldi Lazarovitch, einem Mitglied der<br />
Redaktion der Zeitschrift des Waisenhauses; die<br />
bittere Kälte und die Knappheit von Salz; die Feier<br />
des ersten Hanukkaabends; usw. Dieses persönliche<br />
Dokument schildert das Leben der Juden im Ghetto<br />
von Mogilev aus der Sicht seines Verfassers, des geliebten<br />
Lehrers, der sich seinen Schülern gewidmet hatte. Durch<br />
die Restaurierung werden viele Besucher mehr über die<br />
Zustände in Mogilev erfahren und so ein umfassenderes<br />
Bild über das jüdische Leben während des Krieges in dieser<br />
Region bekommen.<br />
„Ich wusste, dass das Tagebuch in einem schlechten Zustand<br />
sein würde, wenn ich es behielte“, meinte Ruth Tauber. „Die<br />
Seiten bröckelten schon, aber ich hatte keine Möglichkeit,<br />
sie zu restaurieren. Ich wollte aber nicht, dass sie für immer<br />
verloren gehen. Außerdem sind sie in Yad Vashem viel<br />
sicherer, als bei mir zu Hause“. Und sie fügte hinzu: „In<br />
meinem Haus würde sie in einer Schublade auch niemand zu<br />
sehen bekommen, aber in Yad Vashem können die Besucher<br />
sie lesen und über die Ereignisse erfahren. So wird das<br />
Tagebuch eine Mahnung für alle Zeiten sein“.<br />
Restauration von Dokumenten im Archiv von Yad Vashem