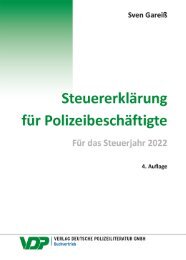Persönlichkeitsrechte von Polizeibeamten - Leseprobe
Tätliche Angriffe auf Polizeibeamte, gefilmte und veröffentlichte Polizeieinsätze, gezielte Diffamierungen von Polizisten in Sozialen Netzwerken, ACAB–Plakate in Fußballstadien, Tätowierungsverbote für Polizeibeamte - schon diese Beispiele verdeutlichen, dass Polizeibeamte sich tagtäglich in unterschiedlichsten Situationen im Spannungsfeld der grundgesetzlich garantierten Persönlichkeitsrechte mit ihrer (Vorbild-)Rolle als Repräsentanten des Staates und Träger des staatlichen Gewaltmonopols bewegen. Aber auch der Dienstherr steht in der Verpflichtung gegenüber den Polizeibeamten und darf deren Grundrechte nicht beliebig einschränken. Insbesondere die im Mai 2018 in Kraft getretene europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hat dieses Verhältnis neu definiert. Folgerichtig setzt sich der Autor in diesem Buch daher umfassend mit den Fragen auseinander, wie die einzelnen verfassungsrechtlichen Garantiebereiche der individuellen Persönlichkeitsentfaltung mit der Wirklichkeit des Polizeiberufes und der Polizeiwirklichkeit in Einklang zu bringen sind. Die Darstellung mit vielen Beispielen aus der täglichen Polizeipraxis und einer gründlichen verfassungsrechtlichen Herleitung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts wendet sich an alle Polizeibeamte und liefert ihnen einen wertvollen Ratgeber dafür, ihre Erfahrungen zu bewerten. So hilft das Buch jedem Polizisten dabei, ein starkes berufliches Selbstbewusstsein und hohes berufliches Selbstverständnis zu erlangen.
Tätliche Angriffe auf Polizeibeamte, gefilmte und veröffentlichte Polizeieinsätze, gezielte Diffamierungen von Polizisten in Sozialen Netzwerken, ACAB–Plakate in Fußballstadien, Tätowierungsverbote für Polizeibeamte - schon diese Beispiele verdeutlichen, dass Polizeibeamte sich tagtäglich in unterschiedlichsten Situationen im Spannungsfeld der grundgesetzlich garantierten Persönlichkeitsrechte mit ihrer (Vorbild-)Rolle als Repräsentanten des Staates und Träger des staatlichen Gewaltmonopols bewegen. Aber auch der Dienstherr steht in der Verpflichtung gegenüber den Polizeibeamten und darf deren Grundrechte nicht beliebig einschränken. Insbesondere die im Mai 2018 in Kraft getretene europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hat dieses Verhältnis neu definiert.
Folgerichtig setzt sich der Autor in diesem Buch daher umfassend mit den Fragen auseinander, wie die einzelnen verfassungsrechtlichen Garantiebereiche der individuellen Persönlichkeitsentfaltung mit der Wirklichkeit des Polizeiberufes und der Polizeiwirklichkeit in Einklang zu bringen sind.
Die Darstellung mit vielen Beispielen aus der täglichen Polizeipraxis und einer gründlichen verfassungsrechtlichen Herleitung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts wendet sich an alle Polizeibeamte und liefert ihnen einen wertvollen Ratgeber dafür, ihre Erfahrungen zu bewerten. So hilft das Buch jedem Polizisten dabei, ein starkes berufliches Selbstbewusstsein und hohes berufliches Selbstverständnis zu erlangen.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Historie<br />
der Terrorismusbekämpfung dienten. 157 Schwere Eingriffe in die informationelle Selbstbestimmung<br />
erfordern unter Proportionalitätsgesichtspunkten besondere Schutzmaßnahmen<br />
des Gesetzgebers. 158<br />
Neue Konkretisierungen der Anforderungen an die verfassungsrechtliche Rechtfertigung<br />
schwerwiegender Grundrechtseingriffe ergeben sich dabei aus dem Urteil zur Vorratsdatenspeicherung.<br />
159 Die dort aus Art. 10 GG abgeleiteten Anforderungen an Informationsmaßnahmen<br />
des Staates sind nur am Rand den spezifischen Erfordernissen des Fernmeldegeheimnisses<br />
geschuldet. Überwiegend können sie auch bei Eingriffen Geltung beanspruchen,<br />
die mangels sachlichen Bezugs zum Fernmeldegeheimnis nicht an Art. 10 GG, sondern am<br />
allgemeinen, vom Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit umfassten, Grundrecht auf<br />
informationelle Selbstbestimmung zu messen sind. Im Vorratsdatenspeicherungsurteil wird<br />
ein Katalog strenger Kriterien zur Beurteilung <strong>von</strong> Eingriffen in die informationelle Selbstbestimmung<br />
formuliert. 160<br />
In das durch den Rückgriff auf die Menschenwürde verstärkt abgesicherte allgemeine Persönlichkeitsrecht<br />
kann nur eingegriffen werden, wenn dies zum Schutz öffentlicher Interessen<br />
unerlässlich ist. 161 So sind z.B. die Entnahme <strong>von</strong> Körperzellen und deren molekulargenetische<br />
Untersuchung zur Identitätsfeststellung in künftigen Strafverfahren zur wirksamen<br />
Aufklärung künftiger Straftaten <strong>von</strong> erheblicher Bedeutung unabdingbar. 162<br />
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht steht auch den Beamten zu. Es stellt sich wegen der<br />
öffentlich-rechtlichen Ausgestaltung des Beamtenverhältnisses als eigenständiges Grundrecht<br />
dar. 163<br />
2. Historie 164<br />
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht hat eine „glänzende Karriere“ wie kaum ein anderes<br />
Recht des deutschen Privatrechts hinter sich. 165 Es wurde 1954 im Wege richterlicher<br />
Rechtsfortbildung aus Art. 1 und 2 Abs. 1 GG entwickelt und ist als „Sonstiges Recht“ i.S. <strong>von</strong><br />
§ 823 Abs. 1 BGB anerkannt. 166 Das allgemeine Persönlichkeitsrecht hat seinen Ursprung im<br />
157 BVerfG, Beschl. v. 04.04.2006 – 1 BvR 518/02, NJW 2006, 1939: Rasterfahndung; BVerfG, Urt. v. 27.02.2008 – 1 BvR 370/07<br />
und 1 BvR 595/07, NJW 2008, 822: Online-Durchsuchung; BVerfG, Urt. v. 11.03.2008 – 1 BvR 2074/05, NJW 2008, 1505:<br />
Automatisierte Kennzeichenerfassung; BVerfG, Urt. v. 24.04.2013 – 1 BvR 1215/07, NVwZ 2013, 1335: Anti-Terror-Datei.<br />
Zum Stand nach dem Antiterrordatei-Urteil des BVerfG Frenz, JA 2013, 840 ff.<br />
158 Britz, JA 2011, 81.<br />
159 BVerfG, Urt. v. 02.03.2010 – BvR 256/08 u.a., NJW 2010, 833: Vorratsdatenspeicherung. Unter einer „Vorratsdatenspeicherung“<br />
versteht man die Verpflichtung der Anbieter <strong>von</strong> Telekommunikationsdiensten, elektronische Kommunikationsvorgänge<br />
ihrer Kunden zu registrieren und bestimmte Daten auf Vorrat zu speichern. Das vorsorgliche Speichern dieser<br />
Daten, unabhängig <strong>von</strong> einem strafrechtlichen Anfangsverdacht oder konkreten Hinweisen auf eine Gefahrenlage, soll die<br />
Bekämpfung und Verfolgung <strong>von</strong> schweren Straftaten erleichtern. Das Urteil zur Vorratsdatenspeicherung fügt sich in eine<br />
mittlerweile bereits lange Reihe <strong>von</strong> Entscheidungen des BVerfG, in denen zwar formal die Vereinbarkeit eines deutschen<br />
Gesetzes mit dem Grundgesetz beurteilt wird, mittelbar jedoch auch die Rechtmäßigkeit europäischer Rechtsakte in den<br />
Blick genommen wird. Es ist seit Jahrzehnten kennzeichnend für das Verhältnis zwischen Bundesverfassungsgericht und<br />
Europäischem Gerichtshof, dass solche Konflikte nie bis zur konkreten Kollisionslage getrieben werden, Durner, JA 2010,<br />
391 (394).<br />
160 Britz, JA 2011, 81.<br />
161 BVerfGE 84, 239, 280: Zinsbesteuerung.<br />
162 BVerfGE 103, 21, 33: DNA-Analyse.<br />
163 Leuze, ZBR 1998, 187 (191).<br />
164 Zur geschichtlichen Entwicklung Neuner, JuS 2015, 961 ff.<br />
165 Lettmeier, JA 2008, 566.<br />
166 BGHZ 13, 334 = NJW 1954, 1404: Leserbrief.<br />
47