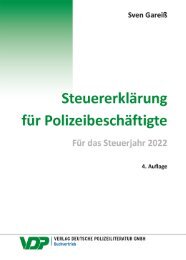Persönlichkeitsrechte von Polizeibeamten - Leseprobe
Tätliche Angriffe auf Polizeibeamte, gefilmte und veröffentlichte Polizeieinsätze, gezielte Diffamierungen von Polizisten in Sozialen Netzwerken, ACAB–Plakate in Fußballstadien, Tätowierungsverbote für Polizeibeamte - schon diese Beispiele verdeutlichen, dass Polizeibeamte sich tagtäglich in unterschiedlichsten Situationen im Spannungsfeld der grundgesetzlich garantierten Persönlichkeitsrechte mit ihrer (Vorbild-)Rolle als Repräsentanten des Staates und Träger des staatlichen Gewaltmonopols bewegen. Aber auch der Dienstherr steht in der Verpflichtung gegenüber den Polizeibeamten und darf deren Grundrechte nicht beliebig einschränken. Insbesondere die im Mai 2018 in Kraft getretene europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hat dieses Verhältnis neu definiert. Folgerichtig setzt sich der Autor in diesem Buch daher umfassend mit den Fragen auseinander, wie die einzelnen verfassungsrechtlichen Garantiebereiche der individuellen Persönlichkeitsentfaltung mit der Wirklichkeit des Polizeiberufes und der Polizeiwirklichkeit in Einklang zu bringen sind. Die Darstellung mit vielen Beispielen aus der täglichen Polizeipraxis und einer gründlichen verfassungsrechtlichen Herleitung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts wendet sich an alle Polizeibeamte und liefert ihnen einen wertvollen Ratgeber dafür, ihre Erfahrungen zu bewerten. So hilft das Buch jedem Polizisten dabei, ein starkes berufliches Selbstbewusstsein und hohes berufliches Selbstverständnis zu erlangen.
Tätliche Angriffe auf Polizeibeamte, gefilmte und veröffentlichte Polizeieinsätze, gezielte Diffamierungen von Polizisten in Sozialen Netzwerken, ACAB–Plakate in Fußballstadien, Tätowierungsverbote für Polizeibeamte - schon diese Beispiele verdeutlichen, dass Polizeibeamte sich tagtäglich in unterschiedlichsten Situationen im Spannungsfeld der grundgesetzlich garantierten Persönlichkeitsrechte mit ihrer (Vorbild-)Rolle als Repräsentanten des Staates und Träger des staatlichen Gewaltmonopols bewegen. Aber auch der Dienstherr steht in der Verpflichtung gegenüber den Polizeibeamten und darf deren Grundrechte nicht beliebig einschränken. Insbesondere die im Mai 2018 in Kraft getretene europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hat dieses Verhältnis neu definiert.
Folgerichtig setzt sich der Autor in diesem Buch daher umfassend mit den Fragen auseinander, wie die einzelnen verfassungsrechtlichen Garantiebereiche der individuellen Persönlichkeitsentfaltung mit der Wirklichkeit des Polizeiberufes und der Polizeiwirklichkeit in Einklang zu bringen sind.
Die Darstellung mit vielen Beispielen aus der täglichen Polizeipraxis und einer gründlichen verfassungsrechtlichen Herleitung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts wendet sich an alle Polizeibeamte und liefert ihnen einen wertvollen Ratgeber dafür, ihre Erfahrungen zu bewerten. So hilft das Buch jedem Polizisten dabei, ein starkes berufliches Selbstbewusstsein und hohes berufliches Selbstverständnis zu erlangen.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Persönlicher Schutzbereich<br />
4. Persönlicher Schutzbereich<br />
Bei der Prüfung des personalen Schutzbereichs („Wer wird geschützt?“) sind die Personen<br />
zu ermitteln, die durch das betreffende Grundrecht geschützt werden (Grundrechtsträger).<br />
a) Grundrechtsfähigkeit natürlicher Personen<br />
Träger des Persönlichkeitsrechts sind alle natürlichen Personen, einschließlich des nasciturus,<br />
mit Vollendung der Geburt. Auch Verbände und Personenmehrheiten sind vom Schutzbereich<br />
erfasst, soweit das allgemeine Persönlichkeitsrecht sinngemäß auf sie anwendbar<br />
ist. Dies ist etwa für den Schutz des sozialen Geltungsanspruchs eines Wirtschaftsunternehmens<br />
eindeutig zu bejahen. Dagegen scheidet ein Schutz der Intimsphäre eines Verbandes<br />
denknotwendig aus. 175<br />
Grundrechtsfähigkeit oder auch Grundrechtsträgerschaft bzw. Grundrechtssubjektivität ist<br />
die Fähigkeit einer natürlichen oder juristischen Person, Träger <strong>von</strong> Grundrechten zu sein. 176<br />
Auf ein Grundrecht kann sich nur berufen, wer konkret grundrechtsfähig ist. Dabei ist zwischen<br />
Menschen- und Bürgerrechten zu unterscheiden sowie zwischen der Grundrechtsberechtigung<br />
<strong>von</strong> natürlichen und juristischen Personen.<br />
Die Grundrechtsfähigkeit beginnt grundsätzlich mit Vollendung der Geburt und endet mit<br />
dem Tod (wenn die Hirnfunktionen irreversibel erloschen sind). Grundrechte können zum<br />
Teil aber auch schon vor der Geburt wirksam werden. So ist in Deutschland anerkannt, dass<br />
auch schon der Nasciturus (ungeborenes Leben im Mutterleib) das Recht auf Leben und körperliche<br />
Unversehrtheit hat. 177 Auch nach dem Tod können Grundrechte noch wirksam sein.<br />
Der Schutz der Persönlichkeit erlischt nicht mit dem Tod ihres Trägers. Anerkannt ist, dass<br />
das Persönlichkeitsrecht auch noch nach dem Tode Wirkungen entfaltet. Auch die ärztliche<br />
Schweigepflicht wirkt nach dem Tod des Betroffenen fort. 178 Bestehen keine Anhaltspunkte<br />
für die Äußerung eines Patienten zu Lebzeiten, dass der Arzt nach seinem Tod schweigen<br />
solle bzw. dass er Angaben machen dürfe, kommt es auf den mutmaßlichen Willen des<br />
Patienten an. 179 Die Mitteilung <strong>von</strong> Geheimnissen kann prinzipiell den Tatbestand des § 203<br />
StGB erfüllen. 180<br />
Das Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG kann aber nur einer lebenden Person zukommen, weil<br />
dieses auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit gerichtete Grundrecht die Existenz einer<br />
wenigstens potenziell oder zukünftig handlungsfähigen Person, also eines lebenden Menschen<br />
als unabdingbar voraussetzt. 181 Zwar endet mit dem Tod das Recht auf freie Entfaltung<br />
der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG), da „Entfaltung“ schon begrifflich eine handlungsfähige<br />
Person, also einen lebenden Menschen, voraussetzt. Aus Art. 1 GG folgt jedoch, dass der<br />
Verstorbene auch posthum nicht in seiner Würde verletzt werden darf. 182 Seit der Mephisto-<br />
175 Lettmaier, JA 2008, 566; instruktiv Specht-Riemenschneider/Riemenscheider/Schneider, 2020, S. 142 ff.<br />
176 Herrmann/Lang/Schneider 2004, S. 21<br />
177 Demgegenüber beginnt die Rechtsfähigkeit mit der Vollendung der Geburt, § 1 BGB.<br />
178 Adamus, jurisPR-FamR 14/2016 Anm. 7; Spickhoff, NJW 2005, 1982 (1983).<br />
179 OLG Koblenz, Beschl. v. 23.10.2015, 12 W 538/15, jurisPR-FamR 14/2016 Anm. 7 (Adamus).<br />
180 Im Bereich der Psychiatrie und Psychotherapie ist eine Überschreitung der durch § 203 StGB strafbewehrten ärztlichen<br />
Schweigepflicht besonders heikel. Hat der Patient eine Durchbrechung der Schweigepflicht zu erwarten, führt dies zur<br />
Verschlossenheit und gefährdet die Therapie. Deshalb ist selbst das Führen der Zusatzbezeichnung „Psychotherapie“, z.B.<br />
auf einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, schon als strafrechtlich bedenklich diskutiert worden, Spickhoff, NJW 2005,<br />
1982 (1983).<br />
181 Diederichsen, JURA 2008, 1 (7). Zum postmortalen Persönlichkeitsrecht verstorbener Straftäter Mitsch, NJW 2010, 3479 ff.<br />
182 BVerfG, Beschl. v. 25.08. 2000 – 1 BvR 2707/95: Schutz des postmortalen Persönlichkeitsrechts (Willy Brandt).<br />
49