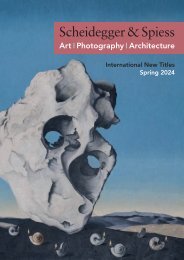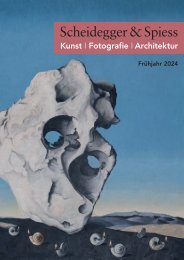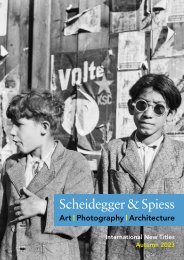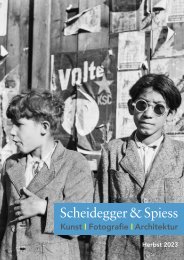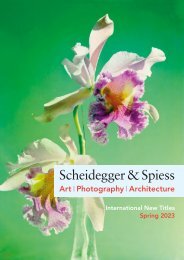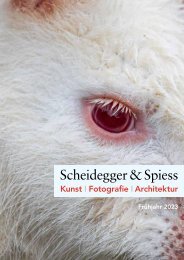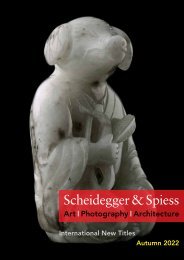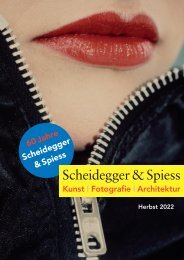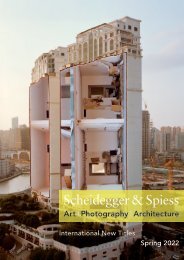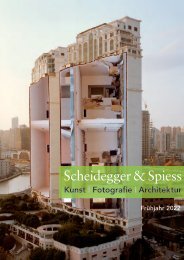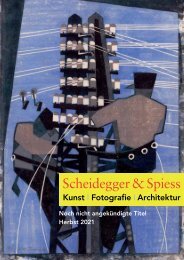Vorschau Scheidegger & Spiess Frühjahr 2021
Das aktuelle Frühlingsprogramm mit den Neuerscheinungen des Verlags Scheidegger & Spiess zu Kunst, Fotografie und Architektur. Briefe von Sophie Taeuber-Arp, der Katalog zur grossen Frühjahrsaustellung im Museum für Gestaltung, Zürich, zur Modeszene in der Schweiz, das grosse Buch zum Schaffen von Pia Zanetti von der Fotostiftung Schweiz und vieles mehr. Werfen Sie einen Blick in unser Programm!
Das aktuelle Frühlingsprogramm mit den Neuerscheinungen des Verlags Scheidegger & Spiess zu Kunst, Fotografie und Architektur. Briefe von Sophie Taeuber-Arp, der Katalog zur grossen Frühjahrsaustellung im Museum für Gestaltung, Zürich, zur Modeszene in der Schweiz, das grosse Buch zum Schaffen von Pia Zanetti von der Fotostiftung Schweiz und vieles mehr. Werfen Sie einen Blick in unser Programm!
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Scheidegger & Spiess
Kunst I Fotografie I Architektur
Frühjahr 2021
Wichtige Neuerscheinungen Herbst 2020
Dance Me to the End of Love
Ein Totentanz
Herausgegeben von Stephan Kunz
und Stefan Zweifel
In Zusammenarbeit mit dem
Bündner Kunstmuseum Chur
Broschur
344 Seiten, 137 farbige und
39 sw Abbildungen
16 × 23 cm
978-3-03942-000-1 Deutsch
sFr. 49.– | € 48.–
ISBN 978-3-03942-000-1
Totentänze, auch Makabertänze genannt, vergegenwärtigen
als Bildmotive den Tod und dessen Einfluss auf unsere irdische
Existenz. Dieses Buch widmet sich nicht der klassischen
Ikono grafie des Totentanzes, sondern stellt die Bewegung, die
Ekstase und die Metamorphose bis hin zur Auflösung im Tod
ins Zentrum. Es bildet einen medialen Rausch ab, der sich von
der Antike bis in die Gegenwart zieht.
9 783039 420001
Immer nur das Paradies
Augusto Giacometti – Die Tagebücher 1932–1937
Der Maler Augusto Giacometti (1877–1947), Abkömmling der
berühmten Bergeller Künstlerfamilie und geboren in Stampa,
lebte ab 1915 in Zürich, wo er in seinem Atelier an der Rämistrasse
Sammlerinnen und Auftraggeber empfing und zu einer
einflussreichen Figur des städtischen wie auch des nationalen
Kunstlebens wurde. Seine bislang nicht publizierten Tage bücher
der Jahre 1932 bis 1937 zeigen ihn auch als verletzliche Persönlichkeit,
die das zunehmend dramatische Weltgeschehen von
sich fernhielt und schrieb: «Man sollte immer nur das Paradies
Herausgegeben und kommentiert
von Caroline Kesser
Gebunden
280 Seiten, 84 farbige und
14 sw Abbildungen
18,5 × 23 cm
978-3-85881-684-9 Deutsch
sFr. 49.– | € 48.–
ISBN 978-3-85881-684-9
malen».
9 783858 816849
Richard Speer
The Space of Effusion
Sam Francis in Japan
Herausgegeben und mit einem
Vorwort von Debra Burchett-Lee
In Zusammenarbeit mit der Sam
Francis Foundation in Pasadena, CA
Gebunden
224 Seiten, 140 farbige und
50 sw Abbildungen
24 × 30 cm
978-3-85881-861-4 Englisch
sFr. 75.– | € 68.–
ISBN 978-3-85881-861-4
Sam Francis (1923–1994), einer der führenden Vertreter des
Abstrakten Expressionismus, reiste 1957 erstmals nach Japan,
wo er rasch mit einem weiten Kreis von Künstlern, Schriftstellern,
Filmemachern, Architekten und Musikern der Avantgarde
in Kontakt kam. Diese Monografie zeichnet erstmals
Francis’ Verbindungen zur Kunst- und Kulturszene Japans
der Nachkriegsjahre und seine komplexe, sich stetig fortentwickelnde
Beziehung zu der Ästhetik Ostasiens über fast vier
Jahrzehnte nach.
9 783858 818614
Schriften der Fondazione
Marguerite Arp, Locarno
Band 1
Herausgegeben von der
Fondazione Marguerite Arp
Kommentiert und mit einem
Beitrag von Walburga Krupp
sowie einem Vorwort von
Simona Martinoli
Gestaltet von Sabine Hahn
Broschur
ca. 92 Seiten, ca. 25 farbige und
sw Abbildungen
17 × 24 cm
978-3-03942-017-9 Deutsch
ca. sFr. 25.– | € 25.–
Erscheint im März 2021
Die italienische Ausgabe erscheint
bei Edizioni Casagrande, Bellinzona
ISBN 978-3-03942-017-9
9 783039 420179
Erstveröffentlichung der Briefe
und Postkarten von Sophie
Taeuber-Arp an ihre wichtigsten
Sammler und Förderer
Mit Faksimile-Abbildungen ausgewählter
Briefe und Postkarten
Kommentiert von der führenden
Spezialistin für Leben und Schaffen
von Sophie Taeuber-Arp
Erscheint anlässlich der Retrospektive
Sophie Taeuber-Arp. Gelebte
Abstraktion im Kunstmuseum
Basel (20. März bis 20. Juni 2021)
Die Briefe und
Postkarten von
Sophie Taeuber-Arp
an ihre ersten und
wichtigsten Sammler
Briefe von Sophie Taeuber-Arp
an Annie und Oskar Müller-Widmann
Das Basler Ehepaar Annie und Oskar Müller-Widmann begann schon früh, expressionistische
Kunst zu sammeln, und entdeckte gegen Ende der 1920er-Jahre auch die
abstrakte Kunst für sich. Das Haus des Paars auf dem Bruderholz in Basel war ein
Treffpunkt, an dem die herausragenden Protagonistinnen und Protagonisten der Moderne
verkehrten, darunter auch Hans Arp und Sophie Taeuber-Arp. Oskar und Annie
Müller-Widmann wurden zu engen Freunden der beiden und die ersten und über
Jahre hinweg wichtigsten Sammler ihrer Werke.
Erstmals werden nun in diesem Band die Briefe und Postkarten veröffentlicht, die
Sophie Taeuber-Arp zwischen 1932 und 1942 an das Ehepaar Müller-Widmann
schrieb. Darin geht es um das künstlerische Schaffen, um Ausstellungen und andere
Projekte, aber auch um private Umstände des Künstlerinnenlebens. Das geschlossen
erhaltene Konvolut stellt ein äusserst wichtiges Zeugnis zu Leben und Schaffen Sophie
Taeuber-Arps dar. Sämtliche Postkarten werden als Faksimiles abgebildet, die Texte
aller Briefe und Karten sowohl in Originalsprache transkribiert als auch in deutscher
Übersetzung wiedergegeben. Walburga Krupp, die führende Kennerin von Sophie
Taeuber-Arps Schaffen, hat die Briefe kommentiert und arbeitet in einem Essay die
Besonderheiten dieses Briefwechsels heraus.
Walburga Krupp war 1990–2012 Kuratorin der Stiftung Hans Arp und
Sophie Taeuber-Arp in Rolandseck und ist Co-Kuratorin der grossen
Taeuber-Arp-Retrospektive in Basel, New York und London 2021.
Simona Martinoli ist Kuratorin der Fondazione Marguerite Arp in Locarno
und Dozentin an der Università della Svizzera italiana in Mendrisio.
Scheidegger & Spiess
Frühjahr 2021 3
Die Überwindung
von «High» und «Low»:
Die legendäre Wiener
Werkstätte und ihre
Dependance in Zürich
Herausgegeben vom
Kunsthaus Zürich
Mit Beiträgen von Tobias G. Natter,
Rainald Franz, Niklaus M. Güdel,
Monika Mayer und Elisabeth
Schmuttermeier
Gestaltet von Lena Huber
Gebunden
ca. 208 Seiten, ca. 150 farbige
und sw Abbildungen
22 × 27 cm
978-3-03942-016-2 Deutsch
ca. sFr. 49.– | € 48.–
Erscheint im Mai 2021
ISBN 978-3-03942-016-2
Die erste umfassende Darstellung
der Verbindungen der Wiener
Werkstätte mit Zürich und der
Schweiz
Ein höchst attraktives Buch zu den
sehr populären Künstlern Klimt
und Hodler, das einen frischen
Blick von aussen auf den Schweizer
Nationalkünstler wirft
Reichhaltig illustriert mit Abbildungen
von rund 180 Werken, darunter
Gemälde, Entwürfe, Möbel,
Schmuck etc.
Erscheint anlässlich der gleichnamigen
Ausstellung im Kunsthaus
Zürich (21. Mai bis 29. August 2021)
9 783039 420162
Hodler, Klimt
und die Wiener Werkstätte
Als die Malerei in Wien um 1900 mit Gustav Klimt (1862–1918) einen Höhepunkt
erreichte, forderte dieser die Überwindung der traditionellen Unterscheidung von «hoher»
und «angewandter» Kunst. Seinen Überlegungen legte Klimt eine «ideale Gemeinschaft
der Schaffenden und Geniessenden» zugrunde. Zum nachhaltigen Motor einer
modernen Designentwicklung wurde das Schaffen der 1903 gegründeten Wiener
Werkstätte. Zu den Kunden der Wiener Werkstätte zählten Klimts wichtigste Auftraggeberinnen
– aber auch der Schweizer Künstler Ferdinand Hodler (1853–1918), der
1913 dort das Mobiliar für seine Genfer Wohnung in Auftrag gab. Seit der für Hodler
bahnbrechenden Ausstellung in der Wiener Secession von 1904 war er mit deren Ideen
bestens vertraut.
Ausgehend von diesem engen Verhältnis wirft das Buch zur gleichnamigen, von Tobias
G. Natter kuratierten Ausstellung aus Wiener Perspektive einen frischen Blick auf den
Schweizer Nationalkünstler. Erstmals werden darin auch die weiteren Beziehungen
der Wiener Werkstätte zu Zürich und zur Schweiz dargestellt, die 1917 mit der Gründung
einer eigenen Filiale an der Zürcher Bahnhofstrasse ihren Höhepunkt fanden.
Der Band ist reichhaltig illustriert mit Abbildungen von rund 180 Werken, darunter
Gemälde, Entwürfe, Möbel, Schmuck und anderes mehr.
Tobias G. Natter ist freier Kurator für führende Kunstmuseen weltweit, Autor zahlreicher
Publikationen und Herausgeber der Werkverzeichnisse Klimt (2012) und Egon Schiele (2017).
Rainald Franz ist Kustos der Sammlung Glas & Keramik am Museum für angewandte
Kunst MAK in Wien.
Niklaus M. Güdel ist Direktor der Archives Jura Brüschweiler, Schriftsteller und Kunstkritiker.
Monika Mayer leitet Archiv und Provenienzforschung am Museum Belvedere in Wien.
Elisabeth Schmuttermeier ist ehemalige Kuratorin und Leiterin des Wiener Werkstätte Archivs
am Museum für angewandte Kunst MAK in Wien.
Scheidegger & Spiess
Frühjahr 2021 5
Einblicke in eine
pulsierende Szene:
Porträts von rund
fünfzig innovativen
Schweizer Modelabels
Herausgegeben vom Museum
für Gestaltung Zürich, Karin Gimmi
und Christoph Hefti
Gestaltet von Marietta Eugster
Broschur
ca. 140 Seiten, ca. 200 farbige
Abbildungen
23 × 28,5 cm
978-3-03942-015-5
Deutsch / Englisch
ca. sFr. 29.– | € 29.–
Erscheint im Februar 2021
ISBN 978-3-03942-015-5
Ein höchst attraktiver Überblick
der innovativen Schweizer Modeszene,
der rund fünfzig Labels und
ihre aktuellen Arbeiten präsentiert
Reich illustriert mit Modeshootings
und Kampagnenbildern
Eingebettete Print-in-Motion-
Videos zeigen Designer in ihren
Ateliers und Interviews mit
Modeexperten und -expertinnen
Erscheint anlässlich der gleichnamigen
Ausstellung im Museum
für Gestaltung Zürich (Standort
Ausstellungsstrasse, bis 11. April
2021)
9 783039 420155
Wild Thing – Modeszene Schweiz
Mode ohne Massenproduktion, ohne Hollywood und internationale Fashion Weeks?
Fernab vom Scheinwerferlicht und vom Diktat der grossen Modezentren erproben in
der Schweiz kleine Labels, Kollektive, junge Studienabsolventinnen und Studienabsolventen
sowie etablierte Modemarken ihr Potenzial. Kreative Gestalterinnen und Gestalter
positionieren sich auf eigene Faust in Berlin, jonglieren im Modezirkus in Paris
mit oder richten in der Schweiz clevere Businesssysteme ein.
Das Buch Wild Thing – Modeszene Schweiz, das anlässlich einer Ausstellung im Museum
für Gestaltung Zürich erscheint, nimmt sich dieser Entwicklung und der daraus
entstehenden Produkte an. Es vermittelt aktuelle Themen – wie den Minimalismus
oder die Infragestellung etablierter Identitätszuschreibungen –, die Entwürfe, Designkonzepte
und Prozesse prägen. Zahlreiche Abbildungen zeigen Looks und Kreationen
bedeutender Labels, ausgewählte Outfits, Stofferfindungen und Kollektionspräsentationen.
Zusammen mit kurzen Interviews, Porträts der Designerinnen und Designer
und Themenbeiträgen entsteht so eine höchst attraktive Momentaufnahme der kreativen
und pulsierenden Modeszene Schweiz.
Das Buch ist zudem mit kurzen Print-in-Motion-Videos verknüpft, die starten, wenn
Lesende die Kamera ihres Mobiltelefons oder Tablets auf die entsprechende Abbildung
richten. Zu sehen sind Videos zu Designern, Interviews mit Modeexpertinnen und
Modeexperten sowie Beiträge von Modeschulen.
Karin Gimmi ist Kunsthistorikerin und Kuratorin am Museum
für Gestaltung Zürich.
Christoph Hefti ist Designer und lebt in Zürich und Brüssel.
2009 wurde er mit dem Schweizer Grand Prix Design ausgezeichnet.
Scheidegger & Spiess
Frühjahr 2021 7
Der Beginn einer
neuen Schaffensphase:
Paul Klees Studien
zur polyphonen Malerei
Weiterhin lieferbar in der Reihe
Schlüsselwerke der Schweizer Kunst:
Walburga Krupp
Sophie Taeuber-Arp – Equilibre
978-3-85881-662-7
Deutsch / Englisch
sFr. 29.– | € 29.–
Angelika Affentranger-Kirchrath
Franz Gertsch – Rüschegg
978-3-85881-663-4
Deutsch / Englisch
sFr. 29.– | € 29.–
Herausgegeben von
Angelika Affentranger-Kirchrath
Gestaltet von Arturo Andreani
Gebunden
ca. 96 Seiten, ca. 40 farbige
Abbildungen
21,5 × 25 cm
978-3-03942-011-7
Deutsch / Englisch
ca. sFr. 29.– | € 29.–
Eine fundierte Studie zu Paul Klees
Gemälde Ad Parnassum, einem
Schlüsselwerk im Schaffen des
Malers
Beleuchtet den Entstehungshintergrund
von Klees Suche nach
einer polyphonen Malerei in
Analogie zur mehrstimmigen Musik
Erscheint im April 2021
ISBN 978-3-03942-011-7
9 783039 420117
Oskar Bätschmann
Paul Klee – Ad Parnassum
Schlüsselwerke der Schweizer Kunst
In den 1920er-Jahren begann Paul Klee (1879–1940), sich intensiv mit der polyphonen
Malerei – der mehrstimmigen Malerei in Analogie zur Musik – auseinanderzusetzen.
Die Studien des unermüdlichen Experimentators fanden ihren Anfang zunächst am
Bauhaus in Dessau, entwickelten sich während seiner Zeit an der Kunstakademie
Düsseldorf weiter und fanden ab 1933 mit Klees Rückkehr nach Bern ihren Abschluss.
Der international anerkannte Kunsthistoriker Oskar Bätschmann erkundet in diesem
Band dessen Haupt- und Schlüsselwerk Ad Parnassum (1932). Das Gemälde entstand
kurz nach Klees Weggang vom Bauhaus und steht sinnbildlich für eine neue Ära sowie
die Selbstfindung des Künstlers. Bätschmann dokumentiert das Streben des Künstlers
nach einer Verbindung von Musik und Malerei in den Klängen der Farben und in der
rhythmischen Bewegung farbiger Punkte.
Reich illustriert setzt das Buch am Beispiel dieses Schlüsselwerks Klees polyphones
Kunstverständnis in einen kunsthistorischen Kontext und gibt Aufschluss über das
synästhetische Denken, das in jenen Jahren aufkam.
Oskar Bätschmann lehrte bis 2009 als Professor für Kunstgeschichte
der Neuzeit und der Moderne an der Universität Bern. Er war Mitglied
der Paul-Klee-Stiftung und Mitinitiator des von 1998 bis 2004
erschienenen Catologue raisonné des Künstlers.
Scheidegger & Spiess
Frühjahr 2021 9
Eine zeitgemässe und
reflektierte Auseinandersetzung
mit der Art brut
am Beispiel einer beeindruckenden
Sammlung
Herausgegeben von
Markus Landert
Mit Beiträgen von Martina Denzler,
Markus Landert, Rolf Röthlisberger
und Astrid Sedlmeier
Gestaltet von Urs Stuber
In Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum
Thurgau
Gebunden
ca. 320 Seiten, 320 farbige Abbildungen
23 × 30 cm
978-3-03942-014-8 Deutsch
ca. sFr. 59.– | € 58.–
Kunstschaffen von Aussenseitern
der Gesellschaft ist ein Thema von
anhaltender Aktualität und erhält
zunehmende Aufmerksamkeit
Präsentiert erstmals einen Überblick
über eine herausragende
Sammlung von Aussenseiterkunst
und Art brut
Erscheint anlässlich der gleichnamigen
Ausstellung im Kunstmuseum
Thurgau (21. März bis
19. Dezember 2021)
Erscheint im März 2021
ISBN 978-3-03942-014-8
9 783039 420148
Jenseits aller Regeln
Aussenseiterkunst – ein Phänomen
Während über dreissig Jahren hat Rolf Röthlisberger, passionierter Sammler und ehemaliger
Leiter des Psychiatrie-Museums der Klinik Waldau bei Bern, eine beeindruckende
Sammlung von Aussenseiterkunst zusammengetragen, die von den 1920er-
Jahren bis ins frühe 21. Jahrhundert reicht. Sie vereint Werke von künstlerisch tätigen
Menschen, die wegen psychischer Krankheit, kognitiver Beeinträchtigung oder anderer
widriger Umstände am Rand der Gesellschaft stehen. Mit den Künstlerinnen und
Künstlern in engem Kontakt stehend, erwarb Röthlisberger die Werke bei persönlichen
Besuchen in Kliniken, Ateliers oder Privatwohnungen direkt von ihnen.
Dieses Buch, das anlässlich einer Ausstellung im Kunstmuseum Thurgau erscheint,
präsentiert erstmals eine grosse Auswahl von Werken aus der Sammlung Rolf Röthlisbergers.
Neben der Sammlung als solcher rückt die Theorieentwicklung rund um die
Aussenseiterkunst in den Fokus. Markus Landerts Essay widmet sich dem Umgang
mit der Kunst aus einer verrückten Welt. Kurztexte von Martina Denzler, Astrid Sedlmeier
und Markus Landert untersuchen die Schwerpunkte der Sammlung anhand von
Hauptwerken. Ein Interview mit Rolf Röthlisberger schliesslich gibt Einblick in die
Entstehung seiner herausragenden Sammlung.
Markus Landert ist Kunsthistoriker und Direktor des Kunstmuseums
des Kantons Thurgau / Ittinger Museum. Er ist Autor zahlreicher Artikel
zur Art brut.
Scheidegger & Spiess
Frühjahr 2021 11
Kunst und Heilung:
Emma Kunz’ faszinierendes
Gesamtwerk im Spiegel
der Gegenwart
Herausgegeben von Yasmin Afschar
Mit Beiträgen von Yasmin Afschar,
Lars Bang Larsen, Elise Lammer,
Ingo Niermann, Marco Pasi,
Julia Voss u.a.
In Zusammenarbeit mit dem
Aargauer Kunsthaus, Aarau
Gestaltet von Atlas Studio
Broschur
ca. 208 Seiten, ca. 200 farbige
Abbildungen
23 × 31 cm
978-3-85881-682-5
Deutsch / Englisch
ca. sFr. 49.– | € 48.–
Erscheint im März 2021
ISBN 978-3-85881-682-5
Greift mit Spiritualität und alternativen
Heilmethoden aktuelle
Themen auf, die Kunstschaffende
und die Gesellschaft gleichermassen
beschäftigen
Die künstlerischen Arbeiten der
Forscherin und Naturheilpraktikerin
Emma Kunz finden international
grosse Beachtung und wurden in
jüngster Zeit in Venedig, München,
London und Tel Aviv gezeigt
Werkabbildungen und Interviews
zeigen künstlerische Positionen
der Gegenwart im Dialog mit dem
Werk und Wirken von Emma Kunz
Erscheint zur gleichnamigen Ausstellung
im Aargauer Kunsthaus,
Aarau (23. Januar bis 24. Mai 2021)
9 783858 816825
Kosmos Emma Kunz
Eine Visionärin im Dialog mit zeitgenössischer Kunst
Die Aargauer Forscherin, Naturheilpraktikerin und Künstlerin Emma Kunz (1892–
1963) schuf Zeichnungen auf der Grundlage von Fragen und Visionen, die sie durch
Pendeln auf Millimeterpapier kartografierte. Davon ausgehend erarbeitete sie komplexe
Systeme aus Linien, Formen und Flächen. Das Werk der Autodidaktin, die das
Pendel auch für ihre Arbeit als Heilerin verwendete, ist ein frühes Beispiel eines erweiterten
Kunstbegriffs.
Im Buch tritt Kunz’ Wirken in einen Dialog mit Positionen der zeitgenössischen Kunst.
Werke von Agnieszka Brzeżańska, Joachim Koester, Goshka Macuga, Shana Moulton,
Rivane Neuenschwander, Mai-Thu Perret und anderen nehmen Themen auf, die dem
Schaffen von Emma Kunz verwandt sind, und erlauben so einen frischen Blick darauf.
Neben Interviews mit den Künstlerinnen und Künstlern widmen sich Essays der Wirkungsgeschichte
des Visionären in der Kunst und heben die Aktualität der Arbeiten
von Emma Kunz hervor. Ein innovativer Ausstellungsrundgang per 3D-Laserscantechnologie
vervollständigt das Buch.
Yasmin Afschar ist Kunsthistorikerin und seit 2018 Kuratorin
am Aargauer Kunsthaus, Aarau.
Scheidegger & Spiess
Frühjahr 2021 13
Weekend Project I, 2003, 30-teilige Serie, Eitempera auf Leinwand,
montiert auf MDF, je 41 x 32 cm, Privatsammlung
15
27
49
Beratung, 2013, Öl und Acryl
auf Leinwand, montiert auf MDF,
27 x 51.5 cm, Privatsammlung
61
16
28
Ohne Titel, 2001 / 02, neun Koffer,
Auskleidung Acryl auf Baumwolle,
je ca. 18 x 55 x 40 cm, Installation
variabel
50
62
19
Kommode, 1999, Eitempera auf
Leinwand, 94 x 115 cm
Ohne Titel, 1996, Eitempera und
Acryl auf Leinwand, 170 x 230 cm,
Kunstsammlung der Zürcher
Kantonalbank
63
32 Fenchelsalami, 2017, Gips,
Acryl, Pigment, Lack, Schnur,
sortiert, je 33 x 6 x 6 cm,
Installation variabel
97
20
64
98
Ruth Schweikert
Nach dem Wochenende
Schaumgeboren ist Aphrodite, die Göttin der Liebe und der Schönheit; von Zeiträumen
träumte ihr, von Äonen und Augenblicken, von Ewigkeitssehnsucht und
rasendem Stillstand auch. Raumträume, die sich in Traumräume verwandeln, während
Betrachter*innen gedankenverloren vor dreissig Tableaus stehen, die je ein
mit dunkelgelber, weisslich schäumender Flüssigkeit (mehr oder minder) gefülltes
(Bier-)Glas zeigen. Sogleich steigen weitere Bilder auf, Erinnerungen an Sommerabende
unter Platanen, an Blätterrauschen, Kieselsteine und Seeluft; wechselnde
Lichtspiele, die eine Zeit lang haften bleiben auf menschlichen Netzhäuten, während
am Nebentisch jemand eine Geschichte erzählt, von einem japanischen Pilz
namens Matsutake, oder wie Indonesien, damals niederländisch Ostindien, zur
Weltausstellung 1900 in Paris einen gigantischen Baldachin verschifft habe, gewoben
von Tausenden von Spinnen, ein hochfiligranes, phantastisches Kunstwerk
der Natur – das sich bei seiner Ankunft, wirft eine andere ein, im Hafen von Marseille
in einen Haufen Schimmel verwandelt hatte.
Weekend Project I, 2003, 30-teilige Serie, Eitempera auf Leinwand, montiert
auf MDF, je 41 x 32 cm: ebenso sorgfältig wie die Pinselstriche sind auch die Materialangaben
zum Werk; gemalt hat Christoph Hänsli die dreissig Bilder im Jahr
2003, in Erinnerung vielleicht an, in Vorwegnahme und / oder während des schon
damals – etwas übereilt! – sogenannten Jahrhundertsommers; wer ihn erlebt
hat, erinnert sich an eine schier endlose Aneinanderreihung überhitzter Tage;
ge nauso gut allerdings, denke ich, könnten die Vorlagen aus den Sechzigerjahren
des 20. Jahr hunderts stammen oder gar aus den Roaring Twenties. Trinkgefässe
und Tranksame, die Gläser, das Bier: Beides hat sich, seit meine längst verstorbenen
Gross eltern sich in einem Berliner Biergarten zum ersten Mal zuprosteten,
nicht wesentlich verändert; auch die verwendeten Arbeitsmaterialien, Eitempera
und Leinwand, gehören seit vielen Jahrhunderten zum Werkzeug bildender Künstler*innen.
Einzig die (unsichtbar verhüllten) MDF-Platten verweisen auf eine Zeit
ab den späten Achtzigerjahren, als die mitteldichte Holzfaserplatte sich weltweit
verbreitete.
Dreissig Tableaus also mit dreissig Feierabendbieren, keines ganz ausgetrunken,
Schaum oder Schaumspuren in jedem Glas; an einen Einzelnen denke ich, an
dreissig Momentaufnahmen im Laufe der Zeit, von Frühling bis Hochsommer, von
Spätherbst bis Wintereinbruch, oder gar von 1941 bis 2018, vom ersten, heimlichen
Bier des vierzehnjährigen Maurerlehrlings bis zum letzten, unter Auslassung einiger
Hunderter oder Tausender Stangen, Chübeli, Herrgöttli, je nach Trinktemperament,
Lebensdauer und Bierdurst. An dreissig Freund*innen dachte ich, die sich
auf ein Feierabendbier treffen – bloss wo? Denn weit und breit ist kein Biergarten
in Sicht, weder ein nettes Quartier-Restaurant noch eine Hafenbar, auch keine Kleine
Kneipe in unserer Strasse, und so trinkt jede*r für sich, zu Hause im Nirgend wo,
oder nirgendwo zu Hause, Somewheres, Anywheres and everyone beyond, vor
normiert-neutralem Bildhintergrund, der nichts von sich preisgibt, keine weiteren
Die stille Poesie
des Alltäglichen,
mit Texten von
zehn bekannten
Autorinnen und
Autoren
Herausgegeben von
Franziska Stern-Preisig
Mit Beiträgen von Christian
Hackenberger, Cathérine Hug,
Juerg Judin & Pay Matthis Karstens,
Tim Krohn, Friedrich Meschede,
Gianna Molinari, Erik Porath,
Judith Schalansky, Ruth Schweikert
und Ulrike Vedder
Gestaltet von Atelier Pol, Bern
Zeigt zwischen 1998 und 2020
entstandene Arbeiten des international
beachteten Schweizer
Malers und Konzeptkünstlers
Christoph Hänsli in einer Ausstellungspräsentation
Mit Texten zu den Werken von zehn
bekannten Schriftstellerinnen,
Galeristen, Kuratorinnen, Künstlern
und Wissenschaftlerinnen
In Zusammenarbeit mit der Villa
Renata, Basel
Broschur
100 Seiten, 39 farbige
Abbildungen
21,5 × 29,5 cm
978-3-03942-002-5 Deutsch
sFr. 39.– | € 38.–
Lieferbar
ISBN 978-3-03942-002-5
9 783039 420025
Christoph Hänsli – Die Konferenz der Dinge
Der Schweizer Konzeptkünstler Christoph Hänsli (*1963) – international bekannt geworden
durch das Werk Mortadella – bedient sich in erster Linie der Malerei als
Medium. Als Motive wählt er häufig Gegenstände, die an Alltäglichkeit kaum zu
überbieten sind. So entstehen empathische Porträts von Staubsaugern, Koffern, Biergläsern,
Archivschachteln oder auch vom Hauptschalter eines Krematoriums. Vergänglichkeit,
Abwesenheit und Erinnerung sind wichtige Themen seines Schaffens.
In diesem Buch haben zehn Autorinnen und Autoren ein Bild gewählt, das sie besonders
anspricht, und einen Text dazu verfasst. Dazu gehören die Schriftstellerinnen
Judith Schalansky, Ruth Schweikert und Gianna Molinari und der Schriftsteller Tim
Krohn, die Galeristen Juerg Judin und Pay Matthis Karstens, der Kurator Friedrich
Meschede und die Kuratorin Cathérine Hug, die Literaturwissenschaftlerin Ulrike
Vedder, der Chemieprofessor Christian Hackenberger und der Philosoph, Medienwissenschaftler
und Künstler Erik Porath. So ist eine wunderbar liebevolle Hommage an
die berückende Banalität der Dinge entstanden.
Franziska Stern-Preisig ist die Gründerin und Geschäftsführerin
der Villa Renata in Basel.
Scheidegger & Spiess
Frühjahr 2021 15
Herausgegeben vom
Kunsthaus Zürich
In Zusammenarbeit mit der
Einfachen Gesellschaft Kunsthaus-
Erweiterung
Gestaltet von Stefan Hunziker
Corti, Büro4
Broschur
52 Seiten, 57 farbige und
5 sw Abbildungen
19 × 23 cm
978-3-85881-696-2 Deutsch
978-3-85881-875-1 Englisch
978-3-85881-876-8 Französisch
sFr. 15.– | € 15.–
Erscheint anlässlich der Fertigstellung
von David Chipperfields
Erweiterungsbau für das Kunsthaus
Zürich im Dezember 2020
Die Fertigstellung des neuen
Erweiterungsbaus markiert den
grössten Entwicklungssprung
in der Geschichte des Kunsthaus
Zürich
Lieferbar
ISBN 978-3-85881-696-2
Deutsch
9 783858 816962
ISBN 978-3-85881-876-8
Französisch
ISBN 978-3-85881-875-1
Englisch
9 783858 818751
Kunsthaus Zürich:
ein Kunstmuseum
für das 21. Jahrhundert
9 783858 818768
Das neue Kunsthaus Zürich
Museum für Kunst und Publikum
Weiterhin lieferbar:
Die Baugeschichte
des Kunsthaus Zürich 1910–2020
978-3-85881-676-4 Deutsch
978-3-85881-859-1 Englisch
978-3-85881-860-7 Französisch
sFr. 19.– | € 19.–
ISBN 978-3-85881-676-4
Deutsch
9 783858 816764
ISBN 978-3-85881-860-7
Französisch
9 783858 818607
ISBN 978-3-85881-859-1
Englisch
9 783858 818591
Im Dezember 2020 wird David Chipperfields markanter Erweiterungsbau des Kunsthaus
Zürich fertiggestellt. Damit ist das Kunsthaus auf nahezu doppelte Grösse gewachsen
und – zusammen mit den vorangegangenen Umbauten und Sanierungen der
älteren Gebäude – zu einem zeitgemässen Kunstmuseum des 21. Jahrhunderts geworden.
Nach dem im Frühjahr 2020 erschienenen Band Die Baugeschichte des Kunsthaus
Zürich 1910–2020 stellt dieses Buch nun das neue Kunsthaus umfassend vor. Es zeigt
auf, wie die Bauaufgabe für ein Museum im 21. Jahrhundert gelöst werden konnte.
Konzise Texte, Aussagen von Projektbeteiligten und von künftigen Besucherinnen und
Nutzern sowie zahlreiche Abbildungen zeichnen den Entstehungsprozess des Erweiterungsprojekts
und den Bauablauf nach und betrachten das vollendete Werk aus
unterschiedlichen Perspektiven. Das Buch beleuchtet auch die Bedürfnisse, die ein
Museumsbau heutzutage erfüllen muss. Es untersucht, welche architektonischen und
städtebaulichen Qualitäten gefragt sind und welche finanziellen und organisatorischen
Herausforderungen dies alles für die Projektrealisierung bedeutete. In einem Gespräch
mit Expertinnen und Experten wird schliesslich der Frage nachgegangen, wie der
Neubau und das neue Kunsthaus insgesamt die unmittelbare Umgebung und die Stadt
als Ganzes verändern.
Das Kunsthaus Zürich ist eines der führenden Kunstmuseen Europas
und ab 2021 das grösste der Schweiz. Seine Sammlung umfasst Werke
vom Mittelalter bis zur Gegenwart mit besonderen Schwerpunkten
auf dem französischen Impressionismus und Postimpressionismus sowie
der klassischen Moderne.
Scheidegger & Spiess
Frühjahr 2021 16
Herausgegeben von
The Missing Link
Gestaltet von Studio Sauvage
Gebunden
ca. 256 Seiten, ca. 150 farbige und
sw Abbildungen
22,5 × 28,5 cm
978-3-03942-018-6 Deutsch
ca. sFr. 49.– | € 48.–
Erscheint im April 2021
ISBN 978-3-03942-018-6
9 783039 420186
Untersucht das Phänomen Traum
in seiner Vielfältigkeit als Angriff
auf unsere Selbstverständlichkeiten
ebenso wie hinsichtlich der Ausweitung
unserer Möglichkeiten
Behandelt eine breite Themenpalette
aus Kunst, Architektur,
Psychologie, Theater, Film und
Wissenschaft
Bietet neue Texte von Künstlerinnen,
Kulturwissenschaftlern, Architektinnen
und Psychoanalytikern,
die aller hier erstmals veröffentlicht
werden
Mit Beiträgen u.a. von Elisabeth
Bronfen, Olaf Knellessen, Una
Szeemann, San Keller, Andres
Bosshard, Florian Faller und
Manuel Zahn
Träume gestalten
die Entwürfe
unserer Welt und
unserer Kultur
Traumstationen – Geheimagent Traum
Versuche zur Spannung zwischen Anonymität und Individualität
Träume sind nicht nur Ausdruck der Psyche, sondern auch Verarbeitungen von Erfahrungen
mit der uns umgebenden Welt. Sie bringen unterschiedlichste Zeiten und
Räume zusammen. Dieses Buch ist aus einem Gemeinschaftsprojekt des Psychoanalytischen
Seminars Zürich und des Zürcher Theaters Neumarkt mit Künstlerinnen,
Intellektuellen und Psychologen zum Thema hervorgegangen. Dies unter aktiver Teilnahme
der Bevölkerung: An verschiedenen Orten wurden «Traumboxen» aufgestellt,
in die man aufgeschriebene Träume einwerfen konnte, zudem wurden Träume über
eine telefonische Hotline, eine E-Mail-Adresse und sogar eine mobile Traumstation,
eine Velo-Rikscha, gesammelt.
Im Buch wird das Phänomen Traum nun u. a. von Künstlerinnen, Kulturwissenschaftlern,
Architektinnen und Psychoanalytikern in seiner Vielfältigkeit und seinem Schillern,
in seiner Lust wie in seinem Schrecken, als Angriff auf unsere Selbstverständlichkeiten
wie hinsichtlich der Ausweitung unserer Möglichkeiten untersucht. So bringt
es – wie der Traum selbst – unterschiedliche Medien zusammen: die Sprache, den Text
und seine Geschichten ebenso wie den Film und die Bilder, die Musik und ihre Stimmen.
Entstanden ist eine spannende Mischung von Text- und Kunst-Beiträgen, die ein
weites Themenfeld aufspannen, das vom Traum in Game-Design und Experimentalfilm
bis hin zu Shakespeare reicht, der Traum, Bühne und Wahn ständig miteinander
verwoben hat.
The Missing Link ist eine Initiative des Psychoanalytischen Seminars
Zürich. Der gleichnamige Preis für Psychoanalyse wird für hervorragende
Arbeiten im interdisziplinären Austausch der Psychoanalyse mit anderen
wissenschaftlichen Disziplinen verliehen.
Scheidegger & Spiess
Frühjahr 2021 17
JESSE LEE JONES, NASHVILLE, TN
88
168
47
LYDIA FAITHFULL, LAS VEGAS, NV
89
169
176
SEPTEMBER 5, 2016, NEW YORK
CULTURAL HISTORIAN
177
1
CHARLIE SCHEIPS
INTERVIEW SECTION
NEWS P 93
ELECTION P 107
EXPERTISE P 122
FUTURE P 145
DREAMS P 156
I think there are
larger social forces
than the president
of the United States.
Ein faszinierendes
Porträt der USA
in Zeiten der
Ungewissheit
social forces,
void
the antics
just a consumer.
revolutionary act
cornerstone
Darwinian
jukebox
pictures
policies?
Climate change
social control
and vote.
Blind trust, porno
it’s online,
common thread
ideology.
capture moments, weaker
Herausgegeben von
Ludovic Balland mit Pauline Mayor
Fotografien und Texte von Ludovic
Balland. Mit Vorworten von Julien
Gester, Brice Matthieussent und
Hilar Stadler
Gestaltet von Ludovic Balland
Broschur
276 Seiten, 69 farbige und
139 sw Abbildungen
24 × 33 cm
978-3-85881-880-5 Englisch
sFr. 39.– | € 38.–
Eine neue Auswahl und Zusammenstellung
aus dem Material, das
Ludovic Balland 2016 für sein viel
beachtetes «Archiv amerikanischer
Leserinnen und Leser» zusammengetragen
hat
Die Originalausgabe American
Readers at Home wurde mit dem
German Design Award 2019 in
Gold und in den Wettbewerben
der Schönsten Deutschen Bücher
und Schönsten Schweizer Bücher
2018 ausgezeichnet
Lieferbar
ISBN 978-3-85881-880-5
9 783858 818805
American Readers at Home – New Cut
«Ein faszinierendes Zeitdokument der Widersprüchlichkeiten», schrieb Die Zeit, als
American Readers at Home 2018 erschien. Der Schweizer Publizist Daniel Binswanger
nannte es «die Psychoanalyse der amerikanischen Mediennutzung». Bald schon war
das Buch vergriffen, was wohl auch an den vielen Auszeichnungen lag, die es erhielt:
German Design Award 2019 in Gold, Schönste Deutsche Bücher, Schönste Schweizer
Bücher.
Nun legt der Gestalter und Fotograf Ludovic Balland eine neue Zusammenstellung
seines viel beachteten Materials vor: American Readers at Home – New Cut. Auf
276 Seiten verbinden sich Fotografien von Stadtlandschaften, Interviews mit amerikanischen
Zeitungslesern über ihre Mediengewohnheiten, Fotoporträts derselben Menschen
sowie Faksimiles von Zeitungsseiten und zu Collagen zusammengefügte Statements
über den Zustand der USA im 21. Jahrhundert. Aufgenommen hat Ludovic
Balland die Interviews und die Fotografien im Präsidentschaftswahlkampf 2016. Aber
nichts davon hat an Aussagekraft oder Dringlichkeit verloren – im Gegenteil!
Julien Gester, Kulturjournalist für Libération, und der Kurator Hilar Stadler haben
neue Vorworte beigesteuert.
Ludovic Balland lebt und arbeitet als Grafikgestalter und Entwickler
kompletter Buchkonzepte in Basel. Er ist Professor für Typografie an der
Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig.
Scheidegger & Spiess
Frühjahr 2021 19
Die Welt mit der Kamera
befragen: Das Lebenswerk der
Fotojournalistin Pia Zanetti
Herausgegeben von Peter Pfrunder
mit Jürg Trösch
Mit Beiträgen von Nadine
Olonetzky und Peter Pfrunder
In Zusammenarbeit mit der
Fotostiftung Schweiz und Codax
Publisher
Gestaltet von
Hanna Williamson-Koller
Erste umfassende Monografie
über Pia Zanetti, eine der wichtigsten
Schweizer Fotojournalistinnen
Reich illustriert, auch mit teilweise
bisher unveröffentlichtem Material
aus dem Archiv der Fotografin
Erscheint anlässlich der gleichnamigen
Ausstellung in der Fotostiftung
Schweiz (23. Januar bis
23. Mai 2021)
Klappenbroschur
196 Seiten, 153 farbige und
199 sw Abbildungen
24 × 34 cm
978-3-03942-008-7 Deutsch
sFr. 49.– | € 48.–
Erscheint im Januar 2021
ISBN 978-3-03942-008-7
9 783039 420087
Pia Zanetti. Fotografin
Die Fotografin Pia Zanetti, geboren 1943, arbeitete nach ihrer Lehre als Fotografin in
Basel ab 1963 für die wichtigsten in- und ausländischen Printmedien und für zahlreiche
NGOs. Hartnäckig behauptete sie sich in einer Domäne, die lange Zeit von Männern
dominiert wurde. Sie bereiste zunächst Europa, später die ganze Welt. Dabei galt ihr
Interesse immer den Menschen, die sie auf der Strasse, bei der Arbeit oder in der
Freizeit aufnahm. Einfühlsam, kritisch und präzis hielt sie kleine und grosse Dramen
fest – in einem Alltag, der immer auch von der Politik mitgeprägt war.
Pia Zanetti. Fotografin gibt mit einem umfangreichen Bildteil Einblick in das langjährige
und vielfältige Schaffen der Fotojournalistin. Aus ihrem Archiv wurden jene
Aufnahmen ans Licht geholt, die mehr als Dokumente sind – einprägsame Bilder, in
denen Pia Zanetti Ereignissen und Begegnungen mit Menschen ein Stück Poesie abgerungen
hat. Nadine Olonetzky zeichnet Pia Zanettis Werdegang und ihr Schaffen
nach, Peter Pfrunder beschäftigt sich mit ihrem charakteristischen Blick und der Wirkung
ihrer Bilder. Eine Würdigung von Leben und Werk einer Fotografin, die mit der
Kamera die Solidarität und den Widerstand gegen Unrecht festhielt, aber auch jene
glücklichen Momente einfing, in denen Träume wahr werden.
Peter Pfrunder ist Publizist mit Spezialgebiet Fotografie, Kultur- und
Alltagsgeschichte und seit 1998 Direktor und Kurator der Fotostiftung
Schweiz.
Scheidegger & Spiess
Frühjahr 2021 21
31
Ernst Heiniger in seinem Wohnatelier an der Bahnhofstrasse, Zürich, 1945-65
71
216 217
Von Engwang im Thurgau
nach Hollywood:
Fotograf und Kurzfilmpionier
Ernst A. Heiniger
79
446 447
machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges
erklommen hatte, warf es einen letzten Blick
zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen,
die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner
eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine
rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen
Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte
das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal
umgeschrieben worden und alles, was von ihrem Ursprung
noch übrig wäre, sei das Wort “und” und das Blindtextchen
solle umkehren und wieder in sein eigenes, sicheres Land
zurückkehren. Doch alles Gutzureden konnte es nicht
überzeugen und so dauerte es nicht lange, bis ihm ein paar
heimtückische Werbetexter auflauerten, es mit Longe und
Parole betrunken machten und es dann in ihre Agentur
schleppten, wo sie es für ihre Projekte wieder und wieder
mißbrauchten. Und wenn es nicht umgeschrieben wurde,
dann benutzen Sie es immernoch. Weit hinten, hinter den
Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien
leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen
an der Küste des Semantik, eines großen
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt
durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem
New York City, 1940 → S. 50
gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von
der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht
– ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine
Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik.
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren.
Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es
einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline
von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig
lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs
traf es eine Copy.
Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben
worden und alles, was von ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das Wort “und”
und das Blindtextchen solle umkehren und wieder in sein eigenes, sicheres Land zurückkehren.
Doch alles Gutzureden konnte es nicht überzeugen und so dauerte es nicht
lange, bis ihm ein paar heimtückische Werbetexter auflauerten, es mit Longe und Parole
betrunken machten und es dann in ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre Projekte
wieder und wieder mißbrauchten. Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, dann benutzen
Sie es immernoch. Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien
und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen
an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens
Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein
paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht
Testen im Schnee, 1940 → S. 50
einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu
unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext,
ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox
riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und
hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte seine
sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als
es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück
auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf
und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rhetorische
Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy. 16 17
Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben
worden und alles, was von ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das Wort “und” und das
Blindtextchen solle umkehren und wieder in sein eigenes, sicheres Land zurückkehren.
Doch alles Gutzureden konnte es nicht überzeugen und so dauerte es nicht lange, bis
ihm ein paar heimtückische Werbetexter auflauerten, es mit Longe und Parole betrunken
machten und es dann in ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre Projekte wieder und
wieder mißbrauchten. Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, dann benutzen Sie es
immernoch. Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien
leben die Blindtexte.
Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines
großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und
versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem
gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion
werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext,
ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite
Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da
es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen
und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen
ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien,
schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf
den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen
hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die
Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline
von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße,
der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage
über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs
traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da,
wo sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben worden
und alles, was von ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei
das Wort “und” und das Blindtextchen solle umkehren und
wieder in sein eigenes, sicheres Land zurückkehren. Doch
alles Gutzureden konnte es nicht überzeugen und so dauerte
es nicht lange, bis ihm ein paar heimtückische Werbetexter
auflauerten, es mit Longe und Parole betrunken
machten und es dann in ihre Agentur schleppten, wo sie es
für ihre Projekte wieder und wieder mißbrauchten. Und
wenn es nicht umgeschrieben wurde, dann benutzen Sie es
immernoch. Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der
Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte.
Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste
des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines
Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches
Land, in dem einem gebratene Satzteile in den
Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion
werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu
unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß
eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum,
hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox
riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen
und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren.
Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es
einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline
von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig
lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort.
Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkäme
Herausgegeben von
Katharina Rippstein, Fotostiftung
Schweiz
Mit Beiträgen von Patricia Banzer,
Katharina Rippstein und Muriel Willi
Gestaltet von Anna Haas
Gebunden
ca. 256 Seiten, ca. 80 farbige und
120 sw Abbildungen
22,5 × 28,5 cm
978-3-03942-006-3 Deutsch
ca. sFr. 49.– | € 48.–
Erste umfassende Monografie
zum Schaffen von Ernst A. Heiniger
als Fotograf und Filmer
Präsentiert reiches und teilweise
erstmals publiziertes Bildmaterial
aus Heinigers Archiv
Erscheint anlässlich der gleichnamigen
Ausstellung in der
Fotostiftung Schweiz (4. Juni bis
10. Oktober 2021)
Erscheint im Juni 2021
ISBN 978-3-03942-006-3
9 783039 420063
Good Morning, World!
Fotografien und Filme von Ernst A. Heiniger
Ernst A. Heiniger (1909–1993) begann 1929 autodidaktisch im Stil des Neuen Sehens
zu fotografieren. In den 1930er-Jahren betrieb er mit Heiri Steiner in Zürich ein innovatives
Atelier für Fotografie und Grafik, gestaltete Plakate und publizierte mit Puszta
Pferde 1936 eines der ersten modernen Fotobücher der Schweiz. Anlässlich der Weltausstellung
der Photographie in Luzern lernte er 1952 Walt Disney kennen. Diese
Begegnung animierte den Schweizer, der sich in den 1940er-Jahren dem Dokumentarfilm
zugewandt hatte, zum Sprung über den Atlantik. Heinigers Filme Ama Girls über
japanische Taucherinnen und Grand Canyon liefen jeweils vor Disneys Animationsfilmen
und wurden beide 1959 als beste Kurzfilme mit Oscars ausgezeichnet.
Ernst A. Heinigers Archiv befindet sich seit 2014 in der Fotostiftung Schweiz und
bildet die Basis für diese erste umfassende Monografie. Reich bebildert mit den wichtigsten
Fotografien, Fotografiken, Buchgestaltungen und Filmstills, stellt das Buch
Heinigers umfangreiches Schaffen in einer repräsentativen Auswahl vor. In den begleitenden
Essays geht Patricia Banzer auf biografische Spurensuche, Katharina Rippstein
untersucht Heinigers Landschaftsfotografie und Muriel Willi nimmt eine fotohistorische
Einordnung seines Werks vor.
Ernst A. Heiniger, geboren 1909 in Engwang (Kanton Thurgau), hatte von
1942 bis 1986 ein Wohnatelier an der Zürcher Bahnhofstrasse. Ab 1953 war
er für seine Filmprojekte in den USA und der ganzen Welt unterwegs und
starb 1993 in Los Angeles.
Katharina Rippstein ist Leiterin des Bildarchivs der Fotostiftung Schweiz
und kuratiert im Frühjahr 2021 die dortige Ausstellung zu Ernst A. Heiniger
in Zusammenarbeit mit Teresa Gruber, Koordinatorin der Sammlung und
Kuratorin der Fotostiftung Schweiz.
Scheidegger & Spiess
Frühjahr 2021 23
Das Phänomen Bauernsterben
als persönliches
fotografisches Tagebuch
Weiterhin lieferbar:
Tomas Wüthrich
Doomed Paradise
978-3-85881-642-9
Deutsch / Englisch / Penan
ISBN 9783858813374
sFr. 49.– | € 48.–
9 783858 813374
Fotografien von Tomas Wüthrich
Texte von Peter Pfrunder
und Balz Theus
Gestaltet von Atlas Studio
Gebunden
168 Seiten, 73 Duplex-Abbildungen
22 × 30 cm
978-3-85881-681-8 Deutsch
978-3-85881-878-2 Französisch
ca. sFr. 49.– | € 48.–
Künstlerisch-dokumentarische und
sozioökonomische Annäherung an
das Thema Bauernsterben anhand
eines zugänglichen Einzelschicksals
Besticht durch die intime und
unmittelbare Bildsprache von
Wüthrichs Fotografien
Erscheint zur Ausstellung
Mur blanc #04: Tomas Wüthrich
HOF NR. 4233 im Musée gruérien,
Bulle (4. Februar bis 18. April 2021)
Erscheint im Januar 2021
ISBN 978-3-85881-681-8
Deutsch
ISBN 978-3-85881-878-2
Französisch
9 783858 816818
9 783858 818782
Tomas Wüthrich
Hof Nr. 4233
Ein langer Abschied
Der Fotograf Tomas Wüthrich wuchs auf einem Bauernhof in Kerzers im Kanton Freiburg
auf. Als dieser aufgelöst werden muss, hält er die letzten zwölf Monate täg licher
Arbeit seiner Eltern und die Momente der Aufgabe des Hofs mit der Kamera fest: die
Unterschrift des Vertrags mit dem neuen Pächter, den Abtransport der Kühe, das letzte
grosse Aufräumen im leeren Stall. Entstanden sind Bilder von einer Nähe, wie sie
nur selten zu sehen sind. Seine schwarz-weissen Fotografien zeigen ein individuelles
Schicksal, das stellvertretend für das kollektive Bauernsterben und den tiefgreifenden
Wandel steht, in dem sich die Landwirtschaft in der Schweiz schon seit vielen Jahren
befindet.
Das Buch zeigt eine sorgfältige Auswahl und Anordnung von 73 Fotografien. Peter
Pfrunder, Direktor der Fotostiftung Schweiz, verortet die Bildserie historisch innerhalb
der Bauernfotografie. Der Journalist Balz Theus beleuchtet den bäuerlichen
Strukturwandel und eröffnet mittels Gesprächsauszügen mit den Eltern Wüthrichs
einen intimen Einblick in ihr Leben.
Tomas Wüthrich ist seit 2000 freischaffender Fotograf und lebt in Liebistorf (FR).
Scheidegger & Spiess
Frühjahr 2021 25
2 3
44 45
90 91
102 103
24 25
8 9
118 119
Am Puls der Zeit –
Bilder eines Spitals
WALTER REINHART
Spitalbauten prägen ein Ortsbild. Während andere der bekannte Fotograf Albert Steiner im Auftrag des
Wahrzeichen einer Stadt eher auf eine Bewahrung ihrer Spitals 1941 gemacht hatte. Albert Steiner ist berühmt
historischen Substanz bedacht sind, stellen Spitäler geworden durch seine einzigartigen Landschaftsfotografien
des Engadins, was seine vorliegenden Architek-
Zweckbauten dar, die kontinuierlich den sich ändernden
Bedürfnissen des Gesundheitswesens anpasst werden turfotografien besonders reizvoll macht.
müssen. Stetiger Wandel ist deshalb die Regel. Solche
Umbauten werden von Zeit zu Zeit von grossen Neubauten
abgelöst, welche als Meilensteine in die Spital-
an bis zur Eröffnung im Jahr 2020 fotografisch begleitet.
Das Grossbauprojekt SUN hat Ralph Feiner von Anfang
geschichte eingehen.
Ralph Feiner, welcher für seine Architekturfotografien
weitherum bekannt geworden ist, war auf Anhieb
Für Graubünden war das Jahr 1941 ein solcher Meilenstein,
als auf einer grünen Wiese in Chur erstmals ein Schwarz-Weiss-Fotografien von damals in einen Dialog
begeistert von der Idee eines Fotobuches, in dem die
Zentrumsspital erbaut wurde, damals Rätisches Kantons-
und Regionalspital genannt. Die Architekten waren Klarer könnte man die Entwicklung der Fototechnik nicht
treten sollen mit den heutigen digitalen Farbbildern.
Fred G. Brun und Rudolf Gaberel, welche als Sieger aus darstellen als mit einer solchen Gegenüberstellung am
einem Architekturwettbewerb hervorgegangen waren. gleichen Objekt. Der Buchtitel Steiner und Feiner war
Zu jener Zeit war ein Spital ein Krankenhaus, dessen geboren.
hauptsächliche Aufgabe es war, Kranke und Gebrechliche
zu beherbergen. Die durchschnittliche Spitalaufenthaltsdauer
betrug damals mehr als einen Monat und wurden mit digitaler Technik reproduziert. Ralph Feiner
Die Silbergelatine-Kontaktabzüge von Albert Steiner
die Anzahl Verpflegungstage war ein gängiger Leistungsindikator.
ging nicht darum, das gleiche Sujet zu suchen und Alt
fotografierte in vergleichbarer Weise den Neubau. Es
und Neu direkt zu vergleichen. Das wäre auch kaum
Ein weiterer Meilenstein in der Baugeschichte des möglich gewesen, zu unterschiedlich war der Zweck
Kantonsspitals Graubünden folgte fast 80 Jahre später der beiden Bauvorhaben. 1941 waren es Patientenzimmer
mit eng stehenden Betten, Aufenthaltsräume für
mit dem Projekt SUN (Sanierung, Umbau und Neubau),
dessen erste Etappe 2020 abgeschlossen wurde. Gebaut Patienten, Pikettzimmer, Ärzte- und Schwesternesszimmer.
Albert Steiners Fotografien, auf der Rückseite mit
wurde es von Astrid Staufer und Thomas Hasler Architekten,
welche den Wettbewerb gewonnen hatten. Der Bleistift beschriftet, zeigen zum Beispiel «Zugang zum
Neubau, ohne neue stationäre Betten, war nötig geworden,
um durch eine grundsätzliche Reorganisation der verteilung», «Frühjahrsstimmung, Krankenschwestern
Sonnenbad», «Diakonissen-Schwester bei der Speise-
Abläufe und Patientenpfade mit den rasanten Entwicklungen
im ambulanten Bereich Schritt halten zu können. spannen».
und Patienten» und «Schwestern draussen beim Ent-
Solche Meilensteine sind Anlass, um auf die Geschichte
zurückzuschauen. In diesem Zusammenhang wurde im Im Jahr 2020 gab es keine derartigen Bilder mehr. Gebaut
wurden verschiedene hochinstallierte Bereiche,
Staatsarchiv des Kantons Graubünden eine einmalige
Serie von 60 Schwarz-Weiss-Fotografien entdeckt, die die es 1941 noch gar nicht gab; Intensivstation, Intermediate
Care, Endoskopie, Dialysestation, Schlaflabor und sen und Ordensschwestern. Er streckt seine linke Hand
Poliklinik, um nur einige zu nennen. Auch die Tiefgarage einem im Bett liegenden Patienten rettend entgegen,
war ein Novum. Das Bauvolumen hat überwältigende mit der rechten Hand entlässt er offensichtlich genesene
Kinder in die Obhut ihrer Eltern. Das verherrlichende
Dimensionen. Dabei war 2020 erst die eine Hälfte des
Hauses H bezugsbereit. Für die Vollendung des Bauvorhabens
müssen Teile des alten Gebäudes von 1941 Kaktus, den der Künstler unverhofft auf die Spitalmauer
Bild des Spitalgeschehens wird irritiert durch einen
weichen, bevor die weiteren, hochmodernen Räume wie gesetzt hat. Was er damit symbolisieren wollte, gibt uns
zusätzliche Operationssäle, Notfallstation, Strahlentherapieräume,
Labor und andere gebaut werden können. war eine schlichte Metalltüre, umrahmt von Malereien
Rätsel auf und bleibt sein Geheimnis. Der Eingang selber
Diese temporäre Schnittstelle zwischen Alt und Neu (Bild Seite 12). Zwei blühende Bäumchen, ein Pferd, mit
ziert den Buchumschlag; das Aufeinandertreffen des dem ein gebrechlicher, alter Mann von einem Helfer zu
wappengeschmückten Baus von 1941 und der ersten einer weiss gewandeten Gestalt mit wallendem Haar gebracht
wird, welche die rechte Hand helfend ausstreckt.
Etappe des Neubaus von 2020.
Links von der Türe ein «seitliches Kontroll-Fenster für
Die Fotoserien dieses Buches aus zwei verschiedenen die Nachtschwester», wie es Albert Steiner betitelt hat.
Zeitepochen sind Zeugen der Entwicklung der Spitalarchitektur,
wie auch der Architektur im Allgemeinen. 2020 befindet sich der Haupteingang auf der gegenüberliegenden,
südlichen Seite des Spitals, der von der
Auch wenn das Buch nicht primär die technischen Fortschritte
in der Medizin über die Zeit darstellen will, führt Hauptverkehrsachse zugänglich ist. Für die künstlerische
Gestaltung des neu entstandenen Spitalplatzes
es doch in aller Deutlichkeit vor Augen, wie vieles sich
im Gesundheitswesen geändert hat. Aus dem Krankenasyl
ist ein bedeutender und flo rierender Wirtschafts-
dem Unterengadin stammende Künstler Not Vital (*1948)
wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, den der aus
zweig geworden. Die Fotografien sagen auch etwas aus gewann. Er schuf die monumentale, begehbare Skulptur
aus blau-gelb bemaltem Eisen mit dem Titel Scarch
über die Entwicklung der Gesellschaft, die das Spital
baute. Sie stehen für die Befind lichkeit, den Wohlstand (SCulpture-ARCHitecture, siehe oben). Eine geschwungene
Treppe führt hinauf und über ein Kulminations-
und die Ansprüche der Gesellschaft.
Unmerkliche Änderungen im Zeitenwandel werden plateau wieder hinunter, wobei man eine Achterbahn
wahrnehmbar.
absolviert. Die Zahl 8, die dem Werk zugrunde liegt, ist
das Symbol für Unendlichkeit und Glück.
Die Wandlung der Rolle eines Spitals zeigt sich gut in
der Gestaltung des Eingangsbereichs, was die zwei Dass die Idee dieses Buches schliesslich in die Wirklichkeit
umgesetzt werden konnte, ist dem Kantonsspital
Fotografien veranschaulichen. 1941 befand sich der Eingang
auf der Nordseite. Ein Churer Weinhändler stiftete und dessen Mitarbeitenden, allen voran dem Vorsitzenden
der Geschäftsleitung, Dr. Arnold Bachmann, zu
das frei stehende, monumentale Wandmosaik Krankheit
und Genesung, das der Oberengadiner Künstler Turo verdanken.
Pedretti (1896–1964) schuf (oben links). In der Bildmitte
steht der gebietende Arzt. Er ist umgeben von Diakonis-
Gesundheit im Fokus:
Albert Steiners und
Ralph Feiners Blick auf
ein Krankenhaus
Herausgegeben von
Walter Reinhart
Mit Beiträgen von Karin Fuchs,
Köbi Gantenbein, Stephan Kunz
und Walter Reinhart
In Zusammenarbeit mit dem
Kantonsspital Graubünden
Gestaltet von Spescha
Visual Design
Architekturfotografie aus zwei
Epochen: Bilder des berühmten
Landschaftsfotografen Albert
Steiner von 1941 treffen auf Ralph
Feiners Fotografien von 2020
Veranschaulicht auf eindrückliche
Weise Entwicklungen in der
Fotografie, dem Gesundheitswesen
und den Ansprüchen der
Gesellschaft an Spitäler
Gebunden
ca. 152 Seiten, ca. 90 farbige und
sw Abbildungen
22 × 29 cm
978-3-85881-689-4 Deutsch
ca. sFr. 49.– | € 48.–
Erscheint im April 2021
ISBN 978-3-85881-689-4
9 783858 816894
Albert Steiner und Ralph Feiner
Architekturfotografie des Kantonsspitals Graubünden 1941/2020
1941 wurde der berühmte Engadiner Landschaftsfotograf Albert Steiner damit beauftragt,
das im selben Jahr fertiggestellte Rätische Kantons- und Regionalspital der
Zürcher Architekten Fred G. Brun und Rudolf Gaberel in Chur zu fotografieren. Aus
dem Auftrag an Steiner ist ein einmaliges Zeitdokument in Form gut erhaltener
Schwarz-Weiss-Abzüge entstanden.
Achtzig Jahre später wird das Grossprojekt «Sanierung, Umbau und Neubau» (SUN)
des nun Kantonsspital Graubünden genannten Krankenhauses nach den Plänen des
in Frauenfeld beheimateten Büros Staufer & Hasler realisiert. Den ersten Teil des
Neubaus hat der bekannte Bündner Architekturfotograf Ralph Feiner im Jahr 2020
dokumentiert.
In diesem Buch erzählen Albert Steiners analoge Schwarz-Weiss-Fotografien und
Ralph Feiners digitale Farbbilder von den Entwicklungen in der Fotografie und der
Spitalarchitektur. Aus ihrem Blick auf die Bauten in Chur sind auch die gewandelte
Bedeutung des Gesundheitswesens und die deutlich gesteigerten Ansprüche unserer
Gesellschaft an Krankenhäuser ablesbar.
Walter Reinhart ist ehemaliger Chefarzt des Kantonsspitals Graubünden
und Präsident der Stiftung Bündner Kunstsammlung.
Scheidegger & Spiess
Frühjahr 2021 27
Ironie des Alltags:
Momentaufnahmen
aus vierzig Jahren
Mit einem Beitrag von
Daniele Muscionico
Gestaltet von Vieceli & Cremers
Gebunden
ca. 160 Seiten, ca. 180 Duplex-
Abbildungen
23,5 × 30 cm
978-3-03942-012-4 Deutsch
ca. sFr. 49.– | € 48.–
Erscheint im März 2021
ISBN 978-3-03942-012-4
Ein besonderer Beitrag zur
Geschichtsbetrachtung, wie er nur
fotografisch zustande kommen
kann
Eine humorvolle und bisweilen
satirische Begegnung mit dem Alltag
in der Schweiz
Der Grossteil der Bilder wird in
diesem Buch erstmals überhaupt
publiziert
9 783039 420124
Mäddel Fuchs – Irgendwo und überall
Gesammelte Momente
Ohne Chronologie lose zusammengeführt, bilden diese rund 160 Momentaufnahmen
von Mäddel Fuchs einen besonderen Beitrag zur Geschichtsbetrachtung, wie er nur
fotografisch zustande kommen kann. Das Buch schöpft aus dem umfangreichen Bestand
des Schweizer Fotografen, aus vierzig Jahren kontinuierlichen Fotografierens.
Erweisen sich einige Bilder als leicht zugänglich, verlangen andere eine vertiefte Auseinandersetzung,
eine Beschäftigung mit Thema und Darstellung. Wieder andere sind
an historische Ereignisse gebunden oder fordern die Betrachterinnen und Betrachter
mit ihren Zeichen- und Sprachspielereien.
Der begleitende Text der Kulturjournalistin Daniele Muscionico ergründet Mäddel
Fuchs’ Bildwelten, vor allem aber seine Lust, querzudenken und dort Zusammenhänge
zu entdecken, wo sich neue Wahrheiten und abgründige Gedankenräume auftun.
Seine humorvollen und bisweilen satirischen Begegnungen mit dem Alltag zeigen die
unendliche Vielfalt unserer Lebenswelt, von vergnüglich bis aufwühlend. All diesen
lebenserhellenden Momenten ist das Buch gewidmet.
Mäddel Fuchs, geboren 1951, wuchs in Zürich und Trogen auf und wurde
auf autodidaktischem Weg Fotograf. Bekannt ist er für seine fotografischen
Langzeitprojekte zur landwirtschaftlichen und kulturellen Tradition des
Appenzellerlandes.
Scheidegger & Spiess
Frühjahr 2021 29
Depuis longtemps, Ulysse avait cédé à l’hubris, s’entourant
rz-magali-elysee-2-vect.indd 6 10.09.20 09:40 rz-magali-elysee-2-vect.indd 7 10.09.20 09:40
moises_spreads_a.indd 12-13 29/08/2020 11:09
Alys_Tomlinson_Prix.indd 6-7 13/09/2020 12:43
Boure, passage du Génie, Paris, 2019
Aboubacar, rue Robespierre, Bagnolet, 2020
Aminata, rue Jules Ferry, Montreuil, 2019
Nyake, avenue de la Résistance, Montreuil, 2019
02
LES LOTOPHAGES
de toutes les technologies que la Lotos Corporation revendait au
prix fort. Grâce à ces gadgets, il lui semblait possible de dépasser
sa condition par trop humaine et d’ainsi résister à l’angoisse de sa
propre obsolescence. Malgré tout, il pressentait confusément que
cette magie technicienne l’éloignait de sa véritable destinée, de
tout ce à quoi ses ancêtres avaient patiemment œuvré. Regardant
vaguement la ville à travers son hublot, il se souvenait des propos
que lui avait tenus la sorcière Nausicaa, fille d’Alkinoos roi des
Phéaciens : « La tâche dévolue à l’Homme moderne n’est plus
celle de son auto-transformation par ses qualités intrinsèques ;
son évolution est désormais dictée par la logique propre de
l’appareillage cybernétique. »
En moyenne, dans le monde, un individu passe 2 heures
et 24 minutes par jour sur les réseaux sociaux.
En France, 61% des personnes interrogées affirment
regarder leur smartphone ou une tablette dès le réveil
et près des deux tiers se jugent incapables de vivre
sans ces appareils plus d’une journée.
« L’installation du fascisme technobureaucratique
n’est pas inscrite
dans les astres. Il y a une autre
possibilité (...) . »
14
IVAN ILLICH, LA CONVIVIALITÉ (1973).
Ulysse s’était grimé le visage afin d’échapper aux
algorithmes de reconnaissance faciale du cyclope. À la
tombée du jour, il embarqua furtivement sur son radeau.
Il allait falloir ramer encore longtemps, mais Ithaque serait
bientôt en vue. Et avec elle, la liberté...
VERS LA LIBÉRATION
–
ÉVASION ET RETOUR
À ITHAQUE
ITHAQUE
Higanbana - it does bloom when
its leaves shed, and wilts as its
leaves grow.
Two elves, Mañju and Saka were
asked to guard the flower’s petals
and leaves, respectively. However,
the two grew curious about each
other, and arranged a meeting. It
was love at first sight, but
Amaterasu, the sun goddess,
punished them for their
disobedience. They were fated to
never meet again.
Being the daughter of a Kuomintang
General, Dongyu and her family had
to flee China as the Communist army
looked set to gain control. She was
onboard the SS Kiangyu heading to
Taiwan when she perished at sea.
However, death could not extinguish
Franklin’s love for her. He could
not bear the thought of her spirit
wandering for all eternity in the
afterworld alone.
Franklin would marry Dongyu through
a ghost marriage before fleeing
China himself.
Herausgegeben von Lydia Dorner
In Zusammenarbeit mit dem
Musée de l’Elysée, Lausanne
Gestaltet von Atelier Cana
Broschur
ca. 152 Seiten, ca. 80 farbige
Abbildungen
23,5 × 32 cm
978-3-03942-013-1
Englisch / Französisch
ca. sFr. 39.– | € 38.–
Eine Dokumentation der vierten
Ausgabe des Prix Elysée für
Fotokünstlerinnen und Fotokünstler
in der Mitte ihrer Laufbahn
Präsentiert die acht für die
Finalrunde nominierten Arbeiten
aus 255 Bewerbungen aus fünfzig
Ländern
Erscheint im Vorfeld der Preisverleihung
im Juni 2021
Erscheint im Januar 2021
ISBN 978-3-03942-013-1
9 783039 420131
Einblicke in die
Werkstatt der
Bewerberinnen und
Bewerber um den
Prix Elysée für
Fotobuchprojekte
Prix Elysée
The Nominees’ Book 2020–2022
Seit 2014 lobt das Musée de l’Elysée in Lausanne, eines der renommiertesten Fotomuseen
Europas, den Prix Elysée aus. Junge Fotokunstschaffende sind jeweils eingeladen,
ein Fotobuchprojekt einzureichen. Der Preis ist die Realisierung des Buches, das einen
grossen Schritt in der Karriere des Gewinners oder der Gewinnerin bedeutet.
Anlässlich der vierten Ausgabe des Wettbewerbs gewährt das Museum in diesem Band
Einblick in den bewegten Entwicklungsprozess von der fotografischen Arbeit bis zum
gedruckten Buch. Vorgestellt werden die Projekte der Nominierten Alexa Brunet, Arguiñe
Escandón & Yann Gross, Magali Koenig, Thomas Mailaender, Moises Saman,
Assaf Shoshan, Alys Tomlinson und Kurt Tong. Skizzen, erste Entwürfe und fotografische
Studien dokumentieren die jeweilige Buchentstehung vom Konzept bis zur Bildauswahl
und Gestaltung. Gespräche mit den Nominierten reflektieren deren enge
Zusammenarbeit mit dem Museum und vertiefen die visuellen Portfolios. So wird der
individuelle Schaffensprozess sichtbar und zugleich ein Querschnitt gegenwärtiger
fotokünstlerischer Produktion präsentiert.
Lydia Dorner ist Ausstellungsverantwortliche am Musée de l’Elysée, Lausanne.
Scheidegger & Spiess
Frühjahr 2021 31
F
En 1975, c’est à dire 25 ans avant un changement de siècle, nous
avons commencé à réaliser certaines pièces en commun. C’est aussi
à cette date là que nous avons décidé qu’elles feraient partie d’une
construction appelée Archives du futur. Ce serait une œuvre construite
dans la durée et la diversité. Avec le temps ce travail a pris la
forme d’une traversée dont les pièces constituent un moment
particulier et dont les titres sont les boîtes noires qui l’accompagnent.
Chacune est une trajectoire à l’écoute de ses interférences.
Ce sont les chapitres d’une mémoire organique.
1
D
1975, das heisst mehr als 25 Jahre vor der Jahrhundertwende, haben
wir begonnen, gewisse Arbeiten gemeinsam zu realisieren. Zur
selben Zeit haben wir beschlossen, dass sie alle einem Projekt,
genannt Archives du Futur – Archive der Zukunft –, angehören
würden. Über die Zeit sollte daraus ein Werk der Dauer und Vielfalt
werden. Daraus ist eine Reise durch die Geschichte und der Geschichten
geworden. Jede Werkgruppe ist ein Anhaltspunkt, jeder
Titel eine Kapsel der Erinnerung, in der sich Sinn und Widersinn
treffen. Sie sind die Kapitel eines organischen Gedächtnisses.
E
In 1975, which is to say, twenty-five years before the turn of the
century, we began making certain works of art together. This is also
when we decided that they would be part of a construction we called
Archives of the Future. It would be a work of art constructed over
time in a variety of media. As time passed, the project took the form
of a journey whose pieces constitute a particular moment and
whose titles are the black boxes accompanying it. Each one is a
trajectory monitoring its inter ferences. They are the chapters of an
organic memory.
12
9
DEFRAOUI_Typo_Ver_1_8_Final_NJ.indd 8 08.10.20 14:33
DEFRAOUI_Typo_Ver_1_8_Final_NJ.indd 9 08.10.20 14:33
DEFRAOUI_Typo_Ver_1_8_Final_NJ.indd 21 08.10.20 14:33
11
Olivier Kaeser & Jean-Paul Felley
entretien lors de l’exposition sombras eléctricas
au centre culturel suisse à paris
Interview conducted during the exhibition Sombras Eléctricas
at the Swiss Cultural Centre in Paris
Olivier Kaeser et Jean-Paul Felley :
Est-ce qu’il y a un propos général à ton exposition
?
Silvie Defraoui :
Cette exposition fait partie, comme tout ce que
j’ai fait depuis 1975, des Archives du futur. Il est
mieux, je crois, de vous lire partiellement un
fragment du texte que nous avons rédigé avec
Chérif Defraoui à propos de ce projet et qui figure
aussi dans le dernier catalogue rétrospectif :
« C’est une œuvre construite dans la durée et la diversité.
Avec le temps, ce travail a pris la forme d’une
traversée dont les pièces constituent un moment particulier
et dont les titres sont les boîtes noires qui les
accompagnent. Ce sont les chapitres d’une mémoire
organique. »
Le titre de l’exposition : Sombras eléctricas
(ombres électriques), est la traduction exacte du
mot par lequel les chinois désignent le cinéma.
Je l’ai choisi, car mon travail en général est
basé sur la projection, dans les différents sens
du terme. On projette par la pensée, les images
peuvent être projetées. Mais il y a aussi la projection
sur un même plan de plusieurs événements
mêmes géographiquement éloignés. Notre
mémoire ne fonctionne pas autrement.
Olivier Kaeser and Jean-Paul Felley:
Is there a general idea behind this exhibition?
Silvie Defraoui:
Like everything I’ve done since 1975, this exhibition
is part of the Archives of the Future.
It’s best, I think, to read you part of a description
that Chérif Defraoui and I wrote about
this project, which also appears in our most
recent retrospective catalogue:
“This is an artwork constructed in duration and
diversity. Over time, this work has taken the
form of a journey whose pieces constitute a
particular moment and whose titles are the
black boxes that accompany them. These are
the chapters of an organic memory.”
The title of the exhibition, Sombras Eléctricas
(electric shadows), is the exact translation
of the word the Chinese use for the cinema.
I chose it because my work in general is based
on projection, in the various meanings of the
term. We project by thought, and images
can be projected. But there is also the projection
of several events, even if geographically
distant, onto the same surface. Our memory
functions in just this way.
Superimposed images are often present
in my pieces. They are found throughout the
Ein Künstler-,
Kunstpädagogenund
Lebenspaar und
sein herausragendes,
vielschichtiges Werk
22
DEFRAOUI_Typo_Ver_1_8_Final_NJ.indd 19 08.10.20 14:33
DEFRAOUI_Typo_Ver_1_8_Final_NJ.indd 22 08.10.20 14:33
Chérif Defraoui
la fiction en tant que moyen d’anticipation
Fiction As a Means of Anticipation
titres des
archives du futur : xx
0 Autoportraits, 1973/1990
31 Bifurcation, 1985
1
Doma, Poétique, (Lieu de Mémoire II), 1975
2 Chronologie, 1975
32
Pavillon, 1985
33 Révolution, 1985
3
Jardins exotiques, 1975/1979
4 Estuaire, 1975/1976
34
Croisement d’accords, 1985
35 La querelle des images I, 1985
5 Table de matières, 1975
36 La querelle des images II, 1986
Parler de fiction aujourd’hui, à propos de la photographie,
me ramène toujours à une histoire ancienne
venue du soufisme que raconte une amie.
Dans une case obscure, on a enfermé un éléphant.
Les visiteurs, qui en sortent, échangent leurs impressions.
Il y a ceux qui disent que, dans le noir,
ils ont touché un éventail. Et il y a ceux qui disent
qu’ils ont reconnu une oreille d’éléphant. Evidemment,
on pourrait encore se demander qui a tort
et qui a raison. Mais il est plus intéressant d’examiner
la construction de cette chambre noire qui
a la propriété de rendre aussi contradictoires les
interprétations les plus simples. Notre hypothèse
peut se résumer à dire que, sous sa forme complète,
ce qu’on appelle camera obscura n’a jamais
vraiment existé, même si elle donne l’impression
de commander et l’histoire de la représentation et
son développement industriel. Il y a cette boîte
avec la projection d’une image renversée sur un
plan qu’on fabrique dans les ateliers de la Renaissance;
mais on a toujours fait comme si son invention
était tombée du ciel. Or il est facile de
montrer que le modèle de cette boîte existait depuis
longtemps, mais pour un usage différent
et très proche : celui de la projection des images
mentales et de leur enregistrement, à une époque
Speaking of fiction today, in regards to photography,
always brings me back to an old story
from Sufism that a friend told me. An elephant
was enclosed in a dark hut. Upon exiting, the
visitors discussed their impressions. Some said
that in the darkness they touched a fan. And
others said they recognized an elephant’s ear.
Clearly, we could still ask ourselves who is
wrong and who is right. But it is more interesting
to examine the construction of this darkroom
that has the characteristic of making the
simplest interpretations contradict each other
to such a point. Our hypothesis can be
summed up by saying that, in its complete
form, what we call a camera obscura never
really existed, even if it gives the impression of
controlling both the history of representation
and its industrial development. There is the
box with the projection of an upsidedown image
on a surface that was produced in Renaissance
workshops; but people have always
acted as if its invention fell out of the sky. Yet it
is easy to show that the model for this box had
existed for a long time, but for a different and
very similar use: that of projecting mental
images and recording them, at a time when
15
6
Suerte en el tejado, 1976
7
Los misterios de Barcelona, 1976/1977
8
Lieux de mémoire, Rooms, 1976
9
Les naturalisations, 1977
10
Archétypes et artifices, 1976/1977
11
Perquisition « El Tango », 1977
12 La Route des Indes, 1978
13
Les cours du temps, 1978
14
Soif de savoir, 1978
15 Performances secrètes, 1978
16 Cartographie des contrées à venir, 1979
17
L’Europe après les pluies, 1979
18
Les inscriptions, 1979
19 Boîte à musique, 1980
20 Les instruments de divination, 1980
21
Aerolights, 1980
22
Singsang, 1980/2019
23 Indices de variations, 1981
24 Fragments (Indices de variations), 1981
25 Les formes du récit, 1980/1983
26
La pagode africaine, 1982
27
Conversations sur un radeau, 1982/1983
28 Mirador, 1983
29 Rencontres élémentaires, 1983/1984
30 La fable des membres, 1985
37
Homme, femme, serpent, 1986
38
Cariatides, 1986
39
Les taches du léopard, 1986
40
Das Bild im Boden, 1986/2015
41
Conversation pardessus les eaux, 1986
42
Un cercle est toujours fermé, 1986
43 Et si la terre perdait son pouvoir
d’attraction ?, 1986
44
Orient/Occident, 1987
45 La nuit les chambres sont plus grandes, 1987
46 Bilderstreit, 1987
47
La traversée du siècle, 1988
48
Métamorphoses, 1988
49 Les frontières de l’ordre, 1988
50 Algèbre, 1988/1989
51
Cires, 1988/1989
52
Jardin suspendu, 1990
53 Passages, 1990
54 Tables de multiplication, 1990
55 Vocabulaire, 1990
56
Tragelaph, 1990
57
Le jour, les fenêtres sont plus petites, 1990
58 Stations de l’océan, 1991
59 Marines et paysages, 1991
60 Acanthus, 1991
12
34
DEFRAOUI_Typo_Ver_1_8_Final_NJ.indd 12 08.10.20 14:33
DEFRAOUI_Typo_Ver_1_8_Final_NJ.indd 33 08.10.20 14:33
DEFRAOUI_Typo_Ver_1_8_Final_NJ.indd 34 08.10.20 14:33
Mit Beiträgen von Bigna Guyer,
Daniel Kurjaković, Marie-Louise
Lienhard, Hans Rudolf Reust,
Corinne Schatz, Philip Ursprung,
Anna Vetsch und Denys Zacharopoulos;
Interviews von Jean-Paul
Felley / Olivier Kaeser und
Christophe Kihm; Vorlesungstexte
von Silvie und Chérif Defraoui
Fotografien von Georg Rehsteiner
Gestaltet von Katarina Lang
Gebunden
ca. 256 Seiten, 14 farbige Abbildungen
18 × 24 cm
978-3-03942-004-9
Deutsch / Französisch / Englisch
ca. sFr. 39.– | € 38.–
Silvie und Chérif Defraoui sind
wichtige Pioniere der multidisziplinären
und multimedialen
Kunst und der Kunstpädagogik
in der Schweiz
Alle Texte und Interviews in
Originalsprache Deutsch oder
Französisch sowie in Übersetzung
Englisch
Ihr digitales Werkverzeichnis
www.archives-du-futur.com wird ab
Frühjahr 2021 online nutzbar sein
Das Buch ergänzt und vertieft
den Inhalt des digitalen Werkverzeichnisses
Erscheint im Februar 2021
ISBN 978-3-03942-004-9
9 783039 420049
Silvie & Chérif Defraoui – Archives du Futur
14 Kommentare 1984–2020
Die Künstlerin Silvie Defraoui realisierte ab 1975 gemeinsam mit ihrem Mann Chérif
(1932–1994) einen bedeutenden Teil ihres Werks. Silvie & Chérif Defraoui fassten ihre
Foto- und Videoarbeiten, Installationen, Skulpturen und Performances unter dem Titel
Archives du Futur zusammen. Sie lehrten an der Genfer École supérieure des Beaux-Arts
und gründeten dort das legendäre Atelier Média Mixtes, das eine Reihe renommierter
Kunstschaffender hervorbrachte.
Ab Februar 2021 werden die Archives du Futur, denen Silvie Defraoui seit Chérifs Tod
weitere Werke anfügte, als digitales Werkverzeichnis online zu erforschen sein. Dieses
Lesebuch begleitet, ergänzt und vertieft die digitale Dokumentation. Es versammelt
14 Kommentare namhafter Kunsttheoretiker und Kuratorinnen zu einzelnen Arbeiten
der beiden, die ab 1984 in verschiedenen Kunstzeitschriften und Ausstellungskatalogen
publiziert oder neu für dieses Buch verfasst wurden. Sie reflektieren sowohl das vom
Künstlerpaar gemeinsam als auch das von Silvie Defraoui eigenständig geschaffene
Werk. Interviews mit Silvie Defraoui und ausgewählte Vorlesungen aus der gemeinsamen
Lehrtätigkeit erhellen Intentionen und thematische Schwerpunkte.
Der Band lädt zur Erkundung eines künstlerischen Werks ein, das durch die Verschmelzung
von Dualitäten – Erinnerung und Gegenwart, Morgen- und Abendland, Mann
und Frau, Tradition und Erfindung – hochaktuell ist.
Silvie Defraoui, geboren 1935 in St. Gallen, stellt ihr Werk international
aus. Sie lebt in Vufflens-le-Château.
Chérif Defraoui, geboren 1932 in Genf, verbrachte seine Kindheit in
Alexandria und Kairo, kehrte für sein Studium nach Genf zurück, wo
die Zusammenarbeit mit Silvie begann. 1994 starb Chérif Defraoui in
Vufflens-le-Château.
Scheidegger & Spiess
Frühjahr 2021 33
Miriam Cahn (*1949)
Die tiefen grossen Augen in den Gesichtern, Gestalten und Wesen beherrschen die Malerei von
Miriam Cahn unausweichlich. Wie gebannt sind wir mit ihrem Blick konfrontiert. Auch sie fixieren
uns, forschend, skeptisch …oder gar vertraut?
Miriam Cahn hielt sich stets von der langjährigen Dominanz einer rein formalen, medienspezifischen
undinstitutionskritischen Selbstbefragungder Kunstfern. Stattdessenlotete siemalend
ihr Selbstverständnis aus, ihre Erfahrungen als Frau, als politisch informierte Zeitgenossin: «Ich,
Mensch.»
Die frühen schwarz-weissenZeichnungeninKohle auffragilemPapierenthaltennochexplizite
Hinweise auf gesellschaftliche Verhältnisse. Einige Motive haben als Graffiti sogar direkt den
öffentlichenRauminfiltriert. Die farbigen Gesichter undKörpervon Menschen undTierenaus den
Werken derJuliusBär Kunstsammlungzeigen Wesen in ihrer nackten Verwundbarkeit,ausgesetzt
in ortlosen, weit ausufernden Sphären–aber auch in ihrer Selbstbehauptung gegenüber den
zudringlichen Blicken. Die leuchtendeFarbigkeit dieser stilisierten Gestaltenerinnertandie herausfordernd
intensiven Kontraste desExpressionismus.Zugleichsinddie verschwimmenden Konturen
von einem unfassbaren Licht durchsetzt, als könnten sie sich jederzeit auch wieder auflösen.
Ölbilderwie Tier (1995) oder diedreiteilige Serie‹Ohne Titel› (1993) mitPigmentenund Leim
aufPapier zeigen dieSpurenihresunmittelbarenFarbauftrags.Das volleRisikodes Momentssoll
immerspürbar bleiben.Miriam Cahn isteswichtig, dass sieihreBildernur seltennochüberarbeitet.
Indem sich die Geste des Malens nicht verbirgt und nicht angezweifelt wird, tritt sie ungeschützt
auf wie eine direkte Anrede, die kein Wort scheut, nicht die Verletzlichkeit, nicht die Sinnlichkeit
und kein Tabu.
Hans Rudolf Reust
Kunstkritiker, Dozent an der Hochschule der Künste Bern
und Präsident der Kunstkommission Parlamentsgebäude
Christian Marclay (*1955)
Seit Beginn seiner Karriere spielt Christian Marclay mit allen möglichen Erscheinungsformen der
Musik sowie mit ihren Trägern und betätigt sich sowohl als DJ, Musiker und Musikproduzent als
auch als Performer und obsessiver Sammler. Seine Ausbildung erfolgte an diversen Kunstschulen.
Symbolische Räume, die Kunstschaffende inunterschiedlichen Zeiten zwischen Musik, Performance,
Konzertund Ausstellungeröffnet haben, faszinierenihn.Fotografie,Assemblage,Collage
und Video machen nur einen Teil seiner künstlerischen Kompositionsmittel aus. Denn an Musik
ist Christian Marclay interessiert und ergründet mittels Bildern synergetische Verknüpfungen von
Tönen, Klängen und Geräuschen mit visuellen Medien.
Stets mit einem Augenzwinkern versehen, bieten ihm Klang und Musik eine grosse Bandbreite
möglicher Metaphern für die künstlerische Praxis. So macht er sich etwa mit einer Reihe
von Plakaten über den Begriff der Urheberschaft lustig und unterläuft unsere Erwartungen. Der
zerzauste, energischeRockmusiker Christian Marclayist alsromantischer Chansonniermit Gitarre
fast nicht mehr wiederzuerkennen. Die Serie ‹False Advertising› (1994) offenbart auf humorvolle
Weise, welche Bedeutungdas Publikum demBilddes Urhebers zuschreibt undwelcheErwartungen
an denStilsichdaran knüpfen, sei es in derMusikoderder Kunst. In Actions: SplatSploochWhap
Blub Squich (2014),einer Malerei in Kombination mitSiebdruckauf Papier, kehrterdie Ideeeiner
etwas vagen modernistischen Vorstellungswelt um, dass die Abstraktion zur Harmonie führe. In
dieser Serie von Gemälden, die bespritzt sind mit Lautmalereien, erklingt der Akt des Malens.
In den Videoarbeiten offenbart sich seine Virtuosität vielleicht am deutlichsten. Telephones
(1995) besteht aus Fragmenten von Hollywoodszenen, indenen Schauspieler*innen telefonieren.
Alle diese Sequenzen folgen in einer sorgfältig choreografierten, charakteristischen Ästhetik aufeinander,umsichdanninein
fantastisches Konzertzuverwandeln. Christian Marclayerfindet hier
eine Form, die sich über die Definitionen und Werkzeuge musikalischer Komposition hinwegsetzt.
Samuel Gross
Freier Kurator, Genf
Miriam Cahn
60
Miriam Cahn (*1949), Tier (6.7.1995), Ölauf Leinwand, 50×36cm
61
Christian Marclay
206
Christian Marclay (*1955), Actions: Splat Splooch Whap Blub Squich (2014),
Siebdrucktinte und handgemaltes Acryl auf Papier, 213,5 ×148,2 cm
207
Ausweitung
und Vielfalt–
Gedanken
zur aktuellen
Schweizer
Kunstszene
248 249
Klodin Erb (*1963), Schafspelz (2008), Ölauf Leinwand, 150 ×200 cm 89
Eine herausragende
Unternehmenssammlung mit
Schweizer Kunst im Fokus
Marc-Antoine Fehr (*1953), La pièce d’eau et faisanderie àPressy (1999),
Gouache auf Papier, 15 ×50cm 93
Camillo Paravicini (*1987), Untitled Portraits (2014),
Silbergelatine-Print auf Barytpapier, 9-teilig (Detail), je 18 ×24cm, Edition von 5 268
Nicolas Party (*1980), Still Life (2014), Kreide auf Leinwand, 120 ×100 cm
269
Marion Tampon-Lajarriette (*1982), Camera 1, Plan 8(2008),
3D-Videoanimation, Loop, 5’ 20’’, Edition von 8+2 AP 368
André Thomkins (1930–1985), G’heuet (1985), Ölauf Leinwand, 61×61cm
369
130 131
Herausgegeben von Barbara
Staubli und Barbara Hatebur
Mit Beiträgen von Alexandra
Blättler, Giovanni Carmine, Samuel
Gross, Barbara Hatebur, Daniel
Morgenthaler, Hans Rudolf Reust,
Kristin Schmidt, Barbara Staubli,
Nadine Wietlisbach und Isabel
Zürcher
Gestaltet von Bonbon
Gebunden
404 Seiten, 333 farbige und
25 sw Abbildungen
22 × 29 cm
978-3-85881-694-8 Deutsch
978-3-85881-874-4 Englisch
sFr. 99.– | € 97.–
Ein Überblick der Julius Bär Kunstsammlung
und ihrer Entstehungsgeschichte
Eine dynamische Mischung aus
Kunstwerken etablierter Schweizer
Kunstschaffender und von
Nachwuchstalenten spiegelt die
Sammelleidenschaft der Bank Julius
Bär der vergangenen 40 Jahre bis
heute
In konzisen und illustrierten Texten
werden 35 Künstlerinnen und
Künstler vorgestellt, u.a. John M
Armleder, Silvia Bächli, Miriam
Cahn, Lutz & Guggisberg, Markus
Raetz, Shirana Shahbazi und
Roman Signer
Erscheint im Januar 2021
ISBN 978-3-85881-694-8
Deutsch
ISBN 978-3-85881-874-4
Englisch
9 783858 816948
9 783858 818744
Umgeben von Kunst
Die Julius Bär Kunstsammlung
Die Kunstsammlung der Bank Julius Bär umfasst eine grosse Auswahl zeitgenössischer
Schweizer Kunst. Mehr als 5000 Kunstwerke in verschiedensten Medien – darunter
Gemälde, Skulpturen, Fotografien, Videos und Zeichnungen – prägen heute die
Sitzungsräume, Personalrestaurants, Büros, Foyers und Gänge der Bank an all ihren
Standorten weltweit. Seit ihrer Gründung 1981 durch Hans J. Bär (1927–2011) ist die
Sammlung Ausdruck der tiefen Überzeugung, dass Kunst am Arbeitsplatz die Gesprächskultur
fördert.
Dieses Buch präsentiert eine umfassende Übersicht über die Werke aus der Sammlung
und bietet Einblicke in deren Entstehung und Entwicklung über die letzten vier Jahrzehnte.
35 künstlerische Positionen, u. a. von John M Armleder, Silvia Bächli, Miriam
Cahn, Lutz & Guggisberg, Markus Raetz, Shirana Shahbazi und Roman Signer, werden
in ausführlichen Werkgruppen illustriert und von einem Kurztext begleitet.
Barbara Staubli ist Kunsthistorikerin und Kuratorin
der Julius Bär Kunstsammlung.
Barbara Hatebur ist Kunsthistorikerin und wissenschaftliche
Mitarbeiterin der Julius Bär Kunstsammlung.
Scheidegger & Spiess
Frühjahr 2021 35
Von Schanghai
nach Zürich:
ein ungewöhnliches
Künstlerinnenleben
im Kontext
seiner Zeit
Weiterhin lieferbar:
Eugen Früh und seine Brüder
Auf den Spuren einer
Künstlerfamilie in Zürich
978-3-85881-421-0 Deutsch
ISBN 978-3-85881-421-0
sFr. 49.– | € 48.–
9 783858 814210
Herausgegeben von der Eugen
und Yoshida Früh-Stiftung
Mit Texten von Matthias Fischer
und Annelise Zwez sowie mit einem
Vorwort von Bettina Gockel
Gestaltet von Guido Widmer
Gebunden
ca. 256 Seiten, ca. 200 farbige
und sw Abbildungen
22 × 28 cm
978-3-03942-005-6 Deutsch
ca. sFr. 49.– | € 48.–
Erste Monografie über Erna Yoshida
Blenk anlässlich ihres 25. Todestages
am 9. Juli 2021
Bietet reiches und grösstenteils
exklusives Material wie Fotos,
Dokumente und Werkabbildungen
Zeigt kaum bekannte Aufnahmen
von Galerien und Kunstorten
sowie Kunstschaffenden im Zürich
der 1930er- bis 1970er-Jahre
Erscheint im März 2021
ISBN 978-3-03942-005-6
9 783039 420056
Erna Yoshida Blenk
Ein Künstlerinnenleben
Erstmals wird mit dieser Monografie das Leben und Werk der Zürcher Malerin und
Illustratorin Erna Yoshida Blenk (1913–1996) umfassend dargestellt. Als Kind eines
Schweizer Vaters und einer japanischen Mutter in Schanghai geboren, absolviert die
junge Frau den Vorkurs der Kunstgewerbeschule Zürich bei Otto Meyer-Amden und
Ernst Gubler. Sie beginnt ihre Laufbahn als Illustratorin für bekannte Verlage und
macht sich bald auch mit ihrer Malerei einen Namen. Ihre Werke, darunter viele Stillleben,
weisen oft ostasiatische Motive und Themen auf. Die Kraft ihres Werks liegt in
der ihr eigenen Position zwischen Impressionismus und weiteren Stilrichtungen der
Moderne.
Erna Yoshida Blenk verkörpert in gewisser Weise exemplarisch das weibliche Kunstschaffen
in der Schweiz und in der Zürcher Szene der 1930er- bis 1970er-Jahre. Das
Buch illustriert dies anhand zahlreicher, bislang unveröffentlichter Fotografien und
Dokumente aus dem Archiv der von ihr in die Wege geleiteten Eugen und Yoshida
Früh-Stiftung. Zusammen mit den Erinnerungen von Zeitzeuginnen bietet die Publikation
erhellende Einblicke und Facetten einer vergangenen, heute kaum noch bekannten
Kunstwelt.
Die Eugen und Yoshida Früh-Stiftung in Zürich, gegründet 1997,
bewahrt den künstlerischen Nachlass des Ehepaars Früh-Blenk.
Scheidegger & Spiess
Frühjahr 2021 37
Ein Dialog
zwischen
Naturwissenschaften
und
Malerei
Mit Beiträgen von Laura Corman
und Nadine Olonetzky
Gestaltet von Katarina Lang und
Rebecca de Bautista
Gebunden
ca. 128 Seiten, ca. 90 farbige
Abbildungen
24 × 34 cm
978-3-03942-007-0
Deutsch / Englisch
ca. sFr. 49.– | € 48.–
Erste grosse Monografie zur
Schweizer Malerin Barbara Ellmerer
Präsentiert Ellmerers Schaffen
der letzten zehn Jahre
Zahlreiche grossformatige und
Detailabbildungen, die Ellmerers
Wiedergabe wissenschaftlicher
Prozesse in ihrer Malerei erlebbar
machen
Erscheint im April 2021
ISBN 978-3-03942-007-0
9 783039 420070
Barbara Ellmerer – Sense of Science
Paintings
Fällt ein Apfel zu Boden, sehen wir die Wirkung der Schwerkraft. Doch nicht alle
Naturgesetze sind so offensichtlich. Die Malerin Barbara Ellmerer nimmt unsichtbare
Prinzipien aus Physik, Biologie und Kosmologie als Ausgangspunkt, um sie in Bilder
zu übertragen. Sie schickt uns in ein Reich aus Farbe und Formen, in dem Kräfte,
Bewegungen und Prozesse aus der Natur sinnverwandt umgesetzt und nachfühlbar
werden. So erfasst sie auch etwas Unerklärliches, das uns daran erinnert, wie sehr die
Welt noch immer ein Wunder ist.
Barbara Ellmerer – Sense of Science. Paintings präsentiert eine Auswahl von Ölbildern
und Arbeiten auf Papier aus der Schaffensperiode von 2010 bis 2020. Ellmerers
teils grossformatige Bilder werden nicht nur vollständig, sondern auch in Detailvergrösserungen
gezeigt: So werden Pinselspuren, Farbqualitäten, Oberflächen, Tiefen,
Bewegungen und Gewichte sinnlich erfahrbar und der Wechsel der Medien – von der
Malerei über die Fotografie zur Reproduktion im Buch – fruchtbar eingesetzt. Die
Quantenphysikerin Laura Corman knüpft in ihrem Text an ein mit der Künstlerin
geführtes Galeriegespräch an und erläutert die Verbindungen von Ellmerers Werk zur
Naturwissenschaft. Die Kulturjournalistin und Fotoexpertin Nadine Olonetzky beschreibt
die Möglichkeiten der Kunst, unsichtbare Prozesse nachvollziehbar zu machen.
Barbara Ellmerer, geboren 1956 in Meiringen, studierte an der F+F Schule
für Kunst und Design, Zürich, und an der Universität der Künste, Berlin.
Nach längeren Aufenthalten in Spanien, Italien, New York und Delhi lebt
sie in Zürich.
Scheidegger & Spiess
Frühjahr 2021 39
Herausgegeben von
Christoph Vögele
Mit Beiträgen von Diana Blome,
Robin Byland, Larissa Ullmann und
Christoph Vögele
In Zusammenarbeit mit dem
Kunstmuseum Solothurn
Gestaltet von Guido Widmer
Gebunden
192 Seiten, 139 farbige und
3 sw Abbildungen
22,5 × 28,5 cm
978-3-03942-001-8 Deutsch
sFr. 49.– | € 48.–
Lieferbar
ISBN 978-3-03942-001-8
Albert Trachsel ist ein wichtiger
Vertreter des Symbolismus und der
frühen Moderne in der Schweiz,
dessen Werk auch international
Beachtung findet
Erste umfassende Monografie
zu dem Künstler seit mehr als
30 Jahren
Zeigt zahlreiche öffentlich kaum
zugängliche Werke aus Privatsammlungen
und Faksimiles von
Originalblättern aus dem
Album Les Fêtes réelles
Erscheint anlässlich der gleichnamigen
Ausstellung im Kunstmuseum
Solothurn (bis 7. Februar
2021)
9 783039 420018
Architektur-Visionär
und wichtiger
Künstler zwischen
Symbolismus und
früher Moderne
Albert Trachsel (1863–1929)
Eine Retrospektive
Der Genfer Maler, Zeichner und Aquarellist Albert Trachsel (1863–1929) zählt zu den
wichtigsten und eigenwilligsten Gesamtkünstlern um 1900. Nach einem Studium der
Architektur reist er nach Paris, wo er sich mit den Symbolisten austauscht und neben
Ferdinand Hodler und Félix Vallotton 1892 beim ersten Salon de la Rose-Croix aquarellierte
Zeichnungen kühner Fantasiearchitekturen aus seinem Album Les Fêtes réelles
ausstellt. Zurück in Genf wendet sich Trachsel ab 1902 autodidaktisch der Ölmalerei
zu. Ab 1904 entsteht sein symbolistisches Hauptwerk, die Traumlandschaften, die
sich durch ein strahlendes Kolorit sowie eine auffällige Abstraktion auszeichnen.
Mehr als 30 Jahre nach der letzten grossen Einzelausstellung zeigt das Kunstmuseum
Solothurn nun eine umfassende Retrospektive zu Albert Trachsel. Reich bebildert,
bietet die vorliegende Monografie einen detaillierten Überblick seines Schaffens und
gibt Aufschluss über die Rezeptionsgeschichte sowie über die bedeutenden Schweizer
Sammler seines Werks, Oscar Miller, Josef und Gertrud Müller und Richard Kisling.
Zudem wirft der Band neues Licht auf die einflussreiche Künstlerfreundschaft mit
Ferdinand Hodler. Er betont ausserdem die Essenz des Geistigen in der beginnenden
Moderne, das sich auf einzigartige Weise mit Trachsels symbolistischer Grundhaltung
verbindet.
Christoph Vögele ist Kunsthistoriker und seit 1998 Konservator des
Kunstmuseums Solothurn. Autor zahlreicher Publikationen und Kurator
vieler Ausstellungen zur Schweizer Gegenwartskunst.
Scheidegger & Spiess
Frühjahr 2021 40
Herausgegeben von Carla Burani
und Beat Wismer
Mit Beiträgen von Carla Burani,
Demosthenes Davvetas, Rolf
Winnewisser und Beat Wismer
sowie einem Gedicht von Martin
Disler
In Zusammenarbeit mit dem
Kirchner Museum Davos
Gestaltet von Anne Hoffmann
Broschur
ca. 128 Seiten, ca. 70 farbige und
25 sw Abbildungen
20,5 × 27,5 cm
978-3-85881-699-3
Deutsch / Englisch
sFr. 35.– | € 29.–
Erscheint im März 2021
ISBN 978-3-85881-699-3
9 783858 816993
Martin Disler zählt zu den herausragenden
Figuren der Schweizer
Kunst des ausgehenden 20. Jahrhunderts,
seine Malerei fand in
den achtziger Jahren auch international
grosse Beachtung
Erstmals konzentriert sich diese
Monografie auf Dislers reiches
und bislang zu wenig beachtetes
Schaffen der späten Jahre
Enthält ein bisher unveröffentlichtes
Gedicht Dislers, das die
grossen, sein gesamtes Werk
durchziehenden Themen reflektiert
Erscheint anlässlich der gleichnamigen
Ausstellung im Kirchner
Museum Davos (bis 18. April 2021)
Ein Künstler des
grossen Formats:
Martin Dislers bislang
wenig beachtete
späte Schaffensjahre
Theater des Überlebens
Martin Disler – die späten Jahre
Martin Disler (1949–1996) war in den 1980er-Jahren der wohl bekannteste junge
Schweizer Künstler überhaupt. Zuerst vor allem als Zeichner beachtet, wurde er nach
1980 zum international gefeierten Maler. In seinem letzten Lebensjahrzehnt, das er in
weitgehender Abgeschiedenheit verbrachte, wandte er sich auch der Plastik zu. Seit
seiner Jugend und bis zuletzt arbeitete er auch als Dichter und literarischer Autor. In
allen Disziplinen war er Autodidakt, immer ringend um eine ganz eigene Bildsprache,
aber auch um die ganz grossen Themen, die sein gesamtes vielfältiges Werk durchziehen:
Liebe und Sex, Zorn und Zärtlichkeit ebenso wie Krieg und Gewalt, Krankheit
und Tod. Galt er zur Zeit seiner grössten Erfolge als Vertreter einer wilden oder
neo-expressiven Malerei, so war er doch immer ein gänzlich unabhängiger Einzelgänger.
Diese Monografie widmet sich erstmals den verschiedenen Disziplinen in Dislers spätem
Schaffen. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Bedeutung des Körpers
gelegt und auf dessen Rolle im kreativen Akt, also auf Körpersprache, Tanz, Bewegung,
Gestik, Ausdruck, Abstraktion und Figuration.
Carla Burani ist Kunsthistorikerin und Direktorin des Kirchner Museum Davos.
Beat Wismer ist Kunsthistoriker. Als Direktor des Aargauer Kunsthauses,
Aarau (1985–2007) organisierte er 2007 die erste posthume Retrospektive des
Malers Martin Disler.
Scheidegger & Spiess
Frühjahr 2021 41
Herausgegeben von Irma Städtler
und Werner Ignaz Jans
Erste Monografie zum Schaffen
der Bildhauerin Irma Städtler
Mit einem Text von
Dorothe Freiburghaus
Gestaltet von Guido Widmer
Gebunden
136 Seiten, 66 farbige und
94 sw Abbildungen
19 × 27 cm
978-3-85881-698-6 Deutsch
sFr. 49.– | € 48.–
Erscheint im Januar 2021
ISBN 978-3-85881-698-6
9 783858 816986
Aus Stein geformte
Darstellungen
urmenschlicher
Gefühle
Irma Städtler – Steine
Irma Städtlers Figuren schälen sich aus dem Gestein in einem Ringen um Sichtbarkeit
und Schutz. Wuchtige Hände stemmen sich aus Alabaster und Kalkstein, suchen Halt
und klammern sich fest. Sie umschlingen die gewundenen Körper, die aus Städtlers
Plastiken wachsen. Die 1956 geborene Schweizer Bildhauerin lässt mit ihren Skulpturen
gedrungene Körperwelten entstehen, steinerne Gehäuse, in die sie für die ihnen
innewohnenden Gestalten Öffnungen bricht.
Das Buch zeigt die Vielfalt und Entwicklung von Städtlers Werken, die zwischen 1986
und 2019 entstanden sind. Ein Panoptikum von Türmen, Stelen, Trögen, Zellen und
Figurengruppen, die urmenschlichen Gefühlen und Bedürfnissen Form geben.
Irma Städtler, geboren 1956, erwarb ihre künstlerische Ausbildung
1977–1980 an der damaligen Kunstgewerbeschule Zürich (heute Zürcher
Hochschule der Künste ZHdK). Sie lebt und arbeitet in Riet bei Winterthur
und in Bistagno, Piemont.
Werner Ignaz Jans, geboren 1941, studierte nach einer Grafikerlehre
von 1961 bis 1965 an der Kunstakademie Düsseldorf. Von 1970 bis 1990
war er Lehrer an der Schule für Gestaltung, Zürich. Seit 1965 arbeitet er
als freier Bildhauer.
Scheidegger & Spiess
Frühjahr 2021 42
Mit Beiträgen von Paul Harris
und Johan Myburg und einem
Gespräch mit Angus Taylor
von Johan Thom
Gestaltet von Sabine Hahn
Gebunden
ca. 224 Seiten, ca. 150 farbige
Abbildungen
24 × 30 cm
978-3-85881-870-6 Englisch
ca. sFr. 65.– | € 58.–
Erste Monografie über den südafrikanischen
Bildhauer Angus Taylor
Diskutiert Taylors Schaffen im
Kontext seiner Biografie und der
gesellschaftlichen Situation Südafrikas
Betrachtet seine Methoden,
Praktiken und Philosophie
Erscheint im Mai 2021
ISBN 978-3-85881-870-6
9 783858 818706
Monumentale
Skulpturen zwischen
traditionellem
südafrikanischem
Kunsthandwerk und
zeitgenössischer Kunst
Angus Taylor
Mind Through Materials
Der südafrikanische Bildhauer Angus Taylor, 1970 in Johannesburg geboren und
Alumnus der University of Pretoria, ist vor allem bekannt für seine monumentalen
Arbeiten, die er neben dem klassischen Medium Bronze aus einer besonderen Auswahl
an Materialien seiner unmittelbaren Umgebung fertigt – schwarzer Granit, roter Jaspis,
Stroh oder die rote Erde der Umgebung Pretorias. Aus der Symbiose dieser Materialien
mit einer traditionell künstlerischen Handwerkstechnik entstehen so Werke
von zeitgemässer Unverkennbarkeit, die den Künstler wegweisend in der figurativen
landmark sculpture positionieren.
Mit dieser Monografie wird erstmals ein umfassender Einblick in Angus Taylors
künstlerisches Schaffen vorgelegt. Sie illustriert und diskutiert Schlüsselwerke seiner
Karriere, die seit der Gründung seines Ateliers Dionysus Sculpture Works im Jahr
1997 bis heute entstanden sind, und geht auf Taylors Methoden, Praktiken und persönliche
Philosophien ein. Dadurch wird sein Werk sowohl persönlich-biografisch als
auch gesellschaftlich kontextualisiert. Das Buch bietet somit eine fundierte Einführung
in das innovative und charakteristische Werk des Künstlers.
Paul Harris ist Kunstsammler und Besitzer der Ellerman House Wine
Gallery in Kapstadt, an deren Ausstattung Angus Taylor beteiligt war.
Johan Myburg ist Kunstpublizist und Kurator und als wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Bildende Künste an der North-West University
in Johannesburg tätig.
Johan Thom ist bildender Künstler, der sich zwischen Video, Installation,
Performance und Skulptur positioniert. Zurzeit ist er Dozent am Institut
für Bildende Künste an der University of Pretoria.
Scheidegger & Spiess
Frühjahr 2021 43
Die unbekannte Schwester: Ottilia
Giacometti verewigt von ihrem Vater
Giovanni und ihrem Bruder Alberto
Ottilia Giacometti – Ein Porträt
Werke von Giovanni und
Alberto Giacometti
978-3-85881-672-6 Deutsch
sFr. 25.– | € 25.–
Erlesene Landschaftsmalerei
aus vier Jahrhunderten
Landschaften – Orte der Malerei
978-3-85881-691-7 Deutsch
sFr. 29.– | € 29.–
Neue Technologien und klassische
Referenzen: Der Videokünstler
Jean Otth
Jean Otth
Works 1964–2013
978-3-85881-855-3
Englisch / Französisch
sFr. 39.– | € 38.–
Wo und wann immer Varlin unterwegs
ist, zeichnet er Menschen: blitzschnell,
überaus pointiert und schonungslos
Ulrich Binder
Varlin als Zeichner
978-3-85881-664-1 Deutsch
sFr. 39.– | € 38.–
Auf den Spuren Jean-Jacques
Rousseaus: eine fotografische
Erkundung der Flora
des Kantons Neuenburg
Olga Cafiero – Flora Neocomensis
Fotografische Ermittlung
Neuenburg 2019
978-3-85881-683-2
Deutsch / Französisch
sFr. 49.– | € 48.–
Von Verführung und Vergänglichkeit:
Anna Halm Schudels Blumen-Bilder
Blossom
978-3-85881-621-4
Deutsch / Englisch
sFr. 59.– | € 48.–
Die Monografie über das Fotografenpaar
Michael und Luzzi Wolgensinger,
ausgezeichnet mit dem Deutschen
Fotobuchpreis 2020/21 in Gold
Mit vier Augen
Das Fotoatelier Luzzi und
Michael Wolgensinger
978-3-85881-479-1 Deutsch
sFr. 65.– | € 58.–
Ein Spaziergang durch Bern, zur
Architektur der 1930er-Jahre
ausserhalb der berühmten Altstadt
Bern modern
Wohnbauten der 1920er- und
1930er-Jahre in den Berner Quartieren
978-3-85881-635-1 Deutsch
sFr. 29.– | € 29.–
Scheidegger & Spiess
Backlist 44
Wie Mensch und Natur sich
verbünden: Ein inspirierender Reader
zu Ökologie und Posthumanismus
in der Kunst
Potential Worlds
Planetary Memories & Eco-Fictions
978-3-85881-864-5 Englisch
sFr. 39.– | € 38.–
Künstlerische und wissenschaftliche
Antworten auf existenzielle globale
Herausforderungen
The Glacier’s Essence
Grönland – Glarus:
Kunst, Klima, Wissenschaft
978-3-85881-665-8
Deutsch / Englisch / Kalaallisut
sFr. 65.– | € 58.–
Eine hochaktuelle Analyse der sich auflösenden
Globalisierung in fesselnder
Kombination aus Bild und Text
Charlie Koolhaas
City Lust
London Guangzhou Lagos
Dubai Houston
978-3-85881-804-1 Englisch
sFr. 59.– | € 58.–
Von keiner realen öffentlichen Figur
gibt es mehr fiktionale Repräsenta
tionen als vom amerikanischen
Präsidenten
Lea N. Michel
The President of the United States
on Screen
164 Presidents, 1877 Illustrations,
240 Categories
978-3-85881-858-4 Englisch
sFr. 39.– | € 38.–
Burri komplett: Erstmals wird sein
gesamtes Werk zusammengeführt, mit
zahlreichen bisher unveröffentlichten
Arbeiten
René Burri – Explosion des Sehens
978-3-85881-661-0 Deutsch
978-3-85881-845-4 Englisch
sFr. 49.– | € 48.–
Vom Konstruktivismus über Art déco
zurück zu Avantgarde und zum
Bauhaus: Sowjetische Innenarchitektur
und Möbel
Soviet Design
From Constructivism to Modernism
1920–1980
978-3-85881-846-1 Englisch
sFr. 99.– | € 77.–
Die schwierige Verteidigung des
Bauhauses gegen seine Anbeter –
«Für Kunst-, Design- und Architektur-
Interessierte ein Muss!»
Bücherrundschau
Philipp Oswalt
Marke Bauhaus 1919–2019
Der Sieg der ikonischen Form
über den Gebrauch
978-3-85881-620-7 Deutsch
978-3-85881-856-0 Englisch
sFr. 39.– | € 38.–
Eine intellektuelle Autobiografie
und Reflexion des Schweizer
Architekten Marcel Meili über
die Entwicklung des Engadins im
20. Jahrhundert
Marcel Meili
Steiners Postauto
Eine Bildgeschichte
978-3-85881-675-7 Deutsch
sFr. 39.– | € 38.–
Scheidegger & Spiess
Backlist 45
Kaum öffentlich zu sehen:
Albert Anker als Zeichner und
Aquarellmaler
Albert Anker
Zeichnungen und Aquarelle
978-3-85881-660-3 Deutsch
sFr. 39.– | € 38.–
Reliefs und monumentale Skulpturen:
Das erste Buch zu Hans Arps Werken
im Zusammenhang mit Architektur
Public Arp
Hans Arp – Architekturbezogene
Arbeiten
978-3-85881-652-8 Deutsch
sFr. 39.– | € 38.–
Die Neuausgabe einer massgeblichen
Monografie über Max Bill
Max Bill: ohne Anfang, ohne Ende
978-3-85881-578-1 Deutsch / Englisch
sFr. 49.– | € 48.–
Eine Einführung in Schaffen, Wirkung
und Nachlass des bedeutenden
Kunsthistoriker-Paars
Die Welt der Giedions
Sigfried Giedion und
Carola Giedion-Welcker im Dialog
978-3-85881-610-8 Deutsch
978-3-85881-819-5 Englisch
sFr. 99.– | € 97.–
Porträts, Flaniermeilen und Fabrikhallen:
Vincenzo Vicari als Chronist
des Tessins
Vincenzo Vicari Fotograf
Das Tessin im Wandel der Zeit
978-3-85881-692-4 Deutsch
sFr. 44.– | € 44.–
Auf der Suche nach einer neuen
Moderne: das grosse Schweizer
Architekten- und Designer-Paar
Trix und Robert Haussmann
Protagonisten der Schweizer
Wohnkultur
978-3-85881-561-3 Deutsch
sFr. 65.– | € 58.–
Sieben Jahre in der Sowjetunion:
Eine akribische Recherche über eine
besondere Phase im Leben des
Architekten Hans Schmidt
Jürg Düblin
In Stalins Reich
Die Moskauer Jahre des Architekten
und Städteplaners Hans Schmidt
1930–1937
978-3-85881-653-5 Deutsch
sFr. 49.– | € 48.–
Ein Jahrhundert Elefantentradition
im Schweizer National-Circus Knie
100 Jahre Knie-Elefanten
Geschichte und Perspektiven der
Elefantenhaltung in Wort und Bild
978-3-85881-677-1 Deutsch
978-3-85881-869-0 Französisch
sFr. 39.– | € 38.–
Scheidegger & Spiess
Backlist 46
Strukturen und Dynamiken im Werk
dieser Schlüsselfigur der Performance-
Kunst
Psychoanalytikerin trifft
Marina Abramovic´
Künstlerin trifft Jeannette Fischer
978-3-85881-546-0 Deutsch
978-3-85881-794-5 Englisch
sFr. 19.– | € 19.–
Westliche und afrikanische
Imagination: Kunst, Fotografie und
Text aus dem Kongo neu gedacht
Fiktion Kongo
Kunstwelten zwischen Geschichte
und Gegenwart
978-3-85881-643-6 Deutsch
978-3-85881-835-5 Englisch
sFr. 49.– | € 48.–
Umfassende Darstellung von Leben
und Werk Giovanni Segantinis anhand
von 60 ausgewählten und kommentierten
Hauptwerken
Giovanni Segantini
978-3-85881-522-4 Deutsch
978-3-85881-783-9 Englisch
978-3-85881-784-6 Italienisch
sFr. 49.– | € 48.–
Eine herausragende Fotokünstlerin,
experimentierfreudig und sorgfältig
komponierend
Jan Groover, Photographer
Laboratory of Forms
978-3-85881-838-6 Englisch
sFr. 49.– | € 48.–
Fotografische Experimentierlust:
Simone Kappelers Amerika-Roadtrip
als Akt der Befreiung
Simone Kappeler – America 1981
978-3-85881-679-5
Deutsch / Englisch
sFr. 69.– | € 68.–
Radikale Positionen: 35 aufstrebende
internationale Fotografinnen und
Fotografen im Fokus
reGeneration 4
The Challenges for Photography
and Its Museum of Tomorrow
978-3-85881-857-7
Englisch / Französisch
sFr. 59.– | € 58.–
«Eyes That Saw steht mindestens in
einer Reihe mit Marshall MacLuhans
Publikationen oder S, M, L, XL.»
Textem
Eyes That Saw
Architecture after Las Vegas
978-3-85881-820-1 Englisch
sFr. 49.– | € 48.–
Die erste umfassende Darstellung
von Produktion und Kultur modernen
Designs in einer grenzübergreifenden
dynamischen Region des Alpenraums
Design from the Alps
1920–2020
Tirol Südtirol Trentino
978-3-85881-649-8
Deutsch / Englisch / Italienisch
sFr. 49.– | € 48.–
Scheidegger & Spiess
Backlist 47
Scheidegger & Spiess
Niederdorfstrasse 54
8001 Zürich
Tel. +41 (0)44 262 16 62
www.scheidegger-spiess.ch
info@scheidegger-spiess.ch
Vertrieb
Patrick Schneebeli
Tel. +41 (0)44 253 64 53
p.schneebeli@scheidegger-spiess.ch
Presse und PR
Chris Reding
Tel. +41 (0)44 253 64 51
c.reding@scheidegger-spiess.ch
Marketing
Domenica Schulz
Tel. +41 (0)44 253 64 56
d.schulz@scheidegger-spiess.ch
Verlagsleitung
Thomas Kramer
Tel. +41 (0)44 253 64 54
t.kramer@scheidegger-spiess.ch
Scheidegger & Spiess ist Mitglied
von SWIPS, Swiss Independent Publishers
Auslieferungen
Schweiz
AVA Verlagsauslieferung AG
Centralweg 16
8910 Affoltern a. A.
Tel. 044 762 42 00
Fax 044 762 42 10
avainfo@ava.ch
Deutschland, Österreich,
Belgien, Niederlande, Luxemburg
GVA
Postfach 2021
37010 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 (0)551 384 200-0
Fax +49 (0)551 384 200-10
bestellung@gva-verlage.de
Vertreter
Schweiz
Sebastian Graf
Graf Verlagsvertretungen GmbH
Uetlibergstrasse 84
8045 Zürich
Tel. 079 324 06 57
sgraf@swissonline.ch
Deutschland
Hans Frieden
c / o G.V.V.
Groner Strasse 20
37073 Göttingen
Tel. 0551 797 73 90
Fax 0551 797 73 91
g.v.v@t-online.de
Österreich
Stefan Schempp
Verlagsvertretungen
Wilhelmstrasse 32
80801 München
Deutschland
Tel. +49 89 230 777 37
Fax +49 89 230 777 38
stefan.schempp@mnet-mail.de
Michael Klein
c/o Vertreterbüro Würzburg
Huebergasse 1
97070 Würzburg
Deutschland
Tel. +49 931 174 05
Fax +49 931 174 10
klein@vertreterbuero-wuerzburg.de
Der Verlag Scheidegger & Spiess
wird vom Bundesamt für Kultur mit
einem Strukturbeitrag für die Jahre
2021–2024 unterstützt.
Stand Dezember 2020
Die angegebenen Franken-Preise sind unverbindliche
Preisempfehlungen für die Schweiz inklusive MwSt. –
Die angege benen Euro-Preise sind gebundene
Ladenpreise für Deutschland inklusive MwSt. und
unverbind liche Preisempfehlungen für Österreich.
Für Preise, Beschreibungen und Erscheinungstermine
bleiben Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Umschlagbild:
Schmuckdesign von Vanessa Schindler.
Foto © Chaumont-Zaerpour. Aus dem Buch:
Wild Thing – Modeszene Schweiz, siehe S. 7.
Aenne Biermann
Fotografin
Herausgegeben von Simone Förster und Thomas Seelig
In Zusammenarbeit mit der Stiftung Ann und Jürgen Wilde, Pinakothek
der Moderne, München, und dem Museum Folkwang Essen
Broschur
184 Seiten, 68 farbige und 35 sw Abbildungen
21 × 28 cm
978-3-85881-673-3 Deutsch
sFr. ISBN 978-3-85881-673-3 39.– | € 38.–
9 783858 816733
Aenne Biermann (1898–1933) zählt zu den festen Grössen der
Fotografie der 1920er- und 1930er-Jahre. Diese mit dem Deutschen
Fotobuchpreis 2020/21 in Gold ausgezeichnete Monografie
präsentiert ihr Werk als Beispiel für Moderneströmungen
jenseits der Zentren der Avantgarde und thematisiert die
Verflechtungen von Laienkunst und Avantgardefotografie in den
1920er-Jahren wie auch das Selbstverständnis bürgerlicher
Frauen in Bezug auf künstlerische Produktion und individuelle
Entwicklungen.