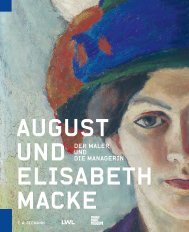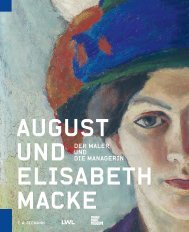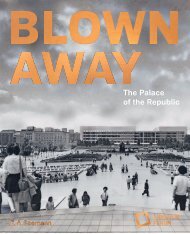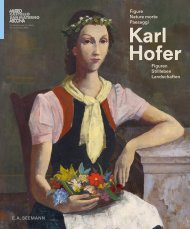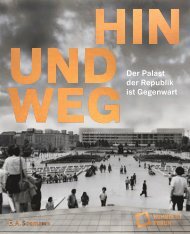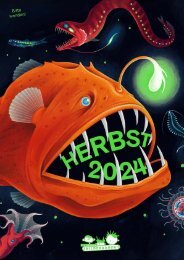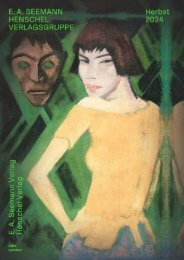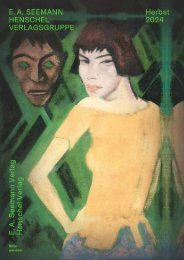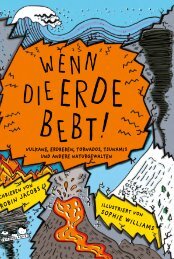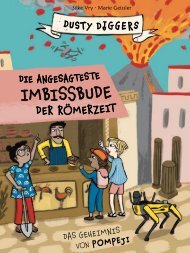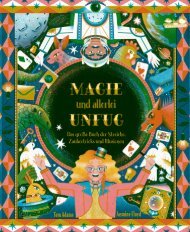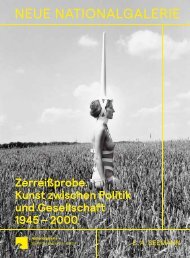Das ist Ballett! 50 Fragen - 50 Antworten
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
WIE POLITISCH<br />
IST DAS<br />
KLASSISCHE<br />
BALLETT?<br />
Auf die Frage, ob der klassisch-akademische<br />
Bühnentanz heute überhaupt noch<br />
eine Ex<strong>ist</strong>enzberechtigung habe angesichts<br />
der Tatsache, dass doch der zeitgenössische<br />
Tanz am häufigsten Politik und das<br />
aktuelle Zeitgeschehen auf die Bühne<br />
bringe, antwortet der Schweizer Choreograf<br />
Martin Schläpfer: ›› Er wird nicht aussterben,<br />
weil er ein europäisches Kulturphänomen<br />
<strong>ist</strong>. […] Ich glaube, dass viele Leute<br />
das Gefühl haben, der zeitgenössische Tanz<br />
sei politischer und näher an der Gesellschaft,<br />
weil die Tänzer darin viel mehr sie<br />
selber sein können.‹‹ 7 Aber <strong>ist</strong> dem so?<br />
Schläpfer, der selbst alle großen klassischen<br />
<strong>Ballett</strong>e wie Dornröschen, Nussknacker<br />
oder Schwanensee getanzt hat, hinterfragt<br />
damit gewiss nicht die Legitimation des<br />
klassischen <strong>Ballett</strong>s, doch seine Aussage<br />
zeigt, wie viel Aufklärungsarbeit hinsichtlich<br />
der klassischen <strong>Ballett</strong>e noch zu le<strong>ist</strong>en<br />
<strong>ist</strong> und wie viele kulturgeschichtliche<br />
Lücken vor allem auf Seiten des Publikums<br />
zu schließen sind.<br />
Um beim Schwanensee zu bleiben: Petipas<br />
<strong>Ballett</strong>e sind keineswegs ›› unpolitisch‹‹ oder<br />
harmlos, weder nur ›› poetisch‹‹ noch ›› inhaltlich<br />
nicht überzeugend‹‹ 8 . Sowohl der<br />
Inhalt des <strong>Ballett</strong>s als auch dessen Rezeption<br />
war und <strong>ist</strong> zum Teil auch politisch<br />
motiviert, was kaum reflektiert wird.<br />
<strong>Das</strong> <strong>ist</strong> besonders interessant, wenn<br />
man sich beispielsweise die <strong>Ballett</strong>geschichte<br />
der DDR anschaut. Nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg sind in der neugegründeten DDR<br />
nur drei <strong>Ballett</strong>genres politisch akzeptiert:<br />
russische Klassiker, sowjetische <strong>Ballett</strong>e<br />
und neue DDR-Schöpfungen. Der sogenannte<br />
deutsche Ausdruckstanz hingegen <strong>ist</strong><br />
verpönt. Ausgeklammert werden muss hier<br />
die in Dresden lebende und arbeitende Ausdruckstänzerin<br />
Gret Palucca, deren persönliche<br />
und tänzerische Geschichte eine andere,<br />
nicht minder komplizierte <strong>ist</strong>.<br />
Tanzkunst, Tanzausbildung und Tanzkritik<br />
haben sich in der DDR an der <strong>Ballett</strong>entwicklung<br />
und Ausbildung in der Sowjetunion<br />
zu orientieren. Die sogenannte<br />
Waganowa-Methode <strong>ist</strong> verbindlich, übrigens<br />
auch in Westdeutschland und anderen<br />
Ländern. Diese Unterrichts-Methode, die<br />
die russische Tänzerin Agrippina Waganowa<br />
1948 in ihrem berühmt geworde nen<br />
Buch Die Grundlagen des klassischen Tanzes<br />
beschreibt, legt zum Beispiel sehr viel Wert<br />
auf die Armhaltung (das sogenannte Port<br />
de bras). In der DDR wird ausschließlich<br />
diese Methode befolgt, in Italien hingegen<br />
zum Beispiel sind einige Schrittvarianten<br />
erlaubt und in den USA entwickelt der georgisch-amerikanische<br />
Choreograf George<br />
Balanchine am New York City Ballet einen<br />
ganz eigenen Tanzstil, der sich von Waganowas<br />
Ästhetik stark un terscheidet. Statt<br />
der gerundeten Arm- und Fingerhaltungen<br />
zieht Balanchine die Bewegungen weit auseinander<br />
und in die Länge.<br />
<strong>Das</strong> <strong>Ballett</strong> <strong>ist</strong> in der Sowjetunion und in<br />
der DDR der sozial<strong>ist</strong>ischen Ideologie unterworfen.<br />
Bewegungen werden immer auch<br />
als ›› Vorwärtsbewegungen‹‹ verstanden, im<br />
Sinne des Aufbaus des neuen Staates und<br />
der Abgrenzung vom kapital<strong>ist</strong>ischen Westen.<br />
Zu den DDR-<strong>Ballett</strong>neuschöpfungen<br />
gehört unter anderem das 1953 an der Deutschen<br />
Staatsoper Berlin uraufgeführte<br />
<strong>Ballett</strong> <strong>Das</strong> Recht des Herrn (Libretto: Albert<br />
Burkat, Musik: Viktor Bruns), das<br />
als ›› sehr gelungener Versuch eines real<strong>ist</strong>ischen<br />
<strong>Ballett</strong>s in der Deutschen Demo kratischen<br />
Republik‹‹ 9 gefeiert wird. Wie sehr der<br />
Tanz vom System instrumentalisiert wird,<br />
offenbart auch die Handlung: In <strong>Das</strong> Recht<br />
des Herrn lyncht eine aufgebrachte Dorfgemeinschaft<br />
am Ende ihren Gutsherrn. Drei <br />
einhalb Wochen vor der Uraufführung<br />
schlagen sowjetische Panzer den Aufstand<br />
des 17. Juni in der DDR blutig nieder. Es<br />
folgt eine große Verhaftungswelle der sogenannten<br />
›› Provokateure‹‹, die DDR-Regierung<br />
baut ihren Überwachungs- und Unterdrückungsstaat<br />
weiter aus. <strong>Das</strong> <strong>Ballett</strong><br />
kommt der DDR-Regierung sehr gelegen,<br />
zeigt es doch mit der Tötung des Guts besitzers,<br />
dass in der neuen sozial<strong>ist</strong>ischen<br />
Zeit auch gewaltsame Maßnahmen legitim<br />
sind.<br />
<strong>Das</strong> <strong>Ballett</strong> wird von Daisy Spies choreografiert.<br />
Sie <strong>ist</strong> eine Schülerin Rudolf<br />
von Labans, der den deutschen Ausdruckstanz<br />
in den 1920er Jahren entwickelt hat.<br />
1926 tanzt sie im Triadischen <strong>Ballett</strong>, einem<br />
experimentellen <strong>Ballett</strong> des Bauhausmalers<br />
Oskar Schlemmer und des Stuttgarter<br />
Tänzerpaars Elsa Hötzel und Albert Burger<br />
(1922). Bekannt wird es vor allem wegen<br />
der ungewöhnlichen Kostüme. Erst nach<br />
ihrer Laban-Ausbildung hat Spies bei Viktor<br />
Gvosky den klassischen russischen Tanz<br />
kennengelernt.<br />
Die klassischen russischen <strong>Ballett</strong>e werden<br />
in der DDR – genau wie in der Sowjetunion –<br />
ausschließlich als zuckersüße Märchenballette<br />
inszeniert, mit denen man problemlos<br />
auch auf Tournee gehen kann. <strong>Das</strong> <strong>ist</strong><br />
durchaus im Interesse des Regimes, das seine<br />
›› besten Produkte‹‹ – als solche sieht<br />
man seine Künstler – im feindlichen Ausland<br />
nur zu gern zeigen will, obwohl gerade<br />
bei Auslandstourneen die ständige Gefahr<br />
der Republikflucht mitre<strong>ist</strong>. Neben den Va luta<br />
will man auch die Bestätigung, dass<br />
das sozial<strong>ist</strong>ische Ausbildungssystem das<br />
beste und erfolgreichste sei.<br />
Doch sehr bald merkt man, dass die<br />
real<strong>ist</strong>ischen neuen DDR-<strong>Ballett</strong>e im Westen<br />
nicht gut ankommen. Die Häuser bleiben<br />
leer. So setzt man noch stärker auf die<br />
bewährten russischen Klassiker. Der umgekehrte<br />
Weg für West-Choreografen, in der<br />
DDR zu inszenieren oder dort mit ihren<br />
Compagnien aufzutreten, <strong>ist</strong> ungleich schwieriger.<br />
1967 gelingt dem Stuttgarter Choreografen<br />
John Cranko aber ein Gastspiel<br />
mit seiner Truppe an der Komischen Oper<br />
in Berlin und eine künstlerische Begegnung<br />
mit dem dortigen Chefchoreografen Tom<br />
Schilling. Zwei Jahre später (1969) kann<br />
Cranko an der Komischen Oper Jeu de Cartes<br />
(<strong>Das</strong> Kartenspiel) einstudieren, ein eigentlich<br />
unbeschwertes <strong>Ballett</strong> des Kompon<strong>ist</strong>en<br />
Strawinsky. Die Regime kritik, die Cranko