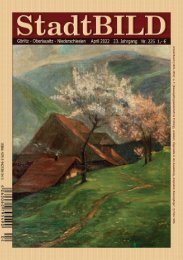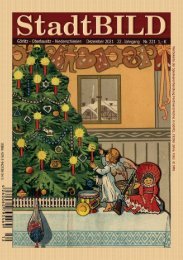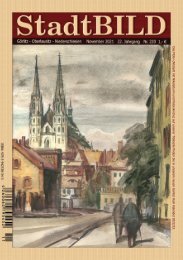218_StadtBILD_September_2021
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Das Motiv (Untermarkt) auf unserer Titelseite finden Sie in unserem neuen Fotokalender 2022.
Liebe Leserinnen, liebe Leser,<br />
Vorwort<br />
dass Denkmäler Identität stiften und ein Stück Lebensqualität<br />
sind, ist längst erwiesen. In Görlitz sind<br />
wir in der glücklichen Lage, inmitten von Denkmälern<br />
leben und arbeiten zu dürfen. Mit diesen verantwortungsvoll<br />
umzugehen, sollte unser persönliches<br />
Anliegen sein. Dass wir das tun, liegt jedoch auch im<br />
Interesse der Allgemeinheit.<br />
Ungezählte Generationen haben sie zu dem gemacht,<br />
was sie sind, und wir haben nicht aufgehört<br />
an ihnen zu arbeiten. Aber diese Arbeit ist nur dann<br />
nachhaltig, wenn sie auf dem Respekt für das Vorhandene<br />
gründet und sich als Teil des Ganzen einfügt.<br />
Darum ist es für die Zukunft unserer Stadt so wichtig,<br />
dass wir jedes unserer Denkmäler, materiell und<br />
ideell, als Teil von uns begreifen. Denkmalschutz und<br />
Denkmalpflege gehen uns alle an!<br />
Immer am zweiten Sonntag im <strong>September</strong> öffnen<br />
historische Bauten und Stätten, die sonst nur teilweise<br />
oder gar nicht zugänglich sind, ihre Türen. Dann<br />
gibt es beim Tag des offenen Denkmals (12. <strong>September</strong>)<br />
Geschichte zum Anfassen. Das diesjährige<br />
Motto lautet: „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur<br />
und Denkmalpflege“ und mit ganz viel „SEIN“<br />
sind auch einige Kirchen mit Führungen dabei und<br />
laden Interessierte aus Stadt und Region dazu ein,<br />
Kirchenräume neu zu entdecken. Man riecht das alte<br />
Holz im Dachstuhl, fühlt die kühlere Temperatur oben<br />
auf dem Turm oder tief unten in Kellergewölben und<br />
Bunkern, kann die Holzmaserung im Beton ertasten<br />
oder spüren, wie der Klang einer Orgel den ganzen<br />
Kirchenraum zum Vibrieren bringt. Denkmalbesuche<br />
sind ein rundum sinnliches Erlebnis.<br />
Am 12. <strong>September</strong> von 9.00 bis 18.00 Uhr veranstaltet<br />
der Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec sein<br />
affenstarkes Tierparkfest.<br />
Auch in diesem Jahr haben die Tierparkmitarbeiter<br />
ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt. Erfahren<br />
Sie aus erster Hand, wie der Arbeitsalltag eines<br />
Zootierpflegers aussieht. Spiel und Spaß für den guten<br />
Zweck verspricht u.a. das Artenschutz-Glücksrad.<br />
Als weiteres Highlight lädt eine Händler- und Aktionsmeile<br />
im Tibetdorf zum Schlendern ein.<br />
Während Sie nun diese Zeilen lesen, haben Sie bereits<br />
die Wahl gehabt und sich zum Lesen entschieden.<br />
– Es vergeht kein Tag, an dem Sie nicht wählen<br />
müssen und sich entscheiden...Angefangen mit ihren<br />
kleinen tagtäglichen Entscheidungen, die Sie treffen,<br />
z. B. wann Sie in den vor Ihnen liegenden Tag starten;<br />
aber auch die nicht alltäglichen Entscheidungen, zwischen<br />
denen Sie im Laufe ihres Lebens immer wieder<br />
die Wahl haben und die weitreichende Auswirkungen<br />
haben, können Sie nicht von sich wegschieben.<br />
Sie haben die Wahl.<br />
Gott sei Dank leben wir hier in Deutschland, in dem<br />
Freiheit eines demokratischen Rechtsstaates, in der<br />
wir unsere Meinung frei äußern dürfen. Das erfordert<br />
aber auch unsere Mündigkeit und unseren verantwortungsvollen<br />
Umgang mit unseren Rechten und<br />
daraus resultierenden Pflichten.<br />
Wenn man sich an Wahlen beteiligt, bestimmt man<br />
mit, was passiert. In einer Demokratie ist es wichtig,<br />
dass die Bürgerinnen und Bürger Verantwortung dafür<br />
mit übernehmen, welche Politik gemacht wird,<br />
welche politischen Entscheidungen getroffen werden.<br />
Sie machen sich bei Wahlen darüber Gedanken,<br />
welche Parteiprogramme ihnen zusagen, in welche<br />
Richtung die Politik in Zukunft gehen soll. Wer wählen<br />
geht am 26. <strong>September</strong> <strong>2021</strong>, kann also Einfluss<br />
darauf nehmen, welche Parteien im Parlament vertreten<br />
sind. Daher bitten wir Sie, liebe Leserinnen und<br />
Leser, gehen Sie am 26. <strong>September</strong> wählen! Sie haben<br />
die Möglichkeit eine Entscheidung mit offenen<br />
Augen in der Nachfolge zu treffen.<br />
Ihr Team vom <strong>StadtBILD</strong>-Magazin<br />
anzeige<br />
Einleitung<br />
3
950 Jahre Zukunft Görlitz Zgorzelec<br />
Jahre Zukunft<br />
Die Bürgerinnen und Bürger von Görlitz<br />
und Zgorzelec standen in ihrer Geschichte<br />
wiederholt vor großen Herausforderungen,<br />
aber auch vor großen Chancen.<br />
Sie mussten katastrophale Ereignisse und<br />
Schicksalsschläge überwinden. Mit Blick<br />
auf eine oft ungewisse Zukunft hatten<br />
Einwohner und Stadtväter weitreichende<br />
Entscheidungen zu fällen. Immer<br />
wieder waren Ängste vor notwendigen<br />
Veränderungen zu überwinden, mussten<br />
neue Möglichkeiten erkannt und schöpferische<br />
Kreativität entfaltet werden. Im<br />
geschichtlichen Rückblick greifen diese<br />
Momente und Ereignisse fast nahtlos ineinander<br />
und scheinen zudem meist ein<br />
glückliches Ende genommen zu haben.<br />
Die Vorausschau ist dagegen schwierig<br />
und bleibt in der Regel nebulös.<br />
Auch heute liegen vor den deutschen<br />
und polnischen Bürger der Europastadt<br />
Görlitz/Zgorzelec Aufgaben, deren Reichweite<br />
in die Zukunft nicht zu überschauen<br />
ist. Unter anderem stehen Klimawandel<br />
und tiefgreifende Veränderungen der<br />
wirtschaftlichen Verhältnisse bevor. Auch<br />
die Altersstruktur der Bevölkerung oder<br />
die Entwicklung innovativer Verkehrskonzepte<br />
werden zu Herausforderungen<br />
der kommenden Zeit. Wo wird die Europastadt<br />
im Jahr 2051 stehen? Wie wollen<br />
wir in der Zukunft zusammenleben?<br />
Die zweisprachige Sonderausstellung<br />
„950 Jahre Zukunft Görlitz Zgorzelec“ im<br />
Kaisertrutz, die noch bis zum 2. Januar<br />
2022 zu besichtigen ist, blickt in die wechselhafte<br />
Geschichte der Doppelstadt. Mit<br />
Hilfe der Besucher sollen aber auch Zukunftsfragen<br />
diskutiert werden.<br />
Görlitz betrat vor 950 Jahren die Bühne<br />
der Geschichte: Am 11. Dezember 1071<br />
verschenkte der römisch-deutsche König<br />
Heinrich IV. (1050–1106) aus der Familie<br />
der Salier viel Land an den Meißner Bischof<br />
Benno. Insgesamt erhielt das Bistum<br />
acht so genannte Königshufen, eine<br />
Liegenschaft mit wohl etwa 380 Hektar<br />
Fläche, deren genaue Lage in der Görlitzer<br />
Flur unbekannt ist. Das Land hatte zuvor<br />
einem „gewissen Ozer“ als Lehen gehört,<br />
der aber beim jungen König in Ungnade<br />
gefallen und nur um Haaresbreite seiner<br />
Hinrichtung entgangen war. Ob Ozer ein<br />
4<br />
Geschichte
1071 NEUGÖRLITZER<br />
950 Jahre Zukunft<br />
Schenkungsurkunde König Heinrichs IV.<br />
Goslar, 11. Dezember 1071, Handschrift auf Pergament, Siegel (Reproduktion, Original Sächsisches<br />
Hauptstaatsarchiv Dresden)<br />
Slawe vom Stamm der Milzener oder ein<br />
Deutscher gewesen ist, lässt sich anhand<br />
der Schriftquellen nicht nachweisen.<br />
Wie ein zufälliges Schlaglicht erwähnt<br />
die abgefasste Urkunde erstmals den Ort<br />
Goreliz, zu dem die verschenkten Ländereien<br />
gehörten. Das genannte Dorf wird<br />
zwischen der Kirche St. Peter und Paul<br />
und der heutigen Peterstraße zu suchen<br />
sein. Die Siedlung lag – wie in dieser Zeit<br />
in der Oberlausitz üblich – im unmittelbaren<br />
Vorfeld der auf dem Burgberg im<br />
Bereich von Peterskirche und Vogtshof<br />
gelegenen Görlitzer Burg. Dort hatte<br />
wohl auch Ozer seinen Sitz. Er war unter<br />
anderem zweifellos mit der Aufgabe betraut,<br />
die für den Handel bedeutende und<br />
noch heute an der Einmündung des Baches<br />
Lunitz bestehende Neißefurt nahe<br />
der heutigen Hirschwinkel-Sporthalle<br />
Geschichte<br />
5
950 Jahre Zukunft Görlitz Zgorzelec<br />
Jahre Zukunft<br />
Detail eines pflügenden Bauern mit Beetpflug aus „Abcontrafaitung der Stadt Görlitz“<br />
Georg Scharffenberg nach Joseph Metzker, 1566, Holzschnitt (Görlitzer Sammlungen)<br />
militärisch abzusichern. Aufgrund der<br />
über die Jahrhunderte intensiven Bebauung<br />
des Burgareals haben sich allerdings<br />
wohl nur im Untergrund der Peterskirche<br />
noch Spuren der Befestigung erhalten,<br />
darunter wohl auch Reste einer vermutlich<br />
hölzernen Burgkirche. Verschiedene<br />
archäologische Ausgrabungen im Umfeld<br />
erbrachten jedenfalls keinerlei Hinweise<br />
auf die 1126 und 1131 unter dem Namen<br />
Yzhorelik urkundlich genannte Burg. Allein<br />
slawische Tonscherben sowie das<br />
anzeige<br />
6<br />
Geschichte
1071 NEUGÖRLITZER<br />
950 Jahre Zukunft<br />
Schar und Sech eines Beetpflugs<br />
Gefunden auf der Landeskrone, um 1400, Eisen (Görlitzer Sammlungen)<br />
Grab einer Frau, die bei Ausgrabungsarbeiten<br />
in den Jahren zwischen 1981 und<br />
1987 innerhalb der Kirche zum Vorschein<br />
kamen, verweisen auf die Verteidigungsanlage.<br />
Die Scherben stammen aus der<br />
Zeit zwischen 900 und 1000. Bereits in<br />
dieser frühen Zeit dürfte sich auf dem<br />
Görlitzer Burgberg eine Befestigung der<br />
slawischen Milzener befunden haben. Die<br />
Anlage diente mit über 70 weiteren Burgen<br />
in der Oberlausitz der Verteidigung<br />
gegen die Eroberungen durch das säch-<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
7
950 Jahre Zukunft Görlitz Zgorzelec<br />
Jahre Zukunft<br />
sisch-ostfränkische Reich. Auch in den<br />
Auseinandersetzungen zwischen 1002<br />
und 1031 zwischen den polnischen Piasten-Herzögen<br />
und den ostfränkischen<br />
Königen und römisch-deutschen Kaisern<br />
wird die Befestigung zur Sicherung der<br />
Neißefurt eine Rolle gespielt haben.<br />
Die Schenkungsurkunde von 1071 markiert<br />
den Beginn des so genannten<br />
mittelalterlichen Landesausbaus in der<br />
Oberlausitz und in Görlitz durch deutsche<br />
Siedler. Denn Bischof Benno von Meißen<br />
warb für sein neues Land Siedler vermutlich<br />
aus Thüringen und Franken an. Kaufleute<br />
und Bauern ließen sich daraufhin<br />
in der am Bach Lunitz neu gegründeten<br />
Siedlung im heutigen Nikolaiviertel nieder.<br />
Sie brachten unter anderem neue<br />
Techniken der Landwirtschaft mit, die zu<br />
erheblichen Ertragssteigerungen führten.<br />
Dazu zählte beispielsweise der Beetpflug<br />
mit eisernem Sech und Pflugschar,<br />
mit dessen Hilfe der Ackerboden tiefgreifend<br />
umgebrochen werden konnte: Das<br />
vorlaufende Sech zerschnitt den Boden<br />
vertikal, die nachlaufende Pflugschar löste<br />
die Scholle horizontal und das Streichbrett<br />
wendete sie um. Die effektiveren<br />
Beetpflüge ersetzten die älteren, von den<br />
Slawen verwendeten Hakenpflüge. Diese<br />
rissen lediglich eine Furche in den Boden.<br />
Die Verwendung von Beetpflügen zählte<br />
zu den wichtigen Neuerungen des mittelalterlichen<br />
Landesausbaus. Pflugschar<br />
und Sech eines Beetpflugs des 14. Jahrhunderts<br />
wurden 1968 auf der Landeskrone<br />
gefunden<br />
Hoffnungsvolle Menschen aus verschiedenen<br />
Gegenden des Reiches begegneten<br />
hier bald nach 1071 slawischen Milzenern,<br />
die bereits über 300 Jahre früher<br />
das Land in Besitz genommen hatten. Zugezogene<br />
und Alteingesessene mussten<br />
Sprach- und Kulturgrenzen überwinden.<br />
Dies wird sicherlich nicht durchweg ohne<br />
Konflikte vonstatten gegangen sein.<br />
Doch so begann die Erfolgsgeschichte<br />
von Görlitz mit dem Zuzug vieler fremder<br />
Menschen. Durch die neuen Siedler<br />
entwickelte sich das Dorf Goreliz in den<br />
folgenden 200 Jahren vom bescheidenen<br />
Burgort zur florierenden Handelsstadt.<br />
anzeige<br />
8<br />
Geschichte
1071 NEUGÖRLITZER<br />
950 Jahre Zukunft<br />
Magdeburger Stadtrecht 1303<br />
Urkunde zur Verleihung des Magdeburger Stadtrechts an die Stadt Görlitz durch Markgraf Hermann von<br />
Brandenburg (1275–1308) am 28. November 1303, Handschrift, Pergament, Siegel, Abschrift 1483,<br />
Bunzlau (Ratsarchiv Görlitz)<br />
Maßgeblich dafür war die zunächst durch<br />
die Lunitz-Niederung über den Steinweg<br />
und den heutigen Nikolaigraben zur Neiße<br />
verlaufende europäische Handelsstraße<br />
Via Regia und die Nähe zur Neiße-Furt.<br />
Erst gegen 1234 wurde an der Stelle der<br />
heutigen Altstadtbrücke eine Brücke<br />
über die Neiße errichtet. Sie fand erstmals<br />
im Testament des Heinrich vom Dorfe<br />
1298 Erwähnung. Im Zusammenhang mit<br />
dem Brückenbau wurde die Via Regia von<br />
der Lunitz-Niederung auf die Achse Obermarkt,<br />
Brüderstraße, Untermarkt und<br />
Neißstraße verlegt. Zeitgleich erfolgte<br />
vermutlich auch die planmäßige Erweiterung<br />
der Stadtfläche um den Obermarkt<br />
herum sowie im Bereich und südlich des<br />
Untermarktes. Durch die Verlegung der<br />
Fernhandelsstraße und den Stadtausbau<br />
verlor das Nikolaiviertel seine durch die<br />
alte Straßenführung begründete Bedeutung<br />
als Kaufmannsniederlassung. Die<br />
Kaufleute errichteten nun neue Häuser<br />
auf den abgesteckten Parzellen entlang<br />
Geschichte<br />
9
950 Jahre Zukunft Görlitz Zgorzelec<br />
Jahre Zukunft<br />
Judeneid<br />
Um 1300, Handschrift, Pergament (Ratsarchiv Görlitz)<br />
der neuen Wegeführung und um die<br />
beiden Marktplätze herum. Das heutige<br />
Nikolaiviertel wurde so zur Handwerkersiedlung.<br />
Die Brücke, die jederzeit,<br />
auch bei Hochwasser oder Eisgang, eine<br />
Querung der Neiße ermöglichte, war der<br />
Schlüssel zum steilen wirtschaftlichen<br />
Aufschwung der jungen Stadt Görlitz. Das<br />
Zusammenwirken alteingesessener Milzener<br />
und zugezogener Deutscher war<br />
also letztlich ein Erfolgsmodell. Die Verwendung<br />
des Magdeburger Stadtrechts<br />
seit etwa 1260 markiert den vorläufigen<br />
Höhepunkt dieses Erfolgs. Im Jahr 1303<br />
lassen sich die Görlitzer das Magdeburger<br />
Stadtrecht bestätigen. Jeder einzelne<br />
Bürger verpflichtet sich ihm mit einem<br />
Eid. Dieses Recht durchdringt alle Bereiche<br />
des Lebens, Wohnens und Arbeitens.<br />
Es schützt die Bürger und deren Besitz,<br />
fordert aber auch Pflichten ein wie etwa<br />
die Verteidigungsbereitschaft. Ebenso<br />
hatten die jüdischen Einwohner der Stadt<br />
ihre Loyalität zu beeiden. Im Buch vom<br />
Land- und Lehnrecht ist der älteste Görlitzer<br />
Judeneid überliefert. Ähnlich wie der<br />
Bürgereid verpflichtete er die jüdischen<br />
Bürger auf das Wohl der Stadt. An diesem<br />
hatten sie durch Waren- und Geldhandel<br />
großen Anteil und genossen den Schutz<br />
des Königs. Durch solche und andere<br />
Maßnahmen schufen die Stadtgründer<br />
die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche<br />
und politische Blüte bis weit in das<br />
10 Geschichte
950 Jahre Zukunft Görlitz Zgorzelec<br />
Jahre Zukunft<br />
Görlitzer Tuchplomben<br />
Gefunden auf den Lofoten, Norwegen, um 1530, Blei (Privatbesitz)<br />
16. Jahrhundert. Dies dokumentieren unter<br />
anderem auch Görlitzer Tuchplomben<br />
der Zeit um 1500 aus Blei, die auf den Lofoten<br />
in Norwegen gefunden wurden. Sie<br />
verweisen auf den Handel mit getrocknetem<br />
sogenanntem Stockfisch. Die an den<br />
Tuchballen angebrachten Siegel garantierten<br />
den Abnehmern sowohl die erstklassige<br />
Qualität als auch den Ursprung<br />
der Ware. Weitere Funde von Görlitzer<br />
Tuchplomben am Polarkreis, in einem<br />
Zarenpalast bei Moskau, in Böhmen und<br />
Mähren sowie in Ungarn belegen die<br />
Reichweite des Görlitzer Tuchhandels<br />
dieser Zeit.<br />
Migration hat es in Görlitz seither immer<br />
wieder gegeben: Nach ihrer Vertreibung<br />
im Jahr 1348 siedelten sich seit 1847 erneut<br />
Menschen jüdischen Glaubens in<br />
der Neiße-Stadt an; ab 1620 kamen böhmische<br />
Glaubensflüchtlinge nach Görlitz;<br />
seit etwa 1866 strömten im Zuge der<br />
industriellen Revolution viele Schlesier<br />
vom Land in die Stadt und suchten Arbeit<br />
in den neuen Fabriken; nach 1945 ließen<br />
sich zahllose schlesische Flüchtlinge und<br />
Vertriebene aus der Ostoberlausitz in<br />
Görlitz und der Umgebung nieder; heute<br />
leben über 4000 polnische Bürger in<br />
Görlitz, arbeiten hier und schicken ihre<br />
Kinder in deutsche Schulen. Bis heute erhält<br />
die Entwicklung der Stadt durch die<br />
zugezogenen Menschen immer wieder<br />
entscheidende Impulse. Stets hat Görlitz<br />
vom Zuzug dieser neuen Bewohner profitiert!<br />
Jasper v. Richthofen<br />
12 Geschichte
Textile Poesie – StoffGeschichten von Gisela Hafer<br />
Selbstporträt der Künstlerin<br />
Ein Besuch der Ausstellung „StoffGeschichten“<br />
bedeutet eintauchen in die Gedanken-<br />
und Erlebniswelt von Gisela Hafer.<br />
In ihrer künstlerischen Tätigkeit widmet sie<br />
sich dem Material Stoff. Auch Fotos finden<br />
Verwendung und werden in einer von ihr<br />
entwickelten Transfertechnik auf Stoff<br />
übertragen und seriell und spielerisch<br />
zu Collagen zusammengefügt, verfremdet,<br />
gespiegelt, bemalt und anschließend<br />
montiert und benäht. Erst aus der Nähe<br />
erschließt sich bei den meist großformatigen<br />
Arbeiten das Thema. Die Bilder der<br />
Vergänglichkeit werden zu Zeitsplittern,<br />
hinterfragen, schaffen Metamorphosen.<br />
Die Geschichte der Deutschen Mark<br />
Nichts ist so, wie es auf den ersten Blick<br />
scheint. Geheimnisvoll sind verschlüsselte<br />
Botschaften, Buchstaben, die auftauchen,<br />
ein Spiel mit Text und Textur. Ihre Inspirationen<br />
findet sie in der Natur, der Kunst, der<br />
Literatur, der Politik, im eigenen Erleben.<br />
So kann man beispielsweise den Texturen<br />
geschredderter DM-Scheine ebenso wie<br />
den Spuren der Industrie folgen. (Pressetext)<br />
Gisela Hafer wuchs in der alten Textilstadt<br />
Zittau auf. Das Interesse an Stoffen, ihrer<br />
Verarbeitung und zuletzt künstlerischen<br />
Gestaltung erwarb sie von ihrem Vater,<br />
einem Textilarbeiter. Nach dem Abitur<br />
14 Sonderausstellung
Ausstellung im Schloß Königshain noch bis 03. Oktober <strong>2021</strong><br />
StoffGeschichten<br />
absolvierte Gisela Hafer ein Maschinenbaustudium<br />
und arbeitete einige Jahre im<br />
Bereich der Gestaltung des Arbeitsumfeldes.<br />
Bereits in dieser Zeit entstanden erste<br />
Werke aus Stoff, die sich künstlerisch mit<br />
dem Arbeitsumfeld auseinandersetzten.<br />
Auf Grund des Erfolges ihrer ersten Ausstellungen<br />
wagte sie 1983 den Schritt in<br />
die Selbstständigkeit und arbeitet seither<br />
erfolgreich als Künstlerin und Dozentin.<br />
Der internationale Durchbruch gelang<br />
ihr als Quilt-Künstlerin, als ihre Werke in<br />
vielen Einzelausstellungen und etlichen<br />
Ausstellungsbeteiligungen einem großen<br />
Publikum im In- und Ausland gezeigt<br />
wurden. Ihre stimmungsvollen Quilts und<br />
textilen Collagen beschäftigen die jetzt in<br />
der pulsierenden Metropole Frankfurt lebende<br />
Künstlerin mit der Frage: Was aber<br />
passiert, wenn das Textil zum Spiegel der<br />
sozialen, politischen und wirtschaftlichen<br />
Verhältnisse wird?? So ist es fast selbstverständlich,<br />
dass sie sich in der Bankenmetropole<br />
auch mit dem Geld, an dem „fast<br />
alles hängt, zu dem alles drängt“, beschäftigt.<br />
Ein interessantes Beispiel zur Gestaltung<br />
mit der Deutschen Mark ist auch in<br />
Königshain zu betrachten.<br />
Gisela Hafer gestaltet aber auch die Geschichte<br />
und Gegenwart ihrer alten Heimat<br />
Zittau in vielen detailreichen Einzelwerken.<br />
2020 übergab die Künstlerin an<br />
den Zittauer Oberbürgermeister Thomas<br />
Zenker das „Zittauer Wunschtuch“ mit<br />
200 eingenähten Wünschen von Bürgern<br />
und Besuchern der Stadt Zittau.<br />
Am 30. August plant Gisela Hafer, als Mit-<br />
Kuratorin, die Ausstellung „Kitsch und<br />
Kunst“ zu eröffnen. Wir freuen uns, dass<br />
die sehenswerte Ausstellung mit Werken<br />
von Gisela Hafer noch bis zum 03. Oktober<br />
<strong>2021</strong> im Barockschloß Königshain zu<br />
sehen ist.<br />
Bertram Oertel<br />
Alte Zittauer Fotografie auf Stoff<br />
Sonderausstellung<br />
15
Gastwirtschaften vorgestern, gestern und heute<br />
Über unsere Stadt ist in der Vergangenheit<br />
schon viel erforscht und geschrieben<br />
worden, so dass man meint, es gäbe<br />
nichts Neues mehr zu erkunden. Dennoch<br />
kommt immer wieder bisher Unbekanntes<br />
ans Tageslicht, das erstaunen lässt. So in<br />
diesen Wochen eine Publikation, die über<br />
die Gastronomie vor langer Zeit und heute<br />
Auskunft gibt und beim Görlitzer Leser<br />
vielleicht einen AHA-Effekt erzeugt.<br />
Bekanntlich hat unsere denkmalgeschützte<br />
Stadt eine lange und bewegte Vergangenheit.<br />
Wie in allen anderen Städten<br />
auch, war nahezu jedes Gewerbe hier<br />
ansässig. Kaufleute, Händler von nah und<br />
fern führte es über die „via regia“ nach<br />
Görlitz. Nicht wenige von ihnen ließen<br />
sich hier nieder und sorgten für das Aufblühen<br />
unserer Stadt. Doch oftmals blieb<br />
nicht viel an Wissen über die einzelnen<br />
Firmen erhalten. Als die ersten Ansichtskarten<br />
vor 1900 verschickt wurden, ahnte<br />
noch niemand, dass genau solche Karten<br />
über 100 Jahre später zu sehr wichtigen<br />
Zeitdokumenten werden sollten. Dabei<br />
geht es nicht um Massenmotive wie Landeskrone,<br />
Rathaustreppe oder Ruhmeshalle,<br />
sondern um Privatfotokarten und<br />
Geschäftsansichten einzelner Firmen. Drei<br />
Görlitzer Hobby-Historiker, Detlef Stahr,<br />
Andreas und Martin Herda, hatten vor<br />
vielen Jahren begonnen, historische Görlitzer<br />
Ansichtskarten zu sammeln und zu<br />
ergründen, was sich hinter der einen oder<br />
anderen Ansicht verbirgt.<br />
Inzwischen umfasst die Görlitzer Ansichtskarten-Sammlung<br />
nun weit über 9000<br />
Stück. Dazu kommen noch weitere historische<br />
Dokumente wie Briefbögen, Vignetten<br />
oder alte Broschüren. Mit jedem<br />
Neuzugang wächst das Wissen über die<br />
einzelnen Firmen.<br />
Natürlich stehen sie mit Gleichgesinnten<br />
in engem Kontakt. Oft werden sie sogar<br />
von anderen Hobbyhistorikern bzw. Familienforschern<br />
angesprochen, die auf<br />
Suche über Informationen ihrer Familie<br />
sind. Nicht selten wurden sie angeregt:<br />
„Ihr wisst doch so viel, macht doch mal ein<br />
Buch“.<br />
Welche Situation die Jahre 2020/21 brachten,<br />
ist uns allen bekannt. Sie ließ bei ihnen<br />
den Entschluss reifen, sich mit einem<br />
anzeige<br />
16<br />
Buchvorstellung
Buchvortsellung<br />
Gastwirtschaft<br />
bestimmten Thema zu befassen. Die<br />
angespannte Lage in diesem Gewerbe<br />
lenkte sie auf das Thema „Schank- und<br />
Gastwirtschaften in Görlitz“. Sie kennen<br />
einige Gaststätten- und Kneipeninhaber<br />
persönlich.<br />
So fingen die Drei an, quer Beet durch die<br />
gesamte Stadt über einzelne Restaurationen<br />
das jahrelange zusammengetragene<br />
Wissen zu erfassen und passende Ansichten<br />
und Werbungen darin einfließen zu<br />
lassen.<br />
Nachdem sie mehrere Wochen zahlreiche<br />
Gaststätten begutachtet hatten oder zumindest<br />
den Grundstock für einen ausreichenden<br />
Text zusammentrugen, stellten<br />
sie fest, dass sie sich ohne ein vernünftiges<br />
Konzept in dem Projekt verrennen<br />
würden. Also setzten sie sich nicht wenige<br />
Male bei „einem“ Bierchen zusammen<br />
und überlegten, was denn nun wirklich<br />
Sinn macht. Sie entschieden sich für einen<br />
Stadtrundgang, entlang bzw. innerhalb<br />
der früheren Stadtmauer. So wurde das<br />
Stadtgebiet zunächst auf den historischen<br />
Kern eingegrenzt.<br />
Heraus kamen 70 Gaststätten und Kneipen,<br />
die auf 150 Seiten des Buches<br />
vorgestellt werden - vom Obermarkt,<br />
Brüderstraße, Untermarkt, Neißstraße, Nicolaivorstadt<br />
und angrenzenden Gassen.<br />
anzeige<br />
Buchvorstellung<br />
17
Gastwirtschaften vorgestern, gestern und heute<br />
Nun muss ich als Mitautor dieser Zeilen<br />
bekennen, dass ich in meinen jüngsten<br />
Jahren, also nach 1945, keine der hier genannten<br />
damals noch bestehenden Gasthäuser<br />
kennengelernt habe; auch später<br />
nicht als Jugendlicher; Erst nach der Wende<br />
bei gelegentlichen Besuchen in der<br />
Heimat.<br />
Ratsstübl, Rathaus Untermarkt<br />
Eine ungeheure, aufwändige Fleißarbeit<br />
und der Leser fragt sich, wie konnten vor<br />
über 100 Jahren und mehr die Gastwirtschaften<br />
in der engeren Altstadt überhaupt<br />
existieren? Nun wohnten damals<br />
in den Häusern viel mehr Menschen als<br />
heutzutage und die Familien waren meist<br />
größer. Der Leser dieser Abhandlung erfährt<br />
nicht nur Umfangreiches und Hintergründiges<br />
aus der Gaststätten- und<br />
Kneipenhistorie; die Autoren lassen auch<br />
viele historische Details aus der Stadtgeschichte<br />
einfließen, die der Leser nicht unbedingt<br />
weiß.<br />
Klosterbrunnen, Klosterplatz 15<br />
Durch die Motive, nicht nur auf den Ansichtskarten,<br />
sondern auch auf Privatfotos<br />
in der Sammlung, kann man teilweise<br />
deutlich die baulichen Veränderungen in<br />
anzeige<br />
18<br />
Buchvorstellung
Buchvortsellung<br />
Gastwirtschaft<br />
der Stadt nachverfolgen. Einige Wirtschaften<br />
existieren noch, andere sind durch<br />
Umbauten der Häuser geschlossen und<br />
andere durch Abriss komplett aus dem<br />
Stadtbild verschwunden.<br />
Mit diesem Buch wollen die Autoren auch<br />
einen Beitrag für das 950jährige Stadtjubiläum<br />
beisteuern und Wissen für die<br />
Nachwelt erhalten. Sie haben die Absicht,<br />
ein weiteres Gaststättenbuch zu erarbeiten.<br />
Ein Teil der Historie der Wirtschaften<br />
außerhalb des Altstadtkerns, in den<br />
Gründerzeitgebieten, haben sie schon im<br />
Pechtners Gasthaus, Obermarkt 18<br />
Groben skizziert. Allerdings, dies sei angemerkt,<br />
ist das Buch eigentlich nur für „echte”<br />
gegenwärtige und ehemalige Görlitzer<br />
sowie historisch Interessierten zu empfehlen.<br />
Lesenswert aber allemal.<br />
Martin Herda (Görlitz)<br />
Wolfhard Besser (Berlin)<br />
Walthers Bierstuben, Elisabethstr. 16<br />
Erhältlich bei: GR-LI-BRÄU,<br />
Landeskron- Ecke Löbauer Straße und<br />
Stöberlädchen, Luisenstr. 21<br />
Preis: 18 €<br />
anzeige<br />
Buchvorstellung<br />
19
Wie eine Wirtin aus Cunewalde zur Mumacherin des Jahres wird<br />
Kleene Schänke<br />
Carola Arnold in ihrer Eventküche.<br />
© Marcel Schröder<br />
Seit über einem Jahr hält die Corona-Pandemie<br />
die Welt in Atem – mit gravierenden<br />
Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben:<br />
Viele Betriebe aus Gastgewerbe, Reisewirtschaft,<br />
Freizeit- und Veranstaltungswirtschaft<br />
sowie Einzelhandel mussten ihre<br />
Tätigkeit stark reduzieren oder gar ganz<br />
herunterfahren. Etliche von ihnen suchen<br />
eigene Wege, ihr Geschäft unter Einhaltung<br />
der Corona-Regeln weiterzuführen<br />
und für den Kunden und Gast sichtbar zu<br />
bleiben.<br />
Die Industrie- und Handelskammer (IHK)<br />
Dresden hat am 13. Juli <strong>2021</strong> in ihren Räumen<br />
die Preisträger des Wettbewerbs “Umdenker,<br />
Anpacker, Mutmacher gesucht!”<br />
ausgezeichnet.<br />
Über den ersten Platz und damit 7.000 Euro<br />
Preisgeld konnte sich Carola Arnold, Pächterin<br />
der Kleenen Schänke in Cunewalde<br />
freuen und entgegennehmen. Unter knapp<br />
40 Bewerbungen für innovative Ideen während<br />
der Corona-Pandemie konnte Sie die<br />
Jury aus Einzelhandel, Reisewirtschaft und<br />
Gastronomie überzeugen.<br />
Sie stellt sich selbst als einen „Ideenschnellkochtopf“<br />
vor. Weil es in ihrem Umgebindehaus<br />
während der Pandemie „zu<br />
kuschlig“ für Lesungen, Verkostungen und<br />
anzeige<br />
20<br />
Geschichte
Carola Arnold siegt im Wettbewerb<br />
Kleene „Umdenker, Anpacker, Schänke<br />
Mutmacher gesucht!“<br />
Floristik-Workshops wurde, ließ sich Carola<br />
immer wieder was Neues einfallen.<br />
Experimentierfreudige Küchenmeisterin ist selbst<br />
Produzentin und hat in einem langen und aufwendigen<br />
Prozess eigene Rezepte für Brotmischungen<br />
mit seltenen Getreidesorten, wie zum<br />
Beispiel Schwarzemmer, Dinkel und Champagnerroggen<br />
entwickelt.<br />
Den Anfang machte eine Whiskykochbox,<br />
ein Whiskydinner mit digitaler Verkostung<br />
und Kochvideo für zu Hause. Es folgten die<br />
Entwicklung und der Online-Vertrieb von<br />
drei Brotbackmischungen in Bioqualität,<br />
das Schreiben und der Eigenverlag des ersten<br />
eigenen Kochbuchs „Carola kocht“ mit<br />
Zutaten und unterhaltsamen Geschichten<br />
aus der Oberlausitz incl. 14 Produzentenporträts<br />
– über 4.400 Exemplare sind schon<br />
verkauft. Im Advent 2020 wurde die Kleene<br />
Schänke zum Weihnachtskaufhaus, im<br />
Frühjahr <strong>2021</strong> kamen Online-Verkostungen<br />
mit regionalen Genusspaketen dazu.<br />
Ein TV-Dreh zum Kochbuch mit dem MDR-<br />
Sachsenspiegel + zwei Radio Interviews<br />
führte zur zweiten Auflage „Carola kocht“.<br />
Die Verkaufszahlen gingen innerhalb von<br />
3 Monaten durch die Decke. Parallel zum<br />
Verkauf sind kleine YouTube-Filme entstanden,<br />
gedreht unter dem Motto „Carola<br />
kocht und plaudert mit Oberlausitzer<br />
Produzenten“. Es folgte ein Oberlausitzer<br />
Online-Abend mit dem Verein SlowFood<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
21
Wie eine Wirtin aus Cunewalde zur Mumacherin des Jahres wird<br />
Kleene Schänke<br />
Ein Treffpunkt für Menschen. Ein Ort, an dem man sich und viele Genüsse kennenlernt. Von Mediterran<br />
Kochen, Betreutes Trinken, Brot Backen und Käsewerkstatt bis hin zu Leseabenden mit Menü und<br />
Reisevorträgen mit Landküche.<br />
Lausitz, wo Sie ihr Kochbuch und vier<br />
Oberlausitzer Produzenten vorstellte. Mit<br />
der Cunewalder ProBier-Werkstatt folgt die<br />
zweite, sehr aufwendige Online-Veranstal-<br />
anzeige<br />
22<br />
Geschichte
Carola Arnold siegt im Wettbewerb<br />
Kleene „Umdenker, Anpacker, Schänke<br />
Mutmacher gesucht!“<br />
Mein kleines Laden Cafè mit vorwiegend regionalen Produkten, interessant für Ansässige und<br />
Besucher. © Marcel Schröder<br />
tung, genau am Tag des Bieres. Mit einer<br />
Hofkiste, vollgepackt mit ökologischem<br />
Gemüse und Obst, die vom Enderhof Tetta<br />
wöchentlich angeboten wird, lädt Carola<br />
Arnold zum geselligen Miteinander beim<br />
Schnippeln, Brutzeln und Verkosten ein.<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
23
Wie eine Wirtin aus Cunewalde zur Mumacherin des Jahres wird<br />
Kleene Schänke<br />
Die Kleene Schänke ist ein Umgebindehaus wie aus dem Bilderbuch. Rustikale Fassade, drinnen lockt<br />
Stubengemütlichkeit, davor ein Bauerngärtchen, in dem der Sommer blüht – ein Musterhaus für die<br />
Oberlausitzer Gastlichkeit. © Marcel Schröder<br />
Im Mai eroberte die Oberlausitz Dresden.<br />
Der neue Laden direkt neben Pfunds Molkerei,<br />
dem schönsten Milchladen der Welt<br />
verkauft jetzt auch Oberlausitzer Produkte.<br />
anzeige<br />
24<br />
Geschichte
Carola Arnold siegt im Wettbewerb<br />
Kleene „Umdenker, Anpacker, Schänke<br />
Mutmacher gesucht!“<br />
Dazu kommt die Löbauer Bergquellbrauerei<br />
mit ihrem Goldenen Reiter ins Spiel.<br />
Aktuell entsteht gerade ein Kulinarischer<br />
Kalender gemeinsam mit den Stadtwerken<br />
Löbau, mit dem Ziel, Region und Küche<br />
hervorzuheben, einzubinden und<br />
bekannt zu machen. Gleichzeitig ist eine<br />
Fischkochbroschüre zu 20 Jahre Lausitzer<br />
Fischwochen mit der MGO und Slow Food<br />
entstanden. Als Highlight zur Eröffnung<br />
der Fischwochen können Sie eine kleine<br />
kulinarische Reise mit dem Oldtimer Bus<br />
online über www.kleeneschaenke.de/veranstaltungen<br />
buchen!<br />
Und ab <strong>September</strong> geht`s los, jeden ersten<br />
Mittwoch ein Lese- & Genussnachmittag<br />
gemeinsam mit dem Team des Bieleboh<br />
Naturressort mit immer einem Oberlausitzer<br />
Autor.<br />
Alle Projekte sind zukunftsfähig und werden<br />
weitergeführt. Die Schwerpunkte Regionalität<br />
und Netzwerkarbeit wurden und<br />
werden weiter gestärkt, digitale Standbeine<br />
aufgebaut. Weitere Projekte stehen<br />
schon in den Startlöchern und wir dürfen<br />
gespannt sein!<br />
IHK-Präsident Andreas Sperl zeigte sich zur<br />
Verleihung am 13. Juli beeindruckt von ihrem<br />
Optimismus.<br />
Erst im Juni 2016 hat Carola Arnold die<br />
Kleene Schänke in Cunewalde eröffnet. Als<br />
gebürtige Oberlausitzerin lebte Sie seit Ihrem<br />
Ausbildungsbeginn 1978 in Dresden<br />
und war bis zuletzt als Betriebs- Küchenleiterin<br />
im Cateringgeschäft tätig.<br />
Sie sieht sich als Zugpferd und möchte<br />
andere ermutigen. „Ich glaube daran, eine<br />
Krise ist immer auch eine Chance, jeder hat<br />
seine Chance im ganz Kleinen wie im ganz<br />
Großen und alles ist sehr wichtig im Puzzlespiel<br />
des ganz normalen Wahnsinns, LEBEN<br />
genannt“. Eure Carola (Arnold) Mai <strong>2021</strong><br />
Gerne können Sie Carola Arnold kontaktieren!<br />
Sie ist immer auf der Suche nach neuen<br />
aktiven Mitmachern und Ansprechpartner.<br />
Kathrin Drochmann<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
25
18. Neiße Filmfestival in Dreiländerregion an der Neißefilmfestival<br />
Vom 16. bis 19. <strong>September</strong> geht das Neiße<br />
Filmfestival in seine 18. Auflage. Aufgrund<br />
der andauernden Corona-Pandemie musste<br />
der Festivaltermin auch in diesem Jahr<br />
vom Mai in den <strong>September</strong> verschoben<br />
werden. Das Publikum in der Dreiländerregion<br />
an der Neiße erwarten an vier Festivaltagen<br />
über 60 Spiel-, Dokumentar- und<br />
Kurzfilme in drei Wettbewerben und begleitenden<br />
Filmreihen und ein vielseitiges<br />
Rahmenprogramm.<br />
Eröffnet wird das 18. Neiße Filmfestival<br />
am 16. <strong>September</strong> mit dem thematisch<br />
zur diesjährigen Fokus-Reihe passenden<br />
Film „Je suis Karl“ (DE/CZ, 2020) von Christian<br />
Schwochow, der zeitgleich in drei<br />
deutschen Kinos zu sehen ist. Im Hauptwettbewerb<br />
des Festivals um den besten<br />
Spielfilm treten je drei Produktionen aus<br />
Deutschland, Polen und Tschechien an,<br />
die u.a. Geschichten von jugendlichen Lebenswelten<br />
und über das Heranwachsen<br />
erzählen. Der Gewinnerbeitrag wird am<br />
Ende mit dem mit 10.000 Euro dotierten<br />
„Drei-LänderFilmpreis“ der sächsischen<br />
Kulturministerin ausgezeichnet. Auch im<br />
Wettbewerb um den besten Dokumentarfilm<br />
gehen insgesamt neun Produktionen,<br />
die sich kritisch mit dem Verhältnis zwischen<br />
Generationen oder zwischen Menschen<br />
und Natur auseinandersetzen, ins<br />
Rennen. Der Preis ist hier mit 5.000 Euro<br />
dotiert und wird von der Standortkampagne<br />
„So geht sächsisch.“ gestiftet. Der<br />
26<br />
Ausblick | Anzeige
18. Neiße Filmfestival in Dreiländerregion an der Neißefilmfestival<br />
Kurzfilm-Wettbewerb beim Neiße Filmfestival,<br />
für den der Studierendenrat der<br />
Hochschule Zittau/Görlitz ein Preisgeld<br />
von 1.000 Euro stiftet, umfasst <strong>2021</strong> wieder<br />
eine große künstlerische Bandbreite<br />
mit Spiel- und Dokumentarfilmen sowie<br />
Animationen, die sich auf vielfältige Weise<br />
mit Menschen in Ausnahmesituationen<br />
befassen.<br />
pa heute ausmacht und wie eine Zukunft<br />
Europas aussehen könnte. Das Filmfest<br />
an der Neiße steht in seiner Trinationalität<br />
von Beginn an für ein offenes, sozial<br />
gerechtes und tolerantes Europa. Wohlstandsgefälle,<br />
Demokratiedefizite und nationalistisches<br />
Denken stellen diese Vision<br />
jedoch in Frage und gefährden lange als<br />
selbstverständlich geltende Freiheiten.<br />
Dieser Auseinandersetzung möchte sich<br />
Unter dem Titel „Mother Europe“ richtet<br />
das 18. Neiße Filmfestival seinen Blick<br />
auf das, was Europäer verbindet – auf die<br />
Wurzeln der europäischen Idee, was Euro-<br />
28<br />
Ausblick | Anzeige
16. – 19. <strong>September</strong> <strong>2021</strong><br />
18. Neißefilmfestival<br />
das Festival mit seiner diesjährigen Fokus-<br />
Reihe nähern und aus der Mitte Europas<br />
heraus zum gesellschaftlichen Diskurs<br />
beitragen. Zum Programm gehört dabei<br />
u.a. eine Lesung mit Navid Kermani am<br />
17. <strong>September</strong> im Gerhart-Hauptmann-<br />
Theater in Zittau.<br />
Daneben stehen in der Reihe „Regionalia“<br />
aktuelle Beiträge von regionalen Filmschaffenden<br />
auf dem Programm, die sich<br />
dem Leben an der Grenze und dem sorbischen<br />
Film widmen. Außerdem sind an<br />
den vier Festivaltagen Filmklassiker wie<br />
„My Fair Lady“ (1964) oder „Spartacus“<br />
(1960) im 23mm- bzw. 70mm-Format, der<br />
deutsch-tschechisch-slowakische Kinderfilm<br />
„Sommer-Rebellen“ (2020) sowie Programmkino-Highlights<br />
aus Deutschland,<br />
Polen und Tschechien zu sehen. Und eine<br />
Retrospektive zeigt zwei Filme der Ehrenpreisträgerin<br />
des diesjährigen Neiße Filmfestivals,<br />
der tschechischen Dokumentarfilm-Regisseurin<br />
und Drehbuchautorin<br />
Helena Třeštíková.<br />
Die feierliche Preisverleihung findet am<br />
18. <strong>September</strong> im Filmtheater Ebersbach<br />
statt. Mit den Neiße-Fischen prämiert<br />
werden hier neben den besten Spiel-,<br />
Dokumentar- und Kurzfilmen auch die<br />
beste darstellerische Leistung, das beste<br />
Drehbuch und das beste Szenenbild. Außerdem<br />
vergibt der Filmverband Sachsen<br />
einen Spezialpreis an einen Film aus dem<br />
Ausblick | Anzeige<br />
29
18. Neiße Filmfestival in Dreiländerregion an der Neißefilmfestival<br />
gesamten Festivalprogramm, welcher<br />
sich dem Verständnis der Nachbarschaft<br />
von Deutschland, Polen und Tschechien<br />
widmet.<br />
Das komplette Programm und aktuelle<br />
News zum Neiße Filmfestival gibt es online<br />
unter www.neissefilmfestival.net.<br />
Gelebtes Europa in der Dreiländerregion<br />
an der Neiße<br />
Seit 2004 präsentiert das Neiße Filmfestival<br />
jährlich im Mai in der Dreiländerregion<br />
zwischen Deutschland, Polen und Tschechien<br />
aktuelle Spiel-, Dokumentar- und<br />
Kurzfilme. Was mit der Idee begann, Filme<br />
in drei Ländern zu zeigen, hat sich zu einer<br />
kulturellen Brücke für Filmfans und Programmkinos<br />
aus den drei Nachbarländern<br />
entwickelt und ist inzwischen wichtiger<br />
Treffpunkt für nationale und internationale<br />
Filmschaffende und Vertreter*innen der<br />
Filmwirtschaft. Das länderübergreifende<br />
Programm bietet neben drei Wettbewerben<br />
und verschiedenen Filmreihen, die<br />
den Blick auf Bezüge und Beziehungen<br />
zwischen den Völkern Osteuropas und auf<br />
die jeweilige filmische Auseinandersetzung<br />
mit Vergangenheit und Gegenwart<br />
eröffnen, auch Veranstaltungen wie Konzerte,<br />
Lesungen, Ausstellungen und Partys.<br />
Fotografen: Hannes Rönsch, Claudia Glatz,<br />
Pawel Dusza, Karin Lason, Ruth Lorenz.<br />
30<br />
Ausblick | Anzeige
Freistaat Sachsen förderte Räuberhauptmann Karasek<br />
Katasek<br />
Illustration aus dem Karasek-Roman<br />
Johannes Karasek, genannt Prager<br />
Hansel oder Räuberhauptmann<br />
Karasek, war um das Jahr<br />
1800 herum der Schrecken der<br />
Oberlausitz.<br />
Geboren im Jahr 1764 in Smichov<br />
bei Prag, erlernte er zunächst das<br />
Tischlerhandwerk, später wurde<br />
er noch Fleischhauer. Als junger<br />
Geselle ging er auf die damals übliche<br />
Wanderschaft. Danach wurde<br />
er zum österreichischen Militär<br />
eingezogen, jedoch desertierte<br />
er immer wieder von dort. Ein Kamerad<br />
brachte ihn dann schließlich<br />
in die damalige böhmische<br />
Enklave Niederleutersdorf in der<br />
Oberlausitz. Hier geriet er bald in<br />
die Fänge des Räuberhauptmanns<br />
Palme. Karasek arbeitete dann als<br />
Hausierer, wobei er redegewandt<br />
die bei zahlreichen Einbrüchen<br />
erbeuteten Sachen verkaufte. Er<br />
war also ein Hehler, brauchte aber<br />
im sächsisch-böhmischen Grenzgebiet<br />
die Polizei nicht ernsthaft<br />
befürchten. Bei einem Einbruch<br />
anzeige<br />
32<br />
Geschichte
Seltenes historisches Buch aus der<br />
Räuberhauptmann Christian-Weise-Bibliothek Zittau restauriert Katasek<br />
Johannes Karasek als Gefangener<br />
1797 kam Palme ums Leben. Karasek<br />
wurde danach zu seinem<br />
Nachfolger gewählt. Sein Prinzip<br />
war es, nie im eigenen Revier zu<br />
räubern. Einige Jahre ging das gut<br />
und man raubte vor allem Faktoren<br />
oder Mühlenbesitzer, also die<br />
Wohlhabenderen der damaligen<br />
Zeit, aus. Manchmal wurde von<br />
der Beute tatsächlich einem armen<br />
Weber oder Häusler etwas<br />
abgegeben. Daraus entwickelte<br />
sich die Legende vom „edlen Räuber“,<br />
der den Reichen nahm und<br />
den Armen gab. Später wurde<br />
dann aber doch auch im eigenen<br />
Revier geräubert und nach einem<br />
Einbruch in Oberleutersdorf<br />
Anfang August 1800 wurde die<br />
Bande schließlich gestellt und<br />
überführt. Karasek wurde in Bautzen<br />
vor das Gericht gestellt und<br />
zum Tode verurteilt. Der sächsische<br />
Kurfürst begnadigte ihn aber<br />
zu lebenslanger Festungshaft in<br />
Dresden. Dort starb Karasek am<br />
14. <strong>September</strong> 1809.<br />
Geschichte<br />
33
Freistaat Sachsen förderte Räuberromane über Karasek<br />
Räuberhauptmann Katasek<br />
Karasek-Heft vor der Restaurierung<br />
Obwohl Johannes Karasek kein „edler Räuber“,<br />
sondern ein schlimmer Räuberhauptmann<br />
war, lebt die Legende weiter, bis in<br />
unsere heutige Zeit.<br />
Schon bald nach seinem Tod fanden Karaseks<br />
Leben und seine Taten Eingang in die<br />
Unterhaltungsliteratur der damalige Zeit. Es<br />
waren vor allem reißerisch gemachte und<br />
in Fortsetzungen erschienene Romane, in<br />
denen Karasek und andere „Helden“ der<br />
Vergangenheit zu handelnden Personen<br />
wurden. Diese Werke wurden in einzelnen<br />
Heften über einen längeren Zeitraum vertrieben.<br />
Das hatte den Vorteil, dass sich<br />
diese auch mancher ärmere Interessent leisten<br />
konnte. Ein komplettes Buch auf einen<br />
Schlag zu bezahlen, wäre für viele Kunden<br />
nicht möglich gewesen. Diese heute von der<br />
Literaturwissenschaft als Trivialliteratur bezeichneten<br />
Werke wurden damals von den<br />
einfachen Menschen regelrecht verschlungen.<br />
Trotz seinerzeit hoher Auflagenzahlen<br />
der Romane sind diese heute kaum noch<br />
vorhanden. Sie wurden regelrecht zerlesen<br />
und dann entsorgt. Bibliotheken haben diese<br />
Literatur kaum gesammelt, am ehesten<br />
findet man sie heute noch in Privatsammlungen.<br />
Einer dieser Räuberromane ist „Johannes<br />
Karaseck. Kriminal-Novelle, auf Grund von<br />
anzeige<br />
34<br />
Geschichte
Seltenes historisches Buch aus der<br />
Räuberhauptmann Christian-Weise-Bibliothek Zittau restauriert Katasek<br />
Karasek-Heft nach der Restaurierung<br />
aktenmäßiger und mündlicher Überlieferung<br />
bearbeitet von A. von Dornburg“.<br />
Über den Autoren Alfred von Dornburg ist<br />
nichts weiter bekannt, außer dass er noch<br />
einen anderen Unterhaltungsroman unter<br />
dem Titel „Martha, die Tochter des Verurteilten<br />
oder Opfer russischer Justiz. Sensationsroman“<br />
veröffentlicht hat. Dornburgs „Karasek“<br />
erschien in 35 Lieferungsheften, welche<br />
jeweils eine Abbildungstafel enthielten, mit<br />
einem Gesamtumfang von 558 Seiten.<br />
Gedruckt und verlegt wurde der „Karasek“<br />
von Dornburg im Jahr 1891 in der damals<br />
bekannten und erfolgreichen Firma von<br />
Hermann Oeser in Neusalza (heute Neusalza-Spremberg)<br />
in der Oberlausitz.<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
35
Freistaat Sachsen förderte Räuberromane über Karasek<br />
Räuberhauptmann Katasek<br />
Karaseks Bande<br />
Vor drei Jahren gelang es dem Wissenschaftlichen<br />
und Heimatgeschichtlichen<br />
Altbestand der Christian-Weise-Bibliothek<br />
Zittau ein Exemplar des „Karasek“ von<br />
Alfred von Dornburg auf dem Antiquariatsmarkt<br />
zu erwerben. Bis zu diesem<br />
anzeige<br />
36<br />
Geschichte
Seltenes historisches Buch aus der<br />
Räuberhauptmann Christian-Weise-Bibliothek Zittau restauriert Katasek<br />
Zeitpunkt war dieses Werk in keiner öffentlichen<br />
deutschen Bibliothek vorhanden!<br />
Das von uns erworbene Exemplar war in<br />
einem schlechten, zerlesenen Zustand. Es<br />
war aber klar, dass dieses Werk unbedingt<br />
erhalten werden muss. Für die Christian-<br />
Weise-Bibliothek Zittau und die gesamte<br />
Oberlausitz ist es von doppelter Bedeutung:<br />
es handelt von einer historische Person<br />
der Region und es wurde hier vor Ort<br />
gedruckt.<br />
Dank einer großzügigen Förderung durch<br />
den Freistaat Sachsen, vermittelt durch<br />
die Landesstelle für Bestandserhaltung an<br />
der Sächsischen Landesbibliothek - Staatsund<br />
Universitätsbibliothek Dresden, konnte<br />
dieses historische Buch kürzlich restauriert<br />
werden. Man kann also ruhig sagen,<br />
der Freistaat Sachsen förderte den Räuberhauptmann<br />
Karasek, wenn auch erst mehr<br />
als 200 Jahre nach dessen Tod.<br />
Bei der Restaurierung des Buches in der<br />
Buchrestaurierung Leipzig GmbH wurden<br />
die zerlesenen und vom Papierzerfall bedrohten<br />
Blätter zunächst gesäubert und<br />
dann angefasert, d. h. mit flüssigem Papierbrei<br />
wurden Fehlstellen ergänzt und<br />
das Papier stabilisiert. Danach sind die<br />
Blätter mit einem hauchdünnen Japanpapier<br />
zusätzlich verstärkt worden. Die somit<br />
gesicherten Blätter wurden am Schluss<br />
wieder zu den ursprünglichen 35 Heften<br />
zusammengeheftet und in eine speziell<br />
angefertigte Kartonmappe eingelegt.<br />
Somit ist der seltene und wertvolle Karasek-Roman<br />
für die Zukunft erhalten und<br />
nutzbar gemacht worden. Die originalen<br />
Hefte stehen künftiger Forschung und für<br />
Ausstellungen zur Verfügung. Für das interessierte<br />
Lesepublikum wurde der Roman<br />
bei der Restaurierung gleichzeitig digitalisiert,<br />
der Text wird demnächst auf „Sachsen.digital“<br />
verfügbar sein.<br />
Allen Beteiligten an der Restaurierung dieses<br />
wertvollen und seltenen Bibliotheksschatzes<br />
gilt unser herzlicher Dank!<br />
Uwe Kahl<br />
Christian-Weise-Bibliothek Zittau<br />
Wissenschaftlicher und Heimatgeschichtlicher<br />
Altbestand<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
37
1989 - Eine Reise mit Hindernissen – von der alten in die neue Welt<br />
Erinnerungen<br />
VieIe Jahre sind vergangen, vieles, sehr vieles<br />
hat sich verändert, doch wenn man sich<br />
heute an die Probleme von damals erinnert,<br />
kommt es einen fast unwirklich vor! Die fast<br />
unmöglichen Reisebestimmungen nach<br />
Amerika erfolgreich zu erfüllen, heute unglaublich,<br />
damaIs aber alltäglich.<br />
Aber nun zum Anfang unserer fast unglaublichen<br />
Geschichte. Nach dem Tod unserer<br />
Mutter gab es viel schriftlichen Nachlass zu<br />
sichten, dabei fand mein Bruder Christian<br />
eine Adresse aus Amerika, genau aus Nord-<br />
Amerika. Nun konnte ich mich noch gut an<br />
ein Paket aus Amerika erinnern, welches den<br />
guten Maxwell Kaffee enthielt. 40 Jahre kein<br />
Zeichen, und nun überlegten wir, warum<br />
war so lange Sendepause? Der Tod konnte<br />
eine Ursache sein, aber viele andere Faktoren<br />
wären auch möglich. Also überprüfen, ob<br />
unsere Verwandtschaft nach so vielen Jahren<br />
noch in Dakota ansässig ist. Mein Bruder<br />
schrieb, und wir warteten geduldig. Nach einem<br />
Vierteljahr kam Post aus Old-Amerika. Es<br />
waren die Kinder unserer Verwandten, und<br />
alle waren über die Post überrascht. Jetzt<br />
kam das Tollste für uns: Wir wurden zum 70.<br />
Geburtstag und zur Silberhochzeit eingeladen!<br />
Die Freude war groß, doch wer durfte<br />
damals als DDR-Bürger nach Amerika reisen ?<br />
Unser Wille war geweckt, wir wollten es versuchen.<br />
Also auf zur Polizei, die Problematik<br />
der Reise - Unterlagen checken. Sie wollen<br />
wohin? Nach Nordamerika und Minnesota!<br />
Ja, mit diesem Brief geht das natürlich nicht!<br />
Ihre Verwandtschaft muß erst mal nachweisen,<br />
ob sie mit ihnen verwandt ist! Sollte das<br />
sein, müsste ihre Tante ihre amtliche Hochzeitsurkunde<br />
schicken zur Überprüfung. Die<br />
wiederum würde von Frau Lemper (staatlich<br />
anerkannte Übersetzerin der DDR) überprüft<br />
werden. Nun, wir wollten mittlerweile alles<br />
versuchen nach Amerika zu reisen. Nachdem<br />
wir unseren Verwandten die Hürden erklärt<br />
hatten, kamen nach geraumer Zeit die geforderten<br />
Unterlagen. Wir mit stolz geschwellter<br />
Brust wieder zur Reise-Unterlagenstelle. Ja,<br />
das sieht aus, als wären die Urkunden echt!<br />
Aber nun muss die Übersetzerin Frau Lemper<br />
erst mal die Richtigkeit bestätigen. Wie können<br />
Sie eigentlich beweisen, mit ihrer angeblichen<br />
Verwandtschaft in Amerika verwandt<br />
zu sein? Das war der Punkt, wo eigentlich<br />
hätte alles zu Ende sein können, doch wer<br />
einen ADLER gebaut hat, gibt nicht so leicht<br />
anzeige<br />
38<br />
Erinnerungen
Oder wie wir 1989 von Görlitz nach North Dakota gereist sind!<br />
Erinnerungen<br />
auf. (Adler war die nach Plänen und unter<br />
Anleitung von Herrn Eulitz gebaute Pioniereisenbahn<br />
in Görlitz)<br />
Wie kämpfen wir weiter? Da sagte mein Bruder,<br />
wir haben noch den Stammbaum unserer<br />
Familie, dort erkennt man, wer wohin<br />
ging, wer gefallen war in Stalingrad, und wer<br />
nach Amerika ausgereist war, geheiratet hat<br />
und dadurch auch seinen Namen verändert<br />
hat. Mit diesen neuen Hoffnungen und unserem<br />
alten Stammbaum zogen wir wieder<br />
zur Reisekontrolle der Polizei. Man muss jetzt<br />
einflechten, die Zeit verging wie im Fluge,<br />
und im August sollten wir in Amerika sein.<br />
Es war schon Anfang Juli und niemand sagte<br />
uns etwas Konkretes. Kommen Sie in 14 Tagen<br />
wieder vorbei!<br />
Wenn man so eine Reise plant, gehört doch<br />
allerhand dazu. Geschenke für alle, Kleidung<br />
und damals das größte Problem – die Finanzen.<br />
Sollten wir die Genehmigung zur Reise<br />
bekommen, brauchten wir unbedingt Finanzmittel!<br />
Dollar für Amerika, D-Mark zum<br />
Tauschen, aber als Reisefinanzen gab es von<br />
der DDR nur 5 Dollar. Sollten wir nun die Reisegenehmigung<br />
bekommen, musste Geld<br />
her. Also wurden viele gefragt, kannst du mir<br />
etwas Geld tauschen? Es war schwierig, doch<br />
letztlich kamen ein paar D-Mark zusammen.<br />
Nun gab es nur einen Weg, offiziell das Geld<br />
zu deponieren: ein Konto auf der Staatsbank<br />
eröffnen. Von da konnte man täglich 40 D-<br />
Mark für Reisen ins nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet<br />
abheben und ausführen. So<br />
haben wir es gemacht!<br />
In der Zwischenzeit mussten wir aber noch<br />
ein anderes Problem lösen. Wenn die Reise<br />
genehmigt würde, wie würden wir reisen<br />
können? Fürs Fliegen langte unser Geld<br />
nicht, denn schon damals wollten alle Fluggesellschaften<br />
harte Währung sehen. Frau<br />
Schmidt, der gute Engel vom Reisebüro an<br />
der Frauenkirche, hörte sich unser Dilemma<br />
an und versprach, wenn möglich zu helfen.<br />
Nach geraumer Zeit rief sie mich an und sagte<br />
mir, vielleicht gibt es eine Variante. Jetzt<br />
,liebe Leser` begann ein tolles Unternehmen!<br />
Aus Rumänien kam ein Flugzeug nach Berlin,<br />
von dort flog es nach Wien, 2 Passagiere stiegen<br />
aus, und wir konnten zusteigen. Von dort<br />
ging es nach Irland, landen, tanken und ab<br />
nach New York! Die ldee war toll, und es war<br />
die einzige Möglichkeit überhaupt zu fliegen,<br />
denn die Rumänen akzeptierten noch Ost-<br />
anzeige<br />
Erinnerungen<br />
39
1989 - Eine Reise mit Hindernissen – von der alten in die neue Welt<br />
Erinnerungen<br />
geld. Dazu muss aber gesagt werden, die Reisepässe<br />
mussten in Berlin von der österreichischen<br />
Botschaft und der amerikanischen<br />
Botschaft begutachtet und für die Einreise<br />
gestempelt werden. Auch das schafften wir,<br />
und wieder gings zur Polizei, Reiseunterlagen<br />
nachfragen. Nun war es schon Juli, noch 14<br />
Tage bis zur eventuellen Abreise. Uns wurde<br />
gesagt, Sie kriegen Bescheid, in einer Woche.<br />
Damals waren wir ja viel jünger, und man verkraftet<br />
manches leichter. Die Woche ging zur<br />
Neige, wir glaubten nicht mehr so recht, dass<br />
es noch klappen könnte, da wurde die Reise<br />
genehmigt.<br />
Frau Schmidt regelte die Fahrkartenbestellung,<br />
die Flugtickets und unser Unternehmen,<br />
Amerika wir kommen, konnte starten.<br />
Sicherlich, können Sie sich denken, ganz so<br />
einfach war es natürlich nicht! Erst mal ganz<br />
früh mit dem Zug nach Dresden, von hier mit<br />
dem lnterzonenzug nach Prag, von dort einfach<br />
nach Wien, und schon waren wir dem<br />
Abflug ein ganzes Stück näher. Leider war<br />
es aber damals äußerst schwierig zu reisen,<br />
denn wir waren kaum hinter Bad Schandau,<br />
kamen unsere Grenzpolizisten, stellten sich<br />
mit 3 Mann vor die Abteiltür: „Die Ausweise,<br />
Koffer bereithalten, Reiseziele!“ Nun ja, wir<br />
waren schon beide bei der Armee gewesen,<br />
uns konnte der raue herrische Ton kaum erschüttern,<br />
doch angebracht war er nicht. Als<br />
wir auch noch als Reiseziel Nord-Amerika<br />
angaben, waren die 3 grünen Herren doch<br />
etwas sehr verdutzt. Erst hatte man den Eindruck<br />
sie glaubten, wir wollen sie veräppeln,<br />
doch nach langer, genauester Überprüfung<br />
unserer Pässe fragte ein Grenzer: „Was haben<br />
Sie für Finanzmittel?“ Wir sagten wahrheitsgemäß<br />
: „Ost-Mark, West-Mark, Dollar“ (ja nur<br />
5, aber das haben wir nicht extra erwähnt).<br />
Haben Sie Devisen versteckt? Nein, wir haben<br />
für alle Finanzmittel Ausfuhrgenehmigungen.<br />
Da gaben sie Ruhe und alle im Abteil<br />
waren froh, dass sie weg waren.<br />
Ja, das war die Zeit, wo viele versuchten, über<br />
Ungarn sich nach den Westen abzusetzen,<br />
in einer sehr unruhigen aufgewühlten Zeit.<br />
Als wir von der CSSR über die Grenze nach<br />
Osterreich fuhren, war es im Zug viel ruhiger<br />
und man kam mit den Leuten ins Gespräch.<br />
Wo kommt ihr her? Wo wollt ihr hin, nein bis<br />
nach Nord-Amerika, und schon gab es eine<br />
Einladung einer jugoslawischen Lehrerin,<br />
die in Dresden war, in den Speisewagen. Sie<br />
anzeige<br />
40<br />
Erinnerungen
Oder wie wir 1989 von Görlitz nach North Dakota gereist sind!<br />
Erinnerungen<br />
Boeing der North-West Airlines in Bismarck, 1989<br />
lud uns zu einem guten Bier ein, es war alles<br />
so einfach! Wir werden auch niemals das österreichische<br />
Ehepaar vergessen, sie fragten<br />
uns, wie geht es halt abends in Wien weiter?<br />
Blauäugig sagten wir, nun wir tauschen etwas<br />
Geld um und fahren vom Franz-Joseph-<br />
Bahnhof zum Westbahnhof und dann mit<br />
dem Bus zum Flughafen Wien-Schwechat.<br />
Doch unsere lieben Reisebegleiter meinten,<br />
das gehe überhaupt nicht. Um diese Zeit<br />
sind alle Wechselstuben geschlossen, kein<br />
Schilling wird mehr getauscht. Wir möchten<br />
euch helfen, euer Weg ist noch weit, nehmt<br />
bitte von uns das Straßenbahngeld. Es war<br />
uns doch sehr peinlich, aber angesichts unserer<br />
Lage bedankten wir uns und fuhren<br />
quer durch Wien zum Westbahnhof. Hier<br />
gab es für uns eine neue Überraschung.<br />
Abends werden in Wien die Bahnhöfe geräumt<br />
und die Stahlgitter heruntergelassen.<br />
Also die Nacht überbrücken ging nicht und<br />
Übernachten im Hotel für 150 D-Mark ging<br />
auch nicht, also Taxi zum Flughafen! Geplant<br />
war eigentlich mit dem Bus zum Flughafen,<br />
doch leider war natürlich der letzte Bus auch<br />
schon weg. Der Taxi-Fahrer war unser Mann,<br />
er brachte uns nach Wien-Schwechat, sprach<br />
noch mit der Nachtsicherheitstruppe, und so<br />
konnten wir in Wärme mit 2 ltalienerinnen<br />
auf den Bänken die Nacht verbringen, sie waren<br />
ebenfalls, wie wir gestrandet. Die Nacht<br />
verging, der Tag brach an, wir rasierten uns,<br />
machten uns frisch, man weiß ja nie wie es<br />
wann weitergeht, und harrten mit Blick auf<br />
den rumänischen Schalter der Dinge die da<br />
kommen sollten. Ab 9 sollte es vorangehen,<br />
aber es wurde 10.00 – 11.00 Uhr, 12.00 Uhr<br />
und um halb 1 Uhr kam Betrieb ins rumänische<br />
Team, alle rannten, wir mit, Koffer abgeben,<br />
Ticketkontrolle und schnell raus, und da<br />
kam sie schon, die alte IL 64. Auch vom Aussehen<br />
schon nicht mehr die Jüngste, aber<br />
halt unser Flugzeug. 2 Mann stiegen aus, wir<br />
rein in den Vogel und schon ging es ab nach<br />
Shannon in Irland. Als wir zur Landung tiefer<br />
gingen, sah man noch keinen Flugplatz,<br />
nur winzig kleine Inseln. Na hoffentlich trifft<br />
der Pilot die Landebahn, waren so meine<br />
Gedanken. Doch alles war o.k. wir verließen<br />
das Flugzeug und gingen in Europas größten<br />
Free Shop. Das Flugzeug wurde zwischenzeitlich<br />
aufgetankt, nach einer Stunde ging<br />
es weiter.<br />
Wer noch nie über den Atlantik geflogen<br />
ist, schaut schon mal aus dem Fenster und<br />
staunt über das viele Wasser weit unterhalb.<br />
Nach geraumer Zeit sieht man Grönland unter<br />
sich, das war für mich ein Grund auf die<br />
Triebwerke zu lauschen, laufen sie noch ruhig<br />
und rund? Ja, es war alles gut, wir konnten<br />
Richtung West nach Boston weiterfliegen.<br />
Gegen Nachmittag waren wir in Küstennähe<br />
des amerikanischen Kontinents, ein großer<br />
Schritt bei unserem Unternehmen Amerika.<br />
Gegen Spätnachmittag, nachdem wir parallel<br />
der amerikanischen Küste in südlicher<br />
Erinnerungen<br />
41
1989 - Eine Reise mit Hindernissen – von der alten in die neue Welt<br />
Erinnerungen<br />
Richtung geflogen waren, erreichten wir<br />
New York. Ein riesiges Flugvorfeld empfing<br />
uns, und hier warteten wir fast 2 Stunden. Ja,<br />
Sicherheit wird hier groß geschrieben.<br />
Ich vergaß in meiner Flugeuphorie zu erzählen,<br />
die anderen Fluggäste waren fast alles<br />
ältere, mit tiefen Falten gezeichnete Männer.<br />
Fast alle mit großen Schnurrbärten und einem<br />
starken Knoblauch-Geruch. Das Essen<br />
war auch wenig für unsere Mägen bestimmt,<br />
so dass wir eigentlich fast nichts gegessen<br />
hatten. Doch jetzt kam Bewegung auf dem<br />
Vorfeld auf. Ein Bus näherte sich, und auf gleicher<br />
Höhe mit dem Flugzeug stieg der Bus zu<br />
uns auf. Er hatte 2 Höcker auf dem Dach, wie<br />
wir später merkten, die verkleideten Hydraulikstempel.<br />
Nun hob sich der ganze Bus nach<br />
oben, und wir konnten durch die Fronttür in<br />
den Bus gehen. Ein tolles Verfahren, um alle<br />
aus Europa kommenden Flugzeuge mit verschiedenen<br />
Einstiegshöhen abfertigen zu<br />
können. Am Einreiseterminal wurden wir von<br />
wunderschönen eleganten dunkelhäutigen<br />
Mitarbeiterinnen in Empfang genommen,<br />
und auf die Frage woher und wohin, gab es<br />
ein riesiges Gelächter. Die Germanboys wollen<br />
nach North Dakota. Wir lachten mit und<br />
die Einreise ging Ruckzuck von statten, entgegen<br />
den Voraussagen über ewiges Filzen<br />
oder dergleichen. Mittlerweile war es nach<br />
19.00 Uhr. Eigentlich hätten wir noch etwas<br />
Geld fassen sollen, doch auch hier gibt es einen<br />
Schalterschluss.<br />
Wir also raus aus dem Bereich in Richtung<br />
gelbe Taxen. Hier klappte es einfach großartig.<br />
Ein richtiger Bud-Spencer-Typ öffnete<br />
uns seinen Wagen und ab gings Richtung<br />
lnlandflughafen. (La Guardia, der gleiche<br />
Flughafen übrigens, bei dem die spätere Sensationslandung<br />
einer A 320 von Aerbus auf<br />
dem Hudson River gelang). Unser Taxifahrer<br />
war als Soldat in Dresden, kannte also auch<br />
unsere Heimat. Mit einer farbigen Postkarte<br />
unserer Görlitzer Oldi-Bahn konnten wir ihm<br />
eine große Freude für seinen kleinen Enkel<br />
machen. Da in Amerika die Flugzeuge in so<br />
kurzen Abständen wie bei uns die Busse fahren,<br />
sind wir mit der nächsten 337 Maschine<br />
von Boeing nach Minneapolis geflogen. Dort<br />
war es allerdings schon 23.00 Uhr. Mit einem<br />
Limousinenservice des Hotels Holiday Inn<br />
gings nun ab ins Hotel. Doch etwas müde,<br />
aber frohen Mutes, haben wir diesen Tag als<br />
einmalig in unserem Leben verbucht, viel<br />
gesehen, viel erlebt. Der Morgen war wieder<br />
voller Überraschungen. Frühstück am Pool<br />
mit 10 japanischen Models und danach zusammen<br />
im Limousinenservice mit ihnen zu<br />
einem Heli Aerport, von wo sie abflogen. Wir<br />
sind weiter zum Flughafen gefahren, und mit<br />
einer Maschine der North-West Airlines mit<br />
Start in Richtung Bismarck geflogen. Nie hätte<br />
ich es für möglich gehalten, über Stunden<br />
entlang einer Straße mit einer Linienmaschine<br />
zu fliegen, doch bei den Weiten in Amerika<br />
ist es möglich. Man muss unbedingt noch etwas<br />
über die Verpflegung sagen. Nach unserem<br />
Gastspiel mit der lL 64 der rumänischen<br />
TARO muß man die North-West AIRLINES als<br />
absolute Spitze bezeichnen. Alles nur vom<br />
Besten, wir können heute noch schwärmen.<br />
Wir waren angekommen!! Es war eine ruhige<br />
gute Landung in Bismarck-Minnesota. Viele<br />
Stunden und viele tausend Kilometer von<br />
der Heimat entfernt, sollten wir nun unsere<br />
Verwandten treffen. Aber es war wie oft im<br />
Film gesehen, eine tolle Überraschung. Eine<br />
hübsche Frau mit süßer Tochter und ein großes<br />
Schild „Wir grüßen Hans + Christian in<br />
Bismarck!“<br />
Ein toller Empfang, nach der herzlichen Begrüßung<br />
ging es zu einem Bus, der außen<br />
42<br />
Erinnerungen
1989 - Eine Reise mit Hindernissen – von der alten in die neue Welt<br />
Erinnerungen<br />
ein Segelboot im Sonnenuntergang als tollen<br />
Druck drauf hatte. Nach einer kleinen<br />
Rundfahrt durch Bismarck ging es heim<br />
zu unseren Verwandten. Die Holzhäuser in<br />
Amerika kennt man ja vom Film, und genau<br />
in einem solchen sollte unser Zuhause für<br />
die nächsten Wochen sein. Man kann sich<br />
schnell daran gewöhnen, breite Straßen, viel<br />
Grün vorm Haus und jeder 2. einen Anhänger<br />
mit Boot oder ein Campingfahrzeug, na<br />
ja, Amerika! Hier ist halt alles ein bisschen<br />
größer und etwas mehr von allem. Zu Hause<br />
angekommen begrüßten wir Ehemann<br />
und Schwester, und dann wurde erzählt. Bei<br />
uns geht das ja reibungslos, nur in Amerika<br />
muss man Englisch können, und da haperte<br />
es bei uns mächtig. Mein Bruder hatte in der<br />
Abendschule Englisch gelernt, nun musste er<br />
es anwenden. Aber mit Händen und Füßen<br />
und etwas englisch ging es doch halbwegs.<br />
Die beiden Mädchen gingen in Bismarck zur<br />
Schule, und wir besuchten sie dort. Ein paar<br />
Tage später wurden wir in ein Technikum<br />
eingeladen. Hier konnten die Farmerkinder<br />
nach der Ernte verschiedene Fachrichtungen<br />
studieren, so wie es im elterlichen Betrieb gebraucht<br />
wurde. Mit Zertifikaten konnte man<br />
Nachbau Wohnhaus des Offiziers George Armstrong<br />
Custer des Unionsheeres in North-Dakota<br />
sich Fachwissen in vielen Richtungen aneignen.<br />
Sehr speziell, aber gut. ln den nächsten<br />
Tagen lernten wir Bismarck, die Hauptstadt<br />
von Minnesota, näher kennen. Wir wurden<br />
zu Freunden eingeladen, dort gab es echte<br />
deutschem Rinderrouladen mit Rotkraut,<br />
genau nach deutschen Kochbuch zubereitet,<br />
wir waren gerührt über den großen kulinarischen<br />
Aufwand jenseits des großen Teiches.<br />
Später lernten wir den Arbeitsplatz unserer<br />
Verwandten kennen: das Heritage Center<br />
anzeige<br />
44<br />
Erinnerungen
Oder wie wir 1989 von Görlitz nach North Dakota gereist sind!<br />
Erinnerungen<br />
(Geschichtscenter), ein monumentaler Bau<br />
mit Super Klimaanlagen in allen Räumen. Viele<br />
Fragen wurden beantwortet: Wo kommt<br />
ihr her? DDR? Stimmt es, dass dort eine Mauer<br />
steht? Und viele andere Fragen mussten<br />
wir beantworten. Alle waren freundlich, doch<br />
von der DDR oder Ostdeutschland wusste<br />
fast keiner etwas Genaues.<br />
Wir hatten Glück; denn zu dieser Zeit wurde<br />
gerade das schönste lndianermädchen gewählt,<br />
und wir waren eingeladen. Die Gewinnerin<br />
war sehr hübsch, und sie hatte 3 Jahre<br />
in Freiburg studiert, was uns später bei den<br />
Glückwünschen und der Unterhaltung zu<br />
Gute kam. Es war ein aufregender Tag voller<br />
neuer Eindrücke und Erlebnisse. Später waren<br />
wir Gäste beim großen Pau Wau (eine<br />
Singveranstaltung der besten lndianergruppen).<br />
Ein großes Essen schloss sich an. Hier<br />
gab es superzartes Büffelfleisch, ein unglaublicher<br />
Gaumenschmaus!<br />
Beim Familientreffen in Bismarck<br />
Indianerinnen beim Festumzug<br />
anzeige<br />
Erinnerungen<br />
45
1989 - Eine Reise mit Hindernissen – von der alten in die neue Welt<br />
Erinnerungen<br />
Unsere Freizeitgestaltung konnten wir durch<br />
die Zeitung bestimmen. Am Wochenende<br />
gibt es ein großes Rodeo vor der Stadt. Ja<br />
das, war genau das Richtige! Man muss es<br />
erlebt haben. Die ankommenden Autos wurden<br />
von den Cowboys auf Pferden zu den<br />
Parkplätzen eingewiesen. Nach Ende der Veranstaltung<br />
lotsten die Cowboys mit Leuchtstäben<br />
die Autos in Richtung Abreise. Für<br />
uns einmalig. Das Rodeo ein Spektakel der<br />
Sonderklasse, man muss es gesehen haben,<br />
um mitreden zu können. Doch wir hatten das<br />
Glück, noch mehr vom Land der unbegrenzten<br />
Möglichkeiten sehen zu dürfen.<br />
Der nächste Höhepunkt war ein Schlauchbootrennen<br />
auf dem Missisippi. Drei Meilen<br />
flussabwärts nur mit Muskelkraft, der<br />
Schnellste bekommt 3000 DoIlar. Die Ausschreibung<br />
war offen, jeder konnte mitmachen.<br />
Der Letzte war übrigens ein Australier,<br />
der mit einem Floß die Stecke bewältigte.<br />
Er hatte eine Palme auf dem Floß und einen<br />
Affen und ein kleines Lagerfeuer. Man kann<br />
nicht alle aufzählen, doch eine bayrische<br />
Blaskapelle mit einem Bratwurstgrill auf einem<br />
großen Floß war auch dabei. Ein großer<br />
Planwagen mit 4 aufgeblasenen Schläuchen<br />
rundherum als Räder und rechts und links an<br />
der Deichsel 2 aufgeblasene große Delphine.<br />
Sie haben nicht gewonnen, haben sich oft<br />
gedreht, aber alle haben gejubelt über den<br />
tollen Einfall. Die Gewinner waren zwei Rad-<br />
Beim Rodeo<br />
Schlauchbootrennen auf dem Mississippi<br />
Alter Raddampfer auf dem Mississippi<br />
46<br />
Erinnerungen
Oder wie wir 1989 von Görlitz nach North Dakota gereist sind!<br />
Erinnerungen<br />
Hans-Rüdiger Eulitz auf dem Gelände Can-Am<br />
Off-Road Motorrad<br />
Freizeitpark Valleyfair in Shakopee, Minnesota<br />
sportler, die ihr Tandem so umgebaut hatten,<br />
dass sie eine Schraube als Heckantrieb<br />
nutzen konnten. Rechts und links waren sie<br />
durch 2 aufgeblasene Schläuche abgesichert.<br />
Es war eine tolle Schau. Von TV-Sendem gesponsert!<br />
Hunderte Boote begleiteten dieses<br />
Riesenspektakel auf dem Fluss. Als die Boote<br />
den Fluss hinunter trieben, kam mir so in<br />
den Sinn, wie weit ich doch derzeit von der<br />
Heimat weg bin. Ein seltsames Gefühl der<br />
Ferne kam in mir auf. Die Beine baumeln im<br />
Mississipi und man denkt an zu Hause. Es war<br />
halt eine andere Welt! Die Schaufelraddampfer,<br />
mit ihren zwei hohen Schornsteinen wie<br />
bei Mark Twain in seinen Büchern, einmalig<br />
und für uns fast unwirklich nach diesem<br />
komplizierten Vorspiel unserer Reise. Eine<br />
besondere Freude machte uns das junge<br />
Paar. Wir fahren nach Minneapolis zum Valleyfair.<br />
Das war ein riesiger Freizeitpark, wo<br />
wir den ganzen Tag nur staunen konnten.<br />
Über Achterbahn (natürlich etwas größer als<br />
bei uns), aber wir fuhren mit. Über Wasserrutschen<br />
bis zum Westernschießen, alles wurde<br />
mitgemacht, und gegen Abend fuhren wir<br />
wieder zurück. 300 Meilen – ein Riesenstück<br />
auch auf dem großen Highway von Amerika.<br />
Wir hatten schon allerhand gesehen, doch es<br />
erwartete uns noch viel Einmaliges. Es ging<br />
auf nach North Dakota, zu den Eltern unserer<br />
Tante. Man muss sich das etwas anders<br />
vorstellen, als bei uns über die Autobahn<br />
zu fahren. Rechts ein riesenhafter Bison (wir<br />
waren im Land der Buffel angekommen), 3<br />
Meilen weiter kam ein komplettes Haus auf<br />
einem Tieflader angerollt, man kann nur sagen<br />
Amerika, das Land der unbegrenzten<br />
Möglichkeiten. Wir sind auf der Ranch unserer<br />
Verwandten angekommen. Viele haben<br />
schon Western-Filme gesehen. Wir erlebten<br />
es original. Der Onkel, ein von der Natur gebräunter<br />
Typ mit schneeweißen Haaren, und<br />
seine Frau, eine gütige reife Farmerin, die<br />
schon einige Stürme erlebt hatte. Dazu gehörte<br />
noch ein Sohn: ruhig, bestimmt und<br />
mit einer Ausstrahlung, dass man ihm sein eigenes<br />
Pferd hätte anvertrauen können. Seine<br />
Frau eine hübsche Krankenschwester, die ge-<br />
Erinnerungen<br />
47
1989 - Eine Reise mit Hindernissen – von der alten in die neue Welt<br />
Erinnerungen<br />
nau wusste, wo in der Not angepackt werden<br />
musste. Das waren unsere Verwandten, eine<br />
äußerst liebenswerte Farmerfamilie in North<br />
Dakota. Nach der Begrüßung und den Geschenken<br />
kam für uns etwas Einmaliges. Der<br />
Onkel zeigte uns seinen Waffenschrank. Eine<br />
gewaltige Gun (eine großkalibrige Waffe, für<br />
Bären, die aus Kanada im strengen Winter<br />
wechseln), zwei Winchester für die Wölfe,<br />
die schon eher mal im Winter vorbeischauen,<br />
wenn das Fressen knapp wird, und so ein<br />
richtiges Jagdgewehr für Enten, Hasen etc.<br />
Etwas Munition war auch vorhanden, man<br />
weiß ja nie, wie viel Wölfe kommen.<br />
Stolz zeigte er uns Bilder von einem Winter<br />
mit sehr viel Schnee. Er war auf dem Dach am<br />
Schornstein und sah die schwarzen Punkte<br />
näher kommen . Es waren Wölfe und alles bis<br />
fast zum Dach eingeschneit. Da musste man<br />
sich selbst helfen. Übrigens nur ein Bär hatte<br />
es bis an die Farm geschafft, das war aber<br />
schon bei seinem Vater, doch der Bär hat seinen<br />
weiten Weg auch bereut. Man muss auch<br />
wissen: Die Farm steht mindestens 10 Meilen<br />
von der nächsten Ansiedlung entfernt, also<br />
bist du Gottes Sohn, so hilf dir selbst!<br />
Für den Winter gibt es natürlich Schneemobile,<br />
für den Sommer große Dreiräder mit Tundrareifen,<br />
man muss ja überall durchkommen.<br />
Die Farm war meine Welt, eine große<br />
Werkstatt mit Drehbank, Schweißgerät u.s.w.<br />
Ja. auf so einer Farm muß man sich selbst in<br />
allen Lebenslagen kümmern können. Wir waren<br />
sehr beeindruckt von dem Lebenswillen<br />
der Rancher und ihrem immer währenden<br />
Kampf mit der Natur. Meine Leute bauen Sojabohnen<br />
und Potatoes (Kartoffeln) an. Doch<br />
nicht jedes Jahr ist ihnen das Wetter wohlgesonnen,<br />
und es gibt Durststrecken, die zu<br />
überleben sind. Unser Onkel meinte eines<br />
Tages, morgen fahren wir nach Hawley, und<br />
Altherren Country-Band<br />
dort macht ihr Entertainment für ältere Bürger!<br />
Nachdem wir erfahren hatten, was gemeint<br />
war, bereiteten wir uns nach Möglichkeit<br />
vor. Zu gut deutsch: Unser Onkel wusste,<br />
dass wir uns kulturell schon betätigt hatten,<br />
und meinte, das würde gut für die Leute in<br />
Hawley passen. lch suchte alle Zaubermöglichkeiten<br />
zusammen, mein Bruder versuchte<br />
Papier und Farben zu beschaffen und schon<br />
war unser Kulturprogramm zusammengestellt.<br />
Der Onkel erwähnte noch am Rande,<br />
die kleinen Klassen haben schulfrei, und das<br />
Regionalfernsehen ist auch dabei. Wir sind ja<br />
auch nicht gleich zu beeindrucken, doch das<br />
war doch auch für uns etwas unverhofft. Wir<br />
wollten unsere Leute nicht enttäuschen und<br />
gaben das Beste. Zwei Tage später stand im<br />
Hawley Kurier: Die Germanboys haben hervorragendes<br />
Entertainment für die Bürger<br />
von Hawley gezeigt. Ja ja, wer reist, der kann<br />
was erzählen!<br />
Diese Veranstaltung war von unseren Verwandten<br />
von langer Hand vorbereitet, denn<br />
aus ganz Amerika kamen alle, die zur Verwandschaft<br />
gehörten, oder bald neu dazu<br />
48<br />
Erinnerungen
Oder wie wir 1989 von Görlitz nach North Dakota gereist sind!<br />
Erinnerungen<br />
kommen sollten. Ein großes Familientreffen.<br />
Alles lief toll harmonisch ab, denn jeder hatte<br />
einen Aufkleber am Pulli mit Namen, so<br />
konnte keiner verwechselt werden. Einfach<br />
toll dieser Zusammenhalt!<br />
Hans-Rüdiger Eulitz beim Richten einer Kardanwelle<br />
Wir haben in Hawley auch eine Tante. Sie ist<br />
78, kann aber noch gut fort, deshalb kümmert<br />
sie sich um die „ALTEN“. Sie hat auch<br />
eine Ranch, ein Stück vor der Stadt. Genau<br />
gesagt mit ihrem Mann hat sie mitten in der<br />
Prärie Bäume gepflanzt, ein Haus gebaut<br />
und lebt nun dort. Ihr Mann ist verstorben,<br />
und als wir sie besuchten, kroch sie unter<br />
dem Traktor hervor und meinte, gut dass ihr<br />
kommt, die Hühnchen sind fertig. Wir waren<br />
verblüfft, mit welcher Energie die alte Dame<br />
ihr Leben meistert. Du bist ja ganz allein hier,<br />
unsere fast schüchterne Frage. „Ich habe viel<br />
zu tun, muss noch Brot backen für eine Hochzeit,<br />
habe mir extra eine Getreidemühle aus<br />
Deutschland kommen lassen, es soll die beste<br />
sein“. Wir haben viel erzählt, sie hat sehr,<br />
sehr gut gekocht, und wir waren begeistert<br />
von unserer Tante in der Prärie unweit von<br />
Hawley. Als wir wieder nach einer Runde<br />
durch Hawley am Treffpunkt für die Senioren<br />
vorbei kamen, kümmerte sich schon wieder<br />
unsere 78jährige Tante, um die alten Senioren.<br />
Eines darf ich nicht vergessen, unsere Tante<br />
fuhr weit mit uns in die Prärie hinaus, um uns<br />
große Steinkreise zu zeigen. Hier zogen die<br />
Indianer lang um hier ihre Tipis aufzubauen.<br />
Diese Rastplätze waren in gewissen Abständen<br />
über die Prärie verteilt. Selbst einen großen<br />
einzelnen Stein mitten in der Prärie gab<br />
es, und der war von einer Seite glattgescheuert,<br />
denn hier rieben sich die Bisons Jahr für<br />
Jahr, wenn sie durch die Prärie zogen. Für uns<br />
waren das beeindruckende Erlebnisse.<br />
(Fortsetzung folgt)<br />
Hans-Rüdiger Eulitz<br />
Blick auf den Fuhrpark der Farm in Hawley<br />
Erinnerungen<br />
49
Tagebau Berzdorf 1946 - 1955 (Teil II)<br />
Berzdorf<br />
Abraumbetrieb<br />
Ausgehend vom III. Parteitag der SED erfolgten<br />
1950 umfangreiche technologische<br />
Untersuchungen zur langfristigen<br />
Entwicklung des Berzdorfer Tagebaues.<br />
Für den Abraumbetrieb wurde eine Drehpunktverlegung<br />
von Süden nach Norden,<br />
ins Bereich des späteren Stellwerkes 7, als<br />
wichtigste Maßnahme herausgearbeitet.<br />
Diese Umstellung, verbunden mit einer<br />
generellen Veränderung der Schwenkrichtung,<br />
musste bis 1953/54 abgeschlossen<br />
sein. Gleichzeitig wurde mit dieser Maßnahme<br />
die notwendige Verlegung der<br />
Pließnitz sowie die Devastierung der Ortslage<br />
Berzdorf zeitlich maximal nach hinten<br />
verschoben. Damit wurde auch ein Spielraum<br />
für tiefgründige und durchdachte<br />
Untersuchungen geschaffen, zumal die<br />
Erkenntnis vorlag, dass nur mit sehr hohen<br />
Aufwendungen und komplizierten<br />
Folgeinvestitionen ein langfristiges Betreiben<br />
des Tagebaues möglich sein wird.<br />
Einbezogen in diese Untersuchungen<br />
wurden die zu erwartenden Kohlebedarfszahlen<br />
nach Inbetriebnahme der ersten<br />
Kraftwerksblöcke in Hagenwerder. Die<br />
Ab 1950 bestand im Abraumbetrieb folgende Grundtechnologie:<br />
- Vorschnitt (+ 203 m NN) 1 Dampfbagger (Bagger 4),1 Dampflöffelbagger auf Schienen, 1.5 cbm<br />
von O & K, 30 cbm/Std.<br />
- 1. Abraumschnitt (+ 202 m NN) Eimerkettenbagger E 250 LMG 80 cbm/Std (Bagger 1)<br />
- 2. Abraumschnitt (+ 192 m NN) Eimerkettenbagger E 300 LMG 100 cbm/Std (Bagger 5)<br />
Einspeisung der Eimerkettengeräte auf Schienen mit 1000 V Gleichstrom.<br />
Für Beräumung der Kohlesättel + 176 m NN:<br />
2 Dampflöffelbagger (mit Greiferausrüstung) von Menck und Hembrock 0,75 cbm und 25 cbm/Std (Bg. 2 und 3)<br />
anzeige<br />
50<br />
Geschichte
Braunkohlenwerk Berzdorf im Zeitrau 1950-1952<br />
Tagebau Berzdorf<br />
Abb. 1 Blick aus Nord Ost in den Tagebau um<br />
1950; Vordergrund Seilbahn, rechts Beladestation<br />
auf der AE + 171 m NN, Bild Mitte Schacht 1 zur<br />
Entwässerung, Bild oben 1. AS mit Bagger 1<br />
und 2. AS mit Bagger 5<br />
Abb. 2 Dampfbagger 3 mit Greifer um 1950<br />
und 2. AS mit Bagger 5<br />
Wiederaufnahme des in den 30er Jahren<br />
begonnenen Kraftwerksbaues war ebenfalls<br />
beschlossen worden.<br />
Obwohl der veraltete Maschinenpark die<br />
Berzdorfer Bergleute bei der Baggerung<br />
vor viele Probleme stellte, war die Abnahme<br />
der Massen auf den Kippen eine noch<br />
größere Herausforderung. Es gab nur Trocken-<br />
bzw. Pflugkippen im Bereich der<br />
Teich- und Langteichhalde sowie im Bruchgebiet<br />
des „Alt-Bergbau-Gebietes“, nahe<br />
der „Ziegelei“. Mit dem Einsatz des ersten<br />
Absetzers auf der Langteichhalde, ab Mitte<br />
1951, sollte der Engpass „Kippe“ überwunden<br />
bzw. entlastet werden. Hierfür wurde<br />
der Absetzer As 300, mit einer theoretischen<br />
Leistung von 300 cbm/h und einer<br />
Versturzhöhe von 16 m, aus dem BKW Al-<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
51
Tagebau Berzdorf 1946 - 1955 (Teil II)<br />
Berzdorf<br />
Abb. 3 Kippenbesatzung mit Anhängepflug<br />
für Dampflok<br />
Abb. 4 995 A 300 Im Einsatz bis ca. 1958<br />
fred Scholz (Tagebau Welzow) durch die<br />
Zentralwerkstatt Welzow am 13.08.1951<br />
umgesetzt. Die Abb. 5 zeigt den A 300 bei<br />
der Inbetriebnahme auf dem Tauchritzer<br />
Kippengelände. Rechts die alte Straße von<br />
Schönau nach Tauchritz. Durch den Einsatz<br />
des Absetzers in Hochschüttung ergaben<br />
sich für den durch die Verbindungsstraße<br />
Schönau-Tauchritz begrenzten Kippraum<br />
wesentliche Verbesserungen. Die Verkippung<br />
der Abraummassen erfolgte auch<br />
weiterhin auf Trockenkippen von Hand<br />
mit Anhängepflügen.<br />
Parallel zu den Entwässerungsarbeiten<br />
wurde deshalb eine Entlastung des<br />
Deckgebirges durch die Einrichtung des<br />
Vorschnittes „Ost“ eingeleitet. Zum Einsatz<br />
kam in diesem Schnitt auf der Höhe<br />
+ 203 m NN ab Mitte 1952 der Eimerkettenbagger<br />
377 E 450 Buckau – 150 m³/h,<br />
500 V Drehstrom, auf Schienen. Für den<br />
anzeige<br />
52<br />
Geschichte
Braunkohlenwerk Berzdorf im Zeitrau 1950-1952<br />
Tagebau Berzdorf<br />
Grubenbetrieb<br />
Die Abb. 6 zeigt den alten Kohlerücken<br />
und die Bohrgerüste. Im Bild vorn Mitte<br />
die Trafostation und Bild Mitte ein Dampfbagger<br />
beim Beräumen eines Kohlesattels.<br />
In der Grube erfolgte der Abbau der Kohle<br />
bis 1953 weiterhin im Handbetrieb mittels<br />
Schurrenabbau. Die Höhen der Schurren<br />
lagen durchschnittlich bei 10 – 20 m. Die<br />
Kohlemächtigkeit betrug 40 – 60 m.<br />
Abb. 5 Bagger 8 bereits 1949 auf dem Montageplatz<br />
DDR Nr. 377 E 450 /300 im Einsatz von<br />
1952 bis 1957. Abraumleistung 4.213 10³m³<br />
Hochschnitt-Bagger musste als Vorarbeit<br />
ein Einsatzschlauch durch Hilfsgeräte hergestellt<br />
werden.<br />
Die generelle Drehpunktumstellung nach<br />
„Norden“ wurde bis 1953 abgeschlossen.<br />
Die Gleise des Vorschnittes – West sowie<br />
des 1. und 2. Abraumschnittes waren ab<br />
diesem Zeitpunkt an die Verbindungsgleise<br />
Hochbunker – Ziegelei angeschlossen.<br />
Abb. 6 Blick in den Tagebau Jan./Feb. 1950<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
53
Tagebau Berzdorf 1946 - 1955 (Teil II)<br />
Berzdorf<br />
Auszug aus „Bergmännisches Handbuch<br />
Bd II, Der deutsche Braunkohlenbergbau“,<br />
1923, Verlag Klöppel, Eisleben:<br />
„…baut man in Schlitzschurren ab. Hierbei<br />
wird unten in der Kohle eine Art Kammer<br />
ausgehackt, welche gerade den Förderwagen<br />
aufnehmen kann. Von der Kammer aus<br />
wird in dem senkrechten Kohlestoße ein<br />
schmaler Schlitz hochgeführt, der dann<br />
gleichfalls von oben her erweitert wird. Damit<br />
die losgehackte Kohle nicht aus dem Schlitz<br />
herausspringt, wird dieser vorn durch einen<br />
Holzverschlag (Abb. 7) und unten durch einen<br />
Sammelkasten abgeschlossen, aus dem<br />
der Förderwagen gefüllt wird. Die Wände der<br />
Schurre müssen immer so steile Neigungen<br />
haben, daß die Kohle von selbst rutscht…“<br />
Die Erweiterung der Betriebsfläche im<br />
Grubenbetrieb durch den Abbaufortschritt<br />
ermöglichte das Einrichten einer<br />
neuen Abbausohle auf + 150 m NN. Im<br />
Betriebsplan für 1951 wurden die Abbausohlen<br />
+ 170 ü NN mit der Abbauhöhe am<br />
Kohlesattel von 22 m, + 161 ü NN und 150<br />
ü NN und damit eine Gesamtabbauhöhe<br />
von 30 m beantragt. Die schwere Arbeit<br />
Abb. 7 Schurrenabbau, rechts Phase 1 und links<br />
Holzverschlag<br />
der Schlepper erfuhr mit dem Einsatz der<br />
ersten Dieselloks, im Grubenbetrieb ab<br />
1951, eine wesentliche Erleichterung. Die<br />
Kohle wurde weiterhin mit ¾ cbm Muldenkipper<br />
in den auf der + 170 ü NN stehenden<br />
Beladebunker verstürzt und von<br />
dort in Seilbahnwagen abgezogen. Nach<br />
der Inbetriebnahme der Seilbahn wurde<br />
die Schiefebene weiterhin zur Förderung<br />
der Zwischenmittel benutzt und diente als<br />
anzeige<br />
54<br />
Geschichte
Braunkohlenwerk Berzdorf im Zeitrau 1950-1952<br />
Tagebau Berzdorf<br />
Reserve für die Kohleförderung. Die generelle<br />
Drehpunktumstellung nach „Norden“<br />
wurde bis 1953 abgeschlossen.<br />
Im gleichen Jahr erschwerte die zweite<br />
größere Rutschung, in Richtung Pließnitz,<br />
die Kohleförderung erheblich. Am<br />
08.08.1951 setzten sich Abraummassen<br />
von der + 191 ü NN in Bewegung und<br />
überschütteten die Gleisanlagen auf der +<br />
171 ü NN. In Folge waren 5 Tage Produktionsausfall<br />
zu verzeichnen und der Ausfall<br />
der Förderung von ca.750 t Kohle.<br />
Kraft und Maschinenbetrieb, Werkbahn,<br />
Investitionen<br />
Auszug aus dem Betriebsplan 1951 zum<br />
Kraft- und Maschinenbetrieb (später<br />
Hauptabteilung Instandhaltung):<br />
„Die Stromversorgung des Betriebes erfolgte<br />
durch die Gleichrichterstation am Nordrand<br />
des Tagebauses. Der Strom 6 KV bezw.<br />
10 KV Drehstrom wird der Station über zwei<br />
getrennte Hochspannungsfreileitungen<br />
von 6 bzw. 10 KV zugeführt, wo der Strom<br />
entsprechend gleichgerichtet bzw. transformiert<br />
wird. Zur Verwendung kommt 1100<br />
Abb. 8<br />
Volt Gleichstrom für die Eimerkettenbagger<br />
im Abraumbetrieb, 6000 V bzw 220/380 V<br />
Drehstrom für die Pumpen und sonstige Maschinen.“<br />
In den Tagesanlagen ist in den Jahren bis<br />
1952 die Hauptwerkstatt entstanden mit<br />
Lok- und Wagenbauwerkstatt und einer<br />
Tischlerei.<br />
In der Ziegelei werden weiterhin Naßpreßsteine<br />
aus der Klarkohle mit einer Ziegelpresse<br />
hergestellt. Die Trockenanlage hat<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
55
Tagebau Berzdorf 1946 - 1955 (Teil II)<br />
Berzdorf<br />
Abb. 9 und 10 Dampflokführer (Kesselwärterprüfung erforderlich) waren sehr geachtete Kollegen.<br />
eine Kapazität von 70000 Stück Steinen,<br />
dazu ein Kesselhaus mit zwei Dampfkesseln<br />
mit 165 m² und 250 m² Heizfläche.<br />
Für die Abraumleistung war die Bereitstellung<br />
von einsatzfähigen Dampflokmotiven<br />
von entscheidender Bedeutung. In<br />
Berzdorf sind 39 Dampfloks im Leistungsund<br />
Hilfsfahrbetrieb im Einsatz gewesen.<br />
Sie kamen aus anderen Werken wie das<br />
Schreiben von 1952 (Abb. 8) zeigt. Die Typenvielfalt<br />
war enorm.<br />
Für die Leistungssteigerung des Fahrbetriebes<br />
wurden 1951/52 noch 2 weitere<br />
Wasserstationen für die Lokspeisung gebaut.<br />
(Abb. 11 und 12)<br />
In den Jahren 1951/52 wurden umfangreiche<br />
Neubauten errichtet und Umbauten<br />
realisiert u.a.:<br />
• Trinkwasserleitung für Berzdorf<br />
• Bau einer Lok Waschanlage<br />
• Errichtung von Waschkauen und<br />
Verwaltungsbaracke (Abb. 13)<br />
• Erweiterung der Werkstätten<br />
• Verlegung der Kleinen Gaule (400 m)<br />
• Bau einer Abraumbrücke über die<br />
Reichsbahnstrecke Görlitz - Zittau<br />
Die Ergebnisse der Produktion im Zeitraum 1950 – 1952<br />
Jahr 1950 1951 1952<br />
Abraum ( m³ ) 1 121 900 1 365 100 1 631 700<br />
Kohle ( t) 339 000 362 000 338 600<br />
von Hand ( t ) 337 000 340 938 306 938<br />
Bg. 5 / Bg. 2 ( t ) 2 000 12 533 / 2 703 22 533<br />
Naßpreßsteine ( t ) 18 400 18 500 18 000<br />
Belegschaft 1 051 1 055 1 066<br />
56<br />
Geschichte
Braunkohlenwerk Berzdorf im Zeitrau 1950-1952<br />
Tagebau Berzdorf<br />
• Bau einer Flutmulde und eines<br />
Hochwasserschutzdammes für die<br />
geplante Tagebauausfahrt<br />
• Neubau von weiteren 24 Wohnungen<br />
Leschwitzer Straße in Weinhübel mit sehr<br />
schöner Fassadengestaltung<br />
Abb. 11 und 12<br />
4.4. Gründung der Abteilung Entwässerung<br />
1950, Beginn der Untertage Entwässerung<br />
Abb. 13<br />
Da das Grundwasser den auslösenden<br />
Faktor spielte, wurde vorsorglich die Abteilung<br />
Entwässerung erweitert und eine<br />
eigenständige Betriebsabteilung gebildet.<br />
Bis 1947 werden die Wässer in von Hand<br />
angelegten Entwässerungsgräben gefasst,<br />
zu hergestellten Sümpfen geleitet und von<br />
dort zur Tagebaukante gepumpt. Deshalb<br />
Geschichte<br />
57
Tagebau Berzdorf 1946 - 1955 (Teil II)<br />
Berzdorf<br />
Abb. 14 Der erste Teil der Handskizze der Betriebssituation Anfang der 50 iger Jahre von Gottfried<br />
Adler für das Betriebsferienheim Großschönau entworfen.<br />
wurde 1948 mit dem Auffahren der ersten<br />
Entwässerungsstrecken in der Kohle vom<br />
offenen Tagebau aus (Mundloch) begonnen.<br />
Das Auffahren erfolgte ausschließlich<br />
von Hand mit Hacke und Schaufel auf der<br />
+ 161 m NN. Die anfallende Rohbraunkohle<br />
wird mittels handbetriebener Hunte abtransportiert.<br />
1949 erfolgte der Bau einer<br />
offenen Wasserstation an der Beladestelle<br />
der Seilbahn. Von dort wurden alle Grubenwässer<br />
zum Mühlgraben geleitet. Als<br />
Pumpkapazität standen 3 Kreiselpumpen<br />
mit einer Leistung von 10/11/12 cbm/min<br />
und 2 Kreiselpumpen mit einer Leistung<br />
von 6 cbm/min zu Verfügung. Außerdem<br />
waren 1949 auf + 171 m NN zwei Filterbrunnen<br />
bis auf das Liegende niedergebracht<br />
worden.<br />
1949 wurde das Teufen des ersten Schachtes<br />
im Südfeld von der im Sümpfungsgebiet<br />
liegenden Grubensohle + 150 m NN<br />
aus begonnen. Die Schachtteufe betrug 20<br />
m. Der Schacht wurde von Hand gehackt.<br />
Die anfallenden Massen wurden über eine<br />
an einem Holzbock befestigte Handwinde<br />
mit Kübel an die Oberfläche transportiert.<br />
Der Ausbau des Schachtes und das<br />
Schachtgerüst bestanden aus Holz. Vom<br />
anzeige<br />
58<br />
Geschichte
Braunkohlenwerk Berzdorf im Zeitrau 1950-1952<br />
Tagebau Berzdorf<br />
Schachtes zwei weitere Pumpenräume errichtet<br />
und mit Kreiselpumpen 1 x 11 cbm<br />
und 2 x 6 cbm bestückt. Die Strecken hatten<br />
und haben folgende Abmessungen:<br />
Sohlenbreite: 1,90 bis 2,00 m; Firsthöhe:<br />
2,00 bis 2,20 m; Firstbreite: 1,20 bis 1,50 m.<br />
Auf die Strecken wurden mittels Handbohrwinde,<br />
auch Schinder genannt, von<br />
der Geländeoberfläche Bohrungen niedergebracht<br />
und mit Filterrohren ausgebaut.<br />
(Fallfilter). Die ersten Fallfilter entstanden<br />
Abb. 15 Mannschaft, die den Schacht ab<br />
1949 abgeteuft hat (v. links Kollegen Müller,<br />
Hirschfelder, Kura Anton, Otto)<br />
Schacht aus sind die Entwässerungsstrecken<br />
1, 1 a bis 1 c, 2 a, 2 b sowie 3 a und 3 b<br />
sternenförmig aufgefahren worden.<br />
Im 1. Jahr wurden insgesamt 582 m Strecke<br />
aufgefahren. Gleichzeitig erfolgte das<br />
Auffahren von 2 Pumpenräumen auf der<br />
Sohle + 135 m NN. Die Ausrüstung erfolgte<br />
mit Kreiselpumpen von jeweils 1x 6/1 x<br />
10 cbm/min. Bis 1953 wurden nördlich des<br />
Abb. 16 Schacht 1, Schachtgerüst aus Holz<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
59
Tagebau Berzdorf 1946 - 1955 (Teil II)<br />
Berzdorf<br />
1951 mit Zementrohren. Untertägig sind<br />
Steckfilter eingebracht worden. Das sich in<br />
den Filtern sammelnde Grundwasser (auch<br />
hineingeleitetes Oberflächenwasser) wird<br />
in die Strecken abgeleitet. Das dort zusammengefasste<br />
„erschrotete Wasser“ läuft zu<br />
den Sümpfen der Pumpenräume, von wo<br />
es nach Übertage in die Pließnitz bzw. den<br />
Tauchritzer Mühlgraben gepumpt wurde.<br />
Die Entwässerungsarbeiten konnten sich<br />
aber nicht nur auf das in westliche Richtung<br />
verlaufende aktive Abbaufeld konzentrieren,<br />
da vor allem am Ostrand des<br />
Tagebaues, in Richtung Teich- und Langteichhalde,<br />
verstärkt Rissbildungen und<br />
großflächige Setzungen auftraten. Mit der<br />
Erweiterung des Streckennetzes in dieses<br />
Gebiet und zielgerichteten Entwässerungsmaßnahmen<br />
sollte einer möglichen Tagebaugefährdung<br />
vorgebeugt werden. Der<br />
geringe geologische und hydrologische Erkundungsstand,<br />
besonders für diesen Feldesteil,<br />
ließ keine eindeutigen Erkenntnisse<br />
zur Ursache der Setzungen zu. 1951 konnte<br />
das erste betriebseigene Bohrgerät zum<br />
Einsatz kommen. Im Zeitraum 1948 – 1952<br />
wurden ca. 26 Mio m³ Wasser gehoben.<br />
Abb. 17 Die erste Bohrbesatzung 1951<br />
Die Grubenwehr wurde 1950 gegründet<br />
Die Grubenwehr in Berzdorf wurde am<br />
16.01.1950 auf der Grundlage einer Anordnung<br />
der Deutschen Wirtschaftskommission<br />
über das Grubenrettungswesen vom<br />
06.04.1949 gegründet. Am Anfang hatte<br />
der Oberführer Emil Kieras, Fahrsteiger im<br />
Grubenbetrieb, 14 Wehrmänner zur Verfügung.<br />
Die erste Unterbringung war 1950 in<br />
einer Baracke an der Wache West. Im Janu-<br />
anzeige<br />
60<br />
Geschichte
Braunkohlenwerk Berzdorf im Zeitrau 1950-1952<br />
Tagebau Berzdorf<br />
ar 1952 wurde die erste Rettungsstelle in<br />
der neuen Waschkaue Ost bezogen, und<br />
der hauptamtliche Gerätewart Manfred<br />
Jenke trat seinen Dienst an. Ab 1954 wurde<br />
im Bereich der Tagesanlagen das neue<br />
Grubenwehrgebäude (Abb. 17) bezugsfertig.<br />
Dieser Stützpunkt war zur Auflösung<br />
der Grubenwehr einsatzbereit.<br />
In der Anzeige zum Betriebsplan 1953<br />
werden nachfolgende verantwortliche<br />
Wehrmänner angezeigt:<br />
Oberführer Erhard Schmidt, Ausbildung<br />
zum Oberführer im Mai 1952, eingesetzt<br />
ab 14.02.1953 – 1955<br />
Stellv. Oberführer Fritz Mannack,<br />
1950 – 1960<br />
Gerätewart Erich Lindner von Mai<br />
1950 – 1980<br />
Hauptamtlicher Gerätewart Manfred Jenke<br />
<strong>September</strong> 1950 – 1988<br />
Ab 1955 wird Helmut Weber als Oberführer<br />
bestellt. Dieses Amt wird er bis 1986<br />
gewissenhaft ausführen.<br />
Joachim Neumann und Klaus Krische<br />
Aus: Berzdorfer Hefte<br />
Die technologische Entwicklung<br />
Tagebau Berzdorf<br />
1946-1955.<br />
Impressum:<br />
Herausgeber (V.i.S.d.P.):<br />
<strong>StadtBILD</strong>-Verlag<br />
eine Unternehmung der<br />
incaming media GmbH<br />
vertreten durch den Geschäftsführer<br />
Andreas Ch. de Morales Roque<br />
Mitglied im Deutschen Fachjournalistenverband<br />
Carl-von-Ossietzky-Straße 45 | 02826 Görlitz<br />
Tel. 03581 87 87 87 | Fax: 03581 40 13 41<br />
E-Mail: info@stadtbild-verlag.de<br />
Shop: www.stadtbild-verlag.de<br />
Bankverbindung:<br />
IBAN: DE21 8504 0000 0302 1979 00<br />
BIC: COBADEFFXXX<br />
Geschäftszeiten:<br />
Mo. - Fr. von 9.00 bis 16.00 Uhr<br />
Druck:<br />
Graphische Werkstätten Zittau GmbH<br />
Erscheinungsweise: monatlich<br />
Redaktion & Inserate:<br />
Andreas Ch. de Morales Roque<br />
Kathrin Drochmann<br />
Dipl. - Ing. Eberhard Oertel<br />
Bertram Oertel<br />
Layout:<br />
Kathrin Drochmann<br />
Lektorat:<br />
Wolfgang Reuter, Berlin<br />
Teile der Auflage werden kostenlos verteilt, um<br />
eine größere Verbreitungsdichte zu gewährleisten.<br />
Für eingesandte Texte & Fotos übernimmt der Herausgeber<br />
keine Haftung. Artikel, die namentlich<br />
gekennzeichnet sind, spiegeln nicht die Auffassung<br />
des Herausgebers wider. Anzeigen und redaktionelle<br />
Texte können nur nach schriftlicher Genehmigung<br />
des Herausgebers verwendet werden.<br />
Redaktionsschluss:<br />
Für die nächste Ausgabe (Oktober)<br />
ist am 20.09.<strong>2021</strong><br />
Geschichte<br />
61
Umzüge steuerlich geltend machen<br />
ETL-Steuerberatung<br />
Umzugskostenpauschalen wurden angehoben<br />
Bezahlbarer Wohnraum in guter Lage ist heiß begehrt. Wurde dann die Traumwohnung gefunden, muss der Umzug geplant<br />
werden – auch finanziell. Denn nicht nur für Renovierung oder neue Einrichtungsgegenstände fallen Kosten an, sondern auch<br />
für den Umzug selbst. Dann ist es gut zu wissen, dass auch Umzugskosten steuerlich berücksichtigt werden können.<br />
Steuerbonus bei privaten Umzügen nutzen<br />
Wer aus privaten Gründen umzieht, kann die Kosten einer Spedition als haushaltsnahe Dienstleistungen in der Steuererklärung<br />
geltend machen. 20 % der Aufwendungen können direkt von der Einkommensteuer abgezogen werden, maximal 4.000<br />
Euro im Jahr. Und auch Kosten für die Renovierung und andere Handwerkerleistungen werden berücksichtigt, allerdings nur,<br />
soweit sie auf die Arbeitsleistungen des Handwerkers entfallen. Als haushaltsnahe Handwerkerleistungen können 20 % der<br />
Arbeitskosten, maximal 1.200 Euro, von der Einkommensteuer abgezogen werden.<br />
Tipp: Wer aus gesundheitlichen Gründen (ärztlicher Nachweis erforderlich) umziehen muss, kann Umzugskosten als außergewöhnliche<br />
Belastungen abziehen. Allerdings sind die Kosten nur abziehbar, soweit sie die zumutbare Eigenbelastung übersteigen.<br />
Diese hängt vom Familienstand, dem Einkommen und der Zahl der steuerlich berücksichtigungsfähigen Kinder ab. Auch<br />
wer aufgrund der Hochwasserkatastrophe im Juli <strong>2021</strong> seine Wohnung verloren hat und umziehen muss, kann Aufwendungen<br />
als außergewöhnliche Belastungen abziehen. Soweit sie hierbei nicht abziehbar sind, kommt eine Berücksichtigung als haushaltsnahe<br />
Dienst- oder Handwerkerleistung infrage.<br />
Umzugspauschalen bei beruflich veranlassten Umzügen abziehbar<br />
Wer aus überwiegend beruflichen Gründen umzieht, kann die dabei entstehenden Aufwendungen als Werbungskosten in der<br />
Einkommensteuererklärung geltend machen. Eine berufliche Veranlassung kann angenommen werden, wenn der Arbeitnehmer<br />
aufgrund einer Versetzung oder eines Arbeitsplatzwechsels an den Arbeitsort umzieht. Berufliche Gründe eines Umzugs<br />
können aber auch die erstmalige Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit sowie die Begründung oder Beendigung einer doppelten<br />
Haushaltführung des Arbeitnehmers sein. Daneben gelten auch eine Fahrtzeitverkürzung von mindestens einer Stunde<br />
täglich und ein Umzug auf Verlangen des Arbeitgebers als beruflich veranlasst.<br />
Abziehbar sind einerseits die tatsächlichen Kosten für das Umzugsunternehmen, eine Maklercourtage für die Vermittlung<br />
der Wohnung sowie Reisekosten zur neuen Wohnung bzw. im Vorfeld zur Suche und Besichtigung der Wohnung. Daneben<br />
können pauschale Beträge für Aufwendungen geltend gemacht werden, die im Zusammenhang mit dem Umzug anfallen.<br />
Im Jahr 2020 wurden die Umzugskostenpauschalen erheblich geändert. Seit dem 1. Juni 2020 richten sich die pauschalen<br />
Beträge nicht mehr nach dem Familienstand, sondern nach dem Begünstigten (dem Umziehenden).<br />
Mit Schreiben vom 21. Juli <strong>2021</strong> hat das Bundesfinanzministerium (BMF) nun die Pauschalen leicht angehoben und zwar rückwirkend<br />
ab dem 1. April <strong>2021</strong>. Die neuen Werte sind auf alle Umzüge anzuwenden, bei denen der Tag vor dem großen Einladen<br />
des Umzugsgutes nach dem 31. März <strong>2021</strong> liegt. Wer also am 1. April <strong>2021</strong> oder später seinen Umzugswagen beladen hat oder<br />
belädt, darf die höheren Pauschalen ansetzen. Ab dem 1. April 2022 gelten erneut höhere Pauschalen.<br />
Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen:<br />
Begünstigter 01.06.2020 bis 31.03.<strong>2021</strong> 01.04.<strong>2021</strong> bis 31.03.2022 ab 01.04.2022<br />
„Umziehender“ = 1. Person 860 € 870 € 886 €<br />
Jede weitere mitumziehende Person 573 € 580 € 590 €<br />
(Ehe-/Lebenspartner, Kinder)<br />
Wer erstmals eine eigene Wohnung bezieht oder seine eigene Wohnung mit dem Umzug auflöst, darf nur 174 Euro als Umzugspauschale<br />
ansetzen (172 Euro bis 31.03.<strong>2021</strong> und 177 Euro ab 1. April 2022). Auch für umzugsbedingte Unterrichtskosten<br />
dürfen Pauschalen angesetzt werden. Für jedes Kind werden bis zu 1.160 Euro berücksichtigt (1.146 Euro bis 31. März <strong>2021</strong><br />
und 1.181 Euro ab 1. April 2022).<br />
Hinweis: Alternativ zum Abzug der beruflich veranlassten Umzugskosten als Werbungskosten kann auch der Arbeitgeber die<br />
Aufwendungen ganz oder teilweise übernehmen oder erstatten. Dabei sind die Aufwendungen des Arbeitgebers steuerfrei,<br />
soweit sie die tatsächlichen Aufwendungen bzw. die Umzugskostenpauschalen nicht übersteigen.<br />
Autor: Ulf Hannemann, Freund & Partner GmbH (Stand: 01.08.<strong>2021</strong>)<br />
62<br />
Ratgeber | Anzeige