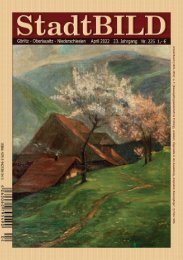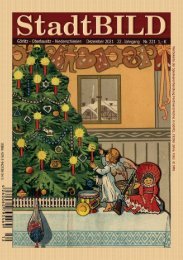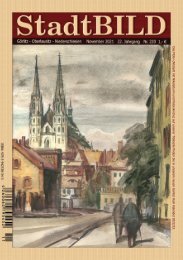222_StadtBILD_Januar_2022
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ratsarchiv Görlitz, Foto: © <strong>StadtBILD</strong>-Verlag (Archiv)
Liebe Leserinnen, liebe Leser,<br />
Vorwort<br />
Mit diesem Gedicht „Ein neues Buch, ein neues Jahr“, das<br />
aus der Feder des Autors bzw. Lyrikers Theodor Fontane<br />
stammt, möchten wir Ihnen ein gesundes, erfolgreiches<br />
Jahr <strong>2022</strong> wünschen!<br />
Ein neues Buch, ein neues Jahr<br />
Theodor Fontane (1819-1898)<br />
Und wieder hier draußen...<br />
Und wieder hier draußen ein neues Jahr –<br />
Was werden die Tage bringen?!<br />
Wird‘s werden, wie es immer war,<br />
Halb scheitern, halb gelingen?<br />
Wird‘s fördern das, worauf ich gebaut,<br />
Oder vollends es verderben?<br />
Gleichviel, was es im Kessel braut,<br />
Nur wünsch‘ ich nicht zu sterben.<br />
Ich möchte noch wieder im Vaterland<br />
Die Gläser klingen lassen<br />
Und wieder noch des Freundes Hand<br />
Im Einverständnis fassen.<br />
Ich möchte noch wirken und schaffen und tun<br />
Und atmen eine Weile,<br />
Denn um im Grabe auszuruhn,<br />
Hat‘s nimmer Not noch Eile.<br />
Ich möchte leben, bis all dies Glühn<br />
Rücklässt einen leuchtenden Funken<br />
Und nicht vergeht wie die Flamm‘ im Kamin,<br />
Die eben zu Asche gesunken.<br />
Wann immer das alte Jahr vergangen ist und ein neues<br />
beginnt, resümiert der Mensch über die Erfahrungen und<br />
Erlebnisse des vergangenen und baut Erwartungen und<br />
Hoffnungen gegenüber dem neuen Jahr auf. Fontanes<br />
Gedicht setzt sich mit eben diesen Fragen auseinander.<br />
Doch ist sein geführter Monolog weitreichender. Denn<br />
mit zunehmendem Alter wird nicht nur ein Fazit über<br />
ein vergangenes Jahres gezogen, sondern das gesamte<br />
Leben versucht zu überblicken. Die schönen ebenso wie<br />
die schlechten Zeiten. Und es stellt sich am Lebensabend<br />
des Weiteren die Frage, wie viel Zeit auf Erden noch verbleiben<br />
wird und wie diese Lebenszeit verlaufen wird.<br />
Wie auch schon 2020 stand 2021 ganz im Zeichen der<br />
globalen Coronapandemie. Zwar startete zum Jahreswechsel<br />
2020/2021 die Impfkampagne in Deutschland,<br />
jedoch sind die Inzidenzen über elf Monate später auf<br />
Rekordniveau, und Deutschland steckt mitten in der<br />
vierten Coronawelle. Noch immer kämpfen wir mit den<br />
menschlichen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie,<br />
Corona hat uns fest im Griff. Und doch haben die<br />
vergangenen Monate auch gezeigt, was wir alle gemeinsam<br />
leisten können, wenn wir ein Ziel vor Augen haben<br />
und alle Hand in Hand arbeiten. Wenn wir Rücksicht<br />
aufeinander nehmen und unsere eigenen Bedürfnisse<br />
zurückstellen, um die Schwächeren zu schützen.<br />
Lassen Sie uns deswegen das neue Jahr mit einem Dank<br />
beginnen: für den unermüdlichen Einsatz aller Kräfte im<br />
Gesundheitswesen, in den Kindergärten und Schulen, im<br />
Einzelhandel, im Handwerk und in der Industrie. Danke<br />
für das Durchhaltevermögen in der Gastronomie, der<br />
Veranstaltungsbranche und in den Kulturstätten. Der<br />
Dank gilt auch allen anderen, die unermüdlich im Einsatz<br />
sind; und lassen Sie uns auch den Kindern Danke sagen,<br />
die in den vergangenen Monaten unglaublich viele Zugeständnisse<br />
machen mussten.<br />
Unser ganz persönlicher Dank gilt Ihnen, liebe Leserinnen<br />
und liebe Leser, für Ihre Anregungen und Ihre Treue<br />
auch in Krisenzeiten.<br />
Lassen Sie uns die Strapazen der Vergangenheit für einen<br />
Moment vergessen, die Sorgen mit dem alten Jahr<br />
verabschieden und voller Hoffnung auf <strong>2022</strong> blicken.<br />
Bleiben Sie zuversichtlich!<br />
Ihr Team vom <strong>StadtBILD</strong>-Magazin<br />
anzeige<br />
Einleitung<br />
3
Aus Schlesien in die Welt.<br />
Charlotte E. Pauly<br />
Charlotte E. Pauly (1886–1981), Einfahrt Boguslawitz, Grafit, Feder in Tusche, Pinsel in Wasserfarben,<br />
1930er Jahre, Kulturhistorisches Museum Görlitz (Foto: K. Wenzel)<br />
„Charlotte E. Paulys sprödes und kraftvolles<br />
Werk muss man anschauen, keine noch so<br />
engagierte Lebensbeschreibung könnte<br />
seinen Reiz erklären.“ So schrieb der Berliner<br />
Grafiker Dieter Goltzsche über eine bedeutende<br />
Künstlerin des 20. Jahrhunderts,<br />
anzeige<br />
4<br />
Geschichte
Die Künstlerin Charlotte E. Pauly (1886–1981)<br />
Pauly<br />
Charlotte E. Pauly (1886–1981), Meer nach Sonnenuntergang, Pinsel in Wasserfarben, um 1930,<br />
Kulturhistorisches Museum Görlitz (Foto: K. Wenzel)<br />
die wie kaum eine andere Erlebtes in ihren<br />
Werken reflektiert hat. Geboren und aufgewachsen<br />
auf dem elterlichen Gut Stampen/<br />
Stępin in Niederschlesien, studierte Charlotte<br />
E. Pauly zunächst Kunstgeschichte an der<br />
Universität Heidelberg und promovierte<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
5
Aus Schlesien in die Welt.<br />
Charlotte E. Pauly<br />
Charlotte E. Pauly (1886–1981), Alte Putzfrau<br />
(Ungarn), Radierung, 1972, Kulturhistorisches<br />
Museum Görlitz (Foto: K. Wenzel)<br />
1914 als eine der ersten Frauen in Deutschland<br />
in diesem Fach. Danach verließ sie den<br />
wissenschaftlichen Weg, entschloss sich,<br />
Malerin zu werden, und studierte bei Bernhard<br />
Pankok an der Kunstgewerbeschule<br />
Stuttgart. Nach einigen Jahren in Niederschlesien<br />
unternahm sie 1925/26 und<br />
1928/29 ausgedehnte Reisen nach Marokko<br />
und Spanien, wo sie Schülerin des Malers<br />
Daniel Vázquez Díaz wurde. Anschließend<br />
lebte sie bis 1932 in der portugiesischen Hafenstadt<br />
Nazaré. Hier entstanden expressive<br />
Zeichnungen der Küstenlandschaft, von<br />
Fischern und Badenden. Von Portugal aus<br />
brach sie schließlich zu einer ausgedehnten<br />
Reise durch Griechenland, Syrien, Libanon,<br />
Palästina, den Irak und Persien auf. Diese<br />
Länder zu bereisen, war zu dieser Zeit eine<br />
Besonderheit. Dass Pauly dieses Abenteuer<br />
als Frau allein unternahm, zeugt davon, wie<br />
frei von Ängsten und offen für Begegnungen<br />
sie durchs Leben gegangen ist.<br />
Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland<br />
musste Charlotte E. Pauly die Repressalien<br />
der Nationalsozialisten erdulden. Ihre<br />
Kunstwerke wurden als entartet diffamiert<br />
und durften nicht mehr ausgestellt werden.<br />
anzeige<br />
6<br />
Geschichte
Die Künstlerin Charlotte E. Pauly (1886–1981)<br />
Pauly<br />
Charlotte E. Pauly (1886–1981), Melonenfrauen, Grafit, Pinsel in Wasserfarben, 1960er Jahre,<br />
Kulturhistorisches Museum Görlitz (Foto: K. Wenzel)<br />
Das bekam die Künstlerin deutlich zu spüren,<br />
als sie sich 1937 an Sigfried Asche, den<br />
damaligen Direktor der Städtischen Kunstsammlungen<br />
Görlitz, mit der Bitte um eine<br />
Ausstellungsmöglichkeit wandte. Da die<br />
Reichskulturkammer im gleichen Jahr sogenannte<br />
entartete Kunst in den Görlitzer<br />
Museumsbeständen hatte beschlagnahmen<br />
lassen, fürchtete der damalige Direktor<br />
wohl, dass eine Charlotte E. Pauly-Ausstellung<br />
politisch nicht opportun sei und<br />
lehnte ihre Anfrage daher ab. Während der<br />
NS-Zeit lebte die Künstlerin zurückgezogen<br />
in Agnetendorf/Jagniątków im Riesengebir-<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
7
Aus Schlesien in die Welt.<br />
Charlotte E. Pauly<br />
ge in direkter Nachbarschaft des Schriftstellers<br />
Gerhart Hauptmann, der sie in dieser<br />
schwierigen Zeit unterstützte. Als sie Schlesien<br />
nach dem Zweiten Weltkrieg verlassen<br />
musste, konnte sie mit dem sowjetischen<br />
Sonderzug mitreisen, der den Leichnam<br />
und den Nachlass Gerhart Hauptmanns in<br />
die Sowjetische Besatzungszone brachte.<br />
Fortan lebte Charlotte E. Pauly im Ost-Berliner<br />
Stadtteil Friedrichshagen und wurde<br />
seit den späten 1950er Jahren als Künstlerin<br />
langsam wiederentdeckt – allerdings nicht<br />
von der Kulturpolitik des SED-Regimes,<br />
sondern von jungen Künstlerinnen und<br />
Künstlern, die nach Freiräumen und anderen<br />
Erfahrungen suchten, als jenen des<br />
streng reglementierten DDR-Kunstbetriebs.<br />
Die Grafiker Dieter Goltzsche und Herbert<br />
Tucholski regten Charlotte E. Pauly dazu<br />
an, ihre Zeichnungen aus den 1920er und<br />
1930er Jahren in Druckgrafiken weiterzuverarbeiten.<br />
Dafür eignete sie sich die anspruchsvollen<br />
Techniken der Lithografie<br />
und der Aquatinta-Radierung an. In ihren<br />
Grafiken ließ sie noch einmal die Erinnerungen<br />
an ihre Zeit in Portugal, Nordafrika und<br />
dem Nahen Osten aufleben und übersetzte<br />
sie in dynamisch-expressive Formen. Auch<br />
konnte sie anschauliche Geschichten aus<br />
diesen Gegenden erzählen, die für junge<br />
Künstlerinnen und Künstler der DDR wie<br />
unerreichbare Länder aus Märchen wirkten.<br />
Mit ihren Kunstwerken, ihrer Biografie und<br />
ihrer unangepassten Lebensweise erreichte<br />
Charlotte E. Pauly daher seit den 1970er<br />
Jahren eine geradezu mythische Bekanntheit<br />
in der Kunstszene der DDR. Sie konnte<br />
ihre Werke nun auch in Museen und Galerien<br />
des Landes ausstellen und erfuhr dafür<br />
viel Zuspruch. Ihre Reisen führten sie zwar<br />
nicht mehr auf die Iberische Halbinsel oder<br />
in den Nahen Osten, aber nach Ungarn und<br />
Bulgarien. Manchmal war sie, wie Dieter<br />
Goltzsche erzählt, von einem Tag auf den<br />
anderen einfach verschwunden und kam<br />
erst Wochen später von einer spontanen<br />
Reise zurück. Wie bereits in den 1920er<br />
und 30er Jahren verarbeitete sie ihre Reiseerlebnisse<br />
wieder in Zeichnungen, die als<br />
Vorlagen für Druckgrafiken dienten. Dabei<br />
entwickelte sie ein besonderes Interesse an<br />
Menschen, die ihr unterwegs begegneten,<br />
und porträtierte Putzfrauen in Ungarn oder<br />
Melonenverkäuferinnen in Bulgarien.<br />
anzeige<br />
8<br />
Geschichte
Die Künstlerin Charlotte E. Pauly (1886–1981)<br />
Pauly<br />
Charlotte E. Pauly (1886–1981), Schwertertanz in Damaskus, Aquatinta-Radierung, 1960er Jahre,<br />
Kulturhistorisches Museum Görlitz (Foto: K. Wenzel)<br />
Auch in der Görlitzer „Galerie am Schönhof“<br />
gab es in den 1980er Jahren eine Ausstellung<br />
von Druckgrafiken Charlotte E. Paulys.<br />
Ins Graphische Kabinett des Kulturhistorischen<br />
Museums fanden ihre Werke jedoch<br />
erst in jüngster Zeit Eingang: Der Berliner<br />
Grafiker Dieter Goltzsche schenkte dem<br />
Graphischen Kabinett im Jahr 2019 130<br />
Werke von Charlotte E. Pauly. Zu dieser<br />
Schenkung gehören Zeichnungen aus den<br />
1920er und 30er Jahren, Druckgrafiken der<br />
1960er und 70er Jahre, aber auch ein Heft<br />
mit Erinnerungen an ihre schlesische Heimat<br />
sowie ein Typoskript ihrer Übersetzungen<br />
von Werken des spanischen Schriftstellers<br />
Federico García Lorca. Eine Auswahl aus<br />
dieser Schenkung ist noch bis zum 20. März<br />
<strong>2022</strong> im Ausstellungsraum des Graphischen<br />
Kabinetts im Barockhaus Neißstraße 30 zu<br />
erleben. Gleichzeitig holt das Kulturhistorische<br />
Museum damit die Ausstellung nach,<br />
um die Charlotte E. Pauly 1937 gebeten hatte,<br />
die aber damals aus politischen Gründen<br />
nicht zustande kam.<br />
Kai Wenzel<br />
Geschichte<br />
9
Zur Geschichte des Görlitzer Bürgerbräuhauses<br />
Neißstraße Nr. 27<br />
Dass in Görlitz seit den ältesten Zeiten Bier<br />
gebraut wurde, haben wir in den letzten<br />
Jahren bei der Beschreibung der Görlitzer<br />
Bierbrauerei und Brauhöfe wiederholt bewiesen.<br />
Heute soll uns an dieser Stelle ein<br />
Brauhof beschäftigen, in dem mehr als fünf<br />
Jahrhunderte hindurch die Braugerechtigkeit<br />
ausgeübt wurde und der somit der älteste<br />
Görlitzer Brauhof war.<br />
Das Haus Neißstraße Nr. 27 gehörte um<br />
1400 einem gewissen Langehans, von dem<br />
leider nichts Näheres bekannt ist. Vielleicht<br />
ist es derselbe Nickel Langehans, dem 1409<br />
von Otto Helwig „ein Melzhaus und ein<br />
Haus dazu und eine Mauer am Remeteicht“<br />
aufgelassen wird. Es würde mit dem „Nebenhaus“<br />
übereinstimmen, das 1549 von<br />
Nr. 27 abgetrennt und selbständig wird. Sicher<br />
ist, dass 1405 die „alte Langehannussin<br />
mit ihren Kindern“ einen Vertrag abschließt<br />
mit dem neuen Nachbarn im Hause Nr. 26,<br />
der sich gleichfalls um ein Melzhaus und<br />
eine Mauer sowie einen Wasserzufluss und<br />
eine Flutrinne dreht. Dieses Nachbarhaus<br />
Nr. 26 besaß um 1400 Hempel Schulz. Es<br />
war gleichfalls ein sechsbieriger Brauhof.<br />
1415 tauscht er ihn mit Michel Schleiffe gegen<br />
dessen dreibierigen im Nikolaiviertel,<br />
wobei Schleiffe 100 Mark zuzahlen musste.<br />
Die Familie Schleiffe spielte, wie auch die<br />
Besitzer des Hauses Neißegasse 29, Lauterbach,<br />
eine große Rolle in Görlitz; sie hatten<br />
großen Grundbesitz und saßen im Rate.<br />
Nachkommen beider Familien, Martin Lauterbach<br />
und Martin Schleiffe, wurden ein<br />
halbes Jahrhundert später 1468 in der Pulververschwörung<br />
enthauptet.<br />
Diese drei Familien, Langehans, Schleiffe<br />
und Lauterbach, besaßen die Häuser Nr. 26,<br />
27 und 29. Um 1428 wechselt das Haus Nr.<br />
27 seinen Besitzer. Es tritt als solcher Peter<br />
Walther von Leschwitz auf, gibt es aber bald<br />
an seinen Sohn, Meister Paulus Walther, weiter.<br />
Bereits 1432 kommt es an dessen Bruder<br />
Georg Walther, und aus einer Erbteilung<br />
geht hervor, dass Paul Walther (vielleicht<br />
im Kampf gegen die Hussiten) sein Leben<br />
lassen musste. Etwa 15 Jahre behält Georg<br />
Walther den Bierhof, dann tritt er ihn 1449<br />
an den Mann seiner Schwester Barbara, Peter<br />
Tschirwitz, ab, der im Rate saß. Um 1480<br />
besitzt das Haus Hieronimus Heune, dessen<br />
Söhne Gregor, Hieronimus, Christoph und<br />
Hans es 1490 an Nikolaus Tilicke verkau-<br />
anzeige<br />
10<br />
Geschichte
Zur Geschichte des Görlitzer Bürgerbräuhauses<br />
Neißstraße Nr. 27<br />
Barockhaus Neißstraße 27 in der Görlitzer Altstadt. Das repräsentative Haus wurde nach dem Stadtbrand<br />
neu aufgebaut, zuvor befand sich hier das älteste Brauhaus der Stadt (Braurechte seit 1225).<br />
fen, wobei es „Haus und Hof in der Neißegassen“<br />
bezeichnet wird. Niklas Tilicke soll<br />
(nach Schäffers Genealogischen Tabellen)<br />
um 1496 in Glogau an der Pest verstorben<br />
sein. Er war verheiratet mit Menzel Emerichs<br />
Tochter Hedwig. Ihr Bruder Paul Emerich<br />
erwirbt dieses Haus von den Tilickschen Erben<br />
im Jahre 1507. Er besaß außerdem das<br />
„Haus im Winkel“ Obermarkt 15, ein Vorwerk<br />
im alten Konsulsdorf und einen Teil<br />
von Heidersdorf. All diesen Grundbesitz mit<br />
Ausnahme von Heidersdorf erwarb von ihm<br />
1519 der Ratsherr und spätere Bürgermeister<br />
Georg Rösler, ein Freund des streng katholischen<br />
Stadtschreibers Johannes Haß.<br />
Rösler, der in der Niederwerfung des Tuchmacheraufstandes<br />
1527 eine Rolle spielte,<br />
wird von dem Anführer desselben, Alexander<br />
Bolze, als „Thrann“ bezeichnet. Sein<br />
Sohn Jakob Rösler, der Bürgermeister der<br />
schweren Pönfallzeit (1547), saß in Prag längere<br />
Zeit gefangen. Zu Georg Röslers Zeiten<br />
brach der große Stadtbrand vom Jahre<br />
1525 aus, der im Hause Neißegasse 20 beim<br />
Bäckermeister Peselt aufging, ungeheuren<br />
Schaden machte und grenzenloses Weh<br />
über die Stadt brachte. Welch ungeheure<br />
Katastrophe suchte die Stadt in dieser einen<br />
Nacht vom 12. zum 13. Juni 1525 heim. 34<br />
Brauhöfe, darunter auch unser Haus Nr. 27,<br />
fielen unter 180 eingeäscherten Häusern<br />
den Flammen zum Opfer, unzählige Gerber-<br />
und Tuchmacherfamilien wurden bettelarm<br />
und brotlos, unermesslich war der<br />
angerichtete Schaden. Jahre, Jahrzehnte<br />
vergingen, ehe die wüssten Stätten wieder<br />
aufgebaut waren, allerdings herrlicher denn<br />
je entstanden sie im Stile der Frührenaissance<br />
aus Schutt und Asche. Nach Georg<br />
Röslers Tode kam 1534 seine Witwe und bei-<br />
Geschichte<br />
11
Zur Geschichte des Görlitzer Bürgerbräuhauses<br />
Neißstraße Nr. 27<br />
der jüngster Sohn Franz Rösler in den Besitz<br />
des Brauhofes. Unstimmigkeiten zwischen<br />
beiden veranlassten 1549 die Mutter, dem<br />
Sohne „einzuräeumen das neben Heuslin<br />
mit zweien gewelben ubereinander samt<br />
der Stuben und Stüblein uf der löuben und<br />
das hirmitte die reinthure zugemauert wurde,<br />
dadurch ein theil von dem andern friede<br />
und rhue haben mag“, mit der Zusatzbestimmung,<br />
dass nach dem Tode der Mutter<br />
dem Sohne Franz das große und das kleine<br />
Haus zufallen sollten. Von diesem Zeitpunkt<br />
ab tritt der abgetrennte Teil als Nr. 28 (Hyp.<br />
Nr. 352) in den Geschossbüchern auf. Rösler,<br />
der den gesamten Besitz 1550 antritt,<br />
verkauft den abgetrennten Teil alsbald an<br />
den D. Theusner. Er selbst behält den Brauhof<br />
Nr. 27 bis etwa 1566, dann veräußert er<br />
ihn an den Handelsmann Christoph Rotsch<br />
aus Tiefenfurt, nordöstlich von Görlitz, der<br />
1555 Bürgerrecht genommen hatte. 23<br />
Jahre vergingen, die Pest hatte 1585 monatelang<br />
in der Stadt geherrscht und Tausende<br />
von Opfern gefordert, dann wechselte<br />
das Haus abermals seinen Besitzer. Es tritt<br />
Merten Schreier auf, der seinen Bierhof in<br />
der Steingasse gegen den Rotscheschen<br />
eintauscht. Schreiers Witwe Elisabeth, geb.<br />
Riesling, verheiratet sich in zweiter Ehe mit<br />
dem Stadtrichter und Herrn aus Pfaffendorf<br />
Franz Beyer. Sie stirbt im Alter von 95 Jahren<br />
und vererbt das Haus ihrem Enkel Johann<br />
Friedrich Schittler. Da dessen gleichnamiger<br />
Sohn, der Mühlenverwalter Johannes Friedrich<br />
Schittler, jung stirbt, fällt das Haus an<br />
dessen Kinder. Der Preis beträgt 4700 Mark.<br />
Unter ihrem Besitz wird das Haus, gleich anderen<br />
Häusern der Neißegasse, abermals in<br />
dem großen Brande von 1726 ein Raub der<br />
Flammen. Im gleichen Hause wie vor 200<br />
Jahren bricht durch die Unachtsamkeit eines<br />
Hausknechtes, der unter der hölzernen<br />
Darre ein zu großes Feuer im Ofen angemacht<br />
hat, am 30. April ein Feuer aus, das<br />
der Altstadt abermals zum Verhängnis werden<br />
soll. Auch das Haus Nr. 27 wurde wiederum<br />
ein Raub der Flammen, und die Schittlerschen<br />
Erben gingen daran, die Ruine zu<br />
verkaufen. Der landvogteiliche Rentschöffer<br />
Gottlob Mitsching erwarb es Anfang November<br />
1726 und ließ es alsbald wieder aufbauen.<br />
An diesen Neubau erinnert das noch<br />
jetzt vorhandene Wappen Mitschings. Seine<br />
Kreditoren verkaufen den Brauhof dann<br />
anzeige<br />
12<br />
Geschichte
Zur Geschichte des Görlitzer Bürgerbräuhauses<br />
Neißstraße Nr. 27<br />
Die Görlitzer Braupfanne um 1710. Abbildung aus: Topographie der Stadt Görlitz, von Dr. Richard Jecht<br />
1763 an Maria Theodora Riech, geb. Adolph,<br />
später verehelichte Fiebig um 5200 Mark,<br />
die ihn wiederum ihrer Schwester Maria<br />
Elisabeth, verehelichte Gutspächter Schneider<br />
in Rauscha, vererbt. Im Jahre 1793 kauft<br />
dann der Vorwerksmann im Wilhelmshof<br />
Christian Gottlob Huscher den Brauhof, ihm<br />
folgt seine Frau, geb. Kiesewetter, im Besitz.<br />
Frau Kaufmann Binder veräußert den Bierhof<br />
1836 an den Brauer Gottfried Müller für<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
13
Zur Geschichte des Görlitzer Bürgerbräuhauses<br />
Neißstraße Nr. 27<br />
Biergeiger und bierausträgerinnen in Görlitz. Abbildung aus: Topographie der Stadt Görlitz,<br />
von Dr. Richard Jecht<br />
9000 Mark. Er baut sofort ein Stockwerk als<br />
Getreideboden auf und reißt ein Jahr darauf<br />
das Hinterhaus bis auf die Darre ab, wie er<br />
auch sonst kleinere bauliche Veränderungen<br />
vornimmt. Um eine größere Tiefe nach<br />
der Gartenseite zu gewinnen, lässt er Pfeiler<br />
mit darüber geschlagenen Bogen anbringen<br />
und auf sämtliche Gebäude Blitzableiter<br />
legen. 1845 führt er im Garten einen<br />
Fachwerkbau auf, der als Pferdestall, Raum<br />
anzeige<br />
14<br />
Geschichte
Zur Geschichte des Görlitzer Bürgerbräuhauses<br />
Neißstraße Nr. 27<br />
für die Malzquetsche und einen Malzboden<br />
gedacht ist, 1857 lässt er die alte hölzerne<br />
Altane abbrechen und verkauft 1858 den<br />
Brauhof um 15500 Reichstaler seinem Sohn<br />
Carl Louis Müller. Auch dieser lässt weitere<br />
Veränderungen und Verbesserungen anbringen,<br />
so das Göpelwerk im Garten des<br />
Hinterhauses bedachen, 1860 ein Schaufenster<br />
neben der Haustür ausbrechen,<br />
einen neuen Keller bzw. Gefäßschuppen<br />
massiv und gewölbt bauen und mit Dachboden<br />
und Pultdach versehen. 1863 führt<br />
er ein gewölbtes Gärhaus auf. In der Front<br />
umfasst es 5 Fenster.<br />
Aus der Brauerei von Louis Müller wurde<br />
eine GmbH und schließlich 1918 eine Aktiengesellschaft<br />
mit dem Namen „Bürgerbräu“.<br />
Nach dem Tode des letzten Direktors<br />
Hetzar im Jahre 1937 übernahm die Görlitzer<br />
Landskronbrauerei das Haus. Jahrhunderte<br />
sanken in die Ewigkeit, aus der<br />
kleinen mittelalterlichen Stadt mit ihren<br />
Mauern und Befestigungen wurde unsere<br />
schöne Gartenstadt, die sich immer mehr<br />
und mehr ausbreitet und den Mauergürtel<br />
längst schon sprengte. Wie vor Jahrhunderten<br />
grüßt in erhabener Größe die alte Stadtkirche<br />
St. Peter vom ehemaligen Burgberg<br />
herüber, verträumt spendet wie zu Urväters<br />
Zeiten die schlichte Röhrbütte im Winkel<br />
des Hainwaldes ihre kühle Gabe, und über<br />
die steile Neißegasse pendelt wie vor Zeiten<br />
aller Verkehr von Ost nach West und umgekehrt.<br />
Geschlechter kamen und gingen;<br />
tiefstem Niedergang folgte blühender Aufstieg.<br />
Krieg, Feuers- und Wassersnot suchten<br />
die Stadt heim, Altes fiel und Neues stieg<br />
empor. Alles erlebten die Häuser der alten<br />
Neißegasse mit, oft aus unmittelbarer Nähe.<br />
Und nun ist wieder ein neuer Abschnitt<br />
angebrochen für den alten, ehrwürdigen<br />
Brauhof Nr. 27. Verschwunden sind Braupfanne,<br />
Gärhaus und Malzdarre, versunken<br />
längst das alte Theater im Nachbarbau, verklungen<br />
die Melodien der mittelalterlichen<br />
Bierfiedler. Künstler und Bauhandwerk sind<br />
dabei, dem jahrhundertealten Brauhofe ein<br />
neues Gesicht zu geben.<br />
Quelle: Die Heimat, 1938<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
15
Märkte und Krämer<br />
und Krämer<br />
Möchte man heutzutage über einen „historischen<br />
Markt“ vor dem Rathause bummeln,<br />
gerät man oft dort in ein arges Gedränge vor<br />
den buntbemalten Buden mit Sommerblumen<br />
und frischen Hühnereiern, mit duftendem<br />
Landbrot und antiquarischem Trödelkram.<br />
Denn sonst hat es unsereins mit dem<br />
Einkaufen eilig. Unsere Supermärkte, Warenhäuser<br />
und Spezialverkaufsstellen an den<br />
Hauptgeschäftsstraßen und in den Neubauvierteln<br />
besitzen nur noch wenig von dem<br />
Reiz, den Handel und Wandel rund um den<br />
Untermarkt einmal hatten. Dabei war der<br />
Untermarkt tatsachlich für Jahrhunderte das<br />
Zentrum für Märkte und Krämer in Görlitz: An<br />
der Südseite der „Zeile“ hatten schon im Mittelalter<br />
die wenigen Würz- und Seidenkrämer<br />
ihre Stände. Sie galten als ranghöchste Gruppe<br />
der Kleinhändler, bei ihnen bekam man<br />
kostbare Stoffe, seltene Gewürze, Pelzwaren,<br />
Bücher und Kunstgegenstände, die nur für<br />
die zahlungskräftigen Bürger erschwinglich<br />
waren. Zahlreicher und weniger vornehm<br />
waren die Spitz- oder Kleinkrämer. Nach den<br />
Pudritzen, den überbauten Gängen der Fachwerk-<br />
und Holzhäuser, nannte man sie auch<br />
die Pudritzkrämer. Sie mussten sich mit der<br />
Nordseite der „Zeile“ begnügen. Unter den<br />
Hirschläuben verkauften auch die Beutler<br />
ihre Lederwaren: Tabaksbeutel, Lederhosen,<br />
Handschuhe, Bruchbänder und Hosenträger.<br />
Marienplatz – Markttreiben mit Dickem Turm,<br />
Foto: Robert Scholz<br />
An festen Plätzen hatten verschiedene Handwerke<br />
Ihre „Bänke“, immer eine begrenzte<br />
Zahl. Die Schuhbänke und Brotbänke fand<br />
man anfangs auf dem Heringsmarkt, dem<br />
nördlichen Untermarkt, die Küchenbänke<br />
und Fleischbänke an der Fleischergasse.<br />
Später, bis ins vorige Jahrhundert, zimmerte<br />
man sich hölzerne Verkaufsbuden. Sie zogen<br />
anzeige<br />
16<br />
Geschichte
Geschichten aus Alt-Görlitz<br />
Märkte und Krämer<br />
Jahrmarkt Hugo-Keller-Straße,<br />
Foto: Robert Scholz<br />
sich um die „Zeile“, die Dreifaltigkeitskirche<br />
und das Salzhaus und lehnten sich auch an<br />
die Stadtmauer. In den engen, dämmrigen<br />
Gewölben und Buden der Krämer stapelten<br />
sich Fässer, Kisten und Säcke, die verschiedensten<br />
Gerüche vermengten sich, und vor<br />
den Eingängen warben die Auslagen zum<br />
Kauf. Schaufenster kannte man noch nicht,<br />
oft dienten die heruntergeklappten Fensterladen<br />
als Verkaufstische. Jeder Krämer hatte<br />
sein Auskommen. Über alle Maßen liebten<br />
die alten Görlitzer die drei Jahrmärkte. Je<br />
nach der Jahreszeit unterschied man den<br />
„kalten“ Jahrmarkt, den „warmen“ Jahrmarkt<br />
und den Kirmes-Jahrmarkt. Da kamen Hunderte<br />
von Händlern mit ihren Wagen von<br />
weither. Buden, Bänke und Tische säumten<br />
die Gasse und zogen sich in die Hausgewölbe.<br />
Im dichten Gedränge kam man kaum<br />
vorwärts. Für eine Woche waren viele Leute<br />
rein aus dem Häuschen. Oft bekamen die<br />
Kinder sogar schulfrei, denn den Lehrern<br />
hörten sie vor Spannung sowieso kaum noch<br />
zu. Nur hier bekamen die Frauen die neuen<br />
Modeartikel zu sehen, nur hier erfuhren die<br />
Männer von technischen Neuerungen wie<br />
den Schwefelhölzchen. Pfefferküchler und<br />
Töpfer hatten ihr gutes Geschäft, aber auch<br />
Possenreißer und Bänkelsänger stellten sich<br />
ein, und manchmal stellten Menagerien ihre<br />
fremdartigen Tiere vor. Etwas stiller ging es<br />
auf den Weihnachtsmärkten zu, die auch lange<br />
Jahre auf dem Untermarkt Heimatrecht<br />
hatten. Auch den Wochenmarkt am Donnerstag<br />
mochten die Görlitzer nicht missen.<br />
Handwerker, Stadtgärtner und Bauern hatten<br />
vielerlei anzubieten. Gegenüber vom „Goldenen<br />
Baum“, zwischen Neptunbrunnen und<br />
Waage, spielte sich der Fischmarkt ab, bis zur<br />
Weihnachtszeit bekam man lebende Fische.<br />
Den Butter- und Eiermarkt fanden die sparsa-<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
17
Märkte und Krämer<br />
und Krämer<br />
Getreidesäcke standen aufgebunden bereit,<br />
damit jeder Käufer die Güte prüfen konnte.<br />
Etwa viermal im Jahre gab es den Viehmarkt,<br />
da kam es vor, dass an die tausend Pferde<br />
Marienplatz, Foto: Robert Scholz<br />
men, wählerischen Hausfrauen und Dienstmädchen<br />
dann auf dem Fischmarkt vor der<br />
heutigen Musikschule, den Flachsmarkt an<br />
der heutigen Jacob-Böhme-Straße, den Geflügelmarkt<br />
an der unteren Elisabethstraße<br />
bis zur Bergstraße. Für den Heu- und Strohmarkt<br />
war der Nikolaigraben freigehalten, für<br />
den Holzmarkt der Nikolaiturm, für den Obstmarkt<br />
und die Böttcher der Klosterplatz. Die<br />
Topfmärkte siedelten sich auf dem heutigen<br />
Lutherplatz an. Auf dem Obermarkt spielte<br />
sich der Getreidemarkt ab. Bauern aus dem<br />
weiten Umkreis, sogar aus Böhmen, waren<br />
mit ihren Pferdefuhrwerken gekommen. Die<br />
Marienplatz mit Elisabethstraße,<br />
Foto: Robert Scholz<br />
und Rinder, Kälber und Schweine aufgetrieben<br />
wurden. Gasthöfe und Geschäfte rund<br />
um die Marktplätze bekamen ihren guten<br />
Teil von den Markttagen. In zufriedener Bierrunde<br />
sah man Händler und Kunden im „Goldenen<br />
Baum“ am Untermarkt (er besteht seit<br />
1538), in der „Goldenen Sonne“, Demianiplatz<br />
54 (früher „Drei Krebse“) oder im Ratskeller<br />
anzeige<br />
18<br />
Geschichte
Geschichten aus Alt-Görlitz<br />
Märkte und Krämer<br />
beieinander. Vor hundert Jahren reihten sich<br />
um den Obermarkt drei Hotels („Goldene<br />
Krone“, „Preußischer Hof“, „Weißes Roß“), zwei<br />
Weinstuben und die Speisegaststätte Pfennigwerth,<br />
wo sich Getreidehändler und Bauern<br />
trafen. Auch im Kolonialwarengeschäft<br />
von Hecker, im Zigarrenladen von Franke, im<br />
Eisen- und Kurzwarengeschäft Krumpelt, in<br />
der Nagelschmiede am Reichenbacher Turm<br />
und in der Großdestillation Friedlander gab<br />
man sich die Klinke in die Hand. Aus der Drogerie<br />
Schluckwerder nahm man Farben, aus<br />
dem Leinen- und Kleiderwarengeschäft von<br />
Eduard Schulze Schürzen und Hemden mit.<br />
Und alles hatte man in einem kurzen Rundgang<br />
um den Platz geschafft. Erst ab 1880<br />
wuchsen die neuen Geschäftsstraßen und<br />
Wohnviertel. Die Ladengeschäfte waren geräumig,<br />
hell, sauber und schließlich sogar geheizt,<br />
das gefiel den Kunden wie eben alles<br />
Neue. Mit den Märkten ging es abwärts. Nur<br />
die Jahrmärkte hielten sich noch einige Zeit.<br />
Es bleibt der Wochenmarkt. Seit 1864 hat er<br />
sich an der Elisabethstraße behauptet.<br />
Quelle:<br />
Geschichten aus Alt-Görlitz<br />
Marienplatz mit Elisabethstraße,<br />
Foto: Robert Scholz<br />
Generell, nicht nur in Görlitz, schwindet die<br />
Zahl an Wochenmarkthändlern. Auch Markthändler<br />
werden älter und geben auf, wenn<br />
sie keine Nachfolger finden. In Ostdeutschland<br />
hatten sich viele nach der politischen<br />
Wende, als der Jobverlust um sich griff,<br />
selbstständig gemacht - mitunter mit einem<br />
Marktstand. Eine Generation, die nun aber in<br />
Rente geht. Auch rechnet sich für viele Händler<br />
in der heutigen Zeit der Aufwand nicht<br />
mehr, weil die Auflagen steigen.<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
19
Der Wiederaufbau der Energieversorgung der Stadtwerke Görlitz<br />
(Fortsetzung)<br />
Positiv wirkte sich später aus, dass durch<br />
die zurück gekehrten Dorfbewohner die<br />
Arbeitskolonnen verpflegt wurden und<br />
die Kommandanturen mit Brot, Fleisch,<br />
Fett, Zucker und teils mit warmen Speisen<br />
Unterstützung gaben. Später übernahmen<br />
die zurück gekehrten Einwohner mit<br />
ihren Bürgermeistern gänzlich die Unterbringung<br />
und Verpflegung der Monteure.<br />
Um ein schnelleres Tempo bei der Instandsetzung<br />
zu erreichen, leisteten Bauern<br />
und örtliche Handwerker unter Anleitung<br />
der städtischen Monteure eine wertvolle<br />
Hilfe bei dem Heranschaffen und der<br />
Auswechslung der umgebrochenen und<br />
beschädigten Leitungsmasten. Das Werkzeug<br />
war meist von zu Hause mitgebracht<br />
oder irgendwo ausgeliehen. Den bewährten<br />
Monteuren wurden neu hinzutretende<br />
Schlosser und Arbeiter zugeteilt,<br />
und es konnten neue Reparaturkolonnen<br />
gebildet werden. Diese wurden dann auf<br />
nachfolgend genannte Leitungsstrecken<br />
aufgeteilt:<br />
1. nördlich von Zodel, Deschka und Zentendorf,<br />
2. südlich nach Wendisch-Ossig und Thielitz,<br />
3. westlich nach Markersdorf,<br />
4. nach Deutsch-Paulsdorf, Friedersdorf<br />
und Reichenbach, sowie<br />
5. nach Königshain und<br />
6. östlich nach Leopoldshain, Stangenhain,<br />
Sohr-Neundorf bis Särcha.<br />
Zeitgleich wurden die Leitungen nach<br />
Kunnersdorf, Krauscha und Kaltwasser<br />
wieder instand gesetzt. Von Reichenbach<br />
wurden die zum größten Teil zerstörten<br />
Strecken über Dittmansdorf nach Seifersdorf<br />
und Jänkendorf, von Rothenburg<br />
über Bremenhain, Spree, Hähnichen bis<br />
nach Rietschen und Liebel neu vorgetrieben,<br />
bis der nördliche Ring von Horka<br />
nach Uhsmannsdorf und von Niesky<br />
über Sproitz über Mücka bis Kreba und<br />
Tschernske wieder hergestellt und geschlossen<br />
war. Größere Abzweigleitungen<br />
nach Wiesa, Ödernitz, Biehain, Trebus und<br />
Kosel auf der einen Seite des Ringes und<br />
nach Petershain, Thiemendorf, Diehsa und<br />
anzeige<br />
20<br />
Geschichte
nach dem 7. Mai 1945<br />
Energieversorgung<br />
Radisch auf der anderen Seite sind instand<br />
gesetzt worden und versorgten endlich<br />
wieder auch die abseits gelegenen Ortschaften<br />
der Landbezirke.<br />
Neben der Instandsetzung der Versorgungsleitungen<br />
gingen die Instandsetzung<br />
und Reparaturen in den ländlichen<br />
Umspannhäusern meist parallel dazu weiter.<br />
Diese hatten oft zerschossene Dächer<br />
und zertrümmerte Schalttafeln. Die Reparatur<br />
und Ersatzteilbeschaffung gestaltete<br />
sich schwierig.<br />
Zum Versorgungsgebiet der städtischen<br />
Werke für die Stadt und die Landkreise Rothenburg<br />
und Niesky gehörten in der Stadt<br />
76 und auf dem Lande 168 Umspannstationen.<br />
Der größte Teil liegt dabei im nördlichen<br />
Versorgungsgebiet und musste<br />
daher als Voraussetzung für die ländliche<br />
Energieversorgung sofort instand gesetzt<br />
werden. Um das Tempo bei der Instandsetzung<br />
insbesondere an den örtlichen<br />
Transformatoren-Stationen zu beschleunigen,<br />
wurde durch ortsansässige Elektromeister<br />
unter planvoller Arbeitslenkung<br />
und Materialbeschaffung durch die Stadtwerke<br />
mit dem Wiederaufbau der Ortsnetze<br />
begonnen. Nach der vordringlichsten<br />
Versorgung der ländlichen Handwerksbetriebe<br />
mit Elektroenergie, weil diese die<br />
Instandsetzung der landwirtschaftlichen<br />
Maschinen die für die Ernte gebraucht<br />
wurden, vornehmen mussten, sowie der<br />
landwirtschaftlichen Güter, die sich inzwischen<br />
schon auf das Dreschen des Getreides<br />
einstellten. Gleichzeitig mussten die<br />
Mühlen mit Strom versorgt werden, denn<br />
die Bevölkerung wartete auf Brot.<br />
Alsdann ging es um die Wiederinstandsetzung<br />
der Stadtbeleuchtung. Auch hier<br />
war eine unglaubliche Arbeitsleistung erforderlich,<br />
um die meist beschädigten Anschlusskästen,<br />
Schaltgeräte und Aufzugsvorrichtungen<br />
der Lampen zu reparieren.<br />
Es war auch notwendig, die fehlenden<br />
meist während des Krieges abgenommenen<br />
und verschollenen Lampen wenigsten<br />
teilweise zu beschaffen und wieder<br />
anzubringen.<br />
In den ersten Tagen nach Kriegsende dachte<br />
noch keiner an die düsteren Prophezeiungen,<br />
dass uns ein verlorener Krieg<br />
die Gebiete östlich von Neiße und Oder<br />
kosten würde, sondern man hielt die An-<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
21
Der Wiederaufbau der Energieversorgung der Stadtwerke Görlitz<br />
deutungen über das Abkommen von Jalta<br />
für Propaganda des Nazi-Regimes. Daher<br />
fanden sich alle aufbauwilligen Kräfte zunächst<br />
wieder im Neißewerk am östlichen<br />
Neißeufer ein, wo sich auch alle Werkstätten,<br />
Lager, Büros und Verwaltungsräume<br />
befanden.<br />
In unmittelbarer Nähe des E-Werkes an<br />
der Neiße, begann die Rote Armee eine<br />
Notbrücke über die Neiße zu bauen, und<br />
daran knüpfte jeder die Hoffnung eines<br />
besseren Verkehrs auch für Zivilpersonen,<br />
darunter die Kontakte mit den eigenen<br />
Angehörigen im östlichen Stadtteil. Diese<br />
Hoffnung aber versank bald, denn mit der<br />
Fertigstellung der Brücke hatten die polnische<br />
Armee und die polnischen Verwaltungsbeamten<br />
den westlichen Rand ihres<br />
Besatzungsgebietes erreicht und durchgesetzt<br />
und ihren Schlagbaum am östlichen<br />
Brückenkopf errichtet. Brückenkontrolle<br />
und jegliches Übergangsverbot folgten<br />
ziemlich rasch aufeinander.<br />
Anfangs war es noch möglich gewesen,<br />
einiges Material, Werkzeuge und Messgeräte<br />
vom E- Werk nach der Westseite<br />
mitzunehmen, aber nunmehr verboten<br />
dies die neuen Grenzverhältnisse. Damit<br />
verlagerte sich der Arbeitseinsatz ziemlich<br />
rasch vom Neißewerk auf die Außenstelle<br />
in der Görlitzer Steinstraße 13. Dort<br />
befanden sich der Kundendienst, die Tarifabteilung,<br />
die Werbung und die Ausstellungsräume.<br />
Das reichhaltige Lager<br />
für Transformatoren, Kabelmaterial, das<br />
Material-, Werkzeug- und Zählerlager, die<br />
gesamten Werkstätten mit den Zählerprüfeinrichtungen,<br />
Garagen, Büros, Archiv und<br />
Geschäftsausstattung gingen nach Kriegsende<br />
auf der Ostseite der Neiße verloren.<br />
Nur die kaufmännische Abteilung hatte<br />
rechtzeitig ihre Büros auf die Westseite der<br />
Stadt verlegt und damit einige unersetzliche<br />
Schreib-, Rechen- und Buchungsmaschinen<br />
sowie einige wichtige Akten,<br />
Verträge und Karteien mitgenommen. Die<br />
gesamten technischen Unterlagen, Zeichnungen,<br />
Pläne, Verzeichnisse, Preislisten,<br />
Broschüren, Literatur usw. sind verloren<br />
gegangen. Damit waren die städtischen<br />
Werke nicht besser gestellt als jeder ausgebombte<br />
Betrieb.<br />
Mit der Neuerstellung und Neuaufnahme<br />
dieser Unterlagen sowie Neubeschaffung<br />
anzeige<br />
22<br />
Geschichte
nach dem 7. Mai 1945<br />
Energieversorgung<br />
von Landkarten, Messtischblättern, Plänen<br />
und Literatur wurde daher schon im Jahre<br />
1945 begonnen.<br />
Altstadtwerk, jetzt Turbinenhaus und Restaurant<br />
Vierradenmühle.<br />
Anmerkung:<br />
Es war also dringend erforderlich, Netz-,<br />
Übersichts- und Schaltpläne neu anzufertigen.<br />
Ein erster grober Übersichtsschaltplan<br />
ließ sich aus den in den Umspannwerken und<br />
Schalthäusern vorhandenen Plänen zusammenstellen<br />
(u. a. Schalthaus Brautwiesenplatz<br />
und Demianiplatz, Gleichrichterwerk<br />
Verrätergasse, Gobbinwerk, Altstadtwerk,<br />
Schaltwerk Reichenbach, Niesky und Freileitungsschaltwerk<br />
Ebersbach). Erst ab dem<br />
Jahre 1948 konnte das gesamte 10-KV-Netz<br />
geographisch neu aufgenommen werden<br />
und auf eine mit Messtischblättern zusammengefügte<br />
Karte übertragen werden. Zu<br />
all diesen Problemen kam hinzu, dass insbesondere<br />
es an den 10-KV-Leitungen und dem<br />
Ortsnetz seit etwa 1942 keine Erweiterungen<br />
und Wartungsarbeiten mehr gegeben hat.<br />
Zur Materialreserve für die Kriegsproduktion<br />
wurden Hoch- und Niederspannungsfreileitungen<br />
aus Kupferseilen gegen Eisenseile<br />
ausgewechselt. Im Norden der Kreise Rothenburg<br />
Niesky waren die Leitungen durch<br />
Kriegshandlungen erheblich zerstört, es gab<br />
fast keine Leitungsmaste mehr.<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
23
Der Wiederaufbau der Energieversorgung der Stadtwerke Görlitz<br />
Um aber technisch diese Abschaltungen<br />
Gebietsweise vornehmen zu können,<br />
musste das gesamte 10-KV-Netzt mit damals<br />
34 km Länge und 56 Schaltstellen sowie<br />
das Dreh- und Gleichstrom- , Niederspannungskabelnetz<br />
in einer Länge von<br />
250 km, was ursprünglich vermascht war,<br />
aufgetrennt werden. Diese Maßnahmen<br />
waren notwendig, da das dem Gleichstromverteilerkabelnetz<br />
übergeordnete<br />
vermaschte Gleichstromspeisekabelnetz<br />
nicht getrennt werden durfte. Daher war<br />
es erforderlich in 5 Gleichstromschaltstellen<br />
ein Doppelsammelschienensystem<br />
einzubauen und 180 Stromkästen, welche<br />
mit einer Granitplatte mit einem Gewicht<br />
von 95 kg abgedeckt sind, ein- bis zweimal<br />
täglich aufzunehmen, um die erforderliche<br />
Trennung der Leitung vornehmen zu<br />
können. Der Einbau der Doppelsammelschienen<br />
sowie die Umschaltungen im<br />
Niederspannungskabelnetz mussten unter<br />
Spannung durchgeführt werden, um<br />
durch Stromausfall keine Störungen im<br />
Aufbau des Versorgungsgebietes hervorzurufen.<br />
Diese Arbeiten konnten nur von 3<br />
Monteuren in kürzester Zeit bei sehr niedriger<br />
Entlohnung, die kaum ausreichte für<br />
notwendige Nahrung zu sorgen, realisiert<br />
wurden. Nach den Aufräumungsarbeiten<br />
und der Wiederherstellung der zerstörten<br />
Verbindungen wurde am 25.10.1945 das<br />
Altstadtwasserkraftwerk (an der Altstadtbrücke)<br />
mit einer Leistung von 135-155<br />
kW wieder in Betrieb genommen.<br />
Gleichzeitig nahmen sich die Stadtwerke<br />
des von Baron Kittlitz verlassenen, kleinen<br />
Wasserkraftwerkes in Bremenhain bei Lodenau<br />
an der Neiße an, welches durch den<br />
Krieg stark gelitten hatte. Die Stromversorgung<br />
wurde hier am 19.2.1945 eingestellt,<br />
seitdem schon seit dem 4.2.1945 jeglicher<br />
Telefonverkehr unterbrochen war und<br />
der Ort Lodenau, von allen Einwohnern<br />
geräumt werden musste. Dieses Werk<br />
war an das 10-KV-Stadtwerkenetz angeschlossen,<br />
versorgte aber selbst nur einige<br />
ländliche Orte über eine 3-KV-Leitung.<br />
Einige Einwohner von Lodenau die auch<br />
über dieses Netz versorgt wurden, halfen<br />
sich zunächst selbst. Besondere Verdienste<br />
erwarb der spätere Maschinenwärter<br />
Knebel dieses Werkes, indem er auf eigene<br />
Initiative in unmittelbarer Nähe des Was-<br />
anzeige<br />
24<br />
Geschichte
nach dem 7. Mai 1945<br />
Energieversorgung<br />
serkraftwerkes vergrabene Mienen suchte<br />
und entfernte. Dabei hat er eine Hand eingebüßt.<br />
Nachdem ab dem 30.6.1945 das<br />
Gelände entmint war, wurde unter Leitung<br />
des Lodenauer Elektromeisters Kirst die<br />
Reinigung und Widerherstellung des Werkes<br />
vorgenommen. Am 18.7.1945 konnte<br />
die Stromversorgung aus diesem Wasserkraftwerk<br />
wieder aufgenommen werden.<br />
Anmerkung:<br />
Der Betrieb des Wasserkraftwerkes musste<br />
aber des öfteren unterbrochen werden, da<br />
Angehörige der Roten Armee mit Tellerminen<br />
und Granaten im Bereich des Kraftwerkes<br />
Fische fingen und es dadurch zu Erschütterungen<br />
der Fundamente des Kraftwerkes<br />
kam. Durch eine Beschwerde bei den sowjetischen<br />
Dienststellen konnte gegen dieses<br />
Vorgehen Abhilfe geschaffen werden.<br />
Eine weitere unumgängliche Aufgabe<br />
bestand nun darin, eigene Transportmittel<br />
anzuschaffen, eine Fahrzeugwerkstatt<br />
aufzubauen und eine Transportkolonne zu<br />
etablieren, um Geräte und Baumaterialen<br />
transportieren zu können. Man fand ein<br />
LKW-Wrack, welches wieder fahrbereit gemacht<br />
werden konnte. Auf ähnliche Weise<br />
wurden aus Trümmern einige Fahrräder, 3<br />
PKWs und 6 LKWs instand gesetzt, von denen<br />
immer 1-2 Fahrzeuge fahrbereit waren.<br />
Desweiteren wurde eine neue Schlosserwerkstatt<br />
eingerichtet. Diese wurde<br />
ausgestattet mit geborgten Werkzeugmaschinen,<br />
Flaschenzügen, Steigeisen, Zangen<br />
und verschiedenen anderen Werkzeugen.<br />
Verschiedene Hilfsmittel sind von<br />
Hand selbst angefertigt worden. Dadurch<br />
konnten Schlosser und Arbeiter mit den<br />
inzwischen fahrbereiten LKWs notwendige<br />
Hilfstransporte und auch Reparaturen<br />
für die Landbevölkerung vornehmen, damit<br />
diese die notwendigen Reparaturen<br />
an Maschinen und Geräten für die Herbstbestellung<br />
1945 realisieren konnten und<br />
damit einsatzbereit machten.<br />
Eine besondere Herausforderung ergab<br />
sich für die Zählerabteilung (Zählerwerkstatt),<br />
die sich im Neißewerk befand und<br />
leider aufgegeben werden musste. Diese<br />
Kollegen wurden zunächst zur Beseitigung<br />
kleinerer Störungen im Stadtnetz<br />
eingesetzt. Obwohl diese Kollegen mit<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
25
Der Wiederaufbau der Energieversorgung der Stadtwerke Görlitz<br />
Ausweispapieren der Kommandantur nur<br />
für Arbeiten des E-Werkes ausgestattet<br />
waren, kam es oft vor, dass diese von sowjetischen<br />
Soldaten für andere Arbeiten<br />
eingesetzt wurden und damit für Arbeiten<br />
des E-Werkes nicht zur Verfügung standen.<br />
Einige Straßen in Görlitz wurden von der<br />
Roten Armee und ihren Angehörigen besetzt.<br />
Das waren unter anderem der obere<br />
Teil der Bahnhofstraße, Seydewitz- Straße<br />
(Carl-von-Ossietzki-Straße), Goethe-Straße<br />
und weitere. Besonders in diesem Gebiet<br />
kamen die Messeinrichtungen (Zähler)<br />
durch Überbelastung und unsachgemäße<br />
Eingriffe zu Schaden. Im Zuge der späteren<br />
Besetzung von weiteren Straßen durch<br />
die Rote Armee wurden in diesen Grundstücken<br />
vorsorglich die Zähler ausgebaut.<br />
Als dann aber Mitte Juni 1945 das Neißewerk<br />
nicht mehr zugänglich war, ergaben<br />
sich erst die größten Schwierigkeiten<br />
für die Zählerwerkstatt. Der Verlust der<br />
Zählerwerkstatt mit ihren Prüf- und Messeinrichtungen<br />
für Gleich-, Wechsel- und<br />
Drehstrom machte eine Überprüfung und<br />
Reparatur der Zählereinrichtungen fast<br />
unmöglich. Bevor neue Zähler eingebaut<br />
wurden, konnten selbige nur grob auf<br />
Anlauf überprüft werden. Wechsel- und<br />
Drehstromzähler wurden auf Spannungsspulenunterbrechung<br />
der einzelnen Triebsysteme<br />
und eventuell auf Leerlauf geprüft.<br />
Der Landeinsatz gestaltete sich jedoch<br />
schwieriger. Die Eisenbahn fuhr noch<br />
nicht. Autos gab es weder privat noch in<br />
den Kommunalbetrieben, Fahrradfahren<br />
war wegen Beschlagnahme riskant. Erst<br />
nach Wochen erfolgte der Einsatz mittels<br />
LKW. Als Ende Juli 1945 die Eisenbahn<br />
wieder fuhr, erfolgte der Einsatz der Zählerabteilung<br />
bei den Vertragsabnehmern<br />
wie bei den Elektrizitätsgenossenschaften<br />
der Ortschaften und Vertragshändlern. Im<br />
Gebiet Niesky wurden durch die Kriegseinwirkungen<br />
besonders große Schäden<br />
an den Messeinrichtungen festgestellt,<br />
zum Teil waren diese ganz verschwunden.<br />
Im Herbst 1945 konnte in den Räumen<br />
des Gaswerkes Görlitz wieder eine eigene<br />
Zählerabteilung eingerichtet werden.<br />
Für diese Werkstatt gelang es, weitere<br />
Prüfgeräte teils auch als Leihgaben anzuschaffen.<br />
Ende des Jahres 1946 wurde eine<br />
anzeige<br />
26<br />
Geschichte
nach dem 7. Mai 1945<br />
Energieversorgung<br />
Isolationsprüfeinrichtung bis 2000 Volt für<br />
Gleich-, Wechsel- und Drehstromzähler<br />
fertiggestellt.<br />
Da sich nunmehr die Abtrennung der<br />
Ostseite an das polnische Gebiet abzeichnete,<br />
ging man nun dazu über, 1946 die<br />
Stromverteilung den nunmehr unveränderlichen<br />
Versorgungsverhältnissen anzupassen,<br />
die sich aus der Zerschneidung in<br />
Görlitz Ost und West ergeben hatten. Die<br />
verlaufende 40-KV-Leitung von Hirschfelde,<br />
die bei Deutsch Ossig von deutscher<br />
Seite über die Neiße auf polnisches Gebiet<br />
verlief, wurde angezapft und ab Deutsch<br />
Ossig neu auf der deutschen Seite zum<br />
Umspannwerk am Wasserwerk verlegt.<br />
Gleichermaßen wurde eine 40-KV-Leitung<br />
auf Holzportalmasten von Deutsch Ossig<br />
zum Umspannwerk Niesky über 34 km neu<br />
gebaut, so dass das Umspannwerk Niesky<br />
die Überlandversorgung im Norden wieder<br />
aufnehmen konnte. Dadurch konnte<br />
eine wesentliche Spannungsverbesserung<br />
erreicht werden. Gleichermaßen entstand<br />
1947 eine neue 10-KV-Leitung parallel zur<br />
B 99 vom Wasserkraftwerk Deutsch Ossig<br />
zum Umspannwerk im Wasserwerk. Das<br />
Umverlegung der 40-KV-Leitung auf deutscher<br />
Seite bei Deutsch Ossig zum Umspannwerk<br />
Weinhübel/Wasserwerk und Errichtung einer<br />
Abzweigung 10-KV-Leitung auf Holzportalmasten<br />
zum Umspannwerk Niesky.<br />
Wasserkraftwerk Deutsch Ossig hatte eine<br />
Leistung von 375 KW.<br />
Das bisherige Hilfsumspannwerk Wein-<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
27
Der Wiederaufbau der Energieversorgung der Stadtwerke Görlitz<br />
Lageplan Umspannwerk im Wasserwerk um 1951 (Abb.: Archiv Hans Steifa Schönau Berzdorf)<br />
hübel am Wasserwerk wurde nun durch<br />
Umbau und Erweiterung zum Hauptumspannwerk<br />
für Görlitz. Als weitere Maßnahmen<br />
konnte das 3-KV-Stromnetz von<br />
Lodenau nach Steinbach auf 10-KV umgebaut<br />
und direkt an das stadteigene<br />
Landnetz mit angeschlossen werden. Die<br />
Betriebsfernsprechleitungen konnten wieder<br />
hergestellt und erweitert werden.<br />
Mit zunehmend besserer Materialversorgung<br />
und deren Beschaffungsmöglichkeiten<br />
wurden die Arbeiten an den Netzen,<br />
deren Erweiterung zügig fortgeführt.<br />
Durch die Einführung der Investitionsplanung<br />
gab es Verzögerungen und Unterbrechungen,<br />
so dass in Görlitz in Bezug<br />
auf Zweckmäßigkeit und Umfang der Verteilungseinrichtungen<br />
der Vorkriegsstand<br />
noch nicht erreicht werden konnte.<br />
Nun bestand eine wichtige Aufgabe darin,<br />
die Arbeits- und Lebensbedingungen<br />
der Beschäftigten zu verbessern. Das Zusammenführen<br />
vieler Spezialkräfte und<br />
Arbeiter machte es nötig, für eine einheitliche<br />
Verpflegung zu sorgen, denn vielen<br />
Beschäftigten war die Beschaffung von<br />
Lebensmitteln und deren Zubereitung<br />
unmöglich. Zuteilungen über amtliche<br />
Stellen gab es nicht. Findige Köpfe des<br />
Unternehmens gründeteten 1945 eine<br />
Werksküche. Am Anfang wurden in unregelmäßigen<br />
Abständen warme Getränke<br />
und Suppen verabreicht. Zwischenzeitlich<br />
konnten im Herbst 1945 Gemüse und Kartoffeln<br />
beschafft werden. Daraus hat sich<br />
dann im Laufe der Zeit eine Werksküche<br />
entwickelt, die von den Beschäftigten<br />
gern in Anspruch genommen wurde, die<br />
28<br />
Geschichte
nach dem 7. Mai 1945<br />
Energieversorgung<br />
auch jetzt noch besteht (1975) und für wenig<br />
Geld eine regelmäßige Mittagsmahlzeit<br />
zur Verfügung stellen kann.<br />
In dieser Zeit war das Bestreben der Stadtwerker<br />
stets, die Energieversorgung für<br />
die Bürger der Stadt zu sichern. Gemeinschaftssinn<br />
und Verantwortung für die<br />
Bürger unserer Stadt waren deren oberste<br />
Maxime, denn viele der arbeitenden<br />
Männer hatten nicht mehr im Besitz, als<br />
das was sie am eigenen Leibe trugen, weil<br />
sie oft selbst Flüchtlinge oder Heimkehrer<br />
waren. Vielen konnte durch Kleidungsspenden<br />
und Wohnungszuweisungen geholfen<br />
werden. Es wurden aber auch Geldbeträge<br />
zur Unterstützung bereitgestellt.<br />
Das Gemeinschaftsgefühl hat die Stadtwerker<br />
stets in den schwierigsten Zeiten<br />
der letzten Vergangenheit zusammengehalten<br />
und im Einsatz immer zum frohen<br />
Schaffen im Sinne des Wiederaufbaus und<br />
der Allgemeinheit angespornt.<br />
Die fortschrittlichen Kräfte, die aus den<br />
Kreisen der Belegschaft als Betriebsleiter<br />
und Betriebsrat hervorgegangen waren,<br />
sind stets bemüht gewesen, die Stadtwerke<br />
zu dem zu machen, was die Stadtwerke<br />
sein sollten, nämlich ein Werk im Dienste<br />
der Allgemeinheit. Diesem Anspruch sind<br />
die Stadtwerke bis heute (2021) stets treu<br />
geblieben.<br />
(Fortsetzung folgt)<br />
Wolfgang Stiller<br />
Erratum: In unserer Dezemberausgabe <strong>StadtBILD</strong>, mit<br />
dem Titel „Verdienstvoller Mediziner Karl Gustav Kahlbaum“,<br />
muss es auf der Seite 47 Kolumne 1, Zeile 8<br />
richtig heißen. Innerhalb Deutschlands brachte sich Dr.<br />
Kahlbaum als Wegweiser der modernen Psychiatrie…<br />
Impressum:<br />
Herausgeber (V.i.S.d.P.):<br />
<strong>StadtBILD</strong>-Verlag<br />
eine Unternehmung der<br />
incaming media GmbH<br />
vertreten durch den Geschäftsführer<br />
Andreas Ch. de Morales Roque<br />
Mitglied im Deutschen Fachjournalistenverband<br />
Carl-von-Ossietzky-Straße 45 | 02826 Görlitz<br />
Tel. 03581 87 87 87 | Fax: 03581 40 13 41<br />
E-Mail: info@stadtbild-verlag.de<br />
Shop: www.stadtbild-verlag.de<br />
Bankverbindung:<br />
IBAN: DE21 8504 0000 0302 1979 00<br />
BIC: COBADEFFXXX<br />
Geschäftszeiten:<br />
Mo. - Fr. von 9.00 bis 16.00 Uhr<br />
Druck:<br />
Graphische Werkstätten Zittau GmbH<br />
Erscheinungsweise: monatlich<br />
Redaktion & Inserate:<br />
Andreas Ch. de Morales Roque<br />
Kathrin Drochmann<br />
Dipl. - Ing. Eberhard Oertel<br />
Bertram Oertel<br />
Layout:<br />
Kathrin Drochmann<br />
Lektorat:<br />
Wolfgang Reuter, Berlin<br />
Teile der Auflage werden kostenlos verteilt, um<br />
eine größere Verbreitungsdichte zu gewährleisten.<br />
Für eingesandte Texte & Fotos übernimmt der Herausgeber<br />
keine Haftung. Artikel, die namentlich<br />
gekennzeichnet sind, spiegeln nicht die Auffassung<br />
des Herausgebers wider. Anzeigen und redaktionelle<br />
Texte können nur nach schriftlicher Genehmigung<br />
des Herausgebers verwendet werden.<br />
Redaktionsschluss:<br />
Für die nächste Ausgabe (Februar)<br />
ist am 15.01.<strong>2022</strong><br />
Geschichte<br />
29
Höhere Mindestlöhne ab <strong>2022</strong> beachten<br />
ETL-Steuerberatung<br />
Sie sind nicht nur Unternehmer, sondern auch Arbeitgeber? Dann müssen Sie den ab<br />
dem 1. <strong>Januar</strong> <strong>2022</strong> geltenden höheren Mindestlohn von 9,82 Euro brutto pro Zeitstunde<br />
(ab dem 1. Juli <strong>2022</strong> 10,45 Euro) oder einen zum 1. <strong>Januar</strong> <strong>2022</strong> gestiegenen Branchentariflohn<br />
beachten. Insbesondere wenn Sie Mini-Jobber beschäftigen, die monatlich 450 Euro<br />
verdienen und deren Stundenlohn derzeit unter dem ab 2021 geltenden Mindestlohn liegt,<br />
besteht Handlungsbedarf.<br />
Damit die Geringfügigkeitsgrenze von 450 Euro nicht überschritten wird, müssen Sie die<br />
Verträge mit Ihren Mini-Jobbern anpassen. Ansonsten wird der Mini-Job zum sozialversicherungspflichtigen<br />
Beschäftigungsverhältnis. Zudem verstoßen Sie gegen das Mindestlohngesetz<br />
oder einen Branchentarifvertrag. Und es reicht auch nicht aus, 450 Euro pro Monat<br />
zu vereinbaren und dann „auf Abruf“ die Stunden abzuleisten.<br />
Eine „Arbeit auf Abruf“ ist zwar in vielen Branchen durchaus üblich, sie hat aber auch ihre<br />
Tücken. Achten Sie daher stets darauf, dass eine Wochenarbeitszeit vertraglich geregelt ist.<br />
Denn im Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) wird geregelt, dass zum Schutz der Arbeitnehmer<br />
eine Arbeitszeit von 20 Stunden pro Woche als vereinbart gilt, wenn die wöchentliche<br />
Arbeitszeit vertraglich nicht festgelegt ist. Haben Arbeitgeber und Mini-Jobber keine<br />
konkrete Wochenarbeitszeit vereinbart, besteht daher dringender Handlungsbedarf. Regelmäßig<br />
ergibt sich ein durchschnittlicher Monatsverdienst von mehr als 450 Euro, wenn<br />
eine Arbeitszeit von 20 Stunden pro Woche unterstellt wird (20 Stunden x 13 Wochen / 3<br />
Monate x 9,82 Euro = 851,07 Euro ab 1. <strong>Januar</strong> <strong>2022</strong> bzw. sogar 905,67 Euro ab 1. Juli <strong>2022</strong>).<br />
Nutzen Sie daher die verbleibende Zeit, um entsprechende Änderungsvereinbarungen abzuschließen.<br />
Bitte beachten Sie, dass Sie in einem Mini-Job nicht mehr als 45,5 Stunden pro<br />
Monat (45,82 x 9,82 Euro = 450,00 Euro) vereinbaren, ab Juli <strong>2022</strong> sogar nur noch 43 Stunden<br />
(43,06 x 10,45 Euro = 450,00 Euro). Angesichts dieser relativ geringen Monatsstundenzahl<br />
könnte in dem einen oder anderen Fall auch eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit im<br />
sogenannten Übergangsbereich die bessere Alternative sein. Ob und wenn ja ab wann die<br />
Minijob-Grenze tatsächlich von 450 Euro auf die im Rahmen der Sondierungsgespräche der<br />
potenziellen Koalitionspartner genannten 520 Euro angehoben wird, ist derzeit ungewiss.<br />
30<br />
Autor: Ulf Hannemann, Freund & Partner GmbH (Stand: 04.11.2021)<br />
Ratgeber | Anzeige