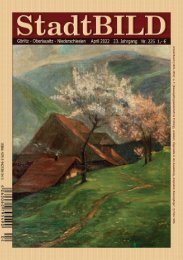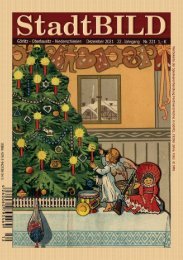Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Das Motiv (Altstadt mit Nikolaiturm und Peterskirche) auf unserer Titelseite finden Sie in unserem neuen Günter Hain Kalender 2022/23.
Liebe Leserinnen, liebe Leser,<br />
Vorwort<br />
Eine Stadt wie Görlitz ist ein lebendes Geschichtsbuch.<br />
Bald in jedem Haus, an jeder Ecke hat sich irgend etwas<br />
abgespielt, hat jemand von Bedeutung gewohnt oder<br />
gearbeitet. Mal waren Mensch oder Ereignis wichtiger,<br />
mal weniger bedeutend. Die Einschätzung hängt immer<br />
auch vom jeweiligen Betrachter und der Sicht einer<br />
Zeit ab. Wenn man will, dann braucht man nur ein<br />
wenig an der Fassade der heutigen Stadt zu kratzen,<br />
und schnell kommt ihre Geschichte zum Vorschein.<br />
Eine Stadt lebt von ihrer Vergangenheit, sie sollte auch<br />
mit ihrer Vergangenheit leben. Die Erinnerung an bekannte<br />
Familien und Persönlichkeiten, deren Ruhestätten<br />
sich auf Görlitzer Friedhöfen befinden, lassen<br />
einen wichtigen Teil unserer Stadtgeschichte lebendig<br />
werden.<br />
Auf dem Städtischen Friedhof Görlitz gibt es zahlreiche<br />
Grabanlagen aus verschiedenen Kriegen, insbesondere<br />
die des Ersten Weltkrieges ist eindrücklich. Einmalige<br />
Ereignisse in der Weltgeschichte hatten dazu geführt,<br />
dass zwischen 1916 und 1919 über 7.000 Soldaten<br />
und Offiziere des IV. Griechischen Armeekorps in Görlitz<br />
lebten. Viele von ihnen starben an den Folgen von<br />
Krankheiten, insbesondere der Spanischen Grippe. Im<br />
Laufe mehrerer Jahre ist eine interessante Gedenkanlage<br />
entstanden, in der noch sieben Grabmale erhalten<br />
sind, unter anderem das des Oberst Chatzopulos.<br />
Ein ganz kleiner Mann mit ganz großem Geist voller<br />
Görlitzer Stadtgeschichte ist am 4. Dezember 2020<br />
von uns gegangen. Zahlreiche Publikationen und Ausstellungen<br />
sowie seine Vortragstätigkeit haben ihn<br />
bekannt gemacht und weisen ihn als Kenner der Geschichte<br />
der Stadt aus. Nun soll Ernst Kretzschmar am<br />
13. <strong>November</strong>, dem Vortag des Volkstrauertages, auf<br />
dem Friedhof mit einer eigenen Gedenkplatte besonders<br />
gewürdigt werden. Evelin Mühle (EB Städtischer<br />
Friedhof Görlitz) wird die Platte bei Ihrer Friedhofsführung<br />
am 13. <strong>November</strong> einweihen.<br />
„Zu guter Letzt“, so lautet eine ungewöhnliche Ausstellung<br />
zum (Weiter)leben.<br />
Die Erinnerung an geliebte Menschen zu erhalten – das<br />
war und ist zu allen Zeiten ein wichtiges Bedürfnis für<br />
Familien und Freunde. Früher fertigte man dafür gern<br />
kleine Kunstwerke an. Der Städtische Friedhof Görlitz<br />
erwarb von einem Sammler eine solche Kollektion von<br />
etwa 280 Bildern und Stücken, die eine verschwundene<br />
Kultur des Umgangs mit Leben und Tod, Gedenken und<br />
Erinnern, Ermahnen wie Erfreuen bezeugen. Die angekauften<br />
Exponate stammen aus dem 19. und 20. Jahrhundert<br />
und hingen ursprünglich in Wohnungen oder<br />
fanden bei Trauerzeremonien Verwendung. Sie geben<br />
Einblick in ein kaum bekanntes und wenig erforschtes<br />
Gebiet der individuellen, privaten Trauerkultur. Die<br />
Formen des Erinnerns an Verstorbene waren dabei vielfältig.<br />
Und was ist heute? Wie trauern wir heute? Was<br />
kann heute helfen? Die Exponate werden in der Alten<br />
Feierhalle auf dem Städtischen Friedhof in einer Dauerausstellung<br />
präsentiet. Im Frühjahr oder Frühsommer<br />
2022 ist Eröffnung. Dann wird es zwischen Frühjahr<br />
und Herbst - die Halle ist nicht beheizbar - Führungen<br />
geben. Evelin Mühle und Matthias Wenzel jedenfalls<br />
haben dann eine ganze Menge zu erzählen. Um das<br />
alles Umzusetzen ist der EB Städtischer Friedhof Görlitz<br />
auf Spenden angewiesen. Mit Spendengeldern und<br />
Sponsoren investiert der Friedhof gezielt in die Ausstellung,<br />
die anders nicht realisierbar wäre.<br />
Auch unser <strong>StadtBILD</strong>-Verlag wird noch einmal ausführlich<br />
auf die Ausstellung „Zu guter Letzt“ aufmerksam<br />
machen.<br />
Ihr Team vom <strong>StadtBILD</strong>-Magazin<br />
anzeige<br />
Einleitung<br />
3
Kriegsgräber in Görlitz –<br />
in Görlitz<br />
Friedhöfe sind aufgeschlagene Geschichtsbücher<br />
…<br />
Und so ist es nicht verwunderlich, dass<br />
besonders die Kriege ihre Spuren auf ihnen<br />
hinterlassen haben. Auf dem Städtischen<br />
Friedhof gibt es zahlreiche Grabanlagen<br />
aus verschiedenen Kriegen,<br />
Kampfhandlungen und politischen Auseinandersetzungen.<br />
Sie spiegeln die deutsche<br />
Geschichte wider und die der Stadt<br />
im Besonderen.<br />
Der Städtische Friedhof wurde 1847 angelegt,<br />
die ältesten Grabanlagen befinden<br />
sich um die Alte Feierhalle herum, direkt<br />
oberhalb des Nikolaikirchhofes. Mit der<br />
Bestattung von Gottlob Ludwig Demiani<br />
wurde im Dezember 1847 der Friedhof<br />
eröffnet. Schon wenige Jahre später, 1867<br />
und 1904 ließ die Stadt den im Preußisch-<br />
Österreichischen Krieg (1966) und im<br />
Deutsch-Französischen Krieg (1870/71)<br />
gefallenen und in Lazaretten verstorbenen<br />
Soldaten Denkmale errichten. Zuerst<br />
der große, helmgeschmückte, beeindruckende<br />
Obelisk aus Sandstein, später die<br />
Grabsteine für 144 Preußen, 9 Franzose, 4<br />
Sachsen und 34 Österreicher. Die Anlage<br />
befindet sich auf dem Alten Friedhofsteil,<br />
unweit der Grabstelle der Minna Herzlieb.<br />
Leider ist die Oberfläche des großen Obelisken<br />
in Teilen bereits stark verwittert.<br />
Die Spuren des 1. Weltkrieges sehen wir<br />
eindrucksvoll in einem Gräberfeld auf dem<br />
neuen Friedhofsteil. 471 Männer aus ganz<br />
Deutschland wurden hier bestattet. Den<br />
Mittelpunkt bildet die Denkmalanlage als<br />
4<br />
Geschichte
eine unvollständige Analyse<br />
Kriegsgräber in Görlitz<br />
monumentales Mahnmal. Es hat eine interessante<br />
Geschichte: bereits 1920 wurde<br />
begonnen, in Görlitzer Vereinen und der<br />
Bürgerschaft Geld zu sammeln für eine Gedenkanlage.<br />
Groß und mächtig sollte sie<br />
werden – aber das gesammelte Geld war<br />
durch die Inflation wertlos geworden. Militär-<br />
und Kriegervereine begannen nach<br />
Herstellung stabiler Finanzverhältnisse<br />
erneut zu sammeln. Die Görlitzer Architekten<br />
Kreidel und Pantke entwarfen die<br />
Pläne und die Firmen Maiwald (Bauunternehmer)<br />
und Däunert (Steinmetzarbeiten)<br />
realisierten das Projekt. Die Einweihung<br />
am 30. Mai 1926 beschäftigte die „Görlitzer<br />
Nachrichten“ mehrere Tage lang, ein<br />
großes Ereignis. Es existieren Fotos von<br />
Robert Scholz; sie zeigen junge Mädchen<br />
und Frauen in weißen Kleidern, daneben<br />
die Honoratioren der Stadt, im Hintergrund<br />
die fahnenschwenkenden Militärund<br />
Kriegervereine. … Nicht mehr lange<br />
bis 1933.<br />
Auch in die Zeit des 1. Weltkrieges gehört<br />
die besondere Geschichte der Griechen in<br />
Görlitz. Im September 1916 waren über<br />
7.000 Griechen in Eisenbahnwaggons in<br />
die Stadt gekommen. Das IV. Griechische<br />
Armeekorps sollte hier politisches Asyl<br />
erhalten und wurde herzlich willkommen<br />
geheißen. Interessante Begebenheiten<br />
müssen sich zugetragen haben, so kann<br />
man es zumindest den damaligen Zeitungen<br />
entnehmen. Seit der Wende haben<br />
sich griechische und deutsche Historiker<br />
und Militärforscher mit dieser einmaligen<br />
Nebengeschichte des 1. Weltkrieges beschäftigt.<br />
Zeitgleich mit dem Aufenthalt der Griechen<br />
von 1916 bis 1919 grassierte die Spanische<br />
Grippe in Görlitz, in Europa, in der<br />
Welt. 133 griechische Soldaten, Offiziere,<br />
Mannschaftsangehörige verloren ihr Leben<br />
und fanden auf dem Neuen Friedhof<br />
ihre letzte Ruhestätte. Irgendwann gerieten<br />
die Gräber in Vergessenheit. Im wahrsten<br />
Sinne war Gras darüber gewachsen.<br />
Erst in den 90er Jahren wurden bei Aufräumungsarbeiten<br />
am Rand des Grabfeldes<br />
die 7 Obelisken gefunden, die heute in der<br />
griechischen Grabanlage zu sehen sind.<br />
Seit dem Auffinden der historisch wertvollen<br />
Steine gab es unzählige Begegnungen<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
5
Kriegsgräber in Görlitz –<br />
in Görlitz<br />
Beide Fotos: Grabanlage 1. Weltkrieg<br />
mit Griechen, Botschafter, Militärattachés,<br />
griechische Vereine, Mitglieder des Konsulats,<br />
Historiker, Presse, Fernsehen …<br />
Im Laufe mehrerer Jahre ist eine interessante<br />
Gedenkanlage entstanden, in der<br />
auch der 1918 verstorbene Oberst Chatzopulos<br />
seine letzte Ruhe fand.<br />
Aus dem 2. Weltkrieg gibt es 677 Gräber<br />
anzeige<br />
6<br />
Geschichte
eine unvollständige Analyse<br />
Kriegsgräber in Görlitz<br />
auf dem Städtischen Friedhof. Außerdem<br />
Gräber auf den Friedhöfen in Rauschwalde,<br />
Weinhübel, Kunnerwitz, Ludwigsdorf,<br />
Tauchritz und auf dem Jüdischen Friedhof.<br />
Fast in jeder Gemeinde im Umland befinden<br />
sich Kriegsgräber auf dem Friedhof<br />
oder in Parkanlagen, wie in Königshain.<br />
In vielen Kirchen und auf Denkmalen werden<br />
außerdem die Toten der jeweiligen<br />
Ortschaft auf Tafeln genannt. Die für die<br />
Kriegsgräber im Land Sachsen zuständige<br />
Landesdirektion für Familie und Soziales<br />
in Chemnitz registriert auf 142 Friedhöfen<br />
11.139 Kriegstote. Hinter den nüchternen<br />
Zahlen stecken dramatische Geschehnisse,<br />
traurige Familienschicksale, junge tote<br />
Männer.<br />
Die größte städtische Anlage ist mit 606<br />
Kriegstoten (deutsche Soldaten) auf dem<br />
Neuen Friedhof. Erst 1995 erhielt sie ein<br />
großes Holzkreuz als gemeinsames Denkmal.<br />
Vor einigen Jahren betteten wir die<br />
Urne mit den Ascheresten der Emma<br />
Schön in eine Nebenreihe. Sie ist ein Opfer<br />
der Euthanasie, starb in Pirna-Sonnenstein<br />
und wurde ursprünglich von der Familie<br />
in einem ganz normalen Urnenreihengrab<br />
Grabmal des Oberst Chatzopulos<br />
bestattet. Erst im Zusammenhang mit der<br />
Einebnung des Grabfeldes kam ihre Geschichte<br />
ans Licht und wir konnten den<br />
Namen den anderen Kriegstoten zufügen.<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
7
Kriegsgräber in Görlitz –<br />
in Görlitz<br />
Grabanlage 1. Weltkrieg<br />
Auch die Gräber verstorbener Zwangsarbeiter<br />
aus Polen und der damaligen Sowjetunion<br />
sind Zeugnisse eines traurigen<br />
Kapitels deutscher Geschichte. Wir finden<br />
sie auf dem Städtischen Friedhof und in<br />
Rauschwalde. Auf dem Jüdischen Friedhof<br />
ist den Opfern des Lagers Biesnitzer Grund<br />
eine Denkmalanlage gewidmet. Ein erster<br />
Gedenkstein stammt aus dem Jahr 1951,<br />
eine neue Anlage von 2015. Bei Friedhofsführungen<br />
auf dem Jüdischen Friedhof<br />
wird über sie berichtet.<br />
anzeige<br />
8<br />
Geschichte
eine unvollständige Analyse<br />
Kriegsgräber in Görlitz<br />
Griechische Grabanlage<br />
Und dann gibt es noch viele kleine Denkmal-<br />
und Gedenkanlagen, an denen an<br />
Kriegsopfer erinnert wird. Teilweise sind<br />
es rührende Geschichten, die sich im Laufe<br />
der Jahre in einer Friedhofsverwaltung<br />
ansammeln. Geschichte/n über die Frauen<br />
vom Postplatz oder die Bautzenopfer, über<br />
gesammelte Grabplatten und besondere<br />
Erinnerungsorte. Wir erzählen sie bei unseren<br />
Friedhofsführungen.<br />
Seit vielen Jahren gibt es immer am Tag vor<br />
dem Volkstrauertag eine Friedhofsführung<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
9
Kriegsgräber in Görlitz –<br />
in Görlitz<br />
zu den Kriegsgräbern des Städtischen<br />
Friedhofes. Sie heißt „Unvergessen“. Viele<br />
Jahre lang führten Dr. Kretzschmar mit mir<br />
zusammen, egal bei welchem Wetter. Gerade<br />
diese Führung war ihm immer wichtig.<br />
Selbst seit vielen Jahren Mitglied im<br />
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge<br />
e. V., war es ihm immer ein Anliegen, die<br />
Geschichte weiterzugeben. Immer war<br />
ihm gerade auch die Nennung der Frauen,<br />
der Mütter und Ehefrauen wichtig, die so<br />
viel erdulden mussten. Und immer war es<br />
auch Mahnung: Nie wieder Krieg!<br />
Am 4. Dezember 2020 ist Dr. Kretzschmar<br />
gestorben. Im Januar wurde seine Urne in<br />
einer Urnengemeinschaftsanlage beigesetzt,<br />
genauso wie er es sich gewünscht<br />
hatte. Die Grabanlage befindet sich nahe<br />
der Kriegsgräber des 1. Weltkrieges, ein<br />
Ort, der ihm wichtig war. Durch Spenden<br />
war es möglich, eine persönliche Gedenkplatte<br />
zu finanzieren. Sie soll bei der Führung<br />
am 13.11.<strong>2021</strong> eingeweiht werden.<br />
Grabstein eines gefallenen Soldaten<br />
„Unvergessen!“ - Friedhofsführung zum<br />
Volkstrauertag<br />
Sonnabend, 13. <strong>November</strong>, 14:00 Uhr<br />
Treff: Freitreppe am Krematorium<br />
anzeige<br />
10<br />
Geschichte
eine unvollständige Analyse<br />
Kriegsgräber in Görlitz<br />
Dr. Ernst Kretzschmar (verstorben am 4. Dezember 2020) Foto: Städtischer Friedhof<br />
Es wird um Spenden für den Volksbund<br />
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. gebeten.<br />
Evelin Mühle, EB Städtischer Friedhof GR,<br />
Schanze 11 b, 02826 Görlitz, 28.10.<strong>2021</strong><br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
11
1585 – Die Pest in Görlitz<br />
950 Jahre Zukunft<br />
Bildnis des Bartholomäus Scultetus, Holzschnitt von Wendel<br />
Scharffenbergk, Foto: Kulturhistorisches Museum Görlitz<br />
Bis vor zwei Jahren glaubten<br />
wir kaum an die Möglichkeit<br />
einer Pandemie. Hygiene und<br />
Fortschritt schienen solcherart<br />
Gefahren in weite Ferne<br />
gerückt zu haben. Doch Anfang<br />
2020 begannen von<br />
Wuhan in China aus SARS<br />
COVID 19-Erreger ihren Siegeszug<br />
rund um den Erdball.<br />
Trotz moderner Medizin verloren<br />
Millionen Menschen ihr<br />
Leben.<br />
In den Städten des Mittelalters<br />
gehörten Epidemien regelmäßig<br />
zum menschlichen Leben<br />
dazu. Die tödlichste – die<br />
Pest, auch als Schwarzer Tod<br />
bezeichnet – führte zwischen<br />
1347 bis 1353 zu etwa 125 Millionen<br />
Todesfällen in Europa.<br />
In manchen dicht besiedelten<br />
Landstrichen starben bis zu<br />
drei Viertel der Bevölkerung.<br />
Görlitz wurde von dieser Pestwelle<br />
nicht getroffen. Fatale<br />
Folge aber war trotzdem die<br />
anzeige<br />
12 Geschichte
1585 – Die Pest in Görlitz<br />
950 Jahre Zukunft<br />
Landkarte der Oberlausitz von Bartholomäus Scultetus 1593, Foto: Kulturhistorisches Museum Görlitz<br />
Vertreibung der jüdischen Familien im<br />
Jahr 1348 aus der Stadt.<br />
Aus den Ratsannalen wissen wir von<br />
zahlreichen Pestwellen. Allein sechs Mal<br />
wurde die Stadt im 15. Jahrhundert heimgesucht,<br />
so 1425, 1431, 1454, 1464, 1484<br />
und 1496. Weitere folgten in den Jahren<br />
1508 und 1521. Allerdings ist nicht immer<br />
sicher, ob es der Schwarze Tod war, der<br />
in Görlitz wütete oder ob es sich um eine<br />
andere hochansteckende Krankheit wie<br />
Typhus handelte. Zudem erscheinen die<br />
verzeichneten Todeszahlen nicht immer<br />
realistisch. 1521 sollen 1.600 Menschen in<br />
der Stadt verstorben sein. Belege fehlen<br />
jedoch. Anders sieht es mit der Epidemie<br />
im Jahre 1585 aus. In diesem Jahr dokumentierte<br />
der Ratsherr, Mathematiker,<br />
Astronom und Landmesser Bartholomäus<br />
Scultetus (1549 – 1614) den Verlauf der<br />
Krankheit und verzeichnete die Todesfälle<br />
in den sogenannten Pestzetteln. Diese<br />
sind zwar in Görlitz leider nicht mehr<br />
überliefert, wurden aber von dem Historiker<br />
Richard Jecht im Jahr 1933 für einen<br />
Artikel im Neuen Lausitzischen Magazin<br />
ausgewertet. Dieser ist Grundlage der folgenden<br />
Betrachtungen.<br />
Bereits im Sommer 1585 waren Pestfälle<br />
in Bautzen bekannt geworden. Von dort<br />
hatte eine Händlerin die Krankheit nach<br />
Görlitz verschleppt. Erste Opfer waren am<br />
14. August Thorsara und Valten Stolle, ein<br />
Ehepaar. Sofort fällte der Görlitzer Rat die<br />
Geschichte<br />
13
1585 – Die Pest in Görlitz<br />
950 Jahre Zukunft<br />
Entscheidung, die Kirmes abzusagen. Boten<br />
wurden ins Umland und zu befreundeten<br />
Städten gesandt, um über den<br />
Ausbruch der Krankheit in Görlitz zu informieren.<br />
Bereits am 3. September wurde<br />
das Gymnasium geschlossen. Immerhin<br />
lernten hier fast 600 Knaben nicht nur<br />
aus Görlitz, sondern aus der gesamten<br />
Oberlausitz, dem angrenzenden Böhmen<br />
und Schlesien. Wenige Tage später wurde<br />
das Verbot erlassen, auswärtige Besucher<br />
im Haus aufzunehmen und die Badestuben<br />
wurden geschlossen. Hochzeiten<br />
blieben zwar erlaubt, aber die Benutzung<br />
des großen Tanzsaales im Salzhaus wurde<br />
verboten. So regulierte man die Anzahl<br />
der Gäste bei Festlichkeiten. Gleichzeitig<br />
erteilte der Rat den Befehl, dass die<br />
Stadtgutbesitzer weiterhin ihre Waren<br />
auf den städtischen Markt zu bringen hatten,<br />
um die Versorgung der Bevölkerung<br />
mit Lebensmitteln nicht zu gefährden.<br />
Mit unserem heutigen Wissen über Corona<br />
erscheinen uns diese Anweisungen<br />
als notwendig und äußerst vernünftig.<br />
Für die Angestellten der Stadtverwaltung,<br />
die mit den Kranken zu tun hatten,<br />
wurden zwei Stuben in der Bastei hinter<br />
dem Marstall errichtet. Hier mussten der<br />
Prädikant (Prediger) und der Bader hausen.<br />
Für Kranke, die nicht zu Hause gepflegt<br />
werden konnten, wurden auf der<br />
„Wüstge“, einem Gartengrundstück vor<br />
dem Finstertor, Hütten errichtet, „damit<br />
die Kranken umso besser versorget werden<br />
können“.<br />
Wohnhäuser, in denen sich Infizierte aufhielten,<br />
markierte der Rat mit weißen<br />
Brettchen, auf die schwarze Kreuze gezeichnet<br />
waren.<br />
Die Zunftältesten bestellte man ins Rathaus,<br />
um ihnen Instruktionen für das Verhalten<br />
in Krankheitszeiten zu geben. Dieses<br />
hatten sie an ihre Mitmeister weiter zu<br />
reichen.<br />
Am 8. Oktober fand die letzte Ratssitzung<br />
im Rathaus statt. Die meisten Mitglieder<br />
dieses Gremiums hatten jedoch die Stadt<br />
schon verlassen. Viele reiche Bürger besaßen<br />
ganze Dörfer oder zumindest Dorfanteile.<br />
In den Gutshäusern waren sie weit<br />
weg von der dichten Besiedelung der<br />
Stadt, wo die Gefahr einer Ansteckung<br />
ungleich höher war als auf dem Lande.<br />
anzeige<br />
14 Geschichte
1585 – Die Pest in Görlitz<br />
950 Jahre Zukunft<br />
Ausschnitt aus der Stadtansicht 1565 von Joseph Metzker und Georg Scharffenbergk,<br />
Foto: Kulturhistorisches Museum Görlitz<br />
Das große Sterben nahm im September<br />
und Oktober 1585 Fahrt auf. Jetzt musste<br />
sogar der Weinkeller geschlossen werden,<br />
nachdem zwei Kellerjungen gestorben<br />
waren. Bei aller Vorsicht und Isolation der<br />
Kranken – auf die Gottesdienste wurde<br />
nicht verzichtet. So steckten sich weiterhin<br />
viele Menschen an. In mancher Wo-<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
15
1585 – Die Pest in Görlitz<br />
950 Jahre Zukunft<br />
Finstertor in Görlitz, Zeichnung von Johann Gottfried Schultz, Foto: Kulturhistorisches Museum Görlitz<br />
che, wie Anfang Dezember, starben bis zu<br />
272 Bürger. Der Totengräber schaffte mit<br />
seinen Gehilfen die Arbeit kaum noch,<br />
obwohl er fürstlich entlohnt wurde. Die<br />
psychische Belastung nahm bei ihm derart<br />
zu, dass er über die Maßen dem Alko-<br />
anzeige<br />
16<br />
Geschichte
1585 – Die Pest in Görlitz<br />
950 Jahre Zukunft<br />
hol zusprach. So musste er „ins Gewölbe“,<br />
gemeint ist das Gefängnis im Rathaus,<br />
gesetzt werden. Vor Weihnachten predigte<br />
der Pfarrer von der Kanzel, dass die<br />
Kranken bitte daheimbleiben mögen und<br />
die Vorstädter sollten sich der Christnacht<br />
fernhalten. Denn in den Vorstädten, besonders<br />
in der Nikolaivorstadt, wütete die<br />
Pest heftig. Bartholomäus Scultetus hatte<br />
beobachtet, dass in den dicht besiedelten<br />
Wohngegenden die Sterberate extrem<br />
hoch war. Vor dem Nikolaitor lebten vor<br />
dem Unglück in 227 Häusern 1471 Menschen.<br />
Nun waren 171 bewohnte Häuser<br />
von der Pest betroffen. Darin starben 739<br />
Bürger. Das heißt etwa die Hälfte der Einwohner<br />
der Nikolaivorstadt war tot. Im<br />
Vergleich zum Untermarkt werden soziale<br />
Unterschiede deutlich. Hier gab es 16<br />
bewohnte Gebäude mit 118 Bewohnern.<br />
In zwei Häusern waren Tote zu beklagen.<br />
Nur zwei Menschen starben. Die Bewohner<br />
waren vermutlich aufs Land geflohen<br />
oder hatten Unterschlupf bei Freunden in<br />
anderen Städten gefunden. Unser Stadtplan<br />
zeigt die Todesraten der einzelnen<br />
Straßen und Viertel farbig an.<br />
Als einer der wenigen Stadträte war Bartholomäus<br />
Scultetus seinen Pflichten als<br />
Ratsherr in dieser schweren Zeit nachgekommen.<br />
Er führte die Ratsrechnungen,<br />
nur er führte die Protokolle. Aber auch<br />
seine Familie war von der Pest betroffen,<br />
sein Stiefbruder und sein Neffe starben.<br />
Scultetus selbst nahm die Gevatterstelle<br />
beim Sohn des Büttners Israel Beyer<br />
an. Balzer Beyers beide Eltern verstarben<br />
während der Epidemie.<br />
Im Januar 1586 ließ die Macht der Krankheit<br />
rasch nach, so dass bereits im Februar<br />
das Gymnasium wiedereröffnet werden<br />
konnte und langsam Normalität in<br />
die Stadt einzog.<br />
Von den 9.096 Einwohnern von Görlitz<br />
waren von August 1585 bis Januar 1586<br />
genau 2.455 gestorben. Ein Viertel der<br />
Bevölkerung erlag demnach in Görlitz<br />
der Pest, innerhalb der Stadtmauer jeder<br />
Fünfte, außerhalb jeder Vierte. Die einzigartige<br />
Zusammenstellung der Toten von<br />
Bartholomäus Scultetus verdient heute<br />
große Beachtung. Zum ersten Mal lassen<br />
sich die unmittelbaren Lebensumstände<br />
mit Todesraten kombinieren. Er erbrachte<br />
Geschichte<br />
17
1585 – Die Pest in Görlitz<br />
950 Jahre Zukunft<br />
Vogelschauplan von Görlitz mit eingezeichneten Sterberaten, bearbeitet von Ines Haaser und<br />
Tino Liebchen<br />
(unbewusst) den Beweis. In den kleinen,<br />
dicht bewohnten Häuschen der Vorstädte<br />
war die Ansteckungsgefahr viel höher<br />
als in den Kaufmannspalästen rund um<br />
den Untermarkt oder in der Petersgasse.<br />
Ines Haaser<br />
anzeige<br />
18<br />
Geschichte
Tagebau Berzdorf 1946 - 1955 (Teil III)<br />
Berzdorf<br />
Bericht des Kollegen Elektroingenieur<br />
Alwin Hamann<br />
Das Problem Arbeitskräfte war in diesen<br />
Tagen verhältnismäßig einfach zu lösen.<br />
Weit schwieriger war die Beschaffung der<br />
nötigen Hilfsmaterialien, denn mit dem<br />
guten Willen der Arbeiter und ihrem eigenen<br />
Handwerkszeug konnte man unmöglich<br />
das Wasser auspumpen. Einen<br />
kleinen Einblick über die besonderen<br />
Schwierigkeiten der Situation aus den<br />
März-Tagen 1946 vermittelt uns die Schilderung<br />
des Kollegen Elektroingenieur Alwin<br />
Hamann:<br />
„Als ich am 16. März von Oberingenieur<br />
Mauersberger vom BKW Hirschfelde<br />
den Auftrag erhielt, für den Aufschluß<br />
des Tagebaues Berzdorf die erforderliche<br />
Stromversorgung einschließlich der<br />
gesamten Materialbeschaffung sicherzustellen,<br />
stand ich vor einem großen<br />
Teich - sonst war weit und breit nichts.<br />
Um den Inbetriebnahmetermin für den<br />
ersten Pumpensatz, den 1. April 1946, zu<br />
sichern, benötigten wir noch eine Hochund<br />
Niederspannungsanlage nebst den<br />
erforderlichen Umspannern, Schaltgeräten,<br />
Kabeln usw..<br />
Die Zugverbindungen nach allen Richtungen<br />
waren unterbrochen. Kein Fahrrad,<br />
kein Auto konnte ich auftreiben. Also,<br />
wo du hin willst, zu Fuß. Aber wohin? Wer<br />
hilft mit?<br />
Mein erster Weg war nach der Energieversorgung<br />
Görlitz. Die Antwort: „Nee, mein<br />
lieber Freund, Elektromaterial können<br />
wir dir beim besten Willen nicht geben.<br />
Nischt zu machen, haben selber nischt!“<br />
Am nächsten Tag ging ich zur Energieversorgung<br />
Zittau. Ich hatte die Türklinke<br />
noch in der Hand, da rief Kollege Ottenroth<br />
schon: „Hau ab, ich weiß schon, was<br />
du willst, ich habe selber nichts!“. Aber<br />
ich wußte, daß seine Verbindungen mir<br />
zum Vorteil sein konnten. Er sagte dann<br />
auch: „Wenn du Mut hast, dann sage ich<br />
dir einen ehemaligen Rüstungsbetrieb in<br />
der Oberlausitz, wo einiges Material, was<br />
du dringend brauchst, noch vorhanden<br />
ist. Beeile dich aber, sonst kommst du zu<br />
spät!“<br />
Es war ein weiter Weg. Im Rucksack ein<br />
paar Kartoffeln und einen Kanten Brot. Bei<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
19
Tagebau Berzdorf 1946 - 1955 (Teil III)<br />
Berzdorf<br />
meiner Ankunft erwartete mich niemand.<br />
Als ich den Verwalter endlich gefunden<br />
hatte, schrie er mich mit verglasten Augen<br />
an: „Raus, du hässlicher Uhu! Was willst du<br />
hier?“<br />
Als wir uns doch verständigen konnten,<br />
erfuhr ich, dass das Stammwerk in Taucha<br />
bei Leipzig ist, ohne dessen Genehmigung<br />
aber nichts herausgegeben werden<br />
durfte. Ein durch den Bürgermeister der<br />
Gemeinde Schönau-Berzdorf organisiertes<br />
Auto brachte uns nach einem Achsenbruch<br />
in der Nähe von Dresden, der notdürftig<br />
von einem Schmied geschweißt<br />
wurde, nach Taucha. Die Verhandlungen<br />
führten zum Erfolg, und mit zwei Mann<br />
begann kurze Zeit später die Demontage<br />
in Niederoderwitz. Besondere Schwierigkeiten<br />
entstanden durch den Abtransport<br />
der Transformatoren und übrigen Materialien.<br />
Am 27. März 1946 rollte der erste Materialtransport<br />
nach Berzdorf. Meine Aufgabe<br />
bestand darin, weitere Materialien<br />
aus dem ehemaligen Rüstungsbetrieb für<br />
den Aufbau unseres Werkes sicherzustellen.<br />
Alle anwesenden Arbeiter in Niederoderwitz<br />
nahmen die Arbeit nur unter der<br />
Bedingung auf, wenn sie jeden Tag Mittagessen<br />
bekommen. So bestand meine Aufgabe<br />
auch darin, zusätzlich Kartoffeln und<br />
anderes Essbares bei den Bauern zu erwerben,<br />
was für mich nicht immer leicht war.<br />
Hier im Werk waren meine ersten Mitarbeiter<br />
auf dem elektrotechnischen Gebiet<br />
der Kollege Atzenroth, der Kollege Eduard<br />
Klug sowie der Kollege Anton Gorol.<br />
Der mir vom Generaldirektor Müller gestellte<br />
Termin konnte nicht eingehalten<br />
werden, obwohl die Fa. F. C. Schmalfuß,<br />
Dresden, die notwendigen Rohrleitungen<br />
gelegt hatte. Am 5. April erfolgte die Einschaltung<br />
des 1,6-kV-Pumpensatzes. Aber<br />
im gleichen Moment erfolgte auch die<br />
Ausschaltung. Durchschlag am Hochspannungskabel<br />
zum Motor. Die Auswechslung<br />
gegen ein anderes Kabel, das erst bei<br />
einem Berzdorfer Bauern gefunden werden<br />
mußte, war mit einem erheblichen<br />
Zeitverlust verbunden. Nach Fertigstellung<br />
des Kabelanschlusses erfolgte am 11.<br />
April 1946 die endgültige Inbetriebnahme<br />
des ersten Pumpensatzes. Dem ersten<br />
Pumpensatz folgten weitere, die vom BKW<br />
Hirschfelde herangebracht wurden. Durch<br />
anzeige<br />
20<br />
Geschichte
Zeitzeugen und Zeitdokumente erzählen<br />
Tagebau Berzdorf<br />
Abb. 1 Wasser ist im Wesentlichen abgepumpt<br />
Zufall erfuhr ich, dass in Niederoderwitz<br />
im Betrieb Kosa ein Großumspanner, den<br />
wir dringend benötigten, zur Verfügung<br />
stand.<br />
Nach der schwierigen Beschaffung eines<br />
Tiefladers erfolgte der Transport mittels<br />
5 Zugmaschinen, die alle mehr oder weniger<br />
Kriegsschäden aufzuweisen hatten,<br />
sowie für alle Fälle zwei weitere Reservemaschinen<br />
über Zittau, Ostritz, nach dem<br />
BKW Berzdorf.“<br />
Abb. 2 Das erste Wasser erreicht den Mühlgraben<br />
(links der sowjetische Kapitän Penigin, rechts<br />
Oberingenieur Mauersberger von ASW Hirschfelde<br />
Kollege Günter Poser, später Leiter der<br />
Materialverwaltung, berichtet aus dem<br />
Jahre 1946<br />
Um alle notwendig werdenden Arbeiten<br />
durchführen zu können, beauftragte nunmehr<br />
der Zweckverband weitere Firmen<br />
mit speziellen Aufgaben. „Ich arbeitete als<br />
Hilfsarbeiter bei einem Demontagekom-<br />
anzeige<br />
Erinnerungen<br />
21
Tagebau Berzdorf 1946 - 1955 (Teil III)<br />
Berzdorf<br />
Abb. 3 Zufahrtsweg zur Grube von Tauchritz aus<br />
am 17.03.1946<br />
mando am Güterbahnhof Görlitz. Dabei<br />
erfuhr ich erstmalig von dem Versuch, in<br />
der Nähe von Görlitz einen alten Tagebau<br />
wieder nutzbar zu machen; und das war<br />
Berzdorf.<br />
Bei der Fa. Stecker & Co., Görlitz, konnte<br />
ich am 9. April 1946 als Tiefbauarbeiter<br />
anfangen. Diese Firma hatte den Auftrag,<br />
das ehemalige Zufahrtsgleis am Siebgebäude<br />
wieder herzustellen. Wir 18 Mitarbeiter<br />
dieser Firma waren stolz, einen<br />
Unterstellraum mit rohen Tischen und<br />
Bänken „organisiert“ zu haben. Um den<br />
Kaffee, die Kraut- oder Mehlsuppe mittags<br />
aufwärmen zu können, wurde aus Ziegelsteinen<br />
vor unserer Bude ein Küchenherd<br />
gebaut. Jeder von uns hatte abwechselnd<br />
Küchendienst und für die nötige Feuerung<br />
zu sorgen. Überall und zu jeder Zeit<br />
wurde nach zusätzlicher Verpflegung gesucht.<br />
Das seinerzeit auch Brennmaterial<br />
„organisiert“ wurde, können alle alten<br />
Werkschutzkollegen bestätigen.<br />
Ganz Ausgekochte kamen am Sonntag<br />
mit Pferdegespann vorgefahren und erklärten<br />
dem Werkschutz, Schwellen für<br />
die und die Baufirmen abzuholen. Es<br />
klappte. Eine besonders große Schwierigkeit,<br />
die fast unüberwindlich erschien, war<br />
die Beschaffung der Brückenträger über<br />
die kleine Gaule im jetzigen Kraftwerksgelände.<br />
Eine Görlitzer Firma erklärte sich<br />
schließlich bereit, aus verbogenen Teilen<br />
der Dachkonstruktion des ehemaligen<br />
Fliegerhorstes Görlitz eine vorschriftsmäßige<br />
Brücke zu bauen. Durch die ständige<br />
Arbeit mit dem Schotter ging das letzte<br />
anzeige<br />
22<br />
Geschichte
Zeitzeugen und Zeitdokumente erzählen<br />
Tagebau Berzdorf<br />
Paar Kommiss-Schuhe entzwei. Was nun?<br />
Antrag auf Fussbekleidung war längst<br />
gestellt, aber …! Der für den ganzen Bauabschnitt<br />
verantwortliche Kollege Willim<br />
ging deshalb wieder auf „Organisationsfahrt“<br />
und mit Erfolg. 10 Paar Gummistiefel<br />
(!). Gummistiefel waren für uns nicht<br />
das Geeignete. Holzschuhe müssen her,<br />
aber wie? Ich kann mich noch sehr gut<br />
entsinnen, als eines Tages der Betriebsratsvorsitzende<br />
Willi Schmidt unserer Firma<br />
als Anerkennung zwei Paar Holzschuhe<br />
überreichte. Nachdem ich das Glück<br />
hatte, ein Paar zu erhalten, glaubte ich,<br />
das große Los gewonnen zu haben.“<br />
Erinnerungen von Helmut Kerger, von<br />
Lothar Walli aufgeschrieben<br />
Helmut Kerger war das älteste Mitglied<br />
des Vereins „Oberlausitzer Bergleute“ e.<br />
V., ein Kumpel der ersten Stunde. Bereits<br />
ab August 1946 war er bei der Wiederinbetriebnahme<br />
des Tagebaues Berzdorf<br />
dabei. Er hatte viele Episoden dieser Zeit<br />
in seinem Gedächtnis gespeichert und<br />
manchmal fand er auch die Zeit und den<br />
Abb. 4 Das Foto aus dem Fundus von Helmut<br />
Kerger zeigt die Eigenanfertigung eines Schraubenschlüssels<br />
nach einem der wenigen vorhandenen<br />
Muster. Gefertigt wurde nach dem Motto: Ausschneiden,<br />
bohren, Bohrung ausschneiden, feilen<br />
und schleifen.<br />
Mut, einige davon aufzuschreiben, so<br />
auch die folgenden:<br />
Die erste Werkstatt.<br />
„Nachdem die Zimmerleute, die im Hochbunker<br />
untergebracht waren, 1946 die<br />
von Hirschfelde umgesetzte Hauptwerkstatt<br />
errichtet hatten, kam in Berzdorf viel<br />
Arbeit auf die Werkstatt zu. Die Anzahl<br />
der Schlosser und Schmiede erhöhte sich<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
23
Tagebau Berzdorf 1946 - 1955 (Teil III)<br />
Berzdorf<br />
schnell, nur reichten die Werkzeuge nicht<br />
aus. Was die Bagger und Loks, sowie die<br />
Werkzeugausgabe nicht hatten, war eben<br />
nicht da. Das galt von der kleinsten Ölkanne<br />
bis zum größten Schraubenschlüssel.<br />
Also selbst anfertigen. Günstig war<br />
dabei, dass Karbid, Gas und Sauerstoff<br />
aus Hirschfelde und Weinhübel und auch<br />
Brennstoff für das Schmiedefeuer genügend<br />
ankam. Das wichtigste aber war der<br />
Schrott und das nach der eiligen Demontage<br />
des Kraftwerkes liegengebliebene<br />
Restmaterial, von Feinblech bis Flachstahl<br />
und Rundeisen aller Stärken.“<br />
Jahresabschlussfeier 1947.<br />
„Ende 1947 kam es in der Zollschenke<br />
Hagenwerder zur Jahresabschluss- bzw.<br />
Weihnachtsfeier der Belegschaft des Tagebaues.<br />
Dazu hatte sich der Werkstattund<br />
Maschinenmeister etwas besonderes<br />
einfallen lassen. Er stattete eine Tombola<br />
für alle Belegschaftsangehörigen aus. Er<br />
ließ kleine Gartenwerkzeuge, wie Bohnenhacken,<br />
Kartoffelhacken und anderes<br />
mehr anfertigen. Kartoffelhacken in<br />
Abb. 5 Arbeitsbescheinigung für den Mai 1947 bei<br />
der Fa. Holzmann, Baustelle Berzdorf<br />
größerer Zahl, denn wer von den Leuten,<br />
die von Böhmen oder Schlesien kamen,<br />
hatte schon so etwas mitgebracht, was<br />
jetzt am meisten gebraucht wurde. Denn<br />
nichts war peinlicher, als wenn so eine<br />
geliehene Hacke beim Rammeln auf der<br />
Abraumkippe abhanden kam. Also waren<br />
die kleinen Dinge Goldwert. Der Meister<br />
legte aber Wert darauf, dass bei der Anfertigung<br />
der Dinge die sieben Lehrlinge<br />
der Werkstatt, von denen vier Jahrzehnte<br />
lang Werksangehörige waren, sich daran<br />
beteiligten.“<br />
anzeige<br />
24<br />
Geschichte
Zeitzeugen und Zeitdokumente erzählen<br />
Tagebau Berzdorf<br />
Abb. 6<br />
Abb. 7 Karbidlampen und Rohrbürste<br />
Im Nachlass von Helmut Kerger gefunden.<br />
Meister Riedel mit einem Teil seiner<br />
„Schwarzen“. (Werkstattleute und Maschinisten).<br />
1947 an der Werkstatt, vor der ersten<br />
900 mm spurigen Dampflok – Lok 10<br />
von der Firma Orenstein und Koppel.<br />
(Abb. 6). Vorn am Schornstein einer der<br />
ersten sieben Lehrlinge, dann Kesselschmied<br />
Menzel, Fiebig, Kulke, in der<br />
Laube der Dreher Junge. Unten Heizer<br />
Teuber, Leupold Walter, Horter, Gärtner<br />
und Leupold Gerhard. Ganz rechts Lokführer<br />
Liebe, und fast in der Mitte der<br />
Meister. Vorn die Masten für die neue<br />
Zuleitung zum alten Schalthaus. Rechts<br />
im Hintergrund die Rampe der kleinen<br />
Haspel zum Hochziehen einzelner Holzkipper<br />
zum Füllen der Bahnwaggons.<br />
1949 wurden diese Karbidlampen in der<br />
Grube Berzdorf an das Dampflokperso-<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
25
Tagebau Berzdorf 1946 - 1955 (Teil III)<br />
Berzdorf<br />
nal des Fahrbetriebes zum persönlichen<br />
Gebrauch und Pflege ausgegeben. Unter<br />
den Lampen eine Rohrbürste (Rohre stoßen).<br />
An einer langen Stange mit Griff war<br />
die Bürste aufgeschraubt. Die Anzahl der<br />
Rohre vom Feuerraum bis zur Rauchkammer<br />
war bei den Loks verschieden. Beim<br />
Kessel der 15 t Henschel Lok waren es 108<br />
Rohre.<br />
Erinnerungen von Helmut Dierich, aufgezeichnet<br />
von Lothar Hoffmann 2012<br />
Helmut Dierich wurde am 25.8.1929 in<br />
Gallenau, Kreis Frankenstein, geboren.<br />
1943 begann die Lehre als Dreher bei<br />
der Firma Heckmann u. Lange in Breslau.<br />
Am 15. Januar 1945 wurde er zum Volkssturm<br />
eingezogen, 15 Jahre alt. Der Weg<br />
führte ihn über Görlitz nach Prag und<br />
das Kriegsende erlebte er in Leitmeritz,<br />
in sowjetischer Gefangenschaft, in einen<br />
Lager in Teplice. Von dort ging es weiter<br />
in ein Lager nach Dresden. Die Entlassung<br />
erfolgte am 28.8.1945. Nach Breslau ging<br />
es nicht mehr zurück und der Weg führte<br />
über Gaußig bei Bautzen nach Tauchritz.<br />
Abb. 8 Dampflok 545-2-22, die Lok von Helmut<br />
Dierich<br />
Er fand zuerst Arbeit in der Landwirtschaft<br />
bei dem Bauer Richter in Tauchritz. Er hatte<br />
sich 1946 sofort für den Aufschluss der<br />
Grube Berzdorf beworben, wurde jedoch<br />
wegen der Arbeit in der Landwirtschaft<br />
abgelehnt.<br />
Es gelang ihn jedoch eine Anstellung<br />
bei der Firma Holzmann für Beräumung<br />
des Kraftwerkes zu bekommen. Am<br />
6.7.1946 konnte er bei der Fa. Holzmann<br />
beginnen. Seine ersten Arbeiten für Fa.<br />
anzeige<br />
26<br />
Geschichte
Zeitzeugen und Zeitdokumente erzählen<br />
Tagebau Berzdorf<br />
Holzmann war das Holen von Teilen für<br />
Pumpen, Bagger aus Hirschfelde mit Pferdegespannen.<br />
Als Rückladung wurden<br />
Barackenteile des ehemaligen Gefangenlagers<br />
am Hochbunker nach Hirschfelde<br />
transportiert. Von April 1947 bis 30. April<br />
1949 arbeitete er als Lokheizer. Ab 2. Mai<br />
1949 erfolgte der Einsatz als Lokführer. Im<br />
Dezember 1953 erfolgte die Kesselwärterprüfung<br />
und im März 1956 erfolgte<br />
die Prüfung als E-Lokfahrer. In den nächsten<br />
Jahrzehnten erfolgte der Einsatz als<br />
Oberlokfahrer, Stellwerker und ab Ende<br />
der 70iger Jahre bis zur Rente war er als<br />
Zug-Dispatcher tätig.<br />
Erinnerungssplitter:<br />
Abb. 9 Ausweis Jungaktivist vom 1. Mai 1950<br />
von Helmut Dierich<br />
Die Eisenbahn fuhr nur bis Hagenwerder.<br />
Die Waggons wurden per Hand mit Stricken<br />
auf das Kraftwerksgelände gezogen.<br />
Ende 1946 kam die erste Dampflok und<br />
der 1. Dampfbagger. Küchenchef war ein<br />
Kollege Vogel. Dampfloks (Orenstein und<br />
Koppel) Anfang der 50iger Jahre schon<br />
mit Kompressor für Druckluft. Er hatte mal<br />
einen Auffahrunfall mit Dampflok und Gerichtsverhandlung<br />
in Dresden. 1950 Auszeichnung<br />
als Aktivist. In Tauchritz gab es<br />
eine FDJ Theatergruppe mit der sie auch in<br />
Nachbardörfern aufgetreten sind.<br />
„Der Bauhof“ Gustav Niepel erinnert<br />
sich:<br />
Die ersten Mitarbeiter waren die fünf Zimmerer<br />
Herbert Döring, Oswald Neu, Otto<br />
Theunert, Paul Engler und Gustav Niepel<br />
sowie der Stellmacher Herbert Kühn.<br />
Technische Voraussetzung, wie z. B. Maschinen,<br />
gab es nicht. Alles musste in<br />
anzeige<br />
Geschichte<br />
27
Tagebau Berzdorf 1946 - 1955 (Teil III)<br />
Berzdorf<br />
Handarbeit ausgeführt werden. Lediglich<br />
dem Stellmacher stand eine Hobelbank<br />
für das Anstielen von Schaufeln und andere<br />
Kleinarbeit zur Verfügung. Viele Arbeiten<br />
wurden mit der Seitaxt erledigt.<br />
Abb. 10 Erste Verladerampe 1946<br />
Als Unterkunft diente uns eine etwa 70 bis<br />
80 m² große Holzbaracke hinter der Küche.<br />
1952 war der 1. Stock im Hochbunker<br />
unser Domizil. Die erste Aufgabe für uns<br />
Zimmerer war die Erstellung einer Verladerampe<br />
(Abb. 10), um die Kohle aus der Grube<br />
zu fördern. Die dafür benötigten Holzstämme<br />
mussten in schwerer Handarbeit<br />
mit dem Breitbeil und der Axt bearbeitet<br />
sowie mit der Schrotsäge zugeschnitten<br />
werden. Alles ging über menschliche Kraft,<br />
da modernere Techniken gänzlich fehlten;<br />
jedoch waren wir alle alte, erfahrene Zimmerer,<br />
die noch gelernt hatten mit dem<br />
Breitbeil zu arbeiten.<br />
Anfang der 50er Jahre sollte in Thräna eine<br />
Seilbahn demontiert und bei uns erstellt<br />
werden. Auch bei dieser Arbeit mussten<br />
wir Zimmerer tatkräftig mit anpacken.<br />
Andere Abteilungen stellten ebenfalls Arbeitskräfte<br />
für den Abbruch der Seilbahn<br />
in Thräna. Die Anforderungen an den Bauhof<br />
stiegen von Jahr zu Jahr, dies führte zu<br />
einer ständigen Erweiterung des Bauhofes<br />
in der folgenden Zeit.<br />
Das Kohlestoppeln<br />
Von Beginn an wurden die Kippstellen für<br />
den Abraum nach Restkohlen, Kohlestücke<br />
durchsucht. Schnell wurde erkannt das<br />
ein Verbot nicht möglich ist. Bei den beste-<br />
anzeige<br />
28<br />
Geschichte
Zeitzeugen und Zeitdokumente erzählen<br />
Tagebau Berzdorf<br />
Impressum:<br />
Herausgeber (V.i.S.d.P.):<br />
<strong>StadtBILD</strong>-Verlag<br />
eine Unternehmung der<br />
incaming media GmbH<br />
vertreten durch den Geschäftsführer<br />
Andreas Ch. de Morales Roque<br />
Mitglied im Deutschen Fachjournalistenverband<br />
Carl-von-Ossietzky-Straße 45 | 02826 Görlitz<br />
Tel. 03581 87 87 87 | Fax: 03581 40 13 41<br />
E-Mail: info@stadtbild-verlag.de<br />
Shop: www.stadtbild-verlag.de<br />
Abb. 11 Kohlestoppeln auf der Langteichhalde<br />
Anfang der 50iger Jahre<br />
henden Problemen der Hausbrandversorgung<br />
war es auch eher volkswirtschaftlich<br />
nützlich. Nur es war nicht tragbar ein völlig<br />
wildes unkontrolliertes Kohlestoppeln<br />
zu gestatten. Es wurden durch den Betrieb<br />
Lesekarten mit der Gültigkeit von einen<br />
Tag und gegen Errichtung einer Anerkennungsgebühr<br />
( 50 Pfg. für Rentner 10 Pfg.)<br />
ausgegeben und eine unterschriftliche<br />
Bestätigung einer Belehrung verlangt. Die<br />
Verfahrensweisen wurden bei der Technischen<br />
Bezirksinspektion Senftenberg<br />
angezeigt. Die gesammelte Kohle wurde<br />
mit Leiterwagen in die Heimatorte transportiert<br />
und dabei durchaus große Entfernungen<br />
zurückgelegt (z.B. Deutsch Ossig/<br />
Weinhübel/Bernstadt). Das Foto von der<br />
Langteichhalde Anfang der 50iger Jahre<br />
zeigt die erheblichen Mühen die mit dem<br />
Stoppeln verbunden waren.<br />
Joachim Neumann und Klaus Krische<br />
Aus: Berzdorfer Hefte<br />
Die technologische Entwicklung<br />
Tagebau Berzdorf 1946-1955.<br />
Bankverbindung:<br />
IBAN: DE21 8504 0000 0302 1979 00<br />
BIC: COBADEFFXXX<br />
Geschäftszeiten:<br />
Mo. - Fr. von 9.00 bis 16.00 Uhr<br />
Druck:<br />
Graphische Werkstätten Zittau GmbH<br />
Erscheinungsweise: monatlich<br />
Redaktion & Inserate:<br />
Andreas Ch. de Morales Roque<br />
Kathrin Drochmann<br />
Dipl. - Ing. Eberhard Oertel<br />
Bertram Oertel<br />
Layout:<br />
Kathrin Drochmann<br />
Lektorat:<br />
Wolfgang Reuter, Berlin<br />
Teile der Auflage werden kostenlos verteilt, um<br />
eine größere Verbreitungsdichte zu gewährleisten.<br />
Für eingesandte Texte & Fotos übernimmt der Herausgeber<br />
keine Haftung. Artikel, die namentlich<br />
gekennzeichnet sind, spiegeln nicht die Auffassung<br />
des Herausgebers wider. Anzeigen und redaktionelle<br />
Texte können nur nach schriftlicher Genehmigung<br />
des Herausgebers verwendet werden.<br />
Redaktionsschluss:<br />
Für die nächste Ausgabe (Dezember)<br />
ist am 20.11.<strong>2021</strong><br />
Geschichte<br />
29
Neues vom Lohn: Von der eAU bis zur identifikationsnummer<br />
ETL-Steuerberatung<br />
Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)<br />
Herbstzeit ist Erkältungszeit. Auch Arbeitnehmer werden einmal krank und müssen dann spätestens<br />
am vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit ihrem Arbeitgeber einen „gelben Schein“ vorlegen.<br />
Dies soll ab 1. Juli 2022 für Arbeitnehmer, die gesetzlich krankenversichert sind, einfacher werden.<br />
Denn ab diesem Zeitpunkt können die Arbeitgeber die Daten über die Krankschreibung elektronisch<br />
von den Krankenkassen ihrer Versicherten abrufen. Der Arbeitnehmer erhält dann von seinem<br />
Arzt nur noch einen vereinfachten Papierausdruck für die eigenen Unterlagen.<br />
Doch zunächst entfällt die Informationspflicht des Arbeitnehmers gegenüber der Krankenkasse.<br />
Schon ab 1. Oktober <strong>2021</strong> erfolgt die Mitteilung über die Arbeitsunfähigkeit an die Krankenkassen<br />
grundsätzlich digital durch die Ärzte. Arbeitnehmer sollten jedoch im 4. Quartal <strong>2021</strong> noch bei<br />
ihren Praxen nachfragen, ob diese bereits die Telematikinfrastruktur nutzen und die elektronische<br />
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) ausstellen, denn aufgrund von technischen Problemen<br />
wurde eine Übergangsreglung vereinbart. Bis 31. Dezember <strong>2021</strong> dürfen Praxen auch noch den<br />
altbewährten Krankenschein in Papierform ausstellen.<br />
Hinweis: Vorsicht ist bei nicht gesetzlich krankenversicherten Arbeitnehmern geboten. Diese<br />
müssen bis auf weiteres ihre Krankenkasse und auch ihren Arbeitgeber nach dem alten Verfahren<br />
selbst informieren.<br />
Steuer-ID auch für Jahresmeldung <strong>2021</strong> von Mini-Jobbern notwendig<br />
Auch geringfügig Beschäftigte müssen ihren steuerlichen Pflichten nachkommen und Lohnsteuer<br />
bezahlen. Die Art der Besteuerung kann hierbei jedoch variieren. Wird die geringfügige Beschäftigung<br />
über die Minijob-Zentrale abgerechnet, fallen pauschal 2 % Lohnsteuer an, die der Arbeitgeber<br />
trägt. Eine Angabe in der Einkommensteuererklärung des Arbeitnehmers ist dann nicht mehr<br />
notwendig. Aber auch eine individuelle Besteuerung nach den Lohnsteuerabzugsmerkmalen des<br />
Arbeitnehmers ist möglich.<br />
Die Bundesregierung möchte sicherstellen, dass alle Steuern für Mini-Jobber korrekt angemeldet<br />
und entrichtet werden und hat daher neue, zusätzliche Angaben zur Lohnsteuer für die Entgeltmeldung<br />
von geringfügig Beschäftigen definiert.<br />
Demnach gilt ab 1. Januar <strong>2021</strong> eine erweiterte Meldepflicht, die aber erst zum 1. Januar 2022<br />
umgesetzt wird. Neu ist ein Datenbaustein „Steuer“, der dann die Steuernummer des Arbeitgebers,<br />
die Steueridentifikationsnummer des Beschäftigten und eine Kennziffer zur Art der Besteuerung<br />
(pauschal oder nach Lohnsteuerabzugsmerkmalen) enthält.<br />
Wichtig für alle Arbeitgeber: Bei bereits laufenden Beschäftigungsverhältnissen, die über den 31.<br />
Dezember <strong>2021</strong> hinaus bestehen bleiben, müssen diese Angaben bereits in der Jahresmeldung<br />
für das Kalenderjahr <strong>2021</strong> enthalten sein. Arbeitgeber sollten daher zeitnah prüfen, ob ihnen die<br />
Steueridentifikationsnummern ihrer Arbeitnehmer vorliegen und diese im Zweifel zeitnah anfordern.<br />
Sofern Sie Ihren Steuerberater mit der Lohnabrechnung beauftragt haben, benötigt dieser<br />
spätestens bis zum Jahresende die Steueridentifikationsnummern Ihrer Minijobber.<br />
30<br />
Autor: Ulf Hannemann, Freund & Partner GmbH (Stand: 15.09.<strong>2021</strong>)<br />
Ratgeber | Anzeige