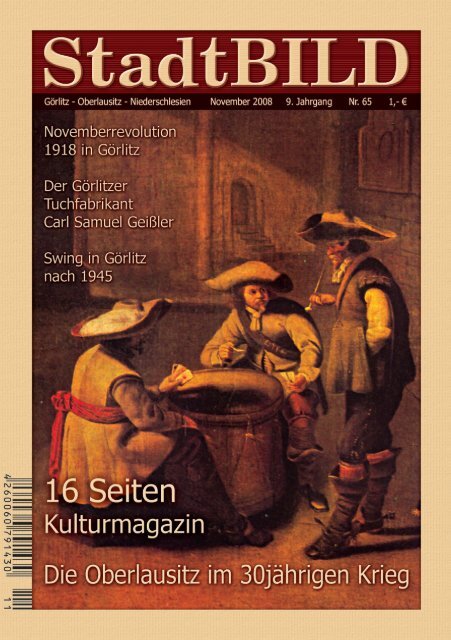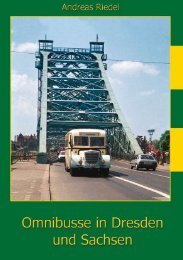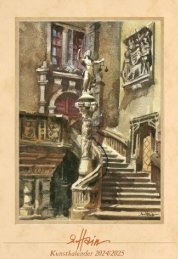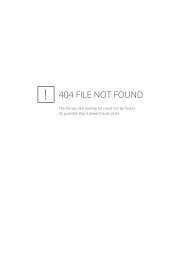Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Vorwort<br />
Liebe Leserinnen, liebe Leser,<br />
Wer erinnert sich nicht gern jener lange<br />
zurückliegenden Deutschstunden, als<br />
Heines “Deutschland. Ein Wintermärchen”<br />
auf dem Plan stand? Es waren<br />
vergnügliche und nachdenkliche Momente,<br />
und man dachte an das judenfeindliche<br />
Jahrzwölft zurück, als man,<br />
noch im Kindesalter, im Bücherschrank<br />
der Nachbarsleute in der geheimnissvollen<br />
zweiten Bücherreihe, hinter Schiller,<br />
Uhland und Storm, jenen “unbekannten<br />
Dichter” der “Loreley” genannt fand.<br />
In goldener Frakturschrift stand “Heine”<br />
auf den roten Buchrücken. Beim<br />
Stöbern ertappt und zum Schweigen<br />
ermahnt, ließ man die Bücher in ihrem<br />
dunklen Versteck. Was mag aus ihnen<br />
geworden sein, als im Januar 1945 sich<br />
der Krieg über Haus und Heimat hinwegwälzte?<br />
Erst wenige Jahre danach,<br />
vor Ende der Schulzeit, kam der Name<br />
wieder. Der schon betagte Musiklehrer<br />
Kurt Fischer sang und spielte im Musikzimmer<br />
im Gymnasium Augustum<br />
am Klosterplatz “Leise zieht durch mein<br />
Gemüt” in der Vertonung durch Felix<br />
Mendelssohn-Bartholdy. Und sprach nur<br />
einen Satz. Text und Melodie stammten<br />
von zwei deutschen Juden. Das blieb einer<br />
der wichtigsten Momente im Leben.<br />
Und dann der Vortragsabend Ende der<br />
1980er Jahre im Görlitzer Theater mit<br />
Eberhard Esche und dem “Wintermärchen”<br />
– die bedeutungsvollen Pausen,<br />
die leisen Töne zwischen den Zeilen, die<br />
scheinbar harmlose Brisanz, die wahrzunehmen<br />
man gelernt hatte. “Im traurigen<br />
Monat <strong>November</strong> war`s, die Tage<br />
wurden trüber, der Wind riß von den<br />
Bäumen das Laub...” Kein Monat sonst<br />
macht uns Vergänglichkeit so unausweichlich<br />
und doch versöhnlich bewußt<br />
wie der <strong>November</strong>.<br />
Bedeutungsschwere Daten machen ihn<br />
auch zum Monat des Sicherinnerns. <strong>November</strong><br />
1918 und 1938, durch die Medien<br />
termingerecht aufbereitet, lassen uns<br />
fragen, wie das damals bei uns war, was<br />
im Gedächtnis blieb, wie man Denkanstöße<br />
für sich verarbeitet. Unser Heft <strong>65</strong><br />
berichtet darüber, auch über Belastungen<br />
der Oberlausitz in jenem Krieg 1618<br />
bis 1648 oder über Swing in Görlitz um<br />
1948. Die Jahreszahlen-Acht birgt Daten<br />
ohne Ende. Eine unterhaltsame und<br />
bedenkenswerte Begegnungen mit den<br />
Bildern und Texten wünscht Ihnen<br />
Ernst Kretzschmar<br />
anzeige<br />
Einleitung<br />
3
Swing in Görlitz<br />
in<br />
nach<br />
Görlitz<br />
1945<br />
Im Mai 1945 waren<br />
die zahlreichen Görlitzer<br />
Tanz- und Vergnügungslokale<br />
geschlossen,<br />
hatten aber alle<br />
den Krieg unbeschädigt<br />
überstanden und öffneten<br />
eins nach dem<br />
anderen bald wieder<br />
ihre Pforten. Schon im<br />
Herbst des gleichen<br />
Jahres starteten die<br />
“Scala” und “2 Linden”<br />
ihre Varietéprogramme,<br />
und ab 1947 war in allen<br />
Musiklokalen außer der “Ressource”<br />
wieder etwas los. Nur das Ballhaus<br />
“Endstation” und das Tanzcafé “Ruhmeshalle”<br />
waren jetzt unerreichbar, weil<br />
sie im polnisch gewordenen Teil von<br />
Görlitz lagen.<br />
Unterdessen waren moderne internationale<br />
Tanzmusik und Jazz, die im Krieg<br />
nicht gespielt werden durften (Tanzen<br />
war ebenfalls verboten), auch in Görlitz<br />
heimisch geworden. Vor allem der<br />
Swing, damals die im Jazz vorherr-<br />
schende Stilart, begeisterte uns Jugendliche.<br />
Die neue Musik war immer öfter<br />
im Radio zu hören (wenn man noch eins<br />
hatte), und ab Ende 1946 gab es wieder<br />
in beschränktem Umfang Noten und<br />
Schallplatten. Besonders die neue Plattenmarke<br />
“Amiga” brachte die Erfolgsnummern<br />
der besten Berliner Bands.<br />
Auch gute Tanzorchester, die von außerhalb<br />
kamen, brachten moderne Schlager<br />
und heiße Musik nach Görlitz.<br />
Auswärtige Kapellen gastierten z.B. in<br />
anzeige<br />
4<br />
Geschichte |
Teil I<br />
I<br />
der “Scala” (Struvestr.), Im “Passage-<br />
Café” (Straßburg-Passage) und vor allem<br />
im “Resi” (Obermarkt), das früher<br />
“Zum Mönch” hieß. Es war ein kleines<br />
Tanzlokal, immer brechend voll, man<br />
trat sich gegenseitig auf die Füße, beim<br />
Tanzen kam man kaum von der Stelle<br />
– eine Nahkampfdiele, wie wir damals<br />
sagten. Hier war die Atmosphäre, in<br />
der Jazz gedeiht. Besonders gut erinnere<br />
ich mich an die Harry-Harder-Combo<br />
“vom Kurfürstendamm, Berlin”, die irgendwann<br />
im Winter 1947/48 im “Resi”<br />
engagiert war. Eine tolle Band – wenn<br />
sie Hey-Ba-Be-Re-Ba hotteten oder den<br />
Flat Foot Floogie swingten, schrieen wir<br />
vor Begeisterung. Man nannte uns damals<br />
etwas verächtlich Swing-Heinis.<br />
Wir wiederum nannten unsere Alters-<br />
genossen, die Schnulzen<br />
und lahme Schlager<br />
liebten (wie z.B. die<br />
„Caprifischer“), herablassend<br />
Tango-Jünglinge.<br />
Sie schmierten sich<br />
Pomade in die Haare,<br />
hatten lange Jacketts<br />
an und waren hinter allen Mädchen her.<br />
Diese Stenze zog es mehr in die “Scala”,<br />
in der sehr gute Tanzorchester spielten<br />
wie z.B. Harry Weissnicht ” vom Luisenhof,<br />
Dresden-Weißer Hirsch”. Hier<br />
machte man auf vornehm. Die Preise<br />
waren hoch, und es herrschte Krawattenzwang.<br />
Wer ohne Schlips kam, wurde<br />
nur eingelassen, wenn er sich an der<br />
Garderobe einen auslieh gegen Hinterlegung<br />
eines Pfandes. Solchen Firlefanz<br />
mochten wir nicht und gingen dort<br />
kaum hin.<br />
Da war das “Passage-Café” (Ecke Straßburg-Passage<br />
/Jakobstr.) Für uns attraktiver.<br />
Hier war z.B. Edi Thum mit seiner<br />
Band aus Weimar mehrmals engagiert.<br />
Die Kapelle spielte unten, wir saßen<br />
meist oben auf der Empore, wo man<br />
anzeige<br />
Geschichte | 5
Swing in Görlitz<br />
in<br />
nach<br />
Görlitz<br />
1945<br />
ungestört war. Wer guten<br />
Swing hören, ein<br />
Mädel aufgabeln oder<br />
seine Freundin ausführen<br />
wollte, kam hier<br />
ebenso auf seine Kosten<br />
wie die Tanzwütigen.<br />
Ohnehin machten<br />
wir damals keinen Unterschied<br />
zwischen moderner<br />
Tanzmusik und<br />
Swing, kannten nur Hot<br />
und Sweet. Hot waren<br />
z.B. Titel wie “In The Mood” oder “Cement-Mixer”,<br />
Sweet hingegen “Sentimental<br />
Journey” oder “Ganz leis erklingt<br />
Musik”.<br />
Doch nun zu den im Raum Görlitz ansässigen<br />
Kapellen, von denen mindestens<br />
drei das Niveau ihrer Kollegen von<br />
außerhalb erreichten. Hier muß vor allem<br />
das Hausorchester des Tanzlokals<br />
und Varietés “Zwei Linden” in Rauschwalde<br />
genannt werden, ein Saalbau,<br />
der schon vor der Jahrhundertwende als<br />
Etablissement “Zu den zwei Linden” ein<br />
beliebtes Ausflugs- und Vergnügungslokal<br />
war und nun eine Diskothek ist. Das<br />
Orchester war in den Nachkriegsjahren<br />
die einzige professionelle (kleine) Big<br />
Band in Görlitz, bestehend aus 2 Trompeten,<br />
1 Posaune, 3 Saxophonen, Akkordeon,<br />
Klavier, Baß, Gitarre,, Schlagzeug<br />
und dem Leiter Walter Übermuth,<br />
der die Band von 1945 bis 1948 dirigierte<br />
und häufig auch bei Tanzmusik als<br />
versierter Altsaxophonist und Klarinettist<br />
den Saxophonsatz verstärkte. Die<br />
Musiker waren keine reinen Jazzer, begleiteten<br />
aber präzise die Artisten und<br />
spielten zum Tanz flott und sauber die<br />
anzeige<br />
6<br />
Geschichte |
Teil I<br />
I<br />
Erfolgsschlager der letzten 6-8 Jahre –<br />
auch neue Stücke, sofern man sie als<br />
Orchester-<strong>Ausgabe</strong>n bekommen konnte.<br />
Aber das war schwierig, wegen der<br />
Papierknappheit. Der Pianist, Kurt Hübel,<br />
war ein gefragter Musiker. Er spielte<br />
nebenbei auch in anderen Musikgruppen<br />
und leitete zeitweise auch eine<br />
Swing-Combo. Der Akkordeonist/Pianist,<br />
Martin Viertel, gründete später mit<br />
Erfolg eine eigene Band. Der 2. Trompeter<br />
gab auch Unterricht. Ich war einer<br />
seiner Trompetenschüler 1947/48.<br />
Der Schlagzeuger, Fritz Gründer von der<br />
Leipziger Str., war ein guter Solist – eine<br />
Rarität damals! Wenn er bei “Barcelona”<br />
den Rumba-Rhythmus schlug oder beim<br />
“Schwarzen Panther” die beiden Schlagzeugsoli<br />
trommelte, eilte ich nach vorn,<br />
um ihm auf die Stöcke zu schauen. Der<br />
Panther, ein heißer, schneller Foxtrott,<br />
war damals bei uns ebenso beliebt wie<br />
“Chattanooga-Choo-Choo” und “In The<br />
Mood”. Und so stand ich dann 1946 (als<br />
lerngieriger Jungschlagzeuger) mit etlichen<br />
anderen Swing-Heinis an der Absperrung,<br />
die das Orchester vom Publikum<br />
trennte. Wir beobachteten, wie der<br />
Drummer sich schaffte, und zappelten<br />
dabei mit dem ganzen Körper im Rhythmus.<br />
Bei dieser Musik vergaßen wir, in<br />
was für einer miesen Zeit wir lebten, daß<br />
wir dauernd hungerten und daß die Zukunft<br />
ungewiß war, daß die Gerüchteküche<br />
im nun zweigeteilten Görlitz besonders<br />
stark brodelte, daß man in diesem<br />
harten Winter 1946/47 wahnsinnig fror.<br />
Das Lokal war schlecht geheizt, es gab<br />
kaum Bier, den Bedienungen wurde pro<br />
Tag nur je eine halbe Flasche Schnaps<br />
für ihre Gäste zugeteilt. So brachte sich<br />
manch einer seinen eigenen Fusel mit<br />
und trank ihn heimlich. Wer dabei erwischt<br />
wurde, mußte das Lokal sofort<br />
verlassen. Nur ein undefinierbares<br />
“Heißgetränk”, ein rotes Gesöff, gab es<br />
reichlich. Manchmal wurde ein “Alkolat”<br />
angeboten, das wohl ein oder zwei<br />
Tropfen Alkohol enthielt.<br />
Sehr erfolgreich waren auch die “Görlitzer<br />
Jazz-Rhythmiker” unter der Leitung<br />
des Trompeters Walter Sedlick von<br />
der Krölstraße. Die Band bestand meist<br />
aus 8 Musikern (Trompete, 3 Saxophone<br />
anzeige<br />
Geschichte | 7
Swing in Görlitz<br />
in<br />
nach<br />
Görlitz<br />
1945<br />
und Rhythmusgruppe) und war bei der<br />
Jugend recht beliebt. Sie spielte immer<br />
wieder in den namhaften Vergnügungslokalen<br />
wie im Resi, im Stadthallengarten<br />
und bei der Wiedereröffnung des<br />
Konzerthauses im Oktober 1946. Sedlick<br />
war einer der wenigen professionellen<br />
Bläser in Görlitz, die jazzig blasen<br />
konnten (später ging er als Musikal-Artist<br />
auf Reisen), und die Band swingte,<br />
was nach meiner Erinnerung an Sedlicks<br />
Bruder Adolf am Schlagzeug lag und an<br />
dem zeitweise mitspielenden Gitarristen<br />
Hannes Stelzer. Aber man war vielseitig<br />
und spielte auch Tangos und Walzer.<br />
Bei den kleinen Kapellen (man bezeichnet<br />
sie heute als Combo) in Görlitz war<br />
die “Benny-Band” führend. Man konnte<br />
sie unter anderem in der “Fledermaus”<br />
(Ecke Berliner Str./Salomonstr.) hören.<br />
Unter den 5 Musikern waren ein sehr<br />
guter Saxophonist und der eben genannte<br />
Hannes Stelzer, der hier auch<br />
sang. Sie spielten jazzige Tanzmusik –<br />
reine Jazzbands, die Tanzmusik ablehnten<br />
und nur Konzerte gaben, gab es<br />
damals bei uns noch nicht – und so kamen<br />
wir Swing-Heinis hierher zum Zuhören<br />
und nicht zum Tanzen. Ließ sich<br />
aber die Tanzerei nicht vermeiden, weil<br />
sonst die Mädchen wegliefen, so tanzten<br />
wir den Hibbel-Swing. Der war 1948<br />
in Mode und hatte den Vorteil, daß man<br />
keine Tanzschritte lernen mußte – man<br />
strampelte nur mit den Beinen auf dem<br />
Parkett herum und bewegte sich kaum<br />
von der Stelle. Mit nur einem Bläser<br />
brauchte die Benny-Band keine Orchester-Arrangements.<br />
Eine Klavierstimme,<br />
die leichter zu bekommen war, reichte<br />
aus. Oder man hörte sich ein Stück auf<br />
der Schallplatte so lange an, bis man es<br />
auswendig spielen konnte. So waren die<br />
Musiker in der Lage, auch die neuesten<br />
Schlager der deutschen Nachwuchs-<br />
Komponisten zu bringen, wie “Hallo kleines<br />
Fräulein”, “Gib mir einen Kuß durchs<br />
Telefon” und die “Räuberballade”, die<br />
der damals beliebte Schlagersänger Bully<br />
Buhlan schrieb.<br />
Zu erwähnen wäre noch das Hausorchester<br />
des Restaurants und Tanzlokals<br />
“Goldener Anker” in Rauschwalde,<br />
dessen Besitzer Lenhart selbst Musiker<br />
anzeige<br />
8<br />
Geschichte |
Teil I<br />
I<br />
war und die bis zu 10 Mann starke Kapelle<br />
leitete. Diese spielte nicht besonders<br />
modern oder gar jazzig, war aber<br />
sehr routiniert und vielseitig. Das war<br />
erforderlich, da in dem geschmackvoll<br />
eingerichteten Lokal neben normalen<br />
Tanzabenden auch oft geschlossene<br />
Veranstaltung stattfanden, bei denen<br />
alles Mögliche gefeiert wurde. Da vergnügte<br />
ich mich bei einem Fest meiner<br />
Schulklasse und ertrug, weil ich einen<br />
Tanzkurs machen mußte, zwei Bälle der<br />
Tanzschule Neumann-Henke. Dabei war<br />
ein konstanter, präziser Rhythmus gefragt,<br />
und den brachte die Kapelle. Sie<br />
hatte auch sofort die neuesten Modetänze<br />
drauf wie die Samba, die 1948<br />
aus Südamerika kam und auch in Görlitz<br />
jung und alt auf die Tanzflächen lockte.<br />
Aber es gab auch “Alte-Herren-Kapellen”,<br />
die eine solide, jedoch recht lahme<br />
Tanzmusik aus den 30er und 40er<br />
Jahren dudelten. Man hörte sie z.B. im<br />
Schweizerhof in Weinhübel und im Kaiserhof<br />
(später Görlitzer Hof), Berliner<br />
Straße. Diese Musik war nichts für Swinger<br />
– da gingen wir nicht hin.<br />
Bekannte Tanzlokale waren damals auch<br />
der Burghof in Biesnitz, Hotel Stadt<br />
Dresden am Bahnhof, das Tivoli an der<br />
Promenade, Café Roland in Weinhübel<br />
und Café Flora, ein Tanzschuppen in<br />
Rauschwalde.<br />
(Fortsetzung folgt)<br />
Manfred Raupach<br />
Bad Wildungen (geschrieben 1995)<br />
anzeige<br />
Geschichte | 9
Christkindelmarkt<br />
Wenn in der Weihnachtszeit vom Weihnachtsmarkt<br />
die Rede ist, dann beneiden<br />
wir Görlitzer oft jene Städte, die auch mit<br />
Striezelmarkt in Dresden<br />
ihrem Weihnachtsmarkt traditionelle Berühmtheit<br />
erlangt haben.<br />
Besonders natürlich Dresden mit seinem<br />
anzeige<br />
10<br />
Geschichte |
Christkindelmarkt<br />
in Schlesien geboren<br />
Weihnachtspyramide in Dresden<br />
Striezelmarkt und Nürnberg mit dem Kindel-Markt.<br />
Die wenigsten Leser werden dabei wissen,<br />
dass der Ursprung des Kindel-Marktes sehr<br />
wahrscheinlich schon bis in das 13. Jahrhundert<br />
zurückgeht und in der Schlesischen<br />
Region seinen Anfang nahm.<br />
Vor etwa 600 Jahren war es noch der<br />
Brauch, dass Bescherkinder nach der<br />
Ernte bei den Bauern wegen einer milden<br />
Gabe anklopften, die sie dann um die<br />
Weihnachtszeit an besonders bedürftige<br />
Mitmenschen verteilten. Bald übernahm<br />
diesen Samariterdienst nur noch ein Bescherkind,<br />
und noch in der Zeit des Mittelalters<br />
entstand aus diesem Brauch der<br />
Christkindelsmarkt. Während der Reformation<br />
verschlug es den Geistlichen Johannes<br />
Hess auch in die Schlesische Region,<br />
und als er das bunte Treiben in den Kirchen<br />
sah, erinnerte er sich vermutlich an<br />
die Tempelreinigung von Jesus Christus.<br />
Hess veranlasste daraufhin, dass der Weihnachtswarenverkauf<br />
und die Spiele auf die<br />
Straße verlagert wurden, und ließ bei seiner<br />
Rückkehr nach Nürnberg den Christkindelsmarkt<br />
im 16. Jahrhundert dort neu<br />
aufleben.<br />
Später wurde daraus ein Christkindelmarkt,<br />
der sich auch in der Niederschlesischen Region<br />
und damit in Görlitz großer Beliebtheit<br />
erfreute.<br />
anzeige<br />
Geschichte |<br />
11
Christkindelmarkt<br />
Christkindelmarkt 2007 in Görlitz<br />
Auf diesem Markt der Vorbereitung für<br />
das Fest handelte man unter anderem<br />
mit Gänsen, Karpfen, Pflaumenkartoffeln,<br />
Breslauer Pflastersteinen, Liegnitzer<br />
Bomben, Fischpfefferkuchen, Christbaumschmuck,<br />
Schnitzereien und Webstoffen.<br />
anzeige<br />
12<br />
Geschichte |
Christkindelmarkt<br />
in Schlesien geboren<br />
Damals lebte der Christkindelmarkt noch<br />
von besinnlicher Stille, und selbst die begleitenden<br />
Spiele über Rübezahl und seine<br />
Zwerge kamen ohne Phonstärken aus.<br />
In Görlitz stirbt der Christkindelmarkt um<br />
1922, weil sich die kommerziell denkenden<br />
Warenhäuser der einträglichen Sache annehmen<br />
und das Geschehen in ihre wärmeren<br />
Gefilde locken.<br />
Er wird nach dem Zweiten Weltkrieg leider<br />
mehr und mehr zum Trubelmarkt, denn<br />
die Menschen wollen sich nach Bombenalarm<br />
und ständiger Angst nun lautstärker<br />
amüsieren, um die Vergangenheit möglichst<br />
schnell zu verdrängen. Der Christkindelmarkt<br />
verlagert sich vom Marienplatz<br />
auf den Obermarkt, und Knecht Ruprecht<br />
sowie das Christkind müssen dem Weihnachtsmarkt<br />
weichen.<br />
In den letzten Jahren wurde der Christkindelmarkt<br />
wieder ein Erfolg. Die Görlitzer<br />
konnten auf dem Untermarkt (dort wo es<br />
ja begonnen hat) einen Christkindelmarkt<br />
erleben, der die weihnachtliche Traditionspflege<br />
Schlesiens im wahrsten Sinne des<br />
Wortes wieder erstrahlen ließ. Ob es die<br />
Empfangszeremonie des Görlitzer Kindel<br />
zwischen Schlesischer Fee und Bauernmädchen<br />
war, seine mehrtätige Marktvisite<br />
in traditioneller Begleitung von Knecht Ruprecht<br />
oder der Auftritt von Stadtschreiber<br />
und Stadtältesten, das Brauchtum konnte<br />
sich ohne größere Ecken und Kanten mit<br />
den neuzeitlichen Gewohnheiten arrangieren<br />
und diesen Weihnachtsmarkt zu einer<br />
wirklich positiven Bescherung für die hiesigen<br />
Bürger werden lassen.<br />
Dazu beigetragen haben natürlich auch<br />
solche lukullischen Nostalgieprodukte wie<br />
Breslauer Pflastersteine und Liegnitzer<br />
Bomben.<br />
Hans-Joachim Terp<br />
Zusammengestellt durch Eberhard Oertel<br />
anzeige<br />
Geschichte |<br />
13
Carl<br />
Preußische<br />
Samuel<br />
Zucht und Ordnung<br />
Geißler<br />
–<br />
anzeige<br />
Carl Samuel Geißler (Foto: Ratsarchiv Görlitz)<br />
Der bekannte Tuchfabrikant in Görlitz<br />
Furtstraße Carl Samuel Geißler<br />
(28.3.1775 – 4.2.1878), ein Bruder von<br />
Ernst Friedrich Geißler, Besitzer der Vierradenmühle.<br />
Carl Samuel Geißler war königlicher Kommerzienrat<br />
und von 1835 bis 1877 mit<br />
einer 2 jährigen Unterbrechung Stadtrat<br />
bzw. Stadtverordneter, Stadtältester und<br />
Träger der Roten Adler Ordens 4. Klasse.<br />
Carl Samuel Geißler hatte 8 Kinder, darunter<br />
5 Mädchen. Seine Tochter Agnes<br />
Therese Geißler (23.2.1825 – 13.12.<br />
1907) verliebte sich in einen Christian<br />
Franz Adolph Webel (6.2.1823 –<br />
8.5.1875), Sohn eines Buchhändlers<br />
und Druckereibesitzers in Leipzig.<br />
2 sehr interessante Liebesbriefe, die<br />
Adolph 1847 an seine Geliebte schrieb,<br />
sind in meinem Besitz.<br />
Nun sollte ja geheiratet werden, und<br />
Adolph wollte Bürger von Görlitz werden.<br />
Der zukünftige Schwiegervater Carl<br />
Samuel Geißler schrieb daraufhin am<br />
12. Juli 1847 nachfolgenden Brief an<br />
Adolph Webel nach Leipzig:<br />
„Aus Ihrem Geehrten ersehe ich Ihren<br />
festen und ernsten Entschluss, daher<br />
auch der meine feststeht, und zu ihrem<br />
und Agnes weiterem Gedeihen,<br />
als Vater nur herzlich Glück wünschen<br />
kann.<br />
Hoffend, daß Sie sich mit ernstlichem<br />
Eifer bemühen werden, in<br />
den Geschäftskreis tätig beizutragen,<br />
vorwärts schreiten zu suchen,<br />
wie es selbst bei mir und jedem tätigen<br />
Geschäftsmannes Pflicht ist,<br />
den Sorgenträger durch das Leben<br />
verändern, wo dann auch Fleiß und<br />
Mühe nicht unbelohnt bleiben wird.<br />
Herrmann Oettel das freundschaftliche<br />
Wort zu geben, mit Ihrer oben angeführten<br />
Bitte, halte ich für Pflicht und Artigkeit.<br />
Wegen dem nun zu erlangenden Bürgerrecht<br />
haben Sie nun die nötigen<br />
Atteste, als Tauf-, Lehr-, Militär- und<br />
Führungsattest Ihres letzten Herren<br />
beizufügen, und durch Gesuch einzureichen,<br />
haben Sie solches ausgefertigt,<br />
können Sie es an mich überschicken,<br />
da ich es selbst abgeben will.<br />
Inliegend ein Formular, in welcher Art<br />
Sie es ungefähr anfertigen können.<br />
Glück auf mit frohem Mut grüßt<br />
Ihnen freundschaftlich<br />
C.S.Geißler“<br />
14<br />
Geschichte |
Es war um 1850 schwierig, Görlitzer Bürger zu werden<br />
Carl Samuel Geißler<br />
anzeige<br />
Originalbrief von Carl Samuel Geißler an Adolph Webel<br />
Geschichte |<br />
15
Carl<br />
Preußische<br />
Samuel<br />
Zucht und Ordnung<br />
Geißler<br />
–<br />
Die Abbildungen zeigen Agnes Therese<br />
Webel geb. Geißler und den Kaufmann<br />
Christian Franz Adolph Webel.<br />
anzeige<br />
Am 11.04 1848 wurde dann geheiratet.<br />
Im Jahre 1854 gelangte das Grundstück<br />
Brüderstraße 13 in den Besitz von Adolph<br />
Webel und Frau Agnes Therese Webel<br />
geb. Geißler (Eingang Schwarze Gasse 4)<br />
Bei Richard Jecht, Tophographie der<br />
Stadt Görlitz, ist auf Seite 384 nachfolgendes<br />
vermerkt:<br />
„Brüderstraße 13 (Überbauung der<br />
Schwarze Gasse)<br />
Die Brauhöfe Brüderstraße 13 (Hyph.<br />
Nr, 13) und Brüdergasse 12 (Hyph. Nr.<br />
10) haben seit 1770 einen gemeinsamen<br />
Überbau über dem Schwarzen<br />
Gässchen; damit kam man überein, als<br />
der Advokat und Kämmerer und Heideverwalter<br />
Georg Geißler Nr. 13 baute,<br />
dass ihm die oberen 2 Fenster, dem Besitzer<br />
der Nr. 12 dem Schöppen Georg<br />
Lochmann, aber die unteren 2 Fenster<br />
eingeräumt wurden. Den Dachboden<br />
sollte jeder zur Hälfte haben. So ist der<br />
Besitzstand noch heute (1934).<br />
16<br />
Geschichte |
Es war um 1850 schwierig, Görlitzer Bürger zu werden<br />
Carl Samuel Geißler<br />
anzeige<br />
Brüderstraße 13<br />
Die Besitzer lassen sich bis 1427 nachweisen,<br />
u.a. 1755 wohnte als Mieter<br />
in diesem Haus der Buchdrucker Sigmund<br />
Ehrenfried Richter (Anm. Carl Sa-<br />
Geschichte |<br />
17
Carl<br />
Preußische<br />
Samuel<br />
Zucht und Ordnung<br />
Geißler<br />
–<br />
muel Geißler heiratete<br />
eine Amalie Therese<br />
Richter (1798 – 1876),<br />
und sein Bruder Ernst<br />
Friedrich heiratete auch<br />
eine Minna Emilie Richter<br />
(1812 – 1901), ob<br />
die Ehe aus dieser Familie<br />
stammt, konnte<br />
ich noch nicht ermitteln.<br />
Eventuelle Hinweise<br />
können der Redaktion<br />
Stadtbild übergeben<br />
werden – auch leihweise<br />
Dokumente).<br />
Weiter schreibt Richard<br />
Jecht: 1854 – 1908 war<br />
es im Besitz von Adolph<br />
Webel und Frau Agnes<br />
Theres Webel geb,.<br />
Geißler. Ab 1808 ist Besitzer<br />
der Kaufmann<br />
Louis Karger.“<br />
Die Familie Adolph Webel<br />
richtete in diesem<br />
Grundstück ein Textilgeschäft<br />
ein.<br />
anzeige<br />
Nebenstehende Annonce<br />
aus dem Neuem<br />
Görlitzer Anzeiger (NGA<br />
Nr. 294 Seite 2092 vom<br />
15.12.1878) zeigt das<br />
Angebot in diesem Geschäft.<br />
Jetzt befindet sich in diesem<br />
Laden die “Schlesische<br />
Schatztruhe“.<br />
18<br />
Geschichte |
Es war um 1850 schwierig, Görlitzer Bürger zu werden<br />
Carl Samuel Geißler<br />
Nachbemerkung:<br />
Aus der Ehe von Adolph Webel mit Agnes<br />
Therese Geißler gingen 3 Söhne hervor.<br />
Helene. Deren Eltern waren Emma Therese<br />
Rehfeld geb. Geißler (1822 – 1896)<br />
und des Fabrikbesitzers Karl Rehfeld<br />
(1814 – 1889).<br />
Die Abb. zeigt links<br />
Kaufmann und Stadtrat<br />
Felix Webel und<br />
rechts seine 2. Ehefrau<br />
Helene Rehfeld<br />
verw. Rösler.<br />
Wolfgang Stiller<br />
Einer der bekanntesten<br />
war Stadtrat Felix<br />
Webel (1848 – 1918).<br />
Felix Webel begründete<br />
sein Textilgeschäft<br />
auf dem Postplatz<br />
14/15 (Webel<br />
Haus und Brasserie).<br />
In zweiter Ehe war<br />
Felix Webel mit Helene<br />
Rehfeld verwitwete<br />
Rösler (1852 –<br />
1943) vermählt, Carl<br />
Samuel Geißler war<br />
der Großvater von<br />
anzeige<br />
Geschichte |<br />
19
9. <strong>November</strong> 1938 in Görlitz<br />
1938<br />
–<br />
In einer “Schriftlichen Nachweisung über<br />
die jüdischen Gewerbebetriebe” in Görlitz<br />
aus den frühen 1940er Jahren sind<br />
64 Unternehmen oder Personen aufgelistet.<br />
Für 35 davon war “kein Nachfolger”<br />
genannt. Sie waren ausgelöscht.<br />
Sonst liest man säuberlich untereinander<br />
“Vor- und Zuname des Erwerbers”<br />
verzeichnet, darunter nachmals recht<br />
bekannte Adressen. Vor ein paar Wochen<br />
spielte diese Liste aus dem Ratsarchiv<br />
eine Rolle, als im Vortragssaal des<br />
Schlesischen Museums Görlitz über die<br />
Vertreibung der Görlitzer Juden nach<br />
1933 berichtet wurde. Ein Vortragender<br />
schilderte faktenreich einige Beispie-<br />
Demoliertes Schaufenster Textilhaus Fischer, Bismarckstraße 29<br />
anzeige<br />
20<br />
Geschichte |
Rückblick nach vornnach vorn<br />
Verwüstetes Schaufenster Horn, Steinstraße 1<br />
le für die staatliche Ausplünderung von<br />
Görlitzern, die durch die Judengesetzgebung<br />
ihrer beruflichen Lebensgrundlagen<br />
beraubt wurden. Zugleich ließ der<br />
Referent durchblicken, daß er keine Namen<br />
späterer privater Nutznießer nennen<br />
werde, um nicht die Bekanntschaft<br />
hochbezahlter Rechtsanwälte einzelner<br />
“Erwerber”–Familien machen zu müssen.<br />
Dabei sind die Akten der Forschung<br />
zugänglich und teils publiziert. Tatsächlich<br />
häufen sich in jüngster Zeit vor unserer<br />
Haustür Fälle, daß vermögende<br />
Wirtschaftskreise durch Nötigung von<br />
Verlagen und Autoren unangenehme<br />
Fakten aus der Unternehmensgeschichte<br />
zu vertuschen suchen. Geht es dabei<br />
um Entrechtung und Beraubung einst-<br />
anzeige<br />
Geschichte |<br />
21
9. <strong>November</strong> 1938 in Görlitz<br />
1938<br />
–<br />
mals angesehener und um<br />
die Stadt verdienter Juden,<br />
kann man die Verdrängungsmanöver<br />
weichgespülter Saubermänner<br />
nur als reichlich<br />
unanständig bezeichnen. Gelegentliche<br />
Betroffenheitsrituale<br />
zu offiziellen Anlässen wirken<br />
da um so peinlicher.<br />
Wer hätte noch vor 20 Jahren<br />
hier so etwas für möglich<br />
gehalten? Erinnern wir uns<br />
deshalb an jenen Bericht der<br />
nationalsozialistischen “Oberlausitzer<br />
Tagespost” in Görlitz<br />
vom 10. <strong>November</strong> 1938 mit<br />
seinen rüpelhaften Pöbeleien:<br />
“Judenfeindliche Kundgebungen<br />
in Görlitz. Sturm gegen<br />
Görlitzer Judengeschäfte.<br />
Auch in Görlitz machten sich<br />
die erregten Gemüter in antisemitischen<br />
Aktionen Luft. In einigen<br />
Judenläden der Stadt übernahmen einige<br />
Görlitzer freiwillige “Aufräumungsarbeiten”,<br />
um dadurch ihrem Abscheu Ausdruck<br />
zu verleihen. So in dem jüdischen<br />
Synagoge Otto-Müller Straße, um 1925<br />
Ramschbasar Horn, Steinstraße, wo in<br />
den Auslagen das oberste zu unterst gedreht<br />
wurde. Außerdem wurden weitere<br />
Judenläden in der Bismarckstraße und<br />
am Grünen Graben in Mitleidenschaft<br />
anzeige<br />
22<br />
Geschichte |
Rückblick nach vornnach vorn<br />
dern der jüdischen Mischpoke<br />
auch in unserer Stadt die Augen<br />
öffnen. Wie die Nachforschungen<br />
der “Oberlausitzer<br />
Tagespost” ergaben, sind darüber<br />
hinaus folgende jüdische<br />
Geschäfte in Görlitz von<br />
der Aktion betroffen worden:<br />
Fischer, Bismarckstraße; Mendel<br />
& Baumann, Demianiplatz<br />
7; S. Freundlich, Adolf-Hitler-<br />
Straße 12. Wie wir weiter erfahren,<br />
haben ferner in den<br />
Wohnungen einiger Hebräer<br />
spontane “zivile Haussuchungen”<br />
stattgefunden, und<br />
zwar handelt es sich hierbei<br />
um folgende: Frenkel, Jakobstraße<br />
15; Pension Bendler<br />
(richtig: Baender, E.K.), Salomonstraße<br />
40; Cohn, Otto-Müller-Straße<br />
2; Dr. Blau,<br />
Inneres der Synagoge nach der Einweihung 1911<br />
gezogen. Wenn auch den Rebekkas und Klein-Biesnitz, Parkstraße 14.” Allerdings<br />
Salomons selbst nichts geschehen ist, so mißlang der Versuch, die Synagoge an<br />
werden vielleicht diese unmißverständlichen<br />
Äußerungen der kochenden Volkszen.<br />
Vorausgegangen waren Boykottak-<br />
der Otto-Müller-Straße in Brand zu setseele<br />
selbst den abgebrühtesten Mitglietionen<br />
gegen jüdische Juristen, Ärzte<br />
anzeige<br />
Geschichte |<br />
23
9. <strong>November</strong> 1938 in Görlitz<br />
1938<br />
–<br />
und Geschäftsleute<br />
1933, der verleumderische<br />
und geplatzte<br />
Prozeß gegen den<br />
sozialdemokratischen<br />
Konfektionshändler<br />
Artur Dresel mit dessen<br />
mysteriösem Tod<br />
im Gefängnis 1935,<br />
der rätselhafte Tod<br />
des Strumpffabrikanten<br />
Ludwig Cohn bald nach dessen Ein-<br />
Anteil am wirtschaftlichen und kultu-<br />
“Arisierte” Kofferfabrik Julius Arnade Görlitz-Moys<br />
lieferung in Buchenwald. Später folgten rellen Aufschwung in Görlitz zwischen<br />
die Deportation von Landgerichtsdirektor<br />
Dr. Schwenck und von Kofferfabri-<br />
Im Umgang mit diesem Erbe brauchen<br />
1850 und 1933 hatten.<br />
kant Arnade nach Auschwitz, der Tod wir keine wehleidigen protokollarischen<br />
des 84jährigen Eisenwarengroßhändlers Pflichtübungen und keine mutmaßende<br />
Martin Ephraim 1944 in Theresienstadt, Sensationsmache der Presse, sondern<br />
der Freitod des Arzt-Ehepaares Oppenheimer<br />
beim Lager Tormersdorf 1941, ches Gedächnis. Nur so richtet sich der<br />
Dankbarkeit, Aufrichtigkeit und ein wa-<br />
die Zerstreuung der einst blühenden Rückblick auf jenen beschämenden 9.<br />
Gemeinde nach deren Auflösung 1938 <strong>November</strong> 1938 nach vorn auf ein hoffentlich<br />
menschlicheres Morgen.<br />
(verzeichnet mit allen untergegangenen<br />
Gemeinden in der Gedenkstätte Yad<br />
Vashem). Es waren vaterländisch eingestellte<br />
Deutsche, Konservative oder Libe-<br />
Dr. Ernst Kretzschmar<br />
rale zumeist, die einen herausragenden<br />
anzeige<br />
24<br />
Geschichte |
Richard Jecht zum<br />
Jecht<br />
150. Geburtstag<br />
Was soll man über diesen Mann noch<br />
schreiben, wie ihn angemessen ehren??<br />
Eine gerechte allumfassende Beurteilung<br />
seines gewaltigen Lebenswerkes blieb<br />
bisher bruchstückhaft, skizzenhaft. Es<br />
fehlt leider bis heute eine umfassende<br />
Biographie. Richard Jechts Lebenswerk<br />
ist mit zwei besonderen Attributen zu<br />
charakterisieren: ungeheurer Fleiß, Heimatliebe<br />
und insbesondere Stolz auf die<br />
Geschichte seiner Heimatstadt.<br />
Wohl kein oberlausitzischer Historiker<br />
konnte sich bereits zu Lebzeiten einer<br />
vergleichbaren Menge unterschiedlichster<br />
Ehrungen erfreuen wie Richard Jecht.<br />
Auch in Zukunft wird sein gewaltiges<br />
Werk nicht dem Vergessen anheim fallen.<br />
Als „Kind des Historismus“, Philologe und<br />
zudem als Görlitzer Ratsarchivar legte er<br />
den größten Wert auf die Nutzung der<br />
überlieferten schriftlichen Quellen. Auch<br />
wenn sich selbstverständlich die wissenschaftlichen<br />
Fragestellungen veränderten<br />
und die von ihm kritisch betrachteten<br />
interdisziplinären Forschungen heute<br />
als selbstverständlich gelten, bleibt der<br />
Wert der Früchte seines Schaffens dauerhaft<br />
bestehen. Wie oft liest man heute<br />
ambitionierte Arbeiten von ambitionierten<br />
zumeist jungen Forschern, die keine<br />
einzige archivische Quelle nutzten! Oder<br />
die im schlimmsten Fall nicht einmal über<br />
das dazu nötige Handwerkszeug verfügen.<br />
Wie oft entsteht aus zwei vorliegenden<br />
eine „neue Veröffentlichung“? Wie<br />
oft werden genutzte Abhandlungen nicht<br />
kritisch auf den Wert und Umfang der<br />
darinnen genutzten Quellen geprüft? Wie<br />
viele Wissenschaftler verbringen heute<br />
noch unermüdlich Tag für Tag in Archiven,<br />
um erst einmal die Grundlagen für<br />
geschichtsphilosophische Verallgemeinerungen<br />
zu schöpfen, um tatsächlich Wissen<br />
zu schaffen?<br />
Nun, Richard Jecht selbst wäre wohl am<br />
glücklichsten, wenn er wüsste, dass die<br />
Erschließung der archivischen Quellen<br />
sowie die auf ihnen basierenden Forschungen<br />
zudem und nicht zuletzt unter<br />
dem Dach der Oberlausitzischen Gesellschaft<br />
der Wissenschaften durch seine<br />
legitimen Erben weitergeführt wird. Man<br />
könnte es auf einen einfachen Nenner<br />
bringen:<br />
anzeige<br />
Persönlichkeit | 25
Richard Jecht zum<br />
Jecht<br />
150. Geburtstag<br />
Richard Jecht im Ratsarchiv Görlitz<br />
Jecht zu ehren bedeutet nichts anderes<br />
als fleißig zu arbeiten. „Fleiß“ war das<br />
Jechtsche Credo.<br />
Richard Jecht: „Wir sind die<br />
Kärrner. Wir fahren die Bausteine<br />
zusammen, damit die<br />
Könige bauen können.“<br />
Am 25. Juli 1945 verstarb<br />
der 87-jährige Sekretär der<br />
Oberlausitzischen Gesellschaft<br />
der Wissenschaften, der<br />
Görlitzer Ehrenbürger und<br />
Ratsarchivar Richard Jecht<br />
im Krankenhaus Dresden<br />
Friedrichstadt fernab von<br />
seiner geliebten, selbst gewählten<br />
Heimatstadt. Die<br />
Sorgen ob der furchtbaren<br />
Zeitumstände und die damit<br />
verbundenen Ängste um<br />
den Erhalt des reichen kulturellen<br />
und wissenschaftlichen<br />
Erbes seiner oberlausitzischen<br />
Heimat sowie<br />
die Fortführung seines Lebenswerkes<br />
werden ihn<br />
schmerzlich bis zu seinem<br />
Ende bedrückt haben. Bereits seit dem<br />
Jahre 1943 lagerte man wegen drohender<br />
Luftangriffe die Masse der wertvol-<br />
anzeige<br />
26<br />
Persönlichkeit |
Richard Jecht zum<br />
Jecht<br />
150. Geburtstag<br />
len Bestände des Ratsarchivs und der<br />
Gesellschaftsbibliothek zum Großteil in<br />
das Stift Joachimstein bei Radmeritz/Radomierzyce<br />
aus. Die Räume des Görlitzer<br />
Ratsarchivs und jene im Haus Neißstraße<br />
30 waren nahezu leer. Würde dieser<br />
Born des Wissens nach Kriegsende wieder<br />
gefüllt sein? Wie würde die traditionsreiche<br />
oberlausitzische Wissenschaftsgesellschaft<br />
den Zusammenbruch des<br />
„Dritten Reiches“ überstehen? Bereits<br />
seit Februar 1945 war Görlitz ein „fester<br />
Platz“, welcher durch Wehrmacht, SS<br />
und Volkssturm verteidigt werden sollte.<br />
Richard Jecht gehörte zu den in jenen<br />
Tagen evakuierten Görlitzern. Die<br />
letzten Monate seines Lebens verbrachte<br />
er im Kreise seiner Angehörigen in Bad<br />
Schandau. Würde die geliebte Heimatstadt<br />
ein ähnliches Schicksal der Zerstörung<br />
treffen wie Breslau oder Lauban?<br />
Jechts Tod fiel in eine Zeit der Ungewissheit,<br />
der Zukunftsangst, der Not, aber<br />
auch der Hoffnung auf das nahe Kriegsende,<br />
auf Frieden. Zukunft braucht Vergangenheit.<br />
Vielleicht schöpfte Richard<br />
Jecht gerade aus dieser Tatsache Hoffnung<br />
für die Zukunft der Oberlausitz und<br />
seine Heimatstadt, für deren Ehre und<br />
für deren Wohl er nach seinem eigenen<br />
Verständnis nahezu sein ganzes Forscherleben<br />
unermüdlich wirkte.<br />
Am 3. März 1939 schreibt Richard Jecht<br />
anlässlich des selbst beantragten Eintrittes<br />
in den Ruhestand folgendes an den<br />
Görlitzer Oberbürgermeister: „Sehr geehrter<br />
Herr Oberbürgermeister!... Bei<br />
meinem endgültigen Abgange aus dem<br />
Dienst der Stadt Görlitz am 31. März<br />
1939 darf ich wohl bitten, dass keine offizielle<br />
Veranstaltung geschieht. Die Stadt<br />
hat bei Gelegenheit meines 80. Geburtstages<br />
am 3. September 1938 in so überaus<br />
gütiger Weise mich geehrt, dass ich<br />
jetzt darüber hinaus jede Kundmachung<br />
vermeiden möchte...“ Eine Ära Görlitzer<br />
Archivgeschichte, verbunden mit dem<br />
Namen Richard Jechts, ging still und bescheiden<br />
zu Ende, die Feder freilich konnte<br />
erst der Tod dem 87-jährigen aus der<br />
Hand nehmen.<br />
(Fortsetzung folgt)<br />
Roland Otto Ratsarchiv Görlitz<br />
anzeige<br />
Persönlichkeit | 27
<strong>November</strong>revolution<br />
Vor 90 Jahren –<br />
Die Revolution kam nicht ohne Vorboten.<br />
Der I. Weltkrieg kostete 2278 Görlitzer<br />
das Leben. Im August 1918 gab<br />
es Streiks und Hungerdemonstrationen<br />
der Maschinenbauer und Waggonbauer.<br />
1917 bildeten die oppositionellen Kräfte<br />
in der SPD eine Görlitzer Ortsgruppe<br />
der USPD. Aber am 9. <strong>November</strong> und<br />
kurz danach überstürzten sich die Ereignisse.<br />
Erst am 12. <strong>November</strong> erschien<br />
in der sozialdemokratischen “Görlitzer<br />
Volkszeitung” ein Überblick unter der<br />
Schlagzeile “Die Revolution in Görlitz –<br />
Die militärische und politische Macht in<br />
den Händen des Arbeiter- und Soldatenrates”.<br />
Über den 9. <strong>November</strong> war da<br />
zu lesen: “Noch am frühen Nachmittag<br />
hat wohl niemand daran gedacht, welche<br />
große Umwälzung der Abend bringen<br />
würde. Ihr Anfang lag in den Spätstunden<br />
des Nachmittags, in denen sich<br />
einzelne Trupps von Soldaten durch die<br />
Stadt bewegten. Die Teilnehmer wurden<br />
immer mehr, und um 6 Uhr abends staute<br />
sich eine große Anzahl von Soldaten<br />
und Zivilpersonen am Kaisertrutz, wo<br />
nach kurzem Widerstand der Wache die<br />
dort befindlichen Arrestanten herausgeholt<br />
wurden. Von hier aus ging es zum<br />
Postplatz, wo unter Hinzuziehung des<br />
Staatsanwalts die im Gerichtsgefängnis<br />
befindlichen Militärpersonen in Freiheit<br />
gesetzt wurden. Auf dem Bahnhof nahm<br />
der Arbeiter- und Soldatenrat durch eine<br />
an roten Armbinden kenntliche Soldaten-<br />
Patrouille seine Tätigkeit auf. Den immer<br />
größer werdenden Trupps, die mit jeder<br />
Minute stärker anschwollen, nahm sich<br />
die Sozialdemokratische Partei an, indem<br />
sie die von Soldaten stark durchsetzten<br />
Massen nach dem Konzerthaus zu einer<br />
Versammlung einlud. Dem wurde umgehend<br />
Folge gegeben, und im Nu hatte<br />
sich der Konzerthaussaal gefüllt. Die imposante<br />
Versammlung wurde von unserem<br />
Reichstagsabgeordneten Genossen<br />
Taubadel eröffnet. Nach der mit stürmischem<br />
Beifall aufgenommenen Ansprache<br />
wurde wie überall in deutschen<br />
Landen ein Arbeiter- und Soldatenrat gewählt,<br />
bestehend aus vier Vertretern der<br />
sozialdemokratischen Arbeiterschaft und<br />
acht Soldaten.” Vorsitzender des Rates<br />
wurde schließlich Paul Taubadel, Redak-<br />
anzeige<br />
28<br />
Geschichte |
<strong>November</strong>revolution in Görlitz<br />
<strong>November</strong>revolution 1918, Kaisertrutz, Zeichnung von Günter Hain 1988<br />
teur der “Görlitzer Volkszeitung”.<br />
Von der Bühne<br />
des Konzerthauses Leipziger<br />
Straße erklärten<br />
sich Oberbürgermeister<br />
Georg Snay und Stadtkommandant<br />
Oberst von<br />
Erxleben zur Zusammenarbeit<br />
bereit.<br />
Am Sonntagvormittag<br />
(10. <strong>November</strong>) wurden<br />
die nicht an der<br />
Front stehenden Soldaten<br />
auf dem Hof der<br />
Neuen Kaserne Trotzendorfstraße<br />
durch den Arbeiter-<br />
und Soldatenrat<br />
über die Lage unterrichtet.<br />
Für 13 Uhr war eine<br />
Kundgebung auf dem<br />
Obermarkt angesetzt.<br />
Dort sprachen Taubadel<br />
(SPD), Bähr (USPD) und<br />
ein Soldat Krüger vor jeweils<br />
kleineren Gruppen<br />
(noch fehlten ja Lautsprecher),<br />
anschließend<br />
anzeige<br />
Geschichte |<br />
29
<strong>November</strong>revolution<br />
Vor 90 Jahren –<br />
Demonstranten auf dem Obermarkt, 1. Mai 1919<br />
fen werden... Nicht das Experimentieren<br />
und das Zertrümmern des Staates, sondern<br />
ein Umformen von Staat und Gesellschaft<br />
und ein Hineinwachsen in den<br />
Sozialismus muß erfolgen. Jeder Bürgerkrieg<br />
muß vermieden werden. Gegen<br />
Extreme von allen Seiten müssen wir<br />
uns wenden.” Paul Taubadel nahm am<br />
Reichsrätekongreß im Dezember in Berbewegte<br />
sich ein Demonstrationszug<br />
zum Friedrichsplatz. Die SPD-Mitgliederversammlung<br />
am 13.11. mit dem Ortsvorsitzenden<br />
Hugo Cohn orientierte auf<br />
eine sozialistische Republik. Am 20.11.<br />
betonte der Görlitzer SPD-Sekretär Hugo<br />
Eberle im Konzerthaus Leipziger Straße:<br />
“Erbarmungslos muß in die Riesengewinne<br />
der Kriegswucherer eingegrif-<br />
anzeige<br />
30<br />
Geschichte |
<strong>November</strong>revolution in Görlitz<br />
lin teil und entschied sich mit der Mehrheit<br />
gegen ein Rätesystem nach sowjetrussischen<br />
Vorbild und für Wahlen zur<br />
Nationalversammlung einer bürgerlichparlamentarischen<br />
Republik. Die Wahl<br />
im Januar 1919 erbrachte in Görlitz bei<br />
einer Beteiligung von 90% für die SPD<br />
24173, für die DDP (Deutsche Demokratische<br />
Parie) 14085 Stimmen gegenüber<br />
49<strong>65</strong> Stimmen für die konservative<br />
DNVP (Deutschnationale Volkspartei),<br />
also eine überwältigende republikanische<br />
Mehrheit. Waffenstillstand, Republik,<br />
Achtstundentag, Frauenwahlrecht<br />
und Verhältniswahlsystem wurden als<br />
Fortschritte gefeiert.<br />
Aber bald folgten der Versailler Raubfriedensvertrag,<br />
Nachkriegskrise, Bürgerkrieg<br />
und politisches Chaos. Die ernüchterten<br />
Görlitzer wählten 1920 bei 89%<br />
Wahlbeteiligung: SPD 14133, DDP 7566,<br />
aber USPD 7012, KPD 280; die großbürgerliche<br />
DVP (Deutsche Volkspartei) verbuchte<br />
9848 Stimmen, die konservative<br />
DNVP 4510.<br />
In der Weltkriegsgeschichte der Garnison<br />
(Infanterie-Regiment Nr. 19) hieß<br />
es 1935 vorwurfsvoll: “Am 9. <strong>November</strong><br />
1918 hatten Arbeiter- und Soldatenräte<br />
auf unserem Kaisertrutz die rote Fahne<br />
gehißt” (Es blieb wohl die einzige auf einem<br />
öffentlichen Gebäude). Zum 10. Jubiläum<br />
erinnerte der liberale “Neue Görlitzer<br />
Anzeiger” unter dem Titel “Vor 10<br />
Jahren” etwas ironisch an die Revolutionstage.<br />
Da erfuhr man nun, auch von<br />
Zeitzeugen: “Nur ganz wenige glaubten<br />
am Sonnabendmittag, dem 9. <strong>November</strong><br />
1918, an ein Übergreifen der revolutionären<br />
Bewegung nach Görlitz. Wohl sah<br />
man einige Soldaten, die die Kokarde<br />
von der Mütze heruntergerissen hatten<br />
und mit frecher Miene höhnisch lächelnd<br />
grußlos an den wenigen Offizieren vorübergingen.<br />
Am frühen Nachmittag liefen<br />
die Nachrichten aus Berlin ein, daß dort<br />
die Revolution siegreich gewesen war.<br />
Hier ging alles seinen üblichen Gang bis<br />
nachmittags gegen 5 Uhr. Ein Soldat aus<br />
Dresden, Weinhold, der später hier eine<br />
sehr unrühmliche Rolle im S- u.A-Rat gespielt<br />
hat, war nachmittags gegen 4 Uhr<br />
hier angekommen, scharte einige Soldaten<br />
auf der Berliner Straße um sich...<br />
anzeige<br />
Geschichte |<br />
31
<strong>November</strong>revolution<br />
Vor 90 Jahren –<br />
Mit 20 bis 30 Mann wurde gegen 5 ¾<br />
Uhr der Kaisertrutz “erstürmt”, indem<br />
die Gefangenen herausgelassen wurden<br />
und vor dem Kaisertrutz ein baumlanger<br />
Soldat Ansprachen an die inzwischen<br />
angewachsene Menge der Neugierigen<br />
hielt, die immer in der Mahnung ausklang:<br />
Nur kein Blutvergießen, nur kein<br />
Blutvergießen. In Wirklichkeit war die<br />
Menge so friedlich wie möglich. Befreiung<br />
der politischen Gefangenen im Gerichtsgefängnis<br />
war die nächste Aufgabe<br />
der Soldaten und der Menschenmenge,<br />
die inzwischen auf etwa 200 Köpfe angewachsen<br />
war. In geschlossenem Zuge<br />
ging es über den Demianiplatz, wo vorsichtige<br />
Geschäftsleute die Rolläden herunterließen,<br />
nach dem Postplatz. Durch<br />
Verhandlungen mit der Staatsanwaltschaft<br />
wurde die Freigabe der Militärgefangenen<br />
erwirkt, etwa 20 an der Zahl.<br />
Gegen 7 ½ Uhr fand im Konzerthaus<br />
eine Versammlung der Garnison statt,<br />
zu der auch Zivilisten zugelassen waren,<br />
und es wurde der erste A-und S-Rat “gewählt”,<br />
d.h. die Anwärter nannten z.T.<br />
ihre Namen selber. Widerspruch erhob<br />
sich nicht, und so war die erste “Wahl”<br />
vollzogen. Auf dem Tisch vor dem “Revolutionstribunal”<br />
häuften sich die Degen<br />
der Offiziere, die in der Hauptsache<br />
von einem halbwüchsigen Soldaten unter<br />
dem Gejohle und Geschrei der Versammelten<br />
als “Gewehr über” in den<br />
Saal getragen wurden. Auf den Straßen<br />
wurden Handzettel ausgegeben, auf denen<br />
zur Teilnahme an einer Riesendemonstration<br />
am Sonntagmittag aufgefordert<br />
wurde. Diese Kundgebung war<br />
aber ein Fehlschlag, denn in Wirklichkeit<br />
fanden sich nur einige hundert Personen<br />
zusammen, die frierend vom Obermarkt<br />
nach dem Friedrichsplatz zogen und sich<br />
dort nach einigen “Hochs” usw. auflösten.<br />
Eine wirkliche Begeisterung konnte<br />
die ausgehungerte und verzweifelte Bevölkerung<br />
damals gar nicht aufbringen.”<br />
Die Weltwirtschaftskrise mit den katastrophalen<br />
Folgen der Abhängigkeit vom<br />
USA-Finanzkapital führte zu weiterer Ernüchterung.<br />
Von weit links wiederholte<br />
sich der Vorwurf von den “Arbeiterverrätern<br />
um Ebert und Scheidemann 1918”,<br />
während von rechts die Vokabeln “No-<br />
anzeige<br />
32<br />
Geschichte |
<strong>November</strong>revolution in Görlitz<br />
Käuferschlange an der Nonnenstraße im Hungerwinter 1917<br />
vemberverbrecher” und<br />
“Dolchstoß in den Rücken<br />
der kämpfenden<br />
Truppe” die Propaganda<br />
beherrschten. Nach<br />
knapp 15 Jahren war die<br />
1918 geborene Republik<br />
am Ende. Auch in Görlitz<br />
hatte sie Hoffnungen genährt<br />
und Enttäuschungen<br />
gebracht.<br />
Nach 90 Jahren ist die Erinnerung<br />
durch manches<br />
Wenn und Aber belastet.<br />
Zu schmerzlich waren<br />
die Turbulenzen und<br />
Katastrophen nach 1918.<br />
Keiner der seitdem praktisch<br />
ausprobierten gesellschaftlichen<br />
Gegenentwürfe<br />
war dauerhaft<br />
und vermochte zu überzeugen.<br />
Aber es bleibt<br />
heilsam, das Datum 9.<br />
<strong>November</strong> 1918 im Blick<br />
zu behalten.<br />
Dr. Ernst Kretzschmar<br />
anzeige<br />
Geschichte |<br />
33
Görlitzer<br />
Glocken meiner Heimatstadt<br />
Glocken<br />
Görlitz –<br />
Wer nach Görlitz als Gast<br />
oder Tourist kommt, hat<br />
noch das Glück, Glockenklang<br />
in vollen Zügen<br />
zu genießen. Wenn<br />
wir auch heute in einer<br />
lauten und hektischen<br />
Zeit leben, empfinden<br />
viele den bekannten<br />
Glockenklang als eine<br />
Stimme ihrer Heimatstadt.<br />
Den Wenigsten ist bekannt,<br />
daß Glocken<br />
eine fast 5000jährige<br />
Geschichte haben.<br />
Spätestens seit der<br />
Ausweitung des Christentums<br />
prägen Glocken – bedingt durch<br />
ihre Aushängung in Türmen – die Kultur<br />
und das Bild der Städte. Sie sind feste Werte<br />
im Wandel der Zeit, Manifeste kultureller<br />
Entwicklung.<br />
Die katholische Kirche „Hl. Kreuz“ auf der<br />
Struvestraße in Görlitz wurde in den Jahren<br />
1850 bis 1853 nach Plänen des Geheimen<br />
Oberbaurates Soller im neubyzantinischen<br />
Kirchweihe am 27.04.1853<br />
Stil erbaut. Sie ist die erste nach der Reformation<br />
erbaute katholische Kirche der<br />
Stadt. Die feierliche Einweihung erfolgte<br />
am 27. April 1853 durch den Breslauer<br />
Weihbischof Latussek.<br />
Der Magistrat der Stadt Görlitz unter Oberbürgermeister<br />
Jochmann schenkte der Gemeinde<br />
das erste Geläut, welches aus drei<br />
Glocken bestand.<br />
anzeige<br />
34<br />
Geschichte |
Görlitzer<br />
Katholische Pfarrkirche<br />
Glocken<br />
„Heilig Kreuz“<br />
Gegossen wurden sie in der Gießerei Hadank<br />
aus Hoyerswerda zu einem Wert von<br />
1 200 Talern.<br />
Nachdem das komplette Geläut im Sommer<br />
1852 auf der Industrieausstellung in<br />
Breslau gezeigt wurde, fand die Weihe dieser<br />
Glocken am 24. September 1852 statt,<br />
also 7 Monate vor der Kirchweihe.<br />
Die reich verzierten Klangkörper trugen<br />
auf der Haube einen Blattwerkfries, an der<br />
Schulter Medaillons mit Engelsköpfen und<br />
Friese sowie am Wolm umlaufend einen<br />
hängenden Akanthusblattfries und einen<br />
Rautenfries.<br />
Die große Glocke, Drm. 108 cm, auf den<br />
Namen „Melchior“ geweiht, wog 11 Zentner<br />
73 Pfund (586,5 kg) und war gestimmt<br />
auf den Nominal (frühere Bezeichnung<br />
Schlagton) g `.<br />
Die Inschrift lautete:<br />
S.AVGVSTINUS: IN OMNIBVS CARITAS<br />
(St. Augustinus: In Allem die Liebe)<br />
Darunter auf der Flanke ein Relief des Görlitzer<br />
Stadtwappens und die Inschrift:<br />
CIVES CONCIUIBVS SUIS<br />
(Die Bürger ihren Mitbürgern). Alle Glocken<br />
trugen auf der Rückseite das Relief<br />
eines Kruzifixes.<br />
Für die mittlere Glocke, Drm. 89 cm, mit<br />
5 Zentnern 106 Pfund (253 kg) und dem<br />
Nominal b ` wurde Maria als Schutzpatron<br />
gewählt. S.AVGVSTINUS: IN DUBIIS LI-<br />
BERTAS (St. Augustinus: Im Zweifelhaften<br />
die Freiheit) sowie das Görlitzer Stadtwappen<br />
waren auf der Flanke dieser Glocke als<br />
Inschrift und Glockenzier in ausgezeichneter<br />
Qualität gelungen. Die dritte und kleinste<br />
Glocke, Drm. 60 cm, mit einem Gewicht<br />
von 3 Zentnern 4 Pfund (151 kg), erhielt<br />
den Namen St. Joseph. Ihr Nominal war<br />
d ``. Neben den gleichen reichen Verzierungen<br />
wie bei den anderen zwei Glocken<br />
lautete hier die Inschrift:<br />
S.AVGVSTINVS: IN NECESSARIIS VNITAS<br />
(St. Augustinus: In der Not Einheit)<br />
Im 1. Weltkrieg wurden für das „Vaterland“<br />
die Glocken von den Türmen geholt.<br />
Auch die Gemeinde „Hl. Kreuz“ musste im<br />
Juni 1917 die große und die mittlere Glocke<br />
zur Ablieferung geben. Nur die Kleinste<br />
durfte als Läuteglocke behalten werden.<br />
Bis 1926 verrichtete diese allein ihren<br />
Dienst in der Gemeinde. Im selben Jahr<br />
konnte die Gemeinde ein neues Dreier-<br />
anzeige<br />
Geschichte |<br />
35
Görlitzer<br />
Glocken meiner Heimatstadt<br />
Glocken<br />
Görlitz –<br />
Geläut empfangen, von der<br />
schlesischen Glockengießerei<br />
Geittner & Söhne aus Breslau.<br />
Der Guss erfolgte am 18.Mai<br />
1926 in Anwesenheit einer<br />
Gemeindedelegation.<br />
75 Jahre nach ihrem Entstehen<br />
in der Gießerei Hadank<br />
verließ nun auch die kleine<br />
Glocke ihr Gemach, die Glockenstube,<br />
und wurde der<br />
Breslauer Firma in Zahlung<br />
gegeben, da der Wohlklang<br />
mit dem neuen Guss nicht<br />
gegeben war. Die am 2. Juni<br />
1926 geweihten Glocken hatten<br />
folgende Daten:<br />
Glocke 1<br />
Heldengedächtnisglocke<br />
Drm. 100 cm<br />
<strong>65</strong>0 kg<br />
Nominal g `<br />
Glocke 2<br />
Marienglocke<br />
Drm. 83 cm<br />
280 kg<br />
Nominal b ` Mittlere Glocke von Hadank und Sohn, 1852<br />
anzeige<br />
36<br />
Geschichte |
Görlitzer<br />
Katholische Pfarrkirche<br />
Glocken<br />
„Heilig Kreuz“<br />
Glocke der Firma Geitner, 1926<br />
Glocke 3<br />
Franziskusglocke<br />
Drm. 66 cm<br />
180 kg<br />
Nominal d ``<br />
Inschriften / Glockenzier:<br />
Auf der Platte das ovale Gießersiegel<br />
sowie an der Schulter<br />
ein Eichenlaubfries bei allen<br />
drei Glocken.<br />
Glocke 1<br />
„HELDEN – Gedächtnis – Glocke“<br />
darunter ein Kruzifix und die<br />
Jahreszahlen 1914 – 1918<br />
Rückseite: „Das Größte aber<br />
ist die Liebe“ 1926.<br />
Glocke 2<br />
„Ave Maria. Sei gegrüßt, Himmelskönigin“.<br />
Rückseite: Der Name der Stifterfamilie<br />
(nicht bekannt)<br />
Glocke 3<br />
“SANCTE FRANCISCE ORA<br />
PRO NOBIS”<br />
Rückseite: Gestiftet von Familie<br />
Erich Zimmer. 1926<br />
anzeige<br />
Geschichte |<br />
37
Görlitzer<br />
Glocken meiner Heimatstadt<br />
Glocken<br />
Görlitz –<br />
Aber auch diese Glocken<br />
ereilte das gleiche Schicksal<br />
wie ihre Vorgängerinnen.<br />
1942 wurden sie beschlagnahmt<br />
und der Rüstungsindustrie<br />
zugeführt. Wiederum<br />
nur die kleine, dem Hl.<br />
Franziskus geweihte Glocke<br />
blieb der Gemeinde erhalten,<br />
seit nunmehr 81 Jahren.<br />
Bis in das Jahr 1993 verrichtete<br />
diese Glocke allein ihren Dienst<br />
in dem historischen Holzglockenstuhl aus<br />
dem Jahre 1852. Dank einer großzügigen<br />
Spende aus Norddeutschland konnte 1993<br />
das Geläut ergänzt werden.<br />
Der Auftrag an die Gießerei Perner in Passau<br />
bestand darin, dass ein Dreiergeläut<br />
entsteht und die zwei neuen Glocken in der<br />
Nominaltonlinie zu der historischen Glocke<br />
passen.<br />
Am 12. Dezember 1993 erfolgte die Glockenweihe<br />
durch Bischof Rudolf Müller<br />
unter großer Anteilnahme der Görlitzer<br />
Katholiken. Der damals unterzeichnende<br />
Sachverständige Kantor Arnold Rißler aus<br />
Gießereisiegel der schlesischen Glockengießerei<br />
Niederoderwitz unterbreitete den Vorschlag,<br />
das Geläut mit einer vierten Glocke<br />
mit dem Nominal e `` zu ergänzen.<br />
Dieser Vorschlag wurde aufgegriffen, und<br />
so konnte 1995 erneut durch die Firma<br />
Perner diese Glocke gegossen und im Mai<br />
des Jahres geweiht werden.<br />
Die Glockengießerei Perner ist eine von<br />
noch 7 Gießereien in der Bundesrepublik,<br />
die sich dem Guss von Kirchenglocken verschrieben<br />
haben. Aus Budweis stammend,<br />
kann sie auf eine über 300 jährige Tradition<br />
im Glockenguss zurückblicken.<br />
Die Daten des neuen Geläutes der Kirche<br />
„Hl. Kreuz“ in Görlitz:<br />
anzeige<br />
38<br />
Geschichte |
Görlitzer<br />
Katholische Pfarrkirche<br />
Glocken<br />
„Heilig Kreuz“<br />
Glocke I II III IV<br />
Nominal: a ` + 7 c `` + 6 d ``` + 7 e `` +7<br />
Drm. / mm: 918 722 660 606<br />
Gießer: Perner Perner Geittner 7<br />
Gussjahr: 1993 1993 1926 1995<br />
Material: Bronze Bronze Bronze Bronze<br />
Gewicht / kg: ca. 4<strong>65</strong> ca. 280 ca. 180 129<br />
Glockenname: Hl. Bonifatius Hl. Hedwig Hl. Franziskus Hl. Erzengel Michael<br />
Inschriften:<br />
Glocke I:<br />
HL. BONIFATIUS: FÜR DIE INNERE EIN-<br />
HEIT UNSERES VOLKES<br />
Glocke II:<br />
HL. HEDWIG: UNSER JA ZUM UNGEBO-<br />
RENEN LEBEN<br />
Glocke III:<br />
SANCTE FRANCISCE ORA PRO NOBIS<br />
(Hl. Franziskus bitte für uns ) Gestiftet von<br />
Familie Erich Zimmer 1926 (Rückseite)<br />
Glocke IV:<br />
Reliefbildnis: Erzengel Michael im Kampf<br />
mit dem Drachen<br />
HL. ERZENGEL MICHAEL VERTEIDIGE<br />
UNS IM KAMPF. GEGEN DIE BOSHEIT UND<br />
NACHSTELLUNGEN DES TEUFELS SEI UN-<br />
SER SCHUTZ.<br />
2005 machte es sich erforderlich, den historischen<br />
Glockenstuhl von 1852 zu sanieren.<br />
Mit Hilfe von Mitteln aus der Altstadtstiftung<br />
konnte eine denkmalgerechte<br />
Sanierung des Glockenstuhles erfolgen.<br />
In jeder Stadt gibt es Standorte, von denen<br />
man zu festlichen Anlässen mehrere<br />
Kirchengeläute hören kann, und deshalb<br />
ist es immer sinnvoll, wenn Geläute musikalisch<br />
aufeinander abgestimmt sind.<br />
Empfinden wir Glockenklang doch nicht als<br />
störende Lärmbelästigung. Sie haben es<br />
ohnehin schwer, sich im Lärmpegel unserer<br />
heutigen Zeit durchzusetzen.<br />
Glockenklang ist ein akustisches Symbol<br />
für Glauben, Heimat und Tradition, für Geborgenheit<br />
und Besinnung.<br />
Dipl. – Ing. (FH) Michael Gürlach<br />
anzeige<br />
Geschichte |<br />
39
Die Oberlausitz im Dreißigjährigen Krieg<br />
Die Besetzung der Oberlausitz<br />
durch Sachsen brachte<br />
zunächst einmal “friedliche<br />
Zeiten”. Sie wirkte sich aber<br />
bei ständigen Einquartierungen<br />
und Kriegskontributionen<br />
auf ihre Weise aus.<br />
1628 stellte sich die Lage so<br />
dar, dass viele arme Bürger<br />
aus Verzweiflung Selbstmord<br />
begangen hatten und andere<br />
geflohen waren. Auf dem<br />
Lande kam es sogar dazu,<br />
dass ganze Dörfer “entlaufen”<br />
wollten und alte, gute<br />
tapfere Leute von Adel erklärten,<br />
von ihren Gütern<br />
fortgehen zu müssen. Die<br />
Lage war so verzweifelt, dass<br />
sich jeder aussuchen konnte,<br />
ob er lieber in einer zerstörten<br />
Stadt leben wollte oder<br />
aber in eine ziehen, die demnächst zerstört<br />
werden würde.<br />
Andererseits drängten aber auch Flüchtlinge<br />
aus Böhmen und Schlesien in die<br />
Oberlausitz. So nahm Zittau, die am<br />
Wallenstein, Kupferstich um 1625<br />
nächsten gelegene Stadt, an einem Tag<br />
zu Ostern um die 320 Flüchtlinge auf.<br />
Am Sonntag darauf kamen noch weitere<br />
638 dazu. - Das ganze Land war völlig<br />
schutzlos. - So verkauften die in Pen-<br />
anzeige<br />
40<br />
Geschichte |
Deutsch-Ossig<br />
zig liegenden Kaiserlichen ihren mitgebrachten<br />
Wein teuer, den sie sich dann<br />
zu ihrer Beköstigung umsonst schmecken<br />
ließen.<br />
Ein anderer Mißbrauch in dieser schwierigen<br />
Zeit ließe sich am besten mit dem<br />
Begriff “Frau als Ware” umschreiben.<br />
Hier zeigt sich die ganze Ohnmacht und<br />
Entmündigung der Bevölkerung, die aus<br />
Furcht vor dem Krieg die Folgen des<br />
Krieges in Kauf nahm und demütig stillhielt.<br />
Auf der Höhe seiner Macht ging es Kaiser<br />
Ferdinand und seinem Gefolgsmann<br />
Wallenstein zu gut. Er erließ am 6. März<br />
1629 das Restitutionsedikt. Damit sollten<br />
sämtliche jemals angeeignete Kirchengüter<br />
herausgegeben werden. Das<br />
ging gegen den Glauben, der aber hier<br />
handfest durch Besitz untermauert war.<br />
Und damit verstand auch Bier-Jörgen<br />
keinen Spaß mehr.<br />
Wallenstein, der Herzog von Friedland,<br />
befand sich ja nur wenige Meilen von<br />
der Oberlausitz entfernt und streckte<br />
seine Hand nach ihr aus. Er hatte seine<br />
Truppen bereits im Quartier. Das hieß<br />
klar und deutlich: Rekatholisierung, wie<br />
sie in Böhmen und Schlesien bereits erfolgt<br />
war und womit rein juristisch auch<br />
die Macht gesichert wurde. Da er damit<br />
aber zu hoch nach den Sternen gegriffen<br />
hatte, brachte seine vorläufige Absetzung<br />
Zeit zum Atemholen im Kriegsverlauf.<br />
Aber die Lage war klar. Fand sich<br />
einer, der Wallenstein im Kampf begegnen<br />
konnte, war mit der Frontlinie unmittelbar<br />
in der Oberlausitz zu rechnen.<br />
Und der neue Gigant auf dem Kriegsschauplatz<br />
war in Sicht; Schweden blieb<br />
in Anbetracht seiner unmittelbaren Bedrohung<br />
nur noch der Eintritt in den<br />
Krieg. An seiner Seite nun er sächsische<br />
Kurfürst Johann Georg.<br />
Auch auf den Schlachtfeldern und im<br />
Hinterland wurde gestorben. Gustav<br />
Adolf II, der Schwedenkönig, fiel, ebenso<br />
Pappenheim und Tilly, Magdeburg<br />
wurde zerstört. Wallenstein erlag seinen<br />
Intrigen und seinem Machthunger.<br />
Nur Johann Georg blieb am Leben und<br />
konnte sich 1635 als erster Sieger feiern<br />
lassen. Am 30. Mai kamen die beiden<br />
Lausitzen endgültig zu Kursachsen.<br />
anzeige<br />
Geschichte |<br />
41
Die Oberlausitz im Dreißigjährigen Krieg<br />
Ermordung Wallensteins auf einem zeitgenössischen Flugblatt<br />
Der Bier-Jörg wechselte (zum wievielten<br />
Male nur?) Lager und Bundesgenossen.<br />
Das führte die Schweden in die Oberlausitz.<br />
anzeige<br />
42<br />
Geschichte |
Deutsch-Ossig<br />
Mit wechselndem Kriegsglück setzten<br />
sie sich schließlich hier in Jahren 1639<br />
bis 1641 fest. Am 16. Mai 1639 fielen sie<br />
über die Dörfer und ihre Bewohner her.<br />
Von den größeren Ortschaften Ostritz,<br />
Bernstadt, Seidenberg und Rothenburg<br />
liegen darüber zeitgenössische Berichte<br />
vor. Der Görlitzer Kreis hatte 14.354<br />
Taler zu zahlen, die Stadt die stattliche<br />
Summe von 9.645 Talern.<br />
General Torstenson stellte als Gegenleistung<br />
dafür einen Schutzbrief aus.<br />
Aber der war, wie es sich herausstellte,<br />
nur Papier. Denn es “streiften noch starke<br />
Parteien herum und verübten gegen<br />
den armen Landmann allerhand cruseliteten<br />
mit Niederhauen, Schänden der<br />
Weibsbilder, Abschneiden der Ohren<br />
und Nasen, Wegnehmung des Viehes<br />
und andere Mobilien”.<br />
Am 18. Oktober kam für zwei Jahre ein<br />
Regiment Dragoner nach Görlitz. Es<br />
stand unter dem Kommando von Oberstleutnant<br />
Jakob Wancke. Über diese Zeit<br />
heißt es, dass Görlitz nie vorher und nie<br />
wieder nachher eine solche Drangsal erlebte.<br />
Die Not auf dem Lande war noch<br />
größer. Bevor die Schweden abzogen,<br />
wurde Görlitz 1641 zwei volle Monate<br />
von den Sachsen belagert. Die Stadt<br />
war selbstverständlich ein Trümmerhaufen,<br />
die darin verbliebene Bevölkerung<br />
dezimiert und ohne Existenzgrundlage.<br />
Mit dem Friedensschluß 1648 haben<br />
die Schweden selbst auf Befehl Wrangels<br />
den Wancke verurteilt. Es wurde<br />
befunden, “daß Wancken wegen seine<br />
greulichen, ganz unerhörten Fürnehmens<br />
zu selbst wohlverdienter Strafe,<br />
andern aber zum abscheulichen Exempel,<br />
sein ungetreues Herz aus dem Leibe<br />
geschnitten, auf das Maul geschlagen,<br />
dann der Leib lebendig in 4 Theile<br />
zerhauen und auf 4 Pfähle an 4 Ecken<br />
der Welt gesteckt werden solle”.<br />
(Fortsetzung folgt)<br />
Dieter Liebig, Volker Richter, Zusammengestellt<br />
durch Dr. Ingrid Oertel<br />
anzeige<br />
Geschichte |<br />
43
Görlitzer<br />
Geschichten aus dem Görlitzer Stadtverkehr<br />
Persönliche Erinnerungen an die Ikarus<br />
66- Omnibussse<br />
Natürlich gehört zum Görlitzer Stadtverkehr<br />
seit Ende der dreissiger Jahre des<br />
vorigen Jahrhunderts auch ein – wenn<br />
auch anfangs nicht<br />
so sehr ausgeprägter<br />
– Busverkehr.<br />
Deshalb werden diesem<br />
von Zeit zu<br />
Zeit auch Beiträge<br />
zu widmen sein. In<br />
den sechziger Jahren<br />
prägte kein Bustyp<br />
unser historisches<br />
Stadtbild so<br />
nachhaltig wie der<br />
Ikarus 66. Brüllend<br />
schoben sich diese<br />
Ungetüme durch<br />
die zuweilen engen<br />
Wg. 14 nach seiner GR 1966<br />
Straßen der Innenstadt, zeitweise sogar<br />
auch die Breitscheid- und Elisabethstraße.<br />
Das wirkte trotz des sie stets umgebenden<br />
Lärms auf mich als Kind bereits<br />
im Vorschulalter überaus beeindruckend.<br />
Ohne hier eine genauere geschichtliche<br />
Einordnung vorwegzunehmen (die späteren<br />
Folgen vorbehalten bleiben soll),<br />
möchte ich anhand von zwei Ereignissen<br />
aus dem Jahre 1966 verdeutlichen,<br />
wie ich selbst dem Kult dieser einzigartigen<br />
Fahrzeuge hoffnungslos erlag,<br />
ohne die ich ganz sicher nie zu einer<br />
so ausgeprägten Liebe für die Görlitzer<br />
Straßenbahn gekommen wäre. Am Kindertag<br />
führten die Görlitzer Verkehrsbe-<br />
anzeige<br />
44<br />
Geschichte |
Görlitzer<br />
Persönliche Erinnerungen<br />
Stadtverkehr<br />
unvergessen. Eine<br />
weitere Episode waren<br />
die Ferienspiele<br />
im Sommer desselben<br />
Jahres. Die Kinder<br />
unserer Schule<br />
verbrachten sie<br />
in der ehemaligen<br />
Hohenzollernburg,<br />
damals Domizil der<br />
1. Oberschule. Von<br />
hier aus erfolgten<br />
Wg. 19+18, 1.6.1966 im Kloster Marienthal<br />
Wanderungen und<br />
ßenbahndepot an diesem wolkenverhangenen<br />
Tag die Ausfahrt der Busse, gens die Anfahrt vom Hotel Monopol<br />
kurze Ausfahrten, aber eben auch mor-<br />
welche dann in Gestalt zweier funkelnagelneuer<br />
Ikarus 66, den Nummern 18 tags die Rückfahrt dorthin, wobei meist<br />
aus mit einem Ikarus 66 und nachmit-<br />
und 19, erfolgte. Sogar die Sitze verfüg-<br />
über die Kunnerwitzer - seltener die Zit-<br />
ten noch über Schutzfolien aus Zellophan.<br />
Vor der Kulisse der jahrhundertealten<br />
Mauern des Klosters entstand<br />
dann ein Bild beider Busse, und ich kann<br />
stolz sagen, dass ich als 8 jähriger Bub<br />
neben dem Fotograf gestanden habe.<br />
Dieser Ausflug blieb<br />
mir bis heute – auch<br />
wegen der Busse –<br />
triebe alljährlich mit den Sprösslingen<br />
ihrer Beschäftigten einen Busausflug<br />
durch. 1966 war das Kloster Ostritz- Marienthal<br />
als Zielort ausgewählt worden.<br />
Ungeduldig erwarteten wir mit unseren<br />
Eltern und Geschwistern vor dem Stra-<br />
anzeige<br />
Geschichte |<br />
45
Görlitzer<br />
Geschichten aus dem Görlitzer Stadtverkehr<br />
tauer - Straße gefahren wurde. Eines<br />
Tages erschien ein äußerlich nagelneuer<br />
Ikarus 66 ohne Betriebsnummer mit<br />
grünen anstelle der sonst grauen oder<br />
braunen Sitze,´und in welchem es nach<br />
frischer Farbe und Leder roch. Wenige<br />
Tage später war an ihm die Nummer 14<br />
angeschrieben, und es zierte ihn beidseitig<br />
ein farbiges Stadtwappen mit grünen<br />
Flügeln. Heute weiß ich, dass dieser<br />
Bus seinerzeit frisch von der Generalreparatur<br />
aus Dresden gekommen ist. Er<br />
verfügte sogar über Positionslampen an<br />
den vorderen Dachrändern, die sonst<br />
eher ein Merkmal von Reisebussen waren.<br />
Fortan konnten wir Kinder uns jedes<br />
Jahr in Görlitz über einen oder zwei<br />
neue Busse freuen, die eigentlich keine<br />
waren. Übrigens kamen die farbig hinterlegten<br />
Linienschilder, wie sie das Foto<br />
erkennen lässt, ausschließlich im Herbst<br />
des Jahres 1966 zum Einsatz. Es gab<br />
grüne (A), rote (B), blaue (E), gelbe (F)<br />
und auch schwarze (D) Schilder. Den Innenraum<br />
eines Ikarus 66 fanden wir trotz<br />
der oft schlechten Belüftung durchaus<br />
gemütlich. Die begehrtesten Sitzplätze<br />
waren jene auf der hinteren Bank und<br />
da besonders die äußeren. Viele mögen<br />
die Ära ähnlich erlebt haben wie ich, für<br />
mich jedoch signalisierten die geschilderten<br />
Ereignisse den Beginn einer Leidenschaft,<br />
die mich seitdem nicht mehr<br />
losgelassen hat und ohne die möglicherweise<br />
viele kleine Details und Bilder aus<br />
der Geschichte unserer Tram unweigerlich<br />
verloren gegangen wären. Eine vorher<br />
bereits vorhandene Faszination für<br />
Busse und Bahnen bekam damals einen<br />
Namen: Görlitz.<br />
Andreas Riedel, Wiesbaden<br />
(Fortsetzung folgt)<br />
anzeige<br />
46<br />
Geschichte |
Machen Sie Ihrer Familie, Ihren Freunden und Bekannten oder sich selbst<br />
ein ganz besonderes Geschenk.<br />
In der Görlitz-Information der Europastadt Görlitz-Zgorzelec GmbH werden Sie<br />
garantiertfündig:Theater-undVeranstaltungstickets,Stadtführungen,Wochenendarrangements<br />
oder die Görlitzer Schatzkiste, ein hochwertiger Koffer mit<br />
regionalen Spezialitäten. Und wenn Sie sich nicht entscheiden können, verschenken<br />
Sie einfach einen unserer Gutscheine. Wir freuen uns auf Sie.<br />
Aktuelle Öffnungszeiten:<br />
Montag - Freitag 09.00 - 18.00 Uhr, Samstag 09.30 - 16.00 Uhr, Sonntag/Feiertag 09.30 - 14.00 Uhr<br />
Obermarkt 32, 02826 Görlitz, Fon: 03581 47 57 0, Fax: 03581 47 57 47, willkommen@europastadt-goerlitz.de