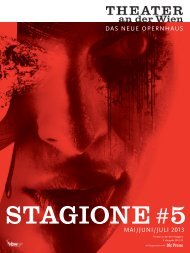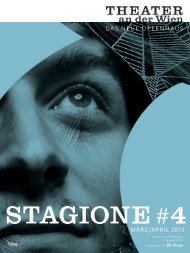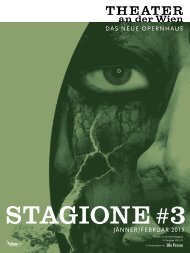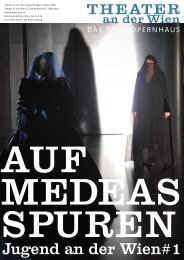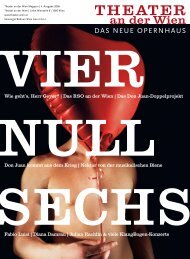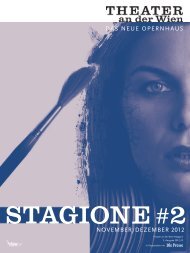Stagione #2 - Theater an der Wien
Stagione #2 - Theater an der Wien
Stagione #2 - Theater an der Wien
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
oper Im Dezember<br />
im Himmel vereint<br />
Initialzündung für das Genre oper: monteverdis L’Orfeo. Von Konrad Kuhn<br />
als sich die mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Florentiner<br />
Camerata, einem Kreis hum<strong>an</strong>istisch gebildeter<br />
adeliger, um 1600 mit dem verhältnis<br />
von (deklamierter) sprache und<br />
musik beschäftigten, war ihr ziel, die<br />
<strong>an</strong>tike Tragödie wie<strong>der</strong> zum Leben zu<br />
erwecken. sie hatten also nichts weniger<br />
im sinn als die entwicklung einer neuen<br />
musikalischen Gattung. so blieben die<br />
ersten versuche, Dramentexte mit musik<br />
zu unterlegen, denn auch blutleer; m<strong>an</strong><br />
muss Jacopo peris Euridice ebenso wie<br />
Giulio Caccinis gleichnamiges Werk als<br />
rein akademisches experiment bezeichnen.<br />
erst als das m<strong>an</strong>tu<strong>an</strong>er Gegenstück<br />
zur Florentiner Camerata, die academia<br />
degli invaghiti, den Komponisten Claudio<br />
monteverdi (1567-1643), <strong>der</strong> im Dienste<br />
<strong>der</strong> Fürsten von m<strong>an</strong>tua st<strong>an</strong>d, 1607 damit<br />
beauftragte, <strong>an</strong>knüpfend <strong>an</strong> peri und<br />
Caccini ein musikalisches orpheus-Drama<br />
zu schaffen, entst<strong>an</strong>d ein Werk, das m<strong>an</strong><br />
nach 400 Jahren operngeschichte mit Fug<br />
und recht als Initialzündung für das Genre<br />
oper bezeichnen k<strong>an</strong>n.<br />
Dabei stellte auch monteverdi das primat<br />
<strong>der</strong> sprache gegenüber <strong>der</strong> musik nicht<br />
infrage. In <strong>der</strong> beh<strong>an</strong>dlung des monodischen<br />
Ges<strong>an</strong>gs, <strong>der</strong> damals gerade dabei<br />
war, die zuvor alles beherrschende polyphonie<br />
als neue stilrichtung abzulösen,<br />
griff er jedoch auf die im (mehrstimmigen)<br />
madrigal gebräuchliche Technik zurück,<br />
einzelne begriffe als schlüsselworte mit<br />
musikalischen mitteln affektiv aufzuladen.<br />
so wird die musik in monteverdis L’Orfeo<br />
nicht nur zur verstärkenden untermalung<br />
eines im vor<strong>der</strong>grund stehenden Textes,<br />
son<strong>der</strong>n zum mittel, diesen Text auszudeuten<br />
und ihm dadurch eine neue ausdrucksebene<br />
zu verleihen, die erst durch<br />
das hinzutreten <strong>der</strong> musik entsteht. Die<br />
dabei <strong>an</strong>gew<strong>an</strong>dten musikalischen Formen<br />
sind vielfältig; T<strong>an</strong>zsätze und strophenlie<strong>der</strong><br />
kommen ebenso vor wie immer<br />
wie<strong>der</strong>kehrende, rein instrumentale zwischenspiele,<br />
„ritornell“ o<strong>der</strong> „sinfonia“<br />
gen<strong>an</strong>nt. Den größten Teil des Textes vertonte<br />
monteverdi jedoch als rezitativ. und<br />
hier erreicht <strong>der</strong> Komponist eine psychologische<br />
Wahrhaftigkeit, die seinen Orfeo<br />
bis heute zu einem <strong>der</strong> meisterwerke <strong>der</strong><br />
Gattung macht.<br />
Die b<strong>an</strong>dbreite <strong>der</strong> musikalisch zur Darstellung<br />
kommenden Gefühlslagen <strong>der</strong><br />
protagonisten ist groß. emotionale extrembereiche<br />
werden erkundet und in kontrastreichen<br />
stimmungen von <strong>der</strong> musik<br />
ausgemalt. Im zentrum steht <strong>der</strong> Titelheld:<br />
von <strong>der</strong> Idylle des vollkommenen<br />
Liebesglücks stürzt er unvermittelt in die<br />
abgrundtiefe verzweiflung über die Nachricht<br />
vom Tod <strong>der</strong> eben erst <strong>an</strong>getrauten<br />
Geliebten euridice. orfeo bäumt sich<br />
auf gegen diesen schicksalsschlag, den er<br />
nicht bereit ist zu akzeptieren. er gerät<br />
in lebensferne bereiche, die monteverdi<br />
in seiner unterweltmusik suggestiv zum<br />
Klingen bringt. und er endet, nachdem er<br />
sich endgültig mit dem verlust euridices<br />
John Mark Ainsley Mari Eriksmoen Ivor Bolton<br />
abfinden muss, in totaler verlassenheit.<br />
eine begegnung mit seinem vater apollo<br />
weist ihm schließlich den Weg <strong>an</strong> jenen<br />
ort, wo er wie<strong>der</strong> mit euridice vereint sein<br />
darf: im himmel.<br />
Ivor bolton, <strong>der</strong> vor zehn Jahren bereits<br />
in münchen mit einem monteverdi-zyklus<br />
große erfolge feiern konnte, erarbeitet mit<br />
dem Freiburger barockorchester den neuen<br />
Orfeo am <strong>Theater</strong> <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>Wien</strong>. hinzu<br />
treten das monteverdi Continuo ensemble,<br />
das mit seiner reichen palette historischer<br />
Continuo-Instrumente für eine differenzierte<br />
ausgestaltung <strong>der</strong> rezitativischen<br />
passagen sorgen wird, sowie <strong>der</strong> arnold<br />
schoenberg Chor.<br />
Die erlesene besetzung wird von John<br />
mark ainsley <strong>an</strong>geführt, <strong>der</strong> die ungemein<br />
<strong>an</strong>spruchsvolle partie des orfeo<br />
seit Jahren im repertoire hat. In weiteren<br />
hauptrollen sind mari eriksmoen, die bezaubernde<br />
zerbinetta <strong>der</strong> letzten spielzeit,<br />
als euridice, Katija Dragojević als messagiera<br />
und sper<strong>an</strong>za sowie in <strong>der</strong> rolle <strong>der</strong><br />
musica, die den prolog bestreitet, suz<strong>an</strong>a<br />
ograjensek als unterweltgöttin proserpina<br />
und als Ninfa, phillip ens als Caronte<br />
und pluto sowie mirko Guadagnini als<br />
apollo zu erleben. Für die Inszenierung<br />
zeichnen <strong>der</strong> regisseur Claus Guth und<br />
<strong>der</strong> bühnen- und Kostümbildner Christi<strong>an</strong><br />
schmidt ver<strong>an</strong>twortlich, die am <strong>Theater</strong> <strong>an</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>Wien</strong> zuletzt mit <strong>der</strong> szenischen version<br />
von händels Messiah einen Triumph<br />
feiern konnten.<br />
oper Im Dezember<br />
Reise ins Reich <strong>der</strong> Schatten<br />
regisseur Claus Guth im Gespräch mit Dramaturg Konrad Kuhn zu monteverdis L’Orfeo.<br />
Mit Claudio Monteverdis L’orfeo, uraufgeführt<br />
1607 am Hof des Herzogs von M<strong>an</strong>tua,<br />
beginnt die Entwicklungsgeschichte des Genres<br />
Oper – nach weniger bedeutenden ersten<br />
Versuchen – eigentlich erst richtig. Ein starker<br />
Beginn! Was <strong>an</strong> Operntypischem steckt<br />
schon im L’orfeo? Was fasziniert uns bis<br />
heute <strong>an</strong> diesem Stück?<br />
Wenn m<strong>an</strong> sich mit monteverdis L’Orfeo<br />
beschäftigt, ist es ein bisschen so, als ob<br />
m<strong>an</strong> sich, von etwas sehr weitgehend ausdifferenziertem<br />
kommend, wie<strong>der</strong> zurück<br />
gräbt zu den Wurzeln. Die einfachsten Wirkungsdynamiken<br />
treten auf geradezu minimalistische<br />
Weise zu Tage, so dass einem<br />
klar wird, aus welchen musikdramaturgischen<br />
elementen so ein stück im Grunde<br />
zusammengesetzt ist. Ich empfinde es<br />
als eine art ohrmuschel-reinigung, mich<br />
damit zu beschäftigen. es ist frappierend,<br />
wie wenig es braucht, um ungeheure emotionale<br />
stimmungswechsel auszudrücken.<br />
Wenn ich mich dabei selbst beobachte,<br />
stelle ich fest, dass m<strong>an</strong> den zuschauer<br />
erst einmal dahin führen muss, das aufzunehmen.<br />
Da unsere ohren durch unsere<br />
hörgewohnheiten so voll sind mit eindrücken<br />
und Tönen, muss m<strong>an</strong> die sensation,<br />
die in diesem minimalismus steckt, erst<br />
einmal wahrnehmen lernen. erst nach einer<br />
gewissen zeit <strong>der</strong> beschäftigung bin<br />
ich ins staunen geraten; zu beginn ist<br />
da einiges <strong>an</strong> mir vorbeigerauscht. Das<br />
kommt vielleicht auch daher, weil ich mich<br />
in <strong>der</strong> letzten zeit sehr viel mit strauss<br />
und Wagner beschäftigt habe. abgesehen<br />
von purcells King Arthur und Fairy Queen<br />
ist es meine erste begegnung mit dem<br />
Frühbarock in <strong>der</strong> musik.<br />
bei purcell herrscht zwar ein großer Ideenreichtum,<br />
aber nicht diese dramaturgische<br />
stringenz wie bei monteverdi. es gibt in<br />
L’Orfeo, für den monteverdi auf ein reich<br />
besetztes orchester zurückgreifen konnte,<br />
zwar schon von <strong>der</strong> Instrumentierung her<br />
eine reihe von effekten. aber <strong>der</strong> aufw<strong>an</strong>d<br />
ist ungleich geringer als zum beispiel bei<br />
Komponisten des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts. Die<br />
unterwelt-musik wirkt deshalb so überraschend,<br />
weil plötzlich eine neue Instrumentengruppe<br />
eingesetzt wird, die m<strong>an</strong><br />
bis dahin nicht zu hören bekommen hat.<br />
In <strong>der</strong> späteren entwicklung <strong>der</strong> barockoper,<br />
etwa bei händel, passiert es einem<br />
häufig, dass m<strong>an</strong> die Form als relativ schematisch<br />
empfindet: es gibt bestimmte arientypen,<br />
die immer wie<strong>der</strong> vorkommen;<br />
das prinzip <strong>der</strong> Da capo-arie als solches,<br />
auch wenn es virtuos geh<strong>an</strong>dhabt wird, ist<br />
im vergleich zu monteverdi vorhersehbar.<br />
Dem gegenüber ist L’Orfeo dramaturgisch<br />
absolut zwingend.<br />
Daraus entwickelt sich eine sogwirkung:<br />
Das stück schraubt sich immer tiefer ins<br />
zentrum <strong>der</strong> Geschichte. Da gibt es keinen<br />
Nebenfiguren-schnickschnack nach dem<br />
motto „jetzt kriegt <strong>der</strong> noch seine arie“,<br />
son<strong>der</strong>n es geht in einer aberwitzigen Geradlinigkeit<br />
vorwärts. Nicht umsonst lautet<br />
die von monteverdi und seinem Librettisten<br />
striggio gewählte Gattungsbezeichnung<br />
„una favola in musica“: eine Geschichte<br />
wird durch die musik erzählt.<br />
bei späteren Werken monteverdis ist das<br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>s: Während m<strong>an</strong> L’Orfeo als „h<strong>an</strong>dlung“<br />
bezeichnen könnte, ist Il ritorno di<br />
Ulisse in patria für mich eher eine „atmos-<br />
phäre“.<br />
8 9<br />
Claus Guth