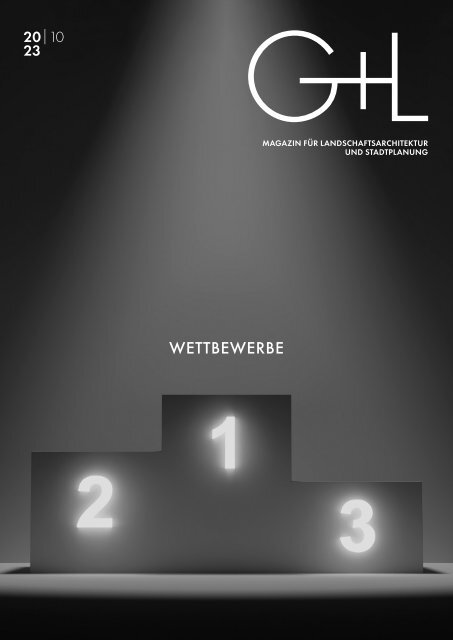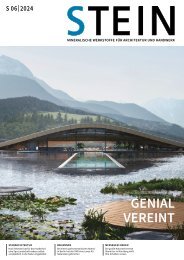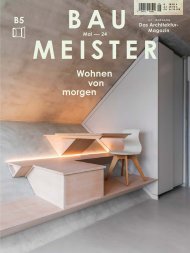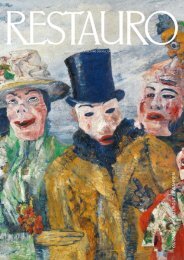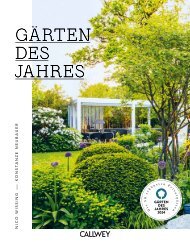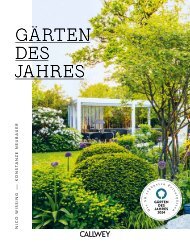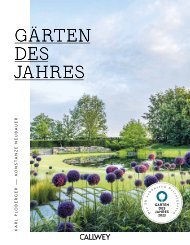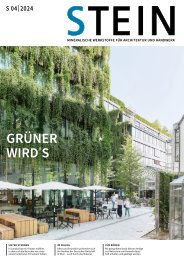G+L 10/2023
Wettbewerbe
Wettbewerbe
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
20|<strong>10</strong><br />
23<br />
MAGAZIN FÜR LANDSCHAFTSARCHITEKTUR<br />
UND STADTPLANUNG<br />
WETTBEWERBE
EDITORIAL<br />
Nicht nur beim Sport, auch bei Planungswettbewerben<br />
gibt es eine*n Sieger*in<br />
sowie zweite und dritte Plätze – zumindest<br />
bei den in diesem Heft vorgestellten<br />
Wettbewerben. Mehr ab Seite 16.<br />
Stephan Lenzen,<br />
Josephine Facius, Ute<br />
Aufmkolk, Martin<br />
Rein-Cano, Timo<br />
Herrmann, Peter Zec,<br />
Irene Lohaus, Tobias<br />
Nowak, Lola Meyer<br />
und Theresa<br />
Keilhacker – danke<br />
Ihnen allen, dass Sie<br />
in diesem Heft<br />
Position bezogen<br />
haben.<br />
Gewinnen in unserem Wettbewerbswesen immer dieselben? – Ja,<br />
nein, jein. Eine Frage, drei Antworten. Wer genau was gesagt hat,<br />
das verrate ich hier nicht; nur, dass ich im Vorfeld dieses Heftes mit<br />
AW Faust (SINAI), Franz Reschke (FRL) und Martin Rein-Cano<br />
(Topotek 1) zum aktuellen Wettbewerbswesen in Deutschland<br />
gesprochen habe. Drei Büroinhaber, drei Perspektiven. Gleiches bei<br />
der Frage, ob junge Büros bei Wettbewerben heute eine Chance<br />
haben und ob die gerufenen Jurymitglieder tatsächlich unvoreingenommen<br />
agieren. Auch hier wieder: eine Frage, drei Antworten.<br />
Schönen Dank die Herren. Könnt ihr nicht eine Meinung vertreten?<br />
Leichter wär‘s.<br />
Aber um leicht geht es hier nicht. Um leicht kann es in diesem<br />
Heft nicht gehen. Denn: Wettbewerbe sind echt. Viel. Arbeit. Und<br />
anstrengend. Und komplex. Und manchmal nervig. Für alle Beteiligten.<br />
Ja, auch für die Kommunen. Und deswegen haben wir es uns<br />
mit der vorliegenden Ausgabe der <strong>G+L</strong> auch alles andere als leicht<br />
gemacht. In dieser feiern wir die herausragendsten Wettbewerbe<br />
der letzten zwölf Monate und diskutieren zugleich mit den mitunter<br />
namhaftesten Planer*innen dieses Landes intensiv und provokant<br />
sämtliche Fragen zum deutschen Wettbewerbswesen – für manch<br />
einen gar ein bisschen zu hitzig. Aber es ist eben ein brandaktuelles<br />
Thema – und so wichtig.<br />
Denn: Wettbewerbe sichern im besten Fall höchst demokratisch die<br />
Innovation und Qualität unserer Baukultur – und dennoch geht<br />
die Zahl ihrer Auslobungen immer weiter zurück. Und das ist „nur“<br />
die große Misere neben all den kleinen Miseren, wie der, dass nur<br />
noch eine gewisse Planungselite sämtliche Wettbewerbe für sich<br />
entscheidet, dass junge Büros konsequent von kommunalen Auslober*innen<br />
unterschätzt werden (bzw. dank bürokratischer Hürden<br />
überhaupt gar keine Chance haben) oder auch dass es viel zu<br />
wenige offene Verfahren gibt. Das alles kann doch nicht auf die<br />
Baukultur einzahlen.<br />
Berlins Wettbewerbskultur gehe weiter den Bach hinunter, sagte uns<br />
Theresa Keilhacker, Präsidentin der Architektenkammer im Interview.<br />
Tatsächlich müssen wir uns die Frage stellen, ob nicht die<br />
Wettbewerbskultur der kompletten Bundesrepublik den Bach runtergeht<br />
und wir hier dringend gegensteuern müssen. Was sagen Sie,<br />
liebe Leser*innen? Schreiben Sie es mir.<br />
Ob der Grüne Loop<br />
in Billwerder von<br />
Loidl oder die Neuen<br />
Ufer von relais – die<br />
wichtigsten<br />
Wettbewerbsentscheidungen<br />
der<br />
letzten zwölf Monate<br />
stellen wir in diesem<br />
Heft nochmal vor.<br />
Das Interview finden<br />
Sie ab Seite 56.<br />
Coverbild: Joshua Golde via Unsplash; Illustration: Laura Celine Heinemann<br />
THERESA RAMISCH<br />
CHEFREDAKTION<br />
t.ramisch@georg-media.de<br />
<strong>G+L</strong> 3
INHALT<br />
AKTUELLES<br />
06 SNAPSHOTS<br />
09 MOMENTAUFNAHME<br />
E-rdgeschraubt<br />
WETTBEWERBE<br />
<strong>10</strong> VOM FREIEN WETTBEWERB UND DEM FREIEN MARKT<br />
Über Divergenzen im Wettbewerbswesen und was sich dagegen tun ließe<br />
14 „WETTBEWERBE KANN MAN NICHT NEBENHER BEARBEITEN“<br />
bdla-Präsident Stephan Lenzen im Interview<br />
18 „FÜR FAIR HALTE ICH DAS WETTBEWERBSWESEN NICHT“<br />
Fünf Fragen an Josephine Facius von impuls Landschaftsarchitekten<br />
22 „MAN KANN UNSEREN BERUFSSTAND GAR NICHT GENUG FEIERN“<br />
Ute Aufmkolk aus der Jury des Deutschen Landschaftsarchitektur-Preises im Interview<br />
28 „ICH WÜNSCHE MIR INDIVIDUELLERE ENTWURFSHALTUNGEN“<br />
Martin Rein-Cano über anonyme Wettbewerbe und entwurflliche Handschriften<br />
32 „MIT DEN GANZEN VERFAHRENSBESCHRÄNKUNGEN IST<br />
KEINEM GEDIENT“<br />
bdla-Vizepräsident Timo Herrmann über Wettbewerbe als hohes Gut<br />
40 „GUTES DESIGN VEREINT VIER QUALITÄTEN“<br />
Fünf Fragen an Peter Zec, den Initiator und CEO von Red Dot<br />
44 „KEINE ANGST VOR JUNGEN PLANUNGSBÜROS“<br />
Landschaftsarchitektin Irene Lohaus im Interview<br />
48 „DIE VORHANDENEN REGULARIEN SIND NICHT DAS PROBLEM“<br />
Fünf Fragen an Landschaftsarchitekt und Stadtplaner Tobias Nowak<br />
52 „EIN MEHRWERT, DEN HERKÖMMLICHE VERFAHREN NICHT BIETEN“<br />
Geschäftsführerin Lola Meyer über die Aktualität des Wettbewerbs Europan<br />
56 „WIR SEHEN ABSOLUT KEINE BESSERUNG“<br />
Theresa Keilhacker zum Wettbewerbswesen und Verfahren in Berlin<br />
Auf den Seiten zwischen den Interviews stellen wir Ihnen Wettbewerbe aus <strong>2023</strong> vor.<br />
PRODUKTE<br />
Herausgeber:<br />
Deutsche Gesellschaft<br />
für Gartenkunst und<br />
Landschaftskultur e.V.<br />
(DGGL)<br />
Pariser Platz 6<br />
Allianz Forum<br />
<strong>10</strong>117 Berlin-Mitte<br />
www.dggl.org<br />
58 LÖSUNGEN<br />
Spezial: FSB <strong>2023</strong><br />
RUBRIKEN<br />
62 Impressum<br />
62 Lieferquellen<br />
63 Stellenmarkt<br />
64 DGGL<br />
66 Sichtachse<br />
66 Vorschau<br />
<strong>G+L</strong> 5
VOM<br />
FREIEN<br />
WETTBE-<br />
WERB UND<br />
DEM FREIEN<br />
MARKT<br />
Die Anzahl der offenen Wettbewerbe hat sich in Deutschland seit 2018 mehr als halbiert.<br />
Dabei gilt der freie Wettstreit doch als das Instrument, um attraktive Lösungen im Planungswesen<br />
zu finden. Andererseits bemängeln vor allem die Planenden selbst oft die unattraktiven<br />
Verfahrensbedingungen. Wie kommt es zu dieser Divergenz, und was lässt sich dagegen tun?<br />
Im Gespräch mit zwei Büroinhabern und Vertreter*innen aus der Stadtplanung suchen wir im<br />
Folgenden Antworten.<br />
JULIA TREICHEL<br />
<strong>10</strong> <strong>G+L</strong>
WETTBEWERBE<br />
VOM FREIEN WETTBEWERB UND DEM FREIEN MARKT<br />
AUTORIN<br />
Julia Treichel<br />
absolvierte an der<br />
TU München den<br />
Bachelor und Master<br />
in Landschaftsarchitektur<br />
und arbeitete<br />
in diversen Büros in<br />
München. Derzeit ist<br />
sie freiberuflich unter<br />
anderem im Kollektiv<br />
LaPensilina tätig und<br />
engagiert sich in<br />
Theorie und Praxis<br />
zu sozialen und<br />
gestalterischen<br />
Fragen der Umwelt.<br />
„Offene Verfahren sind tatsächlich maximal<br />
uninteressant und eigentlich auch<br />
volkswirtschaftlicher Irrsinn. Hier werden<br />
Unmengen an Zeit, Geld und Kreativität<br />
verbrannt.“ So radikal drückt es Felix<br />
Metzler, Geschäftsführer des Landschaftsarchitektur-<br />
und Stadtplanungsbüros<br />
Toponauten, aus. Mit seiner Einschätzung<br />
ist der Landschaftsarchitekt nicht allein.<br />
Denn in den vergangenen Jahren zeigt sich<br />
ein fallender Trend in der Wettbewerbslandschaft.<br />
Die Plattform competitionline<br />
veröffentlich dazu jährlich eine ausführliche<br />
Statistik. Ihr Fazit für 2022 ist bedrückend.<br />
Der Wettbewerb nimmt als Planungswerkzeug<br />
an Bedeutung ab. In nüchternen<br />
Zahlen bedeutet dies, dass Bund, Länder<br />
und Kommunen 2022 insgesamt 397<br />
Planungswettbewerbe auslobten. Im<br />
Vergleich zum Vorjahr sind das rund<br />
2,5 Prozent weniger. Und bereits damals<br />
sprach der Vorstandsvorsitzende der<br />
Bundesstiftung Baukultur, Reiner Nagel,<br />
im Hinblick auf die Anzahl der Planungswettbewerbe<br />
von einem Armutszeugnis.<br />
QUALITÄT DURCH WETTBEWERB<br />
Gleichsam gilt der Architekturwettbewerb<br />
als Kür der Ideenfindung: „Kommunen<br />
profitieren von den hochwertigen<br />
Planungsergebnissen. Die Begleitung<br />
durch ein solches Verfahren und die<br />
Jurysitzungen im Rahmen der Verfahren<br />
liefern wertvolle Argumente für spezielle<br />
Planungsfragen“, betont Jonas Bellingrodt<br />
vom Amt für Stadtplanung, Umwelt und<br />
Klimaschutz der Stadt Freising. Daniel<br />
Lindemann, Geschäftsführer bei Gornik<br />
Denkel Landschaftsarchitektur, unterstützt<br />
diese Ansicht: „Gerade im Zusammenhang<br />
mit der Weitsicht im Städtebau<br />
entstehen so wichtige Impulse – auch für<br />
aktuelle Projekte.“ Neben der Chance für<br />
Kommunen sieht er außerdem einen hohen<br />
Stellenwert für die Planungsbüros selbst:<br />
„Alle unsere Wettbewerbe waren bedeutend<br />
und haben uns weitergebracht.“ Er<br />
bezieht dabei explizit auch jene Verfahren<br />
ein, in denen das Büro ohne Auszeichnung<br />
blieb. Denn aufgrund der vielfältigen<br />
Kooperationen mit anderen Disziplinen<br />
und der Bearbeitung von unterschiedlichsten,<br />
innovativen Aufgabenstellungen seien<br />
sie alle von Relevanz gewesen.<br />
Was die beiden unabhängigen Stimmen<br />
gleichsam zeigen: Der Wettbewerb kann<br />
durchaus als Instrument zur Qualitätssicherung<br />
und Innovation – sowohl für<br />
Kommunen als auch Planer*innen –<br />
dienen.<br />
ANZAHL DER WETTBEWERBE NIMMT<br />
WEITER AB<br />
Wie kommt es trotzdem zum bereits<br />
beschriebenen Negativtrend? Denn die<br />
Zahlen, die competitionline auflistet, sind<br />
ein unumstößlicher Fakt. Gerade im<br />
Objetkttyp Landschaft und Freiraum<br />
verzeichnetet die Statistik 2022 mit einem<br />
Minus von 23 Wettbewerbsauslobungen<br />
im Vergleich zum Vorjahr einen besonders<br />
starken Rückgang. Bei den städtebaulichen<br />
Projekten und im Wohnungsbau<br />
waren es jeweils 15 Wettbewerbsverfahren<br />
weniger. Und auch im Sektor Büround<br />
Verwaltungsbauten sank die Zahl der<br />
Auslobungen von 44 im Jahr 2021 auf<br />
37 ein Jahr später. Allein der Schulbau<br />
erlebte einen Aufwärtstrend mit einem<br />
Plus von 14 ausgeschriebenen Wettbewerbsverfahren.<br />
Dabei fällt auf, dass auch einst entwicklungsstarke<br />
Bundesländer von dem Trend<br />
betroffen sind. Baden-Württemberg etwa,<br />
das weithin als branchenstark im Bausektor<br />
gilt, verzeichnete im vergangenen Jahr<br />
laut competitionline einen Rückgang von<br />
acht Wettbewerben. Gemeinsam mit<br />
Hessen führt das südwestliche Bundesland<br />
damit die deutschlandweite Negativentwicklung<br />
an. Hoffnung schenken die<br />
Zahlen aus Sachsen und Bremen. Der<br />
Stadtstadt verzeichnete ein Plus von neun<br />
Wettbewerben und im Freistaat wurden<br />
2022 insgesamt 19 Verfahren ausgeschrieben,<br />
was gar ein Plus von 15<br />
bedeutet. Die Zunahme sieht Christian<br />
Steinborn, Vorsitzender des Ausschusses<br />
Wettbewerb und Vergabe der Architektenkammer<br />
Sachsen im Nachholeffekt<br />
nach der Corona-Pandemie begründet.<br />
2022 sei das erste Jahr gewesen, in<br />
dem Gremien und Gemeinden wieder<br />
weitgehend unbeeinflusst von Corona-<br />
Einschränkungen agieren konnten,<br />
äußerte er bei competitionline. Dementsprechend<br />
seien wieder vermehrt Wettbewerbe<br />
ausgeschrieben worden.<br />
Gleichzeitig beschreibt er eine zweite<br />
spannende Entwicklung. Denn nicht nur<br />
Leipzig tut sich als deutschlandweit<br />
wettbewerbsstärkste Kommune hervor.<br />
Vielmehr schreiben in Sachsen mittlerweile<br />
auch vermehrt kleinere Gemeinden<br />
Wettbewerbe aus.<br />
AUSLOBENDE STEHEN VOR HOHEM<br />
AUFWAND<br />
Diese Entwicklung ist dahingehend<br />
bemerkenswert, dass der allgemeine<br />
<strong>G+L</strong> 11
„FÜR FAIR HALTE ICH<br />
DAS WETTBEWERBS-<br />
WESEN NICHT“<br />
Das noch junge Büro impuls Landschaftsarchitekten gewann dieses Jahr, im Team mit weiteren<br />
Planer*innen, den ersten Preis beim Wettbewerb um das Modellvorhaben Erfurt Mitte Südost.<br />
Dass sich ein solches Vorhaben lohnt – auch weil sich dadurch weitere Anfragen ergeben –,<br />
bestätigt impuls-Mitbegründerin Josephine Facius. Wenn es darum geht, wie fair das deutsche<br />
Wettbewerbswesen für junge Büros ist, fällt ihre Antwort jedoch kritischer aus.<br />
FRAGEN: THERESA RAMISCH<br />
INTERVIEWEE<br />
Josephine Facius<br />
studierte Landschaftsarchitektur<br />
an der<br />
Fachhochschule<br />
Erfurt. Zusammen mit<br />
ihrem Ehepartner<br />
Philipp Facius und<br />
Holgar Ehrensberger<br />
gründete sie 2017<br />
das Büro impuls<br />
Landschaftsarchitektur<br />
in Jena.<br />
Josephine Facius, wie fair ist aus Ihrer<br />
Perspektive das deutsche Wettbewerbswesen<br />
für junge Büros, die noch nicht<br />
so viele Referenzprojekte vorweisen<br />
können?<br />
Beim Prüfen der verschiedenen Bewerbungsverfahren<br />
habe ich oft den Eindruck,<br />
bereits in den geforderten Voraussetzungen<br />
erkennen zu können, welche Art von<br />
Büro sich die Auftraggebenden wünschen<br />
bzw. wie viel Offenheit gegenüber dem<br />
Ergebnis besteht.<br />
Ich verstehe natürlich, dass Auftraggebende<br />
kein Risiko eingehen möchten bei einer<br />
großen Summe Geld, die sie investieren.<br />
Zu glauben, dass ein größeres, etabliertes<br />
Büro automatisch verlässlicher, erfahrener<br />
und deshalb sicherer sei als ein jüngeres<br />
Büro, halte ich jedoch nicht für die logische<br />
Schlussfolgerung.<br />
Insbesondere in wirtschaftlich angespannteren<br />
Zeiten erhärtet sich der Eindruck,<br />
dass Auftraggebende die Rahmenbedingungen<br />
verschärfen, um so mehr Sicherheit<br />
zu erhalten. In den Phasen des<br />
Baubooms erschienen uns die Forderungen<br />
offener; sowohl auf die Bewerbungen<br />
bezogen als auch auf die Planungsaufgaben<br />
selbst.<br />
Als vor einigen Jahren vermehrt die<br />
Kategorie „junges Büro“ einen vereinfach-<br />
ten Zugang zu Ausschreibungen erhielt, kam der Vorwurf der<br />
Altersdiskriminierung auf. Aktuell liegt für mich jedoch der<br />
Umkehrschluss nahe, der gezielte Ausschluss von jüngeren Büros.<br />
Wie soll ich beispielsweise jemals eine Gartenschau planen,<br />
wenn ich für den Wettbewerb zur Planung einer Gartenschau<br />
bereits eine geplante Gartenschau nachweisen muss? Kooperationsmodelle<br />
wie Bietergemeinschaften oder Eignungsleihe sind<br />
dafür zwar mögliche Optionen, aber bergen meiner Ansicht<br />
nach auch ein zu hohes Risiko für die jüngeren Büros, im Fahrwasser<br />
des etablierten Büros nicht angemessen gewürdigt zu<br />
werden. Das kommt aber natürlich auf die Partnerschaft an<br />
und ist kein pauschales Urteil.<br />
Für mich stellt sich die grundsätzliche Frage, ob die Abfrage von<br />
Referenzen überhaupt gerechtfertigt ist. Theoretisch betrachtet,<br />
ist man als Landschaftsarchitekt*in in den Architektenkammern<br />
gelistet. Hierfür ist unter anderem der Nachweis des Studiums<br />
und eine gewisse Arbeitserfahrung erforderlich. Ich bin daher<br />
offiziell dazu befähigt, jede Leistung in meinem Fachgebiet<br />
zu erbringen. Ist dies nicht eigentlich schon Referenz genug?<br />
Kurz gesagt: Nein, für fair halte ich das Wettbewerbswesen<br />
nicht.<br />
Welche Änderungen würden Sie sich wünschen?<br />
Losziehungen halte ich für ausreichend und ein unabhängiges<br />
Auswahlverfahren. Je nach Umfang der Planung noch<br />
ein Nachweis der Versicherung, dass diese das geplante<br />
Projekt abdeckt.<br />
Als Inhaber*in eines Unternehmens muss ich sowieso immer in<br />
der Lage sein, realistisch einzuschätzen, ob ich eine geforderte<br />
Leistung fachlich und wirtschaftlich erbringen kann – auch im<br />
Vorfeld eines Wettbewerbs. Für mich ist es daher eigentlich eine<br />
18 <strong>G+L</strong>
WETTBEWERBE<br />
INTERVIEW: JOSEPHINE FACIUS<br />
unternehmerische Fragestellung an mich<br />
selbst und weniger eine danach, ob ich<br />
jemand anderen erst davon überzeugen<br />
muss, dass ich die notwendigen Rahmenbedingungen<br />
erfülle.<br />
Ihr Büro impuls Landschaftsarchitekten<br />
hat dieses Jahr unter anderem gemeinsam<br />
mit Octagon Architekturkollektiv und<br />
team red den ersten Preis beim Modellvorhaben<br />
Erfurt Mitte Südost gewonnen.<br />
Herzlichen Glückwunsch nochmal. Lohnt<br />
sich ein Wettbewerb dieser Größenordnung<br />
aus finanzieller Perspektive?<br />
Grundsätzlich lohnt sich im Speziellen<br />
dieses Vorhaben finanziell, da bereits<br />
Fördermittel zu einigen Realisierungsbereichen<br />
in naher Zukunft bewilligt sind. Der<br />
Umfang allein wird für die kommenden<br />
Jahre eine gewisse Auslastung im Büro<br />
erzeugen und auch positive Nebeneffekte<br />
schaffen. Bereits jetzt ergeben sich weitere<br />
Anfragen nur aufgrund dieses Wettbewerbsgewinns.<br />
Angenommen Pierre de Meuron würde<br />
morgen bei Ihnen anklopfen, um mit<br />
Ihnen einen Wettbewerb zu machen.<br />
Würden Sie es machen?<br />
Auf jeden Fall! Ich würde mich zwar ein<br />
wenig über die Anfrage wundern, die<br />
Zusammenarbeit würde mich dennoch<br />
sehr interessieren. Ich befürchte aber,<br />
dass wir nicht die erforderlichen Referenzen<br />
hätten.<br />
Generell gehen wir Zusammenarbeiten<br />
sehr offen an und nutzen gerade bei<br />
Wettbewerben gern die Möglichkeit,<br />
unser Netzwerk zu erweitern und weitere<br />
Zusammenarbeiten zu etablieren. So sind<br />
viele unserer Kontakte zu Architekt*innen<br />
im Zusammenhang mit Wettbewerben<br />
entstanden; sei es durch die gemeinsame<br />
Arbeit oder weil wir durch eine Platzierung<br />
auf uns aufmerksam machten.<br />
Foto: Karina Bickel<br />
Ist es derzeit überhaupt möglich, als<br />
junges Wettbewerbsbüro in Deutschland<br />
gut zu überleben? Was sind Ihre größten<br />
Herausforderungen?<br />
Tatsächlich sehe ich in den Bewerbungsverfahren<br />
die größte Hürde, für junge<br />
Büros und auch uns, überhaupt an<br />
Wettbewerben teilnehmen zu können.<br />
Weiterhin habe ich zunehmend den<br />
Eindruck, dass die bestehenden Büros<br />
immer größer werden und kaum noch<br />
Interesse an der Selbstständigkeit bei<br />
jüngeren Menschen besteht. Auch, weil<br />
es schwieriger geworden ist, Projekte zu<br />
akquirieren? Vielleicht.<br />
Wir selbst hatten viel Glück damit, dass<br />
wir in unseren ersten Jahren, als damals<br />
noch dreiköpfiges Team, Unterstützung<br />
und Partner in Holgar Ehrensberger<br />
fanden. Mithilfe seiner Erfahrung, Netzwerk<br />
und Referenzen wurden Türen<br />
geöffnet, die wir im Alleingang nicht<br />
einmal hätten berühren können. In dieser<br />
Folge ist es auch heute für uns ein wenig<br />
einfacher, sich zu bewerben.<br />
Ich kann mir kaum vorstellen, wie es ohne<br />
den „etablierten Part“ überhaupt möglich<br />
ist, an Wettbewerben teilzunehmen. Denn<br />
selbst die weniger als zehn vermeintlich<br />
„offenen Wettbewerbe“ pro Jahr (<strong>2023</strong>,<br />
rein freiraumplanerisch) ziehen zum<br />
größten Teil ein Vergabeverfahren nach<br />
sich, welches dann doch wieder die<br />
hochklassigen Referenzen, Umsätze,<br />
Mitarbeitendenzahlen und jahrelangen<br />
Praxiserfahrungen fordert.<br />
Josephine Facius, Landschaftsarchitektin und Mitbegründerin des Büros<br />
impuls Landschaftsarchitektur, sieht bei Bewerbungsverfahren die größte<br />
Hürde für junge Büros darin, überhaupt an Wettbewerben teilnehmen<br />
zu können.<br />
<strong>G+L</strong> 19
„MIT DEN GANZEN<br />
VERFAHRENSBE-<br />
SCHRÄNKUNGEN IST<br />
KEINEM GEDIENT“<br />
Ein hohes Gut unserer Gesellschaft – als solches beschreibt Timo Herrmann das Wettbewerbswesen<br />
in Deutschland. In seinen Antworten bezieht der Landschaftsarchitekt und blda-<br />
Vizepräsident auch klar Stellung: Es braucht mehr Wettbewerbsverfahren, und zwar einfache,<br />
offene und transparente. Dabei beschreibt er auch, warum Beschränkungen weder den<br />
Teilnehmer*innen noch den Auslober*innen dienlich sind.<br />
FRAGEN: THERESA RAMISCH<br />
INTERVIEWEE<br />
Timo Herrmann ist<br />
Landschaftsarchitekt<br />
und Geschäftsführer<br />
von bbz landschaftsarchitekten<br />
in Berlin.<br />
Seit 2022 ist<br />
er Vizepräsident<br />
des bdla.<br />
Timo Herrmann, aktuell ist die Position<br />
des bdla-Fachsprechers „Wettbewerbswesen“<br />
vakant. Wieso? Ist die Rolle nicht<br />
wichtig genug?<br />
Der bdla, Bund Deutscher Landschaftsarchitekt:innen,<br />
wird als Berufsverband<br />
durch das ehrenamtliche Engagement<br />
seiner Mitglieder getragen. Die Arbeit<br />
der Fachgruppen stellt dabei den wesentlichen<br />
inhaltlichen Anteil der Verbandsarbeit<br />
und das inhaltliche Engagement<br />
des Verbands dar. Natürlich ist unbestritten,<br />
dass neben allen Fachgruppen<br />
gerade die Fachgruppe Wettbewerbswesen<br />
und somit ebenfalls die des<br />
Fachsprechers eine sehr wichtige ist.<br />
Aus diesem Grunde sind wir aktuell<br />
dabei, diese Position wieder neu zu<br />
besetzen. Und ich möchte nicht zu viel<br />
verraten, aber ich kann sagen, dass wir<br />
aus der Fachgruppe eine hochkarätige<br />
Persönlichkeit – mit viel Wettbewerbserfahrung<br />
auf allen Seiten – gewinnen<br />
konnten, die dieser Fachgruppe wieder<br />
vorstehen wird.<br />
Wie oft ist das deutsche Wettbewerbswesen<br />
Thema bei Ihnen im bdla-Präsidium?<br />
Worüber sprechen Sie dann? Was<br />
diskutieren Sie?<br />
Aufgrund der Wichtigkeit des Wettbewerbswesens<br />
als Tool der Auftragsbeschaffung<br />
bei unseren Mitgliedern ist dies<br />
sehr, sehr häufig Thema im Verband und<br />
unter den Mitgliedern.<br />
Die Themen sind die Stärkung des Wettbewerbswesens,<br />
sozusagen die Werbung<br />
bei potenziellen Bauherr*innen und<br />
Auftraggeber*innen zur Durchführung<br />
solcher Verfahren. Die Beteiligung bei<br />
Schulungen und der Qualifizierung bei<br />
der Durchführung von Verfahren auf<br />
Auftraggeber*innen- und Verfahrensbetreuer*innenseite.<br />
Die Qualifizierung<br />
unserer Mitglieder zu rechtlichen Aspekten<br />
und der Einbindung von Wettbewerben<br />
in die EU-Vergabeverordnung<br />
(Verhandlungsverfahren, VgV). Und nicht<br />
zuletzt der inhaltliche Austausch über<br />
Wettbewerbe mit dem kleinen, sehr<br />
beliebten Branchentreffen, den Entwerfer-<br />
32 <strong>G+L</strong>
WETTBEWERBE<br />
INTERVIEW: TIMO HERRMANN<br />
tagen, die Stephan Lenzen und Franz<br />
Reschke initiiert haben und die nun zum<br />
fünften Mal vom 13. bis 14. November<br />
<strong>2023</strong> in Berlin wieder mit hochkarätigen<br />
Referent*innen stattfinden.<br />
Wie fair sind Ihrer Meinung nach Wettbewerbsverfahren<br />
in Deutschland?<br />
Als Teilnehmer an und Preisrichter bei<br />
vielen Verfahren erlebte ich bisher fast<br />
ausschließlich sehr faire Verfahren. Das<br />
Wettbewerbswesen ist einer der ältesten<br />
demokratischen Prozesse in Deutschland<br />
und ein hohes Gut unserer Gesellschaft.<br />
Es ist immer wieder unglaublich und<br />
faszinierend, welche Ideenvielfalt auf<br />
Teilnehmer*innenseite, welches Ringen,<br />
welche Überzeugungs- und Kompromissbereitschaft<br />
im Auswahlprozess und<br />
daraus welche breite gesellschaftliche<br />
Basis ein Entwurf aus einem Wettbewerbsverfahren<br />
erhält. Es ist faszinierend,<br />
welche hohe Übereinkunft und Verbindlichkeit<br />
unter allen Verfahrensbeteiligten<br />
dadurch hergestellt wird.<br />
Ich kann mir kein anderes Vergabeverfahren<br />
in einer demokratischen Gesellschaft<br />
vorstellen, die dieses Verfahren zur<br />
Gestaltfindung bei öffentlichen Bauaufgaben<br />
ersetzt.<br />
Ich erachte es als ein sehr hohes Gut,<br />
dass sich unsere Gesellschaft dieses auf<br />
allen Seiten sehr aufwendige und teure<br />
Verfahren leistet. Ich selbst und wir als<br />
Verband haben den Eindruck, dass dies<br />
all unsere Mitglieder sehr schätzen,<br />
sich der Bedeutung bewusst sind und<br />
jede*r Einzelne in seinem Bereich auf<br />
Fairness achtet.<br />
eingeladenen oder ausgewählten Teil nehmer*innen<br />
keinen Beitrag ab, und der<br />
oder die Auslober*in hat am Ende weniger<br />
Ideen oder Konzepte zur Auswahl.<br />
Meine klare Meinung: Offene Verfahren<br />
– wer Zeit und Kapazitäten hat und<br />
Lust an der Aufgabe zeigt, nimmt am<br />
Wettbewerb teil.<br />
Aus rein betriebswirtschaftlicher Perspektive:<br />
Raten Sie jungen Büros dazu,<br />
an Wettbewerben teilzunehmen? Wie<br />
wahrscheinlich ist deren Erfolg?<br />
Ich kann jungen Büros absolut nur dazu<br />
raten, an Wettbewerbsverfahren teilzunehmen.<br />
Wir selbst haben unser Büro an<br />
den Standorten in Bern, Berlin und Freiburg<br />
mit der Teilnahme und dann dem<br />
Gewinn von Wettbewerben aufgebaut<br />
und etabliert. Das Wettbewerbswesen ist<br />
nach wie vor ein faires, transparentes und<br />
offenes System der Auftragsbeschaffung.<br />
Weder Herkunft, Sozialisierung, politische<br />
Gesinnung spielen in die Entscheidung<br />
hinein. Einzig der Entwurf zählt. Wo in<br />
der freien Wirtschaft gibt es das bitte<br />
sonst? Auf in den Ring – die beste Idee,<br />
das beste Konzept, der beste Entwurf<br />
möge gewinnen!<br />
Timo Herrmann,<br />
Landschaftsarchitekt,<br />
Geschäftsführer von<br />
bbz landschaftsarchitekten<br />
und Vizepräsident<br />
des bdla, spricht<br />
sich klar für mehr –<br />
und offene – Wettbewerbsverfahren<br />
aus.<br />
Foto: © Lichtschwärmer, Christo Libuda<br />
Brauchen wir Ihrer Meinung nach in<br />
Deutschland mehr Wettbewerbsverfahren<br />
oder weniger?<br />
Mit meinen Ausführungen habe ich ja<br />
schon gezeigt, wie wichtig wir als Verband<br />
und ich selbst Wettbewerbsverfahren<br />
in Deutschland und natürlich auch im<br />
Ausland sehen. Insofern fällt die Antwort<br />
sehr klar aus, wir brauchen mehr Wettbewerbsverfahren,<br />
und wir brauchen einfache,<br />
offene und transparente Verfahren.<br />
Mit den ganzen Verfahrensbeschränkungen<br />
ist doch keinem gedient: Die Auslober*innen<br />
haben zusätzlichen Aufwand<br />
mit der Auswahl von Teilnehmer*innen;<br />
die Teilnehmer*innen haben sehr viel<br />
Aufwand mit der Bewerbung auf die<br />
Verfahren und der zeitlichen Koordinierung<br />
der Bearbeitung; und somit, so<br />
zumindest die Entwicklung in der jüngsten<br />
Zeit, geben 20 bis 30 Prozent der<br />
<strong>G+L</strong> 33
„DIE VORHANDE-<br />
NEN REGULARIEN<br />
SIND NICHT DAS<br />
PROBLEM“<br />
Bereicherung des beruflichen Alltags durch Konkurrenz ist das eine. Wenig<br />
attraktive Preisgelder bei kleineren Aufgaben das andere. Beides führt Landschaftsarchitekt<br />
Tobias Nowak für Wettbewerbe an bei unserer Frage nach<br />
positiven wie negativen Seiten des aktuellen Systems. Und bei VgV-Verfahren<br />
erkennt er die Probleme weniger in den Regularien. Wen er stattdessen in der<br />
Pflicht sieht, welche Bedenken von Auftraggeberseite ihm begegnen und wie<br />
Verfahren seiner Meinung nach erleichtert werden könnten.<br />
FRAGEN: THERESA RAMISCH<br />
Wo ist aus Ihrer Perspektive das Gute im<br />
System? Womit hadern Sie?<br />
Wir sehen in Wettbewerben grundsätzlich<br />
eine tolle Möglichkeit der Akquise von<br />
neuen Auftraggebern – und zwar der<br />
Akquise über die „Idee“, also letztlich die<br />
Qualität des Entwurfs und damit des<br />
Endprodukts. Das gibt nach wie vor auch<br />
jungen oder neugegründeten Büros die<br />
Möglichkeit, sich am Markt zu etablieren.<br />
Die direkte Konkurrenz im Wettbewerbs-<br />
INTERVIEWEE<br />
Tobias Nowak ist<br />
Landschaftsarchitekt<br />
und Stadtplaner. Seit<br />
2002 ist er im büro<br />
raum + zeit<br />
Landschaftsarchitektur<br />
Stadtplanung<br />
(vormals Wartner &<br />
Zeitzler Landschaftsarchitekten)<br />
tätig; seit<br />
2019 führt er das<br />
Büro gemeinsam mit<br />
Yvonne Hammes.<br />
Tobias Nowak, Sie sind Mitglied der<br />
Beratergruppe Vergabe und Wettbewerb<br />
der ByAK. Wie fair ist das deutsche Wettbewerbswesen<br />
aus Ihrer Perspektive?<br />
In der Konzeption haben wir in Deutschland<br />
meiner Meinung nach ein sehr faires<br />
Verfahren, vor allem im Bereich des<br />
Teilnahmewettbewerbs. Die Registrierungspflicht<br />
bei den Kammern sorgt hier für<br />
ausgewogene Zugangsbedingungen bei<br />
Wettbewerben – und zusätzlich ist ja in<br />
Bayern noch die sogenannte Vergabeampel<br />
in Vorbereitung. Das wird für zusätzliche<br />
Anreize und Transparenz sorgen.<br />
verfahren und auch im VgV bereichert und<br />
belebt meiner Meinung das Geschäft und<br />
den beruflichen Alltag. Nicht zuletzt ist<br />
natürlich bei einem Wettbewerb die<br />
Begründung zur Auftragsvergabe transparent<br />
und nachvollziehbar – und vor<br />
allem erfolgt sie nicht rein über den Preis.<br />
Allerdings entsteht je nach Zusammensetzung<br />
der Jury hin und wieder das Gefühl,<br />
dass nicht der beste Entwurf prämiert,<br />
sondern der kleinste gemeinsame Nenner<br />
gesucht wurde.<br />
Bei kleineren Planungsaufgaben ist zudem<br />
das Preisgeld oder das Bearbeitungshonorar<br />
leider oft nicht attraktiv genug im<br />
Vergleich zum Aufwand und damit zum<br />
finanziellen Risiko der Teilnahme – was<br />
schade ist, weil eine kleine Aufgabe ja<br />
nicht weniger reizvoll sein muss!<br />
Im Bereich des VgV hingegen verschiebt<br />
sich der Schwerpunkt mittlerweile oft sehr<br />
stark auf technische oder überzogen<br />
projektspezifische Aspekte im Bereich der<br />
geforderten Referenzen. Das Vertrauen in<br />
die Fähigkeiten der Büros, Aufgaben zu<br />
bearbeiten und zur Zufriedenheit des<br />
48 <strong>G+L</strong>
WETTBEWERBE<br />
INTERVIEW: TOBIAS NOWAK<br />
Auftraggebers zu lösen, ist immer weniger<br />
zu erkennen. Große Büros werden durch<br />
hohe und sehr spezifische Anforderungen<br />
in den VgVs regelmäßig begünstigt.<br />
Die vorhandenen Regularien müssen<br />
sicher immer wieder an die veränderten<br />
Zeiten und Umstände angepasst werden,<br />
sind aber aus meiner Sicht gar nicht so<br />
das Problem. Ich sehe hier eher die<br />
Auftraggeber oder Verfahrensbetreuer in<br />
der Pflicht, die verfügbaren Werkzeuge<br />
sinnvoll anzuwenden und Schwerpunkte<br />
angemessen zu setzen.<br />
Die Entwicklungen im Wettbewerbsverfahren<br />
zum Münchner Gasteig zeigten:<br />
Planungswettbewerbe haben durchaus<br />
ihre Tücken. Wie nervös macht die Ausrichtungen<br />
von Wettbewerben private<br />
und öffentliche Auftraggeber?<br />
Die Schwierigkeiten in diesem Verfahren<br />
zeigen aus meiner Sicht vor allem, dass<br />
es faire und transparente Vergabebedingungen,<br />
Regeln und Entscheidungen<br />
braucht – es diese Regeln aber auch<br />
bereits gibt! Bei konsequenter Anwendung<br />
und gleichzeitiger Offenheit für das<br />
Ergebnis und ausreichendem Vertrauen in<br />
die fachliche Expertise der Jury sowie der<br />
Wettbewerbsteilnehmer bestünde also<br />
kaum Anlass zu Nervosität.<br />
dum zu führen – wobei hier der Auftraggeber<br />
idealerweise bereits in der Auslobung<br />
festlegt, dass erstmal nur mit dem<br />
1. Preisträger verhandelt wird. Diese<br />
Möglichkeit wird meiner Meinung nach<br />
noch viel zu wenig genutzt – das nachgeschaltete<br />
Verfahren wäre dadurch<br />
deutlich einfacher und schneller zu haben.<br />
Verzicht auf Präsenztermine im VgV,<br />
gerade nach einem Wettbewerb, könnten<br />
das Verfahren zusätzlich beschleunigen<br />
und erleichtern.<br />
Für die Zukunft hoffe ich natürlich nach<br />
Wegfall des § 3 Absatz 7 Satz 2 VgV<br />
auf eine deutliche Anhebung der Vergabeschwelle!<br />
Die neue Regelung wird aus<br />
meiner Sicht angesichts der enormen<br />
Anzahl an notwendigen Verfahren vermehrt<br />
zur Auslobung von Generalplanerleistungen<br />
führen, was voraussichtlich<br />
wieder die alteingesessenen und schlagkräftigen<br />
Büros begünstigen wird.<br />
Landschaftsarchitekt und Stadtplaner Tobias Nowak erkennt nicht in den<br />
Regularien das Problem – sondern sieht Auftrag geber*innen oder Verfahrensbetreuer*innen<br />
in der Pflicht, vorhandene Werkzeuge sinnvoll anzuwenden.<br />
Welche Themen tragen die Auftraggeber<br />
sonst an Sie heran? Was beschäftigt sie?<br />
Die Bedenken bezüglich der Durchführung<br />
von Wettbewerben, gerade bei<br />
unerfahrenen Auftraggebern, bestehen<br />
vor allem hinsichtlich der Dauer des<br />
Verfahrens, in Bezug auf vermutete,<br />
zusätzliche Kosten durch das Verfahren<br />
an sich und zuletzt in der Angst vor<br />
„g‘spinnerten Lösungen“, die mit noch<br />
mehr unkalkulierbaren Kosten verbunden<br />
sein könnten ... Irgendwie geht es also<br />
hauptsächlich ums Geld.<br />
Gleichzeitig werden aber erstaunlicherweise<br />
für die Vorbereitung und Durchführung<br />
von VgVs enorme Mittel ausgegeben.<br />
Hier stehen dann leider oft nur noch<br />
Rechtssicherheit und wieder die Kostenminimierung<br />
im Vordergrund.<br />
Foto: Peter Litvai<br />
Viele Büros kritisieren den Einsatz vom<br />
VgV-Verfahren im Wettbewerb. Die<br />
Kommunen sind an die Rechtsprechung<br />
gebunden. Sehen Sie irgendeine Möglichkeit,<br />
die Verfahren zu vereinfachen?<br />
Hier würden wir uns eine stärkere<br />
Gewichtung des Wettbewerbsergebnisses,<br />
also des 1. Preises, wünschen, um den<br />
Wettbewerb als solchen nicht ad absur-<br />
<strong>G+L</strong> 49
„WIR SEHEN<br />
ABSOLUT KEINE<br />
BESSERUNG“<br />
Seit 2021 analysiert die Architektenkammer Berlin in ihrem Vergabemonitoring die Wettbewerbe<br />
und Verfahren in Berlin. Die bisherigen Schlüsse daraus: Es sieht nicht gut aus, wenn es<br />
nach der Präsidentin der Architektenkammer Theresa Keilhacker geht. Wir haben bei ihr nachgefragt,<br />
warum es in Berlin mehr Wettbewerbe braucht und welche Änderungen sie sich im<br />
Vergabeverfahren wünschen würde.<br />
FRAGEN: THERESA RAMISCH<br />
INTERVIEWEE<br />
Theresa Keilhacker ist<br />
freischaffende<br />
Architektin in<br />
Bürogemeinschaft mit<br />
Boris Kazanski in<br />
Berlin. 2014 wurde<br />
sie in die Kommission<br />
für nachhaltiges<br />
Bauen (KNBau) am<br />
Umweltbundesamt<br />
berufen. Seit Mai<br />
2021 ist sie<br />
Präsidentin der<br />
Architektenkammer<br />
Berlin, seit 2022<br />
Mitglied im<br />
Klimaschutzrat Berlin<br />
und im Expert*innen-<br />
Rat des Climate<br />
Change Center (CCC).<br />
Theresa Keilhacker, in einer Pressemitteilung<br />
vom Dezember 2021 forderte die<br />
Architektenkammer Berlin von der neuen<br />
Regierung mehr Wettbewerbe – insbesondere<br />
in Berlin. Knappe zwei Jahre<br />
sind seitdem vergangen: Hat sich was<br />
verändert?<br />
Die Wettbewerbskultur unseres Berliner<br />
Senats ist leider weiter den Bach hinuntergegangen.<br />
Unser monatliches Vergabemonitoring<br />
hat ergeben, dass es in den<br />
letzten Jahren kaum einen Wettbewerb<br />
zum Thema Wohnungsbau gegeben hat.<br />
Gemessen daran, wie viel gebaut wird, ist<br />
das skandalös.<br />
Warum braucht besonders Berlin mehr<br />
Wettbewerbe?<br />
Weil unsere Stadt wächst und viele<br />
Bauvorhaben entstehen, aber eben nicht<br />
mit RPW-Verfahren und damit auch ohne<br />
die Kammer, die diese registrieren soll.<br />
Oft werden sogenannte Werkstatt- oder<br />
Gutachterverfahren umgesetzt, die sich<br />
bestenfalls in einem Graubereich befinden.<br />
Dies ist angesichts der Herausforderung,<br />
Klimaschutzbelange mit dem Bauen<br />
überhaupt vereinbar zu machen sowie in<br />
lebenden Nachbarschaften auch ein<br />
Mindestmaß an Beteiligung zu ermöglichen<br />
und eine neue Umbaukultur zu<br />
fördern, nicht angemessen.<br />
Der Präsidentin der Architektenkammer Berlin Theresa Keilhacker zufolge sind<br />
die Zugangshürden für kleinere Büros bei größeren Bauvorhaben zu hoch.<br />
Foto: Bettina Keller Fotografie<br />
56 <strong>G+L</strong>
WETTBEWERBE<br />
INTERVIEW: THERESA KEILHACKER<br />
In der Pressemitteilung von 2021 kritisierte<br />
die Architektenkammer zudem zu<br />
große Vergabepakete. Warum?<br />
Weil unser Berufsstand nach wie vor<br />
mittelständig geprägt ist, mit kleineren<br />
Büros, die sich für größere Bauvorhaben<br />
beispielsweise als ARGE zusammentun,<br />
aber oft persönlich engagieren und<br />
haften. Sie agieren sehr agil auf dem<br />
Markt, sind kreativ und innovativ<br />
unterwegs, bekommen aber keine<br />
Aufträge, weil die Zugangshürden zu<br />
hoch sind. Nur noch große Generalplanungsgesellschaften<br />
oder Generalübernehmer,<br />
mit Planungsbüros als Subunternehmen,<br />
erhalten den Zuschlag. Das<br />
fördert meistens weder Kreativität noch<br />
Innovation.<br />
Und letztlich kam auch das Thema der zu<br />
hohen Marktzugangshürden auf, die es<br />
kleinen bis mittleren Planungsbüro nahezu<br />
unmöglich mache, an Vergabeverfahren<br />
teilzunehmen. Sehen Sie Besserung?<br />
Wir sehen absolut keine Besserung, im<br />
Gegenteil. Unser Vergabemonitoring<br />
bestätigt den Eindruck, dass die Planungskultur<br />
in dieser Stadt weiter verlottert. Wir<br />
sehen beispielsweise bei den landeseigenen<br />
Wohnungsunternehmen bei fünf bis<br />
zehn Verfahren im Jahr Rahmenverträge<br />
mit jeweils 50 bis 500 Wohneinheiten,<br />
die teilweise Quartierscharakter, jedenfalls<br />
städtebaulichen Maßstab haben und<br />
ganze Stadtteile prägen werden, oder 20<br />
Stück Typenhochhäuser, die in einem<br />
Paket vergeben werden.<br />
Welche Änderungen wünschen Sie sich<br />
heute im Vergabeverfahren? Und welche<br />
Person der Bundesregierung bzw. in<br />
Berlin muss hier Ihrer Meinung nach<br />
Verantwortung übernehmen?<br />
Wir müssen die Planungs- und Prozesskultur<br />
wiederentdecken, indem wir die Auslobung<br />
von RPW-Wettbewerben verschlanken<br />
und die Verfahrenskultur weiterentwickeln<br />
und attraktiver machen, zum Beispiel mit<br />
der Etablierung eines Leitfadens für dialogorientierte<br />
Werkstattverfahren im Rahmen<br />
einer Mehrfachbeauftragung. Verantwortlich<br />
für solche Lösungsansätze und<br />
Mindeststandards sind in Berlin unser<br />
Senator für Stadtentwicklung, Bauen und<br />
Wohnen, Christian Gaebler, und seine<br />
Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt.<br />
Modellserie Urbanis – Auflage Murus<br />
Freiraumausstattung mit System<br />
Modellserie Urbanis<br />
Nims<br />
Vulkanring 7, D-54568 Gerolstein<br />
Telefon +49 (0) 65 91 - 16 400<br />
info@freiraumausstattung.de<br />
freiraumausstattung.de<br />
<strong>G+L</strong> 57
LÖSUNGEN<br />
Alle Produktinformationen<br />
laut Herstellerangaben.<br />
SPEZIAL: FSB <strong>2023</strong><br />
IM INNEREN GUT VERNETZT<br />
Die 5,6 Meter hohe Spielscheune<br />
„LaGrange“ der Berliner Seilfabrik kombiniert<br />
verschiedene Spielzellen, in denen<br />
Kinder das Innere erklettern können. Die<br />
Spielzellen reichen von verschiedenen Netzelementen<br />
wie Netztrichtern oder -tunnel<br />
über Gummi- und Hängematten bis hin zu<br />
anderen Seilelementen. Die offene Fassade<br />
lässt sich mit Bambuspaneelen, transparenten<br />
Gitterrahmen und bedruckbaren<br />
HDPE-Paneelen individuell anpassen. Zudem<br />
können Fassadenelemente um Playpanels<br />
ergänzt werden. Die Gitterrahmen der<br />
Spielscheune erfüllen die Anforderungen der<br />
DIN EN 1176: Aufgrund eines Stababstandes<br />
von 7,5 Millimetern entstehen keine Fingerfangstellen,<br />
und sie bieten keine Möglichkeit<br />
zum Beklettern. Die Rahmen können in RAL-<br />
Farbtönen pulverbeschichtet werden.<br />
berliner-seilfabrik.com<br />
ALLE KÖNNEN MITDREHEN<br />
Wie schnell und in welche Richtung sich dieses Karussell dreht, haben<br />
die Fahrenden selbst in der Hand. In Schwung bringen sie es mit dem<br />
mittigen Handrad. Das ebenerdige Inklusionskarussell des Herstellers<br />
ESF Emsland Spiel- und Freizeitgeräte ist für Menschen jeden Alters,<br />
mit oder ohne Mobilitätseinschränkung gedacht. Es ist eine kompaktere<br />
und leichtere Variante des Rollstuhlfahrerkarussells von EFS. Das<br />
Inklusionskarussell gibt es in zwei verschiedenen Typen, die sich im<br />
Sitzplatz, den Haltebügeln und einer gebogenen Doppel-Reling unterscheiden.<br />
Optional ist ein Spitzdach aus beschichtetem Stahlblech<br />
oder ein Planendach möglich. Auf der gesicherten Stehfläche können<br />
sich auch Rollstuhlfahrer*innen frei bewegen. Der Boden ist speziell<br />
verstärkt, um auch schwere Elektrorollstühle tragen zu können.<br />
emsland-spielgeraete.de<br />
Foto: Berliner Seilfabrik GmbH & Co.; Grafik: ESF Emsland Spiel- und Freizeitgeräte GmbH & Co. KG<br />
58 <strong>G+L</strong>
PRODUKTE<br />
LÖSUNGEN<br />
VOM KUNSTRASEN IN DIE FILTERRINNE<br />
Bei der Sanierung ihres Schul- und Vereinssportplatzes<br />
entschied sich die Stadt Bühl<br />
für einen Kunstrasenplatz. Von diesem<br />
sollen möglichst wenig Kunststoffpartikel in<br />
die Umgebung ausgetragen werden. Als<br />
Infillmaterial wählte man Kork. Dieses sowie<br />
abgebrochene Partikel des Kunstrasenbelags<br />
hält wiederum das Filterrinnensystem Sportfix<br />
Clean des Herstellers Hauraton zurück.<br />
Das System besteht aus Rinnenkörpern mit<br />
Abdeckungen, einem textilummantelten Drainagerohr<br />
sowie dem Filtersubstrat Carbotec<br />
60. In Bühl sind die Rinnen an den Längsrändern<br />
des Spielfelds eingebaut; über sie wird<br />
Wasser von der Oberfläche des Sportplatzes<br />
abgeleitet und gefiltert. Die Rinnenelemente<br />
von Sportfix Clean sind aus recyceltem Kunststoffmaterial<br />
sowie leicht, und das System hat<br />
lange Wartungsintervalle. Der Rinnenfilter ist<br />
trockenfallend und verhindert so Fäulnis und<br />
die Rücklösung von Schadstoffen.<br />
hauraton.com<br />
INKLUSIVES SCHAUKELN<br />
Fotos: HAURATON GmbH & Co. KG; HUCK Seiltechnik GmbH<br />
Mit der Schaukel „Sombrero“ hat der Hersteller HUCK Seiltechnik<br />
seine Vogelnest-Schaukel weiterentwickelt. Durch eine Erhöhung in<br />
der Mitte können sich Schaukelnde nicht nur in die Schaukel legen,<br />
hocken oder stellen, sondern sicher sitzen und sich zurücklehnen.<br />
Damit möchte Huck das Schaukeln noch inklusiver gestalten als<br />
bisher. Die Schaukel „Sombrero“ soll Raum und sicheren Halt bieten,<br />
beispielsweise für Menschen mit Beeinträchtigung, die nicht selbstständig<br />
aufrecht sitzen können.<br />
huck-seiltechnik.de<br />
<strong>G+L</strong> 59