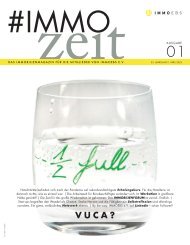Immozeit 03.23 I KOMPLIZIERT
KOMPLIZIERT
KOMPLIZIERT
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
TITELTHEMA<br />
Was ist zirkuläres Bauen?<br />
Zirkuläres Bauen bedeutet, sich mit dem<br />
Erhalt, der Aufwertung und der Aktivierung<br />
des Gebäudebestands auseinanderzusetzen<br />
und diesen als wertvolle Materialquelle<br />
wahrzunehmen. Es geht also darum, vorhandene<br />
Materialien und geschaffene<br />
Werte zu nutzen. Darüber hinaus verfolgt<br />
das zirkuläre Bauen das Ziel, Baustoffe<br />
langfristig zu nutzen und in geschlossenen<br />
Kreisläufen wiederzuverwenden, sodass<br />
über den gesamten Lebenszyklus kein Abfall<br />
entsteht.<br />
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)<br />
Eine Erkenntnis aus dem Projekt war laut dem von der Hochschule<br />
Konstanz (Fakultät Architektur und Gestaltung) verfassten<br />
Abschlussbericht, „dass in den besichtigten Abbruchgebäuden<br />
jeweils nur ein Bruchteil der vorhandenen Bauteile für eine<br />
Wiederverwendung (…) infrage kam“.<br />
Außerdem zeigte es sich, dass gerade Bauteile, die aufgrund ihrer<br />
guten Bearbeitbarkeit eigentlich für eine Wiederverwendung<br />
prädestiniert waren, wegen Schadstoffbelastung aussortiert<br />
werden mussten. Ferner fehlen dem Bericht zufolge auf Bundesebene<br />
spezielle Regularien in Bezug auf Haftung und Gewährleistung<br />
bei gebrauchten Bauteilen. Das Fazit der Untersuchung<br />
lautet: „Die Hemmnisse, die einer umfangreichen Wiederverwendung<br />
von Bauteilen aus Bestandsgebäuden derzeit im Wege<br />
stehen, werden ohne politische und wirtschaftliche Anreize nur<br />
schwierig zu überwinden sein.“<br />
NOCH GIBT ES VIELE HERAUSFORDERUNGEN<br />
Sicher, man müsse „viel Fleiß in die Planung investieren“,<br />
sagt Architekturprofessorin Angèle Tersluisen mit Blick auf<br />
Projekte, die ganz oder mehrheitlich aus gebrauchten Materialien<br />
errichtet werden. Sie rät deshalb dazu, bei der Wiederverwendung<br />
von Bauteilen nicht unbedingt mit der Gebäudehülle<br />
zu beginnen. „Im Innenbereich ist die Wiederverwendung –<br />
vorausgesetzt, die Bauteile weisen keine Schadstoffe auf – deutlich<br />
einfacher“, erklärt sie. „Trennwände in Büros beispielsweise<br />
müssen zwar Anforderungen an den Schallschutz erfüllen, aber<br />
nicht an den Brandschutz.“<br />
Dass noch ein weiter Weg zurückzulegen ist, bis sich der zirkuläre<br />
Ansatz durchgesetzt haben wird, unterstreicht eine Studie<br />
der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).<br />
Darin untersuchte diese die Marktfähigkeit der im Rahmen der<br />
EU-Taxonomie vorgegebenen Kriterien der Circular Economy<br />
anhand von realen Bauprojekten – und kam zu einem ernüchternden<br />
Ergebnis: Keines der untersuchten Projekte kann<br />
demnach als taxonomiefähig eingestuft werden. Als besonders<br />
schwierig erwies sich die Wiederverwendung von Bauteilen:<br />
Kein einziges Vorhaben erfüllte die von der Taxonomie formulierte<br />
Materialquote, wonach die eingesetzten Baumaterialien<br />
zu mindestens 15 Prozent wiederverwendet, zu 15 Prozent<br />
recycelt und zu 20 Prozent entweder nachwachsend, wiederverwendet<br />
oder recycelt sein müssen.<br />
„Das Ergebnis ist überraschend“, sagt dazu Dr. Christine Lemaitre,<br />
geschäftsführender Vorstand der DGNB. „In Vorträgen, Diskussionen<br />
und in den Medien sprechen derzeit alle über das<br />
zirkuläre Bauen und es entsteht der Eindruck, das Thema sei<br />
in der Branche angekommen. Die Studie zeigt jedoch, dass es in<br />
der gebauten Realität in dieser Dimension nicht vorhanden ist.“<br />
WIE ZIRKULARITÄT KONKRET WIRD<br />
Dennoch gibt es diverse Neubauten, die den Kreislaufgedanken<br />
umzusetzen versuchen. Das 2019 errichtete Bürogebäude<br />
der Triodos Bank im niederländischen Driebergen<br />
beispielsweise ist so konstruiert, dass sich die einzelnen Systeme<br />
leicht trennen und rückbauen lassen. Außerdem kamen beim<br />
Bau Trockenbauwände, Holzbalken und andere Materialien aus<br />
abgebrochenen Gebäuden zum Einsatz. Ein anderes Beispiel:<br />
In Bremerhaven bereitet das Berliner Architekturbüro Partner<br />
und Partner den Bau eines viergeschossigen Gründerzentrums<br />
vor, dessen Name „De tokamen Tiet“ (plattdeutsch: die herankommende<br />
Zeit) Programm ist. „Wir verstehen unseren Neubau<br />
als Materialbank“, sagt Jörg Finkbeiner, geschäftsführender<br />
Architekt bei Partner und Partner. „Baustoffe und Komponenten<br />
werden nicht verbraucht, sondern lediglich für eine bestimmte<br />
Dauer genutzt. Später müssen sie – auf verschiedene Arten –<br />
weiterverwendet werden können.“<br />
Zu vernehmen sind aber auch kritische Stimmen. „Zirkuläres<br />
Bauen gibt es eigentlich nicht“, sagt Michael Halstenberg, Baurechtler<br />
und ehemaliger Abteilungsleiter im Bundesbauministerium.<br />
„Schätzungen zufolge können nur etwa 15 Prozent der<br />
für bauliche Anlagen benötigten Baumaterialien durch wiederverwertete<br />
Materialien gedeckt werden, und das vor allem im<br />
Tiefbau“, sagt Halstenberg, der in der Düsseldorfer Kanzlei<br />
Franßen & Nusser Rechtsanwälte PartGmbB tätig ist. Eigentlich<br />
müsste das Ziel also lauten, den Anteil der wiederverwerteten<br />
Baumaterialien zu erhöhen, erklärt Halstenberg weiter. Doch<br />
da gebe es einen Zielkonflikt – denn das beste Recycling sei die<br />
Weiternutzung eines Bauwerks.<br />
Neben diesem grundsätzlichen Dilemma lauern laut dem Juristen<br />
auch technische und juristische Fallstricke. So müsse man zwischen<br />
Bauteilen und Rohstoffen unterscheiden. „Rohstoffe wie Kupfer<br />
und Stahl lassen sich relativ einfach wiederverwerten“, stellt er<br />
fest. Bei behandeltem Holz, Kunststoffen und mineralischen<br />
Stoffen sei es deutlich schwieriger. Ein Großteil der Kunststoffe<br />
werde thermisch verwertet, also verbrannt, während mineralische<br />
Stoffe häufig nicht sortenrein seien. „Deshalb kommt es oft zum<br />
Downcycling“, sagt Halstenberg. „Mineralische Stoffe werden<br />
als Gesteinskörnung zum Beispiel für den Straßenbau genutzt<br />
und sind damit für den Gebäudebereich verloren.“<br />
Auf rechtlicher Seite muss man laut Halstenberg zwischen Bauprodukten-<br />
und Abfallrecht unterscheiden. „Wenn ein Bauteil<br />
seine erste Verwendung hinter sich hat, wird es laut dem Kreislaufwirtschaftsgesetz<br />
in der Regel zu Abfall“, erläutert er. „Es sinkt<br />
gewissermaßen in die ,Unterwelt´ und muss technisch und rechtlich<br />
aufwendig wieder in die ,Oberwelt´ geholt werden.“ Bei <br />
06 #IMMOzeit