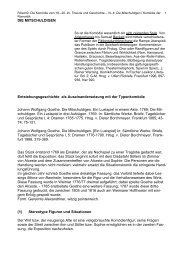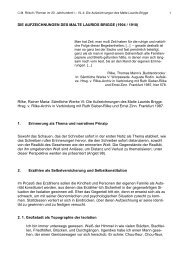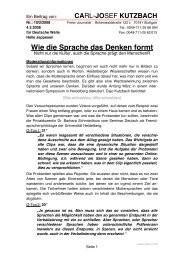Schiller - IDF
Schiller - IDF
Schiller - IDF
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Rösch: Tragödie vom 18. bis 20. Jh. Theorie und Beispiele – VL 6: <strong>Schiller</strong>s Tragödientheorie 3<br />
Die Tragödie wäre demnach dichterische Nachahmung einer zusammenhängenden<br />
Reihe von Begebenheiten (einer vollständigen Handlung), welche uns Menschen in<br />
einem Zustand des Leidens zeigt und zur Absicht hat, unser Mitleid zu erregen. (269)<br />
Wirkungsabsicht und Kennzeichen der Tragödie<br />
(1) Poetische Nachahmung einer Handlung<br />
Die Komposition und Interpretation des Stoffes stehen dem Dichter frei, die Richtigkeit<br />
historischer Fakten bindet ihn nicht.<br />
Aber die Tragödie hat einen poetischen Zweck, d.i. sie stellt eine Handlung dar, um<br />
zu rühren und durch Rührung zu ergötzen. Behandelt sie also einen gegebenen Stoff<br />
nach diesem ihrem Zwecke, so wird sie eben dadurch in der Nachahmung frei; sie<br />
erhält Macht, ja Verbindlichkeit, die historische Wahrheit den Gesetzen der Dichtkunst<br />
unter zu ordnen und den gegebenen Stoff nach ihrem Bedürfnisse zu bearbeiten.<br />
(272)<br />
(2) Vollständigkeit und Wahrheit<br />
Diese Vollständigkeit der Schilderung ist nur durch Verknüpfung mehrerer einzelnen<br />
Vorstellungen und Empfindungen möglich, die sich gegen einander als Ursache und<br />
Wirkung verhalten, und in ihrem Zusammenhang ein Ganzes für unsre Erkenntnis<br />
ausmachen. (267)<br />
Mehrere als Ursache und Wirkung ineinander gegründete Begebenheiten müssen<br />
sich miteinander zweckmäßig zu einem Ganzen verbinden, [... ] (270)<br />
(3) Lebhaftigkeit<br />
Unmittelbare lebendige Gegenwart und Versinnlichung sind also nötig, unsern Vorstellungen<br />
vom Leiden diejenige Stärke zu geben, die zu einem hohen Grade von<br />
Rührung erfodert wird. (264)<br />
(4) Darstellung sinnlich-moralischer Wesen<br />
Verlangt wird der gemischte Charakter; die Bühnenfiguren müssen sich als sinnlichmoralische<br />
Wesen ausweisen:<br />
Die Möglichkeit des Mitleids beruht nehmlich auf der Wahrnehmung oder Voraussetzung<br />
einer Ähnlichkeit zwischen uns und dem leidenden Subjekt. [...] Wir müssen,<br />
ohne uns Zwang anzutun, die Person mit ihm zu wechseln, unser eigenes Ich seinem<br />
Zustande augenblicklich unterzuschieben fähig sein. (264f.)<br />
Die Tragödie ist [...] Nachahmung einer Handlung, welche uns Menschen im Zustand<br />
des Leidens zeigt.[...] Nur das Leiden sinnlichmoralischer Wesen, dergleichen<br />
wir selbst sind, kann unser Mitleid erwecken. [...] Der tragische Dichter gibt also mit<br />
Recht den gemischten Charakteren den Vorzug, und das Ideal seines Helden liegt in<br />
gleicher Entfernung zwischen dem ganz verwerflichen und dem vollkommenen. (273)<br />
(5) Dosierter Affekteinsatz<br />
Ein gezielter Affekteinsatz soll die Aufmerksamkeit gespannt halten; die Intensität<br />
des Leidens ist abzuwägen; die Täuschung/Illusion muß durch Sentenzen und Reflexionselemente<br />
durchbrochen werden.<br />
Wenn also das Gemüt, seiner widerstrebenden Selbsttätigkeit ungeachtet, an die<br />
Empfindungen des Leidens geheftet bleiben soll, so müssen diese periodenweise<br />
geschickt unterbrochen, ja von entgegengesetzten Empfindungen abgelöst werden –<br />
um alsdann mit zunehmender Stärke zurück zu kehren und die Lebhaftigkeit des ersten<br />
Eindrucks desto öfter zu erneuern. (268)