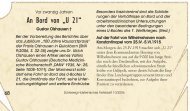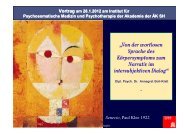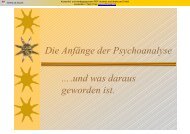aktuell - Ärztekammer Schleswig-Holstein
aktuell - Ärztekammer Schleswig-Holstein
aktuell - Ärztekammer Schleswig-Holstein
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
zteblatt<br />
ärzteblatt<br />
7<br />
2007<br />
Bad Segeberg<br />
Juli 2007<br />
60. Jahrgang<br />
www.aeksh.de<br />
www.arztfindex.de<br />
www.aerzteblatt-sh.de<br />
Quintessenz Verlags-GmbH -<br />
Postfach 42 04 52 - 12064 Berlin<br />
PVSt. Dt. Post AG „Entg. bez.“ A 01697<br />
<strong>Schleswig</strong>-<br />
<strong>Holstein</strong>isches<br />
Ärzteblatt<br />
Herausgegeben von der<br />
<strong>Ärztekammer</strong> <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
mit den Mitteilungen der Kassenärztlichen<br />
Vereinigung <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
KAMMER<br />
INFO<br />
<strong>aktuell</strong><br />
Die Verantwortung des Staates<br />
und die Freiheit der Bürger<br />
Prof. Dr. phil. Wolfgang Kersting S. 54<br />
Neue Entwicklungen beim<br />
Mamma-Carcinom<br />
Medizinische Gesellschaft Lübeck S. 61<br />
Notfallmedizinische Forschung<br />
Arbeitskreis Notfallmedizin S. 63
Anzeige<br />
Quintessenz<br />
Allianz
Reif für den Urlaub<br />
Liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
Sommerzeit - Reisezeit. In den Innenstädten überfüllte Straßencafés. Zufriedene, bewusst entspannt<br />
wirkende Gesichter in der heiß begehrten ersten Reihe und mittendrin und rundherum genervte<br />
Familien, für die selbst ein Tisch in der Nähe der schattigen Hauswand unterhalb der Gerüche<br />
einer Dunstabzugshaube auch für den Rest des Urlaubs unerreichbar scheint.<br />
Glücklich, wer als Einheimischer zu Hause eine eigene Terrasse hat, auf der man - zumindest gefühlt<br />
- immer in der ersten Reihe sitzt.<br />
Morgens auf dem Weg mit dem Fahrrad zur Arbeit fast autofreie Straßen, keine Beinahe-Zusammenstöße<br />
mit wahren Kavalkaden von radelnden und rasenden Schülergruppen, die im Bewusstsein<br />
der Gruppenmacht dreist alle Verkehrsregeln zu ihren Gunsten auslegen und kein Warten an<br />
Kreuzungen, bis endlich eine in der Nähe installierte Ampel für einen kleinen Moment eine Lücke<br />
im Strom der unaufhörlich in die Innenstadt strebenden Autokolonne frei werden lässt.<br />
Leider täuscht die Ruhe gewaltig. In der Klinik - unter anderen Vorzeichen zwar als nachmittags in<br />
der Innenstadt - überfüllte Sitzbänke. Der Platz in der ersten Reihe ist hier - stehend - die Poleposition<br />
am Anmeldeschalter. Idiome, Dialekte und wirkliche Fremdsprachen, die alle Beteiligten zur<br />
äußersten Konzentration zwingen.<br />
Familienverbände, die morgens um 5:00 Uhr von ihrem Campingplatz in Nordjütland abgerückt<br />
sind, um sich bei der ersten Gelegenheit jenseits der Grenze medizinisch versorgen zu lassen (... ist<br />
der Gashahn im Wohnwagen auch wirklich abgedreht? ...)<br />
Unvollständige Anamnesen und hochkomplexe Krankheitsverläufe, die bereits die Mediziner am<br />
jeweiligen Wohnort vor scheinbar unlösbare Probleme gestellt haben. Bei telefonischen Rückfragen<br />
vor Ort, der einzig Zuständige, der eventuell hätte weiterhelfen können, natürlich nicht erreichbar -<br />
ist ja schließlich Urlaubszeit.<br />
Krankheitsberichte in allen europäischen Sprachen, von denen man bestenfalls einige immer noch<br />
international gebräuchliche lateinische Diagnosebegriffe versteht. Schwester Katherina, die Nothelferin<br />
für Verständigungsprobleme in Russisch - im Urlaub.<br />
Zwischendrin das ein oder andere Telefonat mit Falck - der Zentrale des dänischen Rettungsdienstes<br />
in Kopenhagen. Auch dort die über das ohnehin übliche und bekannte Maß hinausgehende<br />
Überlastung - ferietid - Urlaubszeit.<br />
Ja, und dann sind da natürlich auch noch die ganz normalen Patienten, die einen treu das ganze<br />
Jahr über begleiten und deren Krankheit einen Begriff leider nicht kennt - Urlaub.<br />
Sie ahnen sicher bereits, in welcher Stadt diese kleine Sommerepisode spielt. In Flensburg, der<br />
nördlichsten Stadt Deutschlands, meiner Heimatstadt. Und an manchem dieser Tage fehlt einem<br />
geradezu die Hektik und der Stress, mit denen in den übrigen Jahreszeiten berufspolitische Verpflichtungen<br />
und Aktivitäten in Bad Segeberg und Berlin den Gedanken an mögliche Belastungsgrenzen<br />
gar nicht erst aufkommen lassen. Entzugserscheinungen etwa? Nein - eher ein deutliches<br />
Signal in die ganz andere Richtung - reif für den Urlaub!<br />
In diesem Sinne wünschen wir allen, denen das vergönnt ist, einen erholsamen Urlaub und einen<br />
schönen Sommer!<br />
Mit freundlichen kollegialen Grüßen<br />
Ihre<br />
Dr. med. Franz-Joseph Bartmann Dr. med. Cordelia Andreßen<br />
Präsident Hauptgeschäftsführerin<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
seite 3<br />
3
inhaltsverzeichnis<br />
4<br />
(Foto: rat)<br />
19 70 Jahre und ein<br />
bisschen weise ...<br />
Eckhard Weisner ist 70 Jahre alt geworden.<br />
Er war viele Jahre schleswigholsteinischer<br />
KV-Vorsitzender, lange<br />
Zeit im KBV-Vorstand, zuletzt sogar<br />
als stellvertretender Vorsitzender und<br />
als Krönung seiner Ehrenämter Präsident<br />
der <strong>Ärztekammer</strong>. Heute ist er<br />
für die Ärzteschaft noch als Vorsitzender<br />
des Fördervereins Lehrstuhl Allgemeinmedizin<br />
und des Landesverbandes<br />
der Freien Berufe tätig. Sein<br />
jetzt hauptamtlich tätiger Nachnachfolger<br />
im Amt des KV-Vorsitzenden<br />
Ralf Büchner würdigt die Verdienste<br />
Weisners.<br />
25 Kinderarznei im<br />
Test - Interview mit<br />
Dehtleff Banthien<br />
(Foto: Privat)<br />
Eine neue EU-Verordnung soll bewirken,<br />
dass künftig in der EU neu zugelassene<br />
Arzneimittel vor ihrer Verwendung<br />
an Patienten auch bei Kindern<br />
und Jugendlichen getestet sein<br />
müssen. Auf ethische Bedenken - bei<br />
grundsätzlichem Einverständnis - verweist<br />
der Vorsitzende des Berufsverbandes<br />
der Kinder- und Jugendärzte<br />
Dehtleff Banthien.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<br />
<strong>Holstein</strong>isches<br />
Ärzteblatt<br />
Seite 3 3<br />
Nachrichten in Kürze 8<br />
8 Rudolf-Frey-Preis für Notfallmedizin, Kooperationsvertrag zwischen<br />
Lübeck und Bozen, Aus Konkurrenten werden Partner u. a.<br />
17 Leserbrief<br />
Fortbildung 18<br />
18 Veranstaltungskalender<br />
Personalia 19<br />
19 70 Jahre und ein bisschen weise ...<br />
20 Chefarzt Dr. Gerd Gritzke im Ruhestand<br />
21 Geburtstage und Verstorbene<br />
Bad Segeberg 22<br />
22 Situation im Notdienst erfreulich<br />
Manchmal gibt es auch Gutes zu berichten. Ralf Büchner und seinem<br />
Team ist offenbar die seit 1. Januar 2007 erfolgte Umstellung im kassenärztlichen<br />
Notfallbereitschaftsdienst gut gelungen.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> 24<br />
24 Ausstellung Schattensprache<br />
Ausstellung zur nonverbalen Kommunikation in Rendsburg.<br />
25 Kinderarznei im Test - Interview mit Dehtleff Banthien<br />
27 Im Jahr 150 000 Patienten<br />
Gesundheitszentrum Kiel-Mitte erfolgreich. Ärztliche Kommunikation funktioniert<br />
hervorragend.<br />
28 Prävention und Gesundheitsförderung bei Kindern<br />
Bericht über ein Pilotprojekt in der Grundschule Lütjenmoor in Norderstedt.<br />
30 Gegen Gesundheitskarte - für Fundamentalopposition<br />
Generalversammlung der Ärztegenossenschaft <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>. Erstmalig<br />
konnte ein sechsstelliger Gewinn vermeldet werden.<br />
32 Optimismus bei Privaten<br />
Die privaten Kliniken wollen ihre Chancen nutzen.<br />
33 Telemedizinische Überwachung von Herzkranken<br />
Erweiterung der Möglichkeit telemedizinischer Überwachung von Herzkranken<br />
für TK-Mitglieder, s. a. SHÄ 6/2001, S. 34-35; SHÄ 8/2003,<br />
S. 42-43; SHÄ 11/2003, S. 20; SHÄ 10/2005, S. 28-29.<br />
34 Defizite bei Versorgung von Kopfschmerzen und Migräne<br />
Über 100 000 Menschen nehmen täglich in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> Schmerzmittel<br />
gegen Kopfschmerzen ein. Kopfschmerzen und Migräne als stille<br />
Epidemie.<br />
35 Starke Verunsicherung der Patienten<br />
37 Vertrauen in Wirksamkeit gering<br />
Bericht von einer Podiumsdiskussion über das leidige Thema GKV-WSG.<br />
38 48. Westerland-Seminar erfolgreich<br />
Eine Woche Fortbildung für Ärzte(innen), gestaltet und organisiert durch<br />
die Norddeutsche Gesellschaft für ärztliche Fortbildung.<br />
40 Dietmar Katzer neuer Vorstandsvorsitzender<br />
Neue Gesichter im Vorstand der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung.<br />
Auch die <strong>Ärztekammer</strong> ist gut vertreten.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007
41 Unerfüllte Forderungen<br />
43 Erworbene Fortbildungszertifikate<br />
Kammer-Info <strong>aktuell</strong> 44<br />
44 Wo findet man <strong>aktuell</strong>e Informationen?<br />
45 Versorgungsvertrag diabetischer Fuß<br />
45 Verweigerte Hilfe beim Sterben<br />
48 Oder die Flucht nach vorn<br />
49 Ausbildung von Medizinischen Fachangestellten auch im Krankenhaus<br />
möglich<br />
50 Sucht und Migration<br />
51 Schlichtungen in Arzthaftpflichtfragen<br />
Rezension: Tod in Afrika. Mein Leben gegen AIDS (S. 52)<br />
Gesundheits- und Sozialpolitik 53<br />
53 Rezepte - Rabatte - weisse Bescheid?<br />
54 Die Verantwortung des Staates und die Freiheit der Bürger<br />
Medizin und Wissenschaft 61<br />
61 Neue Entwicklungen beim Mammakarzinom<br />
Ein Bericht aus der Medizinischen Gesellschaft Lübeck.<br />
63 Notfallmedizinische Forschung<br />
3. wissenschaftliches Treffen des Arbeitskreises Notfallmedizin der DGAI in Kiel<br />
67 Kieler Herzchirurgen erfolgreich in der Herzklappen-Forschung<br />
Ein minimal-invasives Verfahren zum Ersatz einer Herzklappe am rechten<br />
Herzen bei Kindern mit komplexen, angeborenen Herzfehlern ist in Kiel<br />
erarbeitet worden.<br />
68 Neuartiger Hirnschrittmacher für die Behandlung der Parkinson-<br />
Krankheit<br />
Hirnschrittmacher bei Parkinson-Patienten werden genutzt, wenn die medikamentöse<br />
Therapie nicht mehr wirksam ist. Über Fortschritte dieser<br />
Therapie ein Bericht aus dem Campus Lübeck des UK S-H.<br />
Unsere Nachbarn 70<br />
70 Ist das möglich?<br />
Ist Selbstbestimmung bei Demenz möglich?<br />
71 Wenn Kinder sich selbst und andere gefährden<br />
Konflikt zwischen der Patientenautonomie und der Schadenvermeidung.<br />
Wie kann der die Ärztin/der Arzt damit umgehen.<br />
72 Nichts geht ohne Angehörige<br />
Ein Bericht von den 8. Alzheimertagen in Hamburg. Kann ärztliches Handeln<br />
die Einweisung in ein Pflegeheim verhindern?<br />
Mitteilungen der Kassenärztlichen Vereinigung 75<br />
75 Zur Vertragspraxis Zugelassene. Diese Beschlüsse sind noch<br />
nicht rechtskräftig, sodass hiergegen noch Widerspruch eingelegt<br />
bzw. Klage erhoben werden kann<br />
77 Rechtskräftig zur Vertragspraxis Zugelassene<br />
79 Zur Überweisungspraxis Ermächtigte. Diese Beschlüsse sind<br />
noch nicht rechtskräftig, sodass hiergegen noch Widerspruch<br />
eingelegt bzw. Klage erhoben werden kann<br />
82 Öff. Ausschreibung von Vertragspraxen<br />
Stellen- und Gelegenheitsanzeigen 84<br />
Telefonverzeichnis/Impressum 94<br />
Mitteilungen der Akademie 96<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
inhaltsverzeichnis<br />
35 Starke Verunsicherung<br />
Dr. Bernhard Bambas, Vorsitzender<br />
des schleswig-holsteinischen Berufsverbandes<br />
der Augenärzte<br />
Kritik ist schwer zu ertragen. Vor allem,<br />
wenn sie aus berufenen Munde<br />
kommt. Der Bericht des Patientenombudsmannes<br />
Jens-Hinrich Pörksen<br />
über Beschwerden gegen Augenärzte<br />
führte zu einer heftigen Reaktion des<br />
Berufsverbandes. Eine Einigung im<br />
Interesse der Patienten war bei Redaktionsschluss<br />
noch nicht zu erkennen.<br />
54 Die Verantwortung<br />
des Staates und die<br />
Freiheit der Bürger<br />
Ein Referat<br />
des geschäftsführendenDirektors<br />
des<br />
PhilosophischenSeminars<br />
der<br />
Kieler Universität,<br />
Prof. Dr.<br />
phil. WolfgangKersting<br />
vor den Freien Berufen - s. a.<br />
SHÄ 6/2007, 24-26.<br />
Titelbild: Teilnehmer des Kurses „Rettungsdienst/Notfallmedizin“,<br />
angeboten<br />
von der Akademie der <strong>Ärztekammer</strong>.<br />
(Foto: di)<br />
(Foto: rat)<br />
(Foto: rat)<br />
5
nachrichten in kürze<br />
8<br />
Rudolf-Frey-Preis für Notfallmedizin<br />
an Kieler Arzt<br />
Dr. Patrick Meybohm, Assistenzarzt<br />
der Klinik für Anästhesiologie<br />
und Operative Intensivmedizin<br />
(Direktor: Prof. Dr.<br />
Jens Scholz) des Universitätsklinikums<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>,<br />
Campus Kiel, hat auf der 54.<br />
Jahrestagung der Deutschen<br />
Gesellschaft für Anästhesiologie<br />
und Intensivmedizin im Mai<br />
2007 in Hamburg den mit<br />
2 500 Euro dotierten Rudolf-<br />
Frey-Preis für Notfallmedizin<br />
gewonnen. Dr. Meybohm hat<br />
den Preis „in Würdigung seines<br />
Einsatzes für die anästhesiologische<br />
Forschung“ erhalten, wo<br />
er sich mit den Veränderungen<br />
des Gehirn-Stoffwechsels im<br />
Rahmen eines unkontrollierten,<br />
so genannten hämorrhagischen<br />
Schocks nach Leberverletzung beschäftigt<br />
hat. So konnte in einer tierexperimentellen Arbeit<br />
erstmals demonstriert werden, dass die Kombination<br />
bestimmter Medikamente beim hämorrhagischen<br />
Schock im Vergleich zu üblichen Behandlungsmethoden<br />
vorteilhafter für Hirndurchblutung und Sauerstoffanreicherung<br />
ist. Die Ergebnisse der Studie<br />
wurden im angesehenen internationalen Journal<br />
Anaesthesia & Analgesia publiziert. Damit wurde<br />
die seit einigen Jahren am UK S-H, Campus Kiel,<br />
etablierte Arbeitsgruppe Experimentelle Notfallmedizin<br />
hochrangig ausgezeichnet. (Dr. Anja<br />
Aldenhoff-Zöllner)<br />
Einzigartige Bedingungen für die Erforschung<br />
von Erbkrankheiten<br />
Kooperationsvertrag zwischen Lübeck<br />
und Bozen<br />
Dr. Christine Klein<br />
Dr. Patrick Meybohm (Foto: UK S-H)<br />
Die Europäische Akademie Bozen<br />
(EURAC) und Universität<br />
zu Lübeck haben einen Kooperationsvertrag<br />
geschlossen. Darin<br />
ist die Förderung und Vertiefung<br />
der bestehenden wissenschaftlichenZusammenarbeit<br />
vereinbart.<br />
Die enge Kooperation in der<br />
genetischen Medizin besteht<br />
seit 1997. Die Lübecker Neu-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
rogenetikerin und Lichtenberg-Professorin Dr.<br />
Christine Klein und ihr Bozener Kollege PD Dr.<br />
Peter Paul Pramstaller erforschen die<br />
Mechanismen vererblicher Erkrankungen.<br />
Sie stützen sich dabei auf die Daten<br />
der Bevölkerung abgelegener Alpendörfer<br />
in Südtirol.<br />
Für die Untersuchung von Veränderungen<br />
der Erbsubstanz bieten die Populationen<br />
solcher so genannter Mikroisolate -<br />
anders als die übrige, im Laufe der Generationen<br />
genetisch vielfach durchmischte<br />
Bevölkerung - einzigartige Bedingungen.<br />
Prof. Dr. Christine Klein arbeitet an der<br />
Entwicklung von Biomarkern für die Parkinson-Krankheit.<br />
Dabei kombiniert sie<br />
eine Analyse des Transkriptoms (Genexpression)<br />
mit modernen bildgebenden<br />
Verfahren (strukturelle und funktionelle<br />
Magnetresonanztomographie MRT und<br />
Positronenemissionstomographie PET).<br />
Besonderes Augenmerk liegt auf den frühen<br />
oder sogar präklinischen Krankheitsstadien bei<br />
noch gesunden Mutationsträgern.<br />
Vertiefung der Zusammenarbeit beschlossen: Prof. Dr. Peter Dominiak<br />
(li.) und Dr. Werner Stuflesser (re.) (Fotos: René Kube)<br />
Dr. Pramstaller hat sich 2003 an der Universität Lübeck<br />
habilitiert und ist seitdem Mitglied der hiesigen<br />
Medizinischen Fakultät. Er hat an der Europäischen<br />
Akademie Bozen das Institut für Genetische Medizin<br />
aufgebaut.<br />
Lübecker und Bozener Wissenschaftler haben in<br />
den vergangenen Jahren wechselseitige Gastaufenthalte<br />
durchgeführt. Lübecker Studenten waren an<br />
Forschungsprojekten in Bozen beteiligt und haben<br />
in der dortigen Klinik für Neurologie famuliert.
Christine Klein und Peter Pramstaller feierten in<br />
diesem Jahr ihre 50. gemeinsame Publikation.<br />
An der Vertragsunterzeichnung haben aus Bozen<br />
der Präsident der EURAC, Dr. Werner Stuflesser,<br />
und der Ressortdirektor beim Landesrat für deutsche<br />
Schule, Berufsbildung und Universität der Autonomen<br />
Provinz Bozen - Südtirol, Dr. Günther Andergassen,<br />
für die Universität zu Lübeck der Rektor<br />
Prof. Dr. Peter Dominiak, sowie Prof. Dr. Christine<br />
Klein, Prof. Dr. Detlef Kömpf, PD Dr. Peter Paul<br />
Pramstaller und Prof. Dr. Heribert Schunkert teilgenommen.<br />
Das Land <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> war durch<br />
den Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft,<br />
Wirtschaft und Verkehr, Jost de Jager, vertreten.<br />
(Rüdiger Labahn)<br />
Friedrich-Ebert-Krankenhaus und Ärzte der<br />
Lehmann-Klinik kooperieren<br />
Aus Konkurrenten werden Partner<br />
Ab 1. Juni 2007 beginnen das Friedrich-Ebert-Krankenhaus<br />
(FEK) und die Ärzte der Lehmann-Klinik<br />
in Neumünster eine richtungsweisende Zusammenarbeit<br />
auf dem Gebiet der Chirurgie.<br />
Friedrich-Ebert-Krankenhaus (oben),<br />
Lehmann-Klinik (re.)<br />
(Fotos: FEK/Lehmann-Klinik)<br />
Das Friedrich-Ebert-Krankenhaus<br />
übernimmt die stationäre Versorgung<br />
der Lehmann-Klinik und sichert<br />
damit den Standort für die<br />
stationäre Versorgung in der Marienstraße.<br />
Die Ärzte der Gemeinschaftspraxis<br />
(Dr. Norbert Spilok, Dr. Frank<br />
Supke, Dr. Gerhard Schubert) gründen gemeinsam<br />
mit dem FEK ein Medizinisches Versorgungszentrum<br />
(MVZ) für die ambulante chirurgische Versorgung.<br />
Das FEK beteiligt sich in Nachfolge des aus-<br />
scheidenden Arztes Dr. Heiko Dau ab 1. August<br />
2007 am MVZ mit einem noch anzustellenden Chirurgen.<br />
Die Motivation der Ärzte der Lehmann-Klinik<br />
zur Kooperation liegt in der wirtschaftlichen Sicherung<br />
des Standortes Marienstraße, der traditionellen<br />
Verbundenheit zum Krankenhaus, der Stärkung<br />
der regionalen chirurgischen Versorgung und<br />
besonders in der Sicherung der 35 Arbeitsplätze am<br />
Standort in der Marienstraße. Das FEK ließ sich<br />
letztlich leiten durch die Verbesserung der Wettbewerbssituation<br />
in Neumünster auf chirurgischem<br />
Gebiet, der intensiveren Zusammenarbeit mit dem<br />
ambulanten Bereich und einer richtungsweisenden<br />
Verzahnung der ambulanten und stationären Versorgungsstrukturen<br />
in Neumünster.<br />
Für die Bevölkerung bringt diese Kooperation die<br />
Vorteile einer wohnortnahen kompletten chirurgischen<br />
Versorgung, die Abstimmung von ambulanten<br />
und stationären Behandlungskonzepten, die<br />
Einbindung von erfahrenen Fachärzten der Lehmann-Klinik<br />
in die stationäre Versorgung. Weiterhin<br />
wird in Kürze die ambulante chirurgische Notfallversorgung<br />
außerhalb der Praxissprechzeiten<br />
gemeinsam an einem Standort am Friedrich-<br />
Ebert-Krankenhaus konzentriert, sodass der Patient<br />
am Abend nur noch eine Anlaufstelle hat.<br />
Insgesamt wird diese Kooperation eine Stärkung<br />
des Standortes Neumünster in zunehmendem<br />
Wettbewerb für die Patientenversorgung mit sich<br />
bringen. (A. von Dollen/Dr. N. Spilok)<br />
Rating der apoBank heraufgestuft<br />
nachrichten in kürze<br />
Die Rating-Agentur Moody’s hat das Langfrist-<br />
Rating der Deutschen Apotheker-<br />
und Ärztebank (apoBank)<br />
von bisher „A2“ auf jetzt „A1“<br />
angehoben; der Ausblick wurde<br />
mit „stabil“ bestätigt. Das individuelle<br />
Finanzkraft-Rating bleibt<br />
mit „C+“ unverändert hoch auf<br />
der in dieser Klassifizierung <strong>aktuell</strong><br />
zweitbesten Rating-Note deutscher<br />
Banken.<br />
Die Beurteilung, die nach der Heraufstufung<br />
dem Rating von Standard<br />
& Poor’s und dem Verbund-<br />
Rating von Fitch entspricht, spiegelt<br />
neben den stabilen finanzwirtschaftlichen<br />
Fundamentaldaten das solide Risikoprofil<br />
und die gute Geschäftsposition der apoBank wider.<br />
(Deutsche Apotheker- und Ärztebank)<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 9
nachrichten in kürze<br />
10<br />
Universität Lübeck<br />
Neuer Hemmstoff gegen das Aidsvirus<br />
entdeckt<br />
Chemiker der Universität<br />
zu Lübeck sind an der<br />
Entwicklung von Hemmstoffen<br />
gegen das Aidsvirus<br />
beteiligt. Die Entschlüsselung<br />
des Wirkprinzips<br />
bei dem körpereigenen<br />
HIV-Hemmer<br />
Virip, dessen Entdeckung<br />
jetzt in der Zeitschrift<br />
„Cell“ veröffentlicht<br />
wurde, geschah auf<br />
Prof. Dr. Thomas Peters<br />
Grundlage kernmagnetischer<br />
Resonanzanalysen (Nuclear Magnetic Resonance,<br />
NMR) aus Lübeck.<br />
Prof. Dr. Thomas Peters und Dr. Thorsten Biet aus<br />
dem Institut für Chemie der Universität Lübeck be-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
nutzten die gewonnenen NMR-Daten, um zusammen<br />
mit Prof. Dr. Bernd Meyer von der Universität<br />
Hamburg einen molekularen Strukturvorschlag zu<br />
entwickeln. Er betrifft die Wechselwirkung zwischen<br />
den Zellmembranen von Virus und Wirtszelle,<br />
die von Aidsforschern gegenwärtig mit besonderem<br />
Interesse untersucht wird.<br />
Leiter der Arbeitsgruppe, die den neuen HIV-Hemmer<br />
fand, ist Prof. Dr. Frank Kirchhoff von der Universität<br />
Ulm. Der Beitrag in „Cell“ trägt den Titel<br />
„Discovery and Optimization of a Natural HIV-1<br />
Entry Inhibitor Targeting the gp41 Fusion Peptide“<br />
(Cell 129, S. 263-275, 20. April 2007).<br />
Die Wissenschaftler entdeckten, dass ein bestimmtes<br />
Teilstück eines bekannten Blutproteins Aidsviren<br />
blockiert (Virus-inhibitorisches Peptid =<br />
Virip). Virip unterbindet beim Aidserreger HIV-1<br />
eine spezifische Funktion des Hüllproteins gp41. Die<br />
Viren benötigen das Protein, um in die menschlichen<br />
Zellen einzudringen. Laborversuche ergaben,<br />
dass Viren gegen Virip nicht resistent wurden.<br />
Einschulungstermine und Berufsschultage im Schuljahr 2007/2008<br />
der Medizinischen Fachangestellten bzw. Arzthelferinnen<br />
Berufsschule Unterstufe Mittelstufe Oberstufe<br />
Bad Oldesloe Einschulung: 27.08.07, 7:55 Uhr, Schultage: Mo+Di AH-M: Do AH-O: Mi<br />
Bad Segeberg Einschulung: 28.08.07, Schultage MFA07: Di+Do Mo Mi<br />
Flensburg Einschulung: 29.08.07, 8:00 Uhr, Blockwoche: 29.08.-04.09.07<br />
Schultage: MFA10a: Di+Mi, MFA10b: Fr+Mi<br />
MFA09a: Mo<br />
MFA09b: Do<br />
AH08a: Mo<br />
AH08b: Di<br />
Heide Einschulung: 27.08.07, 7:45 Uhr, Schultage AAr70: Mo+Fr AAr60: Do AAr50: Mi<br />
Itzehoe Einschulung: 29.08.07, 8:00 Uhr, Schultage 07MF: Mi+Do 06MF: Di 05MF: Fr<br />
Kiel Einschulung: MeFa07a+c: 29.08.07, MeFa07b: 30.08.07<br />
Schultage: MeFa07a: Mo+Mi<br />
MeFa07b: Di+Do<br />
MeFa07c: Mi+Fr<br />
Lübeck Einschulung: AU 1: 28.08.07, AU 2: 29.08.07<br />
Schultage: AU 1: Di+Mi, AU 2: Mi+Fr<br />
MeFa06a+b: Mo<br />
MeFa06c+d: Fr<br />
AM 1: Mo<br />
AM 2: Di<br />
AHO5a+d: Di<br />
AHO5b+c: Do<br />
AO 1: Fr<br />
AO 2: Do<br />
Mölln Einschulung: 28.08.07, 7:30 Uhr, Schultage MFA-07: Mo+Mi MFA-06: Do MFA-05: Di<br />
Neumünster Einschulung: 27.08.07, 8:00 Uhr, Schultage: Do+Fr<br />
Blockwoche: 27.8.-01.09.07<br />
Di Mi<br />
Neustadt Einschulung: 27.08.07, 7:45 Uhr, Schultage: Mo+Do Mi Di<br />
Niebüll Einschulung: 28.08.07, 7:55 Uhr, Schultage MFA U: Di+Mi MFA M: Do AH Oa+b: Mi<br />
Pinneberg Einschulung: 27.08.07, Schultage: Mo+Fr Di Mi<br />
Rendsburg Einschulung: 28.08.07, 8:00 Uhr<br />
Schultage: MFA07a: Mi+Fr, MFA07b: Mi+Do<br />
MFA 06a: Di<br />
MFA 06b: Do<br />
AH05a: Mo<br />
AH05b: Di
Dr. Thorsten Biet<br />
(Fotos: Universität Lübeck)<br />
Virip greift am selben<br />
Protein an wie das seit<br />
2003 zugelassene Aidsmedikament<br />
Fuzeon mit<br />
dem Wirkstoff Enfuvirtid,<br />
aber an einer anderen<br />
Stelle. Wenn die<br />
künstlichen Abkömmlinge<br />
von Virip in klinischen<br />
Studien erfolgreich<br />
sind, könnten diese<br />
Verbindungen Menschen<br />
helfen, deren Aidsviren<br />
gegen andere Medikamente resistent geworden sind.<br />
Die Lübecker Forschungen mit der kernmagnetischen<br />
Resonanzanalyse stehen im Rahmen eines gemeinsam<br />
mit der Universität Hamburg betriebenen<br />
NMR-Großgerätes der Deutschen Forschungsgemeinschaft.<br />
Es hat sich hier in den vergangenen Jahren<br />
ein leistungsstarkes Zentrum für Wirkstoffforschung<br />
entwickelt, das an modernen Methoden der<br />
Medikamentenentwicklung arbeitet. (Rüdiger Labahn)<br />
Urologie Kiel des Universitätsklinikums<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
Förderung mit über 200 000 Euro<br />
Die Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG) fördert<br />
seit Juni 2007 die Klinik für Urologie und Kinderurologie<br />
des Universitätsklinikums <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>,<br />
Campus Kiel. Der Antragsteller, PD Dr.<br />
Christoph Seif, wird die Fördersumme von über 200 000<br />
Euro für die Erforschung und Therapie von Blasenentleerungsstörungen<br />
und Prostataleiden mit Botulinumtoxin<br />
einsetzen.<br />
Viele Patienten leiden unter einem sehr häufigen<br />
und unwillkürlich auftretenden Harndrang, der zu<br />
Inkontinenz führen kann und mit Tabletten oft<br />
nicht zu behandeln ist. Die Harnblase krampft sich<br />
bei den Betroffenen, ähnlich wie bei querschnittgelähmten<br />
Patienten, ohne Vorankündigung zusammen.<br />
Als Therapiemaßnahme kann jetzt unter örtlicher<br />
Betäubung ein Medikament (Botulinumtoxin A)<br />
in die Blase injiziert werden, das die genannten<br />
Symptome für acht bis zehn Monate reduziert oder<br />
gänzlich verschwinden lässt. Auch Patienten mit<br />
gutartigen Prostataproblemen, die sich nicht operieren<br />
lassen wollen, können mit diesem Medikament<br />
behandelt werden. Es bewirkt, dass die Prostata<br />
schrumpft und sich der Harnstrahl und die Blasenentleerung<br />
verbessern.<br />
Zahlreiche nationale und internationale wissenschaftliche<br />
Veröffentlichungen zeigen, dass die Bo-<br />
tulinumtoxin-Therapie für Blase und Prostata sehr<br />
gut wirkt. In Deutschland ist sie bisher allerdings<br />
nicht zugelassen. An der Klinik für Urologie am<br />
Campus Kiel laufen daher Zulassungsstudien, um<br />
die Therapien zukünftig allen Patienten anbieten zu<br />
können. Mit den bewilligten finanziellen Mitteln<br />
der DFG werden zudem grundlagen-wissenschaftliche<br />
Daten und Informationen im Labor gesammelt,<br />
um die Behandlung weiter zu optimieren. (Dr. Anja<br />
Aldenhoff-Zöllner)<br />
Johanniter-Krankenhaus Geesthacht<br />
Neuer Geschäftsführer des Johanniter-Krankenhauses<br />
Geesthacht wird Carsten Schwaab ab 1. August<br />
2007. Er ist Nachfolger des langjährigen stellvertretenden<br />
und (seit 2005) Geschäftsführers Christian<br />
Madsen, der zum 1. Mai 2007 an das Krankenhaus<br />
in Wermelskirchen (Nordrhein-Westfalen) gegangen<br />
war. Madsen hatte das Krankenhaus in einer<br />
schwierigen Phase übernommen und erfolgreich die<br />
wirtschaftliche Neuausrichtung eingeleitet, so der<br />
ärztliche Direktor Dr. Frank Templin und der Kuratoriumsvorsitzende<br />
Dr. Ralph Kramer.<br />
Intern bekannt<br />
wurde die Neubesetzung<br />
um<br />
den 23. Mai<br />
2007, als in der<br />
Eingangshalle<br />
des Krankenhauses<br />
eine interessanteFotoausstellung<br />
eröffnet wurde.<br />
Der Chefarzt<br />
der Inneren<br />
Dr. Ekkehard<br />
Schnieber und<br />
sein Oberarzt<br />
Dr. Volker<br />
Dr. Ekkehard Schnieber (Foto: hk)<br />
Penselin mit<br />
Ehefrau Dorothea zeigten zusammen mit einem<br />
Vortrag zum Klimawandel von Dr. Markus Quante,<br />
GKSS Forschungszentrum, nachdenklich machende<br />
Bilder von schmelzenden Gletschern in Chile und<br />
Wüstensand in der Sahara. (hk)<br />
Onkologie-Vereinbarung verlängert<br />
nachrichten in kürze<br />
Die vor zwei Jahren zwischen der Kassenärztlichen<br />
Vereinigung <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> (KVSH) und AOK<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> abgeschlossene „Vereinbarung<br />
zur Förderung der qualifizierten medizinischen Ver-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 11
nachrichten in kürze<br />
12<br />
sorgung auf dem Gebiet der Onkologie“ hat sich<br />
bewährt und ist daher verlängert worden. Dies teilten<br />
beide Vertragspartner am 25. Mai 2007 mit. Der<br />
Vertrag nach § 73 c SGB V (Versorgungsvertrag zur<br />
Förderung der Qualität in der vertragsärztlichen<br />
Versorgung) umfasst über 20 Seiten und ist - allerdings<br />
bei den Anlagen nicht vollständig - mit einem<br />
schnellen Rechner unter www.kvsh.de zu finden. Es<br />
sei gelungen, so die Vorsitzenden von KVSH und<br />
AOK-SH, die Qualitätsstandards in der ambulanten<br />
Krebsdiagnostik und -therapie weiter hoch zu halten,<br />
besonders auch bei der zytostatischen Therapie.<br />
Seit der Einführung wurden etwa 30 000 Patienten<br />
behandelt. Auf der ersten Versorgungsebene sorgen<br />
besonders qualifizierte Ärzte vor Ort für Betreuung<br />
und für die Koordination der Behandlungsabläufe<br />
und der psychotherapeutischen Betreuung. Auf der<br />
zweiten Versorgungsebene wird die Chemotherapie<br />
durch überwiegend onkologisch tätige Ärzte sichergestellt.<br />
Die Behandlungsqualität werde gesichert<br />
durch regelmäßige Fortbildungen und durch onkologische<br />
Kooperationsgemeinschaften mit weiteren<br />
Fachärzten bei Fach- und Fallkonferenzen.<br />
Interessierte erhalten, so heißt es in der Pressemitteilung,<br />
in den AOK-Geschäftsstellen „Auskunft<br />
über die insgesamt 135 teilnehmenden Vertragsärzte<br />
in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>“. Eine Übersicht wenigstens<br />
über die regionale Verteilung wurde dem Berichterstatter<br />
des <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>ischen Ärzteblattes<br />
von KVSH und Kasse nicht gewährt. (hk)<br />
Eröffnung der gefäßchirurgischen Praxis am<br />
Lubinus Clinicum, Kiel<br />
Vor zehn Jahren<br />
Am 1. Juni 1997 eröffnete die inzwischen verstorbene<br />
Dr. Eva Schweizer ihre gefäßchirurgische Praxis<br />
am Lubinus Clinicum Kiel.<br />
Am 1. Juni 2000 wurde die Praxis von Dr. Astrid<br />
Maquardt übernommen. Die Praxis ist mit dem Lubinus<br />
Clinicum Kiel durch die konsiliarärztliche und<br />
belegärztliche Tätigkeit eng verbunden. Im Jahre<br />
2006 wurden 82 Patienten gefäßchirurgisch stationär<br />
behandelt und rund 160 gefäßchirurgische<br />
ambulante Operationen im Lubinus Clinicum<br />
durchgeführt. (Christoph Merker)<br />
Philosophische Beratung<br />
Die vor den Heilberufen nicht haltmachende<br />
Burnout-Symptomatik lässt auch nach eher ungewöhnlichen<br />
Hilfen Ausschau halten. Wer abseits<br />
der Psycho-Schiene ein klärendes Gespräch auf<br />
Augenhöhe schätzt,<br />
kann zum Beispiel<br />
eine philosophische<br />
Beratung in Anspruch<br />
nehmen. In<br />
Reinbek ist seit zwei<br />
Jahren die philosophische<br />
Praxis<br />
„Denkräume“ von<br />
Dr. Ina Schmidt tätig.<br />
Die von der<br />
Universität Lüneburg<br />
kommende<br />
Kulturwissenschaftlerin<br />
und Philosophin<br />
(33) bietet Dr. Ina Schmidt (Foto: hk)<br />
Einzelgespräche, Seminare<br />
und Vorträge zu Lebensfragen an. Sie<br />
kommt von der Lebensphilosophie her, schätzt die<br />
Phänomenologie, die ja auch für Heilberufler im<br />
Blick auf den Patienten wertvoll sein kann. Bei Patienten,<br />
sagte sie im Gespräch mit dem <strong>Schleswig</strong>-<br />
<strong>Holstein</strong>ischen Ärzteblatt, könne philosophisch<br />
tiefer nach dem Befinden, nach den Wünschen<br />
(Gesundheit inwiefern?) und nach der Verbindung<br />
von Gedanken und Gefühlen gefragt werden. Für<br />
Ärzte, denen mitunter die Zeit fehle, ihre Persönlichkeit<br />
positiv in das Arzt-Patienten-Gespräch einzubringen,<br />
gebe es die Möglichkeit der assistierten<br />
Selbstreflexion, etwa im Sinne eines sokratischen<br />
Dialogs. Info im Internet unter www.denkraeume.net.<br />
(hk)<br />
Für Sie gelesen:<br />
Firmenlastige Studien<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
„Natürlich sind nicht nur viele Studien firmenlastig,<br />
sondern auch die dazugehörigen ,Editorials’ und die<br />
resultierenden Leitlinien. Wenn es um Arzneimittel<br />
geht, fehlen offenbar in vielen Fällen industrieunabhängige<br />
Experten, auch in den Fachgesellschaften.“<br />
Prof. em. Dr. Frank P. Meyer in AVP Arzneiverordnung<br />
in der Praxis, April 2007, S. 34 f., Hg. Arzneimittelkommission<br />
der Deutschen Ärzteschaft<br />
(AkdÄ), mit der Forderung, konkrete Halbwahrheiten,<br />
Versäumnisse oder Lügen „zu denunzieren“ -<br />
dies sei die originäre Aufgabe der AkdÄ, aller Ethikkommissionen<br />
und kritischer Medizinjournalisten. (hk)
Medizin und Naturwissenschaften<br />
„Chemie, Anatomie und Botanik galten als medizinische<br />
Hilfswissenschaften, die Naturwissenschaften<br />
waren in diesem frühneuzeitlichen Wissenschaftsverständnis<br />
auf das menschliche Wohlbefinden<br />
bezogen.“<br />
(Dr. phil. Jan Schlürmann, Historisches Seminar d.<br />
Univ. Kiel, über den Kieler Medizinprofessor und<br />
Gartengründer „Johann Daniel Major und der erste<br />
Botanische Garten der CAU zu Kiel“, in: Christiana<br />
Albertina, Forschungen und Berichte aus der CAU,<br />
Mai 2007, S. 37). (hk)<br />
Buchtipp: Arthrose-Info Fuß<br />
Das Arthrose-Info Heft 74 vom Juni 2007 gibt auf<br />
16 Seiten nützliche Tipps für Patienten mit Fuß-,<br />
zumal Sprunggelenksarthrose. Erhältlich bei der<br />
Deutschen Arthrosehilfe, Tel. 06831/946677. (hk)<br />
Deutsch-schweizerische Forschungskooperation<br />
erhält Auszeichnung<br />
Rudolf-Virchow-Preis für Kieler Pathologen<br />
des UK S-H<br />
Die Pathologen Dr. Martin Anlauf aus Kiel und<br />
Prof. Dr. Aurel Perren aus Zürich sind für gemeinsam<br />
durchgeführte Forschungsprojekte mit dem<br />
Rudolf-Virchow-Preis ausgezeichnet worden. Der<br />
mit 3 000 Euro dotierte Preis wurde auf der 91. Jahrestagung<br />
der Deutschen Gesellschaft für Pathologie<br />
in Magdeburg verliehen. Der Rudolf-Virchow-Preis<br />
ist die höchste Auszeichnung für Pathologen unter<br />
40 Jahren im deutschsprachigen Raum.<br />
Anlauf ist wissenschaftlicher Assistent am Institut<br />
für Pathologie des UK S-H am Campus Kiel (Direktor:<br />
Prof. Dr. Günter Klöppel). Perren lehrt an den<br />
Instituten für Pathologie in Zürich (Direktor: Prof.<br />
Dr. Holger Moch) und München. Ausgezeichnet<br />
wurden die Wissenschaftler für ihre Forschungsergebnisse<br />
zur Morphologie und Genetik duodenaler<br />
Gastrinome.<br />
Duodenale Gastrinome sind mikroskopisch kleine<br />
Tumore des Zwölffingerdarms, die das Hormon Gastrin<br />
bilden. Gefährlich für den Patienten sind meist<br />
nicht die Tumore als solche, sondern die Auswirkungen<br />
des produzierten Hormons, das die Schleimhaut<br />
schädigt und innere Blutungen verursacht.<br />
Aufgrund ihrer Größe sind Gastrinome schwer zu<br />
diagnostizieren und zu therapieren, auch nach einer<br />
Operation sind Patienten häufig nicht geheilt. Anlauf<br />
und Perren konnten mit molekularen Analysen<br />
erstmals nachweisen, dass bei einem Teil der Patien-<br />
ten nicht nur einzelne,<br />
sondern<br />
multiple Gastrinome<br />
in Verbindung<br />
mit mikroskopisch<br />
kleinen<br />
Gastrinzell-Vorläuferstadienauftreten,<br />
aus denen<br />
sich vermutlich<br />
weitere Gastrinome<br />
entwickeln<br />
können.<br />
Diese grundlegendenErkenntnisse<br />
liefern möglicherweise<br />
die<br />
nachrichten in kürze<br />
Prof. Dr. Aurel Perren (links) und Dr. Martin<br />
Anlauf bei der Preisverleihung<br />
(Foto: UK S-H)<br />
Basis für neue Therapieansätze und wurden in den<br />
internationalen Fachzeitschriften Gastroenterology<br />
und Gut publiziert. Die Arbeitsgruppen von Anlauf<br />
und Perren in Kiel und Zürich werden ihre gemeinsame<br />
Forschungsarbeit auch in Zukunft fortsetzen.<br />
Gefördert wurde das Kieler Forschungsprojekt von<br />
der Hensel-Stiftung der Christian-Albrechts-Universität<br />
zu Kiel. (Dr. Anja Aldenhoff-Zöllner)<br />
Bundesforschungsministerium fördert klinische<br />
Studie<br />
Hautregeneration mit Erythropoietin<br />
bei Verbrennungen<br />
Das die Bildung roter Blutkörperchen verstärkende<br />
Erythropoietin (EPO) kann in der Verbrennungsmedizin<br />
für die Hautregeneration genutzt werden.<br />
Eine klinische Multicenterstudie dazu an sieben<br />
deutschen Verbrennungszentren wurde am Zentrum<br />
für Schwerbrandverletzte des Universitätsklinikums<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, Campus Lübeck,<br />
konzipiert. Sie wird jetzt vom Bundesministerium<br />
für Bildung und Forschung (BMBF) mit 1,1 Millionen<br />
Euro gefördert.<br />
Bei Patienten mit großflächigen Verbrennungs- oder<br />
Verbrühungsverletzungen kann eine wiederholte<br />
Spalthautentnahme von derselben Entnahmestelle<br />
notwendig sein, um zu transplantierende Areale decken<br />
zu können. Häufig regenerieren die Entnahmestellen<br />
jedoch nicht ausreichend schnell, so<br />
dass bei solchen Patienten ein Mangel an Spenderhaut<br />
zu weiteren und weitreichenden Komplikationen<br />
mit fatalem Ausgang führen kann.<br />
Seit etwa drei Jahren sind zahlreiche regenerative<br />
und zytoprotektive Effekte von niedrigdosiertem<br />
Erythropoietin bekannt. In der Multicenterstudie<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 13
nachrichten in kürze<br />
14<br />
sollen diese Effekte sowohl<br />
auf die Entnahmestellen<br />
von Spalthaut als auch auf<br />
die Verbrennungs- und<br />
Verbrühungsverletzungen<br />
selbst untersucht werden.<br />
Die Ergebnisse sollen zur<br />
Etablierung einer neuen<br />
Therapie mit einer deutlichen<br />
Verringerung der<br />
Morbidität und Mortalität<br />
schwerbrandverletzter Patienten<br />
führen.<br />
Leiter der Studie „Regenerative Effekte von niedrig<br />
dosiertem Erythropoietin bei Verbrennungs- und<br />
Verbrühungsverletzungen“ („A multicenter study<br />
on regenerative effects of low-dose erythropoietin,<br />
LDE, in burn and scald injuries“) ist Prof. Dr. Hans-<br />
Günther Machens aus der Sektion für Plastische<br />
und Handchirurgie und dem Zentrum für Schwerbrandverletzte<br />
des Universitätsklinikums in Lübeck.<br />
(Uni Lübeck)<br />
Qualitätssiegel der Krankenhausgesellschaft<br />
erneut erhalten<br />
Nach 2001 und 2004 hat das Team der Röpersbergklinik<br />
am 22. und 23. März 2007 zum dritten<br />
Mal die Prüfung für das Qualitätssiegel der Krankenhausgesellschaft<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> (KGSH)<br />
bestanden. In den seit 2004 vollständig überarbeiteten<br />
21 Prüfkriterien werden u. a. die Ergebnisqualität,<br />
das Informations- und Qualitätsmanagement,<br />
der Umgang mit den Rehabilitanden und die Wirksamkeit<br />
der Behandlungsprozesse genau betrachtet.<br />
Die Vorbereitungen für die Prüfung fanden intensiv<br />
seit Oktober letzten Jahres statt. Bestehen kann eine<br />
Klinik das Verfahren allerdings nur, wenn sie nachweisen<br />
kann, dass man sich kontinuierlich um eine<br />
hohe Qualität und Verbesserungsprozesse kümmert.<br />
Dies ist den Mitarbeitern offensichtlich gut gelungen.<br />
Bereits am 23. März wurde das neue Prüfsiegel „Medizinische<br />
Rehabilitation in geprüfter Qualität“<br />
übergeben, das bis zur nächsten Prüfung 2010 geführt<br />
werden darf. (Rainer Simeit, Röpersbergklinik)<br />
MRT von EU-Bürokraten bedroht<br />
Prof. Machens<br />
(Foto: Uni Lübeck)<br />
Bis spätestens April 2008 ist noch Zeit, um eine zur<br />
Bürokratieposse geratene Arbeitsschutzrichtlinie<br />
der Europäischen Union zu entschärfen. Nach der<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
Richtlinie 2004/40 EG soll Personal bei Arbeiten<br />
mit elektromagnetischen Feldern geschützt werden,<br />
z. B. Arbeiter an Hochspannungseinrichtungen.<br />
Nicht bedacht hatte man, dass danach medizinisches<br />
Personal bei einer Magnetresonanztomographie<br />
(MRT) nicht mehr beim Gerät anwesend sein<br />
dürfte, auch wenn dies bei Notfallpatienten, Kindern<br />
oder anästhesierten Patienten notwendig wäre.<br />
Beim 88. Deutschen Röntgenkongress der Deutschen<br />
Röntgen-Gesellschaft (DRG) Mitte Mai im<br />
ICC Berlin sorgte die auch in Deutschland vorgesehene<br />
Umsetzung in nationales Recht für großes<br />
Kopfschütteln: „Wir müssten dann viel weniger mit<br />
MRT und wieder mehr mit Röntgen arbeiten, also<br />
ein extrem unwahrscheinliches, hypothetisches<br />
gegen ein bekanntes Risiko eintauschen“, sagte<br />
DRG-Präsident Prof. Reiser (München). Die Frage<br />
bleibt, was eigentlich für eine Qualitätsarbeit für viel<br />
Geld in Brüssel geleistet wird. Oder sind es Kompetenzdefizite,<br />
ist es Richtlinien-Wichtigtuerei? (hk)<br />
5,6 Millionen Euro für den SFB 415 in Kiel<br />
Der Sonderforschungsbereich 415 „Spezifität und<br />
Pathophysiologie von Signaltransduktionswegen“<br />
wird in einer abschließenden<br />
vierten Periode für weitere<br />
drei Jahre mit 5,6 Millionen<br />
Euro von der Deutschen<br />
Forschungsgemeinschaft<br />
(DFG) gefördert. Der SFB<br />
415 wurde 1998 an der Medizinischen<br />
Fakultät der<br />
Christian-Albrechts-Universität<br />
(CAU) zu Kiel eingerichtet<br />
und wird in der<br />
Prof. Kabelitz<br />
(Foto: Privat)<br />
am 1. Juli 2007 beginnenden<br />
neuen Förderperiode<br />
insgesamt 18 Teilprojekte umfassen.<br />
Im SFB 415 arbeiten Forscher aus Kliniken und<br />
Instituten der CAU sowie des Forschungszentrums<br />
Borstel zusammen, um auf molekularer Ebene intrazelluläre<br />
Signalwege aufzuklären, die an Entzündungsreaktionen<br />
und an der Kontrolle von Zellwachstum<br />
und Zelldifferenzierung beteiligt sind. Einen<br />
Schwerpunkt stellen dabei die Signalwege von<br />
Zytokinen dar, den löslichen Botenstoffen des Immunsystems.<br />
Ein weiterer Schwerpunkt ist die molekulare<br />
Kontrolle des programmierten Zelltods<br />
(Apoptose) von Tumorzellen. Wie der Sprecher des<br />
SFB 415, Prof. Dr. Dieter Kabelitz vom Institut für<br />
Immunologie der CAU, mitteilt, ist es das erklärte<br />
Ziel des SFB 415, die Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung<br />
möglichst schnell für die Entwicklung
neuer therapeutischer Ansatzpunkte zur Behandlung<br />
von entzündlichen Erkrankungen und<br />
Tumorerkrankungen zu nutzen. In der neuen<br />
Förderperiode kommen hierbei verstärkt innovative<br />
Tiermodelle zur Anwendung, es werden aber auch<br />
im SFB 415 entwickelte und patentierte innovative<br />
Methoden der Zellbiologie benutzt, um intrazelluläre<br />
Signalwege zu charakterisieren. Der SFB 415<br />
ist von zentraler Bedeutung für die Forschungsschwerpunkte<br />
Entzündung und Onkologie der<br />
Medizinischen Fakultät der CAU. Viele Wissenschaftler<br />
des SFB 415 sind gleichzeitig im standortübergreifenden<br />
Netzwerk Entzündungsforschung<br />
tätig. Der SFB 415 ist somit auch eine tragende Säule<br />
der Exzellenzcluster-Initiative Entzündungsforschung<br />
in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>. Weitere Informationen<br />
zum SFB 415 finden Sie im Internet unter<br />
www.sfb415.uni-kiel.de. (Prof. Dr. Dieter Kabelitz,<br />
UK S-H)<br />
Die Veranstaltung<br />
Neue Impfempfehlungen - Neue Impfstoffe<br />
findet statt am 12.09.2007 in Ratzeburg und am<br />
19.09.2007 in Pinneberg -<br />
jeweils von 15:00-18:00 Uhr.<br />
4 Fortbildungspunkte<br />
Referenten: Dr. Hans-Martin Bader, Prof. Dr. Peter<br />
Rautenberg, Prof. Dr. Jörg Steinmann, Dr. Wolfgang<br />
Barchasch u. a.<br />
Weitere Informationen, ausführliches Programm<br />
und Anmeldung: Landesvereinigung für Gesundheitsförderung<br />
e. V. in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, Kiel,<br />
Tel. 0431/94294, Fax 0431/94871, E-Mail gesundheits@lvgfsh.de,<br />
Internet www.lv-gesundheitsh.de<br />
(Elfi Rudolph)<br />
Herzchirurgie in Lübeck operiert erfolgreich<br />
Die Klinik für Herzchirurgie des Universitätsklinikums<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, Campus Lübeck,<br />
unter der Leitung von Prof. Dr. Hans-Hinrich Sievers<br />
behauptet sich erneut in der Spitzengruppe der<br />
Ergebnisqualität herzchirurgischer Operationen. Im<br />
Jahr 2006 wurden in der Klinik für Herzchirurgie<br />
1 450 herzchirurgische Eingriffe vorgenommen. Die<br />
Bundesgeschäftsstelle für Qualitätssicherung, eine<br />
Institution der Bundesärztekammer, analysierte die<br />
Daten von 77 herzchirurgischen Kliniken in<br />
Deutschland.<br />
In der Klinik der überregionalen Maximalversorgung<br />
wird ein erheblicher Anteil an Hochrisikopatienten<br />
behandelt. Umso höher ist es zu bewerten,<br />
dass insbesondere die Sterblichkeitsraten signifikant<br />
unter dem Bundesdurchschnitt liegen. Bei den Routineoperationen,<br />
wie dem isolierten Aortenklappenersatz,<br />
ist die Sterblichkeit im Vergleich zum Bundesschnitt<br />
in Lübeck am zweitniedrigsten. Bei der<br />
häufigsten herzchirurgischen Operation, der isolierten<br />
Bypassoperation, beträgt die Sterblichkeit nur<br />
2,2 Prozent im Vergleich zum Bundesdurchschnitt<br />
von 3,6 Prozent. Bei komplexen Eingriffen, die einen<br />
Schwerpunkt der Tätigkeit der Klinik für Maximalversorgung<br />
in Lübeck darstellen, wie die Kombination<br />
aus Aortenklappenersatz und Bypassoperation,<br />
liegt die Sterblichkeit in Lübeck bei 3,7<br />
Prozent im Vergleich zu 6,4 Prozent bundesweit.<br />
(Dr. Anja Aldenhoff-Zöllner)<br />
Kriegskinder im Alter<br />
nachrichten in kürze<br />
„Es ist an der Zeit, dass auch Ärzte, Psychologen<br />
und Seelsorger sich um ein umfassendes Verständnis<br />
der Traumatisierung von Kriegskindern bemühen“,<br />
sagte Dr. Anita Stork (Jg. 1940) zu ihrem Seminarprojekt<br />
„Kriegskinder im Alter“ in der Akademie<br />
Sandkrughof (bei Lauenburg). Die Chefärztin für<br />
geriatrische Rehabilitation (a. D.) in Bad Bevensen<br />
initiierte und begleitet das Projekt gemeinsam mit<br />
der Autorin, Biografin und Dozentin Kathleen<br />
Battke M. A.<br />
In der Öffentlichkeit noch wenig bemerkt, ist das<br />
„Tabuthema“ am ehesten bei Heilberuflern wie<br />
Hausärzten, Psychotherapeuten, Psychiatern bekannt<br />
(das Deutsche Ärzteblatt hatte vor etwa zwei<br />
Jahren berichtet). Sonst, so sagen die Seminarleiterinnen,<br />
habe sich die Gesellschaft bis vor wenigen<br />
Jahren stillschweigend darauf geeinigt, dass die<br />
Kinder des 2. Weltkriegs - anders als die Kinder der<br />
Nazi-Opfer und der Täter - gut davongekommen<br />
seien. „Kriegskinder sind überwiegend fleißige und<br />
sozial engagierte Erwachsene geworden; ihre Lebensstrategie<br />
hieß Schweigen, Durchhalten, Vergessen,<br />
Verdrängen, Bagatellisieren und Funktionieren.“<br />
Doch 60 Jahre später beim Eintritt in den Ruhestand<br />
brächen bei vielen die alten Wunden wieder<br />
auf. Die verdrängten Erlebnisse führten zu seelischen<br />
und körperlichen Beschwerden. Aber wer<br />
wolle zuhören, glauben, die Trauer und Ängste verstehen?<br />
Die Gesellschaft biete ihnen keinen Ort des<br />
Gedenkens, keinen Volkstrauertag, keine Erinnerungsstätten.<br />
Zu wünschen sei Hilfe bei der Annahme der eigenen<br />
Vergangenheit. „Trauern heißt, mit unserem<br />
Schicksal Frieden zu schließen“. Viele Kriegskinder<br />
wollten sich austauschen und ihre Erinnerungen<br />
aufschreiben. Dabei sollten die Seminare helfen.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 15
nachrichten in kürze<br />
16<br />
Diese Idee brachte schon am ersten Seminarwochenende<br />
im März große Resonanz, etwa derart:<br />
„Wir möchten uns nicht nur selbst von der Lähmung<br />
des Nichtverstandenwerdens befreien, wir<br />
wollen auch ein Beispiel geben, wie man sinnvoll alt<br />
werden kann.“<br />
Der Sandkrughof, ein schöner ehemaliger Landsitz<br />
am hohen Elbufer, eigne sich auch als damaliger Ort<br />
der Heilung für viele Verletzte nach den Bombenangriffen<br />
auf Hamburg besonders gut für das Projekt.<br />
Der nächste Termin ist 31.08.-02.09.2007 sowie<br />
eine Schreibwerkstatt im November<br />
(www.sandkrughof.de). (hk)<br />
Neuer Vorstand im Landespflegeausschuss<br />
Dietmar Katzer<br />
Andreas Fleck<br />
(Fotos: rat)<br />
Der Landespflegeausschuss <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> hat<br />
in seiner Sitzung am 12. Juni einen neuen Vorstand<br />
gewählt: Vorsitzender des Landespflegeausschusses<br />
bleibt weiterhin Andreas Fleck, Abteilungsleiter im<br />
Sozialministerium. In ihrem Amt als Stellvertreter<br />
bestätigt wurden ebenfalls Dietmar Katzer (VdAK/<br />
AEV Landesvertretung) und Reinhard Rehm<br />
(AOK) als Vertreter der Pflegekassenverbände sowie<br />
Anke Schimmer (Diakonisches Werk <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>)<br />
und Kurt Rohde (Städteverband<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>). Neu in den Vorstand gewählt<br />
wurde Adolf Popall (bpa), nachdem der bisherige<br />
Amtsinhaber, Dr. Reinhard Becker (bpa), nicht<br />
mehr für das Amt kandidiert hat.<br />
Der Landespflegeausschuss ist das zentrale Gremium<br />
im Land, in dem alle Verbände und Aufgabenträger<br />
zu Fragen der Finanzierung und des Betriebs von<br />
Pflegeeinrichtungen eng zusammenarbeiten. Er<br />
kann hierzu Empfehlungen abgeben. Das Gremium<br />
setzt sich zusammen aus Vertreter(innen) der<br />
Pflegeeinrichtungen (Wohlfahrtsverbände und private<br />
Einrichtungen) und Pflegekassen, des Medizinischen<br />
Dienstes der Krankenversicherung (MDK),<br />
des Verbandes der privaten Krankenversicherung,<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
der kommunalen Landesverbände und des Sozialministeriums.<br />
Der Landesseniorenrat gehört dem Ausschuss<br />
als beratendes Mitglied an. (Oliver Breuer)<br />
Sinkende Durchschnittswerte pro Verordnung<br />
Erstmals seien 2006 bei Verordnungen rezeptpflichtiger<br />
Arzneimittel nicht mehr steigende Preise<br />
(„Strukturkomponente“), sondern sinkende Durchschnittswerte<br />
zu beobachten, teilte der BAH (Bundesverband<br />
der Arzneimittelhersteller) mit. Neu<br />
implementierte Wettbewerbselemente und die Festbetragsregelungen<br />
hätten gewirkt. Dennoch sei insgesamt<br />
mit 29 Milliarden Euro etwas mehr Umsatzvolumen<br />
zu verzeichnen. Dagegen seien die Verordnungen<br />
rezeptfreier Arzneimittel im dritten Jahr<br />
rückläufig - auch nicht kompensiert durch zunehmende<br />
Selbstkäufe. Der BAH als Interessenverband<br />
kritisierte die „Stigmatisierung“ der Selbstmedikation<br />
durch den grundsätzlichen Erstattungsausschluss<br />
und meinte sogar, von einer Schwächung der gesundheitlichen<br />
Eigenverantwortung sprechen zu<br />
sollen - was sich doch eher auf einen gesunden Lebensstil<br />
bezieht? (hk)<br />
Wegfall Fachkunde Rettungsdienst - Wartezeiten<br />
für Prüfung Zusatzbezeichnung Notfallmedizin<br />
Zum 30.08.2007 wird die Fachkunde Rettungsdienst<br />
nicht mehr von der <strong>Ärztekammer</strong> <strong>Schleswig</strong>-<br />
<strong>Holstein</strong> ausgestellt, sie bleibt aber weiterhin als<br />
Voraussetzung für die Teilnahme am Rettungsdienst<br />
im Landesrettungsdienstgesetz verankert. Es<br />
wird dann nur noch, zwar unter den gleichen Voraussetzungen,<br />
die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin<br />
erteilt. In diesem Zusammenhang machen wir<br />
darauf aufmerksam, dass die Prüfung zur Erlangung<br />
der Zusatzbezeichnung Notfallmedizin mindestens<br />
drei Monate Wartezeit in Anspruch nimmt. Somit<br />
ist die Möglichkeit, kurzfristig eine Qualifikation<br />
für den Rettungsdienst zu erlangen, nicht mehr gegeben.<br />
Wer die Fachkunde Rettungsdienst noch<br />
erlangen möchte, muss den Antrag, auch unvollständig<br />
und mit Nachreichen der restlichen Unterlagen<br />
innerhalb einer kurzen Frist, bis zum<br />
30.08.2007 bei der <strong>Ärztekammer</strong> <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
vorgelegt haben. (I/Ho)<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> auf Platz zehn<br />
Auf Rang zehn unter den Bundesländern liegt die<br />
Landesförderung der Krankenhausinvestitionen im<br />
vergangenen Jahr. 88,6 Millionen Euro bedeuteten<br />
bei 2,83 Millionen Einwohnern gut 31 Euro pro Einwohner.<br />
Pro gefördertem Bett von insgesamt 13 397
Betten waren es 6 612 Euro (Rang acht). An der<br />
Spitze lag Hamburg mit 63 Euro pro Einwohner und<br />
knapp 10 000 Euro pro Bett, am Ende Niedersachsen<br />
mit 15 Euro pro Einwohner. Das Hamburger<br />
Krankenhaus-Investitionsprogramm 2007 ist veröffentlicht<br />
unter www.krankenhaeuser.hamburg.de.<br />
Was bisher - soweit ersichtlich - fehlt, ist eine klare<br />
gesundheitsökonomische und versorgungspolitische<br />
Analyse der Bundesländer über die Zukunft der<br />
Krankenhausfinanzierung (duales System?) und<br />
über die (welche?) Notwendigkeit und Möglichkeit<br />
der Steuerung von Krankenhaus-Kapazitäten und<br />
über die sinnvolle Höhe von Fördermitteln.<br />
Ein Seitenblick auf ein anderes, soeben vom HWWI<br />
(Hamburgisches Weltwirtschafts-Institut) publiziertes<br />
Bundesländer-Ranking zur Zukunftsfähigkeit<br />
(ökonomische Wachstumsfaktoren) legt nahe, nicht<br />
zu sehr in blau-weiß-rote Euphorie auszubrechen:<br />
danach liegt <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> mit 6,8 Punkten<br />
auf dem drittletzten Platz (Bayern vorn 12,5 und am<br />
Ende Sachsen-Anhalt 4,9 Punkte). (hk)<br />
Neuer Mitarbeiter<br />
Die <strong>Ärztekammer</strong><br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
hat neu im Mitarbeiterteam<br />
einen Assistenten<br />
des Vorstandes.<br />
Thomas Neldner, geboren<br />
in Halle/Westfalen,<br />
absolvierte nach<br />
seiner Ausbildung zum<br />
Bankkaufmann ein<br />
Studium in Betriebswissenschaften<br />
mit<br />
Thomas Neldner (Foto: Privat)<br />
Schwerpunkt Gesundheitswissenschaften<br />
in<br />
Augsburg. Er übernimmt neben der neu geschaffenen<br />
Funktion des Vorstandsreferenten einen Teil<br />
der Aufgaben von Ursula Brocks, die Ende Juli ausscheiden<br />
wird. (SH)<br />
Sylvia Hajduk - 10 Jahre Mitarbeit in der<br />
<strong>Ärztekammer</strong><br />
Kaum zu glauben, aber wahr: Sylvia Hajduk hatte<br />
am 1. Juli ihr 10-jähriges Dienstjubiläum in der <strong>Ärztekammer</strong>.<br />
Ihre gestalterischen Fähigkeiten fielen schon während<br />
ihrer Ausbildung auf, schon damals ergänzte<br />
sie das Team des Ärzteblattes. Nach bestander Prüfung<br />
wurde sie nach kurzer Zeit als Nachfolgerin von<br />
Sylvia Hajduk (Foto: wi)<br />
�<br />
�<br />
nachrichten in kürze<br />
Annika Doose und Marion<br />
David technische Leiterin<br />
und trägt zusammen<br />
mit Tina Rohlf und Katja<br />
Willers die Verantwortung<br />
für die Herstellung des<br />
Ärzteblattes. Einfallsreichtum<br />
und Kreativität sind<br />
herausragende Merkmale<br />
ihrer Tätigkeit - dem Ärzteblatt<br />
sieht man es an.<br />
Wir sind gespannt, was ihr<br />
in Zukunft noch einfallen<br />
wird. (K.-W. Ratschko)<br />
Leserbrief<br />
Leserbrief von Dr. Axel Kloetzing zum<br />
Artikel „Diabetes-Zentrum mit angestelltem<br />
Arzt“, SHÄ 4/2007, S. 29 f.<br />
Der Artikel erweckt den Eindruck, die<br />
Versorgung der Diabetiker im Kreis Steinburg<br />
sei unzureichend. Dieses kann mit Sicherheit<br />
ausgeschlossen werden. Es gibt<br />
in unserer Region allein 45 Praxen mit der<br />
Qualifikation zur Durchführung von Schulungen,<br />
das sind ca. 50 Prozent aller<br />
Hausarztpraxen. Eine flächendeckende,<br />
Dr. Kloetzing<br />
qualifizierte Versorgung der immer grö- (Foto: Privat)<br />
ßer werdenden Zahl von Diabetikern kann<br />
nur durch gut ausgebildete Hausärzte, in Zusammenarbeit<br />
mit den Fachärzten der beteiligten Gebiete<br />
gewährleistet werden. Weitere diabetologische<br />
Schwerpunktpraxen sind dabei nicht erforderlich.<br />
In diesem Zusammenhang ist die Abschaffung des<br />
Zertifikats Diabetologie zu bedauern, da es doch für<br />
viele, auch schon länger niedergelassene Kollegen, eine<br />
Motivation war, sich noch mal intensiv mit dem<br />
Gebiet auseinanderzusetzen. Gleiches gilt im Übrigen<br />
auch für die Gebiete Palliativmedizin und Geriatrie.<br />
Auch hier kann die Therapie nur durch Hausärzte gewährleistet<br />
werden, allein durch die anfallenden<br />
Hausbesuche. Leider ist nach Ablauf der Übergangsfristen<br />
die Zusatzausbildung nur noch nach Einsatz<br />
auf entsprechenden Stationen während der stationären<br />
Ausbildung zu erlangen. Die Angebote der Akademie<br />
sind zudem so gelegt, dass sie für niedergelassene<br />
Ärzte kaum zumutbar sind.<br />
Hier hätte ich gern die Stimme des Kammerausschusses<br />
für Allgemeinmedizin vernommen.<br />
Dr. Axel Kloetzing, Bahnhofstr. 8, 25358 Horst/<strong>Holstein</strong><br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 17
fortbildung<br />
18<br />
Bad Bramstedt<br />
24./25.08.2007, 10:00-19:00/8:30-12:15 Uhr<br />
5. Sommer Akademie Klinische Rheumatologie,<br />
Vaskulitis 2007: Rheuma trifft Niere<br />
Veranstalter: Rheumaklinik Bad Bramstedt GmbH<br />
& Poliklinik für Rheumatologie, UK S-H, Campus<br />
Lübeck<br />
Veranstaltungsort und Auskunft: Rheumaklinik<br />
Bad Bramstedt GmbH, Oskar-Alexander-Straße 26,<br />
24576 Bad Bramstedt, Dr. Barbara Glindemann,<br />
Tel. 04192/902582, Fax 04192/902389, E-Mail<br />
glindemann@r-on-klinik.de, Marie Theres Opitz,<br />
Tel. 04192/902191, E-Mail opitz@r-on-klinik.de<br />
Gebühr: 200 Euro (mit Laborkolloquium 225 Euro)<br />
Bad Malente<br />
25.08.2007, 14:45 Uhr 2 Punkte<br />
Körperbilder - Body Image<br />
Veranstaltungsort: Curtius-Klinik, Neue Kampstr. 2,<br />
23714 Bad Malente-Gremsmühlen<br />
Veranstalter, Kontakt: Nordd. Gesellschaft für angewandte<br />
Tiefenpsychologie (NGaT), Tel. 04381/<br />
409796 oder 04381/6533, Fax 04381/6501, E-Mail<br />
wadelssen@t-online.de, Internet www.ngat.de<br />
Berlin<br />
26.-28.10.2007<br />
Berliner Dopplerkurs DEGUM-, DGKN- und<br />
KBV-Richtlinien, interdisziplinärer Grundkurs<br />
Doppler- und Duplexsonographie der Gefäße<br />
(einschl. Farbcodierung)<br />
Veranstalter, Veranstaltungsort, Kontakt: Berliner<br />
Dopplerkurs, <strong>Holstein</strong>ische Str. 26, 10717 Berlin, Dr.<br />
Becker, Tel./Fax 030/86207565, E-Mail info@<br />
dopplerkurs.de, Internet www.dopplerkurs.de<br />
Hamburg<br />
10.09.2007, 17:00-19:00 Uhr 4 Punkte<br />
Arbeitsmedizinische Falldemonstration u. Fallbesprechung<br />
„Synkanzerogenese Asbest-PAH“<br />
(Baur, ZfAM)<br />
Veranstalter, Veranstaltungsort, Kontakt: Zentralinstitut<br />
für Arbeitsmedizin und Maritime Medizin,<br />
Prof. Dr. X. Baur, Seewartenstr. 10, Tel. 040/428894-<br />
501, Fax -514, E-Mail xaver.baur@bsg.hamburg.de,<br />
Internet www.uke.uni-hamburg.de/institute/arbeitsmedizin<br />
14.-17.10.2010<br />
23. Internationaler Kongress der Deutschen Ophtalmochirurgen<br />
Veranstalter: DOC e. V. in Kooperation mit Ressort<br />
Ophtalmochirurgie BVA<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
Veranstaltungsort: Congress Centrum Hamburg<br />
(CCH)<br />
Kontakt, Anmeldung: MCN Medizinische Congressorganisation<br />
Nürnberg AG, Neuwieder Str. 9, 90411<br />
Nürnberg, Tel. 0911/3931617, Fax 0911/3931620,<br />
E-Mail doc@mcnag.info,<br />
Internet www.doc-nuernberg.de<br />
Kiel<br />
17./18.08.2007, 15 Punkte<br />
16:00-20:00/9:00-18:00 Uhr<br />
Trauerarbeit in der Verhaltenstherapie<br />
25.08.2007, 10:00-17:00 Uhr<br />
Gruppentherapie bei psychosomatischen Erkrankungen<br />
Gebühr: 125 Euro<br />
Veranstalter, Veranstaltungsort, Kontakt: IFT-<br />
Nord, Düsternbrooker Weg 2, 24105 Kiel, Dr. M.<br />
Pieper-Räther, Tel. 0431/57029-40,<br />
E-Mail info@ift-nord.de, Internet www.ift-nord.de<br />
21./22.09.2007 (Teil I)<br />
28./29.09.2007 (Teil II)<br />
TEE in der Anästhesiologie und Intensivmedizin<br />
Veranstalter, Veranstaltungsort, Kontakt: Klinik<br />
für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin,<br />
UK S-H, Campus Kiel, Sekretariat Prof. Dr. J. Scholz,<br />
Schwanenweg 21, 24105 Kiel,<br />
Tel. 0431/597-2965, Fax 0431/597-3002,<br />
E-Mail kontakt@anaesthesie.uni-kiel.de,<br />
Internet www.uni-kiel.de/anaesthesie<br />
Lehmrade<br />
29.08.2007, 16:30 Uhr<br />
Parenterale Ernährung<br />
Veranstaltungsort: Reha-Klinik Lehmrade<br />
Veranstalter, Kontakt: Reha-Klinik Lehmrade<br />
GmbH, Gudower Str. 10, 23883 Lehmrade,<br />
Tel. 04542/8060, Fax 04542/806-444,<br />
Internet www.damp.de<br />
Neumünster<br />
12.09.2007, 15:30-17:30 Uhr<br />
Rheumatoide Arthritis-Frühdiagnostik, Standardtherapie<br />
und neue Therapieoptionen<br />
26.09.2007, 15:30-17:30 Uhr<br />
Arthritis - Fallvorstellung<br />
Veranstaltungsort: FEK, Linker Konferenzraum<br />
Veranstalter, Kontakt: Friedrich-Ebert-Krankenhaus<br />
Neumünster GmbH, Medizinische Klinik, Friesenstraße<br />
11, 24534 Neumünster, Gabriela Schneider,<br />
Tel. 04321/405-7001, Fax 04321/405-7009,<br />
E-Mail gabriela.schneider@fek.de
Eckhard Weisner zum Geburtstag<br />
70 Jahre und ein bisschen<br />
weise ...<br />
Ralf Büchner<br />
Dr. Eckhard Weisner<br />
(Foto: rat)<br />
Am 16. Juni ist Eckhard Weisner<br />
70 Jahre alt geworden. Ein bisschen<br />
weise war er schon vorher.<br />
Aber auch noch unruhig und<br />
unzufrieden genug, um sich ein<br />
ums andre Mal zu Wort zu melden<br />
und laut über die Zukunft<br />
unseres Arzt-Seins, unserer ärztlichen<br />
Interessenvertretung und<br />
unserer Freiberuflichkeit nachzudenken.<br />
Die Strategie-Klausur der Abgeordnetenversammlung<br />
der Kas-<br />
senärztlichen Vereinigung <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
im Februar eröffnete Eckhard Weisner mit einigen<br />
Gedanken und Betrachtungen, die von der<br />
Abschaffung der Kassenärztlichen Vereinigung<br />
(KV), da sie der politisch inszenierten Zersplitterung<br />
ohnehin nicht mehr standhalten könne,<br />
bis zur ultimativen Stärkung, Verteidigung und<br />
gewerkschaftlichen Weiterentwicklung der KV<br />
reichten und im kämpferischen Aufruf gipfelten,<br />
die Reihen fest zu schließen, sich einig und vereint<br />
um die KVen zu scharen, weil nur so und<br />
nur da Freiberuflichkeit eine Überlebenschance<br />
und (neue) Heimat mit Zukunftsperspektive habe.<br />
Das ist Eckhard Weisner, wie er leibt und lebt,<br />
wie ich ihn in den letzten 15 Jahren kennengelernt<br />
habe: Immer die Optionen darstellend in<br />
seinen Ja-Aber-Statements, sie wägend, vermittelnd,<br />
fast als wenn er mit sich selbst im Gespräch,<br />
im inneren Dialog wäre, und schließlich<br />
doch zu einer (meistens ziemlich) klaren Aussage<br />
kommend.<br />
„Das ist ja alles schwierig!“ - wie oft habe ich,<br />
haben wir das von Dir, lieber Eckhard, gehört,<br />
nicht nur auf der Klausur im Februar, sondern<br />
in all den Jahren in der KV (1981 bis 1998) im<br />
Vorstand, in den Kreisstellen und auf der Abgeordnetenversammlung.<br />
Noch gut erinnere ich mich an mein Debüt in<br />
der Abgeordnetenversammlung. Es muss ir-<br />
personalia<br />
gendwann Anfang der 90er Jahre gewesen sein,<br />
als ich unseren damaligen Kreisstellenvorsitzenden<br />
Martin Böhm aus Husum als „geladener<br />
Gast mit Rederecht“ vertreten sollte.<br />
Du warst damals nicht nur Vorsitzender der<br />
KVSH, sondern auch im Vorstand der Kassenärztlichen<br />
Bundesvereinigung. Folglich fragte<br />
ich Dich, wie es denn sein könnte, dass jetzt die<br />
Langzeit-Blutdruck-Messung als neue Leistung -<br />
ohne neues Geld! - in den EBM gekommen sei?<br />
Du hattest im Bericht zur Lage von dem Geld<br />
gesprochen, das der Leistung folgt. Denn sonst<br />
wäre es zwar nett für mich gewesen, auch einmal<br />
nach Segeberg zu fahren und Kaffee und<br />
Kekse zu genießen, aber ohne Antwort auf diese<br />
Frage letztlich doch frustran ...<br />
Deine Antwort war - und wie könnte es anders<br />
gewesen sein -, dass das alles ja doch sehr<br />
schwierig sei und so weiter und so fort. Und -<br />
ehrlich gesagt - habe ich es bis heute nicht begriffen,<br />
und ich bin mir ziemlich sicher, Du auch<br />
nicht, so viel und was man auch sonst noch alles<br />
dazu sagen kann.<br />
Das ist wohl einerseits die Sache mit dem hypertrophen<br />
Demuts-Gen bei uns Ärzten(innen),<br />
andererseits aber auch die Sache mit dem hypertrophen<br />
Macht-Gen bei den Politikern.<br />
Schwierig. Alles wirklich schwierig.<br />
Inzwischen ertappe ich mich - und ich fürchte<br />
andere ertappen mich auch - dabei, dass ich diesen<br />
Satz sage.<br />
Aber nicht nur das habe ich von Dir gelernt.<br />
Im Vorstand gab es eine klare Sitzordnung (Reihenfolge<br />
der Stimmenzahl, mit der man gewählt<br />
worden war, d. h., ich saß nach bzw. links neben<br />
Hans Köhler) und recht unverrückliche Rituale.<br />
Dazu gehörten Deine Berichte aus Köln, die -<br />
um es sachte zu sagen - überaus umfassend waren.<br />
Zumindest kam uns das so vor. Für Dich<br />
waren sie wahrscheinlich nur der High-Density-<br />
Extrakt aus 14 Tagen KBV und unzähligen Sitzungen.<br />
Und den „advocatus diaboli“ spielte regelmäßig<br />
und mit Inbrunst Bodo Kosanke.<br />
Leider habe ich ihn nicht immer auf Anhieb<br />
verstanden und deshalb nachgefragt, selbst auf<br />
die Gefahr hin, dass er mich für das allerdümmste<br />
und vorwitzigste Greenhorn im Vorstand halten<br />
würde, was ich sicherlich war.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 19
personalia<br />
20<br />
Dennoch in diesen KV-Vorstandssitzungen, die<br />
alle zwei Wochen am Dienstagabend (ab 19:30<br />
Uhr) stattfanden und oftmals bis lang in den<br />
nächsten Morgen dauerten, wurde heftig, engagiert<br />
und manchmal auch wütend diskutiert.<br />
Aber immer sportlich. Also fair und mit Respekt<br />
und Achtung vor dem anderen bzw. der Meinung<br />
des anderen. Doch keineswegs mit Glacé-<br />
Handschuhen. Da habe ich - anfänglich doch<br />
recht mimosig (weniger beim Austeilen, aber<br />
beim Einstecken wohl schon) - viel von Dir und<br />
den anderen Vorstandskollegen gelernt. Dafür<br />
bin ich dankbar.<br />
Geblieben ist mir auch die Überzeugung, dass es<br />
bei ausreichender Diskussion (fast) immer möglich<br />
ist, eine vernünftige Lösung zu finden. Diese<br />
Überzeugung wird durch die gesundheitspolitischen<br />
Entwicklungen und die Vielzahl unserer<br />
<strong>aktuell</strong>en Baustellen und Probleme oftmals auf<br />
eine harte Probe gestellt - es ist eben alles noch<br />
schwieriger geworden, jedenfalls nicht leichter -,<br />
aber aufgegeben will und habe ich sie nicht.<br />
Denn anders kann ich mir eine konstruktive<br />
Arbeit nicht vorstellen.<br />
Baruch Spinoza hat gesagt: „Nicht verlachen,<br />
nicht jammern, nicht verachten, sondern verstehen.“<br />
Zu verstehen, was vor sich geht, ist die Voraussetzung<br />
für Gestaltung. Und - Du erinnerst Dich<br />
vielleicht noch daran - das war auch damals<br />
mein erstes Thesen-Papier - heute würde man<br />
„Paper“ sagen - für den KV-Vorstand:<br />
Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus<br />
Chefarzt Dr. Gerd Gritzke im<br />
Ruhestand<br />
Tibor Simonsen, Ilse Friedrich<br />
Geboren ist Dr. Gerd Gritzke am 6. Mai 1942 in<br />
Hamburg. Nach einer humanistisch-gymnasialen<br />
Schulausbildung studierte er von 1962 bis<br />
1967 an den Universitäten Tübingen und Hamburg.<br />
Der Bundeswehr folgten ab 1971 Tätigkeiten<br />
am Institut für Pharmakologie der Universität<br />
Hamburg, in den Psychiatrischen Abteilungen<br />
des Ev. Krankenhauses Alsterdorf. 1977<br />
wurde er Facharzt für<br />
Nervenheilkunde und<br />
übernahm 1978 zunächst<br />
oberärztliche, ab<br />
1980 dann chefärztliche<br />
Aufgaben in der Heilerziehungs-,<br />
Heil- und<br />
Pflegeanstalt der damals<br />
so bezeichneten Alsterdorfer<br />
Anstalten. Später<br />
weitete sich seine<br />
Chefarzt-Tätigkeit auch<br />
auf die Abteilung für<br />
Psychiatrie und Neurologie<br />
in Alsterdorf aus.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
„Gestalten statt Verwalten“.<br />
Verstehen, und dann auch zu handeln für eine<br />
einige, freie und freiberufliche Ärzteschaft, die<br />
sich innovativ, unternehmend und unternehmerisch,<br />
selbstbewusst und kämperisch den Herausforderungen<br />
der Zeit stellt, statt sich jammernd<br />
zurückzuziehen in eine gesellschaftliche<br />
Nische, die es schon lange nicht mehr gibt, das<br />
habe ich - wie viele andere auch - von und mit<br />
Dir gelernt.<br />
Du hast Dich um die Ärzteschaft in <strong>Schleswig</strong>-<br />
<strong>Holstein</strong> und in der Republik - auch in Europa<br />
und in der Welt, wenn ich an die UEMA-Reisen<br />
denke - sowie um die Versorgung der kranken<br />
Menschen verdient gemacht. Und dafür<br />
sind wir Dir dankbar.<br />
(Die Paracelsus-Medaille müsste eigentlich von<br />
der Bundesärztekammer folgen, denn wir können<br />
sie Dir nicht verleihen.)<br />
Noch ein Letztes: Was ich leider bis jetzt noch<br />
nicht von Dir gelernt habe, das hat Klaus Bittmann<br />
vor zehn Jahren in einem Gedicht zu Deinem<br />
60. Geburtstag im Landhaus Hahn in<br />
Schellhorn im Refrain so zusammengefasst:<br />
„Leer sei der Schreibtisch des Vorsitzenden am<br />
Abend!“<br />
Aber - so Gott will - habe ich ja noch ein bisschen<br />
Zeit, auch das zu lernen, - wobei - Du weißt schon,<br />
Eckhard - das ist ja alles schwierig ...<br />
Ralf W. Büchner, Kassenärztliche Vereinigung, Bismarckallee<br />
1-6, 23795 Bad Segeberg<br />
Dr. Gerd Gritzke<br />
(Foto: Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus)
Daneben war er konsiliarisch am Krankenhaus<br />
Elim und Israelitischen Krankenhaus tätig. Im<br />
Jahre 2001 erwarb er die Weiterbildungsbezeichnung<br />
Geriatrie.<br />
Seit dem Jahre 2000 war Dr. Gritzke als Chefarzt<br />
der Abteilung für Gerontopsychiatrie tätig,<br />
nachdem er 1988 chefärztlich die damals II Abteilung<br />
für Allgemein-Psychiatrie des Heinrich-<br />
Sengelmann-Krankenhauses übernommen hatte.<br />
Als Lehrbeauftragter der Universität Hamburg<br />
lehrte er im Fach Psychiatrie von 1992 bis 1994.<br />
Geburtstage<br />
Veröffentlicht sind nur die Namen der Jubilare,<br />
die mit der Publikation einverstanden sind.<br />
Dr. Ingund Krohn, geb. Marx, Neumünster,<br />
feiert am 02.08. ihren 70. Geburtstag.<br />
Dr. Gerhard Thoben, <strong>Schleswig</strong>,<br />
feiert am 03.08. seinen 75. Geburtstag.<br />
Prof. Dr. Wolfdietrich Husstedt, Groß Grönau,<br />
feiert am 04.08. seinen 70. Geburtstag.<br />
Dr. Marianne Adolf-Gödecke, Pinneberg,<br />
feiert am 08.08. ihren 70. Geburtstag.<br />
Dr. Rudolf Schneider, Lübeck,<br />
feiert am 08.08. seinen 70. Geburtstag.<br />
Dr. Christa Eckert, Bad Oldesloe,<br />
geboren am 13.12.1928,<br />
verstarb am 07.03.2007.<br />
Dr. Gerhard Sobotta, Glinde,<br />
geboren am 16.12.1924,<br />
verstarb am 17.04.2007.<br />
Dr. Hermann Bosch, Wedel,<br />
geboren am 09.12.1915,<br />
verstarb am 29.04.2007.<br />
Dr. Erich Blackstein, Scharbeutz,<br />
geboren am 07.01.1914,<br />
verstarb am 25.05.2007.<br />
Dr. Ingeborg Daub, Mölln,<br />
feiert am 10.08. ihren 80. Geburtstag.<br />
Dr. Eberhard Blömer, Kiel,<br />
feiert am 18.08. seinen 80. Geburtstag.<br />
Dr. Behcet Simsek, Ascheberg,<br />
feiert am 23.08. seinen 80. Geburtstag.<br />
Dr. Hans-Jürgen Strache, Schellhorn,<br />
feiert am 27.08. seinen 80. Geburtstag.<br />
Dr. Wolfgang Caliebe, Altenholz,<br />
feiert am 28.08. seinen 75. Geburtstag.<br />
Prof. Dr. Giselher Walpurger, Lübeck,<br />
feiert am 28.08. seinen 75. Geburtstag.<br />
Dr. Hans-Dieter Schmidt, Rendsburg,<br />
feiert am 29.08. seinen 80. Geburtstag.<br />
Wir gedenken der Verstorbenen<br />
personalia<br />
Die Mitarbeiter der Gerontopsychiatrie haben<br />
Dr. Gritzke als kompetent, fürsorglich, stringent<br />
und problemzentriert erlebt. Er erfasste das Erkrankungsbild<br />
der meist auch immer somatisch<br />
erkrankten psychiatrischen Patienten durch seinen<br />
umfangreichen Erfahrungsschatz und eine<br />
heute zunehmend moderner werdende biologisch-psychiatrisch<br />
fokussierte Betrachtungsund<br />
Behandlungsweise.<br />
Dr. Tibor Simonsen, Ilse Friedrich, Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus,<br />
Kayhuder Str. 65, 23863 Bargfeld-Stegen<br />
Dr. Lydia Weiß, Kronshagen,<br />
geboren am 11.06.1911,<br />
verstarb am 26.05.2007.<br />
Ursula Langhagel, Kiel,<br />
geboren am 05.10.1915,<br />
verstarb am 05.06.2007.<br />
Prof. Dr. Wilhelm Föllmer, Timmendorfer Strand,<br />
geboren am 21.10.1908,<br />
verstarb am 07.06.2007.<br />
Dr. Herbert Reid, Lübeck,<br />
geboren am 02.03.1920,<br />
verstarb am 08.06.2007.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 21
ad segeberg<br />
22<br />
Kassenärztliche Vereinigung<br />
Situation im Notdienst<br />
erfreulich<br />
Dirk Schnack<br />
Für niedergelassene Ärzte steht schon lange<br />
fest, dass die Gesamtvergütung nicht ausreicht,<br />
um ihre Leistungen angemessen zu vergüten. Eine<br />
Anpassung wird seit Jahren mit der Bindung<br />
an die Grundlohnsummensteigerungverweigert.<br />
Nun gibt es<br />
erstmals seit Jahren<br />
Hoffnung,<br />
dass der finanzielle<br />
Spielraum<br />
dennoch erweitert<br />
werden kann -<br />
Dr. Ralph Ennenbach<br />
aus<br />
dem Vorstand<br />
der Kassenärzt-<br />
lichenVereinigung <strong>Schleswig</strong>-<br />
<strong>Holstein</strong> (KV<br />
SH) stellte das<br />
Konzept für eine<br />
mögliche Anpassung während der Abgeordnetenversammlung<br />
am 13. Juni in Bad Segeberg<br />
vor.<br />
Ennenbachs Argument für Gespräche mit den<br />
Krankenkassen und im Schiedsamt über eine<br />
Erhöhung der Gesamtvergütung ist eine Gefährdung<br />
der Versorgung, die er mit neuen Daten<br />
aus schleswig-holsteinischen Praxen belegen<br />
will. Die von ihm präsentierten Zahlen zeigen,<br />
dass ganze Arztgruppen in unterdurchschnittliche<br />
Honorargruppen abrutschen, weil die derzeitige<br />
Gesamtvergütung nicht mehr ausreicht.<br />
„Wir verlieren die umsatzstärksten Praxen, damit<br />
wird die Versorgung gefährdet“, sagte Ennenbach.<br />
Als unterdurchschnittlich wird eine Arztpraxis<br />
eingestuft, wenn sie weniger als 80 Prozent des<br />
Fachgruppendurchschnitts an Honorar erzielt.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
Diese Gruppe wird stärker, während zugleich<br />
die Gruppe mit einem Honorar von über 120<br />
Prozent des jeweiligen Fachgruppendurchschnitts<br />
ausdünnt. Diese von Ennenbach als<br />
„Versorgerpraxen“ bezeichneten Praxen sind für<br />
die medizinische Versorgung wichtig, da sie<br />
überdurchschnittlich viele Leistungen erbringen.<br />
Deutlich wird dies etwa bei den Hausärzten:<br />
Nur noch 173 Hausarztpraxen im Land erzielten<br />
im vergangenen Jahr ein Honorar, das 120<br />
Prozent über<br />
dem Fachgruppendurchschnitt<br />
lag. Vier Jahre<br />
zuvor schafften<br />
dies noch 239<br />
Praxen. Mit weniger<br />
als 80 Prozent<br />
des Fachgruppendurchschnitts<br />
mussten<br />
sich in 2006<br />
schon 357 Praxen<br />
begnügen,<br />
2002 waren dies<br />
noch 296. Relativ<br />
konstant blieb<br />
nur die Gruppe<br />
der Praxen mit<br />
einem Honorar zwischen 80 und 120 Prozent<br />
der Fachgruppe (383 in 2006, 378 in 2002). In<br />
anderen Fachgruppen ist nach Angaben Ennenbachs<br />
eine vergleichbare Entwicklung zu beobachten.<br />
Nach ersten Zahlen haben sich die Hoffnungen der KVSH bestätigt:<br />
Strahlende Gesichter von Thomas Miklik aus Kiel, KV-Chef Ralf Büchner<br />
und Dr. Hans-Joachim Commentz (von links), hier bei der Vorstellung des<br />
neuen Notdienstkonzeptes zur Jahreswende in Kiel. (Foto: di)<br />
Den Grund für diese Entwicklung sieht Ennenbach<br />
im Regelleistungsvolumen. Die arztgruppenspezifischen<br />
Obergrenzen mit festen Punktwerten<br />
darunter und Abstaffelungen oberhalb<br />
bringen großen Praxen Verluste und schaffen<br />
Freiräume für kleine Praxen. Eine Änderung<br />
des Honorarverteilungsmaßstabes schafft nach<br />
seiner Darstellung keine Abhilfe, könnte das<br />
Problem sogar noch verschärfen. Deshalb sieht<br />
Ennenbach einen Ausweg nur durch neue Honorargespräche<br />
mit den Krankenkassen. Die<br />
Zahlen der KV weisen einen Mehrbedarf von<br />
mindestens sechs Millionen Euro im Quartal
aus. Zugleich erinnerte Ennenbach an die Folgen<br />
für niederlassungswillige Ärzte: Praxen in<br />
unterdurchschnittlichen Honorargruppen finden<br />
schwerer einen Nachfolger, womit sich die<br />
Versorgungssituation weiter zuspitzen könnte.<br />
Erfreulicher dagegen die Situation im Notdienst.<br />
Dr. Hans-Joachim Commentz berichtete<br />
von positiven finanziellen Auswirkungen der ab<br />
ersten Januar umgesetzten Neuregelungen. Diese<br />
waren wegen ausufernder Kosten notwendig<br />
geworden - von 2004 bis 2006 waren die Notdienstkosten<br />
durch falsche Anreize im EBM von<br />
rund 13 auf 19,5 Millionen Euro gestiegen, was<br />
im Gegenzug die verbleibende Gesamtvergütung<br />
verringerte. Ohne „Notbremse“ in Form<br />
der Neuregelung hätte es nach KV-Berechnungen<br />
in diesem Jahr Notdienstkosten von 24 Millionen<br />
Euro gegeben. Diese Summe wird nun<br />
voraussichtlich unterschritten. Die Bevölkerung<br />
nimmt nach Darstellung Commentz die neue<br />
Struktur mit Anlaufpraxen an den Kliniken gut<br />
an. Die Zahl der Patientenkontakte steigt an.<br />
Zugleich ist der Informationsbedarf hoch - die<br />
Leitstellen bewältigen rund 600 000 Anrufe im<br />
Jahr. Um die Leitstellen besser zu nutzen, kann<br />
sich Commentz hier weitere Änderungen vorstellen.<br />
Als Beispiele nannte der KV-Kreisstellenleiter<br />
aus <strong>Schleswig</strong>-Flensburg eine Anpassung<br />
der Technik und eine bessere Kooperation<br />
der Leitstellen untereinander. Auch weitere<br />
Aufgabengebiete könnten nach seiner Ansicht<br />
auf die Leitstellen verlagert werden, etwa die<br />
Vermittlung von Notdienstapotheken und -zahnärzten,<br />
von Pflegeheimplätzen und von Termi-<br />
Edmund-Christiani-Seminar<br />
Edmund-Christiani-Seminar<br />
Ärztek <strong>Ärztekammer</strong><br />
ammer <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
www.aeksh<br />
www.aeksh.de<br />
.de<br />
Akademie Akademie für für medizinische medizinische Fort- Fort- und und Weiterbildung<br />
Weiterbildung<br />
bad segeberg<br />
nen im Rahmen der zentralen Mammografiestelle.<br />
Klar ist für Commentz, dass die Bevölkerung<br />
mit der Arbeit der Leitstellen zufrieden<br />
sein muss, da diese eine Art „Aushängeschild“<br />
für die Ärzte darstellen.<br />
Mit der überregionalen Gesundheitspolitik beschäftigte<br />
sich KV-Chef Ralf Büchner in seinem<br />
Bericht zur Lage. Erneut gab das Wettbewerbsstärkungsgesetz<br />
Anlass zur Kritik. Grund: Es hat<br />
nach Ansicht Büchners die Intransparenz im<br />
deutschen Gesundheitswesen noch verstärkt.<br />
Als Beispiele nannte er die zahlreichen Rabattverträge<br />
zwischen Krankenkassen und Pharmafirmen,<br />
von denen nach seiner Einschätzung die<br />
große Mehrheit nicht funktioniert. „Oft werden<br />
dem Patienten dadurch gewohnte Medikamente<br />
vorenthalten und durch andere ersetzt. Offenbar<br />
bleibt es Wille und Ziel der Politik, dass<br />
Ärzte und Apotheker ihren Patienten politisch<br />
unpopuläre Maßnahmen erklären sollen.“ Diesen<br />
Wunsch, stellte Büchner klar, werden die<br />
Ärzte der Politik nicht erfüllen: „Für die Rolle<br />
als Erfüllungsgehilfen einer verfehlten Politik<br />
stehen wir nicht mehr zur Verfügung.“ Als weiteres<br />
Beispiel für Intransparenz nannte Büchner<br />
die Selektivverträge zwischen Kassen und verschiedenen<br />
ärztlichen Organisationen - für den<br />
KV-Chef nichts anderes als ein trojanisches<br />
Pferd der Politik mit dem Ziel, die gemeinsame<br />
ärztliche Interessenvertretung zu zerschlagen.<br />
Büchner forderte die ärztlichen Organisationen<br />
auf, sich nicht gegeneinander ausspielen zu lassen.<br />
Dirk Schnack, Postfach 12 04, 24589 Nortorf<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt Ärzteblatt<br />
ArztF ArztFindex<br />
index<br />
Vertrauensstelle ertrauensstelle des des Krebsregisters Krebsregisters <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
23
schleswig-holstein<br />
24<br />
Nonverbale Kommunikation<br />
Ausstellung Schattensprache<br />
Schattensprache heißt eine Ausstellung zur nonverbalen<br />
Kommunikation, die seit Jahresbeginn<br />
in Rendsburg läuft. Besucher lernen hier, mit<br />
den Händen zu sprechen und mit den Augen zu<br />
hören.<br />
Auf einmal ist alles still. In schallisolierten Räumen<br />
haben die Besucher Kopfhörer auf. Kein<br />
Ton dringt mehr an ihr Ohr. Letzte Versuche,<br />
mit den Nachbarn zu sprechen, scheitern. Die<br />
Augen irren durch den Raum, bleiben an einem<br />
Mann hängen, der mit seinen Händen signalisiert,<br />
dass die anderen ihm folgen sollen.<br />
Besucher lernen, sich ohne Worte auszudrücken: Der gehörlose<br />
Guide Gerald Brunk vor einer Wand mit Handzeichen.<br />
Der Mann heißt Gerald, ist gehörlos und<br />
kann sich nur über seine Hände verständlich<br />
machen. Hier im Rendsburger Provianthaus<br />
lotst er Besucher durch eine Ausstellung, in<br />
der die Sprache sichtbar sein muss, um sie<br />
verstehen zu können. Mit diesem Konzept<br />
wollen die Initiatoren über 50 000 Besucher<br />
im Jahr ansprechen. Die Leiterinnen Maike<br />
Baumgärtel und Susanne Dürkop setzen vor<br />
allem auf die positiven Eindrücke, die die ersten<br />
Besucher mitnehmen. „Die meisten sind am<br />
Anfang reserviert, hinterher aber begeistert“,<br />
sagt die diplomierte Gebärdensprachdolmetscherin<br />
Dürkop.<br />
Um die Reserviertheit zu lockern, absolvieren<br />
die Besuchergruppen zunächst die Station Tanz<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
der Hände, die zugleich Lockerungsübungen für<br />
die Finger beinhaltet. Die Besucher lernen<br />
schnell: Für Applaus wird mit den ausgestreckten<br />
Händen gewunken. Es folgt die Galerie der<br />
Gesichter: Besucher sollen Wut, Überraschung,<br />
Ekel oder Erstaunen ausdrücken. Auf Bilder<br />
reagieren sie mit Mimik. An anderen Stationen<br />
wie etwa Forum der Figuren oder Spiel der Zeichen<br />
lernen sie Gebärden und Zeichen kennen,<br />
geben sich am Schluss sogar Namen: Eine Hand<br />
mit ausgestreckten Fingern am Ohr für das<br />
Mädchen mit den Ohrringen, die Hand in Wellenbewegungen<br />
am Kopf entlang für die Frau<br />
mit den langen Locken. Am Schluss geht es in<br />
die Spürbar. Hier muss in Gebärdensprache bestellt<br />
werden und viele Besucher schaffen es ohne<br />
Worte, ihr Getränk zu ordern. Sie haben<br />
es geschafft, die Hemmnisse, sich ohne Worte<br />
auszudrücken, abzubauen. Das muss auch<br />
eine ältere Dame lernen, die vor kurzem in<br />
der Ausstellung war. Sie hat von ihren Ärzten<br />
erfahren, dass ihr Gehör schon bald ertauben<br />
wird. Die Verzweiflung darüber<br />
kommt vor der Führung durch, sichtlich angespannt<br />
und unter Tränen schafft es die<br />
„Besucher sind erst reserviert, dann begeistert“, haben die Leiterinnen<br />
Susanne Dürkop (links) und Maike Baumgärtel beobachtet.<br />
(Fotos: di)<br />
Frau, dennoch hineinzugehen. Nach 60 Minuten<br />
in der Ausstellung ist sie deutlich entspannter.<br />
„Sie hat gemerkt, dass sie auch ohne zu hören<br />
kommunizieren kann“, sagt Baumgärtel.<br />
Hinter der Ausstellung stecken der Journalist<br />
und Dokumentar Andreas Heinecke und die
Kuratorin Orna Cohen, unterstützt werden sie<br />
vom Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen,<br />
Ulrich Hase. Bis Ende 2008 soll<br />
das einzige Projekt dieser Art in Rendsburg zu<br />
erfahren sein. Die Initiatoren setzen außerdem<br />
vergleichbare Ausstellungen in diesem Jahr in<br />
Israel, Finnland und in der Schweiz um. Heinecke<br />
hat schon die Hamburger Ausstellung<br />
„Dialog im Dunkeln“ realisiert, in der Sehende<br />
in die Welt der Blinden eintauchen. Ihr Ziel ist<br />
das Auflösen von Vorurteilen: Hörende erfahren<br />
die Welt der Gehörlosen. Die zahlreichen<br />
Kindermedikamente<br />
Kinderarznei im Test<br />
Werner Loosen<br />
Seit Januar dieses Jahres gibt es eine EU-Verordnung,<br />
mit der erreicht werden soll, dass<br />
künftig in allen EU-Ländern neu zugelassene<br />
Arzneimittel auch an Kindern und Jugendlichen<br />
getestet sein müssen. Hintergrund: Zwischen<br />
50 und 90 Prozent aller Medikamente,<br />
die Minderjährigen in Krankenhäusern verabreicht<br />
werden, seien für diese Altersgruppe<br />
nicht zugelassen. Das sagt in einem Beitrag in<br />
der Süddeutschen Zeitung (SZ) Prof. Dr.<br />
Hannsjörg Seyberth, ehemaliger Direktor der<br />
Universitätskinderklinik in Marburg. Er hat seit<br />
Jahren für eine verbesserte Versorgung gestritten.<br />
Auch in den 6 500 Kinderarztpraxen, so heißt<br />
es weiter in dem erwähnten Bericht, kenne man<br />
das Problem: Zehn bis zwanzig Prozent aller verschriebenen<br />
Mittel gegen alltägliche Krankheiten<br />
seien nur für Erwachsene zugelassen. Niemand<br />
habe an kranken Kindern erforscht, wie<br />
die Präparate wirken und welche Nebenwirkungen<br />
auftreten: „Mit der Dosierung wird der Arzt<br />
oft alleingelassen. Wenn er Kindern Mittel für<br />
Erwachsene verordnet und diese geringer oder<br />
höher dosiert, bewegt er sich mit diesem ‚off label<br />
use’ in der rechtlichen Grauzone.“ Dem Arzt<br />
bleibe oft keine andere Wahl, denn die Arzneimittelhersteller<br />
führen insbesondere für schwere<br />
Krankheiten kaum Kindertests durch. Nach<br />
schleswig-holstein<br />
Info www.schattensprache.de<br />
E-Mail Info@schattensprache.de<br />
Bookingline Tel. 0700/20302003<br />
Fax 04331/7700566<br />
Einträge im Gästebuch der Schattensprache geben<br />
Anlass zur Hoffnung, dass auch die Welt<br />
der Gehörlosen zum Publikumsmagneten wird.<br />
Ein Besucher schrieb: „Stille kann sehr geräuschvoll,<br />
kommunikativ und beredt sein. Eine<br />
sehr spannende Erfahrung.“ (di)<br />
Angaben von Cornelia Yzer vom Verband Forschender<br />
Arzneimittelhersteller (VZA) hat die<br />
Kinderapotheke erhebliche Lücken, etwa bei<br />
Rheuma, Krebs, verschiedenen Herzkreislaufund<br />
Stoffwechselerkrankungen. Mit der neuen<br />
Verordnung könnten viele dieser Lücken in den<br />
nächsten Jahren geschlossen werden.<br />
Fragt sich nur - und das tut auch die SZ - warum<br />
die Pharmahersteller es überhaupt zu diesen<br />
Lücken haben kommen lassen. Die Zeitung<br />
zitiert Prof. Dr. Dietrich Reinhardt, Direktor<br />
des Haunerschen Kinderspitals an der Universität<br />
München: „Studien mit Kindern sind aufwändig.“<br />
Für viele Unternehmen rentierten sich<br />
die Studien nicht. Das lasse sich auch volkswirtschaftlich<br />
ausdrücken: Der pädiatrische Markt<br />
sei zu klein und die Zielgruppe Kind finanziell<br />
unattraktiv. Weiter heißt es in der SZ: „Das<br />
Problem bei der Behandlung liegt nicht darin,<br />
dass sich Mittel für Erwachsene grundsätzlich<br />
nicht für Kinder eigneten. Meist fehlt aber das<br />
Wissen um die optimale Dosierung, weil sich<br />
der Stoffwechsel von Kindern verschiedenen<br />
Alters von dem der Erwachsenen unterscheidet.<br />
Neugeborene und Säuglinge nehmen Arzneien<br />
langsamer durch den Darm auf, da dieser noch<br />
nicht voll ausgebildet ist. Bis die Kinder zwei<br />
Jahre alt sind, bleiben viele Wirkstoffe länger im<br />
Körper, auch Niere und Leber arbeiten langsamer.<br />
Später ändert sich das: Kinder zwischen<br />
zwei und fünf Jahren verstoffwechseln Wirkstoffe<br />
schneller als Erwachsene. Die richtige Menge<br />
einer Arznei hängt vom Lebensalter ab - und für<br />
die Allerkleinsten fehlen die meisten Pillen.“<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 25
schleswig-holstein<br />
26<br />
Jetzt also die neue Verordnung. Die Pharmabranche<br />
erhält als Gegenleistung für den höheren<br />
Aufwand einen verlängerten Patentschutz<br />
für kindertauglich getestete Medikamente; billigere<br />
Nachahmerpräparate dürfen erst später auf<br />
den Markt kommen. Doch die neue Verordnung<br />
hat auch Grenzen. So müssen patentgeschützte<br />
Arzneimittel, die bereits auf dem Markt<br />
sind, nicht nachgetestet werden. Fachleute wie<br />
Dietrich Reinhardt sind ganz zufrieden und meinen,<br />
in zehn bis 15 Jahren werde es für Kleinund<br />
Schulkinder ausreichend aussagekräftige<br />
Arzneimittelstudien geben.<br />
Es gibt aber auch Einwände. Das <strong>Schleswig</strong>-<br />
<strong>Holstein</strong>ische Ärzteblatt hat darüber mit Dehtleff<br />
Banthien, Jahrgang 1957, gesprochen. Er ist<br />
seit 1992 niedergelassener Kinderarzt in Bad Oldesloe<br />
und Vorsitzender im Berufsverband der<br />
Kinder- und Jugendärzte <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>.<br />
SHÄ:<br />
Wie stehen Sie zu der genannten EU-Verordnung,<br />
Herr Banthien?<br />
DEHTLEFF EHTLEFF BANTHIEN: ANTHIEN:<br />
Prinzipiell ist sie sehr begrüßenswert. Das ist ja<br />
ein Problem, an dem die Kinderheilkunde leidet,<br />
dass nämlich kaum Medikamente an Kindern<br />
und Jugendlichen getestet werden. Das<br />
liegt unter anderem daran, dass die Prüfungszulassungen<br />
an verschiedene Altersgruppen geknüpft<br />
ist - da aber keine Daten bezüglich der<br />
Sicherheit und Wirksamkeit von Kinderarzneien<br />
vorliegen, gibt es häufig auch keine, die für<br />
Kinder und Jugendliche zugelassen sind.<br />
SHÄ:<br />
Haben Sie auch Einwände gegen die neue Verordnung?<br />
DEHTLEFF EHTLEFF BANTHIEN: ANTHIEN:<br />
Ich habe einen ethischen Einwand: Was die Risiken<br />
eines neuen Wirkstoffes angeht, so können<br />
Kinder, zumal ganz kleine Kinder, nicht<br />
nach ihrem Einverständnis gefragt werden. Das<br />
müssen die Eltern entscheiden. In der Regel<br />
sind sie besorgt um das Wohlergehen ihrer Kin-<br />
der, dennoch können wir<br />
bei solchen Tests auch<br />
pekuniäre Interessen<br />
nicht ausschließen.<br />
SHÄ:<br />
Sie verweisen auf zahlreiche<br />
Präparate, die Apotheker<br />
rezeptfrei für Kinder<br />
anbieten - wie ließe<br />
sich das unterbinden?<br />
DEHTLEFF EHTLEFF BANTHIEN: ANTHIEN:<br />
Solche Präparate sind keinesfalls ein Ersatz für<br />
die Medikamente, über die wir sprechen! Hier<br />
geht es nur darum, dass Eltern durch die vermeintliche<br />
Kompetenz des Apothekers suggeriert<br />
wird, sie könnten abseits eines Arztbesuchs<br />
Hilfe für ihr Kind erwarten - und das, obwohl es<br />
keinen Wirksamkeitsnachweis für solche Präparate<br />
gibt. Ich meine, wir brauchten ein Gesetz,<br />
das eindeutig verbietet, dass Kindern Medikamente<br />
angeboten werden, die nicht geprüft<br />
sind. Als Kinderärzte bemühen wir uns ja auch<br />
ständig um eine rationale Arzneimitteltherapie.<br />
SHÄ:<br />
Welche Medikamente für Kinder fehlen? Wird<br />
zu wenig geforscht?<br />
DEHTLEFF EHTLEFF BANTHIEN: ANTHIEN:<br />
Es sind vor allem Medikamente zur Behandlung<br />
spezieller Erkrankungen, und das vorwiegend im<br />
Klinikbereich, ich denke an gastroenterologische<br />
Medikamente - als niedergelassener Arzt<br />
muss ich so etwas unter Umständen off-label<br />
einsetzen. Es fehlen auch Medikamente in der<br />
Intensivmedizin, etwa im Bereich der Neugeborenen.<br />
Ganz wesentlich ist, dass bisher keine<br />
Prüfungen stattfinden, und demzufolge gibt es<br />
auch keine entsprechende Forschung.<br />
SHÄ:<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
Dehtleff Banthien (Foto: Privat)<br />
In welchem Bereich der Kinderkrankheiten ärgert<br />
es Sie besonders, dass Ihnen nur Medikamente<br />
für Erwachsene zur Verfügung stehen?
DEHTLEFF EHTLEFF BANTHIEN: ANTHIEN:<br />
Bei Asthma und Allergien haben wir besonders<br />
viel zu tun, vor allem unter dem Schulalter, etwa<br />
bei der inhalativen Behandlung von Entzündungen<br />
oder bei bronchialerweiternder Therapie<br />
- da ist nichts speziell für Kinder zugelassen.<br />
Auch im Gastrobereich, wie gesagt, setzen wir<br />
manchmal Mittel ein, die wir für Kinder gar<br />
nicht einsetzen dürften. Mich ärgert aber noch<br />
etwas ganz anderes: Nehmen Sie als Gegenbei-<br />
Gesundheitszentrum Kiel-Mitte<br />
Im Jahr 150 000 Patienten<br />
Das Gesundheitszentrum Kiel-Mitte ist Standort<br />
für zahlreiche Arztpraxen mit insgesamt<br />
mehr als 25 niedergelassenen Ärzten. Während<br />
die Patienten von den kurzen Wegen und der<br />
schnellen ärztlichen Abstimmung profitieren,<br />
lässt sich eine wirtschaftliche Kooperation im<br />
Praxisalltag nur schwer realisieren.<br />
Gemeinsame Anmeldung,<br />
einheitlich gestaltete<br />
Praxisschilder, zentrale<br />
Terminvergabe, gemeinsamer<br />
Pool von<br />
Schreibkräften, gemeinsame<br />
Auftragsvergabe<br />
von Dienstleistungen an<br />
Fremdfirmen oder abge-<br />
stimmtePraxisöffnungen: In einem Ärzte- Wolfgang Hinz (Fotos: di)<br />
zentrum finden sich viele Ansätze für eine Zusammenarbeit.<br />
Im Gesundheitszentrum Kiel-<br />
Mitte, wo jährlich rund 150 000 Patienten ambulant<br />
behandelt werden, verzichten die niedergelassenen<br />
Ärzte auf solche Verflechtungen.<br />
„Gemeinsamer Personalpool - das hört sich zwar<br />
spannend an, ist aber im Alltag schwer umzusetzen“,<br />
sagt etwa Bernhard Schmidt. Der einzige<br />
Allgemeinmediziner im Gesundheitszentrum<br />
gibt zu bedenken, dass die Anforderungen der<br />
vielen Fachgruppen im Hause unterschiedlich<br />
sind. Finanzielle Vorteile wie etwa günstigere<br />
Preise durch einen gemeinsamen Einkauf würde<br />
nach seiner Einschätzung zwar jeder Arzt im<br />
spiel Impfungen - da gibt es Zulassungsstudien<br />
für alle Altersgruppen und überhaupt keine<br />
Schwierigkeiten: Daran können Sie sehen, dass<br />
hier ganz bestimmte Marktmechanismen greifen!<br />
SHÄ:<br />
Besten Dank für diese Erläuterungen, Herr<br />
Banthien.<br />
Werner Loosen, Faassweg 8, 20249 Hamburg<br />
schleswig-holstein<br />
Hause begrüßen, nur: „Jemand müsste sich darum<br />
kümmern. Und in den Praxen hat niemand<br />
dafür personelle Ressourcen.“<br />
Das 2003 eingeweihte Gesundheitszentrum ist<br />
Standort für verschiedene Fachrichtungen und<br />
Praxen unterschiedlicher Struktur: Einzelpraxis,<br />
große Gemeinschaftspraxen und ein radiologisches<br />
Medizinisches Versorgungszentrum finden<br />
sich hier. Neben den Ärzten sind auch Pflegekräfte,<br />
Zahnärzte, Physiotherapeuten und Hebammen<br />
im Haus. Insgesamt arbeiten rund 150<br />
Menschen im Zentrum. Das durch einen geschlossenen<br />
Fonds finanzierte Haus wird derzeit<br />
erweitert, neue Fachgruppen und eine Apotheke<br />
sollen in das Zentrum einziehen.<br />
Schmidt ist trotz fehlender wirtschaftlicher Kooperation<br />
froh, seine Praxis in die Prüne verlegt<br />
zu haben. „Die Patienten<br />
werden hier schneller<br />
versorgt“, sagt<br />
Schmidt. Bei einem<br />
Tumorverdacht etwa<br />
genüge ein Anruf beim<br />
Facharzt im Hause, um<br />
noch am gleichen Tag<br />
eine Zweitmeinung zu<br />
Dr. Johannes Hezel<br />
erhalten. Diese schnelle<br />
Versorgung hält er für<br />
wichtiger als wirtschaftliche Kooperation. Um<br />
die ärztliche Zusammenarbeit weiter zu optimieren,<br />
will er einen hausinternen Begleitbrief für<br />
die innerhalb des Zentrums überwiesenen Patienten<br />
entwickeln. Auch Radiologe Dr. Johannes<br />
Hezel und der MVZ-Verwaltungsleiter Wolfgang<br />
Hinz sehen die Patienten als Nutznießer<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 27
schleswig-holstein<br />
28<br />
der Praxen unter einem Dach. „Sie haben kurze<br />
Wege und die Ärzte können sich bei Bedarf<br />
schnell abstimmen.“ Als der Neubau in der Kieler<br />
Innenstadt vor vier Jahren eingeweiht wurde,<br />
waren die Praxen schnell belegt - von bereits<br />
vorher niedergelassenen Ärzten. Sie werden<br />
nach Ansicht Hezels später von der Entscheidung<br />
für diesen Standort profitieren, und zwar<br />
durch den Wiederverkaufswert. „Für eine Praxis<br />
in einem solchen Zentrum findet man leichter<br />
einen Nachfolger, als wenn man eine Einzelpraxis<br />
in der Peripherie hat“, sagt Hezel. Dass die<br />
wirtschaftliche Kooperation nicht so ausgeprägt<br />
ist wie von ihm zunächst angedacht, ist kein<br />
Zeichen von Streit: „Die ärztliche Kooperation<br />
funktioniert hervorragend.“ Ärzte seien eben<br />
Gemeinsame Aufgabe für Ärzte,<br />
Lehrer und Eltern<br />
Prävention und Gesundheitsförderung<br />
bei Kindern<br />
Michael Lohmann<br />
Nicht erst seit PISA sind Bewegungsarmut, Haltungsschäden,<br />
Übergewicht und Konzentrationsschwierigkeiten<br />
bis hin zu psychosomatischenBeschwerden<br />
bei etlichen<br />
Schulkindern<br />
zu beklagen. Die<br />
Entstehung und<br />
der Verlauf dieser<br />
Bei seinem Vortrag: Dr.<br />
Svante Gehring<br />
Norderstedt: Die Halle der<br />
Grundschule Lütjenmoor (re.)<br />
(Fotos: Lohmann)<br />
Gesundheitszentrum Kiel-Mitte<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
Individualisten, die sich ungern in ihre Praxen<br />
„hineinregieren“ lassen. (di)<br />
Erkrankungen sind jedoch durch geeignete Präventionsmaßnahmen<br />
zu vermeiden oder aber<br />
positiv beeinflussbar.<br />
Hier setzt ein Pilotprojekt an, das kürzlich in der<br />
Grundschule Lütjenmoor in Norderstedt stattgefunden<br />
hat. Initiator Dr. Svante Gehring ist<br />
hausärztlich tätiger Internist und selbst vierfacher<br />
Vater. „Zu mir kommen Kinder und Erwachsene<br />
erst, wenn die Folgeschäden eines ungesunden<br />
Lebensstils bereits zugeschlagen haben.<br />
Ich kann dann allenfalls das Schlimmste<br />
verhindern, aber leider nur noch selten falsch<br />
erlernte Verhaltensmuster meiner Patienten<br />
beeinflussen“, beklagt Dr. Gehring und wandte<br />
sich unter dem Eindruck wachsender Adipositas<br />
bei Kindern und der Bereitschaft, Gesundheitsförderung<br />
in der Schule zu unterstützen, an die<br />
<strong>Ärztekammer</strong> <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>.
Einen Mitstreiter fand er dort beim Koordinator<br />
für das schleswig-holsteinische Gesundheitsziel<br />
zur Verringerung der koronaren<br />
Herzkrankheit, Dr. oec. troph. Michael<br />
Lohmann. „Besonders Ärztinnen und Ärzte<br />
können Eltern und Lehrer bei der Gesundheitserziehung<br />
ihrer Kinder durch kontinuierliche<br />
Information und Beratung wirkungsvoll<br />
unterstützen“, führt Lohmann an. Für<br />
besonders wichtig hält er in diesem Zusammenhang<br />
die „aufsuchende Beratung“, also<br />
die Unterstützung vor Ort im „setting“<br />
Schule.<br />
„Aus diesem Grund war der Weg zur Planung<br />
einer Projektwoche in der Grundschule Lütjenmoor<br />
die logische Konsequenz“, erläutert Dr.<br />
Gehring. Im ersten Schritt erarbeiteten die beiden<br />
Initiatoren Vorschläge für Themen, die als<br />
Einstieg geeignet erschienen. Dr. Gehring nahm<br />
Kontakt mit der Schulleitung auf, um diese für<br />
die Idee zu gewinnen.<br />
Unterstützung holten sich die beiden Initiatoren<br />
unter anderem bei Sabine Schindler-Marlow<br />
von der <strong>Ärztekammer</strong> Nordrhein, die seit Jahren<br />
das Projekt „Gesund macht Schule“ in Kooperation<br />
mit der AOK Rheinland betreut.<br />
Dort bestehen seit mehreren Jahren Kooperationen<br />
zwischen Ärzten und Lehrern. Im Mittelpunkt<br />
stehen dabei „Patenschaften“ zwischen<br />
Ärzten und Schulen, die von beiden Seiten als<br />
sinnvoll und motivierend erlebt werden.<br />
Derart gerüstet konnte das Projekt anschließend<br />
einer Lehrerkonferenz in der Grundschule<br />
Lütjenmoor vorgestellt werden. Als Ergebnis<br />
wurde beschlossen, aus dem anwesenden Lehrerkollegium<br />
eine Arbeitsgruppe zu bilden und<br />
schleswig-holstein<br />
Ständig im Einsatz: der „Krankentransport“ (oben)<br />
Begeistert: In der Turnhalle wurden die vielfältigen Angebote<br />
wahrgenommen<br />
eine Kontaktlehrerin zu benennen, um kurze<br />
Kommunikationswege zu ermöglichen. Die betreffende<br />
Lehrerin fungiert seitdem auch schulintern<br />
als Ansprechpartnerin für die geplanten<br />
Aktivitäten der Projektwoche. Zusätzlich wurde<br />
von Dr. Gehring eine Infoveranstaltung zum<br />
Thema gesunde Ernährung und Bewegung für<br />
interessierte Eltern angeboten.<br />
Ende Mai 2007 fand dann die Projektwoche in<br />
der Grundschule Lütjenmoor statt. Während<br />
der Projektwoche wurden die Kinder motiviert,<br />
sich mit ihren Sinnes- und Körpererfahrungen<br />
auseinanderzusetzen. Insgesamt wurden 16 Projekte<br />
angeboten. Neben den Themen „Besuch<br />
beim Arzt“ und „gesunde Ernährung“ ging es<br />
dabei um Bereiche der Körperwahrnehmung<br />
(z. B. das Herstellen von Fühlkisten) und um<br />
vielfältige Bewegungsangebote (Klettern, Balancieren,<br />
Fitnessübungen). Entspannungsübungen<br />
wie „ein gesunder Start in den Tag“ oder „Traumreisen“<br />
gehörten genauso dazu wie Hand- und<br />
Fußmassagetechniken.<br />
Mit den genannten Handlungsfeldern wurden<br />
verschiedene Absichten verfolgt:<br />
�� Die Kinder lernen, ihre Bedürfnisse und Empfindungen<br />
zu erkennen und zu beschreiben.<br />
�� Die Kinder werden ermutigt, vorurteilsfrei<br />
über ihre Ess- und Bewegungsgewohnheiten,<br />
ihren Fernseh- und Computerspielekonsum<br />
und ihr Übergewicht zu sprechen und ihr Verhalten<br />
zu analysieren.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 29
schleswig-holstein<br />
30<br />
�� Die Kinder begreifen, dass Angst- und Stressabbau,<br />
gesunde Ernährung und Bewegung<br />
Spaß bringen und so als Grundbausteine des<br />
Lebens der Gesundheit dienen können.<br />
�� Die Kinder erkennen, dass Eigenverantwortlichkeit<br />
und Interessenwahrnehmung für einen<br />
gesundheitsbewussten Lebensstil wichtig<br />
sind.<br />
�� Die Kinder stärken ihre gesundheitliche<br />
Kompetenz und ihr Selbstbewusstsein, indem<br />
sie Techniken und Möglichkeiten kennen lernen,<br />
um die Anforderungen des (Schul-)Alltages<br />
erfolgreich zu meistern.<br />
�� Die Kinder bauen möglicherweise vorhandene<br />
Ängste und Unsicherheiten vor Arzt, Praxis<br />
und Klinik ab und lernen ihre Patientenrolle<br />
individuell zu definieren.<br />
Ziel dieses Pilotprojektes ist es, durch die Kooperation<br />
von Schule, Ärzteschaft und Eltern<br />
eine gesundheitsförderliche Umwelt zu gestalten,<br />
die möglichst nachhaltig wirkt. Das bedeutet:<br />
Der Dialog zwischen den beteiligten Partnern<br />
soll dazu führen, dass möglichst viele Kinder<br />
gesundheitsförderlich aufwachsen können.<br />
Das Rüstzeug dazu liefert die Schule als Ver-<br />
Generalversammlung<br />
Ärztegenossenschaft <strong>Schleswig</strong>-<br />
<strong>Holstein</strong><br />
Gegen Gesundheitskarte -<br />
für Fundamentalopposition<br />
Die Ärztegenossenschaft <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
konnte auf ihrer Generalversammlung<br />
in Rendsburg erstmals einen sechsstelligen<br />
Gewinn vermelden. Kontroverse<br />
Diskussionen gab es um die elektronische<br />
Gesundheitskarte.<br />
In einem mit großer Mehrheit verabschiedeten<br />
Aufruf wurden alle ärztlichen<br />
Körperschaften und die Modellregionen<br />
aufgefordert, die Mitarbeit an der Erprobung<br />
der elektronischen Gesundheits-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
mittler. Schulpatenschaften von Ärzten und gemeinsam<br />
organisierte Veranstaltungen und Projektwochen<br />
sind ein Teil auf diesem Weg. Andere<br />
Instrumente und Bausteine könnten z. B.<br />
in einer regionalen Pressearbeit liegen, um das<br />
Bewusstsein zu fördern. Krankenkassen, Kliniken,<br />
Apotheker, Physiotherapeuten, Vereine<br />
und auch regionale Unternehmer könnten als<br />
ideelle und finanzielle Sponsoren gewonnen<br />
werden. Fortbildungsveranstaltungen für die beteiligten<br />
Parteien und die Bereitstellung geeigneter<br />
Materialien könnten über die <strong>Ärztekammer</strong><br />
organisiert werden.<br />
Die Grundschule Lütjenmoor in Norderstedt<br />
kann als Beispiel dienen, das in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
„Schule machen“ sollte. Es werden daher<br />
interessierte Grundschulen und (Haus-)Ärzte(innen)<br />
gesucht, die zur Zusammenarbeit bereit<br />
sind. Interessierte können sich an Dr. Lohmann<br />
bei der <strong>Ärztekammer</strong> wenden (E-Mail<br />
lohmann@aeksh.org), sodass bei ausreichendem<br />
Interesse eine Informationsveranstaltung<br />
organisiert werden kann.<br />
Dr. oec. troph. Michael Lohmann, <strong>Ärztekammer</strong><br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, Bismarckallee 8-12, 23795 Bad<br />
Segeberg<br />
Vorstand der Ärztegenossenschaft: Dr. Klaus Bittmann<br />
(Fotos: di)<br />
karte zu stoppen.<br />
Die Betreibergesellschaft<br />
Gematik<br />
und die Politik<br />
sollten nach Ansicht<br />
der GenossenKosten-Nutzenrelationen<br />
und<br />
alternative<br />
Lösungen<br />
prüfen.<br />
Gegen<br />
den Aufruf<br />
hatte<br />
sich zum<br />
Beispiel<br />
Dr. Inge-<br />
borg<br />
Kreuz
aus dem Vorstand<br />
der Kassenärztlichen<br />
Vereinigung <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
(KVSH)<br />
ausgesprochen. Kreuz,<br />
selbst Hausärztin aus<br />
der Modellregion<br />
Flensburg, verwies auf<br />
die Erkenntnisse, die<br />
Ärzte bei der Erprobung<br />
in den Modellregionen<br />
sammeln und<br />
in ihre Forderungen bei<br />
Aus dem Vorstand der<br />
KVSH: Dr. Ingeborg Kreuz<br />
der Einführung der E-Card einfließen lassen:<br />
„Das liefert uns Argumente für die politische<br />
Diskussion.“ Außerdem hält sie die Beschlüsse<br />
des Deutschen Ärztetages in Münster zu diesem<br />
Thema für ausreichend, um die Bedenken der<br />
Ärzte zu berücksichtigen.<br />
Dr. Svante Gehring von den UnderDocs sprach<br />
sich für den Ausstieg aus den Modellregionen<br />
aus: „Wenn wir das nicht stoppen, wird es heißen,<br />
Ihr habt doch daran mitgearbeitet.“ Hausarzt<br />
Andreas Stanisak kritisierte die noch immer<br />
ungelöste Kostenfrage. Flensburgs Netzvorsitzender<br />
Dr. Eckehard Meissner mahnte zur Differenzierung.<br />
Er kritisierte insbesondere den hohen<br />
Aufwand für die verordnenden Ärzte beim<br />
elektronischen Rezept, stellte aber auch klar:<br />
„Die elektronische Vernetzung und den Heilberufeausweis<br />
können wir gebrauchen.“ Insgesamt<br />
gab es bei rund 65 anwesenden Mitgliedern sieben<br />
Gegenstimmen und zwei Enthaltungen zu<br />
dem Aufruf.<br />
Kritisch setzte sich Genossenschaftschef Dr.<br />
Klaus Bittmann mit der Rolle der Kassenärztlichen<br />
Bundesvereinigung (KBV) bei der Durchsetzung<br />
der finanziellen Ansprüche der Vertragsärzte<br />
auseinander. Um die Unterfinanzierung<br />
im ambulanten Bereich zu beenden, sollte<br />
die KBV nach Ansicht Bittmanns notfalls eine<br />
Ersatzvornahme durch das Bundesgesundheitsministerium<br />
riskieren. „Die Verantwortung für<br />
die Unterfinanzierung der ambulanten Versorgung<br />
liegt dann bei der Politik“, sagte Bittmann.<br />
Um die bisherige Unterfinanzierung zu beenden,<br />
sind nach Angaben Bittmanns neun Milliarden<br />
Euro auf haus- und fachärztlicher Seite notwendig.<br />
„Diese Forderungen müssen erfüllt werden,<br />
sonst bleibt es trotz Berechnung auf Euro und<br />
Cent bei einer inflationären Muschelwährung“,<br />
sagte Bittmann. Sollte die Unterfinanzierung<br />
nicht behoben werden, hätten KVen und freie<br />
Verbände die Pflicht, die Ärzteproteste fortzusetzen.<br />
„Die Verbände werden faule<br />
Kompromisse nicht<br />
mittragen“, kündigte<br />
Bittmann an.<br />
„Die KBV hat sich von<br />
geplanter Fundamentalopposition<br />
entfernt,<br />
zeigt bekannte Politikfähigkeit<br />
und setzt um, mit<br />
unbegreiflichem Optimismus<br />
wird ein neuer<br />
EBM vorbereitet. Dies ist<br />
ein für die Ärzteschaft<br />
schwer nachvollziehbarer Gesinnungswandel“,<br />
sagte Bittmann.<br />
1. Vorsitzender der Under-<br />
Docs: Dr. Svante Gehring<br />
schleswig-holstein<br />
Geschäftsführer Thomas Rampoldt konnte in<br />
Rendsburg das vierte Jahr in Folge schwarze<br />
Zahlen präsentieren. Ein Gewinn nach Steuern<br />
in Höhe von 108 153 Euro ist das bislang beste<br />
Ergebnis für die Genossen. Wichtigster Anteil<br />
an den Erlösen in Höhe von 786 117 Euro sind<br />
die Erträge aus Beteiligungen, wohinter sich<br />
hauptsächlich die hundertprozentige Tochter<br />
Q-Pharm verbirgt. In 2006 überwies die Generikavertriebsfirma<br />
351 857 Euro an die Genossenschaft.<br />
Weitere Erlöse erzielt die Organisation<br />
etwa aus Provisionserlösen oder aus der<br />
Betreuung von Arztgruppen. Die Q-Pharm<br />
selbst erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz<br />
von 9,8 Millionen Euro und liegt weiter auf<br />
Wachstumskurs. Für das laufende Jahr rechnet<br />
das Unternehmen mit Erlösen von 12,5 Millionen<br />
Euro. Wachstumspotenzial sieht Rampoldt<br />
für die Genossenschaft auch in anderen Geschäftsfeldern.<br />
„Deutliche Steigerungen“ seien<br />
etwa noch bei der Betreuung von Arztgruppen<br />
möglich. Scheinbar ausgereizt ist dagegen das<br />
Mitgliederwachstum. Mit 2 145 Ärzten zum<br />
Jahresende 2006 blieb die Zahl im Laufe des<br />
Jahres nahezu konstant (2 141 ein Jahr zuvor).<br />
Nach Angaben Rampoldts können zwar jedes<br />
Jahr rund 50 neue Mitglieder gewonnen werden,<br />
ebenso viele scheiden aber wegen Praxisaufgabe<br />
auch aus. (di)<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 31
schleswig-holstein<br />
32<br />
Verband der Privatkliniken<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
Optimismus bei Privaten<br />
Die Probleme der Krankenhäuser sind bekannt:<br />
Die gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen<br />
- insbesondere der niedrige Landesbasisfallwert<br />
in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> - geben Anlass zur<br />
Sorge. Doch es gibt auch Chancen - und die<br />
wollen die privaten Kliniken nutzen. Auf einer<br />
Veranstaltung des Verbandes der Privatkliniken<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> (VPKSH) am 6. Juni in Kiel<br />
überwogen die optimistischen Ausblicke. Integrierte<br />
Patientenversorgung und die Organisation<br />
regionaler Leistungsverbünde sehen die Privatkliniken<br />
als Chancen für ihre Häuser an.<br />
Der VPKSH-Vorsitzende Dr. Philipp Lubinus<br />
machte den Anfang. Er berichtete von einer<br />
Umfrage, die eine optimistischere Stimmung in<br />
den privaten Kliniken <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>s im<br />
Vergleich zum Bundesdurchschnitt beschreibt.<br />
Optimismus bei den Vertretern der privaten Kliniken: Dr. Christian<br />
Rotering (links) und Horst A. Jeschke<br />
Auch Regionaldirektor Otto Melchert von<br />
den Sana Kliniken sieht Zukunfts- und<br />
Wachstumschancen etwa durch Zusatzentgelte<br />
für Spezialleistungen in Hochleistungszentren.<br />
Moderator Prof. Heinz Lohmann,<br />
früher Chef des Landesbetriebs<br />
Krankenhäuser (LBK) in Hamburg, geht<br />
davon aus, dass trotz einer Marktbereinigung<br />
- die Klinikzahl in Deutschland von<br />
derzeit rund 2 200 wird sich nach seiner<br />
Einschätzung in wenigen Jahren deutlich<br />
verringern - einzelne<br />
Träger expandieren<br />
werden.<br />
Manhagens Geschäftsführer<br />
Dr. sc. pol.<br />
Christian Rotering begründete<br />
den Optimismus<br />
anhand konkre-<br />
ter Zahlen. Seit 2001<br />
setzt sein Haus auf<br />
integrierte Versorgungsverträge.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
Dr. Philipp Lubinus<br />
In diesem Zeitraum konnte die Patientenzahl<br />
von jährlich 6 079 auf 13 422 gesteigert werden.<br />
Dieser Zuwachs wäre nach Angaben Roterings<br />
ohne IV-Verträge nicht möglich gewesen. In<br />
den Jahren davor hatte die Patientenzahl fast<br />
stagniert. Manhagen hat durch konsequente<br />
Spezialisierung neue Versorgungsangebote geschaffen<br />
und sich als Vertragspartner für die<br />
Krankenkassen attraktiver gemacht. Heute<br />
nimmt die Klinik nach Fallzahlen bei vielen<br />
Eingriffen vordere Plätze in Deutschland ein.<br />
Bundesweit führend ist das Haus etwa mit<br />
jährlich 5 177 Katarakt-Operationen,<br />
3 313 Knie-Arthroskopien, 1 099 Schulter-Arthroskopien<br />
und 785 Kreuzband-<br />
Operationen. Bei einigen bundesweit publizierten<br />
Qualitätsvergleichen in der Publikumspresse<br />
landete die zur Gesellschaft für<br />
Systemberatung im Gesundheitswesen<br />
(GSbG) zählende Park-Klinik im vorderen<br />
Bereich - auch dies hat nach Angaben Roterings<br />
positive Effekte auf die Nachfrage.<br />
Gut kommt bei den Krankenkassen auch<br />
die Gewährleistung der Ergebnisqualität<br />
Otto Melchert (links) und Dr. Ernst Bruckenberger (Fotos: di)
durch Garantie-Übernahme bei allen Operationen<br />
an. Was sich inzwischen bei immer mehr<br />
IV-Verträgen durchsetzt, hat Manhagen schon<br />
vor 16 Jahren für ärztliche, pflegerische und<br />
sonstige therapeutische Behandlungsfehler und<br />
für Materialschäden eingeführt. Seitdem wurden<br />
dort 104 000 Patienten operiert. Zu Gewährleistungen<br />
kam es dabei in 416 Fällen, also<br />
in 0,4 Prozent. Der durchschnittliche finanzielle<br />
Aufwand für einen zweiten Eingriff beträgt 2 839<br />
Euro, die Summe über alle Gewährleistungen in<br />
16 Jahren betrug 1,181286 Euro.<br />
Es gab aber auch warnende Stimmen in Kiel.<br />
Projekt IKK mit 4-K-Verbund und UK S-H<br />
Telemedizinische Überwachung<br />
von Herzkranken<br />
Herzkranke Versicherte der Innungskrankenkassen<br />
in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> können sich jetzt<br />
telemedizinisch überwachen<br />
lassen. An<br />
dem Projekt zur integrierten<br />
Versorgung<br />
beteiligen sich neben<br />
der Kasse und dem<br />
Düsseldorfer Telemedizin-Dienstleister<br />
PHTS fünf Kliniken<br />
im Land sowie niedergelasseneHausärzte<br />
und Kardiolo- Dirk Russ (Fotos: di)<br />
gen.<br />
„Ich bin überzeugt, dass noch mehr Krankenkassen<br />
und mehr Krankheitsbilder einbezogen<br />
werden“, sagte Harald Stender bei der Vorstellung<br />
des Projektes. Der Verwaltungschef des<br />
Westküstenklinikums Heide und seine Kollegen<br />
aus dem 4-K-Verbund (Itzehoe, Neumünster,<br />
Heide/Brunsbüttel sowie Bad Bramstedt) und<br />
des Universitätsklinikums <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
machen sich wegen des Projektes keine Sorgen<br />
um den Zulauf der Patienten - auch wenn dies<br />
dem Ziel dient, dem Gesundheitssystem Kosten<br />
durch weniger Klinikeinweisungen zu sparen.<br />
schleswig-holstein<br />
Horst A. Jeschke aus dem Vorstand der Damp-<br />
Gruppe etwa machte auf die Grenzen des<br />
Wachstums für die privaten Betreiber aufmerksam.<br />
„Mittelfristig wird es keine deutliche Erhöhung<br />
der privat zu zahlenden Leistungen durch<br />
GKV-Patienten im Krankenhaus geben“, warnte<br />
Jeschke vor übertriebenen Erwartungen.<br />
Weiteres Problem: Auch private Betreiber bringen<br />
Kliniken in dünn besiedelten Gebieten nur<br />
mühsam in die Gewinnzone. Melchert nannte<br />
als Beispiel Häuser, von denen in Touristenregionen<br />
eine Rundum-Versorgung verlangt wird,<br />
diese aber nur saisonal ausgelastet sind. (di)<br />
Der Patientenandrang in den beteiligten Häusern<br />
ist nach Angaben Stenders groß genug.<br />
Außerdem sehen die Partner in dem kürzlich in<br />
Neumünster vorgestellten Projekt nur den Start<br />
für eine Ausdehnung der Telemedizin in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>.<br />
Dies könnte - so hofft Stender -<br />
dann irgendwann auch dazu führen, dass PHTS<br />
das für das Projekt notwendige Call-Center<br />
nach <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> verlegt. Arzt Dirk Russ<br />
vom Dienstleister kann sich eine solche Lösung<br />
als Außenstelle an einem der beteiligten Krankenhäuser<br />
zumindest vorstellen.<br />
Zunächst wollen die Partner aber Patienten von<br />
ihrem Modell überzeugen. Die herzkranken Patienten<br />
werden mit einem 12-Kanal-EKG, einem<br />
Blutdruckmessgerät und einer Waage ausgestattet.<br />
Die ermittelten<br />
Vitalwerte<br />
werden täglich an<br />
das telemedizinische<br />
Zentrum von PHTS<br />
in Düsseldorf übermittelt.<br />
Dort sind<br />
Ärzte und Krankenschwestern<br />
rund um<br />
die Uhr erreichbar.<br />
Sie betreuen bislang<br />
Nicolay Breyer<br />
rund 16 000 deutsche<br />
Patienten aus<br />
weiteren Telemedizinprojekten. Die Ärzte benötigen<br />
eine Einverständniserklärung der Patienten,<br />
die vorher von PHTS-Mitarbeitern bei<br />
der Bedienung der Geräte geschult werden.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 33
schleswig-holstein<br />
34<br />
„Die Anrufe sind kostenfrei für die Patienten<br />
und es gibt keine Wartezeiten. Die Datenübertragung<br />
dauert keine 20 Sekunden“, sagte Russ<br />
in Neumünster. Die im Call-Center gesammelten<br />
Daten werden in einer elektronischen Patientenakte<br />
erfasst und stehen den behandelnden<br />
Ärzten für eine leitliniengerechte Therapie online<br />
oder per Fax zur Verfügung. Bei akuten<br />
Herzbeschwerden wird ein Notarzt eingeschaltet<br />
und sofort mit den Patientendaten versorgt.<br />
Patienten, die sich nicht regelmäßig melden,<br />
werden vom Zentrum erinnert. Sie werden aufgefordert,<br />
auch ohne Beschwerden regelmäßig<br />
in die Arztpraxis zu gehen.<br />
Allein 500 bis 600 Hausärzte erhoffen sich<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>s Hausarztchef Nicolay Breyer<br />
und Dr. Klaus Bittmann von der Ärztegenossenschaft.<br />
Sie rechnen mit einer hohen Reso-<br />
Deutsche-Angestellten-Krankenkasse<br />
Defizite bei Versorgung von<br />
Kopfschmerzen und Migräne<br />
Der Krankenstand in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> ist so<br />
niedrig wie zuletzt 1997. Neben dieser erfreulichen<br />
Nachricht verwies die DAK bei der Vorstellung<br />
ihres <strong>aktuell</strong>en Gesundheitsreports aber<br />
auch auf Defizite bei der Versorgung von Patienten<br />
mit Kopfschmerzen und Migräne. Deshalb<br />
soll nun verstärkt über Therapiemöglichkeiten<br />
aufgeklärt werden.<br />
„Kopfschmerzen und Migräne sind eine stille<br />
Epidemie, die wir erst jetzt realisieren“, sagte<br />
Prof. Dr. Hartmut Göbel beim Pressegespräch in<br />
der Kieler DAK-Zentrale. Der Direktor der Kieler<br />
Schmerzklinik zählt zu einer Gruppe von 13<br />
Experten aus der ambulanten und stationären<br />
Versorgung sowie der Forschung, die das mit<br />
der Erstellung des Gesundheitsreports beauftragte<br />
Institut für Gesundheits- und Sozialforschung<br />
(IGES) zuvor befragt hatte. Als Datengrundlage<br />
für die Analyse diente dem IGES eine<br />
repräsentative Bevölkerungsumfrage von rund<br />
3 000 Menschen zwischen 18 und 65 Jahren.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
nanz unter den niedergelassenen Ärzten, weil<br />
die Teilnahme nicht an eine Mitgliedschaft in<br />
Genossenschaft oder Hausarztverband gekoppelt<br />
ist und die extrabudgetäre Quartalspauschale<br />
für jeden eingeschriebenen Patienten 35<br />
Euro beträgt. Auch unter den Patienten erwartet<br />
Dr. Frank Reibe von der IKK eine hohe Aufgeschlossenheit.<br />
Der steigende Altersdurchschnitt<br />
der Bevölkerung und die damit zunehmende<br />
Zahl von Herzerkrankungen machen es<br />
nach seiner Ansicht notwendig, die Betreuung<br />
der Patienten stärker zu strukturieren. Wann<br />
auch andere Versicherte an dem Telemedizinprojekt<br />
teilnehmen können, stand in Neumünster<br />
noch nicht fest. Bittmann, dessen Organisation<br />
mit der Abwicklung und Abrechnung der<br />
Vereinbarung beauftragt ist, kündigte aber Gespräche<br />
mit „weiteren Versorgerkassen“ an. (di)<br />
Als Fazit aus den Daten<br />
und den Expertengesprächen<br />
fasste<br />
Dr. Katrin Krämer<br />
vom IGES zusammen:„Kopfschmerzen<br />
sind als Erkrankung<br />
sowohl in der<br />
Bevölkerung als auch<br />
auf ärztlicher Seite<br />
nicht immer aner-<br />
Dr. Katrin Krämer (Foto: di)<br />
kannt“. Sie sieht<br />
noch immer ein „Akzeptanzproblem für Kopfschmerzen.“<br />
Nach Angaben Göbels nehmen über 100 000<br />
Menschen in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> täglich Schmerzmittel<br />
gegen Kopfschmerzen ein. Damit steige<br />
das Risiko eines Medikamenten induzierten<br />
Dauerkopfschmerzes - was in der Bevölkerung<br />
bislang aber kaum bekannt sei. Eine Ursache<br />
dafür: Viele Menschen mit Kopfschmerzen stützen<br />
sich nicht auf ärztlichen Rat, sondern versorgen<br />
sich selbst. „Das müsste nicht sein“, sagte<br />
Göbel mit Blick auf Fortschritte in der Forschung.<br />
Obwohl die Erkrankung häufig nur zu<br />
kürzeren Arbeitsunfähigkeitszeiten führt, sind<br />
die Folgekosten für die Volkswirtschaft hoch.
„Jeder dritte Migräne-Betroffene ist mäßig bis<br />
schwer in seiner Leistungsfähigkeit in Beruf,<br />
Haushalt und Freizeit eingeschränkt“, sagte<br />
Krämer. Trotz Schmerzen gingen viele Migränepatienten<br />
zur Arbeit, seien dort aber weniger<br />
produktiv.<br />
Krämer hat aus den Expertengesprächen auch<br />
abgeleitet, dass die Aus-, Fort- und Weiterbildung<br />
auf ärztlicher Seite zum Thema verstärkt<br />
werden sollte. Defizite sieht sie auch bei der<br />
Umsetzung leitliniengerechter und interdisziplinärer<br />
Therapien und bei der Zusammenarbeit<br />
im ambulanten Versorgungsbereich. DAK-Landesgeschäftsführer<br />
Uwe Escher kündigte als<br />
Konsequenz der Expertenbefragung eine stärkere<br />
Information der Versicherten über Therapiemöglichkeiten<br />
an. „Je mehr der Patient selbst<br />
über die Erkrankung weiß, umso mehr ist er in<br />
der Lage, mit seinem behandelnden Arzt über<br />
sein Problem zu sprechen“, sagte Escher. Außerdem<br />
arbeitet die DAK an einem Konzept zur integrierten<br />
Versorgung, für das ein Netzwerk mit<br />
Patienten-Ombudsverein<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
Starke Verunsicherung der<br />
Patienten<br />
Der Verein Patienten-Ombudsmann/-frau<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> beobachtet eine steigende<br />
Verunsicherung der Patienten im Gesundheitswesen.<br />
Im vergangenen Jahr wandten sich 1 256<br />
Patienten an die Ombudsleute - so viel wie nie<br />
seit der Gründung des Vereins vor zehn Jahren.<br />
Eine zunehmende Akzeptanz seiner Arbeit in<br />
der Bevölkerung, eine steigende Patientenmündigkeit,<br />
aber auch eine starke Verunsicherung<br />
der Patienten durch neue gesetzliche Regelungen<br />
nennt der Verein in seinem jetzt vorgestellten<br />
Jahresbericht 2006 als Gründe für die Zunahme<br />
der Fälle. Einen Rückschluss auf eine<br />
vermeintlich schlechtere Qualität ärztlicher<br />
Leistungen lässt der Verein nicht gelten.<br />
„Eher ist zu vermuten, dass mehr Patienten sich<br />
zu Wort melden, die sonst nichts gesagt hät-<br />
schleswig-holstein<br />
abgestuften Therapiemöglichkeiten aufgebaut<br />
wird. Göbel gab zu bedenken, dass zeitaufwändige<br />
Sprechstunden mit Migränepatienten besser<br />
honoriert werden müssen als Kurzkontakte.<br />
Der Gesundheitsreport weist auch aus, dass der<br />
Krankenstand in den vergangenen 15 Jahren<br />
um rund ein Drittel gesunken ist, obwohl das<br />
Durchschnittsalter der Bevölkerung steigt.<br />
Escher sieht bei dieser Entwicklung aber Grenzen.<br />
Es sei deshalb wichtig, die Gesundheit und<br />
Motivation der Beschäftigten in den Mittelpunkt<br />
der Personalpolitik zu stellen, sagte<br />
Escher an die Adresse der Unternehmen. Den<br />
höchsten Krankenstand wies auch in der <strong>aktuell</strong>en<br />
Statistik wieder die Branche Gesundheitswesen<br />
mit deutlichem Abstand vor der öffentlichen<br />
Verwaltung auf. Den niedrigsten Krankenstand<br />
hat die Branche Rechtsberatung. Krämer<br />
führt den hohen Krankenstand im Gesund-<br />
heitswesen auf die schwere Arbeit etwa für Pflegekräfte<br />
zurück. (di)<br />
ten“, sagte Ombudsmann Andreas Eilers. Der<br />
Seelsorger hat zusammen mit seinen Kollegen<br />
Jens-Hinrich Pörksen und Siegrid Petersen (löste<br />
zur Jahresmitte Hedi Gebhardt ab) im vergangenen<br />
Jahr 480 Fälle aus Praxen von niedergelassenen<br />
Ärzten bearbeitet. Hinzu kommen<br />
252 Fälle, in denen es um Fragen zu Krankenkassen<br />
und Medizinischer Dienst ging sowie 251<br />
Fälle aus Krankenhäusern. Größtes Problemfeld<br />
war der Bereich Verordnungen (289 Fälle), gefolgt<br />
von den Tätigkeitsfeldern Kommunikation<br />
(264), Verdacht auf Behandlungsfehler (194),<br />
Rechtsanfragen<br />
(152) und Abrechnungen<br />
(144). Die<br />
stark gestiegenen<br />
Anfragen zu Verordnungen<br />
von Medikamenten<br />
und Heiloder<br />
Hilfsmitteln<br />
führt der Verein auf<br />
geänderte Zuzahlungspflichtenzu-<br />
Prof. Günther Jansen (Fotos: di)<br />
rück. Bei vielen Pati-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 35
schleswig-holstein<br />
36<br />
enten beobachteten<br />
die Ombudsleute<br />
„Unsicherheiten und<br />
Ängste“ wegen veränderterVerordnungen.<br />
Nur geringe<br />
Schwankungen gibt<br />
es seit Jahren beim<br />
Verdacht auf Behandlungsfehler.<br />
Kritik gibt es von den Dr. Bernhard Bambas<br />
Ombudsleuten an<br />
niedergelassenen Augenärzten - und umgekehrt.<br />
Grund ist ein Bericht des Omdudsmannes<br />
Jens-Hinrich Pörksen, der eine zunehmende<br />
Zahl von Beschwerden über abweisendes Verhalten<br />
von Augenarztpraxen gegenüber gesetzlich<br />
Versicherten kritisiert. „Manche Augenärzte<br />
verhalten sich offenbar nur gegenüber Privatpatienten<br />
freundlich und entgegen kommend,<br />
erwecken jedoch bei gesetzlich versicherten<br />
Patienten den Eindruck, dass sie auf ihre<br />
Behandlung eigentlich keinen Wert legen“,<br />
stellte Pörksen fest. Er forderte die Kassenärztliche<br />
Vereinigung auf, entweder mehr Augenärzte<br />
zuzulassen oder die bestehenden Praxen<br />
„konsequent zu verpflichten, ihren Versorgungsauftrag<br />
gegenüber gesetzlich Versicherten<br />
zu erfüllen“. Welche Folgen lange Wartezeiten<br />
für Patienten haben können, schildert er an einem<br />
Einzelfall: Eine Patientin hatte trotz des<br />
Hinweises auf zunehmende Beschwerden und<br />
rapide schwindende Sehkraft einen Termin in<br />
einer Augenarztpraxis erst zehn Wochen später<br />
erhalten. Weitere zwei Wochen später erfolgte<br />
in der Praxis eine Angiographie, bevor die Patientin<br />
schließlich an die Uniklinik verwiesen<br />
wurde. Dort stellte man fest, dass das Auge wegen<br />
einer Makula-Degeneration nicht mehr zu<br />
retten war und fragte die Patientin nach dem<br />
Grund für ihr spätes Erscheinen. „Die nach<br />
zehn Tagen durchgeführte Operation ergab,<br />
dass nichts mehr zu retten war“, berichtete<br />
Pörksen. Der Berufsverband der Augenärzte<br />
hatte den Ombudsmann daraufhin zu einem<br />
Gespräch getroffen, weil man in dem Bericht die<br />
ganze Fachgruppe diffamiert sieht. <strong>Schleswig</strong>-<br />
<strong>Holstein</strong>s Berufsverbandsvorsitzender Dr. Bern-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
hard Bambas konnte aber auch nach dem Treffen<br />
beim Patientenombudsmann „keinerlei Bereitschaft<br />
zur Akzeptanz der Tatsachen“ erkennen.<br />
Bambas zeigte sich erstaunt, dass „jemand,<br />
der in Teilbereichen seines Aufgabengebietes<br />
völlig desinformiert ist und sich auch nicht lernwillig<br />
zeigt, zu Konfliktthemen der GKV Stellung<br />
bezieht und als Ombudsmann tätig sein<br />
kann.“ In einem Brief an den Patientenombudsverein<br />
fordert Bambas, „solche Unwahrheiten in<br />
Berichten und Äußerungen der Ombudsleute in<br />
Zukunft zu unterlassen“. Als „Schlag ins Gesicht<br />
der betroffenen Ärzte“ wertet Bambas,<br />
dass die Kritik aus einem zum Teil von der <strong>Ärztekammer</strong><br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> und damit indirekt<br />
von den Ärzten mitfinanzierten Organisation<br />
kommt. Der Vereinsvorsitzende Prof. Günther<br />
Jansen zeigte sich von der massiven Kritik<br />
erstaunt. Er will das Gespräch zu Bambas suchen,<br />
sich aber nicht inhaltlich zu den von den<br />
Ombudsleuten geschilderten Einzelfällen äußern:<br />
„Die Ombudsleute müssen unabhängig<br />
bleiben.“ Wenig Verständnis hat er für den<br />
Hinweis der Augenärzte auf die Mitfinanzierung<br />
des Vereins durch die <strong>Ärztekammer</strong>. Gerade die<br />
breite Trägerstruktur garantiere die Unabhängigkeit.<br />
Der gemeinnützige Patientenombudsverein<br />
wurde vor zehn Jahren von der AOK und<br />
der <strong>Ärztekammer</strong> <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> gegründet<br />
und hat heute Einrichtungen, Organisationen<br />
und Einzelpersonen aus allen Bereichen des<br />
Gesundheitswesens als Mitglieder. Ziel des Vereins<br />
ist nach Angaben Jansens, „Differenzen zu<br />
klären, unterschiedliche Auffassungen über eine<br />
fundierte Moderation zu schlichten, zum Beispiel<br />
um Gerichtsverfahren nach Möglichkeit zu<br />
vermeiden.“ Zum Verein gehört auch ein Pflegeombudsteam,<br />
das im vergangenen Jahr 121<br />
Fälle bearbeitete. In anderen Bundesländern<br />
gibt es nur vereinzelt ähnliche Einrichtungen<br />
wie den Patientenombudsverein. Flächendeckend<br />
wird dagegen derzeit die „Unabhängige<br />
Patientenberatung Deutschland“ (UPD) an 22<br />
Standorten eingerichtet. Träger der UPD sind<br />
der Sozialverband VdK Deutschland, der Verbraucherzentrale<br />
Bundesverband und der Verbund<br />
unabhängiger Patientenberatung. Die Arbeit<br />
der UPD wird von den gesetzlichen Krankenkassen<br />
bezahlt. (di)
GKV-WSG<br />
Vertrauen in Wirksamkeit<br />
gering<br />
Gesundheitsreform 2007 - eine Antwort auf den<br />
demografischen Wandel in Deutschland? Mit<br />
dieser Frage hatte Prof. Dr. Fritz Beske seine<br />
diesjährige gesundheitspolitische Veranstaltung<br />
zur Kieler Woche überschrieben. Die Antworten<br />
zeigten, dass das Vertrauen in die Wirksamkeit<br />
der Reform gering ist.<br />
Hans-Jürgen Ahrens (li.) und Dr. Klaus Bittmann<br />
Über demografischen Wandel und medizinischen<br />
Fortschritt wird derzeit viel diskutiert und<br />
geschrieben. Beske zeigte an nüchternen Zahlen,<br />
was die Veränderungen bewirken können.<br />
Die Bevölkerungszahl in Deutschland wird von<br />
heute 82,3 Millionen bis zum Jahr 2050 auf 68,7<br />
Millionen sinken. Die Lebenserwartung der<br />
Menschen erhöht sich in diesem Zeitraum alle<br />
vier Jahre um ein Jahr. Im Jahr 2050 wird ein<br />
Drittel der Bevölkerung mindestens 65 Jahre, 15<br />
Prozent gar über 80 Jahre alt sein. Auf 100 Erwerbstätige<br />
kommen dann 64 Menschen, die 65<br />
Jahre oder älter sind. Zum Vergleich: Heute<br />
kommen 33 Rentner auf 100 Erwerbstätige. Für<br />
die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ist<br />
diese Alterung ein finanzielles Problem, da ihre<br />
Pro-Kopf-Ausgaben für einen 90-jährigen Versicherten<br />
rund vier Mal so hoch sind wie für die<br />
eines 40-Jährigen. Weil im Jahr 2050 mehr 90-<br />
Jährige, aber weniger 40-Jährige als heute leben,<br />
steigt der GKV-Finanzbedarf stark an - demografiebedingt<br />
müssten die Pro-Kopf-Ausgaben<br />
über alle Versicherten von heute monatlich 150<br />
Euro auf 184 Euro im Jahr 2050 steigen. Hinzu<br />
schleswig-holstein<br />
kommt der Finanzbedarf, den der medizinische<br />
Fortschritt auslöst. Besonders die großen Volkskrankheiten<br />
werden für Kostensprünge sorgen.<br />
PD Dr. Alexander Katalinic, Direktor der Registerstelle<br />
des Krebsregisters<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> an<br />
der Universität Lübeck, sagte<br />
für die kommenden Jahre<br />
eine Vervielfachung der<br />
Zahl der Demenzkranken,<br />
der Herzkranken, der<br />
Krebskranken und der Dia-<br />
Prof. Dr. Fritz Beske betiker voraus.<br />
Annette Widmann-Mauz, Ralf Büchner, PD Dr. Alexander<br />
Katalinic (v. l.) (Fotos: di)<br />
Angesichts dieser Prognosen hält der Vorsitzende<br />
der Kassenärztlichen Vereinigung <strong>Schleswig</strong>-<br />
<strong>Holstein</strong> (KVSH), Ralf Büchner, die Einführung<br />
von Grund- und Wahlleistungen und eine<br />
neue Interpretation des mit der Gesundheitsreform<br />
eingeführten Wettbewerbs für notwendig.<br />
„Wir brauchen einen Wettbewerb außerhalb<br />
des GKV-Systems, nicht in der Grundversorgung“,<br />
sagte Büchner in Kiel. Außerdem<br />
sprach sich der KV-Vorsitzende für einen<br />
schrittweisen Einstieg in die Kapitaldeckung, für<br />
mehr Eigenbeteiligung der Patienten und für<br />
mehr ehrenamtliches Engagement des Einzelnen<br />
aus. Politikern riet Büchner zu mehr Mut<br />
bei der Umsetzung unpopulärer Maßnahmen,<br />
weil die Bevölkerung nach seiner Einschätzung<br />
bei der Beurteilung der notwendigen Einschnitte<br />
viel weiter ist, als die meisten Politiker glaubten:<br />
„Die Menschen vertragen die Wahrheit.“<br />
Auch Dr. Klaus Bittmann, Vorsitzender der<br />
Ärztegenossenschaft <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, sieht<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 37
schleswig-holstein<br />
38<br />
einen möglichen Ausweg in der Umsetzung einer<br />
bekannten Beske-Forderung, nämlich in der<br />
Überarbeitung des GKV-Leistungskataloges.<br />
„Wir müssen uns ernsthaft die Frage stellen, ob<br />
der Leistungskatalog so noch zu halten ist“, sagte<br />
Bittmann. Die jahrelangen Bemühungen der<br />
Politik, das Gesundheitssystem nur durch Kostendämpfung<br />
zu reformieren, betrachtet er als<br />
gescheitert: „Das reicht nicht, wir müssen uns<br />
in ein anderes System bewegen.“ Unterschiedliche<br />
Auffassungen gab es zwischen Büchner und<br />
Bittmann nur in der Frage der Selektivverträge.<br />
Während Büchner diese als Gefahr für Ärzte<br />
und Patienten ansieht, hält Bittmann Selektivverträge<br />
für ein Instrument im Wettbewerb, das<br />
ärztliche Organisationen zum Vorteil der Ärzte<br />
nutzen sollten. AOK-Chef Hans-Jürgen Ahrens<br />
Nordwestdeutsche Gesellschaft für<br />
ärztliche Fortbildung<br />
48. Westerland-Seminar<br />
erfolgreich<br />
Horst Kreussler<br />
Nach zwei Jahren im Ausweich-Tagungsort<br />
Rathaus freuten sich über 190 (!) Teilnehmer<br />
auf den gewohnten Saal im Kurzentrum an der<br />
Friedrichstraße, der inzwischen aufwändig renoviert<br />
und mit moderner Technik ausgestattet<br />
war. So ließ sich bei der anfangs ungewöhnlichen<br />
Hitze draußen dennoch ungestört arbeiten.<br />
Es ging wieder um ein umfangreiches Programm<br />
von vielen Themen aus der Inneren Medizin<br />
und ihren Randgebieten.<br />
Den Einführungsvortrag mit traditionell übergreifendem<br />
Thema bestritt diesmal Dr. Karl-<br />
Werner Ratschko (Bad Segeberg), eingeladen<br />
insbesondere als Vertreter der Akademie der<br />
<strong>Ärztekammer</strong> und langjähriger, den Westerland-Seminaren<br />
verbundener Hauptgeschäftsführer<br />
der <strong>Ärztekammer</strong> <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, so<br />
der scheidende Vorsitzende der veranstaltenden<br />
Nordwestdeutschen Gesellschaft für ärztliche<br />
Fortbildung, Prof. Dr. F. R. Matthias (Gießen).<br />
Das zunächst abstrakt klingende, dann aber im-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
sieht im Gegensatz zu den Ärzten durchaus<br />
Chancen, die von Beske skizzierten Herausforderungen<br />
ohne große Systemeinschnitte zu bewältigen.<br />
Er riet dazu, die Leistungsfähigkeit der<br />
kommenden Generationen zu steigern, die<br />
<strong>aktuell</strong>en Versorgungsformen zu überdenken<br />
und die Einnahmeseite der gesetzlichen Krankenkassen<br />
zu stärken. Annette Widmann-<br />
Mauz, gesundheitspolitische Sprecherin der<br />
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, hielt Ärzten<br />
vor, selbst nicht konsequent genug Forderungen<br />
nach Einschnitten zu unterstützen. Bei Bemühungen<br />
um eine Ausdünnung des Leistungskataloges<br />
etwa hätten auch Ärzte mit Einwänden<br />
dafür gesorgt, dass die Bemühungen stets mit<br />
dem gleichen Ergebnis eingestellt werden: „Am<br />
Ende bleibt nichts übrig.“ (di)<br />
mer mehr packende Thema:<br />
das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz:<br />
Wohin geht der Weg des<br />
deutschen Gesundheitswesens?<br />
Der Referent bemühte<br />
sich zunächst pflichtschuldigst<br />
(aber natürlich<br />
mit einem Augenzwin- Dr. Karl-Werner Ratschko<br />
kern), die Vorgeschichte<br />
(Foto: Br)<br />
sowie die edlen Absichten der zahlreichen Gesundheitsreform-Gesetze(„Jahrhundertgesetze“)<br />
in den letzten Jahren so wertfrei wie möglich<br />
wiederzugeben: bessere Gesundheitsversorgung,<br />
mehr Transparenz, weniger Bürokratie<br />
usw. Schon bei der anschließenden Schilderung<br />
der inhaltlichen Elemente wurde immer deutlicher,<br />
dass die schönen Ziele auf diesem Weg<br />
nicht zu erreichen sind. Gewiss, mehr Wahltarife<br />
der GKV, eine bessere Verzahnung der Sektoren,<br />
ein Ausbau der Integrierten Versorgung,<br />
größere Vertragsfreiheiten der Kassen, Apotheken<br />
und Ärzte oder ein verbessertes Vergütungssystem<br />
für den ambulanten Bereich klingen<br />
zunächst einmal positiv.<br />
Eine kritische Analyse zeige jedoch, dass das<br />
GKV-System immer mehr kompliziert werde<br />
und dass der Überblick verloren gehe: „Sechs
Reformgesetze allein für Arzneimittel in fünf<br />
Jahren sind zuviel.“ Wie die Apotheker und<br />
auch die Ärzte damit umgegangen seien, sei eigentlich<br />
zu bewundern. „Wir wünschen uns<br />
aber Ärzte, die bei der Verordnung zuerst an die<br />
Patienten denken, nicht zuerst an Bürokratie<br />
und wie sie damit fertig werden.“ Zur Resignation<br />
bei den Patienten komme eine schleichende,<br />
sich beschleunigende Demotivation bei den<br />
Ärzten, mit sichtbaren Folgen: „Zum ersten Mal<br />
in der Geschichte der Ärzteschaft sind die Ärztinnen<br />
und Ärzte in großer Zahl auf die Straße<br />
gegangen und haben demonstriert. Nicht zum<br />
ersten Mal, aber noch nie so stark, gab es Sympathie<br />
in der Bevölkerung und in den Medien.“<br />
Auch andere Punkte des GKV-WSG seien<br />
kritikwürdig, so das Austrocknen des PKV-<br />
Systems (Zustrom neuer Versicherter erschwert,<br />
Kontrahierungszwang zum Basistarif),<br />
der Gesundheitsfonds („Gespannt,<br />
wann eine Kasse Überschüsse an Versicherte<br />
zurückzahlt!“), die Uneinheitlichkeit<br />
der Kassenstrategien auf Bundesund<br />
Landesebene, das Gewirr an Hausarztverträgen,<br />
die fehlenden Evaluationen<br />
bisheriger Reformschritte (Beske)<br />
usw.<br />
Ratschkos Fazit war ein Appell an die<br />
Zuhörer, an die Ärzte: Üben Sie Einfluss<br />
auf die Politik aus, auch im Blick auf die<br />
Bundestagswahl 2009, um wenigstens ein „leidlich<br />
funktionierendes Gesundheitssystem“ zu erhalten.<br />
Ja - richtig wählen, aber wie? Die Frage<br />
blieb erst einmal offen.<br />
Anschließend ging es in medias res, in die Medizin.<br />
Prof. Dr. H. Rasche (Bremen) beeindruckte<br />
mit einer umfassenden Übersicht über Thrombose<br />
und Blutungsneigung. Vor etwa 30 Jahren<br />
sei die perioperative Thromboseprophylaxe üblich<br />
geworden, ohne dass anfangs die erhöhte<br />
Blutungsgefahr durch die Op entsprechend wichtig<br />
genommen wurde. Nur sehr wenige Studien<br />
gebe es zur Frage, ob es wirklich und wie viel<br />
stärker blute (iatrogene hämorrhagische Diathese).<br />
Seine resümierende Erkenntnis: Thrombozytenfunktionshemmer<br />
wie ASS als Sekundärprophylaxe<br />
vaskulärer Komplikationen sollten<br />
grundsätzlich nicht abgesetzt werden, wenn<br />
schleswig-holstein<br />
nach Art der Op (Zahn-, Haut-, Augenchirurgie)<br />
kein starker Blutverlust zu befürchten sei<br />
oder lokal vorgegangen werden könne z. B.<br />
durch Mundspülung mit Antifibrinolytika.<br />
Auch orale Antikoagulantien wie Vitamin-K-<br />
Antagonisten könnten abgesetzt, müssten aber<br />
einige Tage vor und nach der Op durch „bridging“<br />
etwa mit Heparin ersetzt werden.<br />
Umfassende Patientenaufklärung<br />
und Dokumentation<br />
seien erforderlich.<br />
Weitere „Highlights“ waren beispielsweise<br />
Beiträge zur optimalen Ernährung<br />
(Prof. U. Rabast, Hattingen: Studien uneinheitlich,<br />
grundsätzlich keine Nahrungsergänzungsmittel,<br />
am besten<br />
Mittelmeerkost), zur Pharmakotherapie<br />
im Alter<br />
(Prof. H. Breithaupt, Gießen:<br />
cave Nebenwirkungen, auf<br />
kurze Halbwertzeit achten, halbe Dosis bei<br />
Rheumamitteln). Ein besonderer Schwerpunkt<br />
war die Vorstellung des „neuen“ Öffentlichen<br />
Gesundheitsdienstes am Beispiel von Kiel. Die<br />
Leiterin Dipl. Soz. A. Hofmann und ihre ärztlichen<br />
Mitarbeiterinnen Dr. Friederike Besch,<br />
Leiterin des Hafenärztlichen Dienstes, und Dr.<br />
A. Wencke erläuterten die zusätzlichen „Managementaufgaben“<br />
nach dem Gesundheitsdienstgesetz<br />
des Landes von 2002. Heute hat<br />
der ÖGD stärker bevölkerungsmedizinisch orientierte<br />
Aufgaben der Gesundheitsförderung,<br />
speziell auch der Kinder- und Jugendgesundheit.<br />
Er hilft vor allem bedürftigen und gefährdeten<br />
Bevölkerungsgruppen durch Beratung<br />
und Betreuung, baut umweltbezogen Gesundheitsschutz<br />
auf und leistet die Gesundheitsberichterstattung<br />
(GBE). Außerdem geht es wie<br />
gewohnt um Schutz vor Infektionskrankheiten,<br />
um die Überwachung von Gemeinschafts- und<br />
medizinischen Einrichtungen, um die Trinkwassersicherheit<br />
und um die Erstellung von Gutachten.<br />
Organisatorisch, so war herauszuhören,<br />
habe die Umstellung des ÖGD von einer Landesaufgabe<br />
auf die kommunale Selbstverwaltung<br />
der Kreise und kreisfreien Städte auch Probleme<br />
bei der Koordinierung gebracht.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 39
schleswig-holstein<br />
40<br />
Am Sonntagnachmittag lautete das Oberthema<br />
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. An den folgenden<br />
Tagen Gastroenterologie/Hepatologie<br />
und bronchopulmonale Erkrankungen (traditionell<br />
mit Prof. Dr. Hinrich Hamm,<br />
Nordseeklinik Westerland) sowie EKG bei<br />
kardialen Erkrankungen und Pharmakotherapie<br />
im Alter.<br />
Beim Themenblock Psychosomatik<br />
sprang PD Dr. G. Langs (Bad Arolsen)<br />
erfolgreich für den leider verstorbenen<br />
Dr. Saupe (Stade) siehe SHÄ 7/2005,<br />
Seite 31, ein. In seinem zweiten Referat<br />
zur Behandlung des Burn-Out-Syndroms schilderte<br />
er den mehrstufigen, oft mehrmals durchlaufenen<br />
Prozess des nicht nur auf Helfer-Berufe<br />
beschränkten Syndroms: Freundlichkeit/Idealismus,<br />
beginnende Überforderung (nicht wahrgenommen),<br />
abnehmende Freundlichkeit,<br />
Schuldgefühle, vermehrte Anstrengungen, Erfolglosigkeit,<br />
Hilflosigkeit, Erschöpfung/Abneigung/Apathie/Wut<br />
... Auf die Ärzte selbst bezogen:<br />
„Viele Ärzte haben Burn-Out-Probleme -<br />
wollen es aber nicht wahrhaben.“<br />
Landesvereinigung für Gesundheitsförderung<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
Dietmar Katzer neuer<br />
Vorstandsvorsitzender<br />
Elfi Rudolph, Hilke Lind<br />
Die Mitglieder der Landesvereinigung<br />
für Gesundheitsförderung<br />
e. V.<br />
in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> haben<br />
Dietmar Katzer, Leiter<br />
der Ersatzkassenverbände<br />
VdAK/AEV, in ihrerMitgliederversammlung<br />
am 30. Mai 2007<br />
Dietmar Katzer (Foto: di)<br />
zum neuen Vorsitzenden<br />
des Vorstandes gewählt. Der 54-jährige Gesundheitsexperte<br />
löst Dr. Karl-Werner Ratschko ab,<br />
der von diesem Ehrenamt zurückgetreten war.<br />
„Das Motto in Zeiten, in denen Sozial- und da-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
Neues aus der Notfallmedizin, aus Neurologie,<br />
Nephrologie und Diabetologie (Dr.<br />
H. Kleinwaechter, Kiel) rundete die Tagung<br />
ab.<br />
Am Ende stand wie üblich der<br />
Blick nach vorn auf die nächste<br />
Tagung, die 49. vom 08.-13.06.2008.<br />
Auch im nächsten Jahr könnte es wieder eine<br />
begleitende Kunstausstellung geben wie in diesem<br />
Jahr von Brigitte Koriath aus Warder bei<br />
Kiel, die mit ihren abstrakt-expressionistischen<br />
Bildern unter dem Motto „Kunst als Analogie<br />
zum Leben“ für angeregte Gespräche sorgte.<br />
Aber auch ein Besuch im nahen, räumlich geschickt<br />
erweiterten Nolde-Museum Seebüll - 50<br />
Jahre alt geworden - ist jedem kunstinteressierten<br />
Mediziner sehr zu empfehlen.<br />
Informationen unter www.westerland-seminar.de<br />
oder bei der langjährigen, in Westerland<br />
für 25 Jahre Tätigkeit geehrten verdienstvollen<br />
Tagungssekretärin Verena Nevermann, Steinburg,<br />
Tel. 04534/8202.<br />
Dr. jur. Horst Kreussler, An der Karlshöhe 1, 21465<br />
Wentorf<br />
mit Gesundheitsabbau Programm ist, kann nur<br />
lauten: Gegensteuern“, sagte Katzer.<br />
Stellvertretender Vorsitzender wird Dr. Thomas<br />
Ruff, Hauptgeschäftsführer der Zahnärztekammer<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>. Zum Schatzmeister ist<br />
Bernd Heinemann von der Landesstelle für<br />
Suchtfragen <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> e. V. gewählt<br />
worden, als seine Stellvertreterin Sylvia Lassen-<br />
Mialkas von der Dräger & Hanse BKK. Schriftführerin<br />
wird Angelika Forster von der AOK<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>. Stellvertretende Schriftführerin<br />
wird Helga Pecnik von der Akademie für<br />
medizinische Fort- und Weiterbildung<br />
in Bad Segeberg.<br />
Beisitzer werden Dr. Dr.<br />
jur. Hans-Michael Steen,<br />
Dr. Uta Kunze und Prof.<br />
Dr. Dr. Lioba Baving. Damit<br />
sind auch die <strong>Ärztekammer</strong><strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
und das Universitätsklinikum<br />
<strong>Schleswig</strong>-Hol- Dr. Uta Kunze (Foto: IB)
Helga Pecnik (Fotos: rat)<br />
stein im Vorstand der Landesvereinigung<br />
vertreten. Delegierte<br />
vom Ministerium für Soziales,<br />
Gesundheit, Familie, Jugend und<br />
Senioren des Landes <strong>Schleswig</strong>-<br />
<strong>Holstein</strong> bleibt Dr. Marion Scupin.<br />
Die Geschäftsführerin der<br />
Landesvereinigung ist seit 2001<br />
Dr. phil. Elfi Rudolph.<br />
Die Landesvereinigung für Gesundheitsförderung<br />
e. V. in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> ist seit 1966 für<br />
mehr Gesundheit in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> aktiv<br />
und bietet Informationen und Angebote zur<br />
Früherkennung, Prävention und Gesundheitsförderung<br />
in verschiedenen Lebensbereichen.<br />
Träger des Vereins sind 170 Mitglieder, darunter<br />
namhafte Institutionen und Organisationen<br />
aus dem schleswig-holsteinischen Gesundheitswesen.<br />
Das Haushaltsvolumen umfasste<br />
im Jahr 2006 rund 531 400 Euro,<br />
davon trug das Gesundheitsministerium<br />
gut die Hälfte der Mittel.<br />
Aufgaben der Landesvereinigung für<br />
Gesundheitsförderung sind in erster<br />
Linie Information und Fortbildung zu<br />
Themen der Gesundheit. Aktuelle<br />
Projekte und Arbeitsschwerpunkte<br />
Deutsche Gesellschaft für Senologie<br />
Unerfüllte Forderungen<br />
Dr. phil. Elfi Rudolph<br />
Erfolgsmeldungen, aber auch unerfüllte Forderungen:<br />
Auf der 27. Jahrestagung der Deutschen<br />
Gesellschaft für Senologie gab es unter den Teilnehmern<br />
je nach Standpunkt Grund zu Optimismus<br />
oder Unzufriedenheit. Vom 21. bis 23.<br />
Juni standen in der Lübecker Musik- und Kongresshalle<br />
Probleme und Lösungen zu Erkrankungen<br />
der weiblichen Brust im Mittelpunkt.<br />
Tagungspräsident Prof. Jürgen Dunst, Direktor<br />
der Klinik für Strahlentherapie am Campus Lübeck<br />
des Universitätsklinikums, konnte rund<br />
2 000 Besucher aus ganz Deutschland begrüßen.<br />
Zertifizierte Brustzentren sind eine „gigantische<br />
Erfolgsgeschichte“, DMP Brustkrebs ist „alles<br />
sind beispielsweise „Brustlife“, die Koordinierungsstelle<br />
der Landesinitiative zur Früherkennung<br />
von Brustkrebs, das Projekt „Leibeslust -<br />
Lebenslust“ vom Servicebüro Kindergarten, die<br />
Koordinierungsstelle der landesweiten Impfkampagne<br />
„Gut behütet durch<br />
impfen“ und der Qualitätsprüfungsservice<br />
für Angebote zur Primärprävention.<br />
Umfangreich ist auch das Fortbildungsprogramm<br />
für Multiplikatoren(innen)<br />
im Gesundheitsbereich.<br />
Zudem ist die Landesvereinigung<br />
Partnerin des Gesundheitsministeriums<br />
beispielsweise<br />
bei der Umsetzung des Kinder-<br />
schleswig-holstein<br />
Dr. Dr. jur. Hans-Michael<br />
Steen<br />
und Jugendaktionsplanes. Insgesamt konnte die<br />
Landesvereinigung im Jahr 2006 an rund 50<br />
Fortbildungen und Fachtagungen<br />
über 1 450 Teilnehmer(innen) verzeichnen.<br />
Darüber hinaus sind rund<br />
125 000 Flyer und Broschüren zu <strong>aktuell</strong>en<br />
Gesundheitsthemen an die<br />
Bevölkerung verteilt worden.<br />
Dr. Elfi Rudolph, Hilke Lind, Landesvereinigung<br />
für Gesundheitsförderung e. V. in<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, Flämische Str. 6-10,<br />
24103 Kiel, Info www.lv-gesundheit-sh.de<br />
27. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Senologie<br />
andere als eine Erfolgsstory“ und das Mammographie-Screening<br />
ein sinnvolles, aber durchaus<br />
noch zu verbesserndes Konzept - nur drei Themen<br />
aus einem riesigen Angebot, aus dem die<br />
Teilnehmer aus ganz Deutschland in Lübeck<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 41
schleswig-holstein<br />
42<br />
auswählen konnten. Die „gigantische Erfolgsgeschichte“<br />
schreiben nach Ansicht von Prof.<br />
Diethelm Wallwiener gerade die zertifizierten<br />
Brustkrebszentren in Deutschland. Der erste<br />
Vorsitzende der Gesellschaft für Senologie sieht<br />
Deutschland mit inzwischen rund 200 zertifizierten<br />
Zentren auf dem Weg zu einer flächendeckenden<br />
Versorgung. Was 2003 mit einem<br />
Pilotprojekt in Tübingen begann, hat sich nach<br />
seiner Beobachtung bundesweit durchgesetzt.<br />
Von den jährlich rund 55 000 neu erkrankten<br />
Frauen lassen sich heute<br />
rund 30 000 in solchen<br />
Zentren behandeln.<br />
Immer mehr Patientinnen<br />
fragten bei<br />
ihren Ärzten selbst<br />
nach einer Behandlung<br />
in einer zertifizierten<br />
Einrichtung: „Die meisten<br />
Patientinnen sind<br />
sehr gut informiert.<br />
Prof. Dr. Diethelm Wallwiener<br />
Unser Ziel ist es, dass<br />
alle in einem zertifizierten Brustkrebszentrum<br />
behandelt werden können“, sagte Wallwiener.<br />
Die Gesellschaft strebt rund 250 dieser Zentren<br />
in Deutschland an. Inzwischen haben sie bereits<br />
Vorbildcharakter - ähnliche Konzepte werden<br />
nach Angaben Wallwieners derzeit in Österreich<br />
und in der Schweiz, aber auch für andere<br />
onkologische Erkrankungen wie etwa Darmkrebs<br />
oder Prostatakarzinom geprüft. Als Vorteile<br />
der Zentren wurden in Lübeck etwa die interdisziplinäre<br />
Zusammenarbeit und die Kommunikation<br />
genannt. Besonders wichtig sind die<br />
Zentren nach Ansicht von Dunst für die komplizierteren<br />
Fälle, die nach seinen Angaben fünf<br />
bis zehn Prozent aller Erkrankungen ausmachen.<br />
Unzufrieden ist man aber noch mit der Finanzierung.<br />
Prof. Rolf Kreienberg aus der Universitätsfrauenklinik<br />
Ulm stellte klar, dass die Zentren<br />
für ihren erhöhten Aufwand auch eine bessere<br />
Honorierung als andere Krankenhäuser benötigen.<br />
„Obwohl wir nachweislich bessere<br />
Leistungen erbringen, werden wir nicht besser<br />
bezahlt. Die Politik lässt uns mit diesem Problem<br />
allein“, kritisierte Kreienberg. Er rechnete<br />
vor: In Deutschland gibt es noch rund 500 Kliniken,<br />
die weniger als 20 Frauen mit Brustkrebs<br />
im Jahr behandeln (zertifizierte Zentren mindes-<br />
Prof. Dr. Ingrid Schreer<br />
(Fotos: di)<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
tens 150). Diese<br />
10 000 Patientinnen<br />
sollten nach seiner Ansicht<br />
an die Zentren<br />
verwiesen werden. Bei<br />
einer Fallpauschalenhöhe<br />
von 3 500 Euro<br />
würde dies Mehreinnahmen<br />
von 35 Millionen<br />
Euro für die Zentren<br />
bedeuten. Wenn<br />
dies politisch nicht<br />
durchsetzbar ist, plädiert Kreienberg für einen<br />
Zuschlag auf die Fallpauschale für die Behandlung<br />
in Brustkrebszentren in Höhe von 1 000 bis<br />
1 500 Euro. „Alles andere als eine Erfolgsstory“<br />
sind nach Ansicht von PD Dr. Ute-Susann Albert<br />
vom Uniklinikum Gießen und Marburg dagegen<br />
die Disease-Management-Programme<br />
(DMP) Brustkrebs. Nach ihren Angaben gibt es<br />
bei jährlich 55 000 Neuerkrankungen bislang<br />
nur 11 000 Einschreibungen. Nach ihrer Ansicht<br />
sollten DMP die Nachsorge stärker berücksichtigen,<br />
den betroffenen Frauen die Teilhabe<br />
am gesellschaftlichen und beruflichen Leben<br />
erleichtern und stärker auf die Versorgungsaspekte<br />
bei erneut auftretenden Erkrankungen<br />
ausgerichtet werden. Zur Früherkennung:<br />
Prof. Ingrid Schreer vom Kieler Mamma-<br />
Zentrum, die auch stellvertretende Vorsitzende<br />
der Deutschen Gesellschaft für Senologie ist,<br />
plädierte für eine Ausdehnung des Mammographie-Screenings<br />
auf auf jüngere Frauen (bislang<br />
nur für 50-69 Jährige). Schreer kann sich eine<br />
bessere Wirkung des Screenings vorstellen,<br />
wenn die Teilnehmerinnen intensiver als bislang<br />
über die Nutzen, Risiken und Grenzen der<br />
Mammographie informiert werden. Hilfreich<br />
wäre es aus ihrer Sicht auch, wenn andere Bundesländer<br />
die „privilegierte Situation“ in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
kopierten. Schreer nannte das<br />
Qualitätssicherungsprogramm QuaMaDi und<br />
die vollständige Erfassung aller Brustkrebserkrankungen<br />
im Krebsregister als Vorteile. Weitere<br />
Anstrengungen zur Vernetzung, etwa vom<br />
ambulant geleisteten Mammographie-Screening<br />
zu den Kliniken, hält sie für notwendig. Die Einordnung<br />
des Screenings in den ambulanten Bereich<br />
ist nach ihrer Ansicht für die Ausbildung<br />
in den Kliniken ein Nachteil. (di)
Das Fortbildungszertifikat haben u. a. erhalten:<br />
Bodo Bachmann, Klein Wesenberg,<br />
Facharzt für Anästhesiologie<br />
Dr. Ute Backheuer, Rendsburg,<br />
Fachärztin für Augenheilkunde<br />
Dr. Heike Berlinghof, Rheinbach, Ärztin<br />
PD Dr. Ralf Bialek, Großhansdorf,<br />
Facharzt für Mikrobiologie und<br />
Infektionsepidemiologie<br />
Christian Brinckmann, Itzehoe, Arzt<br />
Prof. Dr. Joachim Brossmann, Gettorf,<br />
Facharzt für Diagnostische Radiologie<br />
Dr. Anke Dammann, Gnissau,<br />
Fachärztin für Allgemeinmedizin<br />
Dr. Corinna Doll, Lübeck,<br />
Fachärztin für Frauenheilkunde u. Geburtshilfe<br />
Dr. Michael Ebsen, Heikendorf, Arzt<br />
Dr. Michael Eisner, Lindaunis/Schlei,<br />
Facharzt für Nervenheilkunde<br />
Kristine Ewert, Bad Malente-Gremsmühlen,<br />
Ärztin<br />
Dr. Kathrin Gärtner-Petersen, Niebüll,<br />
Fachärztin für Haut- u. Geschlechtskrankheiten<br />
Dr. Jörg Grammerstorf, Stockelsdorf,<br />
Facharzt für Innere Medizin<br />
Jörg Günther, Oldenburg i. H.,<br />
Facharzt für Allgemeinmedizin<br />
Dr. Ruth Jürs, Bad Oldesloe, Praktische Ärztin<br />
Daiga Kaulena, Bad Schwartau,<br />
Fachärztin für Allgemeinmedizin<br />
Dr. Jan Keßeböhmer-Freise, Lübeck,<br />
Facharzt für Radiologische Diagnostik<br />
Dr. Ingo Kleitke, Kiel,<br />
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin<br />
Cornelia-Alexandra Krebs, Itzehoe,<br />
Fachärztin für Physikalische u. Rehabilitative<br />
Medizin<br />
Dr. Cristina Lerin Lozano, Neumünster,<br />
Fachärztin für Innere Medizin<br />
schleswig-holstein<br />
Dr. (Med. Univ. Budapest) Axel Meier, Lübeck,<br />
Praktischer Arzt<br />
Dr. Thies Nentwig, Lübeck,<br />
Facharzt für Allgemeinmedizin<br />
Kirsten Pietz, Lübeck,<br />
Fachärztin für Frauenheilkunde u. Geburtshilfe<br />
Dr. Klaus Poddig, Eutin,<br />
Facharzt für Anästhesiologie<br />
Thomas Posth, Bargteheide,<br />
Facharzt für Nervenheilkunde<br />
Dr. Wolfgang Quehl, Rellingen,<br />
Facharzt für Allgemeinmedizin<br />
Dr. Gertrud Reingruber, Großhansdorf,<br />
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin<br />
Dr. Manuela Rogga, List/Sylt,<br />
Fachärztin für Chirurgie<br />
Eberhard C. Schaal, Rellingen,<br />
Facharzt für Allgemeinmedizin<br />
Dr. Petra Schönrock-Nabulsi, Ratzeburg,<br />
Fachärztin für Innere Medizin<br />
Dr. Frank Schröder, Lübeck,<br />
Facharzt für Anästhesiologie<br />
Dr. Dr. Hans-Michael Steen, Eckernförde,<br />
Facharzt für Innere Medizin<br />
Dr. Annette Sturm-Steen, Eckernförde,<br />
Fachärztin für Allgemeinmedizin<br />
Markus Trappe, Rendsburg,<br />
Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe<br />
Susanna Uhlmann, Ahrensburg,<br />
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie<br />
Johanna Vagedes, Mölln, Ärztin<br />
Dr. Verena Wagner, Lübeck,<br />
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin<br />
Dr. Rüdiger Zech, Wedel,<br />
Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe<br />
Fortsetzung folgt ...<br />
Fragen zu Ihrem Fortbildungszertifikat<br />
beantworten Ihnen gern Dr. Elisabeth Breindl, Tel. 04551/803-143,<br />
oder Juliane Hohenberg, Tel. 04551/803-218<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 43
kammer-info <strong>aktuell</strong><br />
44<br />
Praxisbegehungen<br />
Wo findet man <strong>aktuell</strong>e<br />
Informationen?<br />
Im Internet unter www.kbv.de Rubriken Fachbesucher<br />
- Publikationen - Sonderpublikationen -<br />
findet man die Broschüre „Überwachungen und<br />
Begehungen von Arztpraxen durch Behörden“<br />
zum Download. Die Broschüre gibt Beispiele zu<br />
Gesetz/Verordnungen<br />
Aufstellung der Zuständigkeiten (Stand Mai 2007)<br />
Fundstelle Zuständigkeit Schl.-H.<br />
Infektionsschutzgesetz (IfSG) § 16 Allgemeine Maßnahmen der zuständigen Gesundheitsämter der<br />
Behörden<br />
Kreise und kreisfreien<br />
§ 36 Einhaltung der Infektionshygiene Städte<br />
Medizinproduktegesetz (MPG) § 26 Durchführung der Überwachung LGASH1 Medizinprodukte-Betreiberverordnung<br />
(MPBetreibV)<br />
§ 6 Verlängerung der Frist für sicherheitstechnische<br />
Kontrollen<br />
LGASH1 Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung<br />
(MPSVI)<br />
Gefahrstoffverordnung<br />
(GefStoffV)<br />
§ 3 Meldung von Vorkommnissen LGASH 1<br />
§ 20 Behördliche Ausnahmen, Anordnungen<br />
und Befugnisse<br />
Erläuterungen zur Tabelle:<br />
1: Landesamt für Gesundheit und Arbeitssicherheit des Landes <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, Adolf-Westphal-Str. 4, 24143 Kiel,<br />
E-Mail poststelle@lgash-ki.landsh.de;<br />
2: Aufsichtsbezirk: Kreisfreie Städte Kiel, Neumünster, Flensburg, Kreise Nordfriesland, Plön, Rendsburg-Eckernförde,<br />
<strong>Schleswig</strong>-Flensburg, Landesamt für Gesundheit und Arbeitssicherheit des Landes <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, Adolf-Westphal-Str.<br />
4, 24143 Kiel, E-Mail poststelle@lgash-ki.landsh.de;<br />
Aufsichtsbezirk: Kreisfreie Stadt Lübeck, Kreise Ostholstein, Segeberg, Stormarn, Herzogtum Lauenburg, Landesamt<br />
für Gesundheit und Arbeitssicherheit des Landes <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, Außenstelle Lübeck, Schwartauer Landstraße 11,<br />
23554 Lübeck, E-Mail poststelle@lgash-hl.landsh.de;<br />
Aufsichtsbezirk: Kreise Dithmarschen, Steinburg, Pinneberg, Landesamt für Gesundheit und Arbeitssicherheit des Landes<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, Außenstelle Itzehoe, Oelixdorfer Straße 2, 25524 Itzehoe, E-Mail poststelle@lgash-iz.landsh.de;<br />
3: Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren des Landes <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, Adolf-Westphal-<br />
Str. 4, 24143 Kiel, E-Mail poststelle@SozMi.landsh.de.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
LGASH 2<br />
Biostoffverordnung (BioStoffV) § 16 Unterrichtung der Behörde LGASH 2<br />
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) § 21 Zuständige Behörden; Zusammenwirken<br />
mit den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung<br />
Jugendarbeitsschutzgesetz<br />
(JArbSchG)<br />
§ 51 Aufsichtsbehörde; Besichtigungsrecht<br />
und Berichtspflichten<br />
LGASH 2<br />
LGASH 2<br />
Mutterschutzgesetz (MuSchG) § 20 Aufsichtsbehörde LGASH 2<br />
Röntgenverordnung (RöV) § 17 a Qualitätssicherung durch ärztliche und<br />
zahnärztliche Stellen<br />
Strahlenschutzverordnung<br />
(StrlSchV)<br />
entsprechenden Checklisten und deren Links.<br />
Weiterhin findet man darin auch wichtige Ausschnitte<br />
aus hygienerechtlichen Vorschriften.<br />
Außerdem hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung<br />
unter Punkt 5 ihrer Broschüre zusammengetragen,<br />
wer für die verschiedenen Gesetze<br />
und Verordnungen in Nordrhein-Westfalen und<br />
Berlin zuständig ist. Im Anschluss dieses Artikels<br />
finden Sie eine Aufstellung, wer in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
entsprechend zuständig ist. (Ho)<br />
§ 83 Qualitätssicherung bei der medizinischen<br />
Strahlenanwendung<br />
MSGF 3<br />
MSGF 3<br />
Gesundheitsdienstgesetz (GDG) § 15 Überwachungsbefugnisse Gesundheitsämter der<br />
Kreise und kreisfreien<br />
Städte
Praxisnetz Herzogtum Lauenburg<br />
Versorgungsvertrag<br />
diabetischer Fuß<br />
Monika Schliffke<br />
„Entwicklung und Durchführung eines integrierten<br />
Versorgungsvertrages diabetischer Fuß<br />
unter ländlichen Strukturbedingungen“ unter<br />
diesem Titel hat das Praxisnetz Herzogtum Lauenburg<br />
seinen IV-Vertrag mit der AOK <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
auf dem 42. Jahreskongress der<br />
Deutschen Diabetologischen Gesellschaft vom<br />
16.-19. Mai 2007 im CCH Hamburg präsentieren<br />
können.<br />
Rainer Stengel (Wentorf), Dr. Karin Richter (Ratzeburg), Dr. Manfred Blauth<br />
(Mölln), Dr. Monika Schliffke (Ratzeburg), Dr. Jörg Simon (Fulda), Dr. Torsten<br />
Diederich (Wentorf) (v. l. n. r.) (Foto: Nolte)<br />
Der Vertrag läuft seit dem 1. September 2006<br />
und sieht interdisziplinäre leitliniengestützte<br />
Diagnostik und Therapie, zentrale EDV-Erfas-<br />
Verweigerte Hilfe beim<br />
Sterben<br />
Wally und Horst Hagen<br />
Dr. Monika Beckmann meint in ihrem Leserbrief<br />
im <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>ischen Ärzteblatt<br />
(SHÄ) 4/2007, Seite 14, manch einer unserer<br />
Gedanken im SHÄ 3/07 Seite 45 ff. könne<br />
„nicht unwidersprochen stehen bleiben“. Sie<br />
kritisiert, dass wir es für barmherzig halten, einem<br />
„Sterbenden auf seinen Wunsch hin bei<br />
der aktiven Beendigung seines Lebens zu hel-<br />
kammer-info <strong>aktuell</strong><br />
sung von Behandlungsdaten und Fotodokumentationen,<br />
deren diabetologische Sichtung und<br />
Überwachung sowie eine transparente Regelung<br />
der Zusammenarbeit zwischen Hausärzten,<br />
Fachärzten, diabetologischen Schwerpunktpraxen<br />
und Kliniken vor. Kooperiert wird zudem<br />
mit Orthopädieschuhtechnikern, Pflegediensten<br />
und Podologen.<br />
Die Umsetzung in einem Flächenkreis ist eine<br />
besondere Qualitäts- und Strukturherausforderung.<br />
Ca. 40 Ärzte verfolgen gemeinsam die Ziele<br />
von Frühdiagnostik in jeder haus- und fachärztlichen<br />
Praxis, Schluss jedes Ulcus möglichst<br />
innerhalb sechs Monaten sowie Sekundärprophylaxe<br />
durch konsequente Überwachung und<br />
Hilfsmittelversorgung. Die in<br />
Deutschland hohe Amputationsrate<br />
des diabetischen Fußes<br />
soll deutlich gesenkt werden.<br />
Eine dreifache Winsituation<br />
gilt es zu erreichen: Der Patient<br />
wird optimal und zeitnah versorgt,<br />
die ärztlichen Behandler<br />
aufwandsentsprechend honoriert,<br />
die Krankenkasse gewinnt<br />
durch Behandlungsverkürzung,<br />
Reduktion von Folgekosten,<br />
Rabatte durch zentrale Wundmaterialwirtschaft.<br />
Dr. Dipl. oec. med. Monika Schliffke, Dechower Weg 4,<br />
23909 Ratzeburg<br />
fen.“ Dr. Beckmann begründet ihre Wertung an<br />
dieser Aussage nicht mit ärztlichen oder ethischen<br />
Argumenten, sondern gleich im nächsten<br />
Satz mit der Gefahr des „nur allzu berechtigten<br />
Missbrauchs“. Wir sehen keine Möglichkeit zu<br />
ärztlicher Exekutive bei Missbrauch von Gesetzen<br />
und finden, dass unser Text doch „unwidersprochen<br />
stehen bleiben“ kann. Auf den von<br />
uns zur Reflexion angebotenen Sinn des getadelten<br />
Satzes, nämlich einem Kranken bei der<br />
Beendigung seines Lebens auf seinen Wunsch<br />
hin zu helfen, geht sie überhaupt nicht ein. Der<br />
Wunsch des Kranken, der in die Bitte einmün-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 45
kammer-info <strong>aktuell</strong><br />
46<br />
det, ihm auch beim letzten Schritt des Sterbens<br />
ärztlich zu helfen, wird von unseren Moral-Kritikern<br />
Dr. Beckmann und Ingemar Nordlund<br />
(SHÄ 5/2007, Seite 44 f.) nicht kommentiert,<br />
es geht beiden um eine Zurückweisung unserer<br />
ethischen Gesinnung und ein wenig auch um<br />
ihre Selbstgefälligkeit als beispielgebende Gutmenschen.<br />
Mit ihrer Missbilligung, dass wir unter den Gegnern<br />
der aktiven Sterbehilfe viele Menschen als<br />
Moralisten abwerten, mag Dr. Beckmann freilich<br />
aus ihrer Erfahrung Recht haben. Wir vermuten<br />
allerdings unter den Gegnern der Hilfe<br />
beim gewünschten Sterben<br />
viele Menschen, die sich<br />
mit den realen Modalitäten<br />
eines Sterbevorgangs<br />
noch nie pragmatisch auseinandergesetzt<br />
haben. Sie<br />
urteilen nur auf der theoretischen<br />
Ebene von Moral<br />
und vielleicht auch Ethik.<br />
Einfache Menschen auf<br />
der Straße, die sich für die<br />
Verweigerung der Hilfe<br />
beim Sterben aussprechen,<br />
haben - allein aus statistischen Gründen - wahrscheinlich<br />
nur wenige Sterbende begleitet, denen<br />
sie unter ärztlichen Aspekten den Wunsch<br />
zum Sterben hätten erfüllen können. Gleichwohl<br />
hat die Verbreitung ihrer Ansichten über<br />
vermeintlich moralische Defizite bei Ärzten die<br />
öffentliche Meinung beeinflusst. Das wiederum<br />
ging ein in die Intentionen der Gesetzgeber, die<br />
jene Gesetze erließen, in denen wir persönlich<br />
eben Moralismus sehen. Deren Realitätsferne<br />
drückt sich schon aus in der Wortwahl. Es heißt<br />
da „Tötung auf Verlangen“. Verlangen eines<br />
Menschen, getötet zu werden, ist ja semantisch<br />
etwas völlig anderes als der Wunsch eines Kranken,<br />
ihm beim Sterben zu helfen. Bei der Gesetzgebung<br />
über diesen Komplex haben sicher<br />
auch Nichtmoralisten mitgewirkt, aber mit der<br />
emotionalen Konnotation des komplexen Sterbevorgangs<br />
langzeitbetreuter Patienten waren<br />
nur wenige dieser Gesetzgeber erfahren.<br />
Und was ist mit dem Wunsch eines Kranken,<br />
nicht mehr leben zu wollen? Sei er nun gedacht<br />
Dres. Wally und Horst Hagen (Foto: hps)<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
oder ausgesprochen, ist er unmoralisch? Nimmt<br />
ein Mensch, der seinen Arzt ausdrücklich anfleht,<br />
ihm zum Sterben zu verhelfen, billigend in<br />
Kauf, den Arzt zu einer unmoralischen Handlung<br />
zu animieren? Oder ist die Bitte eines<br />
Kranken an seinen Arzt, ihm auch beim Sterben<br />
Hilfe zu leisten, nicht Ausdruck eines großen<br />
Vertrauens, das sich der Arzt durch bisherige<br />
Empathie erworben hat.<br />
Ärztliches Ethos impliziert strikte Abstinenz<br />
von Ideologien jeglicher Art. Das bezieht sich<br />
auf die Konfession des Arztes sowie auch auf die<br />
seiner Patienten. Ärzte können sich nicht einengen<br />
lassen von der Vorstellung,<br />
nur Christen oder<br />
Muslime könnten moralisch<br />
unantastbare Ärzte<br />
sein. Auch (aus der Sicht<br />
des jeweilig anderen) ungläubig<br />
genannte Mitmenschen<br />
können ethisch<br />
hochstehende Ärzte sein.<br />
Wir müssen unser ärztliches<br />
Selbstverständnis demütig<br />
befreien von der<br />
Vorstellung, Ungläubige<br />
voreilig zu kategorisieren oder nur an der eigenen<br />
Skala zu messen.<br />
Uns die Frage zu stellen, ob Hippokrates ein<br />
Moralist sei, ist reine Provokation. Die Behauptung,<br />
er sei es nicht, kann Dr. Beckmann nicht<br />
auf eine epistemologische Grundlage stellen.<br />
Wissenschaftlich Gebildete dürfen diese Frage<br />
nicht mit Anspruch auf Gültigkeit beantworten,<br />
solange sie nicht bewiesen ist. Ganz sicher hat<br />
Hippokrates in seiner vorchristlichen Zeit nicht<br />
wissen oder gar lehren können, wie „das Geschöpf<br />
Mensch in seiner Stellung zu Gott einzuordnen<br />
sei“. Im hippokratischen Eid ist von<br />
Göttern (im Plural) die Rede. Wäre es ihm<br />
möglich und wäre es in seinem Sinne gewesen,<br />
seine vielen Götter gegen einen monotheistischen<br />
Gott einfach auszutauschen, wie er heute<br />
im christlich abendländischen Weltbild residiert?<br />
Dr. Beckmann hat Hippokrates Götter zu<br />
unserem Christengott umformuliert. Wie auch<br />
immer, wir haben seinen Eid geschworen und<br />
dessen zugrunde liegenden ärztlichen Gebote
absolut undogmatisch im Bezug auf den genauen<br />
Wortlaut zur Maxime unseres ärztlichen Gewissen<br />
gemacht.<br />
Im Gegensatz zum Kollegen Nordlund sind wir<br />
über vierzig Jahre lang sehr oft tief in verschiedene<br />
tropische Urwälder eingedrungen. Den<br />
Einsatz von Macheten konnten wir meist durch<br />
umsichtig geplantes Vorgehen vermeiden, Mut<br />
brauchten wir durch besonnenes Handeln selten.<br />
An Stelle von Wut und Verzweiflung haben<br />
wir in allen Lebenssituationen nach Zuversicht<br />
und Ausgeglichenheit gestrebt. Lektüre<br />
schwieriger Texte wäre für uns im Übrigen nie<br />
Anlass zum Einsatz von verbissenen oder von<br />
Verzagtheit getragenen Hilfsmitteln gewesen.<br />
Gleichwohl entnehmen wir der Urwald-Metapher,<br />
dass unsere Ausdrucksweise miserabel sein<br />
muss. Die mehrfach versuchte bloße Lektüre bis<br />
zur Kenntnisnahme des Inhaltes unseres einfachen<br />
Artikels forderte seine Wut heraus und<br />
brachte ihn zur Verzweiflung. Offensichtlich<br />
scheiterten die Versuche trotz dieser Anstrengungen.<br />
Dabei haben wir vierzig Bücher und<br />
über hundert Artikel geschrieben, deren Leser<br />
oder Rezensenten unsere Sprache nie als schwer<br />
verstehbar beanstandeten. Inhaltlich freilich<br />
war manches in unseren Publikationen schwer<br />
zu begreifen, weil wir manchmal „viele Fässer<br />
auf einmal geöffnet“ haben, um Bedeutungszusammenhänge<br />
darzulegen. Egal! Wir bedauern,<br />
dass Kollege Nordlung unsere Denkanstöße nur<br />
mit so vielen Mühen „zur<br />
Kenntnis zu nehmen“ vermochte.<br />
Und dass er sie zusätzlich<br />
wegen unserer unzulänglichen<br />
Ausdrucksweise auch<br />
noch falsch interpretierte. Dr.<br />
Beckmann hatte zum Glück<br />
keine Schwierigkeiten, wenigstens<br />
unsere Schreibweise<br />
zu verstehen. Sie hat ihre Kritik<br />
mehr am Moralisch-Inhaltlichen<br />
festgemacht.<br />
Wir haben unsererseits nun<br />
Verständnisschwierigkeiten,<br />
welche sechs Fragen Ingemar<br />
Nordlund umformulieren<br />
musste. Uns erscheint sein<br />
Wortlaut nicht als Umfor-<br />
kammer-info <strong>aktuell</strong><br />
mulierung, sondern als Neukonzeption mit ganz<br />
anderen Inhalten. Wir haben ohne vergleichbare<br />
Durchnummerierung unsere Fragen an<br />
Moralisten gerichtet. Sie bezogen sich auf das<br />
Leid der Kranken. Ingemar Nordlund stellt nun<br />
Fragen an uns Ärzte, etwa wie „wir“ uns beim<br />
Umgang mit Sterbenden „schützen, um nicht<br />
verhärtet zu werden“ oder wie „wir“ gut weiterarbeiten<br />
können oder wie „wir“ mit den nachhängenden<br />
seelischen Eindrücken „konstruktiv<br />
umgehen.“ Was „wir“ brauchen, wenn wir Sterbehilfe<br />
leisten, ist nicht unsere Frage, sondern<br />
was Moralisten brauchen, um am grünen Tisch<br />
die Grenzen der Barmherzigkeit festzulegen. Wir<br />
selbst brauchen uns vor der Ernsthaftigkeit unseres<br />
Berufes nicht zu schützen, wir verhärten<br />
auch nicht und wissen auch, wie wir weiterarbeiten<br />
können.<br />
Durch die von Kollege Nordlund neu formulierten<br />
Fragen zieht sich ja ein ganz anderer Ductus<br />
als in den von ihm „umformulierten“ Originalen.<br />
Uns geht es ganz vordergründig um die<br />
Kranken! Seine neuen Fragen liegen jenseits<br />
unseres persönlichen Anliegens. Wir haben nie<br />
danach gefragt, wie „wir“ mit den Aufgaben fertig<br />
werden können, die Wünsche unserer Kranken<br />
zu erfüllen. Bevor wir an die Konsequenzen<br />
für uns selbst denken, steuert unser Mitgefühl<br />
mit den Kranken und unser Sich-in-sie-Hineinversetzen<br />
unser Denken und Handeln. Herausforderungen<br />
an uns Ärzte, die dem New England<br />
Journal of Medicine entnommen sind, gehören<br />
überhaupt nicht<br />
in den Kontext unserer<br />
Absichten. Wir wollten<br />
in unserem Artikel zum<br />
Nachdenken anregen,<br />
sterbewilligen Leidenden<br />
auf deren Wunsch bestimmte<br />
Hilfen zu geben.<br />
Wir wollten auch versuchen,<br />
zur gesetzlichen<br />
und moralischen Entkriminalisierung<br />
der Hilfeleistenden<br />
beizutragen.<br />
(Foto: BilderBox)<br />
Dres. Wally und Horst Hagen,<br />
Nordmeerstr. 13, 23570<br />
Travemünde<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 47
kammer-info <strong>aktuell</strong><br />
48<br />
Der Irrtum<br />
Oder die Flucht nach vorn<br />
Heinz-Peter Sonntag<br />
Laut „Deutschem Ärzteblatt“ hat die Gesundheitsministerin<br />
Ulla Schmidt anlässlich einer<br />
Pressekonferenz in Berlin festgestellt: „Innerhalb<br />
der Selbstverwaltung wird inzwischen offen<br />
über ärztliche Behandlungsfehler geredet.“<br />
Ich erinnere mich an folgenden Fall: Er ist über<br />
35 Jahre her und damit in jeder Richtung verjährt.<br />
In einem reinen Belegkrankenhaus ist der Donnerstag<br />
immer ein sehr beliebter Operationstag,<br />
da die Entlassung der Vorpatienten am Mittwoch<br />
einen einigermaßen freien Nachmittag<br />
beschert. So auch an diesem Donnerstag. Ich<br />
war mit meinen vier Tonsillektomien vor Sonnenaufgang<br />
dran. „Sven“ war die vierte und<br />
letzte Operation - entsprechend der Anamnese,<br />
dass die Mandelausschälung dringend erforderlich<br />
erschien. Der junge Patient wurde in den<br />
Op geschoben und antwortete auf mein „Hallo<br />
Sven!“ - kein Protest wegen des - wie sich später<br />
herausstellte - falschen Namens.<br />
Nach Intubation und Legen des Mundsperrers<br />
erschienen mir die Tonsillen sehr unauffällig<br />
und ich ließ<br />
auf der Stationnachfragen<br />
- „Ja, es<br />
sei Sven!“<br />
(Foto: BilderBox)<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
Sven war am Vorabend eingeliefert worden zusammen<br />
mit einem gleich Großen und gleich<br />
Altrigen (Geburtstag in der gleichen Woche,<br />
im gleichen Jahr) und ebenfalls hellblond, doch<br />
der „Kollege“ sollte an der Phimose operiert<br />
werden.<br />
So passierte der Irrtum schon bei der Einlieferung<br />
und Namensfixierung am Bett, auf dem<br />
natürlich auch die falsche Krankenakte lag.<br />
Nach der Bestätigung durch die Station hatte<br />
ich dann die Mandeln entfernt und bin - so<br />
früh am Morgen - nach Hause auf eine Tasse<br />
Kaffee. Vor meiner Tür stand meine Frau - wir<br />
hatten weder Handy noch (wie später) Funk -<br />
und schickte mich eilens zurück - ohne Rücksicht<br />
auf Verkehrsregeln. Nun stellte sich heraus,<br />
dass der richtige Sven keine Phimose hatte<br />
und eine Putzhilfe als Nachbarin des einen<br />
Knaben den Irrtum richtigstellte.<br />
Nachdem ich dann „meinem“ Patienten die<br />
Mandeln entfernt hatte, erfuhr ich, dass der<br />
Vater Journalist bei einer großen bebilderten<br />
Boulevardzeitung war, nicht sehr arztfreundlich<br />
und auf jeden Fall gegen Mandelausschälungen.<br />
Ich habe mich dann auf den Weg zu den Eltern<br />
gemacht. Wir hatten ein relativ sachliches Gespräch<br />
und ich nahm alle Verantwortung auf<br />
mich.<br />
In der kommenden Woche wurde der „falsche<br />
Patient“ wie ein rohes Ei behandelt. Nach Entlassung<br />
musste er sich noch einmal in der Praxis<br />
vorstellen. Unter dieser war ein Spielwarenladen<br />
und gegen den Willen der Mutter war ein<br />
Speisewagen für die elektrische Eisenbahn fällig.<br />
Ich habe ihn dann nie mehr gesehen und<br />
von dem Zwischenfall nie wieder etwas gehört.<br />
Die Pointe: Mit der Flucht nach vorn und Ehrlichkeit<br />
fährt man am besten.<br />
Dies erinnert mich an meinen alten Chef und<br />
Lehrer, der bei Fehlern, die in einer großen Klinik<br />
unweigerlich vorkommen, nach sachlicher<br />
Diskussion immer fragte: „Steht es in der Krankengeschichte?“<br />
Dr. Heinz-Peter Sonntag, Niobestr. 9,<br />
23570 Lübeck
Ausbildung von<br />
Medizinischen Fachangestellten<br />
auch im Krankenhaus möglich<br />
Patienten(innen) sollen in den Krankenhäusern<br />
bestmöglich versorgt werden! Das wünschen<br />
sich alle, die in den Krankenhäusern arbeiten<br />
und vor allem auch diejenigen, die dort versorgt<br />
werden müssen, also die Patienten(innen). Leider<br />
sind oft genug gerade auch Ärzte(innen)<br />
durch Aufgaben, die nicht primär ärztliche Aufgaben<br />
sind, belastet.<br />
Durch die Einstellung von geeignetem Assistenzpersonal<br />
kann den auf Station arbeitenden<br />
Ärzte(innen) wieder stärker reine ärztliche Tätigkeit<br />
ermöglicht werden. Die Einhaltung des<br />
Arbeitszeitgesetzes ist dann eher möglich und<br />
die Ableistung von Überstunden kann vermindert<br />
werden.<br />
Ärzte(innen) können wieder mehr als bisher<br />
den Patienten(innen) zur Verfügung stehen.<br />
Das ist nicht zuletzt auch ein Gewinn für das<br />
Ansehen des Krankenhauses bei Patienten.<br />
Seit einigen Jahren besteht daher die Möglichkeit<br />
der Ausbildung von Arzthelferinnen (jetzt<br />
Medizinische Fachangestellte) auch im Krankenhaus.<br />
Die Berufsausbildung erfolgt im dualen<br />
Ausbildungssystem, d. h. die praktische<br />
Ausbildung in Einrichtungen der stationären<br />
kammer-info <strong>aktuell</strong><br />
medizinischen Versorgung. Darüber hinaus erfolgt<br />
die theoretische Ausbildung in der Berufsschule<br />
mit ein- bzw. zweitägigem Berufsschulunterricht.<br />
Dieses wird ergänzt durch überbetriebliche<br />
Ausbildungsmaßnahmen im Edmund-<br />
Christiani-Seminar, der Berufsbildungsstätte der<br />
<strong>Ärztekammer</strong> <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>. Ein zusätzliches<br />
Praktikum in einer Arztpraxis rundet den<br />
praktischen Teil der Ausbildung ab. Die Abschlussprüfung<br />
erfolgt bei der <strong>Ärztekammer</strong><br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, der zuständigen Stelle nach<br />
dem Berufsbildungsgesetz.<br />
Um noch geeignete Schulabgänger(innen) für<br />
den Ausbildungsstart im August 2007 vertraglich<br />
zu binden, sollten jetzt so schnell wie möglich<br />
entsprechende Anzeigen geschaltet und/<br />
oder die zuständige Arbeitsverwaltung über freie<br />
Ausbildungsstellen informiert werden.<br />
Informationsmaterial und die erforderlichen<br />
Ausbildungsverträge verschickt die <strong>Ärztekammer</strong><br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, Tel. 04551/803-0.<br />
Weitere Informationen sind bei der <strong>Ärztekammer</strong><br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, Christine Gardner, unter<br />
Tel. 04551/803-135, zu erhalten. (Br)<br />
Anzeige<br />
Anzeige<br />
Quintessenz<br />
Schloss Akademie<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 49<br />
(Foto: BilderBox)
kammer-info <strong>aktuell</strong><br />
50<br />
(Fotos: wl)<br />
Sucht und Migration<br />
Geht es um das Thema Sucht und Migration,<br />
lässt sich feststellen, dass die Versorgung der abhängigen<br />
Menschen mit Migrationshintergrund<br />
unzureichend ist. Das stellte Prof. Dr. Christian<br />
Haasen, Direktor des Zentrums für Interdisziplinäre<br />
Suchtforschung an der Universität Hamburg,<br />
während einer Pressekonferenz bei den 12.<br />
Suchttherapietagen fest. Weitere Schwerpunkte<br />
des Kongresses: die Prävention des Rauchens<br />
und das Rauschtrinken in einem Teil der Jugendkultur.<br />
Christian Bölckow (re.)<br />
Prof. Dr. Christian Haasen (li.)<br />
Nach den Worten von<br />
Ramazal Salmann, Soziologe am Ethno-Medizinischen<br />
Zentrum in Hannover, sind dort vor<br />
neun Jahren spezielle Angebote zum Schwerpunkt<br />
Migranten und Gesundheitswesen entwickelt<br />
worden: „In Deutschland leben 15 Millionen<br />
Menschen mit Migrationshintergrund, in<br />
Frankfurt sind es 38, in Stuttgart knapp 40 Prozent<br />
der Bevölkerung. Die Sucht ist inzwischen<br />
bei den Migranten angekommen.“ Die Suchthilfe<br />
aber erreiche nur zwischen 10 und 15 Prozent<br />
dieser Menschen. Nötig seien ein Professionalisierungsschub,<br />
mehr Fortbildung, mehr Forschung.<br />
„Wir brauchen zudem mehr Prävention - schwierig<br />
bei dieser Klientel, bei der der Suchtbereich<br />
tabuisiert ist.“ Es komme darauf an, die Familien<br />
mehr anzusprechen. Von Hannover aus sind<br />
Präventionsmodelle geschaffen worden, die inzwischen<br />
- von Kiel bis München - 24 Städte erreichen,<br />
unterstützt von den Krankenkassen<br />
und den Kommunen: „Wir haben eine Tür aufgemacht<br />
für Menschen aus rund 50 Nationen“,<br />
erklärt Ramazal Salmann, der Sucht als einen<br />
gestörten Integrationsprozess bezeichnet. Zum<br />
Modell gehören Kurse für Menschen (ebenfalls<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
mit Migrationshintergrund), die in ihre Kreise<br />
gehen und das Thema Sucht ansprechen - es<br />
gibt Veranstaltungen, an denen beinahe überall<br />
in Deutschland auch Ärzte teilnehmen. „Sie bereiten<br />
sich auf ihre künftige Aufgabe bei diesen<br />
Patienten vor, sie sehen sich bereits als Ansprechpartner“.<br />
Hier ist ein guter Weg beschritten<br />
worden, der Weg direkt in die Bevölkerung.<br />
Zum Thema Rauchen und Raucherschutz stellte<br />
Hermann Schlömer vom Suchtpräventionszentrum<br />
(SPZ) fest, derzeit rauchten fast 20<br />
Prozent der 11- bis 17-Jährigen. Er verwies auf<br />
Argumentationshilfen vom Krebsforschungszentrum<br />
Heidelberg, etwa das erhöhte Risiko für<br />
Menschen, die sich in berauchten Innenräumen<br />
aufhalten, an Herz-Kreislaufstörungen zu erkranken.<br />
Die jetzt vorbereiteten Gesetze seien<br />
Schritte in die Zukunft, sie stärkten den Nichtraucherschutz.<br />
Christian Haasen erinnerte daran,<br />
dass Rauchen zwar als Krankheit anerkannt<br />
sei, dass aber zugleich notwendige Therapiemaßnahmen<br />
(etwa auch medikamentöser Art)<br />
nicht von der Kassen bezahlt würden: „Der Arzt<br />
muss da Umwege machen, denn eigentlich sind<br />
die erforderlichen Maßnahmen eindeutig kurativ,<br />
bezahlt aber wird nur die Prävention.“<br />
Zum Rauschtrinken bei Jugendlichen sagte<br />
Christian Bölckow von der Hamburgischen<br />
Landesstelle für Suchtfragen, derzeit würden alle<br />
Kinder und Jugendlichen direkt angesprochen,<br />
wenn sie mit einer Alkoholvergiftung ins<br />
Krankenhaus eingeliefert würden. „Wir fordern<br />
zudem Warnhinweise auf den Flaschen, die diese<br />
Altersgruppe ansprechen. Wir fordern, dass<br />
das Ladenpersonal akustisch aufgefordert wird,<br />
mehr auf diese Altersgruppe zu achten, und wir<br />
wünschen uns verstärkt Testkäufe. Die Eltern<br />
sollten sich verstärkt melden, wenn sie bemerken,<br />
dass ihren Kindern Alkohol verkauft worden<br />
ist.“<br />
Wenn Sucht ein Zeichen von gescheiterter Integration<br />
ist, so Christian Haasen, „dann erinnere<br />
ich an die Heroinstudie - selbst konservative<br />
Politiker haben sich von den Erfolgen<br />
dieser Studie überzeugen lassen, als ihnen klar<br />
wurde, dass die so behandelten Menschen zum<br />
großen Teil wieder in die Gesellschaft integriert<br />
worden sind“. (wl)
Schlichtungen in Arzthaftpflichtfragen<br />
kammer-info <strong>aktuell</strong><br />
Die Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen der norddeutschen <strong>Ärztekammer</strong>n, Hans-Böckler-Allee 3,<br />
30173 Hannover, Tel. 0511/3802416, ist eine Einrichtung der <strong>Ärztekammer</strong>n zur außergerichtlichen Beilegung<br />
von Streitigkeiten zwischen Ärzten und Patienten wegen behaupteter Behandlungsfehler unter Beteiligung<br />
des Haftpflichtversicherers des betroffenen Arztes. Die Schlichtungsstelle hat bei folgenden Anträgen<br />
aus <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> einen Behandlungsfehler bejaht:<br />
Gebiet<br />
Anlass der ärztlichen<br />
Tätigkeit<br />
Gefäßchirurgie Hüft-TEP-Lockerung<br />
HNO Heilkunde Allergische Rhinopathie<br />
Innere Medizin Aortenklappenendokarditis<br />
Ärztliche Maßnahme Vermeidbarer<br />
ärztlicher Fehler<br />
Hüft-TEP-Wechsel,<br />
Osteotomie des Femur,<br />
postoperative Diagnostik<br />
(gefäßchirurgisches<br />
Konsil, Dopplersonographie)<br />
Antiallergische Behandlung,<br />
technische<br />
Durchführung der Injektionen<br />
Innere Medizin Appendizititis Klinische Diagnostik,<br />
radiologische Diagnostik<br />
(Sonographie), Labordiagnostik,diagnostische<br />
Laparotomie<br />
Innere Medizin Zustand nach Herzinfarkt,<br />
Pneumonie,<br />
Dekubitus<br />
Orthopädische<br />
Chirurgie<br />
Orthopädische<br />
Chirurgie<br />
Therapieresistente<br />
Schmerzen in der<br />
Schulter<br />
Mukoidzyste am<br />
Endgelenk des<br />
Ringfingers, veraltete<br />
Schnittverletzung<br />
über dem Mittelgelenk<br />
des Zeigefingers<br />
mit Strecksehnenbeteiligung<br />
Pathologie Gastrointestinaler<br />
Stromatumor<br />
(GIST)<br />
Unfallchirurgische<br />
Orthopädie<br />
Karpaltunnelsyndrom<br />
Auf Durchblutungsstörungen<br />
(Nekrosen, typischer<br />
Schmerz in Fuß und Wade)<br />
nicht mit Diagnostik<br />
des arteriellen Systems reagiert<br />
Fehlerhafte Volon A-Injektion<br />
(bezüglich Injektionsort<br />
und Injektionstiefe)<br />
Diffenzialdiagnostik Keine Diagnostik bei rezidivierendem<br />
Fieber, kein<br />
fächärztliches Konsil<br />
Therapie des Dekubitus,<br />
Frage der häuslichen<br />
Entlassung, Kommunikation<br />
Arzt und<br />
Angehörige<br />
Infiltrationstherapie,<br />
Kontrolle<br />
Operative Entfernung<br />
der Mukoidzyste,<br />
Wundbehandlung der<br />
Schnittwunde<br />
Histologische Beurteilung<br />
der Präparate<br />
Operative Dekompression<br />
des Medianusnerven<br />
am Handgelenk<br />
Verzögerte Indikationsstellung<br />
zur diagnostischen<br />
Laparotomie<br />
Fehlerhafte Lokalbehandlung,<br />
Entlassung in kritischem<br />
Zustand (Dekubitus,<br />
kardiale Verschlechterung)<br />
Predni-H dreimal innerhalb<br />
einer Woche gegeben,<br />
keine Aufklärung über Risiko<br />
der Infektion<br />
Intraoperative Schädigung<br />
des Strecksehnenansatzes<br />
am Ringfingerendglied,<br />
Übersehen einer Streckerkappenverletzung<br />
über<br />
dem Mittelgelenk des Zeigefingers<br />
Keinen Referenzpathologen<br />
eingeschaltet, keine<br />
Überprüfung des Tumors<br />
mit dem Antikörper CD<br />
117<br />
Eröffnung der Guy’schen<br />
Loge statt des Karpaltunnels<br />
wegen falscher Schnittführung<br />
Schaden<br />
Unterschenkelamputation,<br />
mehrere Wochen Schmerzen,<br />
Nekrosen am Fuß,<br />
Abtragung<br />
Kosmetisch störende Gewebsatrophien<br />
Lungenödem, lange intensivmedizinische<br />
Betreuung<br />
Verzögerung einer Appendektomie<br />
um vier Tage,<br />
unnötig ertragene Schmerzen<br />
Verschlechterung und Vergrößerung<br />
des Dekubitus,<br />
dadurch vermehrte Beschwerden<br />
und Beeinträchtigung<br />
des Allgemeinbefindens<br />
über eine Woche bis<br />
zum Tod<br />
Infektion im Schultergelenk<br />
Streckbehinderung des<br />
Ringfingerendgliedes,<br />
Greifbehinderung durch<br />
Ausbildung einer Knopflochdeformität<br />
des Zeigefingers<br />
Unnötige Zweitoperation,<br />
vermehrte psychische Belastung<br />
durch Kenntnis der<br />
Diagnoseverzögerung<br />
Funktionsausfall des tiefen<br />
Profundusastes des Nervus<br />
ulnaris mit Greifschwäche<br />
und Streckbehinderung der<br />
ulnaren Finger<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 51
kammer-info <strong>aktuell</strong><br />
52<br />
Da wir in Heft 5 des <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>ischen Ärzteblattes einen Absatz dieses Beitrages „unterschlagen“<br />
hatten, hier die Rezension noch einmal:<br />
Tod in Afrika. Mein Leben gegen AIDS<br />
Mit einem Vorwort von Nelson Mandela<br />
Bibliographische Angaben: Edwin Cameron, Verlag CH. Beck, München 2007,<br />
256 Seiten, 19,90 Euro, ISBN 978-3-406-54982-3<br />
Nelson Mandela hat den Kampf gegen AIDS als nächste große Herausforderung<br />
Südafrikas und nach dem Ende der Apartheid bezeichnet. Dass dies nicht übertrieben<br />
ist, zeigt Edwin Camerons Buch, das in Südafrika sofort zum Bestseller wurde.<br />
Edwin Cameron, geboren 1953 in Südafrika, begann seine Karriere als Anwalt für<br />
Menschenrechte im Kampf gegen die Apartheid. In Nelson Mandelas Südafrika<br />
stieg er schnell in hohe Richterämter auf und wirkte beim Aufbau der neuen Institutionen<br />
mit. Heute ist er Richter am obersten Berufungsgericht Südafrikas und<br />
zugleich einer der führenden AIDS-Aktivisten Afrikas.<br />
Edwin Cameron hat AIDS. Für einen Südafrikaner ist das eigentlich ein Todesurteil.<br />
Denn dort erhält nur ein Bruchteil der etwa vier bis fünf Millionen Menschen<br />
mit HIV oder AIDS eine angemessene medizinische Versorgung. Ohne eine<br />
antiretrovirale Therapie beträgt die Lebenserwartung nach Beginn der AIDS-<br />
Erkrankung selten mehr als einige Jahre. Doch Edwin Cameron lebt, obwohl<br />
AIDS bei ihm bereits 1997 diagnostiziert wurde. Denn er ist privilegiert. Er ist weiß, hat eine gut dotierte<br />
Tätigkeit und seine Krankenversicherung zahlt die lebensrettenden Medikamente, mit denen die HI-Viren in<br />
Schach gehalten werden können.<br />
Aber Edwin Cameron möchte nicht privilegiert sein. Er möchte, dass alle Menschen mit AIDS, in Südafrika<br />
und anderswo, ob reich oder arm, medizinisch adäquat versorgt werden, damit das massenhafte vorzeitige<br />
Sterben ein Ende hat. Dafür setzt sich Edwin Cameron seit vielen Jahren in Vorträgen, bei Konferenzen und<br />
auf Rundreisen in Südafrika und anderen Ländern ein.<br />
2005 hat er das Buch geschrieben, das nun endlich auf Deutsch erschienen ist. Darin klagt er diejenigen an,<br />
die die Verantwortung für das Massensterben tragen. Allen voran sind dies die westlichen Pharmakonzerne,<br />
die sich weigern, die Preise für die antiretroviralen Medikamente ausreichend zu senken und mit Unterstützung<br />
ihrer Regierungen die Einhaltung von Patentschutzregelungen durchzusetzen versuchen, die enorme<br />
Profitraten sicherstellen. Aber auch die südafrikanische Regierung um Präsident Mbeki trägt Schuld, da sie<br />
sich jahrelang die Position der so genannten AIDS-Dissidenten zu eigen gemacht hatte, wonach AIDS nicht<br />
durch das HI-Virus hervorgerufen werde, sondern eine Armuts- und Umweltkrankheit sei oder das Ergebnis<br />
des „Lebensstils“ vieler Schwuler (zu viel Sex, zu viele Partys, zu viele Drogen). Auch die antiretroviralen<br />
Medikamente wie AZT werden als AIDS-Verursacher in Betracht gezogen.<br />
Nicht nur aufgrund seiner persönlichen Erfahrung setzt sich Edwin Cameron mit den Positionen der AIDS-<br />
Dissidenten und der ANC-Regierung in dieser Frage offensiv und mit Herzblut auseinander. Seinen Argumentationen<br />
ist auch anzumerken, dass er sich intensiv mit den wissenschaftlichen Forschungsergebnissen<br />
auseinandergesetzt hat, aus denen abzuleiten ist, dass AIDS die Folge einer Zerstörung des Immunsystems<br />
durch das HI-Virus ist und aufgehalten werden kann durch eine antiretrovirale Kombinations-Therapie.<br />
Es gibt noch ein weiteres Übel, gegen das Cameron anschreibt, nämlich die Stigmatisierung derjenigen, die<br />
an AIDS erkranken. Die soziale Ächtung führt zu Diskriminierung und Ausgrenzung, Verfolgung und Gewalt.<br />
Das Stigma hat so eine enorme Kraft, weil AIDS eine sexuell übertragbare Erkrankung ist. Edwin Cameron<br />
hat selbst viele Jahre gebraucht, bevor er seine Erkrankung öffentlich machte.<br />
Nelson Mandela schreibt am Schluss seines Vorwortes: „Mit dem öffentlichen Bekenntnis zu seiner HIV-Infektion<br />
hat Edwin Cameron großen Mut bewiesen. Er gibt uns allen ein Beispiel dafür, dass man mit dieser<br />
Infektion leben und weiterhin Großes zur Verbesserung des Lebens aller leisten kann.“ Und die Nobelpreisträgerin<br />
Nadine Gordimer schreibt zu diesem Buch: „Wenn Wahrheit Schönheit ist, dann ist dieses brillante<br />
und unnachgiebig hoffnungsvolle Buch schön. Es ist ein Text, nach dem wir leben können, wenn wir nach<br />
der Möglichkeit eines besseren Lebens für alle streben.“ Diesem Lob kann ich mich nur anschließen.<br />
Rezensent: Prof. Dr. Klaus-Dieter Kolenda, Villenweg 21, 24119 Kronshagen<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007
In den guten alten<br />
Zeiten<br />
mühten wir<br />
Hausärzte uns<br />
mit Preisvergleichen<br />
per PC ab,<br />
um billige Generika<br />
zu verordnen.<br />
Heute<br />
können wir<br />
dank der tollen<br />
Ideen aus der Gesundheitsministerialbürokratie<br />
ganz neue Wege beschreiten,<br />
und Rezeptpapier kann<br />
der Hausarzt gleich mehrfach bearbeiten:<br />
Die Apothekerin ruft mich<br />
an, denn das rezeptierte und günstige,<br />
dem Patienten vertraute Präparat<br />
darf sie nicht rausgeben. Die<br />
Kasse A hat einen Rabattvertrag<br />
mit der Firma B geschlossen, wonach deren<br />
Präparate an die Kassenmitglieder verbilligt<br />
abgegeben werden. Nun kann leider die Firma<br />
bei dem Ansturm gar nicht liefern. Wer da wohl<br />
dumm aus der Wäsche guckt? Weisse Bescheid?<br />
Der Patient kommt wieder und benötigt ein<br />
Aut-idem Kreuz für das nicht Aut-idem-Präparat.<br />
Heute bedeutet ja „aut idem“ genau das Gegenteil,<br />
nämlich nicht das wirkstoffgleiche, sondern<br />
genau das benannte Präparat soll ausgeben<br />
werden. Weisse Bescheid?<br />
Das ist dem Patienten jetzt zu doll, er muss noch<br />
in die Stadt und löst dort sein Rezept ein. Da<br />
aber ist das „aut idem“ angekreuzte Präparat<br />
nicht vorrätig. Der Patient kommt entnervt<br />
wieder und möchte sein altes Präparat aufs Rezept.<br />
Weisse Bescheid, wer jetzt Erklärungen abliefert?<br />
Es soll Patienten geben, die mehr als drei Präparate<br />
brauchen. Das ergibt ungeheure Möglichkeiten<br />
der Kombination von nicht erfüllbaren<br />
Präparatwünschen des Hausarztes (inzwischen<br />
sind über 100 Kassen mit 12 000 Präparaten<br />
vertreten).<br />
Betäubungsmittelrezepte mit zwei Durchschlägen<br />
könnten die neuen Renner beim Papierverbrauch<br />
werden. Allerdings ist Vorsicht geboten:<br />
Verordnungen von Fentanylpflaster z. B. könn-<br />
Rezepte - Rabatte -<br />
weisse Bescheid?<br />
Anndreas Krueger<br />
gesundheits- und sozialpolitik<br />
ten ab Stärke 75 ym/h aufgrund der Höchstverordnungsmenge<br />
von mehr als 17 mg/Pflaster<br />
sogar strafrechtlich relevant werden.<br />
Sollte ich da nicht<br />
besser gleich jedes Mal<br />
in der Apotheke nachfragen,<br />
welches Präparat<br />
abgabefähig ist,<br />
bevor ich mir irgend-<br />
eine Arbeit mache?<br />
Vereinfachen könnten<br />
wir Niedergelassene den<br />
Vorgang auch, indem<br />
wir uns in den Apotheken-Computereinloggen,<br />
um uns nach deren<br />
Warenbestand zu richten.<br />
Weisse Bescheid?<br />
Gott sei Dank wollen die<br />
meisten Kassen sparen<br />
und deshalb flattern uns<br />
dauernd Briefe von verschiedenen Kassen und<br />
dann noch von jeder Pharmaklitsche ins Haus,<br />
um uns zu informieren - oder besser zu desinformieren,<br />
denn die versteckte Werbung verdeckt<br />
die Misere der nicht bekannten Rabatthöhen.<br />
Und sollten Wirtschaftlichkeitsprüfungen erfolgen,<br />
würden die Bruttopreise der rabattierten<br />
Präparate bei der Erstdurchsicht zugrundegelegt?<br />
Weisse Bescheid?<br />
So kann der Doktor im Dunklen rumstochern,<br />
denn ob Preis rauf oder runter, mal mehr Rezepte<br />
für ein Präparat gedruckt oder noch mehr Telekommunikation<br />
mit der Apotheke - Geld<br />
spielt ja nur insofern eine Rolle, dass der Doktor<br />
fürs Budget haftet.<br />
Knallhart nachgefragt: Bekanntlich ist Absurdistan<br />
schon lange Teil unserer Republik, wann<br />
kommt endlich die Gesundheitskarte und das<br />
E-Rezept, damit der Verbund der Gesundheitsalleswisser<br />
dem Hausarzt den Rest geben kann?<br />
Wer von den „Machern“ glaubt denn, dass von<br />
Hausärzten noch elektronisch Daten gepflegt<br />
werden können oder auch nur die <strong>aktuell</strong> korrekten<br />
Medikamentennamen auf den Chip gelangen?<br />
Und - wer lässt sich das wie lange noch gefallen?<br />
Dr. Andreas Krueger, Gartenstr. 2, 25379 Herzhorn<br />
(Foto:BilderBox)<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 53
gesundheits- und sozialpolitik<br />
54<br />
Die Verantwortung des Staates<br />
und die Freiheit der Bürger<br />
Wolfgang Kersting<br />
Anfangs, so heißt es in der kantischen Erzählung<br />
vom mutmaßlichen Anfang der Menschengeschichte,<br />
anfangs leitete der natürliche Instinkt,<br />
„diese Stimme Gottes”, den Menschen,<br />
und alles war gut. Dann „fing aber die Vernunft<br />
bald an sich zu regen“ und der Mensch „entdeckte<br />
in sich ein Vermögen, sich selbst eine<br />
Lebensweise auszuwählen und nicht gleich anderen<br />
Thieren an eine einzige gebunden zu<br />
sein”. Diese neugewonneneFreiheit<br />
ist aber mehr<br />
Last als Lust; die<br />
Maßlosigkeit birgt<br />
in sich die Gefahr<br />
der Selbstzerstörung.<br />
Um diese<br />
abzuwenden, muss die emanzipierte Vernunft<br />
das Erhaltungspensum, die bislang durch die<br />
Natur erbracht worden ist, selbst auf sich nehmen.<br />
Die emanzipierte Vernunft muss zu einer<br />
kompensatorischen Vernunft werden. Sie muss<br />
Ersatz schaffen für das mit der Geburt der Freiheit<br />
weggefallene Naturregiment. Sie muss die<br />
in Unordnung geratene Begehrlichkeit durch eine<br />
Ordnung des Begehrens besänftigen, der<br />
Freiheit ohne natürliches Maß durch eine Verfassung<br />
des Handelns Gestalt geben.<br />
Wäre die Erdoberfläche ein unendlicher Raum,<br />
dann könnten sich die Menschen verlaufen, ohne<br />
einander ins Gehege zu kommen, ohne einander<br />
bei der Befriedigung ihrer Wünsche zu<br />
stören. Doch wir leben unter Knappheitsbedingungen,<br />
daher sind Interessenkollisionen und<br />
Verteilungskonflikte unvermeidlich. Daher bedarf<br />
es wirksamer Regeln, die gewaltfreie Koexistenz<br />
sichern, die Handlungen koordinieren<br />
und über die Berechtigung von Ansprüchen im<br />
Konfliktfall entscheiden und dadurch die gewaltfreie<br />
Koexistenz der Menschen sichern.<br />
„Das erste, was der Mensch tun muss, ist dass er<br />
Freiheit unter Gesetze der Einheit bringt; denn<br />
ohne dies ist sein Tun und Lassen lauter Verwirrung“.<br />
Man kann Kants menschheitsgeschichtlichen<br />
Anfang als liberale Urszene deuten. Sie entwickelt<br />
in äußerster Prägnanz die Grammatik liberalen<br />
Ordnungsdenkens unter den Gegebenheiten<br />
von Freiheit und Knappheit. Drei fundamentale<br />
Grundsätze lassen sich ausmachen: 1.<br />
Ordnung ist eine anthropologische Unerlässlichkeit.<br />
2. Diese Ordnung muss als Ordnung<br />
der Freiheit verstanden und entwickelt werden,<br />
als Regelwerk der Handlungskoordination, als<br />
Rahmenwerk der Konkurrenz, die ein spannungsvolles<br />
Zugleich von Wettbewerb und Kooperation<br />
ermöglicht. 3. Eine Ordnung ist nur<br />
dann eine Ordnung der Freiheit, wenn sie nicht<br />
nur Freiheit ordnet, sondern auch selbst Aus-<br />
Prof. Dr. phil. Wolfgang Kersting hielt dieses Referat am 10.05.2007 anlässlich<br />
des Jahresempfanges des Landesverbandes der Freien Berufe in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
im Kieler Schloss. Prof. Kersting ist geschäftsführender Direktor<br />
des Philosophischen Seminars der Kieler Universität. Sein Forschungsschwerpunkt<br />
ist die politische Philosophie, dabei beschäftigt er sich vor allem mit<br />
den Themen Sozialstaat, Gerechtigkeit und Gesellschaftsordnung. (Foto: rat)<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
druck der Freiheit ist, wenn sie sich der Selbstgesetzgebung<br />
der ihr unterworfenen Individuen<br />
verdankt.<br />
Erst der Staat lässt uns leben, gibt uns Zukunft.<br />
Politik ist die dauerhafte Beendigung von Ausnahmezustand<br />
und Grenzsituation. Daher kann<br />
der Wechsel vom Naturzustand zum Staat auch<br />
als Übergang von der Notwendigkeit der Überlebenssicherung<br />
zur Möglichkeit der Lebensführung<br />
charakterisiert werden. Die politische Ordnung<br />
setzt die Herrschaft der Normalität durch;<br />
und Normalität herrscht dann, wenn durch die<br />
staatlichen Sicherheitsleistungen und die Festigkeit<br />
der Institutionen die basalen Voraussetzungen<br />
für menschliches Glück und Handlungserfolg,<br />
für existenzielle Selbstentwicklung und<br />
ethische Selbstverwirklichung zur unauffälligen<br />
Selbstverständlichkeit geworden sind, wenn Gewalt<br />
aus dem zwischenmenschlichen Raum verbannt<br />
ist, Zukunftsvertrauen besteht, Erwartun-
gen handlungsleitende Stabilität gewinnen und<br />
wechselseitige Verlässlichkeit herrscht. Aber<br />
nur dann findet diese staatliche Ordnung allseitige<br />
Zustimmung, wenn sie nicht der Durchsetzung<br />
besonderer moralischer, ethischer oder religiöser<br />
Vorstellungen dient, sondern ausschließlich<br />
eine Ordnung der Handlungsfreiheit ist, die<br />
jedem einen gleich großen Freiheitsraum zuteilt,<br />
in dem er in völliger ethischer und religiöser<br />
Unabhängigkeit sein Leben gestalten kann. Und<br />
dann ist diese Gesetzesordnung eine Ordnung<br />
der Freiheit, wenn die Gesetze ihre Legitimität<br />
von der Zustimmung der Bürger abhängig machen,<br />
wenn sie demokratischer Natur ist.<br />
Für Wilhelm von Humboldt, Kant und den<br />
klassischen Liberalismus war mit der Errichtung<br />
einer rechtsstaatlich organisierten und demokratisch<br />
regierten Marktgesellschaft das Ziel der<br />
Politik erreicht. Allen Forderungen der Gerechtigkeit<br />
war in einer solchen Ordnung Genüge<br />
getan. Diejenigen, die mehr Gerechtigkeit wollten,<br />
als Rechtsstaat und Marktgesellschaft lieferten,<br />
als die Gleichheit vor dem Preis und die<br />
Gleichheit vor dem Recht garantieren konnte,<br />
durften sich nicht mehr an die Politik wenden;<br />
sie mussten zur Religion ihre Zuflucht nehmen<br />
und auf die Kompensationsleistungen postmortaler<br />
Sanktions- und Gratifikationssysteme - also<br />
auf himmlische Belohnung und höllische Bestrafung<br />
- hoffen.<br />
Jedoch bei dieser Arbeitsteilung zwischen irdischer<br />
Freiheitsordnung und jenseitiger Heilserfüllung<br />
ist es nicht geblieben. Der Anspruch an<br />
die institutionellen Rahmenbedingungen individueller<br />
Lebensplanung ist in der individualistischen<br />
Moderne unaufhörlich gestiegen. Der Bereich<br />
der politischen Verantwortlichkeit weitete<br />
sich stetig. Der Rechts- und Verfassungsstaat<br />
wandelte sich zum Sozialstaat, der tief in die<br />
wirtschaftlichen Abläufe und gesellschaftlichen<br />
Beziehungen der Menschen eingriff. Die Verantwortlichkeiten<br />
der Bürger wurden ausgedünnt,<br />
die Zuständigkeiten des Staates hingegen<br />
wuchsen weiterhin. Kämpfte er ursprünglich<br />
an den Grenzen der Normalität gegen den<br />
eindringenden Naturzustand, so wurde er im<br />
Gewand des Sozialstaats, unter den Bedingungen<br />
demokratischer Herrschaft, die eine hemmungslose<br />
Selbstklientelisierung der Bürger be-<br />
gesundheits- und sozialpolitik<br />
günstigte, allgegenwärtig, aufdringlich. Eine stetig<br />
wachsende Bürokratie der Betreuung und<br />
Beobachtung entstand. Anfänglich ging es nur<br />
um die Domestikation des Leviathans, um den<br />
Schutz der Bürger vor dem Golem, den sie selbst<br />
geschaffen hatten, um sich voreinander zu<br />
schützen. Durch institutionelle Fesseln unterschiedlichster<br />
Art wurde seine Bewegungsfreiheit<br />
eingeschränkt. Seine wilde Natur wurde<br />
durch die Moral der Menschenrechte besänftigt;<br />
und sein entschlossen zupackendes, entscheidungsschnelles<br />
Wesen durch die mühselige<br />
Konsensfindungsmaschinerie der demokratischen<br />
Organisationen gelähmt. Doch mit der<br />
Einrichtung und dem unvermeidlichen Ausbau<br />
des Sozialstaats endete dieser Prozess der Selbstermächtigung<br />
der Bürger. Es kam zu einer Erneuerung<br />
des leviathanischen Tauschgeschäfts.<br />
Jetzt jedoch wurde nicht Lebensschutz gegen<br />
Gehorsam getauscht, sondern Loyalität mit der<br />
Sicherung dynamisierter Lebensqualität vergolten.<br />
So wurde es zur bürgerlichen Gewohnheit,<br />
den Staat für alle Lebensumstände verantwortlich<br />
zu machen, ihn, wie früher die Götter, als<br />
Schutz gegen alle Widrigkeiten des Schicksals<br />
anzurufen.<br />
Die von den Politikern der demokratischen Parteien<br />
gern aufgegriffene und selbstsüchtig bekräftigte<br />
Totalverantwortlichkeitsunterstellung<br />
ist der Reflex eines begrifflich diffusen und normativ<br />
vagen Legitimationskonzepts, das Maßlosigkeit<br />
begünstigt und allen Begehrlichkeiten<br />
moralische Rückendeckung verspricht. Sozialstaatliche<br />
Staatszweckbestimmung schwankt<br />
zwischen den Zielen der Daseinsfürsorge und<br />
der Verteilungsgerechtigkeit, zwischen kompensatorischer<br />
Ungleichheitsminderung und Chancengleichheit,<br />
zwischen bedürfnisorientierter<br />
Grundversorgung und exklusionsverhindernder<br />
bürgerlicher Solidarität. Und so unübersichtlich<br />
der Begriff, so unübersichtlich auch die bürokratische<br />
Wirklichkeit. Die Ordnungen der Sicherheit<br />
und Freiheit drohen unter dem Druck<br />
überbordender Verantwortlichkeit und Zuständigkeit<br />
zu zerbrechen. Im Gestrüpp der wuchernden<br />
Bürokratie wächst staatliche Misswirtschaft,<br />
greifen Zerfall und Korruption um<br />
sich. An der Komplexität der Institutionen der<br />
sozialstaatlichen Eingriffsverwaltung verschleißt<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 55
gesundheits- und sozialpolitik<br />
56<br />
sich die Gestaltungskraft der politischen Intelligenz.<br />
Jede Problemlösung erzeugt aufgrund der<br />
Unübersichtlichkeit der Verhältnisse und der<br />
kognitiv undurchdringlichen Regulationsdichte<br />
der rechtlichen Regelungen nicht vorhersehbare<br />
neue Probleme. Die sozialstaatliche Politik<br />
wird unordentlich, das Gemeinwesen wird unregierbar.<br />
Und nach wie vor wird diese horizontlose<br />
Flickschusterei begleitet von einem vollmundigen<br />
Moralismus, der sich um die liberale<br />
Grenzziehung zwischen Recht und Ethik immer<br />
weniger kümmert und das Recht als Ethisierungshebel<br />
und volkspädagogisches Instrument<br />
benutzt. Dem Ziel der „Vergerechtlichung“ aller<br />
Lebensverhältnisse verschrieben ist der Staat<br />
immer weniger imstande, seiner fundamentalen<br />
Verantwortlichkeit, nämlich der „Ordnungsvorsorge“,<br />
gerecht zu werden, stabile Rahmenbedingungen<br />
des gesellschaftlichen Lebens zu garantieren,<br />
in denen die Bürger ein Leben mit Eigenbeteiligung<br />
führen und ein selbstverantwortliches<br />
Risikomanagement entwickeln können.<br />
Besitzstandswahrung ist das manifeste Prinzip<br />
gegenwärtigen sozialstaatlichen Handelns: Besitzstandswahrung<br />
dominiert das Interesse der<br />
Machtinhaber, die den Sozialstaat als Kriegskasse<br />
zur Finanzierung ihrer Wiederwahlkampagnen<br />
benutzen und sich um alles in der Welt den<br />
Souverän gewogen erhalten wollen; Besitzstandswahrung<br />
wollen aber auch die Bürger, die<br />
das erreichte sozialstaatliche Bequemlichkeitsniveau<br />
energisch verteidigen. So arbeiten Politik<br />
und Bürger gleichermaßen an der Vertiefung<br />
des Widerspruchs zwischen Eigeninteresse und<br />
den Erhaltungsbedingungen der politischen Gesamtordnung,<br />
folgen gleichgesinnt Handlungsstrategien,<br />
die die Stabilität der systematischen<br />
Fundamente gefährden und die Funktionsgesetze<br />
der Wirtschaft und Demokratie verletzen.<br />
Von einer stetig wachsenden Schuldenlast niedergedrückt<br />
schleppt sich der Staat mühsam<br />
von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr. Die Politik<br />
vermag immer weniger ihrer gestalterischen<br />
Verantwortung nachzukommen. Sie hat kaum<br />
noch finanzpolitischen Handlungsspielraum,<br />
denn nicht nur schwinden die Einnahmen,<br />
wenn das Kapital auf der Suche nach den besseren<br />
Verwertungsbedingungen in der Weite der<br />
Weltwirtschaft verschwindet und zuhause drü-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
ckende Massenarbeitslosigkeit herrscht, auch ist<br />
der weitaus größte Teil des Haushaltsbudgets<br />
bereits durch sozialpolitische Verpflichtungen<br />
gebunden und ausgabenpolitisch unverfügbar.<br />
So kommt der Politik die Zukunft abhanden.<br />
Sie kommt stets zu spät und erschöpft sich in<br />
nachträglicher und kurzatmiger Korrektur. Sie<br />
vermag sich keinen Planungshorizont zu schaffen,<br />
ist nicht in der Lage, berechenbares, konzeptgeleitetes<br />
und strukturadressiertes Handeln<br />
zu entwickeln. Sie ist nur handlungsimitierende<br />
Bewegtheit, Antipolitik, ein Schattenbild dessen,<br />
was politisches Handeln zu sein hat. Sicherlich<br />
gibt es nationalpolitische und weltpolitische<br />
Begebenheiten, die bei der Herbeiführung dieser<br />
widrigen Verhältnisse mitgewirkt haben. Aber<br />
vor allem ist diese Handlungsohnmacht, diese<br />
konzeptuelle Horizontlosigkeit, dieses Verschwimmen<br />
begrenzter und wohldefinierter<br />
Verantwortlichkeitszonen zu einer konturenlosen<br />
Gesamtverantwortlichkeit das Resultat einer<br />
staatlichen Selbstfesselung, die die Bedingungen<br />
politischer Verantwortlichkeit den<br />
machtpolitischen Verheißungen einer wohlwollenden<br />
massendemokratischen Wählerbewirtschaftung<br />
geopfert hat und sich als zu schwach<br />
erwies, die nötigen strukturellen Systemrevisionen<br />
vorzunehmen, als sich abzeichnete, dass die<br />
vielfältigen ökonomischen, politischen, gesellschaftlichen,<br />
kulturellen und demographischen<br />
Voraussetzungen sozialstaatlicher Solidität rasant<br />
schwanden und der Generationenvertrag,<br />
die Rationalitäts- und Legitimationsbedingung<br />
des umlagefinanzierten Sozialstaats, sich immer<br />
mehr als Illusion erwies.<br />
Natürlich wird auch eine von dieser Allzuständigkeitsanmaßung<br />
befreite Sicherheits- und<br />
Freiheitsordnung sozialstaatliche Aufgaben<br />
wahrzunehmen haben. Diese dienen jedoch<br />
nicht einer chimärischen Verteilungsgerechtigkeit,<br />
sondern der Bereitstellung einer Grundversorgung<br />
für Selbstversorgungsunfähige und der<br />
Errichtung eines institutionellen Rahmenwerks<br />
zur Gewährleistung gleicher Lebenschancen.<br />
Was aber heißt Chancengleichheit? Es ist hilfreich,<br />
hier zwei Lesarten von Chancengleichheit<br />
zu unterschieden. Da ist einmal die Gerechtigkeit<br />
der flachen Chancengleichheit und da ist<br />
zum anderen die Gerechtigkeit der tiefen Chan-
cengleichheit. Während die flache Chancengerechtigkeit<br />
auf die Etablierung eines rechtsstaatlichen<br />
Rahmens individueller Lebensführung<br />
zielt, um einen diskriminierungsfreien Wettbewerb<br />
um Positionen, Ämter und Arbeitsstellen<br />
zu gewährleisten, geht es der tiefen Chancengleichheit<br />
um umfassende Gleichheit der Startbedingungen.<br />
Flache Chancengleichheit erhebt<br />
keinen Einspruch, wenn die vorgefundene, in<br />
jeder Hinsicht zufällige, durch keinerlei individuelle<br />
Leistung verdiente genetisch-soziale Prägung<br />
den Bewerbungserfolg der Individuen bestimmt,<br />
wenn sich die Ungleichheit der genetisch-sozialen<br />
Ausgangslage in soziale und ökonomische<br />
Ungleichheit verwandelt. Flache<br />
Chancengleichheit erhebt erst dann einen Einspruch,<br />
wenn die selektiven Effekte diskriminierender<br />
Regeln, Praktiken, Sichtweisen einen offenen<br />
Wettbewerb der Individuen um Ämter,<br />
Positionen und Arbeitsstellen verhindern. Diese<br />
Ungleichheitstoleranz hingegen vermag der Anhänger<br />
der tiefen Chancengleichheit nicht aufzubringen.<br />
Denn natürlich ist die Qualität der<br />
Lebenskarrieren der Individuen abhängig von<br />
ihren natürlichen und erworbenen Fähigkeiten<br />
und Fertigkeit. Die Talentierteren und durch<br />
günstige Sozialisationsbedingungen Geförderten<br />
können mit einer weit besseren Ressourcenausstattung<br />
ins Leben gehen als ihre genetisch weniger<br />
gut bedachten und sozial weniger begünstigten<br />
Mitbewerber. Und das ist in den Augen<br />
des Egalitaristen ein gerechtigkeitsethischer<br />
Skandal. Und ohne Frage verschafft er mit diesem<br />
Argument einem weitverbreiteten vag-moralischen<br />
Gefühl begriffliche Rückendeckung.<br />
Aber dieses Argument ist nicht gültig. Denn zu<br />
seiner Begründung muss es einen menschenrechtlichen<br />
Anspruch auf materiale Gleichheit<br />
vorweisen. Ein Menschenrecht auf materiale<br />
Gleichheit würde aber die ingeniöse Menschenrechtsidee<br />
einer durch allgemeine formale Gesetze<br />
strukturierten Freiheitsordnung völlig zerstören.<br />
Wie weit mag der Egalitarismus der Lebenserfolgsressource,<br />
die wir selbst sind, gehen?<br />
Schönheit, zumal in einer so äußerlichkeitskultischen<br />
Gesellschaft wie der unsrigen, ist eine<br />
soziale Macht. Muss nicht angesichts der überaus<br />
kläglichen Ergebnisse der natürlichen Äs-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
gesundheits- und sozialpolitik<br />
thetiklotterie einerseits und der unleugbaren<br />
Startvorteile der Schönen andererseits der Egalitarist<br />
revoltieren? Eine Schönheitssteuer einführen<br />
oder freie Kosmetik oder freies Hanteltraining<br />
für alle einschlägig Bedürftigen? 1960<br />
hat L. P. Hartley in London ein Buch mit dem<br />
schönen Titel Facial Justice veröffentlicht. Es<br />
berichtet von dem Gerechtigkeitsskandal der<br />
Schönheit, von dem unverdienten guten Aussehen,<br />
dem Wettbewerbsvorteil der angenehm geschnittenen<br />
Zügen, von der benachteiligenden<br />
Hässlichkeit und der marginalisierenden Unansehnlichkeit.<br />
Und es berichtet von der „Antlitz-<br />
Gleichmachungs-Behörde“ und ihrem Egalisierungsprogramm,<br />
das durch die Entwicklung einer<br />
risikolosen und unaufwändigen Gesichtschirurgie<br />
ermöglicht wurde und erlaubte, die blinde<br />
natürliche Verteilung ästhetischer Eigenschaften<br />
durch Gesichtsplastiken der ausgleichenden<br />
Gerechtigkeit zu überformen, sodass nur noch<br />
ästhetische Durchschnittlichkeitsvarianten<br />
existierten und die körperliche Individualität<br />
sich auf eine karrierepolitisch neutrale Mediokritätsvariation<br />
beschränkte. Damit hätte die<br />
„Antlitz-Gleichmachungs-Behörde“ dann die<br />
Ungerechtigkeit der Natur überwunden und die<br />
soziale Macht der Schönheit gebrochen. Der<br />
Egalitarist, seit je Anwalt neidischer Vergleichssucht,<br />
kann zufrieden sein: Die Schönen sind<br />
verschwunden und die ästhetischen Habenichtse<br />
müssen sich nicht mehr in Neid zerfressen.<br />
Es ist ersichtlich, dass der Sozialstaat durch die<br />
Ausdehnung des Prinzips der Chancengleichheit<br />
auf den Bereich der natürlichen und sozialen<br />
Prägung, also durch eine Politik der tiefen<br />
Chancengleichheit, sich in eine totalitäre Bürokratie<br />
verwandeln muss. Die legitime Zuständigkeit<br />
staatlichen Eingriffshandelns endet an der<br />
Haut der Menschen. Daher ist die genetische<br />
und soziale Konditionierung menschlichen Lebens<br />
kein legitimer Gegenstand einer umverteilenden<br />
Gerechtigkeit. Wir sind Personen, die<br />
ein selbstverantwortliches Leben zu führen das<br />
Recht haben; und der Staat ist als Institution<br />
der Institutionen mit der Aufgabe betraut, ein<br />
System der institutionellen Sicherung einer -<br />
notwendig flachen - Chancengleichheit zu etablieren.<br />
Wir sind jedoch keine Lebenserfolgsressourcen,<br />
die durch Sozialstaatshandeln egalisiert<br />
57
gesundheits- und sozialpolitik<br />
58<br />
werden müssen, um Chancenvorteile und<br />
Chancennachteile auszugleichen. Entsprechend<br />
ist auch die Ungleichheit als gerechtigkeitsethisch<br />
unbedenklich zu akzeptieren, die im<br />
Rahmen eines Systems der flachen Chancengleichheit<br />
durch die unterschiedlichen genetischen<br />
und sozialen Prägungen produziert wird.<br />
Wenn sich staatliches Handeln als individuensensibler<br />
Schicksalsausgleich versteht, wird die<br />
Dimension des Politischen zerstört. Politik ist<br />
nicht mehr Sorge um den Bürger, nicht mehr<br />
Diskriminierungsbekämpfung und Sorge um<br />
Bürgerlichkeit ermöglichende Umstände. Der<br />
Bürger ist in diesem egalitären Gerechtigkeitsstaat<br />
längst ausgestorben. In der Welt des Egalitarismus<br />
gibt es nur Bevorzugte und Benachteiligte,<br />
Schicksalsbegünstigte und Schicksalsbeladene,<br />
sozial Privilegierte und sozial Deprivilegierte.<br />
Und jeder Benachteiligte hat die Defini-<br />
tionshoheit über seine Benachteiligung und das<br />
kompensationspflichtige Ausgleichsausmaß, ist<br />
zur eigenständigen Handhabung des Lebenskarriereabstandsmessers<br />
befugt. Damit ruft diese<br />
egalisierungsverpflichtete Gesellschaft zur Selbstorganisation<br />
des Neides auf. Eine paradoxe Tiefenstruktur<br />
des Egalisierungsetatismus wird<br />
sichtbar: der Egalitarismus produziert nicht nur<br />
Gleichheit, sondern notwendig immer auch ihr<br />
Gegenteil; als Inegalitätskompensation schüttet<br />
er fortwährend Prämien für Inegalität aus und<br />
erklärt damit die Autoviktimisierung zur Erfolgsstrategie.<br />
Es versteht sich, dass der Gerechtigkeitsbegriff<br />
der flachen Chancengerechtigkeit eine entschieden<br />
liberale Neuorientierung des Sozialstaats<br />
verlangt. Der Sozialstaat muss als freiheitsfunktionale<br />
Veranstaltung verstanden werden,<br />
der Selbstständigkeit ermutigt und individuelle<br />
Autonomie fördert. Er muss auf die<br />
machtpolitischen Gewinne der Versorgungsund<br />
Betreuungsstrategien verzichten, das Linsengericht-Agreement,<br />
in dem Freiheit gegen<br />
Versorgung eingetauscht wurde, rückgängig machen<br />
und den Bürgern ihr freiheitsrechtliches<br />
Erstgeburtsrecht zurückgeben. Er muss bestrebt<br />
sein, möglichst viele Menschen in den Wettbewerb<br />
zurückzuführen und die charakterschulenden<br />
Eigenschaften des Wettbewerbs für die Herausbildung<br />
von Selbstständigkeit und Autono-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
mie und damit auch von größerer bürgerpolitischer<br />
Kompetenz zu nutzen.<br />
Aber es ist zu befürchten, dass die Bürger diese<br />
Befreiung gar nicht wünschen. Der Wohlfahrtsstaat<br />
hat die zurückliegenden Dekaden gut genutzt<br />
und sein eigenes kulturelles Binnenklima<br />
erzeugt. Er ist den Bürgern unter die Haut gegangen,<br />
hat ihr Denken, Handeln und Fühlen<br />
geprägt. Er ist ein Seelenbildner, der sich den<br />
Menschen nach seinem Bilde erschaffen hat.<br />
Die Welt der Sozialklientel wurde zu einer Art<br />
beheiztem Glashaus der reinen Wertkonsumtion<br />
innerhalb der gesamtgesellschaftlichen Lebens-<br />
und Arbeitswelt. Eine Kultur der Abhängigkeit<br />
entstand. Das führte zu einer ethischen<br />
Marginalisierung der Persönlichkeit, die, so das<br />
Ideal des Liberalismus, der Aufklärung und des<br />
freiheitlichen Menschenrechts, sich wesentlich<br />
als autonom, handlungsfähig und selbstverantwortlich<br />
erfahren möchte. Das führte auch zu<br />
einer wachsenden Unfähigkeit, Verantwortung<br />
für sein Leben zu übernehmen und Kontingenzen<br />
zu ertragen. Die Menschen wurden schicksalsunfähig;<br />
sie wurden aus eigener Kraft nicht<br />
mehr mit Pech, Unglück und anderen negativen<br />
Widerfahrnissen fertig; vor widrigen Umständen<br />
weichen sie zurück und suchen die Trutzburg<br />
des Staates auf, wo der bürokratische „Generalagent<br />
für Lebenszufriedenheit“ (Klages) sie<br />
in einem dicht gestrickten Sozialversicherungsnetz<br />
auffängt. Vor dem Hintergrund der liberalen<br />
Freiheitsethik ist dem expansiven Wohlfahrtsstaat<br />
der Gegenwart entschieden der Vorwurf<br />
der moralischen Kontraproduktivität zu<br />
machen: er betreibt zügig die Abschaffung der<br />
Selbstständigkeit, er verhindert Bürgerlichkeit.<br />
Während der Markt ein System der wechselseitigen<br />
Verstärkung ökonomischer und selbstverantwortungsethischer<br />
Anreizstrukturen bietet,<br />
eigenverantwortliche Lebensführung und ökonomische<br />
Erfolgssuche strukturell harmonisiert,<br />
treten verantwortungsethisches und ökonomisches<br />
Anreizsystem im Wohlfahrtsstaat in ein<br />
polemisches Verhältnis. In demselben Maße, in<br />
dem im solidaritätsbegründeten Wohlfahrtsstaat<br />
die Berechtigten zu Klienten werden und ökonomisch<br />
orientiertes Verhalten an den Tag legen,<br />
möglichst große private Ausnutzungsmargen<br />
suchen und sich politisch organisieren, um
ihre gruppenbezogene Gesamtzuteilung zu erhöhen,<br />
verkümmern die verantwortungsethischen<br />
Anreize, die Selbstbeanspruchungsbereitschaft<br />
und das pure, nach Unabhängigkeit von fremden<br />
Erhaltungsleistungen trachtende Selbstständigkeitsbedürfnis.<br />
Wollen wir einen Moralvergleich zwischen Sozialstaat<br />
und Markt vornehmen, geht dieser eindeutig<br />
zugunsten des Marktes aus. Denn der<br />
Markt ist kein metaphysischer Dom, in dem die<br />
Freiheit als Götze angebetet wird, sondern ein<br />
flexibles, dezentrales Verteilungssystem, das<br />
notwendig ist, wenn Menschen ein Leben führen<br />
wollen, in dem sie für ihre eigenen Entscheidungen<br />
verantwortlich sind, wenn sie Lebensprojekte<br />
selbstbestimmt angehen und durchführen<br />
wollen, wenn ihnen gleiche Chancen auf individuelle<br />
und moralische Entfaltung eingeräumt<br />
werden sollen. Der Markt ist die hohe<br />
Schule der Selbstverantwortlichkeit. Aber nicht<br />
nur die moralische, ihre Lebensautorschaft<br />
ernstnehmende Subjektivität verlangt nach<br />
dem Markt. Auch das Prinzip der Individualität<br />
favorisiert den Markt, denn kein Verteilungssystem<br />
ist differenzfreundlicher, könnte der Individualität<br />
bessere Entfaltungsbedingungen bieten<br />
und der Unterschiedlichkeit der menschlichen<br />
Lebensentwürfe gerechter werden. Freilich, die<br />
Neoliberalismuskritiker sehen das anders: In<br />
ihrem einfältigen Weltbild kommt dem Markt<br />
die Rolle des Bösen und dem Sozialstaat die<br />
Rolle des Guten zu. Aber die irren sich beträchtlich,<br />
die im Sozialstaat eine Höhle erblicken,<br />
in der die Moral in der kalten Jahreszeit<br />
des Kapitalismus überwintert. Der Sozialstaat ist<br />
kein Ort ethischer Exzellenz, er erzieht nicht zur<br />
Moral. Seine Anreizsysteme begünstigen den<br />
Egoismus nicht minder als der Markt. Die Menschen<br />
betreiben ihre Versorgungskarrieren im<br />
Sozialstaat mit der gleichen egozentrischen<br />
Konzentration wie ihre Erfolgskarrieren auf dem<br />
Markt, nur müssen sie nicht das disziplinierende<br />
Selbstverantwortlichkeitspensum ableisten, dass<br />
der Markt jedem abverlangt.<br />
Diese Entmündigungskritik ist offensichtlich eine<br />
zeitgenössische Variation der alten, gegen<br />
den Polizei- und Wohlfahrtsstaat des 18. Jahr-<br />
1 Alexis de Tocqueville: Über die Demokratie in Amerika, München 1976, S. 814.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
gesundheits- und sozialpolitik<br />
hunderts gerichteten Paternalismuskritik Wilhelm<br />
von Humboldts und Immanuel Kants. Als<br />
Relaisstation zwischen der alten und der neuen<br />
Bevormundungsklage kann ein Zitat aus dem<br />
Jahre 1835 gelten. Es stammt aus Tocquevilles<br />
„Über die Demokratie in Amerika“. „Eine gewaltige,<br />
bevormundende Macht“ erhebt sich<br />
über eine Menge vereinzelter und entfremdeter<br />
Individuen; „sie wäre der väterlichen Gewalt<br />
gleich, wenn sie wie diese das Ziel verfolgte, die<br />
Menschen auf das reife Alter vorzubereiten;<br />
statt dessen aber sucht sie bloß, sie unwiderruflich<br />
im Zustand der Kindheit festzuhalten; es ist<br />
ihr recht, dass die Bürger sich vergnügen, vorausgesetzt,<br />
dass sie nichts anderes im Sinn haben,<br />
als sich zu belustigen. Sie arbeitet gerne für<br />
deren Wohl; sie will aber dessen alleiniger Betreuer<br />
und einziger Richter sein; sie sorgt für ihre<br />
Sicherheit, vermisst und sichert ihren Bedarf,<br />
erleichtert ihre Vergnügungen, führt ihre wichtigsten<br />
Geschäfte, lenkt ihre Industrie, ordnet<br />
ihre Erbschaften, teilt ihren Nachlass; könnte<br />
sie ihnen nicht auch die Sorge des Nachdenkens<br />
und die Mühe des Lebens ganz abnehmen“? 1<br />
Eine weniger emphatische Version dieses sozialstaatskritischen<br />
Arguments rückt von dem personentheoretischen<br />
Ideal der selbstständigen<br />
Lebensführung ab und stellt die strukturelle Unterminierung<br />
des Leistungsprinzips, das, was Soziologen<br />
die sozialstaatliche „Entmeritokratisierung<br />
des Bewusstseins“ genannt haben, in den<br />
Mittelpunkt. Die normativen, charakterprägenden,<br />
verhaltensbildenden Orientierungen der<br />
Welt der sozialstaatlichen Institutionen haben<br />
insgesamt den Effekt, die Dispositionen zu diskreditieren,<br />
die für ein erfolgreiches Leben in<br />
der Arbeitswelt erforderlich sind, und damit das<br />
Ethos des Marktes auszuhöhlen, insbesondere<br />
die ethische Balance von Leistung und Verdienst<br />
auszuhebeln und den Bezug gegenleistungsfreier<br />
Transferzahlungen zur beanstandungsfreie<br />
moralische Selbstverständlichkeit zu<br />
erklären. Wenn gegenleistungsfreie Versorgung<br />
ein solches Niveau erreicht, dass sich die Arbeitsaufnahme<br />
oder Arbeitsfortsetzung für die<br />
Individuen als nicht mehr lohnend erweist, wird<br />
das Gesamtsystem aus Markt und Sozialstaat in<br />
59
gesundheits- und sozialpolitik<br />
60<br />
Frage gestellt, das Leistungsethos des Marktes<br />
verhöhnt und die organisierte Solidarität lächerlich<br />
gemacht.<br />
Wollen wir die Freiheit aus ihrer wohlfahrtsstaatlichen<br />
Gefangenschaft befreien, müssen<br />
sich Staat und Bürger gleichermaßen ändern.<br />
Die sozialstaatlichen Entlastungen werden zurückgeschraubt<br />
werden müssen. Die Individuen<br />
werden in weit höherem Maße als bisher sich<br />
über den Markt mit risikominimierenden Versicherungen<br />
versehen müssen. Mehr als ein residualer<br />
Sozialstaat wird der Sozialstaat der Zukunft<br />
nicht sein können, mehr als eine gerade<br />
einmal die Not wendende Grundversorgung<br />
wird er nicht mehr finanzieren können. Immer<br />
noch wird er sich verpflichtet sehen, das Elend<br />
zu bekämpfen, aber vor den großen Zielen des<br />
sozialdemokratischen Zeitalters der Armutsausrottung<br />
und der Ungleichheitsabschaffung wird<br />
er kapitulieren. Notwendig ist ein Abbau der<br />
staatlichen Zuständigkeiten, eine Korrektur der<br />
Verantwortungsverteilung. Die dem Staat aufgehalsten<br />
und nur zu gern von der zustimmungssüchtigen<br />
Parteipolitik übernommenen<br />
Verantwortlichkeiten müssen von den Bürgern<br />
zurückgenommen werden. Der liberale Prozess<br />
der Selbstermächtigung der Bürger, der mit der<br />
Einrichtung des Sozialstaats zum Erliegen kam,<br />
muss wieder aufgenommen und weiter geführt<br />
werden. So wie die Bürger aus Sorge um ihre<br />
Freiheit den Leviathan des Absolutismus zivilisiert<br />
haben, ihn aus einer furchterregenden<br />
Schutzveranstaltung in eine politische Selbstorganisation<br />
der Bürgerschaft verwandelt haben,<br />
so müssen sie sich jetzt daran machen, wiederum<br />
aus Sorge um ihre Freiheit, aber vor allem<br />
auch aus Sorge um die dem Leviathan des Lebensschutzes<br />
abgerungene Ordnung der Freiheit,<br />
den Sozialstaat zu zivilisieren, ihn auf ein<br />
System bedürfnisorientierter Grundversorgung<br />
zu reduzieren. Sie müssen lernen, wieder ein Leben<br />
mit wachsender Eigenbeteiligung zu führen.<br />
Das aber ist mühsam, denn die liberale Ordnung<br />
ist zumutungsreich und unbequem. War<br />
die Vorzugswürdigkeit der individuellen Freiheit<br />
im Schatten des eisernen Vorhangs geradezu<br />
selbstevident, vergisst man in der Weite des<br />
Weltmarktes, warum sie ein schützenswertes<br />
Gut sein könnte. Menschen scheuen vor offe-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
nen Räumen zurück, sie leiden an einer existenziellen<br />
Agoraphobie, haben einen großen Bedarf<br />
an Grenzen, an Übersichtlichkeit und Nähe, an<br />
Weisung, Orientierung und Sinn, an sozialer<br />
und metaphysischer Sicherheit. Wird dieser Bedarf<br />
nicht mehr gedeckt, wird die kulturelle<br />
Umwelt für sie unbekömmlich. Und das Gespann<br />
von Liberalismus und Kapitalismus vermag<br />
diesen Bedarf bei Weitem nicht zu decken.<br />
Denn beide sind die zentralen kulturellen Produktivkräfte<br />
der zerstörerischen Moderne. Ihrer<br />
emanzipatorischen Dynamik konnte nichts<br />
standhalten. Sie haben Ordnungen aufgelöst,<br />
Bindungen gelockert, Autoritäten gestürzt, Gewissheiten<br />
abgeschafft. Sie haben individualisiert<br />
und pluralisiert. Die Ressourcen kollektiver<br />
Sinnstiftung sind versiegt, denn kollektive Sinnstiftung<br />
gelingt nur in den geschlossenen Systemen<br />
der Religion und der Geschichte. Die Religion<br />
wird im Liberalismus zu einer privaten Angelegenheit,<br />
und die Geschichte verliert ihre<br />
Richtung, ist nur noch richtungslose Linearität.<br />
Das moderne Individuum steht unter offenem,<br />
leerem Himmel. Kapitalismus und Liberalismus<br />
haben es sich selbst zurückgeworfen und mit<br />
den Zumutungen der Selbstermächtigung, des<br />
eigenverantwortlichen Lebensmanagements allein<br />
gelassen.<br />
Diesen Zumutungen sind wir aber offensichtlich<br />
kaum gewachsen. Wir sperren uns gegen das<br />
uns vom Liberalismus abverlangte Modernitätspensum<br />
und pflegen unsere obrigkeitsethische<br />
Anhänglichkeit. Die Entwicklung unseres Seelen-<br />
und Gefühlshaushalts, unserer lebensethischen<br />
Kapazitäten hat mit der Entwicklung unserer<br />
Konsumgewohnheiten nicht Schritt gehalten.<br />
Wir haben es bis zum Konsumindividualismus<br />
gebracht, zum Verantwortungsindividu-<br />
alismus sind wir aber noch nicht fähig. Wir wollen<br />
Gewißheit und Steuerung, sehnen uns nach<br />
Sicherheit und Geschlossenheit, betrachten den<br />
Sozialstaat als eine Gemeinschaft des Guten<br />
und dichten dem Staat die Weisheit an, die<br />
Kinder bei Erwachsenen vermuten.<br />
Prof. Dr. phil. Wolfgang Kersting, Philosophisches Seminar<br />
der Christian-Albrechts-Universität, Leibnizstr.<br />
6, 24118 Kiel, E-Mail kersting@philsem.uni-kiel.de
Bericht aus der Medizinischen<br />
Gesellschaft Lübeck<br />
Neue Entwicklungen beim<br />
Mammakarzinom<br />
Jürgen Dunst, Dorothea Fischer,<br />
Alexander Katalinic, Wolfgang Kühnel<br />
Die wissenschaftliche Sitzung der Medizinischen<br />
Gesellschaft Lübeck am 10.05.07 beschäftigte<br />
sich mit <strong>aktuell</strong>en Entwicklungen in der<br />
Diagnostik und Therapie von Brustkrebs. Alexander<br />
Katalinic stellte die neuesten Daten des<br />
schleswig-holsteinischen Krebsregisters vor.<br />
Nach einer Jahrzehnte andauernden Phase des<br />
Ansteigens der Brustkrebserkrankungen zeichnet<br />
sich <strong>aktuell</strong> in verschiedenen Regionen der<br />
Welt ein Rückgang ab. Auch in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
nahm seit dem Jahr 2002 die Brustkrebsinzidenz<br />
um etwa sieben Prozent pro Jahr ab. Der<br />
deutlichste Rückgang ist in der Altersgruppe<br />
50-69 Jahre zu beobachten (Abb. 1 a). Dabei<br />
wird ein Zusammenhang des Inzidenzrückgangs<br />
mit dem ebenfalls zu beobachtenden Rückgang<br />
der Nutzung der Hormonersatztherapie (HRT)<br />
diskutiert. Der Einsatz einer Hormonersatztherapie<br />
nahm in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> zwischen<br />
2001 und 2005 (Daten aus dem Modellprojekt<br />
„qualitätsgesicherte Mammadiagnostik“, Qua-<br />
MaDi) ebenfalls ab, nämlich von 46 Prozent auf<br />
30 Prozent (Abb. 1 b). Der Rückgang der Brustkrebsinzidenz<br />
ist dabei hoch korreliert mit dem<br />
Rückgang der HRT.<br />
Abb. 1 a: Brustkrebsinzidenz in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, altersspezifische<br />
Raten pro 100 000 Frauen<br />
medizin und wissenschaft<br />
Der Rückgang der Brustkrebsinzidenz ist außer<br />
in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> auch im Saarland zu beobachten.<br />
Dort ging die Brustkrebsinzidenz von<br />
2003 bis 2004 um etwa neun Prozent zurück, in<br />
der Altersgruppe 50-69 Jahre um ca. 13 Prozent.<br />
Vor der Diskussion eines möglichen Zusammenhangs<br />
der Abnahme von HRT- und Brustkrebsinzidenz<br />
sind weitere Faktoren, die zu einem<br />
Rückgang der Inzidenz führen könnten, zu berücksichtigen.<br />
Ganz allgemein kann ein (ggf.<br />
temporärer) Rückgang einer Erkrankungshäufigkeit<br />
verschiedenste Ursachen haben. Eine erfolgreiche<br />
Primärprävention (Ausschaltung/<br />
Verringerung einer schädlichen Noxe) beispielsweise<br />
sollte zu einem Absinken der Inzidenz<br />
führen. Bei der Einführung von Früherkennungsprogrammen<br />
(Sekundärprävention) wäre<br />
nach einer Phase des Inzidenzanstiegs ein deutliches,<br />
aber temporär befristetes Absinken der<br />
Inzidenz unter das Ausgangsniveau zu beobachten.<br />
Der beobachtete Zusammenhang von HRT<br />
und Brustkrebsrisiko kann auf Basis dieser Daten<br />
alleine nicht eindeutig als kausal angesehen<br />
werden, scheint jedoch unter Hinzuziehung<br />
weiterer Evidenz (WHI-Studie, One-Million-<br />
Women-Study) wahrscheinlich. Der sich insgesamt<br />
erhärtende Zusammenhang von HRT und<br />
Brustkrebsrisiko hat weit reichende Public<br />
Health-Konsequenzen. Eine Reduktion der<br />
Brustkrebsinzidenz um zehn Prozent würde für<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> etwa 230 weniger Brustkrebsfälle<br />
pro Jahr bedeuten. Weniger Brustkrebsfälle<br />
dürften auch zu weniger Todesfällen<br />
Abb. 1 b: Nutzung der Hormonersatztherapie (in Prozent)<br />
in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> (QuaMaDi)<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 61
medizin und wissenschaft<br />
62<br />
Klinische Konstellation<br />
Adjuvante Therapiemaßnahme<br />
nach OP<br />
an Brustkrebs führen. Die Indikation für die HRT<br />
sollte daher kritisch geprüft und auf die klinisch<br />
indizierten Behandlungsfälle reduziert werden.<br />
Möglicherweise lässt sich bei weiter rückläufigem<br />
Verschreibungsverhalten sogar ein weiterer<br />
Rückgang der Brustkrebsinzidenz erreichen.<br />
Dorothea Fischer berichtete über die St. Gallen-<br />
Konferenz 2007. Dieses internationale Expertentreffen<br />
findet seit mehr als 20 Jahren im<br />
Rhythmus von zwei Jahren statt und gibt Empfehlungen<br />
zur adjuvanten Therapie des Mammakarzinoms.<br />
Für die Frage, welche Systemtherapie<br />
(Chemotherapie, endokrine Therapie und<br />
Antikörpertherapie) in Frage kommt, sind die<br />
Einteilung in Risikogruppen und die Erfolgswahrscheinlichkeit<br />
einer endokrinen Therapie<br />
besonders wichtig. Bei prämenopausalen Patientinnen<br />
stehen verschiedene Verfahren zur Ausschaltung<br />
der ovariellen Funktion zur Verfügung,<br />
die als äquieffektiv angesehen werden<br />
(Ovarektomie, Ovarbestrahlung, medikamentöse<br />
Therapie); in der Praxis wird die medikamentöse<br />
Behandlung (zwei Jahre Gn-RH-Analoga<br />
und fünf Jahre Tamoxifen) bevorzugt. Bei<br />
postmenopausalen Patientinnen ist Tamoxifen<br />
ein Standard-Medikament, aber bei Kontraindikationen<br />
(Thromboemboliegefahr) oder Hochrisikosituation<br />
werden Aromatasehemmer empfohlen.<br />
Für die Chemotherapie gelten anthrazyklinhaltige<br />
Regime (z. B. sechsmal FEC) als<br />
Standard. Bei nodalpositiven Patientinnen werden<br />
zunehmend auch Taxane eingesetzt. Die<br />
Antikörpertherapie mit Trastuzumab (Herceptin<br />
® ) kann bei Patientinnen mit Her-2-neu-po-<br />
Verbesserung der 10-<br />
Jahres-Rezidivfreiheit<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
Verbesserung des brustkrebsspezifischen<br />
Überlebens nach 10 Jahren<br />
< 50 Jahre Polychemotherapie + 12,4 % + 7,9 %<br />
50-69 Jahre Polychemotherapie + 2,9 % + 2,9 %<br />
Hormonrezeptorpositiver<br />
Tumor<br />
Tamoxifen + 13,6 % + 7,6 %<br />
Brusterhaltende OP,<br />
pN0<br />
Brusterhaltende OP,<br />
pN+<br />
Brustbestrahlung + 19,2 %* + 2,9 %<br />
(nach 15 Jahren: + 5,1 %)<br />
Brustbestrahlung + 33,4 %* + 8,7 %<br />
Tab. 1: Einfluss adjuvanter Therapiemaßnahmen auf die Rezidivrate (* bei Bestrahlung sind die Raten intramammärer<br />
Rezidive angegeben) und auf das Gesamtüberleben nach zehn Jahren<br />
sitiven Tumoren (etwa 20 Prozent aller Brustkrebsfälle)<br />
das Rückfallrisiko weiter senken; diese<br />
Therapie wird ggf. nach Abschluss einer Chemotherapie<br />
für ein Jahr angeschlossen.<br />
Jürgen Dunst referierte über die zunehmende<br />
Bedeutung der Strahlentherapie zur Optimierung<br />
der lokalen Tumorkontrolle. Das Mammakarzinom<br />
wurde seit etwa 25 Jahren als eine<br />
„Systemerkrankung“ aufgefasst. Diese vor allem<br />
von Bernhard Fisher (dem langjährigen Leiter<br />
der NSABP-Studiengruppe) propagierte Theorie<br />
hat maßgebliche Verbesserungen in der Behandlung<br />
bewirkt, nämlich die Einführung der<br />
brusterhaltenden Therapie (Rücknahme der<br />
Radikalität der Lokaltherapie als logische Konsequenz<br />
der fehlenden Korrelation von lokaler<br />
Kontrolle und Überleben) und die Einführung<br />
der adjuvanten, prophylaktischen Chemotherapie.<br />
Die Strahlentherapie wurde als lokale Maßnahme<br />
zur Verbesserung der Brusterhaltungsrate<br />
angesehen; einen Einfluss auf das Überleben<br />
durch die Nachbestrahlung erwartete man<br />
nicht. Die in den letzten Jahren regelmäßig aktualisierten<br />
Meta-Analysen großer Studien zeigen<br />
dagegen seit etwa fünf Jahren eine zunehmende<br />
und hochsignifikante Verbesserung der<br />
Überlebensraten durch die postoperative Radiotherapie.<br />
Dies war aufgrund der Hypothese der<br />
„Systemerkrankung“ nicht erwartet worden. Die<br />
Nachbestrahlung der Brust hat für viele Patientinnen<br />
hinsichtlich der Verbesserung der Überlebenszeit<br />
einen ebenso hohen Stellenwert wie<br />
die Hormon- oder Chemotherapie (Tab. 1). Die<br />
Optimierung der lokalen Tumorkontrolle hat
also eine wesentlich größere Bedeutung als bisher<br />
angenommen. Daraus ergeben sich für die<br />
klinische Praxis wichtige Fragen und Änderungen.<br />
Diese betreffen insbesondere die Frage der<br />
Intensivierung der Lokaltherapie bei jungen Patientinnen<br />
mit hohem Lokalrezidivrisiko, die<br />
Optimierung der Interaktion von Strahlentherapie<br />
und Systemtherapie und die Behandlung<br />
von lokoregionalen Rezidiven. Möglicherweise<br />
spielen lokale Therapieverfahren auch bei limi-<br />
3. wissenschaftliches Treffen des<br />
Arbeitskreises Notfallmedizin der DGAI<br />
Notfallmedizinische Forschung<br />
Jan-TThorsten Gräsner, Jan Bahr, Bernd<br />
W. Böttiger, Erol Cavus, Volker Dörges,<br />
André Gries, Tanja Rosolski-Jantzen,<br />
Volker Wenzel, Jens Scholz<br />
Auch 2007 lud der 1. Sprecher des Arbeitskreises<br />
Notfallmedizin der Deutschen Gesellschaft<br />
für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI),<br />
Prof. Jens. Scholz, zum dritten Treffen der wissenschaftlichen<br />
Arbeitsgruppen „Notfallmedizin“<br />
nach Kiel ein. Die ca. 60 Teilnehmer konnten<br />
sich einen Überblick zu <strong>aktuell</strong>en Einzelprojekten<br />
und vernetzten Studien verschaffen.<br />
Der nachfolgende Bericht fasst die vorgestellten<br />
Projekte zusammen und bietet somit die Möglichkeit,<br />
sich ein Bild über die <strong>aktuell</strong>e Forschungs-<br />
und Studiensituation im Bereich Notfallmedizin<br />
zu machen. Die Klinik für Anästhesiologie<br />
und Operative Intensivmedizin des Universitätsklinikums<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> (UK S-H),<br />
Campus Kiel (Direktor: Prof. Dr. Jens Scholz),<br />
organisiert seit mehreren Jahren diese weit über<br />
die Grenzen von <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> bekannte<br />
Veranstaltung.<br />
Ausbildung und Lehre<br />
Die notfallmedizinische Ausbildung an Universitäten<br />
wurde von Brokmann, Aachen, mit einer<br />
Umfrage erfasst. „Klassische Lehrmethoden“<br />
überwiegen gegenüber Konzepten wie problemorientiertes<br />
Lernen oder E-Learning; Mul-<br />
medizin und wissenschaft<br />
tierter Metastasierung (als Ergänzung zur Systemtherapie)<br />
eine wichtige Rolle; dies ist zurzeit<br />
Gegenstand von klinischen Studien.<br />
Prof. Dr. med. habil. Jürgen Dunst (für die Autoren),<br />
Universität zu Lübeck, Klinik für Strahlentherapie,<br />
Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck, Dr. Dorothea<br />
Fischer, Klinik für Frauenheilkunde, PD Dr. med. habil.<br />
Alexander Katalinic, Institut für Krebsepidemiologie<br />
e. V., Prof. Dr. Wolfgang Kühnel, Medizinische<br />
Gesellschaft Lübeck<br />
tiple-Choice-Klausuren gegenüber praktischen<br />
Prüfungen und strukturierten Examen.<br />
Breckwoldt, Berlin, widmete sich in seinem Beitrag<br />
den Langzeit-Effekten eines speziellen EH-<br />
Kurses, der von Studierenden für Studierende<br />
gegeben wird und auf praktischen Übungsteilen<br />
mit realitätsnahen Szenarien aufbaut. Im Vergleich<br />
zum konventionellen Kurs wird dieser als<br />
sehr gut bewertet. Eine standardisierte Überprüfung<br />
der Kenntnisse nach 20 Monaten zeigte jedoch<br />
keine Unterschiede.<br />
Um eine Vereinfachung der Basismaßnahmen<br />
der HLW ging es Skorning, Aachen. Der in den<br />
Guidelines 2000 vorgesehene siebenstufige Basis-Check<br />
(1) wurde auf drei Schritte reduziert<br />
(2), in einem weiteren Schritt wurde die Beatmung<br />
weggelassen (3). In der Gruppe 1 wurden<br />
die Maßnahmen nach sechs Monaten nur noch<br />
von 12,5 Prozent korrekt durchgeführt. In<br />
Gruppen 2 und 3 wurde früher mit den Thoraxkompressionen<br />
begonnen, in Gruppe 3 war die<br />
Anzahl durchgeführter Kompressionen am<br />
höchsten.<br />
Die Vorteile der Software „ReaDok“ zur Dokumentation<br />
und Analyse des Erfolges beim Reanimationstraining<br />
gegenüber Video-Analysen,<br />
Aufzeichnungen von MegaCode-Simulatoren<br />
oder Papier-Protokollen stellte Kunigk, Würzburg,<br />
vor.<br />
Rücker, Rostock, untersuchte, ob Studierende in<br />
der Lage sind, auf Videos mit realen Situationen<br />
Schnappatmung, Apnoe bzw. normale Atmung<br />
zu erkennen. Eine Schnappatmung wurde häufig<br />
als normale Atmung verkannt, wobei Studie-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 63
medizin und wissenschaft<br />
64<br />
rende im 6./7. Semester noch schlechter abschnitten<br />
als Erstsemester.<br />
Über einen neuen Ansatz in der grenzüberschreitenden<br />
Luftrettung und der Zusammenarbeit<br />
zwischen Dänemark und Deutschland berichtete<br />
Dörges, Kiel. Im Rahmen eines EU-<br />
Projektes wurden systematisch Ausbildungsstände<br />
und Arbeitsmethoden analysiert und das<br />
gesamte Personal nach einer gemeinsam erarbeiteten<br />
Richtlinie ausgebildet.<br />
Die endotracheale Intubation (ITN) wurde von<br />
Timmermann, Göttingen, mit der Intubationslarynxmaske<br />
(ILMA) verglichen. Als Probanden<br />
der randomisierten Studie dienten Studierende<br />
der Medizin. Keine signifikanten Unterschiede<br />
bezüglich der Ventilation, jedoch signifikant<br />
mehr Zeit für die ITN wurden herausgearbeitet.<br />
Grundlagenforschung<br />
Aktuelle Resultate aus der experimentellen<br />
Trauma-Forschung stellte Wenzel, Innsbruck,<br />
vor. Der passagere Einsatz von Vasopressin bei<br />
komplexen Beckenfrakturen und Mesenterialverletzungen<br />
bis zur chirurgischen Versorgung<br />
könnte sich günstig auf das Überleben auswirken.<br />
Schneider, Heidelberg, erzielte an Ratten durch<br />
kontinuierliche Infusion von Neurotensin, einem<br />
an zentralen, spezifischen Rezeptoren wirkenden<br />
Peptid, eine dosisabhängige Hypothermie<br />
- ein neuer Therapieansatz zur Neuroprotektion.<br />
Meybohm, Kiel, konnte bei der alternierenden<br />
Applikation von Adrenalin und Vasopressin<br />
gegenüber alleiniger Gabe von Adrenalin bei<br />
der Reanimation am Schweinemodell eine Verbesserung<br />
von koronarem und zerebralem Perfusionsdruck<br />
sowie der Hirndurchblutung zeigen.<br />
Die Reanimations-Empfehlungen 2005 mit einem<br />
Kompressions-/Ventilationsverhältnis<br />
(K/V) von 30:2 wurden dem bisherigen K/V<br />
von 15:2 und einer alleinigen Kompressionsgruppe<br />
ohne Ventilation von Cavus, Kiel, gegenübergestellt.<br />
Bei einem K/V von 15:2 waren<br />
arterielle Oxygenierung höher und Azidose geringer<br />
ausgeprägt.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
Qualitätsmanagement<br />
Schlechtriemen, Saarbrücken, referierte über<br />
das Traumanetzwerk. Bei allen vom Saarländischen<br />
Rettungsdienst präklinisch versorgter<br />
Traumapatienten wurden Verletzungsschwere,<br />
Zeitdauer der präklinischen Versorgung und des<br />
Transportes, Umfang der präklinischen Versorgung<br />
und Versorgungsstufe der Zielklinik für die<br />
Jahre 2005-2006 analysiert.<br />
Die Einrichtung von First-Responder (FR)-<br />
Gruppen zur Unterstützung des Rettungsdienstes<br />
in einem ländlichen Bereich untersuchte<br />
Naths, Mölln. In die Analyse gingen 200 FR-<br />
Einsätze ein. Den durchschnittlichen Zeitvorteil<br />
der FR von 7,2 (+/- 3,2) min konnte für primär<br />
einfache Diagnostik sowie Erste-Hilfe-Maßnahmen<br />
genutzt werden.<br />
Hinkelbein, Mannheim, ermittelt auf der<br />
Grundlage von jährlich 2 000 000 bodengebundenen<br />
und 80 000 Luftrettungseinsätzen die<br />
Unfallrisiken für das eingesetzte Personal. In einer<br />
retrospektiven Analyse der Jahre 1996-2005<br />
konnte kein Unterschied für die Unfallhäufigkeit<br />
jedoch für das Todesfallrisiko zu Ungunsten<br />
der Luftrettung festgestellt werden.<br />
Eine Arbeitsgruppe um Hauke, Ulm, untersuchte<br />
die papiergestützte digitale Einsatzdokumentation.<br />
Durch Kombination von Papierprotokoll<br />
und digitalem Stift konnte ein klassisches Protokoll<br />
an die Weiterbehandelnden übergeben und<br />
die Daten für eine elektronische Bearbeitung<br />
zugängig gemacht werden. Die Vorteile im Hinblick<br />
auf Akzeptanz, Vermeidung von Doppeleingaben<br />
sowie der Verifizierung am PC wurden<br />
bestätigt.<br />
Schmidtbauer, Berlin, beschrieb die Entwicklung<br />
eines Einsatzplanes für die Bewältigung<br />
von ABC-Lagen im Krankenhaus. Aus der Erfahrung<br />
der Giftgasanschläge in Tokio hat die<br />
Bundeswehr für Berlin Vorbereitungen im Hinblick<br />
auf Materialvorhaltung, Personalressourcen<br />
sowie Umsetzbarkeit in den Zielkliniken getroffen.<br />
Klinische Studien<br />
Sellmann, Duisburg, Roessler, Göttingen, und<br />
Kill, Marburg, berichteten über Studien zur Im-
Vorsitzende der Veranstaltung: Professoren Volker Dörges, Volker Wenzel, Jens Scholz,<br />
Bernd W. Böttiger (v. l. n. r.)<br />
rechts: Kongressteilnehmer<br />
(Fotos: UK S-H)<br />
plementierung einer prähospitalen<br />
nicht-invasiven Beatmung<br />
(NIV). Alle drei Referenten<br />
unterstrichen die Vorteile<br />
für die Patienten und<br />
fanden keine patientengefährdenden Komplikationen.<br />
Der Aufbau einer nationalen Datenbank<br />
zur NIV im Rettungsdienst wird vorbereitet.<br />
Roessler, Göttingen, stellte ein prospektives<br />
Projekt der Jahre 2004-2006 zur Verwendung<br />
des Larynxtubuses als initiale Beatmungshilfe<br />
bei Reanimationen vor. Er zeigte, dass in allen<br />
Fällen die Einlage des Larynxtubus auf Anhieb<br />
möglich ist. Im Falle einer insuffizienten Ventilation<br />
über den Larynxtubus lag entweder eine<br />
vorbestehende Aspiration oder ein Cuffdefekt<br />
vor.<br />
Dörges, Kiel, stellte eine prospektive klinische<br />
Studie mit zwei kürzlich entwickelten Einmal-<br />
Beatmungshilfen (Larynxtubus/LTS-D ® vs. Intubationslarynxmaske/FastrachTM-D<br />
® ) vor.<br />
Geprüft wurden Handhabung, Systemdichtigkeit,<br />
Patientenkomfort, ausreichende Ventilation<br />
und adäquate Oxygenierung in der klinischen<br />
Routine. LTS-D ® und FastrachTM-D ®<br />
konnten zeitgerecht platziert werden. Beide<br />
Verfahren ermöglichten eine suffiziente Oxygenierung<br />
und Ventilation. Die LTS-D ® zeigte eine<br />
höhere Systemdichtigkeit und ermöglichte<br />
höhere Atemwegsspitzendrücke.<br />
medizin und wissenschaft<br />
Bassi, Basel, stellte<br />
eine Untersuchung<br />
der REGA-Basis<br />
Basel vor. Es werden<br />
die initialen<br />
Cuffdruckwerte und<br />
der weitere Cuffdruckverlauf<br />
bei 59<br />
Primär- und 53 Sekundäreinsätzen<br />
der<br />
Luftrettung erfasst.<br />
Es zeigte sich, dass<br />
die initial gemessenen<br />
Cuffdrücke bei Primär-<br />
82 Prozent und bei<br />
Sekundäreinsätzen 64<br />
Prozent zu hoch(> 25<br />
cm H 2 O) waren.<br />
Breitkreutz, Frankfurt,<br />
berichtete über 15 endotracheale<br />
Intubationen<br />
erwachsener Notfallpatienten mit dem starren<br />
Intubationsfiberskop nach Bonfils (BIF). Bei allen<br />
Patienten (Patienten mit einfachem Atemweg,<br />
polytraumatisierte Patienten unter HWS-<br />
Immobilisation mittels Stifneck, Patienten mit<br />
unerwartet schwierigem Atemweg) war eine<br />
zeitnahe (< 40 sec.) Platzierung des Endotrachealtubus<br />
möglich.<br />
Schmidbauer, Berlin, stellte eine Untersuchung<br />
an anatomischen Leichenpräparaten vor. Nach<br />
simuliertem Erbrechen wird der Schutz vor Aspiration<br />
bei Anwendung von supraglottischen<br />
Beatmungshilfen beurteilt. Combitube, Easytube<br />
und Intubationslarynxmaske konnten dem<br />
Maximaldruck von 130 cm H2O standhalten.<br />
Larynxmaske, Larynxmaske Pro Seal, Larynxtubus<br />
und Larynxtubus S II ließen bei geringeren<br />
ösophagealen Drücken eine Leckage zu.<br />
Brenner, Heidelberg, stellte die Heidelberger Intraossäre<br />
Punktions-(HIOPS)-Studie vor. Am<br />
erwachsenen Leichenpräparat wurde ein halbautomatisches<br />
intraossäres Punktionssystem<br />
(EZ-IO) und ein manuelles intraossäres Punktionssystem<br />
(16-G-IO-Nadel) evaluiert. Bei vergleichbaren<br />
Insertionszeiten der als erfolgreich<br />
gewerteten Punktionsversuche konnten unter<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 65
medizin und wissenschaft<br />
66<br />
Verwendung des EZ-IO mehr erfolgreiche<br />
Punktionen im ersten Versuch registriert werden.<br />
Bei der EZ-IO-Punktion traten weniger<br />
technische Komplikationen auf.<br />
Bernhard, Heidelberg, konnte in einer prospektiven<br />
Studie über zwei Jahre mit insgesamt 273<br />
Patienten zeigen, dass durch die Einführung eines<br />
Schockraumalgorithmus für schwerverletzte<br />
Patienten (ISS > 16) langfristig eine Verkürzung<br />
der Zeitintervalle bis zum Abschluss der bildgebenden<br />
Diagnostik bzw. bis zum Beginn der Notoperation<br />
erreicht werden kann.<br />
Wyl, Basel, lässt durch zwei unabhängige Ärzte<br />
20 Original-Schockraum-Szenarien beobachten.<br />
Verantwortlichkeit, Behandlungsabfolge, Kommunikation<br />
und Behandlungsqualität ergaben<br />
bei anschließender Dokumentation in strukturierte<br />
Fragebögen eine hohe Beobachterübereinstimmung.<br />
Schikora, Demmin, analysiert mittels Fragebogen<br />
das Management innerklinischer Notfallsituationen<br />
in den Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern.<br />
Die Auswertung deckt<br />
Schwachstellen des innerklinischen Notfallmanagements<br />
auf (mangelnde Ausrüstung, Ausbildung,<br />
Dokumentation und Auswertung).<br />
Vogelsang, Bochum, stellt eine drei Jahres Analyse<br />
innerklinischer Notfallsituationen vor. Bei<br />
229 Notfallmeldungen wurde in 63 Fällen ein<br />
Kreislaufstillstand beobachtet. In 52 Fällen wurde<br />
ein AED (automatischer externer Defibrillator)<br />
angelegt, der in 40 Fällen einen Schock<br />
empfahl. Bei 32 Patienten konnte die Spontanzirkulation<br />
wieder hergestellt werden. 20 Patienten<br />
konnten nach Hause entlassen werden.<br />
Krieter, Saarbrücken, vergleicht vier Methoden<br />
der pCO2-Messung (mobile BGA, transcutane<br />
Messung, endtidale Messung, stationäre BGA)<br />
bei 33 beatmeten Patienten während des Intensivtransportes.<br />
Trotz signifikanter Unterschiede<br />
zwischen den Messverfahren gab es nur bei der<br />
Kapnometrie klinisch relevante (- 5,3 ± 6,1<br />
mmHg) Messwertabweichungen.<br />
Breitkreuz, Frankfurt, geht der Frage nach, ob<br />
Ärzte ohne Vorkenntnisse, kurze etwa fünf Sekunden<br />
dauernde Echokardiographiebefunde<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
nach je vier Unterrichtseinheiten (à 45 Minuten)<br />
Theorie und Praxis erkennen können. Die<br />
Antwort lautet ja: Am Kursende konnten alle<br />
Teilnehmer einen Perikarderguss, eine hochgradig<br />
reduzierte LVEF und eine PEA erkennen.<br />
Mit einer retrospektiven Auswertung von 2 255<br />
Notarzteinsätzen will Genzwürker, Mannheim,<br />
die Frage beantworten, ob das Fachgebiet des<br />
Notarztes die Intubationshäufigkeit (IH) und<br />
die Intubationsinzidenz (II) im Notarztdienst<br />
beeinflussen. Nach seinen Ergebnissen hängt<br />
die IH vorwiegend von der Einsatzhäufigkeit des<br />
Notarztes ab, während die II bei Assistenzärzten<br />
gehäuft ist. Das Fachgebiet des Notarztes spielt<br />
in der untersuchten Stichprobe keine Rolle.<br />
Wenzel, Insbruck, macht auf eine geplante randomisierte<br />
internationale multizentrische Studie<br />
aufmerksam, in der untersucht werden soll, ob<br />
die Injektion von Vasopressin (zehn IE bis zu<br />
dreimal) beim therapierefraktären traumatischhämorrhagischen<br />
Schock zur Verbesserung der<br />
Überlebensrate von Unfallopfern beitragen<br />
kann.<br />
Spöhr, Heidelberg, stellte Ergebnisse der<br />
Thrombolysis in Cardiac Arrest (TROICA)<br />
Studie vor. Nach Einschluss von 1 050 Patienten<br />
zeigte sich, dass die zusätzliche Therapie mit<br />
TNK ohne Heparin weder die 30-Tage-Mortalität<br />
noch die Rate der in die Klinik aufgenommenen<br />
Patienten positiv beeinflussen konnte.<br />
Prof. Dr. Jens Scholz, Dr. Jan-Thorsten Gräsner, Dr.<br />
Erol Cavus, Prof. Dr. Volker Dörges, UK S-H, Campus<br />
Kiel, Klinik für Anästhesiologie und Operative<br />
Intensivmedizin, Dr. Jan Bahr, Zentrum Anästhesiologie,<br />
Rettungs- und Intensivmedizin, Georg-August-Universität<br />
Göttingen, Prof. Dr. Bernd W.<br />
Böttiger, Prof. Dr. André Gries, Klinik für Anästhesiologie,<br />
Sektion Notfallmedizin, Ruprecht-Karls-<br />
Universität Heidelberg, Prof. Dr. Tanja Rosolski-<br />
Jantzen, Klinik für Anästhesiologie, Hanse-Klinikum<br />
Wismar, Prof. Dr. Volker Wenzel, Universitätsklinik<br />
für Anästhesie und Allgemeine Intensivmedizin, Medizinische<br />
Universität Innsbruck<br />
Korrespondenzanschrift: Dr. Jan-Thorsten Gräsner,<br />
UK S-H, Campus Kiel, Klinik für Anästhesiologie<br />
und Operative Intensivmedizin, Schwanenweg 5,<br />
24105 Kiel, E-Mail graesner@anaesthesie.uni-kiel.de
Kieler Herzchirurgen erfolgreich<br />
in der Herzklappen-Forschung<br />
Anja Aldenhoff-Zöllner<br />
Kinder mit komplexen, angeborenen Herzfehlern<br />
benötigen bis zum Erwachsenenalter häufig<br />
mehrere Operationen - speziell, wenn dabei eine<br />
Herzklappe betroffen ist. Für die Patienten<br />
und deren Eltern bedeutet dies<br />
häufige Krankenhausaufenthalte.<br />
Ein so genanntes minimal-invasives<br />
Verfahren zum Ersatz einer Herzklappe<br />
könnte den betroffenen kleinen<br />
und größeren Patienten große komplexe<br />
Operationen ersparen. Eine<br />
Herzklappe, die mittels eines Katheters<br />
über die Leiste implantiert werden<br />
könnte, stellt daher so etwas wie<br />
eine Revolution der bisherigen Therapie<br />
von angeborenen und erworbenen<br />
Herzklappenerkrankungen dar.<br />
Seit mehr als fünf Jahren arbeiten<br />
Kieler Herzchirurgen aus dem Team<br />
von Prof. Dr. Jochen Cremer, Direktor<br />
der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie,<br />
Universitätsklinikum <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, Campus<br />
Kiel, an einer Möglichkeit, die herkömmliche<br />
Operationstechnik beim Ersatz der so genannten<br />
Pulmonalklappe (Klappe an der Lungenschlagader)<br />
im Sinne der kleinen Patienten<br />
zu vereinfachen.<br />
Jetzt hat der Kieler Herzchirurg Tim Attmann<br />
den Wissenschaftspreis 2007 der Ulrich-Karsten-Stiftung,<br />
vergeben von der deutschen Gesellschaft<br />
für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie<br />
für seine Forschung auf dem Gebiet der katheterimplantierten<br />
Herzklappen am rechten<br />
Herzen erhalten. Mitbeteiligt in der Forschergruppe<br />
sind die Mitarbeiter der Klinik für Diagnostische<br />
Radiologie unter der Leitung von<br />
Prof. Martin Heller, die die genaueste Platzierung<br />
der Herzklappen mittels neuester radiologischer<br />
Technik ermöglichen und die Mitarbeiter<br />
der Klinik für Anästhesiologie von Prof. Jens<br />
Scholz, die mit einer ausgewogenen Narkose dafür<br />
sorgen, dass es bei der Herzklappen-Implantation<br />
zu keiner Kreislaufeinschränkung kommt.<br />
medizin und wissenschaft<br />
Zeitgleich hat die Arbeitsgruppe um PD Dr.<br />
Georg Lutter mit ihrem Kooperationspartner<br />
PD Dr. Ulrich Stock aus Tübingen mehr als<br />
600 000 Euro bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft<br />
eingeworben, um Herzklappen aus<br />
körpereigenem Gewebe herzustellen. Dieses<br />
Verfahren, bei dem dem späteren Empfänger<br />
der Herzklappe zunächst Zellen entnommen<br />
Kieler Arbeitsgruppe für mikrochirurgisch-implantierbare Herzklappen:<br />
Prof. Dr. Jochen Cremer, PD Dr. Georg Lutter, Dr. René Quaden, mit dem<br />
weltweit neuesten Bioreaktor zur Aufzucht von Herzklappenzellen und Dr.<br />
Tim Attmann, der Preisträger (v. l. n. r.) (Fotos: UK S-H)<br />
werden, wird als Tissue Engineering bezeichnet.<br />
Körpereigene Zellen werden außerhalb des Körpers<br />
vermehrt und für den Aufbau einer Herzklappe<br />
benutzt. Diese kann dann gefaltet und<br />
über einen Katheter in das rechte Herz implantiert<br />
werden. Die körpereigene Herzklappe soll<br />
in Zukunft auch mit dem Körper, beispielsweise<br />
bei Kindern, mitwachsen.<br />
Die Arbeitsgruppe Lutter und Cremer hat damit<br />
in diesem Jahr mit ihren Kooperationspartnern<br />
bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft und<br />
beim Bundesministerium für Bildung und Forschung<br />
über 1,7 Millionen Euro eingeworben.<br />
Wichtige Partner bei der Durchführung sind das<br />
Laserzentrum in Lübeck und das Institut für Mikrotechnik<br />
der TU Braunschweig. Die Fördermittel<br />
werden in den nächsten drei Jahren in die<br />
Weiterentwicklung von Techniken eingesetzt,<br />
um verkalkte, patienteneigene Herzklappen<br />
über einen Leistenkatheter herauszuschneiden,<br />
um anschließend eine neue körpereigene Herzklappe<br />
zu implantieren.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 67
medizin und wissenschaft<br />
68<br />
Dieses kombinierte<br />
Verfahren<br />
ist heute für den<br />
Patienten noch<br />
nicht verfügbar,<br />
wird in der modernenHerzklappen-Chirurgie<br />
jedoch eine<br />
große Rolle spielen.<br />
Für den Körper<br />
und Organsysteme<br />
des Patienten bedeutet es, dass<br />
die gesamte Operation schonend durchgeführt<br />
werden kann und die Operationswunde<br />
im Bereich des Brustbeins<br />
nicht mehr notwendig ist. Die Patienten<br />
können früher nach Hause entlassen<br />
werden und benötigen keine lange Rehabilitation<br />
mehr.<br />
Weltweit arbeiten fünf Arbeitsgruppen<br />
intensiv und erfolgreich auf diesem Gebiet. An<br />
sehr wenigen Zentren werden Verfahren des<br />
Herzklappenersatzes über die Leiste bereits am<br />
Menschen angewendet, jedoch ausnahmslos ohne<br />
Beseitigung der verkalkten, patienteneigenen<br />
UK S-H Campus Lübeck<br />
Neuartiger Hirnschrittmacher<br />
für die Behandlung der<br />
Parkinson-Krankheit<br />
Das Bundesforschungsministerium fördert ein<br />
Lübecker Projekt in der Nanobiotechnologie.<br />
Hirnschrittmacher, wie sie beispielsweise für die<br />
Behandlung der Parkinson-Krankheit angewendet<br />
werden, können deutlich verkleinert und<br />
besser verträglich werden. Daran arbeiten Informatiker<br />
und Neurologen der Universität zu Lübeck.<br />
Ihr Forschungsprojekt BiCIRTS („Nanofunktionalisierte<br />
Biosonden für chronische Implantation<br />
und rückgekoppelte Tiefenhirn-Stimulation“)<br />
wird jetzt vom Bundesministerium<br />
für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen<br />
oben: Eine Herzklappe<br />
aus körpereigenen Zellen<br />
zur katheterunterstützten<br />
Implantation<br />
rechts: Ein Klappenstent,<br />
der mithilfe körpereigener<br />
Zellen durch tissue-engineering<br />
hergestellt wurde.<br />
Er wird gefaltet über einen<br />
Katheter in das rechte<br />
Herz implantiert.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
Klappe. Dadurch sind die Ergebnisse<br />
bisher sehr ernüchternd.<br />
Die Arbeitsgruppe sieht daher die<br />
Notwendigkeit zur nachhaltigen<br />
experimentellen Forschung. Erst<br />
wenn die Methode ausgereift ist,<br />
sollte eine klinische Anwendung am Patienten<br />
erfolgen.<br />
Dr. Anja Aldenhoff-Zöllner, Pressesprecherin UK S-H,<br />
Universitätsklinikum <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, Campus<br />
Kiel, Brunswiker Straße 10, 24105 Kiel, Campus Lübeck,<br />
Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck<br />
des Förderprogramms „Nanobiotechnologie“<br />
mit zwei Millionen Euro gefördert.<br />
Hirnschrittmacher werden bei Parkinson-Patienten<br />
genutzt, wenn eine medikamentöse Behandlung<br />
nicht mehr wirksam ist. Dabei werden<br />
elektrische Impulse über dünne Drähte in bestimmte<br />
Regionen des Gehirns gesendet, um die<br />
für die Krankheit charakteristischen Fehlimpulse<br />
zu unterdrücken. Anders als bei bisherigen<br />
Geräten, die eine Dauerstimulation erzeugen,<br />
sollen die in BiCIRTS entwickelten Biosonden<br />
eine bedarfsabhängige Stimulation ermöglichen.<br />
Dies geschieht durch die Rückkoppelung des<br />
miniaturisierten Stimulators mit einer breitbandigen<br />
Aufnahme neuronaler Signale in Echtzeit.<br />
Leiter des Projektes sind PD Dr. Ulrich Hofmann<br />
vom Institut für Signalverarbeitung und<br />
Prozessrechentechnik der Universität Lübeck<br />
und Prof. Dr. Andreas Moser aus der Lübecker
Universitätsklinik für<br />
Neurologie. Beteiligt<br />
sind Wissenschaftler<br />
der Universität Marburg<br />
und die Firmen<br />
Inomed und IMM.<br />
In dem geförderten<br />
Projekt werden flexible<br />
Mikrosonden<br />
entwickelt, die mechanisch<br />
mit der<br />
Elastizität des Gehirngewebesübereinstimmen.<br />
Der besondere<br />
Vorteil dieser<br />
neuen Sonden ist ihre<br />
Oberfläche mit<br />
zwei Arten von Edelmetall-Mikroelektroden<br />
in hoher Zahl, die zu<br />
einer Minimierung der gehirneigenen Abwehrreaktion<br />
führt. Die Sonden sollen für Neuronen<br />
attraktiv wirken, was die langfristige Ankoppelung<br />
der Elektroden an die Gehirnumgebung<br />
fördert und der Biopassivierung entgegenwirkt.<br />
Experimente in Lübeck werden es durch eine<br />
ko-lokalisierte Platzierungstechnik von Biosonden<br />
und Mikrodialyse-Sonden ermöglichen, die<br />
neurochemischen Effekte der Stimulation wie<br />
auch der Biosonden selbst zu verfolgen. Die bedarfsgerechte<br />
Aktivierung des Stimulators er-<br />
medizin und wissenschaft<br />
Rückgekoppelte Hirnstimulation (Abb: Universität zu Lübeck)<br />
folgt mithilfe eines neuartigen Datenaufnahmesystems,<br />
das durch miniaturisierte Signalkonditionierung<br />
eine vielkanalige, breitbandige neuronale<br />
Signalaufnahme erlaubt.<br />
Arbeitshypothese hinter der bedarfsabhängigen<br />
Stimulation auf kleiner Skala ist die Beobachtung,<br />
dass ein Netzwerkeffekt Krankheitssymptome<br />
wie zum Beispiel die des Morbus Parkinson<br />
moduliert, mithin also keine aufwändige<br />
Dauerstimulation zur Symptomunterdrückung<br />
erforderlich sein muss.<br />
Rüdiger Labahn, Pressestelle UK S-H, Ratzeburger<br />
Allee 160, 23538 Lübeck<br />
www.arztfindex.de<br />
Tel. 04551/803-306<br />
- Die Arzt-Suchmaschine für <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> -<br />
Im Arztfindex der <strong>Ärztekammer</strong> <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
sind die patientenzugänglichen Ärzte <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>s<br />
mit einem Grund- bzw. ausführlichen Eintrag<br />
verzeichnet.<br />
Hier haben Ratsuchende die Möglichkeit nach einem bestimmten Arzt, z. B. nach Ort, Fachrichtung<br />
und besonderen Behandlungsverfahren zu suchen. Alle Personen, die nicht über einen<br />
Internetanschluss verfügen, können die Mitarbeiterinnen des Arztfindex<br />
unter Tel. 04551/803-306 erreichen.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 69
unsere nachbarn<br />
70<br />
Selbstbestimmung bei Demenz<br />
Ist das möglich?<br />
Die diesmal im interdisziplinären Ethikseminar<br />
am Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf<br />
(UKE) gestellte Frage wartet immer dringlicher<br />
auf Antwort: Patientenverfügungen gehören<br />
mit zu den am häufigsten diskutierten Themen.<br />
Und: Brauchen wir eine gesetzliche Regelung?<br />
In den gegenwärtigen Orientierungsdebatten<br />
wird das Thema immer wieder neu hochgespült.<br />
Zum einen ist eine entsprechende Gesetzesinitiative<br />
geplant, zum anderen wächst in der Bevölkerung<br />
offenbar der Wunsch nach selbst bestimmtem<br />
Sterben ebenso wie die Angst vor der<br />
so genannten Apparatemedizin. Hinzu kommt<br />
der demographische Wandel - wir werden immer<br />
älter, und damit steigt die Zahl der Dementen.<br />
Der Sozial- und Bioethiker Prof. Dr. Peter Dabrock<br />
vom Fachbereich Evangelische Theologie<br />
an der Universität Marburg, Mitglied der Zentralen<br />
Ethikkommission der Bundesärztekammer,<br />
nannte eine Patientenverfügung eine Willensäußerung,<br />
mit der jemand feststellt, in welcher<br />
Weise er medizinisch behandelt oder nicht<br />
behandelt werden möchte, falls er aus gesundheitlichen<br />
Gründen nicht selbst zustimmungsfähig<br />
sein sollte. „Nun gibt es strittige Fragen -<br />
überhaupt ist die Diskussion mehr von immer<br />
neuen Fragen als von gültigen Antworten geprägt<br />
- dazu gehört die, ob das Wohl des Menschen<br />
gegen dessen Willen eingesetzt werden<br />
soll. Muss die Verfügung schriftlich abgefasst<br />
sein? Wie soll die Form aussehen, wie die Beratung,<br />
wird die Verfügung befristet sein, wie soll<br />
verfahren werden mit den Begriffen Alter, Behinderung<br />
und Krankheit?“ Wie wird das Verhältnis<br />
zwischen dem <strong>aktuell</strong>en Willen und dem<br />
voraussichtlichen Willen desjenigen bewertet<br />
werden, der eine Patientenverfügung unterzeichnet?<br />
Gilt die Verfügung nur in der Sterbephase<br />
oder im Falle einer schweren Erkrankung,<br />
etwa einer Demenz? Eine weitere in unserem<br />
Zusammenhang wichtige Frage: „Dürfen Patientenverfügungen<br />
Anzeichen von Lebenswillen<br />
bei Demenzkranken übertrumpfen?“ Peter Da-<br />
brock erinnerte daran,<br />
dass die Bundesärztekammer<br />
keinen<br />
gesetzlichen Handlungsbedarf<br />
sieht und<br />
nannte drei Begriffe,<br />
die beachtet werden<br />
müssen: Menschenwürde<br />
- „sie muss<br />
sich am Schutz echterSelbstbestimmung<br />
bewähren“,<br />
Lebensschutz (ein<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
Prof. Dr. Peter Dabrock<br />
(Foto: wl)<br />
konditionales, nicht aber das höchste Gut) sowie<br />
Fürsorge. Beachtet werden müsse dies, da<br />
„bezweifelt werden kann, ob jemand seine Situation<br />
in der Demenz voraussagen kann“.<br />
Nicht abhängig von Leistungen und<br />
Eigenschaften<br />
In der evangelischen Theologie ist der Mensch<br />
nicht abhängig von Leistungen und Eigenschaften,<br />
er ist vielmehr als Gottes Ebenbild geschaffen<br />
- Peter Dabrock umschrieb dies mit den<br />
Worten „du darfst sein“, und dies mache nicht<br />
halt bei Dementen oder Menschen mit anderen<br />
Gebrechen oder Erkrankungen: „So gesehen, ist<br />
Selbstbestimmung stets mehr als Autonomie, sie<br />
ist eingebunden in Lebensverhältnisse, kommunikative<br />
Verflechtungen und kulturelle Abhängigkeiten.“<br />
Die geriatrische Forschung habe belegt,<br />
dass auch Demente in der Lage sind, sich<br />
mitzuteilen, zwar nicht kognitiv, aber affektivleiblich.<br />
„Das heißt: Zur biographischen Persönlichkeit<br />
zählt auch die Demenz, daher rate ich<br />
zur Vorsicht bei der heute vermehrt geforderten<br />
absoluten Autonomie!“ Dies bedeute, dass der<br />
Arzt einem Demenzkranken - trotz Patientenverfügung<br />
- bei einer hinzu kommenden schweren<br />
Erkrankung die notwendigen Medikamente<br />
geben sollen darf, „und zwar dann, wenn so etwas<br />
wie ein Lebenswille zu beobachten ist“. Anders<br />
stelle sich die Situation dar, wenn der Erkrankte<br />
beispielsweise die Nahrung verweigere.<br />
„Das bedeutet für meine Bewertung: Im Zweifelsfall<br />
hat der Lebensschutz Vorrang, nämlich<br />
dann, wenn ich nicht weiß, wie die Selbstbestimmung<br />
aussieht.“ (wl)
Selbstgefährdung<br />
Wenn Kinder sich selbst und<br />
andere gefährden<br />
Es gibt kein Rezeptbuch für den Umgang mit<br />
Kindern und Jugendlichen, die wegen einer Erkrankung<br />
behandelt werden müssen. Das stellte<br />
Dr. Anneke Aden von der Klinik und Poliklinik<br />
für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindesund<br />
Jugendalters am Hamburger Universitätskrankenhaus<br />
Eppendorf (UKE) - Direktor der<br />
Klinik: Prof. Dr. Peter Riedesser - in einem<br />
Ethikseminar im UKE fest. Sicher greifen auch<br />
hier die moralisch-ethischen Grundzüge ärztlichen<br />
Handelns: Respekt für die Autonomie des<br />
Menschen, Gebot der Schadensvermeidung,<br />
Verpflichtung zur Hilfe, das Prinzip der Gerechtigkeit.<br />
„Schwierig aber wird es bei Kindern und<br />
Jugendlichen, zumal wenn sie psychisch erkrankt<br />
sind - wie wollen Sie da zum so genannten<br />
informed consent kommen?“<br />
Das heißt, diese Klientel ist oft nicht in der Lage,<br />
zu verstehen, warum eine Behandlung nötig<br />
ist, geschweige denn, dieser Notwendigkeit zuzustimmen.<br />
Die Eltern, der Vormund, vielleicht<br />
der Lehrer entscheiden und bestimmen. „Und<br />
das bedeutet“, so Anneke Aden, „dass häufig<br />
ein Konflikt auftritt zwischen den gleichrangigen<br />
Prinzipien Patientenautonomie und Schadensvermeidung.<br />
Wir als Ärzte und Therapeuten<br />
übernehmen die Verantwortung - wo bleibt<br />
die Freiwilligkeit der Behandlung?“ Es gebe<br />
schwer fassbare Forderungen für Entscheidungshilfen<br />
im konkreten Einzelfall. Das heißt: Im<br />
Einzelfall sind eventuell abweichende Vorgehensweisen<br />
oder Heilversuche erforderlich -<br />
„und das muss verantwortlich begründet werden“.<br />
Unter Umständen muss das Selbstbestimmungsrecht<br />
vernachlässigt, muss eine forcierte<br />
Behandlung vereint werden mit dem Prinzip der<br />
Fürsorge und dem informed consent. Der Behandler<br />
muss im Kopf behalten, dass der Patient<br />
die Behandlung verweigern kann, ohne dass der<br />
Betroffene die langfristigen Folgen der Verweigerung<br />
abschätzen kann, und: „Wir wissen, dass<br />
die therapeutischen Maßnahmen nicht immer<br />
positiv sind, vielleicht auch wegen der mangelnden<br />
Kooperation des Patienten.“<br />
unsere nachbarn<br />
Nötig: altersgerechte Aufklärung, Situation und<br />
Ängste bezüglich Aufnahme und Therapie müssen<br />
angesprochen werden, Partizipation des<br />
Kindes oder Jugendlichen an der Aufnahmeentscheidung,<br />
optimalerweise Schaffung einer<br />
ethisch begründbaren Basis. Auch müssen Ärzte<br />
und Therapeuten lernen - seit einiger Zeit im<br />
UKE mithilfe der in den Niederlanden entwickelten<br />
CFB-Methode (Kontrolle und körperliche<br />
Beherrschung), bei eventuell auftretenden<br />
Dilemmata den richtigen Umgang zu haben.<br />
Dazu gehören: Güterabwägung Selbst- versus<br />
Fremdbestimmung, Nutzen-Risiko-Abwägung<br />
für restriktives Vorgehen, individuelle Betrachtung<br />
des konkreten Einzelfalls. Hilfreich wären<br />
Ethik-Konsile - gibt es leider nicht am UKE -<br />
und die intensive Nutzung von Kasuistiken.<br />
Nach den Worten<br />
von Oberarzt Dr.<br />
Andreas Richterich<br />
„sind wir tagtäglich<br />
konfrontiert mit Patienten,<br />
die sich oder<br />
andere gefährden.<br />
Ich komme gerade<br />
von einem Jugendlichen,<br />
er ist 13 Jahre<br />
alt und hat die 5.<br />
Nierenoperation<br />
Dr. Anneke Aden (Foto: wl)<br />
hinter sich - er will<br />
nicht mehr, er leistet verstärkt Widerstand gegen<br />
jegliche Behandlung - darf ich diesen jungen<br />
Mann fixieren (lassen)? In solchen Akutsituationen<br />
stecken wir ständig.“ Um das für Patienten<br />
und Mitarbeiter erträglicher zu machen,<br />
gibt es spezielle Trainingsmethoden wie CFB.<br />
Damit kann der Mitarbeiter erkennen, wo der<br />
Patient gerade steht. Ziel: So wenig Gewalt für<br />
Patient und Personal, etwa auch weniger Fixierungen<br />
- „das ist“, so Andreas Richterich, „ein<br />
ganz schlimmer Eingriff!“ In den Niederlanden<br />
besteht die Möglichkeit, den Patienten so lange<br />
zu isolieren, bis er sich beruhigt hat. Es geht also<br />
darum, die Kontrolle über die jeweilige Situation<br />
zu erreichen. In einigen Kliniken in Deutschland<br />
gibt es CFB inzwischen modellhaft. Es soll<br />
europaweit etabliert werden. Erste Hinweise zeigen,<br />
dass gewalttätige Situationen dadurch abnehmen.<br />
(wl)<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 71
unsere nachbarn<br />
72<br />
Alzheimertage<br />
Nichts geht ohne Angehörige<br />
Zum achten Mal gab es in Hamburg die Alzheimer-Tage,<br />
gemeinsam veranstaltet von Hamburgische<br />
Brücke - Beratungsstelle für ältere<br />
Menschen und der Alzheimer Gesellschaft Hamburg.<br />
Kann ärztliche Kunst die Einweisung in<br />
ein Pflegeheim verhindern? Können Medikamente<br />
das Fortschreiten der Erkrankung verzögern?<br />
Wie steht es mit dem Unterhaltsrecht? -<br />
Fragen, die während der Alzheimer-Tage beantwortet<br />
worden sind.<br />
Bei Demenz und Alzheimer-Krankheit,<br />
so<br />
Dr. Ann-Kathrin<br />
Meyer, Chefärztin<br />
der Abteilung Geriatrie<br />
der Asklepios<br />
Klinik Wandsbek,<br />
sind die pflegenden<br />
Angehörigen häufig<br />
abgeschnitten von<br />
Fakten, wie sie nur<br />
die Fachöffentlichkeit<br />
zur Verfügung<br />
Dr. Ann-Kathrin Meyer<br />
(Fotos: wl)<br />
stellen kann. Die Alzheimersche Krankheit -<br />
vor genau einhundert Jahren exakt beschrieben<br />
vom Frankfurter Nervenarzt Alois Alzheimer<br />
und in dessen Beschreibung bis heute gültig - ist<br />
die wichtigste Form der Demenz: Rund 80 Prozent<br />
aller Demenzkranken haben die Alzheimer-Krankheit,<br />
etwa zehn Prozent gehen auf eine<br />
vaskuläre Ursache zurück, alles andere ist<br />
eher selten. „Besonders wichtig ist die intensive<br />
Grundlagenforschung“, erklärt Ann-Kathrin<br />
Meyer. „Nur damit kann es gelingen, dass wir irgendwann<br />
in hoffentlich naher Zukunft über<br />
wirksame Medikamente verfügen.“<br />
Fehlende Selbstbestimmung<br />
Die erfahrene Ärztin stellt fest: Demenz verhindert<br />
die Selbstbestimmung des Menschen, von<br />
einer Krankheit spricht die Fachwelt, wenn die<br />
Erkrankung mindestens sechs Monate vorliegt.<br />
Betroffen sind vor allem Menschen jenseits des<br />
80. Lebensjahres, die Krankheit kann aber bereits<br />
vorher beginnen: Fünf Prozent der mehr<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
als 65-Jährigen leiden unter einer deutlichen<br />
Demenz. Beim normalen Altern verlangsamt<br />
sich das Denken, gefolgt von kognitiven Beeinträchtigungen,<br />
und bei vielen Menschen bleibt<br />
es dabei. 15 Prozent aber entwickeln eine Demenz.<br />
Derzeit leben etwa 1,5 Millionen Demenzkranke<br />
unter uns, 2010 werden es 1,8 Millionen<br />
sein, die Einwohnerzahl Hamburgs: „An<br />
dieser Tatsache dürfen wir nicht vorbeisehen!“,<br />
mahnt Ann-Kathrin Meyer. Den genannte<br />
Symptomen folgen deutliche Verhaltensauffälligkeiten<br />
und, in der letzten Phase, die Pflegebedürftigkeit.<br />
Durchschnittlich dauert die Demenz<br />
vom Alzheimer-Typ zehn Jahre, gelegentlich<br />
führt sie schneller zum Tod. Der Erkrankte<br />
verliert jegliches Zeitgefühl, er kann die gewohnte<br />
Umgebung und selbst die Familienmitglieder<br />
nicht mehr erkennen. Weitere Hinweise:<br />
aufbrausendes Verhalten, Inkontinenz, Tag-/<br />
Nachtrhythmusstörungen. Zu den Verhaltensauffälligkeiten<br />
zählen: Wiederholen von Sätzen,<br />
Rastlosigkeit, unkooperatives Verhalten, Wandern,<br />
emotionale Ausbrüche, Kratzen, Beißen,<br />
Selbst- und Fremdbeschädigung. Der Erkrankte<br />
entwickelt heftiges Misstrauen, er leidet unter<br />
Angstzuständen, der Schlaf-Wach-Rhythmus ist<br />
gestört, hinzukommen Wahn und Halluzinationen.<br />
Zusammengefasst: Gedächtnis-, Orientierungs-,<br />
Aufmerksamkeits- und Sprachstörungen.<br />
Ursache für all dies sind, wie von Alzheimer<br />
beschrieben, Eiweißablagerungen im Gehirn;<br />
in der Folge schrumpfen die Nervenzellen:<br />
„Und dies schreitet fort, es gibt bislang keine<br />
Chance auf Besserung“, erklärt Ann-Kathrin<br />
Meyer. „Wir stellen es bei 90 Prozent aller Demenzkranken<br />
fest, das beeinträchtigt die Lebensqualität<br />
der Patienten und der Angehörigen<br />
- und wir haben damit die häufigsten Gründe<br />
für eine Heimeinweisung“, erklärt Ann-Kathrin<br />
Meyer. Mit Medikamenten werde versucht,<br />
das Fortschreiten der Krankheiten zu<br />
verlangsamen. Hilfreich wäre eine möglichst<br />
frühe Behandlung - daran aber mangele es. Der<br />
typische Alzheimer-Patient kommt nicht von<br />
allein zum Arzt, er ist angewiesen auf Angehörige.<br />
Nur die Hälfte aller Demenzen wird diagnostiziert,<br />
lediglich 17 Prozent der Erkrankten werden<br />
medikamentös behandelt - vielfach sprechen<br />
die Budgets dagegen.
Hilfreiche Medikamente<br />
Zur medikamentösen Therapie gehören Antidementiva,<br />
um die Hirnleistung zu verbessern,<br />
Neuroleptika, sie verringern Verhaltensauffälligkeiten,<br />
Antidepressiva, Tranquilizer. Zudem<br />
empfiehlt es sich, Acetylcholin zu geben, damit<br />
weniger Hirnzellen zerstört werden: „Dies alles<br />
bringt eine Menge, umso mehr, wenn früh damit<br />
begonnen wird“. Wenig hilfreich seien<br />
Durchblutungsmittel und Gingko-Präparate.<br />
Ein weiterer Kernsatz der Ärztin: „Eine ausbleibende<br />
Verschlechterung gegenüber dem Ausgangsbefund<br />
ist bereits ein Beweis für die Wirksamkeit!“<br />
Der Patient sollte weder über-, noch unterfordert<br />
werden („Lernen muss der Angehörige,<br />
nicht der Erkrankte!“), alles andere führt zu<br />
Frustration. Hilfreich: Musiktherapie, Biographiearbeit,<br />
Angehörigengruppen. Unterstützend<br />
wirkt ein strukturierter Tagesablauf, weiter: die<br />
Erinnerungen am Leben erhalten, positive Emotionen<br />
ansprechen, alte Fotos zeigen, Hobbys<br />
pflegen, Augenkontakt halten beim Sprechen.<br />
Die Angehörigen müssen entlastet und das Wissen<br />
um die Krankheit erweitert werden. Es empfiehlt<br />
sich ein Erfahrungsaustausch, etwa in einer<br />
Selbsthilfegruppe (Auskunft gibt die Alzheimer<br />
Gesellschaft). „Bedenken Sie: Schon jetzt<br />
haben wir in Deutschland drei Millionen Mitbürger(innen),<br />
die älter sind als 80 Jahre. Diese<br />
Menschen haben noch sieben bis acht Jahre zu<br />
leben. Die Hälfte dieser Zeit ist gekennzeichnet<br />
durch Gebrechlichkeit, unter anderem aufgrund<br />
der Demenz. Unsere Verpflichtung“, so Ann-<br />
Kathrin Meyer, „sehe ich darin, diesen Jahren<br />
Leben zu geben. Demenztherapie heißt nichts<br />
anderes als ein Altern in Würde!“<br />
Aus psychologischer Sicht<br />
„Gehen Sie auf Demenzkranke stets mit offenen<br />
Armen zu - damit sind Sie immer willkommen“,<br />
das ist die Erfahrung von Rita Erlemann, Diplom<br />
Psychologin, tätig in der Beratungsstelle<br />
Demenz und Pflege der Arbeiterwohlfahrt in<br />
Kiel. Für den verbalen und nonverbalen Umgang<br />
mit Demenzkranken ein Hinweis: „Sind<br />
wir nicht alle und zu aller Zeit bemüht, keine<br />
Fehler zu machen? Was aber ist so schlimm,<br />
unsere nachbarn<br />
wenn etwas nicht so<br />
gut gelaufen ist? Ich<br />
erinnere an einen<br />
Satz, der bei mir haften<br />
geblieben ist:<br />
When too perfect,<br />
lieber Gott böse.“<br />
Wer perfekt sein wolle,<br />
gehe oft steif<br />
durchs Leben. Besser<br />
sei: Mal etwas durchgehen<br />
lassen in dem Rita Erlemann<br />
Wissen: Ich tue mein<br />
Bestes: „Trauen Sie sich, am Gefühl orientiert<br />
mit Demenzkranken zu kommunizieren.“ Also:<br />
weg vom Verstand, statt dessen wissen: cummunicare<br />
bedeutet mitteilen, sich vereinen. Es gehe<br />
um Gemeinschaft, darum, Bedürfnisse und<br />
Gefühle zu entdecken, sie vielleicht in den Augen<br />
des Kranken zu lesen und so Meinungen<br />
auszutauschen. Der Erkrankte sei in seinen Mitteilungsmöglichkeiten<br />
eingeschränkt, etwas,<br />
was die Angehörigen schmerzlich empfinden<br />
mit der Tendenz, einsam zu werden. Es komme<br />
daher darauf an, sich im Umgang mit einem Demenzkranken<br />
auch immer der eigenen Gefühle<br />
klar zu sein: „Holen Sie sich Hilfe, wenn Sie anders<br />
kommunizieren wollen oder müssen. Ich<br />
möchte Sie dazu ermutigen, auch wenn Sie jetzt<br />
verzweifelt sind. Der Weg über das Gefühl ist<br />
vernünftig, und es ist im Umgang mit diesen<br />
Kranken der einzige gangbare Weg. Der Demenzkranke<br />
kann seinen Kurs nicht mehr ändern“,<br />
erklärt Rita Erlemann. Denn: Beim Demenzkranken<br />
zerfällt der Zusammenhang zwischen<br />
Wörtern und Bildern, oder es werden die<br />
Worte nicht mehr gefunden. Es fehlt im Gehirn<br />
der Befehl zur Artikulation. Der Kranke ist<br />
demnach in mehrfacher Hinsicht gestört, wer<br />
mit ihm umgeht, muss vielleicht Sehen und Hören<br />
ebenfalls kompensieren, da beides auch gestört<br />
sein kann.<br />
Augenkontakt, Mimik, Gestik - „zeigen Sie offene<br />
Hände, seien Sie freundschaftlich, lächeln<br />
Sie“. Nach Erfahrung von Rita Erlemann muss<br />
so etwas bewusst eingesetzt werden, um den Dementen<br />
zu etwas zu bewegen, „ihn oder sie nicht<br />
einfach nur betatschen oder aus der Ferne winken,<br />
statt dessen Zu-Wendung, Mut zur Begeg-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 73
unsere nachbarn<br />
74<br />
Rechtliche Faktoren<br />
Gute Pflege kostet viel Geld. Pflegende Angehörige haben Pflichten,<br />
aber auch Rechte. Dennoch - die Kosten für Pflege und Betreuung steigen<br />
wegen der Bevölkerungsentwicklung stetig, und die geht unter anderem<br />
auf die Fortschritte in der Medizin zurück. Auf rechtliche Aspekte<br />
ging Rechtsanwalt Stephan Wittkuhn ein, Spezialist in Sachen<br />
Sozialrecht. Beispielsweise: Sobald die Pflege nicht aus dem eigenen<br />
Einkommen sowie vorrangigen Leistungsgesetzen wie der gesetzlichen<br />
Pflegeversicherung finanziert wird, kommt die Sozialhilfe ins Spiel, geregelt<br />
seit 2005 für nicht Erwerbsfähige und Personen über 65 Jahre im<br />
SGB XII. Für Streitigkeiten sind somit die Sozialgerichte zuständig.<br />
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme: Sozialhilfebedürftigkeit der<br />
Stephan Wittkuhn zu pflegenden/betreuenden Person, Vorliegen einer bestehenden Unterhaltspflicht<br />
der vom Sozialhilfeträger in Anspruch genommenen Person,<br />
Leistungsfähigkeit der unterhaltsverpflichteten Personen. Angesichts der bestehenden<br />
Schwierigkeiten, so Stephan Wittkuhn, sind auch die Sozialämter nicht fehlerlos.<br />
Voraussetzungen des Rückgriffs: Sozialhilfebedürftigkeit der unterhaltsberechtigten Person - zunächst<br />
muss die unterhaltsberechtigte Person ihren Bedarf (Pflege, Betreuung) nicht aus eigenem<br />
Einkommen und Vermögen decken können. Das Sozialamt prüft, ob vielleicht der Sohn zahlen<br />
muss. Hat er kein Einkommen, wohl aber dessen Frau, so muss sie eventuell für die Pflege aufkommen.<br />
Eine Inanspruchnahme entfällt, wenn sie grob unbillig wäre, etwa bei einem vollständigen<br />
Bruch zwischen Eltern und Mindern (Misshandlungen, sexuelle Übergriffe). Ein Rückgriff auf die<br />
Enkel bei Bedürftigkeit der Großeltern findet nicht statt, Verwandtschaft 2. und entfernteren Grades.<br />
Ein Rückgriff findet auch dann nicht statt, wenn Unterhaltsanspruch und Sozialhilfeanspruch<br />
zeitlich nicht deckungsgleich sind. Einen Rückgriff gibt es nur dann, wenn die unterhaltsverpflichtete<br />
Person selbstleistungsfähig ist. Alle diese und andere Faktoren sind nicht abschließend, es ist,<br />
so Stephan Wittkuhn, immer der Einzelfall zu betrachten: „Egal, ob Sie Schulden geltend machen<br />
oder allgemeine Lebenskosten - das Sozialamt wird versuchen, an Ihr Geld zu kommen.“ Es empfiehlt<br />
sich also, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.<br />
nung. Das braucht nicht mal mehr Zeit!“ Weitere<br />
Hinweise: keine langen Sätze, nicht etwas<br />
mit anderen Worten noch einmal erklären wollen,<br />
besser ist es, das Gesagte zu wiederholen:<br />
„Es geht hier nicht um Technik, es geht darum,<br />
dass sich eine Person zur Verfügung stellt!“<br />
Aber: Nicht jeder Angehörige kann der Therapeut<br />
des Kranken sein. Dann empfiehlt es sich,<br />
den kranken Partner abzugeben (Tagespflege,<br />
Betreuungsgruppe). Rita Erlemann erklärt: „Der<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
Demenzkranke ist der Hinterbliebene des Menschen,<br />
der er einmal war. Was bedeutet dann<br />
Trost? Gefühle des Kummers, der Angst, des<br />
Zorns, der Verzweiflung aushalten zu können,<br />
ohne sie verändern zu wollen.“ Und: „Sorgen<br />
Sie als Angehöriger gut für sich, dann können<br />
Sie Wohlbefinden ausstrahlen. Geben Sie klare<br />
Informationen, auf weniges reduziert, unterstützt<br />
von liebevollen Gesten - werden Sie vernünftigerweise<br />
gefühlsbetont!“ (wl)<br />
Liebe Leserinnen und Leser!<br />
Bitte denken Sie daran, dass Sie Ihre Einsendungen auf Chiffre-Anzeigen<br />
direkt an an die die Quintessenz Quintessenz Verlags-GmbH, Verlags-GmbH, Ifenpfad Ifenpfad 2-4, 2-4, 12107 12107 Berlin, Berlin, senden.<br />
Vielen Dank!<br />
Die Redaktion des <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>ischen Ärzteblattes
Folgende Ärzte wurden zur Vertragspraxis<br />
zugelassen. Diese Beschlüsse sind<br />
noch nicht rechtskräftig, sodass hiergegen<br />
noch Widerspruch eingelegt bzw.<br />
Klage erhoben werden kann:<br />
Stadt Flensburg<br />
Herr Dr. med. Sylvio Löhndorf, Facharzt für Urologie,<br />
hat ab 01.07.2007 die Genehmigung zur Verlegung<br />
seiner Vertragspraxis von 24937 Flensburg, Nikolaistraße<br />
1, nach 24937 Flensburg, Südermarkt 1,<br />
erhalten.<br />
Herr Dr. med. Sylvio Löhndorf und Herr Heinrich<br />
Rodewald, Fachärzte für Urologie, haben ab<br />
01.07.2007 die Genehmigung zur Führung einer Berufsausübungsgemeinschaft<br />
in Form einer Gemeinschaftspraxis<br />
in Flensburg erhalten.<br />
Stadt Kiel<br />
Frau Dr. med. Elisabeth Fenner, ausschließlich psychotherapeutisch<br />
tätige Fachärztin für Innere Medizin<br />
in 24103 Kiel, Alter Markt 1-2, hat ab 01.07.2007<br />
die Genehmigung zur Verlegung ihrer Vertragspraxis<br />
nach 24105 Kiel, Holtenauer Straße 93, erhalten.<br />
Die ortsübergreifende Berufsausübungsgemeinschaft<br />
„Abts und Partner“ hat ab 24.05.2007 die<br />
Genehmigung zur Anstellung von Frau Sarah Dunkel<br />
als Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe<br />
in einer Ganztagstätigkeit in Kiel erhalten.<br />
Herr OmedR Dr. med. Gero Rabenhorst, Facharzt<br />
für Pathologie, hat ab 01.07.2007 die Genehmigung<br />
zur Anstellung von Herrn Dr. med. Dirk Janssen als<br />
Facharzt für Pathologie in einer Ganztagstätigkeit in<br />
Kiel erhalten.<br />
Herr OmedR Dr. med. Gero Rabenhorst, Facharzt<br />
für Pathologie, hat ab 01.07.2007 die Genehmigung<br />
zur Anstellung von Frau Rosario Bargallo-Dominguez<br />
als Fachärztin für Pathologie in einer Ganztagstätigkeit<br />
in Kiel erhalten.<br />
Stadt Lübeck<br />
Herr Dr. med. Andreas Mohr, hausärztlich tätiger<br />
Facharzt für Innere Medizin, und Herr Dr. med.<br />
Bernhard Greiling, hausärztlich tätiger Facharzt für<br />
Innere Medizin und Facharzt für Psychosomatische<br />
Medizin und Psychotherapie, Travemünde, haben ab<br />
01.07.2007 gemäß § 32 b Ärzte-ZV in Verbindung<br />
mit den §§ 23 i bis m Bedarfsplanungs-Richtlinie die<br />
Genehmigung zur Beschäftigung von Herrn Kai Stru-<br />
mitteilungen der kassenärztlichen vereinigung<br />
ve als angestellten hausärztlich tätigen Facharzt für<br />
Innere Medizin in einer Dreivierteltagstätigkeit in<br />
Travemünde erhalten.<br />
Frau Elke Meyer, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,<br />
hat ab 01.07.2007 die Genehmigung zur<br />
Verlegung ihrer Vertragspraxis von 23552 Lübeck,<br />
Hundestraße 101, nach 23560 Lübeck, Niendorfer<br />
Straße 65, erhalten.<br />
Der Zulassungsausschuss stellt fest, dass sich ab<br />
01.07.2007 die bisherige ortsübergreifende Berufsausübungsgemeinschaft<br />
in Form einer Gemeinschaftspraxis<br />
zwischen Frau Elke Meyer und Herrn Dr. med.<br />
Martin Bethge in eine ortskonforme Berufsausübungsgemeinschaft<br />
umgewandelt hat.<br />
Frau Dr. med. Gudrun Schmielau, Fachärztin für<br />
Allgemeinmedizin, hat ab 01.07.2007 die Genehmigung<br />
zur Verlegung ihrer Vertragspraxis von 23560<br />
Lübeck, Kronsforder Allee 31, nach 23568 Lübeck,<br />
Mecklenburger Straße 98, erhalten.<br />
Kreis Nordfriesland<br />
Herr Dr. med. Karl-Heinz Brückner, hausärztlich<br />
tätiger Facharzt für Innere Medizin in Westerland/<br />
Sylt, hat mit Wirkung ab 26.04.2007, befristet bis<br />
zum 30.06.2009, die Genehmigung zur partiellen<br />
Teilnahme an der fachärztlichen Versorgung zur<br />
Durchführung von Leistungen gemäß den Nummern<br />
01741, 13400, 13402, 13421, 34230, 34240, 34241,<br />
34242 und 34243 EBM erhalten.<br />
Die Zulassung von Frau Dr. med. Bärbel Mahler als<br />
Fachärztin für Psychotherapeutische Medizin für<br />
25821 Breklum, Carolinenweg 1, wurde in eine solche<br />
als Fachärztin für Psychosomatische Medizin und<br />
Psychotherapie umgewandelt.<br />
Frau Dr. med. Sybille Langenstein, hausärztlich tätige<br />
Fachärztin für Innere Medizin in Niebüll, hat ab<br />
24.05.2007, befristet bis zum 30.06.2009, eine Genehmigung<br />
zur partiellen Teilnahme an der fachärztlichen<br />
Versorgung zur Durchführung der in der Nummer<br />
13400 EBM enthaltenen Leistungen erhalten.<br />
Kreis Pinneberg<br />
Frau Regina Gruszka, Fachärztin für Psychosomatische<br />
Medizin und Psychotherapie in 22869 Schenefeld,<br />
Kurzer Kamp 14, hat die Genehmigung zur Verlegung<br />
ihrer Vertragspraxis nach 22869 Schenefeld,<br />
Holstenplatz 8, erhalten.<br />
Kreis Rendsburg-Eckernförde<br />
Herr Dr. med. Dr. jur. Michael Steen, fachärztlich<br />
tätiger Facharzt für Innere Medizin, Frau Dr. med.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 75
mitteilungen der kassenärztlichen vereinigung<br />
76<br />
Annette Sturm-Steen, Frau Dörte Paulsen und Herr<br />
Arnd Kummerfeldt, Fachärzte für Allgemeinmedizin<br />
in 24340 Eckernförde, Langebrückstraße 10, und<br />
Herr Dr. med. Hans Heinicke, Facharzt für Allgemeinmedizin<br />
in 24340 Eckernförde, Kieler Straße 72,<br />
haben ab 01.07.2007 die Genehmigung zur Führung<br />
einer versorgungsbereichsübergreifenden und überörtlichen<br />
Berufsausübungsgemeinschaft in Form einer<br />
Gemeinschaftspraxis erhalten.<br />
Kreis <strong>Schleswig</strong>-Flensburg<br />
Herr Dr. med. Hans-Henning Buske, Herr Dr. med.<br />
Wolfgang Mehne und Frau Dr. med. Gyde Rodewald,<br />
Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe<br />
in <strong>Schleswig</strong>, haben ab 01.07.2007 gemäß § 32 b<br />
Ärzte-ZV in Verbindung mit den §§ 23 i bis m Bedarfsplanungs-Richtlinie<br />
die Genehmigung zur Beschäftigung<br />
von Herrn Jochen Bühl als angestellten<br />
Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in einer<br />
Ganztagstätigkeit in <strong>Schleswig</strong> erhalten.<br />
Kreis Segeberg<br />
Herr Dr. med. Klaus Fleischhack, Frau Marina Kardorf-Metsis,<br />
Fachärzte für Allgemeinmedizin, und<br />
Herr Dr. med. Michael Pfeifer, hausärztlich tätiger<br />
Facharzt für Innere Medizin, haben ab 01.07.2007 die<br />
Genehmigung zur Führung einer Berufsausübungsgemeinschaft<br />
in Form einer Gemeinschaftspraxis in<br />
Leezen erhalten.<br />
Herr Dr. med. Klaus Fleischhack, Frau Marina Kardorf-Metsis,<br />
Fachärzte für Allgemeinmedizin, und<br />
Herr Dr. med. Michael Pfeifer, hausärztlich tätiger<br />
Facharzt für Innere Medizin, haben ab 01.07.2007 die<br />
Genehmigung zur Anstellung von Herrn Dr. med.<br />
Michael Borgner als Facharzt für Allgemeinmedizin<br />
in einer Ganztagstätigkeit in Leezen erhalten.<br />
Dem „Kardiologischen Versorgungszentrum Segeberger<br />
Kliniken GmbH“, Norderstedt, wurde ab<br />
01.07.2007 die Anstellung von Frau Dr. med. Marina<br />
Gebhard, als Fachärztin für Innere Medizin und<br />
Fachärztin für Innere Medizin, Schwerpunkt Kardiologie,<br />
in einer Ganztagstätigkeit genehmigt.<br />
Dem „Kardiologischen Versorgungszentrum Segeberger<br />
Kliniken GmbH“, Norderstedt, wurde ab<br />
01.07.2007 die Anstellung von Herrn Michael Dolff<br />
als prakt. Arzt als Nachfolger für Frau Dr. Gebhard in<br />
einer Ganztagstätigkeit genehmigt.<br />
Das „Kardiologische Versorgungszentrum Segeberger<br />
Kliniken GmbH“, Norderstedt, erhält gemäß §<br />
103 Abs. 4 a Satz 1 SGB V die Genehmigung zur Anstellung<br />
von Herrn Willy Tegen in einer Ganztagstätigkeit<br />
ab 01.07.2007 als Facharzt für Innere Medizin<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
und Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt Kardiologie,<br />
in Norderstedt.<br />
Kreis Steinburg<br />
Die Zulassung von Frau Dipl.-Med. Petra Dörr,<br />
prakt. Ärztin in Itzehoe, wurde in eine solche als<br />
Fachärztin für Allgemeinmedizin umgewandelt.<br />
Herr Stephan Schreiber, prakt. Arzt, hat ab 01.07.2007<br />
gemäß § 95 Abs. 9 SGB V die Genehmigung zur Anstellung<br />
von Herrn Dr. med. Matthias Johansons als<br />
Facharzt für Allgemeinmedizin in einer Ganztagstätigkeit<br />
in 25524 Itzehoe, Sandberg 38, erhalten.<br />
Kreis Stormarn<br />
Herr Marek Rossmann, Facharzt für Allgemeinmedizin,<br />
hat ab 01.07.2007 die Genehmigung zur Verlegung<br />
seiner Vertragspraxis von 22926 Ahrensburg,<br />
Hamburger Straße 10, nach 22926 Ahrensburg, Große<br />
Straße 28-30, erhalten.<br />
Herr Dr. med. Jan Philip Wegner, hausärztlich tätiger<br />
Facharzt für Innere Medizin, hat ab 01.07.2007<br />
die Genehmigung zur Verlegung seiner Vertragspraxis<br />
von 22926 Ahrensburg, Hamburger Straße 10,<br />
nach 22926 Ahrensburg, Große Straße 28-30, erhalten.<br />
Herr Peter Kralisch, prakt. Arzt, hat ab 01.07.2007<br />
die Genehmigung zur Verlegung seiner Vertragspraxis<br />
von 22926 Ahrensburg, Hamburger Straße 10,<br />
nach 22926 Ahrensburg, Große Straße 28-30, erhalten.<br />
Frau Dr. med. Gertrud Reingruber, Fachärztin für<br />
Kinder- und Jugendmedizin, hat ab 01.10.2007 die<br />
Genehmigung zur Verlegung ihrer Vertragspraxis von<br />
22927 Großhansdorf, Ahrensfelder Weg 1, nach<br />
22927 Großhansdorf, Sieker Landstraße 122-124, erhalten.<br />
Frau Bärbel Petermann, Fachärztin für Kinder- und<br />
Jugendmedizin, hat ab 01.10.2007 die Genehmigung<br />
zur Verlegung ihrer Vertragspraxis von 22926 Ahrensburg,<br />
Große Straße 2, nach 22927 Großhansdorf,<br />
Sieker Landstraße 122-124, erhalten.<br />
Das „Medizinische Versorgungszentrum Bad Oldesloe“<br />
wurde mit Wirkung ab 01.07.2007 für 23843<br />
Bad Oldesloe, Schützenstraße 55, zugelassen.<br />
Das „Medizinische Versorgungszentrum Bad Oldesloe“<br />
hat gemäß § 103 Abs. 4 a Satz 1 SGB V die<br />
Genehmigung zur Anstellung von Herrn Dr. med.<br />
Dietrich Schulz in einer Ganztagstätigkeit ab<br />
01.07.2007 als Facharzt für Diagnostische Radiologie<br />
in Bad Oldesloe erhalten.
Das „Medizinische Versorgungszentrum Bad Oldesloe“<br />
hat gemäß § 103 Abs. 4 a Satz 1 SGB V die<br />
Genehmigung zur Anstellung von Frau Dr. med. Heike<br />
Fink in einer Ganztagstätigkeit ab 01.07.2007 als<br />
hausärztlich tätige Fachärztin für Innere Medizin in<br />
Bad Oldesloe erhalten.<br />
Folgende Ärzte wurden rechtskräftig zur<br />
Vertragspraxis zugelassen:<br />
Stadt Flensburg<br />
Frau Dr. med. Kerstin Först-Hädicke ab 08.03.2007<br />
gemäß § 101 Abs. 1 Nr. 4 sowie Abs. 3 Satz 1 SGB V<br />
(Job-Sharing) in Verbindung mit den Nummern 23 a<br />
bis g Bedarfsplanungs-Richtlinien-Ärzte als Fachärztin<br />
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe für 24937<br />
Flensburg, Holm 45.<br />
Die Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe,<br />
Herr Viktor Moldaschl und Frau Dr. med. Kerstin<br />
Först-Hädicke, haben ab 08.03.2007 die Genehmigung<br />
zur Führung einer Gemeinschaftspraxis in<br />
Flensburg erhalten.<br />
Stadt Kiel<br />
Herr Dr. med. Stephan Lischner 01.04.2007 als<br />
Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten für<br />
24103 Kiel, Schlossgarten 13.<br />
Herr Dr. med. Stephan Lischner und Frau Martina<br />
Podszuweit haben mit Wirkung ab 01.04.2007 die<br />
Genehmigung zur Führung einer Berufsausübungsgemeinschaft<br />
als Fachärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten<br />
in Kiel erhalten.<br />
Herr Henning Mansfeld ab 01.04.2007 als Facharzt<br />
für Nervenheilkunde für 24105 Kiel, Holtenauer<br />
Straße 114 a.<br />
Herr Dr. med. Dirk Janssen ab 01.04.2007 als Facharzt<br />
für Pathologie für 24106 Kiel, Am Tannenberg<br />
85 a.<br />
Frau Anke Prczygodda-Willeitner ab 01.04.2007 als<br />
Fachärztin für Allgemeinmedizin für 24149 Kiel, Poggendörper<br />
Weg 3-9.<br />
Stadt Lübeck<br />
Herr Jörn Burfeind ab 01.04.2007 als Facharzt für Allgemeinmedizin<br />
für 23568 Lübeck, Luisenstraße 9-11.<br />
Herr Dr. med. Sven Gutsche ab 01.04.2007 als Facharzt<br />
für Kinder- und Jugendmedizin für 23564 Lübeck,<br />
Stresemannstraße 4.<br />
Herr Dr. med. Bernhard Jahrbeck ab 01.04.2007 als<br />
Facharzt für Innere Medizin und Facharzt für Innere<br />
mitteilungen der kassenärztlichen vereinigung<br />
Medizin, Schwerpunkt Nephrologie, für 23562 Lübeck,<br />
Ratzeburger Allee 160.<br />
Herr Dr. med. Bernhard Jahrbeck, Herr Prof. Dr.<br />
med. habil. Lutz Fricke und Herr Dr. med. Rolf Winterhoff<br />
haben ab 01.04.2007 die Genehmigung zur<br />
Führung einer Gemeinschaftspraxis als Fachärzte für<br />
Innere Medizin und Fachärzte für Innere Medizin,<br />
Schwerpunkt Nephrologie, in Lübeck erhalten.<br />
Herr Dr. med. Björn Mayer ab dem 01.04.2007 als<br />
Facharzt für Innere Medizin und Facharzt für Innere<br />
Medizin, Schwerpunkt Kardiologie, für 23560 Lübeck,<br />
Kronsforder Allee 3 b.<br />
Herr Dr. med. Bernhard Greiling, Facharzt für Allgemeinmedizin<br />
in Lübeck, ab 01.07.2007 zusätzlich als<br />
Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie<br />
für 23570 Lübeck, Am Dreilingsberg 7.<br />
Herr Dr. med. Volker Deseniß ab 01.07.2007 als<br />
Facharzt für Innere Medizin und Facharzt für Innere<br />
Medizin, Schwerpunkt Angiologie, sowie als Facharzt<br />
für Innere Medizin und Facharzt für Innere Medizin,<br />
Schwerpunkt Kardiologie, für 23564 Lübeck, Ratzeburger<br />
Allee 14 b.<br />
Stadt Neumünster<br />
Herr Dr. med. René Schwall ab 01.04.2007 als Facharzt<br />
für Orthopädie und Unfallchirurgie für 24539<br />
Neumünster, Wittorfer Straße 89.<br />
Herr Dr. med. Carl-Christian Büll, Facharzt für Orthopädie<br />
in Kronshagen, Herr Dr. med. René Schwall,<br />
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie in Neumünster,<br />
Herr Priv.-Doz. Dr. med. habil. Ludger Josef<br />
Gerdesmeyer, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie<br />
in Kronshagen, und Herr Dr. med. Wolfgang<br />
Kohlsche, Facharzt für Orthopädie in Bornhöved,<br />
haben die Genehmigung zur Führung einer ortsübergreifenden<br />
Berufsausübungsgemeinschaft in<br />
Form einer Gemeinschaftspraxis erhalten.<br />
Kreis Nordfriesland<br />
Frau Elke Behling ab 08.03.2007 als prakt. Ärztin für<br />
25980 Westerland/Sylt, Friedrichstraße 9.<br />
Kreis Pinneberg<br />
Frau Anja Seiler ab 01.03.2007 gemäß § 101 Abs. 1<br />
Nr. 4 sowie Abs. 3 Satz 1 SGB V (Job-Sharing) in<br />
Verbindung mit den Nrn. 23 a bis g Bedarfsplanungs-<br />
Richtlinien-Ärzte als Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin<br />
für 25421 Pinneberg, Dingstätte 27.<br />
Frau Anja Seiler, Frau Dipl.-Med. Petra Theuerkorn<br />
und Herr Dr. med. Dirk Hillebrand, Fachärzte für<br />
Kinder- und Jugendmedizin, haben mit Wirkung ab<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 77
mitteilungen der kassenärztlichen vereinigung<br />
78<br />
01.03.2007 die Genehmigung zur Führung einer Berufsausübungsgemeinschaft<br />
in Pinneberg erhalten.<br />
Frau Dr. med. Britt Günther ab 08.02.2007 gemäß §<br />
101 Abs. 1 Nr. 4 sowie Abs. 3 Satz 1 SGB V (Job-<br />
Sharing) in Verbindung mit den Nrn. 23 a bis g Bedarfsplanungs-Richtlinien-Ärzte<br />
als hausärztlich tätige<br />
Fachärztin für Innere Medizin für 25436 Tornesch,<br />
Wilhelmstraße 2.<br />
Frau Dr. med. Britt Günther, Herr Dr. med. Meinhard<br />
Sziegoleit, hausärztlich tätige Fachärzte für Innere<br />
Medizin, und Herr Dr. med. Matthias Bohnsack,<br />
Facharzt für Innere Medizin und Facharzt für Innere<br />
Medizin, Schwerpunkt Kardiologie, haben mit Wirkung<br />
ab 01.04.2007 die Genehmigung zur Führung<br />
einer versorgungsbereichsübergreifenden Berufsausübungsgemeinschaft<br />
in Tornesch erhalten.<br />
Kreis Plön<br />
Herr Jens Kohn ab 01.04.2007 als Facharzt für Allgemeinmedizin<br />
für 24217 Schönberg, Bahnhofstraße 20.<br />
Kreis Rendsburg-Eckernförde<br />
Frau Dr. med. Corinna Walter ab 01.07.2007 als<br />
Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe für<br />
24214 Gettorf, Bergstraße 20.<br />
Herr Dr. med. Florian Bosse ab 01.04.2007 als Facharzt<br />
für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde für 24220 Flintbek,<br />
Rosenberg 22.<br />
Frau Dr. med. Marina Zachariah ab 01.04.2007 als<br />
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und<br />
-psychotherapie für 24340 Eckernförde, Hindenburgstraße<br />
4.<br />
Frau Dr. med. Amrey Stübinger ab 01.04.2007 gemäß<br />
§ 101 Abs. 1 Nr. 4 sowie Abs. 3 Satz 1 SGB V<br />
(Job-Sharing) in Verbindung mit den Nummern 23 a<br />
bis g Bedarfsplanungs-Richtlinien-Ärzte als Fachärztin<br />
für Kinder- und Jugendmedizin für 24119 Kronshagen,<br />
Kopperpahler Allee 121.<br />
Die Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin, Herr<br />
Manfred Lübke und Frau Dr. med. Amrey Stübinger,<br />
haben ab 01.04.2007 die Genehmigung zur Führung<br />
einer Gemeinschaftspraxis in Kronshagen erhalten.<br />
Herr Jens-Uwe Schneider ab 01.04.2007 als Facharzt<br />
für Allgemeinmedizin für 24800 Elsdorf-Westermühlen,<br />
Dorfstraße 27 a.<br />
Die Fachärzte für Allgemeinmedizin, Frau Dr. med.<br />
Margret Hinrichs, Herr Jens-Uwe Schneider und<br />
Herr Rolf Killmer, prakt. Arzt, haben ab 01.04.2007<br />
die Genehmigung zur Führung einer Berufsausübungsgemeinschaft<br />
in Elsdorf-Westermühlen erhalten.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
Herr Dr. med. Florian Bosse, Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde,<br />
Rosenberg 22, 24220 Flintbek,<br />
hat ab 01.04.2007 die Genehmigung zur Verlegung<br />
seiner Vertragspraxis nach 24768 Rendsburg, Moltkestraße<br />
1, erhalten.<br />
Herr Herbert Klenk und Herr Dr. med. Florian Bosse,<br />
Fachärzte für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, haben<br />
mit Wirkung ab 01.04.2007 die Genehmigung zur<br />
Führung einer Berufsausübungsgemeinschaft in<br />
Rendsburg, erhalten.<br />
Herr Dr. med. Carl-Christian Büll, Facharzt für Orthopädie<br />
in Kronshagen, Herr Dr. med. René Schwall,<br />
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie in Neumünster,<br />
Herr Priv.-Doz. Dr. med. habil. Ludger Josef<br />
Gerdesmeyer, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie<br />
in Kronshagen, und Herr Dr. med. Wolfgang<br />
Kohlsche, Facharzt für Orthopädie in Bornhöved,<br />
haben die Genehmigung zur Führung einer ortsübergreifenden<br />
Berufsausübungsgemeinschaft in<br />
Form einer Gemeinschaftspraxis erhalten.<br />
Kreis <strong>Schleswig</strong>-Flensburg<br />
Frau Ulrike Prehn ab 01.04.2007 als Fachärztin für<br />
Augenheilkunde für 24955 Harrislee, Zur Höhe 12.<br />
Herr Dr. med. Jasper Malkus ab 01.04.2007 als Facharzt<br />
für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde für 24837<br />
<strong>Schleswig</strong>, Plessenstraße 13.<br />
Kreis Segeberg<br />
Herr Dr. med. Alexander Weise ab 01.04.2007 als<br />
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin für 24568<br />
Kaltenkirchen, Am Markt 6.<br />
Herr Dr. med. Alexander Weise und Frau Sylke<br />
Neumann haben ab 01.04.2007 die Genehmigung<br />
zur Führung einer Gemeinschaftspraxis als Fachärzte<br />
für Kinder- und Jugendmedizin in Kaltenkirchen erhalten.<br />
Herr Dr. med. Thomas Flamm ab 01.04.2007 als<br />
Facharzt für Allgemeinmedizin für 22851 Norderstedt,<br />
Tangstedter Landstraße 532.<br />
Herr Dr. med. Carl-Christian Büll, Facharzt für Orthopädie<br />
in Kronshagen, Herr Dr. med. René Schwall,<br />
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie in Neumünster,<br />
Herr Priv.-Doz. Dr. med. habil. Ludger Josef<br />
Gerdesmeyer, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie<br />
in Kronshagen, und Herr Dr. med. Wolfgang<br />
Kohlsche, Facharzt für Orthopädie in Bornhöved,<br />
haben die Genehmigung zur Führung einer ortsübergreifenden<br />
Berufsausübungsgemeinschaft in<br />
Form einer Gemeinschaftspraxis erhalten.
Die bis zum 30.06.2007 befristete Ermächtigung von<br />
Herrn Andreas Steimann, Oberarzt des Psychiatrischen<br />
Zentrums Rickling, wurde bis zum 30.06.2009<br />
verlängert und mit Wirkung ab 26.04.2007 von Amts<br />
wegen um die Durchführung von Leistungen gemäß<br />
der Nummern 32137 und 32140 bis 32148 EBM erweitert.<br />
Kreis Steinburg<br />
Frau Vidmanta Sarach ab 01.06.2007 als Fachärztin<br />
für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde für 25524 Itzehoe,<br />
Hanseatenplatz 1.<br />
Herrn Dr. med. Jörg Promies ab 01.04.2007 als Facharzt<br />
für Allgemeinmedizin für 25566 Lägerdorf, Dorfstraße<br />
28.<br />
Frau Julia Benteler ab 08.02.2007 als Fachärztin für<br />
Innere Medizin und Fachärztin für Innere Medizin,<br />
Schwerpunkt Pneumologie, im Rahmen einer Sonderbedarfsfeststellung<br />
gemäß dem 5. Abschnitt Nr.<br />
24 b Bedarfsplanungs-Richtlinien-Ärzte für 25524 Itzehoe,<br />
Kirchenstraße 18. Die Zulassung erfolgt mit<br />
der Maßgabe, dass nur die ärztlichen Leistungen abrechnungsfähig<br />
sind, die die Schwerpunktbezeichnung<br />
Pneumologie umfassen. Diese Leistungsbeschränkung<br />
endet, wenn der Landesausschuss für den<br />
Kreis Steinburg feststellt, dass eine Überversorgung<br />
gemäß § 103 Abs. 1 und 3 SGB V in der bedarfsplanerischen<br />
Gruppe der an der fachärztlichen Versorgung<br />
teilnehmenden Internisten nicht mehr besteht.<br />
Kreis Stormarn<br />
Herr Dr. med. Ulrich Fritz, bisher als hausärztlich<br />
tätiger Facharzt für Innere Medizin in der Sophienstraße<br />
7, 21465 Reinbek, zur Vertragspraxis zugelassen<br />
und niedergelassen, wurde im Rahmen einer Sonderbedarfsfeststellung<br />
als Facharzt für Innere Medizin<br />
und Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt Hämatologie<br />
und Internistische Onkologie, nach Nr. 24<br />
b Bedarfsplanungs-Richtlinien-Ärzte mit Wirkung ab<br />
01.04.2007 für Reinbek zugelassen. Die Zulassung erfolgt<br />
mit der Maßgabe, dass nur die ärztlichen Leistungen<br />
abrechnungsfähig sind, die die Schwerpunktbezeichnung<br />
Hämatologie und Internistische Onkologie,<br />
umfassen. Diese Leistungsbeschränkung endet,<br />
wenn der Landesausschuss für den Kreis Stormarn<br />
feststellt, dass eine Überversorgung gemäß § 103 Abs.<br />
1 und 3 SGB V in der bedarfsplanerischen Gruppe<br />
der an der fachärztlichen Versorgung teilnehmenden<br />
Internisten nicht mehr besteht.<br />
Herr Dr. med. Friedrich Bernhardt ab 01.04.2007 als<br />
Facharzt für Urologie für 21465 Reinbek, Schmiedesberg<br />
3.<br />
mitteilungen der kassenärztlichen vereinigung<br />
Folgende Ärzte bzw. Krankenhäuser<br />
wurden zur Teilnahme an der vertragsärztlichen<br />
Überweisungspraxis ermächtigt.<br />
Diese Beschlüsse sind noch nicht<br />
rechtskräftig, sodass hiergegen noch<br />
Widerspruch eingelegt bzw. Klage erhoben<br />
werden kann:<br />
Kreis Herzogtum Lauenburg<br />
Die bis zum 30.09.2007 befristete Ermächtigung von<br />
Herrn Dr. med. Volker Penselin, Oberarzt der Inneren<br />
Abteilung des Johanniter-Krankenhauses Geesthacht,<br />
wurde bis zum 30.09.2009 verlängert.<br />
Stadt Lübeck<br />
Herr Prof. Dr. med. Thomas Hütteroth, Ärztlicher<br />
Direktor und Chefarzt der Medizinischen Klinik der<br />
Sana Kliniken Lübeck GmbH, Krankenhaus Süd,<br />
wurde mit Wirkung ab 01.07.2007, befristet bis zum<br />
30.06.2009, längstens jedoch bis zum Ende seiner<br />
ärztlichen Tätigkeit an vorgenannter Klinik, ermächtigt<br />
zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Überweisungspraxis<br />
zur Durchführung der nachstehend aufgeführten<br />
Leistungen:<br />
1. Endoskopische Ultraschalluntersuchungen (EUS)<br />
von Ösophagus, Magen, Pankreas und Gallenwegen<br />
gemäß den Leistungen der Nummern 13400,<br />
33042 und 33090 EBM.<br />
2. Rektaler Ultraschall von Erkrankungen des Rektums,<br />
d. h. insbesondere Tumorstaging und Nachsorge<br />
gemäß den Leistungen der Nummern 13400,<br />
33042 und 33090 EBM.<br />
3. Duplexsonographie der Pfortader, Lebervenen, des<br />
Tr.coeliacus, der a. mes. sup. und der Nierenarterien<br />
sowie der Nierenvenen im Zusammenhang mit<br />
gefäßchirurgischen Maßnahmen und Endosonograhie<br />
gemäß den Leistungen der Nummern 33073<br />
und 33075 EBM.<br />
4. Wechsel von Gallenwegsprothesen, und Pankreasprothesen,<br />
ggf. mit sonographischer Kontrolle gemäß<br />
den Leistungen der Nummer 13431 EBM.<br />
5. Laserung von Tumorstenosen in Ösophagus, Magen<br />
und Rektum gemäß den Leistungen der Nummern<br />
13400, 13410 und 13424 EBM.<br />
6. Konsiliarische Beratung bei Patienten mit speziellen<br />
hepatologischen Problemen auf Überweisung<br />
durch Ärzte für Innere Medizin. In diesem Zusam-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 79
mitteilungen der kassenärztlichen vereinigung<br />
80<br />
menhang sind lediglich die Gebührenpositionen<br />
01310, 01311, 01312, 01601, 01602 und 13220<br />
EBM abrechnungsfähig.<br />
7. Dilatations- und Bougierungsbehandlungen von<br />
Stenosen im Ösophagus und Rektum gemäß den<br />
Leistungen der Nummern 13257, 13400 und<br />
13410 EBM.<br />
8. Durchführung der Argon-Plasma-Koagulation<br />
(Nummer 13424 EBM im Zusammenhang mit<br />
Nummer 13257 oder 13400 EBM) für<br />
a) Blutstillungstherapie bei<br />
- diffusen Tumorblutungen im Ösophagus, Magen<br />
und Rektum,<br />
- Angiodysplasien und „Wassermelonenmagen“,<br />
- Ulcus ventriculi et duodeni,<br />
b) flankierende Therapie zur Eröffnung von narbigen<br />
Stenosen im Ösophagus, Magen und Rektum<br />
und zur Dilatations- und Bougierungsbehandlung.<br />
Herr Dr. med. Eike Burmester, Oberarzt an der Medizinischen<br />
Klinik der Sana Kliniken Lübeck GmbH,<br />
Krankenhaus Süd, wurde mit Wirkung ab 01.07.2007,<br />
befristet bis zum 30.06.2009, längstens jedoch bis zum<br />
Ende seiner ärztlichen Tätigkeit an vorgenannter Klinik,<br />
ermächtigt zur Teilnahme an der vertragsärztlichen<br />
Überweisungspraxis zur Durchführung der<br />
nachstehend aufgeführten Leistungen:<br />
1. Endoskopische Ultraschalluntersuchungen (EUS)<br />
von Ösophagus, Magen, Pankreas und Gallenwegen<br />
gemäß den Leistungen der Nummern 13400,<br />
33042 und 33090 EBM.<br />
2. Rektaler Ultraschall von Erkrankungen des Rektums,<br />
d. h. insbesondere Tumorstaging und Nachsorge<br />
gemäß den Leistungen der Nummern 13400,<br />
33042 und 33090 EBM.<br />
3. Duplexsonographie der Pfortader, Lebervenen, des<br />
Tr.coeliacus, der a. mes. sup. und der Nierenarterien<br />
sowie der Nierenvenen im Zusammenhang mit<br />
gefäßchirurgischen Maßnahmen und Endosonograhie<br />
gemäß den Leistungen der Nummern 33073<br />
und 33075 EBM.<br />
4. Wechsel von Gallenwegsprothesen, und Pankreasprothesen,<br />
ggf. mit sonographischer Kontrolle gemäß<br />
den Leistungen der Nummer 13431 EBM.<br />
5. Laserung von Tumorstenosen in Ösophagus, Magen<br />
und Rektum gemäß den Leistungen der Nummern<br />
13400, 13410 und 13424 EBM.<br />
6. Konsiliarische Beratung bei Patienten mit speziellen<br />
hepatologischen Problemen auf Überweisung<br />
durch Ärzte für Innere Medizin. In diesem Zusam-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
menhang sind lediglich die Gebührenpositionen<br />
01310, 01311, 01312, 01601, 01602 und 13220<br />
EBM abrechnungsfähig.<br />
7. Dilatations- und Bougierungsbehandlungen von<br />
Stenosen im Ösophagus und Rektum gemäß den<br />
Leistungen der Nummern 13257, 13400 und<br />
13410 EBM.<br />
8. Durchführung der Argon-Plasma-Koagulation<br />
(Nummer 13424 EBM im Zusammenhang mit den<br />
Nummern 13257 oder 13400 EBM) für<br />
a) Blutstillungstherapie bei<br />
- diffusen Tumorblutungen im Ösophagus, Magen<br />
und Rektum,<br />
- Angiodysplasien und „Wassermelonenmagen“,<br />
- Ulcus ventriculi et duodeni,<br />
b) flankierende Therapie zur Eröffnung von narbigen<br />
Stenosen im Ösophagus, Magen und Rektum<br />
und zur Dilatations- und Bougierungsbehandlung,<br />
9. Durchführung der Manometrie/LZ-pH-Metrie des<br />
Ösophagus auf Überweisung durch gastroenterologisch<br />
tätige Ärzte gemäß den Leistungen der Nummer<br />
13401 EBM.<br />
Die bis zum 30.09.2007 befristete Ermächtigung von<br />
Herrn Dr. med. Wolfram Höche, Chefarzt der Abteilung<br />
für Radiologie und Nuklearmedizin der Sana<br />
Kliniken Lübeck GmbH, Krankenhaus Süd, wurde<br />
bis zum 30.09.2009 verlängert.<br />
Stadt Neumünster<br />
Die bis zum 30.06.2007 befristeten Ermächtigungen<br />
von Herrn Werner Wortmann und Herrn Dr. med.<br />
Klaus Wittmaack, Ltd. Oberärzte an der Klinik für<br />
Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin des<br />
Friedrich-Ebert-Krankenhauses Neumünster GmbH,<br />
wurden bis zum 30.06.2009 verlängert.<br />
Die bis zum 30.06.2007 befristete Ermächtigung von<br />
Frau Dr. med. Frauke Strahlendorf-Elsner, Ltd.<br />
Oberärztin des Zentrallaboratoriums am Friedrich-<br />
Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH, wurde bis<br />
zum 30.06.2009 verlängert.<br />
Kreis Nordfriesland<br />
Die bis zum 30.06.2007 befristete Ermächtigung von<br />
Herrn Dr. med. Rolf Schneider, Chefarzt der Abteilung<br />
Chirurgie/Phlebologie am Klinikum Nordfriesland<br />
gGmbH, Klinik Tönning, wurde bis zum<br />
30.06.2009 verlängert.<br />
Herr Dr. med. Johannes Matthias, Funktionsoberarzt<br />
an der Fachklinik Satteldüne, Nebel/Amrum, wurde
mit Wirkung ab 24.05.2007, befristet bis zum<br />
30.09.2008, längstens jedoch bis zum Ende seiner<br />
ärztlichen Tätigkeit an vorgenannter Klinik, ermächtigt<br />
zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung<br />
zur Durchführung der nachstehend aufgeführten<br />
Leistungen auf Überweisung durch den ermächtigten<br />
Arzt Herrn Dr. med. Gerd Hüls:<br />
- Sonographie des Abdomens und Retroperitoneum,<br />
einschließlich Nieren bei Kindern, B-Mode,<br />
- Sonographie der Uro-Genitalorgane, ohne weibliche<br />
Genitale, B-Mode,<br />
- Sonographie der Säuglingshüfte.<br />
Im Rahmen dieser Ermächtigung sind die Nummern<br />
01722, 33042, 33043 und 33051 EBM abrechenbar.<br />
Kreis Plön<br />
Die Ermächtigung der Psychiatrischen Tagesklinik<br />
„Die Brücke“, Preetz, gemäß § 118 SGB V als psychiatrische<br />
Institutsambulanz wurde mit Wirkung ab<br />
24.05.2007 hinsichtlich des Überweisungsvorbehaltes<br />
wie folgt abgeändert:<br />
Die Psychiatrische Tagesklinik „Die Brücke“ ist ermächtigt<br />
als psychiatrische Institutsambulanz gemäß<br />
§ 118 SGB V zur ambulanten psychiatrischen und<br />
psychotherapeutischen Behandlung und zwar beschränkt<br />
auf folgende Diagnosebereiche:<br />
- Psychosen,<br />
- schwere Verläufe bei Suchterkrankungen,<br />
- psychisch Kranke mit schweren Nachfolgekrankheiten.<br />
Kreis Rendsburg-Eckernförde<br />
Herr Dr. med. Dirk Johnsen, Oberarzt der Klinik für<br />
Kinder- und Jugendmedizin am Kreiskrankenhaus<br />
Rendsburg-Eckernförde, Rendsburg, wurde mit Wirkung<br />
ab 01.07.2007, befristet bis zum 30.06.2009,<br />
längstens jedoch bis zum Ende seiner ärztlichen Tätigkeit<br />
an vorgenannter Klinik, ermächtigt zur Teilnahme<br />
an der vertragsärztlichen Versorgung zur<br />
- Durchführung von Sonographien zwecks differenzialdiagnostischer<br />
Abklärung auf Überweisung solcher<br />
Vertragsärzte, die sonographische Untersuchungen<br />
durchführen. In diesem Zusammenhang<br />
sind die Nummern 01722, 33042, 33043, 33051,<br />
33052, 33081, 33090 und 33092 EBM abrechenbar.<br />
- Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes<br />
mellitus. Insoweit sind folgende EBM-Ziffern<br />
abrechenbar: 01310, 01311, 04120, 01601, 01602,<br />
32030, 32031, 32057 und 32094,<br />
- Mitbetreuung von Kindern und Jugendlichen mit<br />
einer hämatologischen und onkologischen Grunderkrankung<br />
auf Überweisung durch Vertragsärzte<br />
mitteilungen der kassenärztlichen vereinigung<br />
(Nummern 01310, 01311, 04311, 01601, 01602,<br />
02100 EBM),<br />
- Durchführung von konsiliarischen Beratungen und<br />
Untersuchungen in ausgewählt schwierigen Fällen<br />
zur Abklärung des weiteren diagnostischen und therapeutischen<br />
Vorgehens auf Überweisung durch<br />
Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin. Insoweit<br />
sind lediglich die EBM-Nummern 01310, 01311 sowie<br />
01601 und 01602 abrechenbar sowie im Einzelfall<br />
sonographische Leistungen.<br />
Die bis zum 30.06.2007 befristete Ermächtigung von<br />
Herrn Dr. med. Hans-Carsten Joachim, Oberarzt der<br />
Medizinischen Klinik am Kreiskrankenhaus Rendsburg-Eckernförde,<br />
Eckernförde, wurde bis zum<br />
30.06.2009 verlängert.<br />
Die bis zum 30.06.2007 befristete Ermächtigung von<br />
Frau Dr. med. Karin Oltmann, Oberärztin der Abteilung<br />
Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und<br />
Schmerztherapie am Kreiskrankenhaus Rendsburg-<br />
Eckernförde, Rendsburg, wurde bis zum 30.06.2009<br />
verlängert.<br />
Die bis zum 30.09.2007 befristete Ermächtigung von<br />
Herrn Prof. Dr. med. Oliver Behrens, Chefarzt der<br />
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Kreiskrankenhaus<br />
Rendsburg-Eckernförde, Rendsburg,<br />
wurde bis zum 30.09.2009 verlängert.<br />
Die Ermächtigung von Herrn Prof. Dr. med. Joachim<br />
Brossmann, Chefarzt der Abteilung Diagnostische<br />
und Interventionelle Radiologie des Kreiskrankenhauses<br />
Rendsburg-Eckernförde, Rendsburg, zur Teilnahme<br />
an der vertragsärztlichen Versorgung als Programmverantwortlicher<br />
Arzt (PVA) im Rahmen der<br />
Früherkennung von Brustkrebs durch Mammographie-Screening<br />
gemäß Anlage 9.2 BMV-Ä/EKV wurde<br />
dahingehend berichtigt, dass sie bis zum<br />
30.06.2017 befristet ist.<br />
Kreis Steinburg<br />
Die bis zum 30.06.2007 befristete Ermächtigung von<br />
Herrn Dr. med. Wolfram Kluge, Funktionsoberarzt<br />
der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin<br />
der Klinik für Anästhesiologie, Operative Intensivmedizin/Schmerztherapie<br />
am Klinikum Itzehoe, wurde<br />
bis zum 30.06.2009 verlängert.<br />
Herr Dr. med. Hartmut Wegener, Oberarzt der Klinik<br />
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum<br />
Itzehoe, wurde mit Wirkung ab 01.07.2007, befristet<br />
bis zum 30.06.2009, längstens jedoch bis zum<br />
Ende seiner ärztlichen Tätigkeit an vorgenannter Klinik,<br />
ermächtigt zur Teilnahme an der vertragsärztlichen<br />
Versorgung zur Durchführung von konsiliari-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 81
mitteilungen der kassenärztlichen vereinigung<br />
82<br />
schen Beratungen und Untersuchungen zur Abklärung<br />
des weiteren diagnostischen und therapeutischen<br />
Vorgehens auf Überweisung durch Fachärzte<br />
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, die Leistungen<br />
nach der Nummer 01773 EBM erbringen. Im<br />
Rahmen dieser Ermächtigung sind die Nummern<br />
01310, 01311, 01312, 01600, 01601, 01602, 01775,<br />
01780, 08215 und 33044 EBM abrechenbar. Die Ermächtigung<br />
erstreckt sich nicht auf solche Leistungen,<br />
die gemäß § 115 a SGB V erbracht werden.<br />
Kreis Stormarn<br />
Herr Geert Geusendam, Kommissarischer Leiter des<br />
DRK-Blutspendedienstes Nord gGmbH, Lütjensee,<br />
wurde mit Wirkung ab 01.07.2007, befristet bis zum<br />
30.06.2009, längstens jedoch bis zum Ende seiner<br />
ärztlichen Tätigkeit an der vorgenannten Institution,<br />
ermächtigt zur Durchführung der nachstehend aufgeführten<br />
Leistungen:<br />
1. ambulante Transfusionen auf Überweisung durch<br />
Vertragsärzte,<br />
2. Durchführung von Leistungen nach den Gebührennummern<br />
32103, 32530, 32540, 32541, 32542,<br />
32543, 32545, 32546, 32550, 32551, 32552, 32554,<br />
32556 EBM auf Überweisung durch Fachärzte für<br />
Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Hämatolgie<br />
bzw. Hämatologie und Internistische Onkologie,<br />
transfundierende Vertragsärzte und in speziellen<br />
Einzelfällen auf Überweisung durch Fachärzte für<br />
Laboratoriumsmedizin und im Zusammenhang mit<br />
Ziffer 1 der Ermächtigung auf Überweisung durch<br />
Vertragsärzte.<br />
Öffentliche Ausschreibung von Vertragspraxen<br />
gemäß § 103 Abs. 4 SGB V<br />
Die Kassenärztliche Vereinigung <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
schreibt auf Antrag von Ärzten/Psychotherapeuten<br />
deren Vertragsarztsitze zur Übernahme durch Nachfolger<br />
aus, da es sich um für weitere Zulassungen gesperrte<br />
Gebiete handelt:<br />
Kreis Dithmarschen<br />
7619/2007<br />
Praxis eines Facharztes/einer Fachärztin für<br />
Augenheilkunde<br />
Bewerbungsfrist: 31.08.2007<br />
7621/2007<br />
Praxis eines Facharztes/einer Fachärztin für<br />
Augenheilkunde<br />
Bewerbungsfrist: 31.08.2007<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007<br />
Stadt Kiel<br />
8069/2007<br />
Praxis eines Facharztes/einer Fachärztin für<br />
Haut- und Geschlechtskrankheiten<br />
Bewerbungsfrist: 31.07.2007<br />
8732/2007<br />
Praxis eines Facharztes/einer Fachärztin für<br />
Innere Medizin<br />
Bewerbungsfrist: 31.07.2007<br />
Stadt Lübeck<br />
8331/2007<br />
Praxis eines Hausarztes/einer Hausärztin<br />
Bewerbungsfrist: 31.08.2007<br />
8332/2007<br />
Praxis eines Facharztes/einer Fachärztin für Orthopädie<br />
Bewerbungsfrist: 31.08.2007<br />
8529/2007<br />
Praxis eines Hausarztes/einer Hausärztin<br />
Bewerbungsfrist: 31.08.2007<br />
8117/2007<br />
Praxis eines Psychologischen Psychotherapeuten/einer<br />
Psychologischen Psychotherapeutin<br />
Bewerbungsfrist: 31.08.2007<br />
Kreisregion Stadt Neumünster/<br />
Kreis Rendsburg-Eckernförde<br />
8573/2007<br />
Praxis eines Hausarztes/einer Hausärztin<br />
Bewerbungsfrist: 31.08.2007<br />
8671/2007<br />
Praxis eines Hausarztes/einer Hausärztin<br />
Bewerbungsfrist: 31.08.2007<br />
8674/2007<br />
Praxis eines Facharztes/einer Fachärztin für<br />
Augenheilkunde<br />
Bewerbungsfrist: 31.07.2007<br />
Kreis Nordfriesland<br />
8644/2007<br />
Praxis eines Facharztes/einer Fachärztin für<br />
Haut- und Geschlechtskrankheiten<br />
Bewerbungsfrist: 31.08.2007<br />
8698/2007<br />
Praxis eines Hausarztes/einer Hausärztin<br />
Bewerbungsfrist: 31.08.2007<br />
Kreis Ostholstein<br />
7965/2007<br />
Praxis eines Facharztes/einer Fachärztin für Orthopädie<br />
Bewerbungsfrist: 31.08.2007<br />
Kreis Pinneberg<br />
8319/2007<br />
Praxis eines Hausarztes/einer Hausärztin<br />
Bewerbungsfrist: 31.08.2007
8327/2007<br />
Praxis eines Facharztes/einer Fachärztin für<br />
Innere Medizin, Schwerpunkt Rheumatologie<br />
Bewerbungsfrist: 31.08.2007<br />
Kreis Plön<br />
7629/2007<br />
Praxis eines Hausarztes/einer Hausärztin<br />
Bewerbungsfrist: 31.08.2007<br />
8250/2007<br />
Praxis eines Hausarztes/einer Hausärztin<br />
Bewerbungsfrist: 31.08.2007<br />
8336/2007<br />
Praxis eines Hausarztes/einer Hausärztin<br />
Bewerbungsfrist: 31.08.2007<br />
Kreis Segeberg<br />
7987/2007<br />
Praxis eines Facharztes/einer Fachärztin für<br />
Frauenheilkunde und Geburtshilfe<br />
Bewerbungsfrist: 31.08.2007<br />
Kreis Steinburg<br />
8251/2007<br />
Praxis eines Facharztes/Fachärztin für Augenheilkunde<br />
Bewerbungsfrist: 31.08.2007<br />
Der/Die abgabewillige Arzt/Ärztin bzw. Psychotherapeut/Psychotherapeutin<br />
möchte zunächst noch anonym<br />
bleiben. Interessenten können Näheres bei der<br />
Kassenärztlichen Vereinigung <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> erfahren<br />
(Tel. 04551/883327, 883259, 883346, 883378,<br />
883291, 883303).<br />
Bewerbungen um diese Vertragspraxen sind innerhalb<br />
der jeweils angegebenen Bewerbungsfrist an die<br />
Kassenärztliche Vereinigung <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, Bismarckallee<br />
1-3, 23795 Bad Segeberg, zu richten. Der<br />
Bewerbung sind die für die Zulassung zur Vertragspraxis<br />
erforderlichen Unterlagen beizufügen:<br />
� Auszug aus dem Arztregister,<br />
� ein unterschriebener Lebenslauf.<br />
mitteilungen der kassenärztlichen vereinigung<br />
Außerdem sollte bereits vorab durch den Bewerber<br />
ein polizeiliches Führungszeugnis der Belegart „O“,<br />
ein so genanntes Behördenführungszeugnis, bei der<br />
zuständigen Meldebehörde beantragt werden, das der<br />
KV <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> dann unmittelbar vom Bundeszentralregister<br />
übersandt wird.<br />
Die Bewerbungsfrist ist gewahrt, wenn aus der Bewerbung<br />
eindeutig hervorgeht, auf welche Ausschreibung<br />
sich die Bewerbung bezieht, für welchen Niederlassungsort<br />
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) die<br />
Zulassung beantragt wird und ein Arztregisterauszug<br />
beigefügt wurde. Sollte innerhalb der Bewerbungsfrist<br />
keine Bewerbung eingehen, so akzeptiert der Zulassungsausschuss<br />
Bewerbungen, die bis zu dem Tag eingehen,<br />
an dem die Ladung zu der Sitzung des Zulassungsausschusses<br />
verschickt wird, in der über die ausgeschriebene<br />
Praxis verhandelt wird.<br />
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Ärzte/<br />
Psychotherapeuten, die für diesen Planungsbereich<br />
und diese Fachrichtung eine Eintragung in die Warteliste<br />
beantragt haben, nicht automatisch als Bewerber<br />
für diese Praxis gelten. Es ist in jedem Fall eine<br />
schriftliche Bewerbung für diesen Vertragsarztsitz erforderlich,<br />
die Eintragung in die Warteliste befreit<br />
hiervon nicht.<br />
Um die Übernahme von ausgeschriebenen Vertragsarztsitzen<br />
von Hausärzten (Fachärzte für Allgemeinmedizin,<br />
prakt. Ärzte und hausärztlich tätige Internisten)<br />
können sich sowohl Fachärzte für Allgemeinmedizin<br />
als auch hausärztlich tätige Internisten bewerben.<br />
Um die Übernahme von ausgeschriebenen Vertragspsychotherapeutenpraxen<br />
können sich Psychologische<br />
Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten,<br />
Ärzte für Psychotherapeutische<br />
Medizin sowie Ärzte, die beabsichtigen, ausschließlich<br />
psychotherapeutisch tätig zu werden, bewerben.<br />
Kassenärztliche<br />
Vereinigung Arznei- und Heilmittelverordnung 2007<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
Ab sofort finden Sie die von der Kassenärztlichen Vereinigung<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> und ihren Vertragspartnern unterschriebene Arznei- und Heilmittelvereinbarung<br />
2007 im Internet unter www.kvsh.de - Verträge - Arznei- und Heilmittel zum Download. Auf Wunsch kann<br />
die Vereinbarung auch in Papierform bei der Formularausgabe der KVSH bestellt werden.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>isches Ärzteblatt 7/2007 83
Neues aus der Akademie ...<br />
Fördergesellschaft lädt ein<br />
Bis zu 20 Prozent der Bevölkerung<br />
der westlichen Welt leidet an Obstipation.<br />
Diagnostik und Therapie sind schwierig und<br />
kostenträchtig. Zur Behandlung dieser komplexen<br />
Symptomatik ist die Zusammenarbeit, insbesondere<br />
zwischen Internisten, Chirurgen und<br />
Psychologen, erforderlich.<br />
Die Fördergesellschaft der Akademie hat sich<br />
dieser Herausforderung für die ambulante wie<br />
die klinische Medizin gestellt. In einer interdisziplinären<br />
Veranstaltung sollen Ursachen, Wege<br />
der Diagnostik und Möglichkeiten der medikamentösen<br />
und chirurgischen Therapie <strong>aktuell</strong><br />
dargestellt und diskutiert werden.<br />
Termin: Samstag, 01.09.2007, 9:30-13:00 Uhr<br />
Die Veranstaltung ist gebührenfrei!<br />
Wir bilden aus<br />
Ich bin Jasmin Tüxen und<br />
zurzeit als Auszubildende in<br />
der Akademie-Geschäftsstelle<br />
tätig.<br />
Zu meiner 3-jährigen Ausbildung<br />
zur Kauffrau für Bürokommunikation<br />
bei der<br />
<strong>Ärztekammer</strong> <strong>Schleswig</strong>-<br />
<strong>Holstein</strong> gehört auch eine<br />
4-monatige Arbeitsphase in<br />
der Akademie.<br />
Jasmin Tüxen (Foto: Pecnik)<br />
Durch die gute Einarbeitung<br />
der Mitarbeiter der Akademie<br />
kann ich unterstützend tätig sein und gewinne<br />
einen großen Einblick in die Akademiearbeit.<br />
Ich lerne die Kursorganisation kennen<br />
und komme so auch mit Teilnehmern und Referenten<br />
in Kontakt, was mir sehr viel Spaß bereitet<br />
und ein Gegensatz zur Arbeit in der <strong>Ärztekammer</strong><br />
ist. Durch die verschiedenen Bereiche der<br />
<strong>Ärztekammer</strong> und der Akademie fühle ich mich<br />
gut vorbereitet für mein weiteres Berufsleben.<br />
Auf eine freiwerdende Stelle würde ich mich<br />
nach bestandener Prüfung sehr gern bewerben ...<br />
Veranstaltungen im August<br />
27.-31. August 2007,<br />
5 in sich abgeschlossene Tageskurse<br />
Intensivmedizin<br />
Training schwieriger Situationen am Simulator<br />
28. August bis 1. September 2007, Beginn 9:00 Uhr<br />
Fachkunde Strahlenschutz<br />
Einführung, Grundkurs, Spezialkurse<br />
29. August bis 2. September 2007, Beginn 9:00 Uhr<br />
Homöopathie Kurs B für die Zusatz-Weiterbildung<br />
Vorschau<br />
8.-15. September 2007, Beginn 9:00 Uhr<br />
Fachkunde Rettungsdienst<br />
Zusatzbezeichnung Notfallmedizin<br />
17.-26. September 2007, Beginn 8:30 Uhr<br />
Innere Medizin<br />
Auffrischungskurs für das Gesamtgebiet<br />
5.-7. Oktober 2007, 6 weitere Termine<br />
Naturheilverfahren 160-Stunden Kurs für die<br />
Zusatz-Weiterbildung<br />
6.-7. Oktober 2007, Beginn 9:00 Uhr<br />
Der ärztliche Bereitschaftsdienst<br />
Fallbeispiele aus verschiedenen Fachgruppen<br />
5.-9. November 2007, Beginn 9:30 Uhr<br />
Sonographie-Grundkurs für Abdomen und<br />
Schilddrüse<br />
5.-9. November 2007, Beginn 8:30 Uhr<br />
Intensivmedizin<br />
Theoretische und praktische Grundlagen<br />
16.-18. November und 7.-9. Dezember 2007<br />
Diabetologie<br />
Strukturierte curriculäre Fortbildung<br />
24.-25. November 2007, 3 weitere Termine<br />
Ernährungsmedizin - 100-Stunden-Kurs<br />
Strukturierte curriculäre Fortbildung<br />
Akademie für med. Fort- und Weiterbildung<br />
der <strong>Ärztekammer</strong> <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
Esmarchstr. 4-6, 23795 Bad Segeberg<br />
Tel. 04551/803-166, Fax 803-194<br />
Internet www.aeksh.de/akademie<br />
E-Mail akademie@aeksh.org