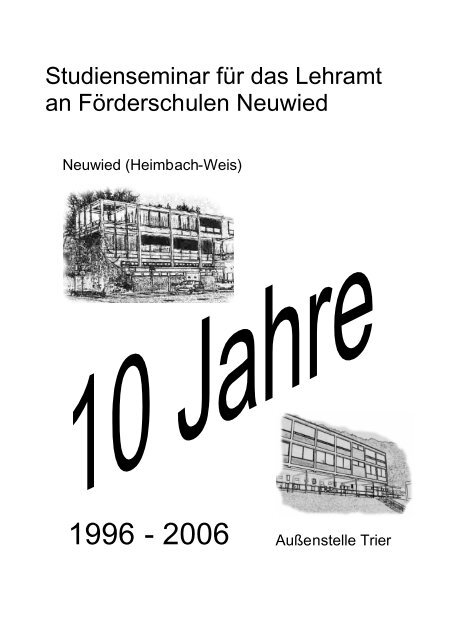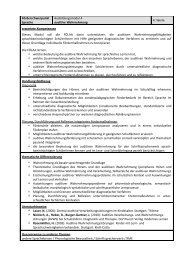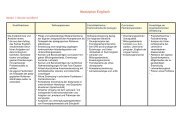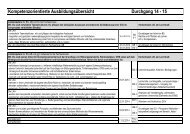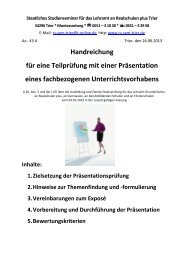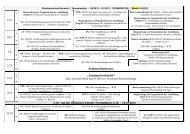Festschrift: 10 Jahre Studienseminar - Studienseminare Rheinland ...
Festschrift: 10 Jahre Studienseminar - Studienseminare Rheinland ...
Festschrift: 10 Jahre Studienseminar - Studienseminare Rheinland ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Studienseminar</strong> für das Lehramt<br />
an Förderschulen Neuwied<br />
Neuwied (Heimbach-Weis)<br />
1996 - 2006<br />
Außenstelle Trier
Impressum:<br />
Herausgeber: Staatliches <strong>Studienseminar</strong><br />
für das Lehramt an Förderschulen<br />
Am Weiser Bach 3<br />
56566 Neuwied (Heimbach-Weis)<br />
Telefon: 02622-972111<br />
Fax: 02622-972112<br />
E-Mail: odsnwss@uni-koblenz.de<br />
URL: http://www.studsem-nhw.bildung-rp.de<br />
Redaktion: Waldemar Breiten, Martin Eggert, Ekkehard Kiersch,<br />
Klaus Leber<br />
Druck: Druckhaus optiprint, Sinzig<br />
Wir danken der HUK Coburg für die großzügige Unterstützung bei der<br />
Herausgabe dieser <strong>Festschrift</strong>.<br />
Neuwied 2006
Inhalt<br />
Vorwort 04<br />
Grußworte 05<br />
1 Vorbereitende Maßnahmen und Einrichtung des Seminars 14<br />
1.1 Die kooperative Ausbildungsidee wird erprobt 14<br />
1.2 Ein neues <strong>Studienseminar</strong> für das Lehramt an Sonderschulen in 15<br />
Neuwied wird vorbereitet<br />
1.2.1 Raumbeschaffung 16<br />
1.2.2 Start des neuen <strong>Studienseminar</strong>s Sonderschulen am 1.08.1996 19<br />
1.2.3 Ausbildung im <strong>Studienseminar</strong> 20<br />
1.2.4 Ausbildung in der Schule 22<br />
1.3 Bezug der neuen Diensträume am 01.01.1997 22<br />
1.4 Phase der Konsolidierung 26<br />
1.5 Erweiterung des Seminarbezirks am 01.08.1999 29<br />
1.6 Einrichtung einer Außenstelle in Trier zum 01.02.2003 31<br />
1.7 Ausbildung von Quereinsteigern ab 01.02.2004 31<br />
1.8 Zusammenarbeit mit der ADD 31<br />
2 Konzept- und Organisationsentwicklung 34<br />
2.1 Konzeptbildung für die Ausbildung in den Fachrichtungen 34<br />
2.1.1 Zum Konzept der Schwerpunktfachrichtung (SFR) 36<br />
2.1.2 Zum Konzept der weiteren Fachrichtung (wFR) 37<br />
2.2 Kooperation mit dem Grund- und Hauptschulseminar 38<br />
2.3 Entwicklung von Leitaspekten der Beurteilung von Unterricht 39<br />
2.4 Entwicklung von Leitaspekten der Beurteilung von mündlichen 40<br />
Prüfungsleistungen<br />
2.5 Fortbildungskonzept für alle an der Ausbildung Beteiligten 41<br />
(Abstimmungsprozesse an Beispielen)<br />
2.6 Konzeptbildung für Ausbildungsprojekte (Verantwortung für Natur 43<br />
und Umwelt, Außerschulische Lernorte)<br />
2.7 Minimalkonsens „Beratung und Beurteilung“ 46<br />
2.8 Modularisierung der Ausbildungsinhalte 48<br />
2.9 Leitbild mit Schwerpunktsetzungen 52<br />
2.<strong>10</strong> Evaluation der Veranstaltungen des <strong>Studienseminar</strong>s 55<br />
2.11 Ausblick 56<br />
3 Konzepte der Ausbildung in den Fachrichtungen 57<br />
3.1 Blinden- und Sehbehindertenpädagogik 57<br />
3.2 Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik 58<br />
3.3 Geistigbehindertenpädagogik 59<br />
3.4 Körperbehindertenpädagogik 60<br />
3.5 Lernbehindertenpädagogik 61<br />
3.6 Sprachbehindertenpädagogik 63<br />
3.7 Verhaltensbehindertenpädagogik 66<br />
4 Seminarleiter und Stellvertreter, Verwaltungsangestellte, Fachleiterinnen 71<br />
und Fachleiter, Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter<br />
3
Vorwort<br />
Zum 1.08.1996 wurde im Nordteil von<br />
<strong>Rheinland</strong>-Pfalz nach 7-jähriger Unterbrechung<br />
infolge der Aufhebung eines<br />
grundständigen Studiums wieder ein<br />
<strong>Studienseminar</strong> für das Lehramt an<br />
Sonderschulen eingerichtet, zunächst mit<br />
Standort Koblenz, ab dem 01.01.1997 mit<br />
Standort Neuwied.<br />
Unter der Leitung von Ekkehard Kiersch, der<br />
bereits in der Zeit vom 01.02.1978 – bis<br />
31.07.1989 Leiter eines <strong>Studienseminar</strong>s für das Lehramt an Sonderschulen<br />
in Neuwied war, nahmen 24 Fachleiterinnen und Fachleiter,<br />
davon 7 aus dem Grund- und Hauptschulbereich, am 01.08.1996 die<br />
Ausbildung von 36 Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern auf.<br />
Ab dem 01.08.1999 wurde der Seminarbezirk ausgeweitet auf die Region<br />
Trier, ab dem 01.02.2003 wurde in der Region Trier eine Außenstelle<br />
mit eigenem Einstelltermin eingerichtet. Über 500 Lehramtsanwärterinnen<br />
und Lehramtsanwärter haben in den vergangenen <strong>10</strong> <strong>Jahre</strong>n erfolgreich<br />
den Vorbereitungsdienst in den Ausbildungsschwerpunkten Neuwied<br />
und Trier abgeschlossen.<br />
Die vorliegende kleine <strong>Festschrift</strong> dokumentiert die Phasen der Seminarentwicklung<br />
und vor allem auch die Konzept- und Organisationsentwicklung,<br />
die unter Berücksichtigung der zahlreichen Reformen im<br />
Bildungswesen in den vergangenen <strong>10</strong> <strong>Jahre</strong>n eine konzeptionelle<br />
Basis geschaffen hat, von der aus eine aktive Mitgestaltung der sich in<br />
der unmittelbaren Zukunft verändernden Lehrerausbildung zuversichtlich<br />
in Angriff genommen werden kann.<br />
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei allen zu bedanken, die den<br />
Aufbau des <strong>Studienseminar</strong>s für das Lehramt an Förderschulen Neuwied<br />
mit Engagement und Kompetenz in den letzten <strong>10</strong> <strong>Jahre</strong>n mitgetragen<br />
und auch von außen unterstützt haben.<br />
Waldemar Breiten, Förderschulrektor<br />
Leiter des <strong>Studienseminar</strong>s Förderschulen Neuwied<br />
4
Grußwort<br />
Die Stadt Neuwied weist nicht ohne Stolz auf<br />
ihre Tradition als Schulstandort und auf die<br />
Vielfalt der hier ansässigen Bildungseinrichtungen<br />
hin. Vor allem mit Blick auf die<br />
Förderung von Menschen mit Beeinträchtigungen<br />
finden wir hier ein weithin<br />
beispielhaftes Netz an verschiedenartigen<br />
Angeboten. Dass sich dann 1996 das<br />
Staatliche <strong>Studienseminar</strong> für das Lehramt an<br />
Sonderschulen bei uns ansiedelte - übrigens<br />
in einer frei gewordenen städtischen Immobilie -, war ohne Zweifel eine<br />
willkommene Ergänzung und eine Bereicherung der pädagogischen<br />
Landschaft.<br />
Das <strong>Studienseminar</strong> kann also <strong>10</strong>-jähriges Bestehen feiern, wozu ich im<br />
Namen der Stadt Neuwied herzlich gratulieren darf. <strong>10</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Studienseminar</strong><br />
- diese Entwicklung spiegelt die vorliegende <strong>Festschrift</strong> wider.<br />
Zwar geht es dabei um einen relativ kurzen Zeitraum, trotzdem dürfte<br />
auch hier bereits deutlich werden, wie rasant gesellschaftliche Veränderungen<br />
ablaufen können. Veränderungen, auf die auch die Pädagogik<br />
und unser Bildungssystem Antworten geben müssen.<br />
So fällt beim Blick auf die Arbeit des <strong>Studienseminar</strong>s unter anderem<br />
auf, welchen Stellenwert integrative Ansätze und der Gedanke der<br />
Kooperation augenscheinlich genießen. Ich habe dieses Beispiel aufgeführt,<br />
weil darin auch ein bestimmtes Menschenbild zum Ausdruck<br />
kommt. Ein Menschenbild, das verstärkt von der generellen Bildungsfähigkeit<br />
des Individuums ausgeht, ihm Spielraum für seine Entwicklung<br />
lässt und weniger sortiert und selektiert.<br />
Unzweifelhaft von großer Bedeutung für den Erfolg aller pädagogischen<br />
Ansätze ist natürlich eine umfassende Qualifizierung der Lehrenden.<br />
Das <strong>Studienseminar</strong> leistet auf diesem Gebiet hervorragende Arbeit.<br />
Daher will ich die Gelegenheit nutzen und mein Kompliment für dieses<br />
Engagement verbinden mit den besten Wünschen für die Zukunft und<br />
ein weiterhin erfolgreiches Wirken. Die Gäste der Festveranstaltung<br />
zum <strong>10</strong>-jährigen Bestehen des <strong>Studienseminar</strong>s darf ich herzlich in<br />
Neuwied begrüßen.<br />
Nikolaus Roth,<br />
Oberbürgermeister<br />
der Stadt Neuwied<br />
5
6<br />
Grußwort<br />
Das Staatliche <strong>Studienseminar</strong> für das<br />
Lehramt an Förderschulen Neuwied feiert<br />
sein <strong>10</strong>-jähriges Bestehen. Zu diesem<br />
Ereignis gratuliere ich allen, die in diesen<br />
<strong>10</strong> <strong>Jahre</strong>n an der Ausbildung von mehr<br />
als 500 Förderschullehramtsanwärterinnen<br />
und -anwärtern mit Erfolg mitgewirkt<br />
haben, ganz herzlich, auch im Namen von<br />
Frau Ministerin Doris Ahnen.<br />
Mit dem Seminarstandort Neuwied und der Außenstelle Trier, die am<br />
1.02.2003 mit eigenem Einstelltermin eingerichtet wurde, leistet das<br />
<strong>Studienseminar</strong> Förderschulen Neuwied einen wichtigen Beitrag zur<br />
Personalentwicklung an den Förderschulen im nördlichen <strong>Rheinland</strong>-<br />
Pfalz. Die Qualifizierung der Förderschullehramtsanwärterinnen und –<br />
anwärter im Vorbereitungsdienst in gemeinsamer Verantwortung mit<br />
den Ausbildungsschulen wie auch die Weiterentwicklung der Konzepte<br />
in Fortbildungsveranstaltungen mit den Mentorinnen und Mentoren<br />
erweisen sich dabei als wirkungsvoll sowohl im Hinblick auf die Qualitätsentwicklung<br />
im Seminar als auch an den Förderschulen selbst.<br />
Das <strong>Studienseminar</strong> für das Lehramt an Förderschulen Neuwied kooperierte<br />
von Anfang an mit dem <strong>Studienseminar</strong> für das Lehramt an<br />
Grund- und Hauptschulen Neuwied. Somit wurde schon frühzeitig der<br />
Empfehlung der KMK zur sonderpädagogischen Förderung in den<br />
Schulen der Bundesrepublik Deutschland (1994) Rechnung getragen,<br />
die als Paradigmenwechsel im Hinblick auf die förderpädagogische<br />
Berufsrolle angesehen werden kann. Durch die kooperative Ausbildung<br />
an Grund-, Haupt- und Förderschulen lernen die Lehramtsanwärter und<br />
-anwärterinnen beider <strong>Studienseminar</strong>e die jeweils spezifischen Sichtweisen<br />
und Methoden der beiden Lehrämter im Hinblick auf eine wirkungsvolle<br />
spätere Kooperation kennen und verstehen.<br />
In den vergangenen <strong>10</strong> <strong>Jahre</strong>n haben viele Reformbewegungen die<br />
Schulen und damit auch die Anforderungen an die Lehrkräfte verändert.<br />
Institutionell sind vor allem die Einrichtung von Ganztags- und<br />
Schwerpunktschulen, pädagogisch und didaktisch vor allem die Formen<br />
eines offeneren und selbstständigeren Lernens sowie die Integration der<br />
modernen Informationstechnologien in den Unterricht zu nennen. Ich<br />
freue mich, dass im <strong>Studienseminar</strong> Förderschulen Neuwied, wie ich
den Seminarunterlagen entnehme, bei allen Entwicklungen und Neuerungen<br />
immer der Anspruch eines bildungswirksamen Lernens mit<br />
einem besonderen Gewicht aufrechterhalten wurde.<br />
Eine besondere Struktur, Personal- und Qualitätsentwicklung strebt die<br />
Landesregierung mit der seit 2003 in Gang gesetzten Reform der Lehrerbildung<br />
in <strong>Rheinland</strong>-Pfalz an. Stärkere Verbindlichkeit durch Orientierung<br />
an curricularen Standards, intensivere Integration von Theorie<br />
und Praxis durch Verzahnung von erster und zweiter Ausbildungsphase<br />
und Erweiterung der begleitenden Praktika, größere Polyvalenz durch<br />
schulartübergreifende Inhalte in der Bachelor-Phase sowie mehr Professionalität<br />
durch Spezialisierung in der Master-Phase sind wesentliche<br />
Zielsetzungen des Reformkonzepts. An den Entwicklungen, die bereits<br />
im vollen Gange sind, sind Vertreter des <strong>Studienseminar</strong>s Förderschulen<br />
Neuwied auf vielfältige Weise engagiert beteiligt, sei es in Kommissionen<br />
zur Erarbeitung curricularer Standards, in Arbeitsgruppen zur<br />
konzeptionellen Vorbereitung der Praktika oder auch in den Mitgliederversammlungen<br />
der Lehrerbildungszentren mehrerer Universitäten.<br />
Nach der Festlegung der rechtlichen Grundlagen, des Aufbaus eines<br />
institutionellen Rahmens und der konzeptionellen Grundlegung beginnt<br />
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der <strong>Studienseminar</strong>e in Kürze<br />
die Phase der unmittelbaren Umsetzung des Reformkonzepts mit der<br />
Vorbereitung der Ausbildungslehrkräfte, der Betreuung von Praktika und<br />
der Übernahme von Lehrtätigkeiten im Rahmen der fachdidaktischen<br />
Studien. Diese stärker auf das Berufsfeld und die Kooperation von<br />
Universität und <strong>Studienseminar</strong>en hin angelegte Lehrerbildung eröffnet<br />
für alle Beteiligten interessante und gewinnbringende Perspektiven.<br />
Ich wünsche den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des <strong>Studienseminar</strong>s<br />
für das Lehramt an Förderschulen Neuwied, dass sie die Chancen<br />
der Mitarbeit an diesem großen und wichtigen Reformvorhaben erkennen,<br />
und bitte sie, ihre Kompetenzen und ihr Engagement wie in den<br />
vergangenen <strong>10</strong> <strong>Jahre</strong>n im Interesse einer theoretisch fundierten und<br />
jederzeit praxisorientierten Lehrerbildung einzusetzen und damit letztlich<br />
mitzuhelfen, Kindern und Jugendlichen positive Zukunftsperspektiven zu<br />
eröffnen.<br />
Michael Bohnekamp<br />
Ministerialrat<br />
Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend<br />
7
Grußwort<br />
Als ich den Brief des <strong>Studienseminar</strong>s<br />
erhielt mit der Bitte, für die <strong>Festschrift</strong> aus<br />
Anlass des <strong>10</strong>-jährigen Bestehens ein<br />
Grußwort zu schreiben, glaubte ich, ein<br />
Déjà-vu-Erlebnis zu haben.<br />
Zehn <strong>Jahre</strong> <strong>Studienseminar</strong>, das gab es<br />
schon einmal, 1988.<br />
Damals hatte ich einen kurzen Beitrag aus<br />
der Sicht eines Fachleiters geschrieben.<br />
Die Auflösung des damaligen <strong>Studienseminar</strong>s,<br />
nachdem es <strong>10</strong> <strong>Jahre</strong><br />
bestanden hatte, war sicher ein Fehler.<br />
Das Fehlen eines Ausbildungsauftrages<br />
wirkte sich nachteilig auf unsere Schulen aus. Es war ein Glück für die<br />
Sonderpädagogik vor Ort als 1996 das <strong>Studienseminar</strong> wieder eröffnet<br />
wurde. Herr Kiersch, der alte Leiter, wurde auch wieder der neue Leiter.<br />
Es war gut, dass seine Kompetenzen wieder genutzt werden konnten.<br />
Ausbildungshandeln aus verschiedenen Perspektiven habe ich in den<br />
fast 40 <strong>Jahre</strong>n meiner Dienstzeit erleben können, erleben dürfen. Meine<br />
wesentliche Rolle der letzten <strong>10</strong> <strong>Jahre</strong> ist die des Prüfungsvorsitzenden<br />
bei 2. Staatsprüfungen.<br />
Oft geht dabei mein Blick wieder zu meiner eigenen Ausbildung, meiner<br />
eigenen 2. Prüfung zurück. Ich weiß noch gut, was mich damals bewegte:<br />
Hast du dich genügend vorbereitet? Wie werden die „Stunden“ gesehen?<br />
Als ich dann 1981 selbst Fachleiter wurde, gab es andere Fragen<br />
und Herausforderungen: Hast du die richtigen Inhalte mit den Lehramtsanwärtern<br />
erarbeitet? Kannst du ihnen das aus der Praxis vermitteln,<br />
was sie für den Beruf brauchen? Bist du ihnen gerecht geworden<br />
bei den Benotungen? Hoffentlich machen sie in den mündlichen Prüfungen<br />
einen „guten Eindruck“! Aber auch aus der Sicht des Vaters,<br />
dessen Tochter im Referendariat war, habe ich Ausbildungssituationen<br />
erlebt. Innere Beteiligung und Aufregung vor Prüfungssituationen kann<br />
ich nicht verhehlen.<br />
Wenn ich heute bei 2. Prüfungen den Vorsitz wahrnehme, sind mein<br />
Denken und Handeln geprägt von diesen vielfältigen Erfahrungen. –<br />
Und ich kann sagen, kaum etwas ist mir fremd!<br />
Mein Bemühen ist es, den Menschen gerecht zu werden, auch im Vergleich<br />
der Prüfungsanforderungen.<br />
8
Bei den 2. Prüfungen konnte ich feststellen, dass das Ausbildungshandeln<br />
aller beteiligten Fachleiterinnen und Fachleiter einen hervorragenden<br />
Stand hat. Neben der hohen Fachlichkeit erlebe ich aber auch die<br />
zugewandte menschliche Beteiligung. Hervorzuheben ist, dass bei der<br />
Beurteilung von Prüfungsergebnissen immer eine hohe Übereinstimmung<br />
besteht.<br />
Das heutige <strong>Studienseminar</strong> Neuwied hat an den überaus guten Ruf<br />
des alten <strong>Studienseminar</strong>s anknüpfen können.<br />
Ich danke allen Fachleiterinnen und Fachleitern, auch denen aus dem<br />
Grund- und Hauptschulbereich, und der Seminarleitung, Herrn Breiten<br />
und Herrn Eggert, für ihren hohen Einsatz in der Ausbildungsarbeit.<br />
Danken möchte ich aber auch den Mentorinnen und Mentoren in den<br />
Ausbildungsschulen. Ihre Kompetenzen sind oft entscheidend für den<br />
Ausbildungserfolg.<br />
Den Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern wünsche ich<br />
möglichst wenig Stress, vor allem aber einen guten Abschluss!<br />
Wolfgang Justrie<br />
Leitender Regierungsschuldirektor<br />
Aufsichts – und Dienstleistungsdirektion<br />
Außenstelle Schulaufsicht Koblenz<br />
Referat Förderschulen / Sonderpädagogische Förderung an Regelschulen<br />
9
Grußwort<br />
Seit <strong>10</strong> <strong>Jahre</strong>n werden in <strong>Rheinland</strong>-Pfalz<br />
wieder Anwärter für das Lehramt an<br />
Förderschulen im <strong>Studienseminar</strong> Neuwied<br />
und in den Schulen ausgebildet: <strong>10</strong> <strong>Jahre</strong><br />
des beständigen Wandels und der<br />
dauernden Fortentwicklung!<br />
Besonders erfreulich aus meiner Sicht: in<br />
die schulische Ausbildung konnten alle<br />
Schulen des Aufsichtsbezirks Trier<br />
einbezogen werden, Trier wurde<br />
Ausbildungsschwerpunkt, sogar Außenstelle des <strong>Studienseminar</strong>s.<br />
Und: zusammen mit dem <strong>Studienseminar</strong> Grund- und Hauptschulen<br />
konnte die Ausbildung in vielen Fällen sogar kooperativ gestaltet werden.<br />
Eine wichtige Weiterentwicklung: ist doch der Arbeitsplatz künftiger<br />
Förderschullehrerinnen und –lehrer mehr und mehr der Förderort Regelschule!<br />
Viele Schulen haben von ihrem neuen Status „Ausbildungsschule“, von<br />
der Arbeit der Lehramtsanwärterinnen und –anwärter und von der Begleitung<br />
durch das Seminar, neue und wesentliche Impulse erfahren für<br />
die eigene Weiterentwicklung. Für eine Reihe von Kolleginnen und<br />
Kollegen hat das Seminar neue Herausforderungen geboten, sei es in<br />
der Aufgabe als Mentorin und Mentor, sei es für lehrbeauftragte oder<br />
hauptamtliche Fachleiterinnen und Fachleiter.<br />
Mit meinem Glückwunsch an das Staatliche <strong>Studienseminar</strong> für das<br />
Lehramt an Förderschulen verbinde ich zugleich meinen Dank für die<br />
geleistete Arbeit. Dieser Dank gilt allen an der Ausbildung Beteiligten:<br />
der Seminarleitung, den hauptamtlichen wie lehrbeauftragten Fachleiterinnen<br />
und Fachleitern, den Mentorinnen und Mentoren.<br />
Danken möchte ich aber auch für die ausgezeichnete Zusammenarbeit<br />
und die stete Bereitschaft, neue Entwicklungen in die Seminararbeit<br />
aufzunehmen und sie den Anwärterinnen und Anwärtern erfahrbar zu<br />
machen.<br />
Deshalb dürfen wir auch gemeinsam uns zuversichtlich den weiteren<br />
Entwicklungen einer neu geordneten Lehrerausbildung stellen, das<br />
gemeinsame Ziel vor Augen: Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem<br />
Förderbedarf werden von hervorragend ausgebildeten<br />
Lehrkräften in ihrem Lernen begleitet und gefördert.<br />
Hubert Weis<br />
Leitender Regierungsschuldirektor<br />
Aufsichts – und Dienstleistungsdirektion Trier<br />
Referat Förderschulen / Sonderpädagogische Förderung an Regelschulen<br />
<strong>10</strong>
11<br />
Grußwort<br />
„Damit das Mögliche entsteht,<br />
muss immer wieder<br />
das Unmögliche versucht werden.“,<br />
sagt Hermann Hesse.<br />
Mit ministerieller Genehmigung wurde auf gemeinsamen Wunsch beider<br />
Seminarleitungen 1996 das neu eröffnete Sonderschul-<strong>Studienseminar</strong><br />
als ein kooperatives <strong>Studienseminar</strong> in Verbindung mit dem Grund- und<br />
Hauptschul-<strong>Studienseminar</strong> in Neuwied gegründet.<br />
Sonderschul-<strong>Studienseminar</strong> hieß es bis vor kurzem. „Sonder“, mittelhochdeutsch<br />
„sunder“ heißt ‚eigen’, ‚ausgezeichnet’, ‚ungewöhnlich’<br />
und ist heute als „besonders“ in unserer Sprache lebendig.<br />
Etwas Besonderes war von Beginn an die Zusammenarbeit zwischen<br />
beiden <strong>Studienseminar</strong>en und etwas Besonderes ist sie bis heute<br />
geblieben:<br />
Etwas Besonderes ist die harmonische Zusammenarbeit in den<br />
beiden Seminarleitungen und in den Geschäftszimmern.<br />
Etwas Besonderes ist die gemeinsame Ausbildung der Lehramtsanwärterinnen<br />
und –anwärter in beiden <strong>Studienseminar</strong>en.<br />
Etwas Besonderes ist die Mitarbeit von Fachleiterinnen und<br />
Fachleitern im jeweils anderen <strong>Studienseminar</strong>.<br />
Etwas Besonderes ist die rasche Problemlösung – auch im<br />
technischen Bereich.<br />
Etwas Besonderes ist die gegenseitige Unterstützung – auch in<br />
der Ausbildung auf dem multimedialen Feld.<br />
Etwas Besonderes ist die gemeinsame Entwicklung und Nutzung<br />
von Seminarpapieren.<br />
Etwas Besonderes ist die gedankliche Verwandtschaft ohne<br />
Aufgabe der jeweiligen eigenen Identität.<br />
Etwas Besonderes ist die freundschaftliche Verbundenheit zwischen<br />
den <strong>Studienseminar</strong>en.<br />
Nun heißt das <strong>Studienseminar</strong>, dessen zehnjähriges Jubiläum wir heute<br />
feiern, seit kurzem „Förderschul-<strong>Studienseminar</strong>“. „Fördern“ heißt „wei-
ter nach vorne bringen“, auch „wegbringen“. Ich gehe nicht davon aus,<br />
dass uns die Namensänderung trennt; ich setze vielmehr auf den Geist,<br />
der unsere Arbeit bisher beflügelt hat und darauf, dass in beiden namentlichen<br />
Bezeichnungen das Wort „Schule“ enthalten ist, das sich<br />
von althochdeutsch scuola, lateinisch schola ableitet und bekanntlich<br />
„Muße“, „Ruhe“ zur wissenschaftlichen Beschäftigung bedeutet.<br />
So sehen wir auch der weiteren Entwicklung mit Ruhe und Gelassenheit<br />
entgegen in der Gewissheit, dass wir die künftige Entwicklung gemeinsam<br />
auf unsere besondere Art samt und sonders förderlich begleiten<br />
werden, ganz im Sinne Albert Einsteins:<br />
„Das Lehren sollte so sein, dass das Dargebotene als wertvolles<br />
Geschenk und nicht als eine harte Pflicht empfunden wird.“<br />
Dr. Reiner Friedrichs, Rektor<br />
Leiter des <strong>Studienseminar</strong>s Grund- und Hauptschulen Neuwied<br />
12
13<br />
Grußwort<br />
Liebe Kollegen, liebe Leser der <strong>Festschrift</strong>,<br />
am 13. März 2006 erhielt ich das Schreiben meines Kollegen Waldemar<br />
Breiten, des Leiters des <strong>Studienseminar</strong>s Neuwied, mit der Einladung<br />
zur Festveranstaltung und der Bitte ein Grußwort zur <strong>Festschrift</strong> zu<br />
verfassen.<br />
Ende März war der Titel „<strong>10</strong> <strong>Jahre</strong> Staatliches <strong>Studienseminar</strong> für das<br />
Lehramt an Sonderschulen“ schon Geschichte. Wir sind zum „<strong>Studienseminar</strong><br />
für das Lehramt an Förderschulen“ umbenannt worden.<br />
Ich denke, das Beispiel verdeutlicht die Entwicklungen. Die Veränderungen<br />
durch die Erfordernisse der „Lehrerbildungsreform“ in <strong>Rheinland</strong>-Pfalz<br />
fordern unsere Arbeitskraft verstärkt. Wir schreiben Standards<br />
und formulieren Module. Eine spannende Zeit.<br />
Aus Kaiserslautern darf ich mich ganz herzlich für die Zusammenarbeit<br />
bedanken. Unserem Schwesterseminar wünschen wir weiterhin eine<br />
glückliche Hand, die richtigen Worte zur rechten Zeit und eine mit viel<br />
Herz gefüllte Seminarkultur in der Anwärterbegleitung; dann wird es<br />
Euch/Ihnen weiterhin gelingen, hervorragend ausgebildete Lehrer in die<br />
Schule zu entlassen und unseren Schülern beste Bildungschancen zu<br />
eröffnen.<br />
Für das <strong>Studienseminar</strong> Kaiserslautern<br />
Jürgen Köppler, Förderschulrektor<br />
<strong>10</strong> <strong>Jahre</strong><br />
Staatliches <strong>Studienseminar</strong><br />
für das Lehramt an Förderschulen<br />
in Neuwied
1 Vorbereitende Maßnahmen und Einrichtung des<br />
<strong>Studienseminar</strong>s<br />
1.1 Die kooperative Ausbildungsidee wird erprobt<br />
In den frühen 90er <strong>Jahre</strong>n wurde das Aufgabenfeld der Sonderpädagogik<br />
und damit auch des Sonderpädagogen wesentlich erweitert. Während<br />
es in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung von 1977 noch<br />
schwerpunktmäßig darum ging, zu selbständiger und erfolgreicher<br />
Arbeit im Lehramt an Sonderschulen zu befähigen, wird in der entsprechenden<br />
Prüfungsordnung im Jahr 1993 postuliert, dass die Arbeit im<br />
Lehramt an Sonderschulen die Erteilung von Unterricht und Fördermaßnahmen<br />
an anderen Schulen einschließt und dass die „Beratungsund<br />
Kooperationskompetenz“ in „besonderer Weise“ zu fördern seien.<br />
Es sind verschiedene Komponenten, die diese Entwicklung gefördert<br />
haben:<br />
� das Verständnis von Unterricht, das selbständig verantwortungsvoll<br />
handelnde Persönlichkeiten zum Ziel hat<br />
� das Verständnis von Behinderung, das die Frage nach bestmöglicher<br />
Förderung in der bisherigen Lebensumwelt an den Anfang<br />
stellt und erst dann über die relevanten Förderorte entscheidet<br />
� und dies beinhaltet die Akzentuierung des sonderpädagogischen<br />
Förderbedarfs im Sinne integrierter Förderarbeit.<br />
Hinzu kamen relevante Verwaltungsvorschriften (z. B.: Förderung von<br />
Kindern mit Lernschwierigkeiten in der Grundschule) und wichtige<br />
Schulversuche, die kindspezifische Ansätze fundierten.<br />
Dies sind ganz wesentliche Voraussetzungen, dass Lehrerausbildung<br />
und Kooperation der verschiedenen Lehrämter einen neuen Stellenwert<br />
erhielten. Im Jahr 1992 wurde im Land <strong>Rheinland</strong>-Pfalz die eigenständige<br />
Sonderschullehrerausbildung in einem <strong>Studienseminar</strong> (hier Kaiserslautern)<br />
wieder aufgenommen. In Kaiserslautern mussten alle sonderpädagogischen<br />
Fachrichtungen ausgebildet werden, auch Blinden- und<br />
Sehbehindertenpädagogik. Da es aber landesweit nur eine Ausbildungsschule<br />
gibt und die in Neuwied liegt, wurde überlegt, ob Blindenpädagogik<br />
oder Sehbehindertenpädagogik mit den entsprechenden<br />
Zweitfachrichtungen nicht in Kooperation zwischen den <strong>Studienseminar</strong>en<br />
Sonderschulen Kaiserslautern und Grund- und Hauptschulen Koblenz<br />
ausgebildet werden könnten, zumal im <strong>Studienseminar</strong> der Grundund<br />
Hauptschulen Koblenz Fachleiter des ehemaligen Sonderschulseminars<br />
(das <strong>Studienseminar</strong> bestand von 1978 bis 1989 mit Sitz in<br />
14
Neuwied) Ausbildungs- und Leitungsaufgaben übernommen hatten. Das<br />
<strong>Studienseminar</strong> Grund- und Hauptschulen Koblenz entwickelte ein<br />
kooperatives Ausbildungskonzept. Danach wurden im <strong>Studienseminar</strong><br />
Sonderschulen Kaiserslautern die Allgemeinen Seminare und im <strong>Studienseminar</strong><br />
Grund- und Hauptschulen Koblenz die Ausbildung der<br />
sonderpädagogischen Fachrichtungen und der Unterrichtsfächer durchgeführt.<br />
Das Konzept hatte folgende strukturelle Eckpunkte:<br />
� Konzeptbesprechung unter Beteiligung von Ausbildern in der Schule<br />
(Mentoren) und im Seminar (Fachleitern); Information der Schulleitungen<br />
� Durchführung von Kooperationsseminaren unter Beteiligung von<br />
Fachrichtungs- und Fachvertretung<br />
� gemeinsame Beurteilung von Anwärterleistungen im Unterricht und<br />
bei der Examensarbeit<br />
� gemeinsame Durchführung der Zweiten Staatsprüfungen mit Abstimmung<br />
der Prüfungsinhalte und der Bewertungskriterien<br />
� Organisation der Ausbildung in unterschiedlichen Ausbildungstagen<br />
(Sonderpädagogik Mittwoch, Grund- und Hauptschulen Dienstag).<br />
Das Ministerium hatte dieses kooperative Ausbildungskonzept ausdrücklich<br />
gefördert und bewilligt und damit Erfahrungen ermöglicht, die<br />
für das kooperative Ausbildungskonzept mit Gründung des neuen sonderpädagogischen<br />
<strong>Studienseminar</strong>s in Neuwied 1996 tragend wurden.<br />
In der Zeit von 1992 bis 1996 wurden 6 Anwärterinnen und Anwärter mit<br />
Blinden- und Sehbehindertenpädagogik ausgebildet.<br />
1.2 Ein neues <strong>Studienseminar</strong> für das Lehramt an<br />
Sonderschulen in Neuwied wird vorbereitet<br />
Obwohl das <strong>Studienseminar</strong> Sonderschulen Kaiserslautern halbjährlich<br />
einstellte, war auf Dauer die Ausbildung im Vorbereitungsdienst nach<br />
angemessener Wartephase nicht immer gewährleistet, da im Wintersemester<br />
1995/96 über 950 Damen und Herren an der Universität Koblenz-Landau<br />
Sonderpädagogik studierten. Es war der erklärte Wille aller<br />
politischen Entscheidungsträger, im Norden des Landes <strong>Rheinland</strong>-<br />
Pfalz ein weiteres <strong>Studienseminar</strong> für das Lehramt an Sonderschulen zu<br />
errichten. Für den Standort des Seminars spielten neben verkehrstechnischen<br />
Gesichtspunkten folgende Kriterien eine Rolle:<br />
� das <strong>Studienseminar</strong> sollte im Nahbereich von Sonderschulen als<br />
Ausbildungsschulen liegen<br />
15
� das <strong>Studienseminar</strong> sollte im Nahbereich von Grund- und Hauptschulen<br />
als Ausbildungsschulen liegen und<br />
� das <strong>Studienseminar</strong> soll als kooperatives Seminar eingerichtet<br />
werden, das eine besondere räumliche, fachliche und ausbildungsspezifische<br />
Nähe zum <strong>Studienseminar</strong> für das Lehramt an Grundund<br />
Hauptschulen aufweist.<br />
Der Standort Neuwied entsprach diesen Anforderungen, zumal von<br />
1978 bis 1989 bereits ein entsprechendes Seminar in Neuwied eingerichtet<br />
war. Der Leiter des <strong>Studienseminar</strong>s Grund- und Hauptschulen<br />
Koblenz erhielt mit Schreiben des MBWW vom 24.04.1996 folgenden<br />
Auftrag:<br />
Sehr geehrter Herr Kiersch,<br />
um die Eröffnung des neuen <strong>Studienseminar</strong>s zu dem o.g. Zeitpunkt<br />
zu gewährleisten, sind die damit einhergehenden Sachfragen<br />
(Räumlichkeiten, Möblierung, usw.) ebenso wie die Personalfragen<br />
(Verwaltungsangestellte, Überprüfung von hauptamtlichen<br />
und lehrbeauftragten Fachleiterinnen/Fachleitern) umgehend mit<br />
Nachdruck zu betreiben.<br />
Als ehemaliger Leiter des Staatlichen <strong>Studienseminar</strong>s für das<br />
Lehramt an Sonderschulen Neuwied und derzeitiger Leiter des<br />
Staatlichen <strong>Studienseminar</strong>s für das Lehramt an Grund- und<br />
Hauptschulen in Koblenz beauftrage ich Sie mit der Wahrnehmung<br />
der vor Ort erforderlichen Aufgaben.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
Im Auftrag<br />
Peter Wagner<br />
1.2.1 Raumbeschaffung<br />
Der ehemalige Seminarleiter erinnert sich<br />
(Undercover auf Objektsuche)<br />
An einem tristen Februarmorgen im Jahr 1996 läutet im <strong>Studienseminar</strong><br />
für Grund- und Hauptschulen Koblenz das Telefon. Die Sekretärin wird<br />
gebeten, eine Verbindung zum Leiter des <strong>Studienseminar</strong>s, Herrn Rektor<br />
Ekkehard Kiersch, herzustellen. Am Telefon ist der Referatsleiter für<br />
16
Grund-, Haupt- und Sonderschulen im Ministerium, Herr Ministerialrat<br />
Peter Wagner.<br />
„Hallo Ekkehard, hier ist Peter. Heute habe ich für dich eine etwas heikle<br />
Mission. Wie Du weißt, soll zum 01. 08. diesen <strong>Jahre</strong>s ein neues<br />
Sonderschulseminar im Bereich Neuwied – Deiner alten Wirkungsstätte<br />
– eingerichtet werden. Wir suchen nun nach einem Gebäude, in dem<br />
das neue Sonderschulseminar zusammen mit dem Grund- und Hauptschulseminar,<br />
das auch nach Neuwied umziehen wird, untergebracht<br />
werden kann. In der Stadt Neuwied soll es jetzt ausreichend Platz zum<br />
Anmieten geben. Also bitte ich Dich zu eruieren, ob da zwei <strong>Studienseminar</strong>e<br />
untergebracht werden können. Folgende Kriterien sollen erfüllt<br />
sein: ausreichend Platz für zwei Seminare ,ausreichend Parkfläche,<br />
wenn möglich, unbewirtschaftet und Grund- und Hauptschulen sowie<br />
Sonderschulen in erreichbarer Nähe. Und jetzt die Hauptsache: die<br />
Sondierungsaktion darf nicht publik werden. Also nimm die Sache selbst<br />
in die Hand und berichte mir dann telefonisch“.<br />
Jetzt hatte ich den Rechercheauftrag. In der Tat wurden in Neuwied<br />
Mietobjekte frei, da die Verwaltungsabteilungen, die in den Stadtteilen<br />
untergebracht waren, im ehemaligen Rasselsteinhochhaus zentralisiert<br />
werden sollten. Ich fand drei Mietobjekte, die für einen Seminarstandort<br />
interessant sein könnten: Niederbieber, Heimbach-Weis und Engers .<br />
Ich habe die 3 Verwaltungsgebäude besucht und nach den mir aufgetragenen<br />
Kriterien überprüft. Beim Besuch dieser verschiedenen Objekte<br />
wurde mein suchendes Interesse als Desorientierung interpretiert.<br />
Hilfreiche Verwaltungsmitarbeiter/innen boten sich an, mir den Weg zu<br />
zeigen. Meine verschiedenen Fragen, die für einen Behördennutzer<br />
eher außergewöhnlich waren, haben die Miterbeiter/innen spürbar<br />
verunsichert. Sie blieben freundlich, wurden aber mit ihren Antworten<br />
zunehmend vorsichtiger. Vermutlich hatten sie den Verdacht, dass es<br />
sich um eine verdeckte Überprüfung ihrer Arbeitsbedingungen handelte.<br />
Nach 2 Tagen der Sondierung konnte ich dem Ministerium eine erfolgreiche<br />
Suche melden:<br />
“Hallo Peter, ich kann erfolgreichen Vollzug der Geheimaktion melden.<br />
Ich habe tatsächlich ein Verwaltungsgebäude gefunden, das für beide<br />
Seminare wie geschaffen ist. Es bietet ausreichend Platz, die Möglichkeit<br />
der Einrichtung einer gemeinsamen Bibliothek fast ohne bauliche<br />
Veränderung, einen Festsaal , mehrere kleine Verwaltungsräume, die<br />
zu funktionstüchtigen Seminarräumen erweitert werden können und<br />
17
dazu ausreichend unbewirtschaftete Parkfläche vor dem Haus. Grund-,<br />
Haupt- und Sonderschulen sind in unmittelbarer oder erreichbarer Nähe.<br />
Zwischen Heimbach-Weis und Neuwied, Hauptbahnhof besteht eine<br />
gute Busverbindung. Dieses Mietobjekt würde ich vorschlagen“.<br />
Und so kam es dann auch. Das vorgeschlagene Mietobjekt wurde Domizil<br />
für die <strong>Studienseminar</strong>e Grund- und Hauptschulen sowie Sonderschulen.<br />
Ekkehard Kiersch , FöR i. R.<br />
Nach Vorliegen der ungefähren Studiendaten der zukünftigen LAA Ende<br />
Mai 1996 konnte mit den direkten Vorbereitungsarbeiten begonnen<br />
werden:<br />
� Berufung von Schulen zu Ausbildungsschulen durch die Bezirksregierung<br />
� Meldung interessierter Sonderschullehrkräfte zur Übernahme von<br />
Ausbildungsaufgaben im <strong>Studienseminar</strong><br />
� Überprüfung der Fachleiter/innen durch Bezirksregierung und <strong>Studienseminar</strong><br />
(15 Meldungen) in der Zeit vom 13.06. bis 03.07.1996<br />
� Zuteilung der LAA an die Schulen am 18.06.1996<br />
� Unterzeichnung des Mietvertrages am 19.06.1996<br />
� Dienstbesprechung mit den Leiterinnen und Leitern der zukünftigen<br />
Ausbildungsschulen am 15.07.1996 zur Klärung des Ausbildungskonzepts,<br />
zur Abstützung der Ausbildungsaufgaben, zu Berufungsverfahren<br />
von Mentorinnen und Mentoren und zu Fragen des Unterrichtseinsatzes<br />
(selbständiger Unterricht, angeleiteter Unterricht,<br />
Hospitation).<br />
Die Fülle der skizzierten Aufgaben in dem schmalen Zeitfenster zu<br />
bewältigen war nur möglich, weil alle an Planung- und Durchführung der<br />
Ausbildung im neuen <strong>Studienseminar</strong> beteiligten Stellen hoch engagiert<br />
und voll überstützend mitgewirkt haben. Die Bezirksregierung Koblenz,<br />
das Sonderschulreferat, ist in diesem Zusammenhang besonders zu<br />
nennen. Vor Beginn der Ausbildung musste dem MBWW ein Stellenkonzept<br />
zur zukünftigen Ausstattung des <strong>Studienseminar</strong>s an Planstellen<br />
und Etatanforderungen vorgelegt werden, das an den voraussehbaren<br />
Studienzahlen orientiert war.<br />
18
1.2.2 Start des neuen <strong>Studienseminar</strong>s am 01.08.1996<br />
Mit Rundschreiben des MBWW vom 13.11.1996 wurde mit Wirkung<br />
vom 01.08.1996 das Staatliche <strong>Studienseminar</strong> für das Lehramt an<br />
Sonderschulen Neuwied errichtet. Das Seminar war im <strong>Studienseminar</strong><br />
Grund- und Hauptschulen Koblenz mit Sitz Koblenz, Pfaffendorfer Höhe,<br />
untergebracht. Es startete mit 36 Lehramtsanwärter/innen, die an<br />
zwei Grundschulen und 29 Sonderschulen (eine im Bereich Trier –<br />
Schule für Gehörlose) ausgebildet wurden. Die Ausbildungsaufgaben<br />
wurden im <strong>Studienseminar</strong> von 17 Fachleiter/innen Sonderschulen und<br />
7 Fachleiter/innen Grund- und Hauptschulen und an Ausbildungsschulen<br />
von Mentorinnen und Mentoren wahrgenommen.<br />
Lehramtsanwärter erinnern sich<br />
Vor <strong>10</strong> <strong>Jahre</strong>n haben wir als zwei von 36 SLAA unser Referendariat am<br />
<strong>Studienseminar</strong> für Sonderschulen Neuwied begonnen. Vieles befand<br />
sich noch im Aufbau – Seminarort und -bezeichnung waren nicht deckungsgleich:<br />
Vereidigung und Seminare fanden zunächst in Koblenz<br />
statt. Die der Ausbildung zugrunde liegende Prüfungsordnung lag anfangs<br />
als Entwurf vor und erforderte und ermöglichte die Mitarbeit von<br />
SLAA und FL.<br />
Die FL erprobten und erweiterten ihre Methodenkompetenz in unserem<br />
Durchgang der Fachseminare, und wir erwarben grundlegende Fähigkeiten<br />
im Clustern und Kugellagern, Mind-Mappen usw., doch nie im<br />
Fishbowlen. (Frau Wolff-Wintermeier scheiterte hier wiederholt an unserer<br />
Unwilligkeit; es fanden sich einfach keine Freiwilligen.)<br />
Wir erörterten, was eine didaktische Analyse sei und wo wir die Grenze<br />
zur methodischen Analyse ziehen sollten. Dabei gab es durchaus unterschiedliche<br />
Auffassungen von Fachseminar zu Fachseminar. Anders als<br />
heute gab es noch keine Handreichungen aus dem Internet.<br />
Die Seminare der zweiten Fachrichtung fanden jeweils reihum an den<br />
Ausbildungsschulen der Teilnehmer statt, verbunden mit langen Fahrten<br />
durch blühende Landschaften. So manches Mal ergab sich hier die<br />
Notwendigkeit einer Fahrgemeinschaft (Reisekostenabrechnung!), bei<br />
der wir unsere Fachleiterin Frau Müller von einer ganz anderen Seite<br />
kennen lernten: Sie hatte einen Golf „Rolling Stones“ und so fuhr sie<br />
auch.<br />
Das Fachseminar Biologie fand in Kooperation mit dem Hauptschulseminar<br />
statt. Der fruchtbare gegenseitige Austausch untereinander gipfelte<br />
für Teilnehmerinnen und den Fachleiter Herrn Caratiola häufig in der<br />
Erkenntnis: „Bei Gehörlosen ist immer alles anders!“<br />
19
Heute blicken wir auf eine spannende und erfolgreiche Ausbildungszeit<br />
zurück und freuen uns, durch die Arbeit als Mentoren immer wieder im<br />
Ausbildungsprozess eingebunden zu sein.<br />
Martin Ernst/ Saskia Kleinegräber<br />
Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung legte die Ausbildungsaufgaben<br />
fest. Das Ziel der Ausbildung gemäß § 1 ist die selbständige und erfolgreiche<br />
Arbeit im Lehramt an Sonderschulen auf der Grundlage der<br />
studierten Fachrichtungen und der Fächer; dabei wird die Erteilung von<br />
Unterricht und Fördermaßnahmen an anderen Schulen eingeschlossen.<br />
Beratungs- und Kooperationskompetenz sind besonders zu fördern. Die<br />
Ausbildung findet im <strong>Studienseminar</strong> und an Ausbildungsschulen statt.<br />
1.2.3 Ausbildung im <strong>Studienseminar</strong><br />
� Allgemeines Seminar 25 Tagungen<br />
� Seminare der Schwerpunktfachrichtung (SFR) 40 Tagungen<br />
(30 SFR + <strong>10</strong> Lernbereich/ didaktischer Bereich)<br />
� Seminare der weiteren Fachrichtung (wFR) 20 Tagungen<br />
Das Hauptfach wird in der Regel im Rahmen der Schwerpunktfachrichtung<br />
ausgebildet. Wurde das Hauptfach auf Sekundarstufe I-Niveau<br />
studiert und / oder unterrichtet der Anwärter an einer Sonderschule, die<br />
schwerpunktmäßig nach Grund- und Hauptschullehrplänen unterrichtet,<br />
so findet die Fachausbildung im <strong>Studienseminar</strong> Grund- und Hauptschulen<br />
statt. Dies erfordert ein umfassendes Kooperationskonzept, das in<br />
den Grundaussagen in der Zeit von 1993 bis 1996 in der Schule für<br />
Blinde und Sehbehinderte erprobt wurde.<br />
Ein kooperierender Fachleiter erinnert sich<br />
Am 04.09.1996 fand in der Seminarschule, Schillerschule / GHS / Lahnstein,<br />
das erste Fachseminar im Fach Sport in Kooperation statt. Referendare<br />
des <strong>Studienseminar</strong>s für das Lehramt an GHS und an Sonderschulen<br />
sollten von nun an gemeinsam, wenn auch in unterschiedlicher<br />
Teilnahmedauer, ausgebildet werden. Die ersten beiden Durchgänge<br />
(1996 – 1999) begannen zeitversetzt, ab Februar 1999 aber lief alles in<br />
„geregelten“ Bahnen.<br />
In den von mir geleiteten acht <strong>Jahre</strong>n gemeinsamer Ausbildungsarbeit<br />
nahmen Referendare des <strong>Studienseminar</strong>s für das Lehramt an Sonderschulen/Neuwied<br />
teil, die in Schulen für Lernbehinderte, Körperbehinderte,<br />
Geistigbehinderte und Verhaltensbehinderte tätig waren.<br />
Insgesamt ist festzustellen, dass diese kooperative Form der Ausbildung<br />
als positiv eingestuft werden kann. Beide Seiten konnten vonein-<br />
20
ander profitieren und fortan auch weiter über ihren „eigenen Tellerrand“<br />
schauen. In vielen Bereichen o.g. Sonderschulen war festzustellen, das<br />
dort sportlich z. T. identische Inhalte angeboten werden konnten, dass<br />
Schwerpunkte ähnlich gelagert wie in der GHS, systematisch angegangen<br />
wurden. Ich möchte dazu den Schwerpunkt Kondition/Ausdauer<br />
erwähnen, an dem in einer Schule für Geistigbehinderte über einen<br />
längeren Zeitraum intensiv gearbeitet wurde und beachtliche Erfolge<br />
gezeitigt werden konnten. Ich denke an Schwimmunterricht an gleicher<br />
Stätte, wo bis zu drei Schwimmtechniken vermittelt werden konnten,<br />
natürlich unter sensibler Beachtung spezieller Methoden.<br />
Um die Eigenarten der jeweiligen Schulen (Förderschwerpunkte) noch<br />
besser kennen zu lernen, fanden auch Fachtagungen mit Unterricht und<br />
sportpraktischer Ausbildung in Sonderschulen selbst statt. Somit konnte<br />
der Blick für viele unbekannte Fakten geschärft und gewisse Problematiken<br />
besser eingeschätzt und verstanden werden. Wir alle schlüpften<br />
u.a. zeitweise in die Rolle eines Körperbehinderten und bevorzugten<br />
einen Unterrichtstag lang einen Rollstuhl als Fortbewegungsmittel. Das<br />
praktizierten wir sowohl im Schulgebäude, bei Sport und Spiel in der<br />
Halle und außerhalb der Schule.<br />
In diesem Zusammenhang sei auch noch die bemerkenswerte Arbeit<br />
mit den pädagogischen Fachkräften erwähnt, so u.a. an einer Schule,<br />
genannt Förderzentrum, wo in einer Lerngruppe mehrere Formen der<br />
Behinderung zu berücksichtigen waren, eine Aufgabe für die beiden, die<br />
ich als äußerst schwierig und problematisch einschätzte. Eine optimale<br />
Absprache innerhalb des Unterrichts war angesagt. Nach <strong>Jahre</strong>n der<br />
Erprobung wurde aber diese Form der schulischen Förderung als gut<br />
und praktikabel eingestuft.<br />
Zusammenfassend kann nochmals festgestellt werden, dass diese Art<br />
der Ausbildung, die Kooperation zweier <strong>Studienseminar</strong>e „unter einem<br />
Dach“, für alle Beteiligten eine Bereicherung auf vielen Ebenen darstellte.<br />
Man lernte Gemeinsamkeiten, spezifische Eigenheiten und viele<br />
Nuancen jeweiliger schulischer Tätigkeiten kennen. Große Unterstützung<br />
erfuhr ich bei den Fachleiter/-innen des <strong>Studienseminar</strong>s für Sonderschulen<br />
und bei den Mentoren, die u.a. bei Unterrichtsbesuchen<br />
fachrichtungsspezifisch nicht nur den Unterricht beleuchten konnten.<br />
Die Zusammenarbeit war, bezogen auf das Fach Sport, sehr positiv und<br />
konstruktiv, so dass auch hier die Kooperation sich durchweg bewährt<br />
hat.<br />
Alois Lochner,<br />
Fachleiter Sport im GHS-Seminar,<br />
kooperative Ausbildung 1996 – 2003<br />
21
In der Zeit von August bist Dezember 1996 mussten die konzeptionellen<br />
Ausbildungsgrundlagen auf der Basis der Vorschläge von Herrn Breiten<br />
(stellvertretender Seminarleiter im neuen <strong>Studienseminar</strong>) gelegt werden.<br />
Vielfältige Anstöße und wissenschaftlichen Diskussionsbedarf löste<br />
dabei der Begriff des „zentralen Anliegens“ aus.<br />
Die ersten Ausbildungspläne entstanden. Die gemeinsame Arbeit an<br />
„Hinweise für eine umfassende Unterrichtsplanung“ schuf hinsichtlich<br />
der Lernvoraussetzungen, der Inhalte der Lernverfahren und Medien<br />
eine gute Basis für eine konzeptionell abgestimmte Ausbildungsarbeit.<br />
1.2.4 Ausbildung in der Schule<br />
Wenn es die Wahl der Fachrichtungen zulässt, werden beide sonderpädagogischen<br />
Fachrichtungen an einer Ausbildungsschule ausgebildet.<br />
Ist dies nicht der Fall, findet die Ausbildung an zwei Sonderschulformen<br />
oder an zwei Schularten (z. B. Sonderschule und Grundschule) statt.<br />
Insgesamt werden pro Woche 12 Stunden Unterricht erteilt. In den 18<br />
Monaten sollen durchschnittlich 6 Stunden pro Woche eigenständig<br />
erteilt werden. Aus pragmatischen Gründen sieht das <strong>Studienseminar</strong><br />
Sonderschulen Neuwied folgende Regelung vor:<br />
1. Halbjahr 8 Std. betreut 4 Std. selbständig<br />
2. Halbjahr 6 Std. betreut 6 Std. selbständig<br />
3. Halbjahr 4 Std. betreut 8 Std. selbständig<br />
Die schulpraktische Bewährung wird punktuell in Form von Lehrproben<br />
durch das <strong>Studienseminar</strong> und die unterrichtliche und erzieherische<br />
Langzeitwirkung durch die Schule festgestellt.<br />
Das 2. Staatsexamen besteht aus 3 Teilen: schriftlicher Teil (Examensarbeit),<br />
praktischer Teil (zwei Lehrproben in den jeweiligen sonderpädagogischen<br />
Fachrichtungen) und mündlicher Teil.<br />
1.3 Bezug der neuen Diensträume zum 01.01.1997<br />
Bevor – gemeinsam mit dem <strong>Studienseminar</strong> Grund- und Hauptschulen<br />
– die neuen Räume in Neuwied, Heimbach-Weis, bezogen werden<br />
konnten, mussten noch geringfügige Umbau- und Renovierungsmaßnahmen<br />
vorgenommen werden. Bei allem wurden wir vom Ministerium<br />
und der Stadt Neuwied umfassend unterstützt; dies gilt auch für die<br />
Forderung, die die gemeinsame Personalvertretung für die beiden Stu-<br />
22
dienseminare mit Nachdruck vertrat, alle zukünftigen Diensträume auf<br />
Giftstoffe zu überprüfen. Es zeigte sich, dass diese Maßnahme notwendig<br />
war.<br />
Mit dem Leiter der Dienststelle des <strong>Studienseminar</strong>s Grund- und Hauptschulen,<br />
Herrn Dr. Friedrichs, wurde ein Raum- und Nutzungsplan<br />
erstellt, der hohen kooperativen Anforderungen entsprach. Auch die<br />
Etatanforderungen und Medienbeschaffungen wurden koordiniert.<br />
Es wurde eine gemeinsame Bibliothek eingerichtet. Die Eröffnung des<br />
neuen <strong>Studienseminar</strong>s erfolgte am 11.06.1997 durch Herrn Minister<br />
Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner in einer bewegenden Feierstunde, die deutliche<br />
Züge gelebter Kooperation aufzeigte. Der Minister beschrieb in<br />
seiner Grundsatzrede das kooperative Ausbildungskonzept, neue<br />
Sichtweisen von Unterricht, neue Aufgabenbereiche der Sonderpädagogik<br />
und differenzierte bei der Definition von Behinderung und Förderung.<br />
Oberbürgermeister Scherrer, Ministerialrat Wagner, Landrat Kaul, Minister Prof. Dr.<br />
Zöllner und Dezernent Rollepatz (v.l.) bei der Eröffnungsfeier 1997 (Foto Ruth Köfer)<br />
Im Verlauf des 1. Ausbildungsdurchgangs gewann die Frage nach der<br />
Beurteilung von Anwärterleistungen an Bedeutung. Hierzu wurden<br />
Konferenzen durchgeführt und Handreichungen zur Beurteilung von<br />
Anwärterleistungen in <strong>Studienseminar</strong> und Schule entwickelt. Dieser<br />
Entwicklungsprozess diente auch der Abstimmung von Leistungsanforderungen.<br />
Die entwickelten Papiere wurden den Schulleitern in Dienstbesprechungen<br />
vermittelt.<br />
23
Ein Schulleiter erinnert sich<br />
- eine sehr persönliche Sichtweise<br />
1989: Das <strong>Studienseminar</strong> für das Lehramt an Sonderschulen in Neuwied<br />
auf dem Heddesdorfer Berg wird aufgelöst. Hervorragend funktionierende<br />
Strukturen in der Sonderschullehrerausbildung werden zerschlagen.<br />
1996: Ein <strong>Studienseminar</strong> für das Lehramt an Sonderschulen wird mit<br />
Sitz in Neuwied Heimbach-Weis nach 7-jähriger Nichtexistenz erneut<br />
eingerichtet.<br />
Die Maximilian-Kolbe-Schule, Schule für Lernbehinderte (Sonderschule)<br />
in Rheinbrohl ist wieder Ausbildungsschule. Die schulpraktische Ausbildungsarbeit<br />
des Schulleiters und der Mentorinnen und Mentoren wird<br />
fortgesetzt.<br />
Im Juli 1996 meldete sich bei mir telefonisch eine Sonderschullehramtsanwärterin<br />
und stellte sich mit sympathischem pfälzischen Zungenschlag<br />
vor. Es wurden kurze Informationen ausgetauscht und ein Gesprächstermin<br />
in der Maximilian-Kolbe-Schule vereinbart. Auf ihre<br />
Frage nach einer Unterkunft für die Zeit der Ausbildung, konnte ich<br />
sogar bei der Zimmerfindung in Neuwied behilflich sein. (Auch das ist<br />
für mich Teil meiner Ausbildungsarbeit im weiteren Sinne.) Eine mir<br />
bekannte Familie in Neuwied hatte viel Platz in ihrem großen Einfamilienhaus<br />
und nahm die SLAA’ gern bei sich auf. Nebenbei: Der Kontakt<br />
zwischen ihnen besteht bis heute!<br />
Es folgte die erste Begegnung in der Maximilian-Kolbe-Schule mit einem<br />
längeren Gespräch, dem Vorstellen der Ausbildungsklasse, des<br />
Mentors, des übrigen Kollegiums inklusive Sekretärin und Hausmeister<br />
sowie einem Gang durch das Schulgebäude.<br />
Der Mentor für die Schwerpunktfachrichtung „Verhaltensbehindertenpädagogik“<br />
war schnell gefunden: Herr Sonderschullehrer Hoß, Leiter der<br />
Klasse 1/2. In der weiteren Fachrichtung „Lernbehindertenpädagogik“,<br />
so die Vorgabe, sollte die SLAA’ in einer anderen Klasse unterrichten.<br />
Die Betreuung musste auch ein weiterer Mentor übernehmen. Das war<br />
schwierig, stand doch in der damals 6-klassigen MKS aus den verschiedensten<br />
Gründen kein zusätzlicher Mentor zur Verfügung, da alle<br />
Kollegen (auf die weibliche Form muss hier verzichtet werden, da das<br />
Kollegium vor Ort ausschließlich aus 7 Männern!!! bestand; was in der<br />
Tat als extreme Seltenheit anzusehen war) bereits anderweitig schulische<br />
Zusatzaufgaben zu bewältigen hatten. Was tun?<br />
Frau Sonderschullehrerin Handwerker, eine erfahrene Mentorin aus der<br />
Zeit des „alten“ <strong>Studienseminar</strong>s, die von der Maximilian-Kolbe-Schule<br />
zur Arbeit im Schulversuch „Gemeinsamer Unterricht...“ an die Grundschule<br />
in Unkel abgeordnet war, fand sich bereit, in ihrer Integrations-<br />
24
klasse für die SLAA als Mentorin zu wirken. Somit unterrichtete die<br />
SLAA’ nun an einem Tag pro Woche 4 Stunden in einer Integrationsklasse<br />
der Grundschule Unkel. Im Nachhinein erwies sich dies als äußerst<br />
positiv, ist doch heutzutage der Einsatzort vieler Förderschullehrer<br />
/ innen die Schwerpunktgrundschule bzw. Schwerpunktschule Sek. I.<br />
Der Not gehorchend wurde somit diesbezüglich seinerzeit genau die<br />
richtige Entscheidung getroffen.<br />
Als ehemaliger Fachleiter und nun schon seit 22 <strong>Jahre</strong>n Schulleiter,<br />
stelle ich immer wieder mit Respekt und Freude fest, dass die FöLAA<br />
(früher SLAA) als Einstieg in ihre zukünftige Arbeit an der Förder- und /<br />
oder Schwerpunktschule hervorragende theoretische Kenntnisse von<br />
der Universität mitbringen.<br />
In der Schulpraxis ist unser Ausbildungsziel die selbständige und erfolgreiche<br />
Arbeit der FöLAA mit Förderschülern. Meine Aufgabe als<br />
Schulleiter ist es, gemeinsam mit den Mentorinnen und Mentoren mit<br />
den FöLAA in ständiger Auseinandersetzung mit der Theorie diese in<br />
der Schulpraxis zu konkretisieren und stets kritisch zu überprüfen.<br />
Der Unterricht steht im Vordergrund. Um ihn geht es primär. Er ist theoriegeleitete<br />
Praxis, die die kritische Reflexion des Handelns in der konkreten<br />
Situation beinhaltet, also (m.E. in dieser Reihenfolge): Erziehung,<br />
Wissensvermittlung, Beratung, Beurteilung und manches andere,<br />
gleichsam „spurenelementar“, mehr. Mit der Mentorin bzw. dem Mentor<br />
habe ich den FöLAA Hilfen zu bieten zum Finden des eigenen persönlich-individuellen<br />
Weges hinsichtlich des Unterrichts im engeren und der<br />
Aufgabenfelder des Förderschullehrers im weiteren Sinne. Die FöLAA<br />
erhalten Raum für Eigenerfahrung und sollen pädagogische und persönliche<br />
Initiativen entfalten.<br />
Wichtige Grundlage des Erziehungserfolges ist das Zutrauen der FöLAA<br />
in sich selbst und in ihre Arbeit sowie ihr Vertrauen in das Kind und<br />
dessen Erziehbarkeit und Bildsamkeit.<br />
Als Schulleiter habe ich sie diesbezüglich zu stützen und bei mit Sicherheit<br />
auch eintretenden Misserfolgen wieder aufzubauen.<br />
Die FöLAA erfahren täglich die sehr hohen Anforderungen, die die<br />
Förderschule bzw. Schwerpunktschule an uns Lehrerinnen und Lehrer<br />
richtet!<br />
Die vielen kleinen Erfolge bei der Bildungs- und Erziehungsarbeit unserer<br />
Schüler / innen, machen unseren Beruf als Lebensaufgabe liebenswert<br />
.<br />
Bernd Kuha, Förderschulrektor<br />
Leiter der SFL Rheinbrohl<br />
25
1.4 Phase der Konsolidierung<br />
Der 2. Ausbildungsdurchgang startete im Februar 1998 mit 56 Anwärterinnen<br />
und Anwärtern, die sich wie folgt auf die sonderpädagogischen<br />
Fachrichtungen verteilten:<br />
Schwerpunktfachrichtung weitere Fachrichtung<br />
Blindenpädagogik 3 1<br />
Gehörlosenpädagogik 3 -<br />
Geistigbehindertenpädagogik 7 13<br />
Körperbehindertenpädagogik 7 9<br />
Lernbehindertenpädagogik 22 12<br />
Schwerhörigenpädagogik - -<br />
Sehbehindertenpädagogik - -<br />
Sprachbehindertenpädagogik <strong>10</strong> 16<br />
Verhaltensbehindertenpädagogik 4 5<br />
Die Ausbildung erfolgte an 37 Ausbildungsschulen. Die Hauptfächer<br />
wurden schwerpunktmäßig durch Grundschulpädagogik (27), Deutsch<br />
(13), Mathematik (5), Biologie (5) und Sport repräsentiert. Kooperative<br />
Ausbildung konnte in Arbeitslehre/Haushalt (1), Biologie (4), Deutsch<br />
(8), Englisch (2), Evangelische Religion (3), Geschichte (2), Mathematik<br />
(3), Physik (1), Sport (3) und Textiles Gestalten (1) angeboten werden.<br />
Für die Fachausbildung im <strong>Studienseminar</strong> Grund- und Hauptschulen<br />
Neuwied wurden Handreichungen entwickelt, die Teil eines Kooperationskonzepts<br />
waren.<br />
In einer Ausbildung im <strong>Studienseminar</strong>, die die theoriegeleitete Praxis in<br />
den Mittelpunkt stellt, war die Unterrichtstätigkeit an der Ausbildungsschule<br />
als Erfahrungs-, Reflexions- und Alltagsfeld von zentraler Bedeutung.<br />
Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung sieht zur Bewältigung<br />
dieses Lernfeldes eine Hilfe vor. Dies ist die Mentorin / der Mentor. Das<br />
Tätigkeitsfeld „Mentor“ enthält helfende, beratende und beurteilende<br />
Elemente. Dazu wurde im <strong>Studienseminar</strong> eine umfassende Handreichung<br />
entwickelt und durch ein Fortbildungskonzept mit kontinuierlichen<br />
Fortbildungstagungen in Zusammenarbeit mit den entsprechenden<br />
Instituten konkretisiert.<br />
26
Eine Mentorin erinnert sich<br />
Oft genug habe ich gesagt, dass ich über die Erfahrungen als Mentorin<br />
Bücher schreiben könnte, Bücher ja, aber eine Seite? Wie kann ich so<br />
viele Eindrücke in wenige Zeilen fassen?<br />
Eines Tages, im Vorübergehen auf dem Flur, teilt mir meine Konrektorin<br />
mit: „Ich brauche Sie als Mentorin.“ Ein hektischer Blick meinerseits<br />
nach hinten, aber dort war niemand, sie sprach mit mir. So, denke ich,<br />
kommt man also an dieses Amt, einfach eine Feststellung der Tatsache,<br />
keine Frage, keine Möglichkeit abzulehnen.<br />
Viele Gedanken und Fragen tauchen in so einem Moment auf: warum<br />
ich? Die eigene Prüfung ist erst / schon zehn <strong>Jahre</strong> her, kann ich das<br />
überhaupt, jemanden beraten, ist mein Unterricht vorzeigbar und kann<br />
ein junger Mensch etwas davon lernen??? Und dann: Unterrichtsbesuche,<br />
jemand sitzt wieder in meinem Unterricht und schaut zu. Die Leute<br />
vom <strong>Studienseminar</strong> kommen wieder in die Schule, vielleicht sogar der<br />
Herr Kiersch! Und ich habe nicht nur gute Erinnerungen an meine eigene<br />
Zeit als Lehramtsanwärterin. Immerhin, jetzt sitze ich auf der anderen<br />
Seite und kann endlich sagen, was mir früher immer viel zu spät<br />
eingefallen ist.<br />
Die erste Lehramtsanwärterin, die in meine Klasse kommt, braucht nicht<br />
wirklich eine Mentorin. Die junge Frau ist sehr klug, engagiert und fleißig<br />
und weiß ganz genau, was sie wie und warum tun muss. Die Schüler<br />
sind begeistert, ich auch und besonders die Damen und Herren vom<br />
Seminar. Mentorin sein war doch viel einfacher als ich gedacht hatte.<br />
Außerdem habe ich viel Neues gelernt, denn das „Stationen –Lernen“<br />
und die „Werkstatt“ waren zu meiner Zeit noch nicht erfunden gewesen.<br />
Und so gelange ich zu der Ansicht, dass Mentorin sein zwar Zeit und ein<br />
wenig Mühe kostet, aber auch zum eigenen Fortschritt beiträgt.<br />
Frohen Mutes sehe ich den kommenden Anwärter- / innen entgegen.<br />
Und muss feststellen, dass diese sehr verschieden sein können. Ich<br />
lerne ein neues Wort und seine Bedeutung kennen: „beratungsresistent“.<br />
Vorsichtig erkundige ich mich beim zuständigen Fachleiter, wie<br />
weit die Mentorenpflicht geht. „Beraten“, heißt es da, und „Anleiten“.<br />
Aha, aber wenn die Anwärterin beides nicht möchte, sondern statt dessen<br />
fertige Stunden und Arbeitsblätter? Gleichzeitig muss ich die aufgebrachte<br />
PF beruhigen und vermitteln, wenn die angehende Lehrerin<br />
nach der gehaltenen Stunde entschwindet und das Aufräumen des<br />
Klassenzimmers zum wiederholten Male vergisst. Vorsichtige Rücksprachen<br />
mit Kolleginnen zeigen, dass ich nicht allein bin mit meinem<br />
Problem. Nach kurzer Zeit wird eine Selbsthilfegruppe gegründet: das<br />
27
inoffizielle Mentorentreffen. Eine wunderbare Einrichtung, hier können<br />
wir nicht nur Probleme austauschen sondern auch die Lösungen dazu.<br />
Mentorin zu sein, ist eine ebenso spannende Sache, wie Lehrerin zu<br />
sein, kein Tag ist wie der andere, immer gibt es Überraschungen und<br />
die positiven Aspekte überwiegen bei weitem. Ich würde es wieder tun.<br />
28<br />
Martina Ohmer<br />
Im Jahr 1998 erhielten beide sonderpädagogischen <strong>Studienseminar</strong>e<br />
vom Ministerium den Auftrag, einen gemeinsamen Ausbildungsplan zu<br />
entwickeln, der neben Ziel- und Inhaltsverbindungen auch seminardidaktische<br />
und –methodische Komponenten enthielt. Es wurden für das<br />
Allgemeine Seminar und die jeweiligen Fachrichtungen und zum Teil<br />
auch Fächer gemeinsame Arbeitsgruppen gebildet. Die kollegialen<br />
Gespräche führten zu einer abgestimmten Konzeptbildung, einer gemeinsamen<br />
Ausbildungsplanung und förderten das Selbstverständnis<br />
der Fachleiterinnen und Fachleiter.<br />
Eine ehemalige Fachleiterin erinnert sich<br />
Fachleiterin im Sonderschulseminarein<br />
Stellenanzeigenprofil:<br />
Sie sollte ausgesprochen kooperativ sein, da immens viele Absprachen<br />
stattfinden, grundlegende Arbeitspapiere verfasst und Vereinbarungen<br />
getroffen werden müssen sowie Konsens über gemeinsame Beurteilungsgrundlagen<br />
hergestellt werden muss.
Sie sollte viel diplomatisches Verhandlungsgeschick mitbringen, da<br />
großes Einfühlungsvermögen und Empathie bei Beurteilungsdifferenz<br />
mit Kollegen erforderlich ist.<br />
Sie sollte belesen sein und sehr fundierte fachliche und didaktische<br />
Kenntnisse aufweisen, um damit alle Welt beeindrucken zu können.<br />
Sie sollte sicher Auto fahren können, denn sie trägt auf weiten Fahrstrecken<br />
zu den Ausbildungsschulen Verantwortung für mitfahrende Fachleiterkollegen.<br />
Sie sollte über ein sehr gutes Zeitmanagement verfügen, denn sie muss<br />
häufig Treffpunkte für die gemeinsame Fahrt zu den Ausbildungsschulen<br />
mit den Fachleiterkollegen zeitgerecht koordinieren.<br />
Sie sollte darüber hinaus in hauswirtschaftlichen Belangen kompetent<br />
sein, um bei diversen Festivitäten im <strong>Studienseminar</strong> Kuchen, Salate<br />
und sonstige kulinarische Leckerbissen beisteuern zu können.<br />
Dr. Margit Theis-Scholz<br />
1.5 Erweiterung des Seminarbezirks am 01.08.1999<br />
Zum 01.08.1999 wurden dem <strong>Studienseminar</strong> 90 Anwärter/innen zugewiesen.<br />
Hohe Anwärterzahlen und ein erweiterter Bedarf an Sonderschullehrer/innen<br />
waren dafür ausschlaggebend. Der Bereich Trier<br />
wurde Ausbildungsbezirk. Es waren vorbereitende Maßnahmen nötig,<br />
um Ausbildungsarbeit durchführen zu können. Folgende Ausbildungszahlen<br />
für den Raum Trier waren vorgesehen:<br />
SFR wFR<br />
Blindenpädagogik -- --<br />
Gehörlosenpädagogik 1 --<br />
Geistigbehindertenpädagogik 4 3<br />
Körperbehindertenpädagogik -- 2<br />
Lernbehindertenpädagogik 7 4<br />
Schwerhörigenpädagogik --<br />
Sehbehindertenpädagogik -- --<br />
Sprachbehindertenpädagogik 7 9<br />
Verhaltensbehindertenpädagogik 1<br />
zusammen: 19 19<br />
29
Eröffnungsseminar in der Außenstelle Trier mit LRSD Schmitz-Wenzel, ADD Trier (im<br />
Hintergrund), FöFachl Heinz Valerius und FöLAA. (Foto: Trierischer Volksfreund)<br />
Die Ausbildung benötigte 15 Ausbildungsschulen. Um diese Ausbildungsaufgaben<br />
zu bewältigen mussten Sonderschullehrkräfte aus dem<br />
Großraum Trier gewonnen werden, die Interesse hatten in den sonderpädagogischen<br />
Fachrichtungen Lernbehindertenpädagogik, Geistigbehinderten-<br />
und Sprachbehindertenpädagogik auszubilden. In Zusammenarbeit<br />
mit der Bezirksregierung in Trier wurden entsprechende<br />
Überprüfungen durchgeführt. Wir haben durch die Referenten bei der<br />
Bezirksregierung eine hohe Unterstützung bei allen Maßnahmen für die<br />
Erweiterung des Seminarbezirks erfahren. Die Schulleitungen wurden<br />
über das Ausbildungskonzept informiert und an der Auswahl der Ausbildungsschulen<br />
beteiligt. Die kooperative Ausbildung konnte im <strong>Studienseminar</strong><br />
Grund- und Hauptschulen Trier in dem Fach Deutsch (4 LAA)<br />
aufgenommen werden. Die Ausbildungsarbeit in den sonderpädagogischen<br />
Fachrichtungen Gehörlosenpädagogik, Körperbehindertenpädagogik<br />
und Verhaltensbehindertenpädagogik musste von Fachleiter/innen<br />
aus dem Raum Neuwied wahrgenommen werden; dies führte<br />
zu erhöhten Belastungen durch Ausbildungsarbeit der „weiten Wege“.<br />
Die hohe Entfernung Trier – Neuwied erschwerte auch die kontinuierliche<br />
Zusammenarbeit in Dienstbesprechungen und Konferenzen für die<br />
Fachleiter/innen aus der Region Trier.<br />
30
1.6 Einrichtung einer Außenstelle in Trier zum 01.02.2003<br />
Am 01.02.2003 wurde die Erweiterung des Seminarbezirks auf den<br />
Raum Trier durch Errichtung einer Außenstelle festgeschrieben. Sie hat<br />
eine auf ca. 30 Anwärter/innen begrenzte Aufnahmekapazität und beginnt<br />
den Vorbereitungsdienst um ein halbes Jahr zeitversetzt zum<br />
<strong>Studienseminar</strong> Neuwied. Dies war eine schulpolitische Setzung, um<br />
einen weiteren Einstelltermin zu gewinnen. Weiterhin erfolgte die Ausbildung<br />
in bestimmten Fächern kooperativ im <strong>Studienseminar</strong> Grundund<br />
Hauptschulen Trier. Die Außenstelle Trier ist durch den versetzten<br />
Einstelltermin vom Aufwand her der Leitung eines zweiten <strong>Studienseminar</strong>s<br />
gleichzustellen.<br />
1.7 Ausbildung von Quereinsteigern ab 01.02.2004<br />
Seit 01.02.2004 in Neuwied und 01.08.2004 in Trier können Quereinsteiger<br />
in den Vorbereitungsdienst aufgenommen werden. Ihre Aufnahme<br />
ist abhängig von der Lehrerbedarfslage, der Seminarkapazität, der<br />
Studienqualifikation und einem Auswahlgespräch. Quereinsteiger im<br />
<strong>Studienseminar</strong> Sonderschulen haben eine sonderpädagogische Fachrichtung<br />
studiert und in dieser Fachrichtung ein Diplom erworben. Am<br />
Auswahlgespräch, das von der ADD geleitet wird, nimmt der Seminarleiter<br />
als Berater teil. Als zweite sonderpädagogische Fachrichtung werden<br />
Lernbehindertenpädagogik oder Verhaltensbehindertenpädagogik<br />
festgelegt.<br />
Die Ausbildung im Vorbereitungsdienst setzt bezüglich der didaktischen<br />
Breite (Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, musisches Zusatzangebot)<br />
und der schulpraktischen Verknüpfung deutliche Akzente.<br />
1.8 Zusammenarbeit mit der ADD<br />
In jedem Ausbildungsdurchgang gab und gibt es vielfältige Begegnungspunkte<br />
mit den Referenten des Sonderschulreferats bei der ADD<br />
in Koblenz und auch in Trier. Sie beginnen bei der Zuweisung der LAA<br />
zu den Ausbildungsschulen und enden bei den 2. Staatsprüfungen, bei<br />
denen die Referenten in der Regel den Vorsitz führen. Durch Teilnahme<br />
an Dienstbesprechungen und Fortbildungstagungen haben sie ihr Interesse<br />
an der Seminararbeit gezeigt. Sie wirkten mit bei der Überprüfung<br />
lehrbeauftragter und hauptamtlicher Fachleiterinnen und Fachleiter und<br />
sie setzten bei der Besprechung und Beurteilung von Leistungen im<br />
Rahmen der 2. Staatsprüfungen deutliche Akzente. Wir haben stets<br />
eine engagierte und konstruktive Zusammenarbeit erlebt.<br />
31
Erinnerungen aus Sicht der Schulaufsicht<br />
Mit der Eröffnung des <strong>Studienseminar</strong>s für das Lehramt an Sonderschulen<br />
verband sich seitens der Schulaufsicht die Hoffnung, den permanenten<br />
Mangel an Bewerberinnen/Bewerbern bei der Neueinstellung in<br />
unserem Bezirk zu überwinden. Die Einbeziehung möglichst vieler<br />
Schulen in die Ausbildung sollte gleichzeitig einen Austausch pädagogisch-innovativer<br />
Impulse in Gang setzen.<br />
Die Zusammenarbeit zwischen <strong>Studienseminar</strong> und Schulaufsicht erfolgte<br />
anlässlich vielfältiger Situationen und Anlässe. Als bedeutsam in<br />
Erinnerung geblieben sind die damit im Zusammenhang geführten<br />
konstruktiven Gespräche sowie die kollegiale Beratung.<br />
Gemeinsam zu treffende Entscheidungen hatten in den meisten Fällen<br />
einen organisatorischen Anlass. Für diese Entscheidungen waren<br />
selbstverständlich in erster Linie Ausbildungsgesichtspunkte zu berücksichtigen.<br />
Wann und wo immer es aber möglich war, wurden auch pädagogische<br />
Überlegungen i.w.S. („Schule ist für Kinder da“) mit einbezogen.<br />
Die stete Erfahrung umfassender Verantwortung war Grundlage<br />
einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.<br />
Als Beispiele für Bereiche, in denen sich dies konkretisiert hat, sind zu<br />
nennen:<br />
� Auswahl der Ausbildungsschulen (Berücksichtigung der Einsatzwünsche,<br />
Bedingungen möglicher Ausbildungsschulen etc.)<br />
� Überprüfung von Bewerberinnen/Bewerbern als hauptamtliche<br />
und lehrbeauftragte Fachleiter;<br />
� Durchführung der 2. Prüfungen, häufig als Doppelprüfungen organisiert;<br />
In Erinnerung ist dabei der Zwiespalt, der durch unterschiedliche Erwartungshaltungen<br />
gegeben war:<br />
� Behördeninterne Vorgabe: Vorsitz nur bei wenigen Prüfungen,<br />
� Erwartung des <strong>Studienseminar</strong>s: Wegen der Vergleichbarkeit,<br />
Vorsitz bei möglichst vielen Prüfungen<br />
� eigene Zielstellung: Anlässlich von Prüfungen zugleich einen<br />
möglichst umfassenden Einblick in die Arbeit der Schule zu gewinnen<br />
z.B. auch im Hinblick auf Personalentwicklung.<br />
Zu erinnern ist auch an das nachhaltige Anbahnen neuer Wege, z.B. die<br />
partielle Vernetzung mit der Ausbildung im <strong>Studienseminar</strong> für das<br />
Lehramt an Grund- und Hauptschulen mit entsprechender Auswirkung<br />
auf die spätere unterrichtliche Tätigkeit.<br />
32
Die Zusammenarbeit mit dem <strong>Studienseminar</strong> habe ich als durchgängig<br />
sach- und zielorientiert, konstruktiv, anspruchsvoll bezüglich der gesetzten<br />
Maßstäbe, getragen von einem überdurchschnittlichen Einsatz<br />
sowie einer beispielhaften Ausrichtung an diesen Grundsätzen durch<br />
die jeweils handelnden Personen erlebt. Insbesondere führte ihr beispielgebendes<br />
Agieren auch zu einer wahrnehmbaren, nachhaltig positiven<br />
Diensteinstellung bei den Lehramtsanwärterinnen und -anwärtern.<br />
Für die auch in Konfliktsituationen loyale und menschlich angenehme<br />
Umgangsweise möchte ich an dieser Stelle allen ehemaligen und derzeitigen<br />
Kolleginnen und Kollegen des <strong>Studienseminar</strong>s insbesondere<br />
der ehemaligen und derzeitigen Leitung herzlich danken.<br />
Bezüglich der eingangs erwähnten Erwartungen bleibt festzuhalten,<br />
dass durch die Arbeit des <strong>Studienseminar</strong>s viele positive Veränderungen<br />
in den Schulen angestoßen bzw. verstärkt wurden.<br />
Die erwartete Verbesserung der Bewerbersituation im Hinblick auf<br />
Neueinstellungen erfüllte sich nicht im erhofften Umfang für den Bezirk<br />
Koblenz. Kennzeichnend hierfür war die Aussage einer Lehramtsanwärterin<br />
nach hervorragend bestandener Prüfung. Sie war zur Ausbildung<br />
einer Schule im Bezirk Koblenz zugewiesen worden. Bei der Zusage für<br />
die Einstellung in den Vorbereitungsdienst, so ihre Aussage nach bestandener<br />
Prüfung, kannte sie den Ausbildungsort überhaupt nicht. Sie<br />
lobte Ausbildung in Seminar und Schule, bat aber um Verständnis, dass<br />
sie sich aus persönlichen Gründen nicht um eine Einstellung in den<br />
Schuldienst im Bezirk Koblenz bewerben werde, Stellen waren vorhanden.<br />
Diese Aussage steht stellvertretend für viele.<br />
Solche aus Sicht der Schulaufsicht im Bezirk Koblenz kurzfristig enttäuschende<br />
Aussagen konnten und können der beispielhaften Arbeit im<br />
<strong>Studienseminar</strong> keinen Abbruch tun.<br />
Mit der bereits erwähnten Dankbarkeit wünsche ich allen Beteiligten die<br />
Fortsetzung der erfolgreichen Arbeit zum Wohle der Lehramtsanwärterinnen<br />
und –anwärter und damit letztlich zum Wohle der uns anvertrauten<br />
Kinder.<br />
Erwin Betzing,<br />
bis 2005 Referatsleiter Förderschulen<br />
bei der ADD, Außenstelle Schulaufsicht Koblenz<br />
33
2 Konzept- und Organisationsentwicklung<br />
Die Konzept- und Organisationsentwicklung seit dem 1.08.1996 wurde<br />
in der Weise vollzogen, dass in Verbindung mit der Entwicklung der<br />
Ausbildungsstrukturen und der Ausbildungskonzepte jeweils schwerpunktmäßig<br />
und handlungsfeldbezogen die nachfolgenden Themenbereiche<br />
ausgewählt und in Abstimmungs- und Konkretisierungsprozessen<br />
unter Berücksichtigung der rechtlichen und administrativen Vorgaben<br />
systematisch miteinander (Fachleiterinnen und Fachleiter, Mentorinnen<br />
und Mentoren, FöLAA) bestimmt wurden.<br />
� Konzeptbildung für die Ausbildung in den Fachrichtungen<br />
� Kooperation mit dem GHS-Seminar (kooperative Ausbildung)<br />
� Entwicklung von Leitaspekten der Beurteilung von Unterricht<br />
� Entwicklung von Leitaspekten der Beurteilung von mündlichen<br />
Prüfungsleistungen<br />
� Konzeptbildung für die Fortbildung der an der Ausbildung Beteiligten<br />
(Abstimmungsprozesse an konkreten Beispielen)<br />
� Konzeptbildung für Ausbildungsprojekte (Verantwortung für Natur<br />
und Umwelt, Außerschulische Lernorte)<br />
� Minimalkonsens „Beratung und Beurteilung“<br />
� Modularisierung der Ausbildungsinhalte<br />
� Leitbild mit Schwerpunktsetzungen<br />
� Evaluation der Veranstaltungen des <strong>Studienseminar</strong>s<br />
Implizit vollzog sich dabei eine Entwicklung von gemeinsam getragenen<br />
Leitvorstellungen immer mit, die dann im <strong>Jahre</strong> 2004 zu einer expliziten<br />
Leitbilddiskussion führte.<br />
2.1 Konzeptbildung für die Ausbildung in den einzelnen<br />
Fachrichtungen<br />
Mit der Einrichtung des <strong>Studienseminar</strong>s für das Lehramt an Sonderschulen<br />
und dem unmittelbaren Beginn der Ausbildungsveranstaltungen<br />
bestand die erste Aufgabe darin, ein Ausbildungskonzept für die Fachseminare<br />
zu entwickeln.<br />
34
Vorgabe und Orientierung waren dabei der Auftrag der Schulen aufgrund<br />
des Schulgesetzes für die öffentlichen Schulen in <strong>Rheinland</strong>-<br />
Pfalz (§ 1, Absatz 1), der sich bestimmt<br />
„aus dem Recht des einzelnen auf<br />
Förderung seiner Anlagen und<br />
Erweiterung seiner Fähigkeiten<br />
sowie<br />
35<br />
aus dem Anspruch von Staat und<br />
Gesellschaft an einen Bürger, der<br />
zur Wahrnehmung seiner Rechte<br />
und Pflichten hinreichend vorbereitet<br />
ist.“<br />
sowie der § 8, Absatz 3 und 4 der LVO über die Ausbildung und Zweite<br />
Staatsprüfung für das Lehramt an Sonderschulen mit den Vorgaben für<br />
die Ausbildung in den Fachseminaren:<br />
„(3) In den Fachseminaren für die sonderpädagogische Schwerpunktfachrichtung,<br />
die weitere Fachrichtung und die Fachdidaktik werden<br />
fachrichtungsspezifische Fragen mit didaktischen, methodischen und<br />
unterrichtsorganisatorischen Gesichtspunkten auf der Grundlage des<br />
Studiums und der praktischen Erfahrungen der Lehramtsanwärter verbunden<br />
und im Hinblick auf die Planung, Durchführung und Reflexion<br />
von Unterricht und Fördermaßnahmen an Sonderschulen und anderen<br />
Schulen erörtert. Hierbei soll mit den <strong>Studienseminar</strong>en der anderen<br />
Lehrämter kooperiert werden.<br />
(4) Die fachdidaktische Ausbildung (Fach, weiteres Fach, fachdidaktische<br />
Bereiche) erfolgt in der Regel in einem Fachseminar in Verbindung<br />
mit der Schwerpunktfachrichtung.“<br />
Dem o.a. Auftrag entsprechend kann sich das sonderpädagogische<br />
Handeln im Lehramt für Sonderschulen richten<br />
� auf das Handeln mit Individuen unter Förderschwerpunkten im<br />
Hinblick auf eine individuell-spezifisch wünschenswerte und im<br />
Rahmen von Schule(n) durch Unterricht und sonstige Maßnahmen<br />
realisierbare Förderung, wobei dem Unterricht sicher der größte<br />
Stellenwert zukommt,<br />
� auf Erziehung und Bildung, wie sie durch Schulgesetz, Schulordnung(en),<br />
Leitlinien, Lehrpläne in Grundzügen bei individuellen Gestaltungsspielräumen<br />
definiert werden.<br />
Daraus ergeben sich strukturell zwei unterschiedliche Handlungsformen,<br />
die dann auch bestimmend für die Konzeptbildung in den Fachrichtungen<br />
im Sinne von Schwerpunktfachrichtungen und weiteren<br />
Fachrichtungen waren:
2.1.1 Zum Konzept der Schwerpunktfachrichtungen (SFR)<br />
Ausbildungsvolumen: 120 Stunden<br />
In Schulen (Förderschulformen) ist die praktische Durchführung der o.a.<br />
Aufgaben organisatorisch einerseits grundsätzlich durch Schulordnung,<br />
Dienst- und Konferenzordnung sowie Lehrpläne geregelt, andererseits<br />
durch die Personen und situativen Gegebenheiten vor Ort (individuelle<br />
Schulprofile) spezifisch ausgeformt.<br />
Die Ausbildung im Vorbereitungsdienst muss daher unter dem Anspruch<br />
der Qualifizierung für die Bewältigung von Alltagssituationen alle Ausbildungsmaßnahmen<br />
unmittelbar auf den Alltag beziehen, also Themenbereiche<br />
unter dem Aspekt der Alltagsrelevanz auswählen und die<br />
Auseinandersetzung exemplarisch für schulische Organisations- und<br />
Handlungsformen gestalten. Es ergeben sich nachfolgende Themenund<br />
Zielbereiche<br />
Sonderpädagogische Grundfragen der Fachrichtung<br />
� Schüler als Personen verstehen und stärken (Persönlichkeitskompetenz<br />
aufbauen)<br />
� Schüler zu einem empathischen sozialen Miteinander führen (Sozialkompetenz)<br />
� Möglichkeiten der beruflichen und gesellschaftlichen Eingliederung<br />
(Rechtsgrundlagen, Institutionen)<br />
� fachrichtungsspezifische Organisationsformen des Handelns (Elternarbeit)<br />
Förderdiagnostik der Fachrichtung<br />
fallspezifische Lernprozessanalysen und Förderkonsequenzen - Erfassung,<br />
Interpretation, Dokumentation, z.B. Problemfeld „Schriftsprache“,<br />
Problemfeld „Mathematik“, Problemfeld „Sachauseinandersetzung“,<br />
Problemfeld „Wahrnehmung“, Problemfeld „Motorik“, Problemfeld „Sozialverhalten“<br />
Basale Fachdidaktik<br />
- die Förderschule „SFR“ (Schulordnung, Leitlinien, Organisationsstruktur,<br />
spezifische Profile)<br />
- fachrichtungsspezifisch besonders relevante schulische Inhalte<br />
(bzw. Fächer)<br />
36
Fachdidaktische Ergänzung<br />
- weitere relevante schulische Inhalte (Fächer) unter Berücksichtigung<br />
der Studienvoraussetzungen der FÖLAA<br />
In Abgrenzung zum Allgemeinen Seminar sind in den Fachsitzungen<br />
der Schwerpunktfachrichtungen alle hier exemplarisch genannten Themenbereiche<br />
nicht nur auf Unterrichtspraxis hin zu reflektieren, sondern<br />
auch praktisch umzusetzen.<br />
2.1.2 Zum Konzept der weiteren Fachrichtungen (wFR)<br />
Ausbildungsvolumen: 60 Stunden<br />
Grundverständnis<br />
� Sonderpädagogik als die Bereitschaft und aufgrund spezifischer<br />
Professionalisierung angeeignete Fähigkeit, die Herausforderung<br />
besonderer pädagogischer Situationen anzunehmen (fallspezifisches,<br />
situationsorientiertes Handeln in Problemsituationen)<br />
� an der Förderschule der Schwerpunktfachrichtung, an Grund- und<br />
Hauptschulen in Form integrierter Förderung oder in Schwerpunktschulen<br />
� aufgrund von förderschwerpunktbezogenen Herausforderungssituationen<br />
, die zusätzliche, professionelle Fördermaßnahmen über das<br />
reguläre Angebot im Unterricht hinaus erfordern<br />
Themenbereiche<br />
� Rechtsgrundlagen und Organisationsformen einer förderschwerpunktbezogenen<br />
Förderung<br />
� Erfassen und Verstehen von Erscheinungsformen und „interakten<br />
Bedeutungen“ (Kobi) bzgl. der “angezeigten” Probleme und Herausforderungen<br />
(Förderdiagnostik fachrichtungsbezogen)<br />
� förderschwerpunktbezogene Methoden und Vorgehensweisen<br />
(Handlungsmodelle)<br />
� fallspezifische Konzeptbildung u. Dokumentation<br />
� Förderschwerpunktbezogene Maßnahmen in Verbindung mit bzw.<br />
im Unterricht (Fallstudien)<br />
- Deutschunterricht I und II<br />
- Mathematik I und II<br />
- Sachfächer I und II<br />
� Möglichkeiten einer musischen Erziehung und Bildung im Problemzusammenhang<br />
37
� Hilfen zur Gestaltung individuell-spezifischer Lern- und Lebenssituationen<br />
(Familie, Schule, Freizeit)<br />
� Zusammenarbeit mit Personen und Einrichtungen des sozialen und<br />
erzieherischen Umfeldes<br />
Die Qualifizierung für ein fallspezifisches und situationsorientiertes<br />
Handeln wird in den weiteren Fachrichtungen durch die Einrichtung als<br />
Wanderseminare (wechselnde Tagungsorte an den Ausbildungsschulen<br />
der FöLAA) unterstützt.<br />
2.2 Kooperation mit dem Grund- und Hauptschulseminar<br />
(kooperative Ausbildung)<br />
Im Hinblick auf die sich nach dem KMK-Beschluss vom 6. Mai1994, der<br />
ausdrücklich neben Förderschulen auch Regelschulen als Förderort<br />
bestimmt, zunehmend verändernde sonderpädagogische Berufsrolle<br />
wurde das <strong>Studienseminar</strong> Sonderschulen Neuwied von Anfang an als<br />
kooperierende Dienststelle mit dem Grund- und Hauptschulseminar<br />
Neuwied mit folgenden Strukturmerkmalen eingerichtet.<br />
� Kooperative fachdidaktische Ausbildung in allen studierten Fächern,<br />
wenn Unterricht nach dem Lehrplan der Sekundarstufe 1 oder in der<br />
SFL ab Lernstufe 5/6 möglich ist.<br />
� Teilnahme an einem Fachseminar des GHS Seminars<br />
� Ca. 45 Stunden nach Absprache mit der FL´in / dem FL GHS gemäß<br />
Terminplan GHS<br />
� Fachseminare an Regel- und Sonderschulen<br />
� Gemeinsame Unterrichtsbesuche durch FL GHS und FöS<br />
� Bei Hausarbeit im Fach GHS-FL´in / FL als Zweitgutachter / in<br />
� Beteiligung der GHS-FL an der praktischen und mündlichen Prüfung<br />
Durch die Begegnung in beiden Handlungsfeldern (Regel- und Förderschulen)<br />
und die Beziehung der Ausbildungsinhalte auf beide Handlungsfelder<br />
werden die aufgrund der jeweils spezifischen Professionalisierung<br />
notwendigen Verständnis- und Abstimmungsprozesse im Hinblick<br />
auf eine Optimierung der Kooperation bei integrierten Fördermaßnahmen<br />
erheblich begünstigt.<br />
38
2.3 Entwicklung von Leitaspekten der Beurteilung von<br />
Unterricht<br />
Mit der Beurteilung von Unterricht im Rahmen von Lehrproben und<br />
später auch Prüfungen ergab sich sehr bald die Notwendigkeit, im Interesse<br />
von Vergleichbarkeit und Transparenz Kriterien als Orientierungsgrundlage<br />
zu bestimmen und das Handeln nach diesen Kriterien einzuüben.<br />
In einem länger andauernden Prozess wurde dies zunächst innerhalb<br />
des Fachleiterkollegiums, dann aber auch in gemeinsamen Fortbildungen<br />
mit Mentorinnen und Mentoren vollzogen und noch heute als einem<br />
Schwerpunkt gemeinsamer Fortbildungsmaßnahmen weitergeführt. Sie<br />
werden nachfolgend einschließlich der Rechtsbezüge und einer inhaltlichen<br />
Ausdifferenzierung tabellarisch dargestellt:<br />
Leitaspekt Rechtsbezüge Inhaltliche Ausdifferenzierung<br />
Intentionalität SchG §1 Auftrag der Schule<br />
(umfassende Zielformulierungen)<br />
„Sie (Schulen) verfolgen<br />
bestimmte Erziehungs- und<br />
Lernziele (SchG §6)<br />
Didaktische<br />
Gültigkeit<br />
SchG §1 Auftrag der Schule<br />
als Bildungsauftrag<br />
Sonderschulordnung §1<br />
Abs. 4 Vermittlung einer<br />
grundlegenden Bildung<br />
... in verschiedenen Fächern<br />
und Sachzusammenhängen<br />
(Fach- und Sachanspruch)<br />
SchG §6<br />
Lehrpläne der Fächer in den<br />
einzelnen Bildungsgängen<br />
39<br />
Welche Ziele verfolgt der FöLAA<br />
mit dem Unterricht (vor allem)?<br />
Korrespondieren die Ziel mit dem<br />
Lehrplan, dem Förderbedarf,<br />
dem Zielanspruch des Faches?<br />
Sind dem FöLAA die Ziele im<br />
Unterricht bewusst? Inszeniert er<br />
den Unterricht auf die Ziele hin?<br />
Wissen die Schüler, was sie<br />
lernen können bzw. sollen und<br />
nicht nur, was sie tun sollen?<br />
Sind die Ziele für die Schüler<br />
potentiell erreichbar? Was tut der<br />
FöLAA dafür, dass die Lehrziele<br />
zu Handlungszielen der Schüler<br />
werden?<br />
Handelt es sich um einen bedeutungsvollen<br />
bzw. sinnvollen Inhalt<br />
für die Schüler? Gelingt es im<br />
Unterricht, Bedeutung/ Sinn für<br />
den Inhalt zu erschließen?<br />
Werden mit dem ausgewählten<br />
Inhalt grundsätzliche Strukturen,<br />
Qualifikationen (exemplarische<br />
Bedeutung) vermittelt? Wurde<br />
der Unterricht sachlich–fachlich<br />
korrekt gestaltet?
Situations- und<br />
Adressatenorientierung<br />
Methodische<br />
Plausibilität<br />
Pädagogische<br />
Situation<br />
Recht des Einzelnen auf<br />
Förderung seiner Anlagen<br />
und Erweiterung seiner<br />
Fähigkeiten (SchG §1)<br />
Sonderschulordnung §1<br />
Abs. 2 Schülerinnen und<br />
Schüler unter Berücksichtigung<br />
ihrer individuellen<br />
Möglichkeiten zum selbständigen<br />
und gemeinsamen<br />
Leben, Lernen und<br />
Handeln befähigen<br />
SchG § 6 ... planmäßiger<br />
und systematischer Unterricht<br />
Sonderschulordnung §1<br />
Abs. 6 Bei der Erfüllung des<br />
Unterrichts und Erziehungsauftrags<br />
tragen die Klassenleiterin<br />
oder der Klassenleiter<br />
eine besondere pädagogische<br />
Verantwortung<br />
SchG §25 Lehrkräfte<br />
gestalten Erziehung und<br />
Unterricht der Schülerinnen<br />
und Schüler frei und in<br />
eigener pädagogischer<br />
Verantwortung<br />
40<br />
Handelte der Lehrer situationsadäquat?<br />
Kann er auf unvorhergesehene<br />
Situationen (Abweichungen<br />
von der Planung)<br />
angemessen reagieren? Spricht<br />
er die Schüler individuellspezifisch<br />
oder zumindest<br />
differenziert an? Finden im<br />
Unterricht Feststellungen der<br />
Bedingungsanalyse eine Berücksichtigung?<br />
Ist ein methodisches Konzept zu<br />
erkennen? Korrespondiert die<br />
gewählte Methode mit den<br />
Intentionen und dem Inhalt /<br />
Thema? Werden die einzelnen<br />
Unterrichtsphasen lern– und<br />
bildungswirksam inszeniert? Ist<br />
der Aufbau methodisch stringent<br />
(innerer Zusammenhang der<br />
Teilschritte)? Weitere Einzelfragen<br />
zu Medien, Arbeits– und<br />
Organisationsformen, Sozialformen,<br />
Unterrichtsprinzipien)?<br />
Ist eine pädagogisch stimmige<br />
Atmosphäre zu erkennen?<br />
Begegnet der Lehrer den Schülern<br />
mit Verständnis, Zuspruch<br />
und Anspruch? Stärkt er die<br />
Schüler in ihrer Person ? Zeigt er<br />
sich als Vorbild für ein anzustrebendes<br />
Verhalten?<br />
2.4 Entwicklung von Leitaspekten der Beurteilung von<br />
mündlichen Prüfungsleistungen<br />
Neben der Entwicklung von Leitaspekten für die Beurteilung von Unterricht<br />
entstand mit dem ersten Durchgang von Zweiten Staatsprüfungen<br />
die Notwendigkeit, im Interesse vergleichbarer Beurteilungsprozesse<br />
und einer Transparenz der Prüfungsanforderungen Kriterien für die<br />
Beurteilung mündlicher Prüfungsleistungen zu bestimmen:
Orientierungen boten an dieser Stelle die Lernzielstufen der Bildungskommission<br />
des Deutschen Bildungsrates im Strukturplan für das Bildungswesen<br />
(1970, S.78-82)<br />
� Reproduktion<br />
� Reorganisation<br />
� Transfer<br />
� Problemlösen<br />
und die Landesverordnung über die Ausbildung und Zweite Staatsprüfung<br />
für das Lehramt an Sonderschulen<br />
„Die Lehramtsanwärter sollen auf der Grundlage ihres Studiums mit<br />
Theorie und Praxis der Erziehung und des Unterrichts allgemein<br />
sowie in den studierten Fachrichtungen und ihren jeweiligen Unterrichtsfächern<br />
so vertraut gemacht werden, dass sie zu selbständiger<br />
Arbeit im Lehramt an Sonderschulen fähig sind.“ (§1, Absatz 1, Satz<br />
1 der LVO)<br />
Aus den genannten Vorgaben wurden folgende Leitaspekte abgeleitet:<br />
� Theoretische / grundsätzliche Orientierung<br />
� Persönliche Einstellung, Stellungnahme<br />
� Verbindung zum Handlungsfeld<br />
� Exemplarische Konkretisierung<br />
Mündliche Prüfungen sind dann Gespräche, die darauf abzielen, in<br />
Erfahrung zu bringen, mit welcher Qualitätsausprägung ein Kandidat /<br />
eine Kandidatin zu einem für Erziehung und Unterricht relevanten Sachverhalt<br />
(Thema) eine grundlegende Orientierung und eine persönliche<br />
Einstellung / Meinung hat, ob bzw. in welchem Maße er / sie eine Verbindung<br />
zum Handlungsfeld Schule herstellen und ob bzw. in welchem<br />
Maße er / sie das exemplarisch konkretisieren kann.<br />
2.5 Fortbildungskonzept für alle an der Ausbildung<br />
Beteiligten (Abstimmungsprozesse an Beispielen)<br />
Mit der Einrichtung des <strong>Studienseminar</strong>s am 1.08.1996 übernahmen<br />
sowohl die Fachleiterinnen und Fachleiter als auch die Mentorinnen und<br />
Mentoren erstmals Ausbildungsaufgaben im Vorbereitungsdienst ohne<br />
Erfahrungshintergrund in den jeweiligen Rollen. Von daher kam der<br />
41
Qualifizierung und Abstimmung im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen<br />
von Anfang an ein besonderer Stellenwert zu.<br />
Parallel zu Dienstbesprechungen, in denen die Wahrnehmung der<br />
Ausbildungsaufgaben und Rollen durch Vermittlung der schul- und<br />
ausbildungsrechtlichen Vorgaben gesichert wurde, boten Fortbildungsveranstaltungen<br />
die Gelegenheit, alle an der Ausbildung Beteiligten in<br />
Konzeptbildungs- und Qualifizierungsprozesse einzubinden und Ausbildungsprozesse<br />
als komplementäre Prozesse in den Ausbildungsveranstaltungen<br />
des <strong>Studienseminar</strong>s und dem Ausbildungsunterricht in den<br />
Schulen zu gestalten.<br />
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle dem IFB, das bis heute als<br />
Träger diese Fortbildungsveranstaltungen ermöglicht.<br />
Methodischer Leitgedanke der Veranstaltungen ist es, dass sich Ausbilderinnen<br />
und Ausbilder praxisbezogen in der Wahrnehmung, Reflexion<br />
und Beurteilung von konkreten Ausbildungssituationen begegnen und<br />
dabei in ihren individuell-spezifischen Sichtweisen verstehen lernen und<br />
annähern.<br />
Dazu werden repräsentative Ausschnitte des Ausbildungsgeschehens<br />
wie Unterrichtsausschnitte, Lehrdarstellungen, Arbeits- und Förderpläne,<br />
Bedingungsanalysen u. ä. exemplarisch zum Gegenstand von Analysen<br />
und Reflexionen sowie einer Ableitung von Zielen und Aufgaben<br />
für die Ausbildung im <strong>Studienseminar</strong> und in den Ausbildungsschulen.<br />
Nach diesem Prinzip werden begleitend zu einem Ausbildungskurs<br />
jeweils drei Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt:<br />
In der Eingangsphase des Vorbereitungsdienstes geht es um die Konzeptbildung<br />
für das erzieherische und unterrichtspraktische Handeln in<br />
der Schwerpunktfachrichtung und weiteren Fachrichtung sowie um die<br />
Grundlegung der Planung von Unterricht und Fördermaßnahmen<br />
(Ausbildungshandeln I).<br />
Im weiteren Verlauf der Ausbildung mit den jetzt näher rückenden Beurteilungsprozessen<br />
wird die Optimierung der praktischen Umsetzung von<br />
Unterricht und Fördermaßnahmen, orientiert an Leitaspekten, zum<br />
Gegenstand von Abstimmungen in Beurteilungsprozessen und der<br />
Festlegung und Umsetzung von Beratungsinhalten.<br />
(Ausbildungshandeln II)<br />
42
Mit der Zulassung der FöLAA zur Zweiten Staatsprüfung fällt Fachleiterinnen<br />
und Fachleitern wie auch Mentorinnen und Mentoren die Rolle<br />
einer / eines Prüfenden zu. Die damit anstehenden Aufgaben erfordern<br />
im besonderen Maße eine bewusste Orientierung und sichere Handhabung<br />
von Beurteilungskriterien und auch die Fähigkeit zu kollegialen<br />
Urteilsfindungen (Ausbildungshandeln III).<br />
Die auf den jeweiligen Ausbildungsfortschritt und die damit verbundenen<br />
dienstlichen Aufgaben der Ausbilderinnen und Ausbilder bezogenen<br />
Fortbildungsmaßnahmen müssen als permanente Erprobung, Einübung<br />
und Abstimmung immer wieder aufs Neue vollzogen werden, um Ausbildungswirksamkeit<br />
und eine verantwortungsbewusste Gestaltung der<br />
Beurteilungsprozesse zu garantieren.<br />
2.6 Konzeptbildung für Ausbildungsprojekte (Verantwortung<br />
für Natur und Umwelt, Außerschulische Lernorte)<br />
Die optimale Nutzung der im Vorbereitungsdienst verfügbaren Zeit<br />
erfordert eine Organisation der Ausbildung mit langfristig festgelegter<br />
Termin- und Themenplanung und fester Gruppenbildung. Um die Möglichkeiten<br />
und Grenzen einer offeneren, projektorientierten Planung,<br />
Umsetzung und Reflexion von Bildungsinhalten erfahrbar zu machen,<br />
wurden seit 1998 Ausbildungsprojekte durchgeführt, als verpflichtende<br />
Ausbildungsangebote in der Eingangsphase des Vorbereitungsdienstes<br />
und als Wahlpflichtangebote in der verfügbaren Zeit nach der Zweiten<br />
Staatsprüfung.<br />
Zentrales Anliegen: Ausgehend von themenbezogenen Primärerfahrungen<br />
(Selbsterfahrung) Möglichkeiten und Grenzen fachrichtungsbezogener<br />
Förderschwerpunkte reflektieren, förderschwerpunktbezogene<br />
Aufarbeitungsmöglichkeiten auf der Basis der Selbsterfahrung bestimmen<br />
und unterrichtliche Umsetzungsmöglichkeiten nach den Vorgaben<br />
der Lehrpläne von Förderschulformen entwerfen.<br />
Konzeptionell waren das Gesamtprojekt und die konkreten Auswahlangebote<br />
dabei von folgenden Grundsätzen bestimmt:<br />
� Möglichkeiten zur Begegnung und zum Kennenlernen im Rahmen<br />
eines zweitägigen Ausbildungsangebots mit gemeinsamen Arbeitsund<br />
Freizeitphasen.<br />
� Festlegung einer ausbildungs- und gegenwartsrelevanten Rahmenthematik,<br />
die im Schulgesetz und in den Ausbildungsplänen einen<br />
besonderen Stellenwert hat (Verantwortung für Natur und Umwelt)<br />
43
� Erprobung und Gestaltung einer Methodenstruktur, die in regulären<br />
Ausbildungsveranstaltungen (4 – 6 Zeitstunden) nicht zu praktizieren<br />
ist.<br />
� Projektorientiertes Arbeiten mit teilnehmerzentrierter Vorbereitung<br />
und Ausdifferenzierung.<br />
Die Projekte wurden jeweils unter Einbeziehung der Forstbehörde in der<br />
Waldjugendherberge Sargenroth zu den nachfolgenden Zeiten durchgeführt<br />
und konzeptionell im Rahmen von Gesamtkonferenzen unter Beteiligung<br />
der LAA weiterentwickelt.:<br />
„Natur erleben“ unter fachkundiger Anleitung von Förster Homann in<br />
der Waldjugendherberge Sargenroth (Foto: Ekkehard Kiersch)<br />
Sargenroth I (<strong>10</strong>. – 11.03.1998)<br />
Sargenroth II (21. – 22.09.1999)<br />
Sargenroth III (23. – 25.04.2001)<br />
Nach einer Erprobung eines Projekts kooperierender Fachrichtungsseminare<br />
zum Thema „Außerschulische Lernorte“ im Naturfreundehaus<br />
Mendig (15. – 17.<strong>10</strong>.2001) auf Initiative und unter Leitung der damaligen<br />
Leiterin eines Allgemeinen Seminars, Frau Dr. Theis-Scholz, führten die<br />
dort gewonnenen Erfahrungen nach einer Auswertung in der Gesamtkonferenz<br />
am 19.12.2001 dazu, die Rahmenthematik zu akzentuieren<br />
und den Tagungsort zum Seminarstandort und die Umgebung zu verlagern.<br />
44
Das zentrale Anliegen war jetzt: Nach themenbezogenen Selbsterfahrungen<br />
und einer Konzeptbildungsphase im Hinblick auf Unterrichten<br />
mit Schülern an einem außerschulischen Lernort bildungswirksam handeln<br />
und dabei lernen, wie man so etwas macht (Vorbereitung, Durchführung,<br />
Auswertung und im Sinne von Ausbildung Strukturen, Strategien,<br />
Konzepte erwerben).<br />
Mit thematischen Angeboten wie<br />
� „Kulturraum Kirche, Synagoge, Moschee<br />
� Außerschulischer Lernort Supermarkt<br />
� Lernen im Museum<br />
Lernen wie damals im Landschaftsmuseum Westerwald in Hachenburg<br />
(Foto: Klaus Schemann)<br />
� Methoden des SU am Beispiel Wald<br />
� Außerschulischer Lernort Bauernhof“<br />
wurden folgende Seminarprojekte durchgeführt:<br />
Außerschulische Lernorte I (24. – 25.09.2002)<br />
Außerschulische Lernorte II (20. – 21.04.2004)<br />
Außerschulische Lernorte III (17. – 19.04.2005)<br />
45
2.7 Minimalkonsens „Beratung und Beurteilung“<br />
Empfehlungen zur Nutzung des Arbeitspapiers<br />
"Minimalkonsens Beratung"<br />
1. Das Arbeitspapier "Minimalkonsens Beratung" wurde durch die<br />
Gesamtkonferenz vom 19.12.01 in der vorliegenden Fassung als<br />
Vereinbarung im Sinne eines Minimalkonsenses für Beratungssituationen<br />
im Vorbereitungsdienst angenommen.<br />
2. Beratungssituationen im Sinne des Arbeitspapiers ergeben sich in<br />
Verbindung mit Unterrichtsbesuchen (Beratungsbesuche, unbenotete<br />
und benotete Lehrproben), Seminarlehrproben, Ausbildungsgesprächen,<br />
der Eröffnung der Seminarbeurteilung und Reflexionen<br />
der Seminararbeit in den Seminargruppen.<br />
3. Das Arbeitspapier versucht Aspekte des Grundverständnisses,<br />
Dimensionen, Gestaltungsmöglichkeiten und Grenzen von Beratung<br />
transparent zu machen, um den Beteiligten die Möglichkeit zu eröffnen,<br />
Beratungssituationen, verantwortungsbewusst, sachkompetent,<br />
wirkungsvoll und menschlich annehmbar vorzubereiten, zu<br />
gestalten und auszuwerten.<br />
4. Wenn auch bewährte Gestaltungselemente Berücksichtigung finden<br />
können, so fordert dennoch jede Beratungssituation aufgrund ihrer<br />
Originalität die Wahrnehmung und Beachtung der aktuellen situativen,<br />
personalen und sozialen Gegebenheiten und lässt sich daher<br />
nicht schematisch festlegen.<br />
5. Beratungssituationen können den jeweils Beteiligten Entwicklungsperspektiven<br />
und die ihnen zufallenden Aufgaben im Hinblick auf<br />
den Einzelfall als auch grundsätzliche Hinweise für eine Weiterentwicklung<br />
der Ausbildung in den Seminaren und der Ausbildungsschule<br />
im Sinne einer Qualitätssicherung erschließen.<br />
6. Im Interesse einer Wahrnehmung von Entwicklungen, einer Fundierung<br />
von Bewertungen, eines Erfahrungsaustauschs und einer Weiterentwicklung<br />
von Ausbildungskonzepten empfiehlt es sich, Erkenntnisse<br />
aus Beratungssituationen zu fixieren (und/oder zu dokumentieren).<br />
Dabei sollte zunächst einmal jeder / jede die ihm /ihr<br />
eigene Form praktizieren. Im Hinblick auf gemeinsame Auswertungen<br />
und Erkenntnisinteressen müssten gegebenenfalls darauf bezogene<br />
Darstellungsschemata situativ vereinbart werden.<br />
46
Minimalkonsens `Beratung´<br />
1. Grundlegendes Verständnis<br />
- Dialogisches Fachgespräch<br />
mit dem Ziel<br />
Selbstreflexion anzuleiten<br />
- Gemeinsame Überlegungen<br />
zur Optimierung<br />
von Handeln im<br />
Unterricht (Fach-,<br />
Sach-, Personalkompetenz)<br />
- Beratung u. U. auch als<br />
Pflichtangebot<br />
2. Grenzen<br />
2.1 Äußerlich<br />
- Zeitliches Limit (45 –<br />
60 Minuten)<br />
- Räumliche Gegebenheiten<br />
2.2 Inhaltlich<br />
- Subjektivität<br />
- Gegenseitige Voreingenommenheit<br />
- Unterschiedliche ggf.<br />
widersprüchliche Gewichtung<br />
von Beratungsschwerpunkten<br />
- Situative Einflüsse<br />
(Tagesform)<br />
- Fehlende Einsicht aller<br />
Beteiligten auch bei<br />
konstruktiver Kritik<br />
- Mangelnde Kompetenz<br />
- Überlagerung der<br />
Beratung durch Beurteilung<br />
3. Dimensionen<br />
3.1 Inhalt<br />
- Zielorientierung an<br />
Leitaspekten (Standards)<br />
- Realitäts- und Alltagsbewusstsein<br />
- Offenheit (des FL) für<br />
alle Unterrichtsformen<br />
3.2 Beziehung<br />
- Bestätigung individueller<br />
Stärken des SLAA<br />
(Hervorhebung des<br />
Positiven)<br />
- Beachten, dass diese<br />
Form der Beratung<br />
stets<br />
- innerhalb eines Machtgefälles<br />
stattfindet,<br />
- ein Eingriff in die<br />
Persönlichkeit ist,<br />
- subjektiv verläuft.<br />
3.3 Bewertung<br />
- Transparenz, d.h.:<br />
Struktur für Selbst- und<br />
Fremdeinschätzung<br />
klären<br />
- Fachbezogene, sachverständigeArgumentation<br />
-<br />
3.4 Rückkopplung<br />
- Aufzeigen von Entwicklung<br />
- Konkretisierung von<br />
Seminarinhalten<br />
- Kontinuität<br />
47<br />
4. Empfehlungen zur<br />
Durchführung<br />
4.1 Vermittlung<br />
- Klärung des Settings<br />
(Gesprächsleitung, Dauer<br />
etc.)<br />
- Verständlichkeit und<br />
Nachvollziehbarkeit<br />
- Versuch einer gemeinsamen<br />
Unterrichtsanalyse<br />
- Problemstellungen verdeutlichen<br />
und Alternativen<br />
aufzeigen<br />
4.2 Verlaufsstruktur<br />
- positive Rückmelderunde<br />
– thematische Auseinandersetzung<br />
– Ergebnis /<br />
Erkenntnis<br />
- Abstimmung der Beratungsschwerpunkte<br />
4.3 Gesprächsführung<br />
- Wahrnehmung verschiedener<br />
Sichtweisen<br />
- Begrifflich klar und verständlich<br />
- Initiierend, bestätigend,<br />
konstruktiv-kritisch<br />
- Entwicklung gemeinsamer<br />
Ideen
2.8 Modularisierung der Ausbildungsinhalte<br />
Begriff und Darstellungsstruktur:<br />
Eine Modularisierung der Ausbildungsinhalte versucht unter Strukturbegriffen<br />
Ausbildungsinhalte so zu beschreiben, dass anvisierte Ziele,<br />
inhaltliche Strukturen, Theorie-Praxis-Bezüge, basale Quellen und<br />
Querverbindungen bezeichnet werden.<br />
Bezüglich der konkreten Gestaltung der einzelnen Seminarveranstaltungen<br />
bleibt dabei eine Offenheit für die methodische Gestaltung und<br />
inhaltliche Akzentuierungen sowie für eine Überprüfung und Weiterentwicklung<br />
erhalten.<br />
Die Darstellung der einzelnen Module orientiert sich an der nachfolgenden<br />
Struktur:<br />
Bereich, Thema, Koordinator / Koordinatorin<br />
Zentrales Anliegen<br />
Themenbezogene Tätigkeiten<br />
Thematische Differenzierung<br />
Methodische Möglichkeiten<br />
Literaturhinweise<br />
Querverweise zu anderen Themen<br />
Materialien<br />
Die vorausgehende Darstellungsstruktur intendiert folgende Wirkungen:<br />
� Das „zentrale Anliegen“ bindet die einzelnen Fachleiterinnen und<br />
Fachleiter bei aller inhaltlichen und methodischen Variation, auch<br />
aufgrund einer Planungsmitbeteiligung der FöLAA, die jeweilige<br />
Veranstaltung intentional vergleichbar auszurichten und ermöglicht<br />
damit eine Evaluation.<br />
� Die Aussagen zu „Themenbezogene Tätigkeiten im Alltag“ gewährleisten<br />
eine Orientierung an der Wirklichkeit des Schulalltags.<br />
� Die „Thematische Differenzierung“ skizziert die inhaltliche Struktur,<br />
reduziert damit Redundanz und ermöglicht weiterhin eine fachseminarspezifische<br />
Akzentuierung bei Themenüberschneidungen.<br />
� Die Literaturhinweise bieten Orientierungshinweise für eine theoretische<br />
Grundlegung der Thematik.<br />
� Die „Querverweise zu anderen Themen“ fördern eine Verzahnung<br />
der Einzelveranstaltungen des jeweiligen Seminars.<br />
48
Funktionen einer Modularisierung<br />
� Transparenz für alle an der Ausbildung beteiligten Personen<br />
� Abstimmung in einem Ausbildungsbereich<br />
� Integration / Abstimmung AS – SFR – wFR<br />
� Vorbereitungs-/ Arbeitshilfe für FöLAA<br />
� Orientierung für neue FL – KollegInnen / MentorInnen<br />
� Differenzierung im Arbeitsansatz bei (stark) heterogenen Studienund<br />
Lernvoraussetzungen der FöLAA<br />
� Orientierung für eine Wiederholung von Ausbildungsinhalten<br />
� Basis für die Festlegung von Prüfungsinhalten<br />
Handhabung der Module<br />
Einige typische Situationen, in denen die Module in den o. a. Funktionen<br />
genutzt werden können:<br />
FöLAA<br />
� Sich einen Überblick verschaffen über die Inhalte der einzelnen<br />
Seminare<br />
� Sich vorbereiten auf eine Seminarsitzung<br />
� Absprachen treffen im Hinblick auf einen Seminarbeitrag<br />
� Ausbildungsinhalte im Hinblick auf die Prüfung wiederholen<br />
Fachleiterinnen und Fachleiter<br />
� Die gesamte Ausbildungsarbeit einer Fachrichtung / eines Faches<br />
strukturieren<br />
� Eine Fachsitzung vorbereiten (Strukturierung und Differenzierung)<br />
� Sich mit FöLAA bzgl. der Gestaltung von Seminarbeiträgen absprechen<br />
/ abstimmen<br />
� Ausbildungsaufgaben innerhalb des Kollegiums koordinieren (AS-<br />
SFR-wFR)<br />
� Prüfungsinhalte auswählen und festlegen<br />
� Eine interne Evaluation konzipieren und durchführen<br />
� Ausbildungsaufgaben mit Mentorinnen und Mentoren abstimmen<br />
Mentorinnen und Mentoren<br />
� Sich bzgl. der Ausbildung im Seminar informieren<br />
� Die eigene Ausbildungsarbeit als komplementäre Ergänzung zur<br />
Ausbildung im Seminar bestimmen<br />
� Ausbildungsaufgaben mit Fachleiterinnen und Fachleiter abstimmen<br />
� FöLAA im Hinblick auf die Zweite Staatsprüfung beraten<br />
49
Zum Prozess der Modularisierung im <strong>Studienseminar</strong> Sonderschulen<br />
Neuwied<br />
� Frühjahr 1999 bis Sommer 2001: Absprache und Abgleichung der<br />
Themenpläne für AS und Fachrichtungen mit dem <strong>Studienseminar</strong><br />
Sonderschulen Kaiserslautern<br />
� Herbst 2001 bis Sommer 2002: Modularisierung der Ausbildungsinhalte<br />
in den Allgemeinen Seminaren<br />
� September 2002: Vorstellung der Modularisierungsprozesse und<br />
AS-Module mit Erfahrungsberichten in der Gesamtkonferenz<br />
� Dezember 2002: Studientag zur Modularisierung<br />
� Januar bis Juni 2003. Erstellung erster Module in den Fachrichtungen<br />
� Juni 2003: letzte Abstimmung bzgl. der Strukturbegriffe und ihrer<br />
Semantik in der Gesamtkonferenz<br />
� Seit Januar 2004: Fertigstellung, Revision und Veröffentlichung der<br />
Module über die Homepage des <strong>Studienseminar</strong>s sowie über eine<br />
Material-CD, die LAA und Mentorinnen und Mentoren zu Beginn eines<br />
Ausbildungskurses erhalten.<br />
Beispiel für ein Modul:<br />
Allgemeine<br />
Didaktik und<br />
Methodik<br />
Zentrales Anliegen:<br />
Thema:<br />
Didaktische Modelle und Begründungszusammenhänge<br />
Zentrale Planungsaspekte sonderpädagogischen<br />
Handelns<br />
50<br />
Koordinator:<br />
Breiten,<br />
Waldemar<br />
Dieses Modul soll die Lehramtsanwärterinnen und –anwärter befähigen, didaktische<br />
Modelle und Unterrichtskonzepte zu unterscheiden, die bildungs- und<br />
lehr-/lerntheoretische Didaktik in ihren zentralen Aussagen zu erinnern, die<br />
sich daraus ergebenden Handlungskonsequenzen für die Planung von Unterricht<br />
und sonderpädagogischen Fördermaßnahmen abzuleiten und exemplarisch<br />
an einem konkreten Beispiel anzuwenden.<br />
Themenbezogene Tätigkeiten im Alltag<br />
Analyse einer didaktischen Analyse aus einer Lehrdarstellung<br />
Erstellen einer didaktischen Analyse zu einem vorgegebenen Thema
Thematische Differenzierung:<br />
Didaktische Modelle und Begründungszusammenhänge<br />
- Didaktische Modelle und Unterrichtskonzepte im Überblick<br />
- Bildungstheoretische Didaktik - Theorie der Bildungsinhalte<br />
- Lehr-/lerntheoretische Didaktik - Theorie des Unterrichts und der ihn bestimmen<br />
den Faktoren<br />
Zentrale Planungsaspekte sonderpädagogischen Handelns<br />
- Sonderpädagogisches Handeln als Unterrichten in Förderschulformen und als<br />
Durchführen von Fördermaßnahmen angesichts situativ-spezifischer Herausforderungen<br />
in Förderschulen und anderen Schulen(strukturelle Unterschiede)<br />
- Die Bedeutung und die Durchführung einer didaktischen Analyse<br />
- Leitaspekte im Hinblick auf Planungsprozesse - worauf kommt es jeweils an?<br />
- Gesichtspunkte für eine umfassende Unterrichtsplanung<br />
(Konferenzbeschluss vom 17.02.97)<br />
Pragmatische Hinweise zur Gestaltung von Planungsprozessen<br />
- Planung in Einheiten<br />
- Begriffe als Ordnungsrahmen (Ordner / Mappe mit Register)<br />
- Zum Umgang mit der Interdependenz von Planungsapekten<br />
Literaturhinweise:<br />
Adl-Amini/Künzli (Hrsg.): Didaktische Modelle und Unterrichtsplanung.<br />
München 1980.<br />
Heimann/Otto/Schulz (Hrsg.): Unterricht. Analyse und Planung.<br />
Hannover 1972 6 .<br />
Jank/Meyer: Didaktische Modelle Frankfurt/M. 1991<br />
Klafki, Wolfgang: Didaktische Analyse als Kern der Unterrichtsvorbereitung.<br />
In: Roth / Blumenthal (Hrsg.): Didaktische Analyse. Hannover 1969 <strong>10</strong> , S.5-<br />
34.<br />
Klafki, Wolfgang: Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik.<br />
Weinheim 1985.<br />
Meyer, Hilbert: Leitfaden zur Unterrichtsvorbereitung. Kronberg 1980.<br />
Meyer, Hilbert: UnterrichtsMethoden. I: Theorieband. Frankfurt/M. 1990 3 .<br />
Meyer, Hilbert: UnterrichtsMethoden. II: Praxisband. Frankfurt/M. 1989 2 .<br />
Schulz, Wolfgang: Unterrichtsplanung. München 1980.<br />
Querverweise zu anderen Themen:<br />
Planung und Durchführung von Fördermaßnahmen auf der Grundlage amtlicher<br />
Vorgaben<br />
Unterrichtskonzepte (Offener Unterricht, Handlungsorientierter Unterricht)<br />
51
2.9 Leitbild mit Schwerpunktsetzungen<br />
Implizit vollzog sich die Entwicklung von gemeinsam getragenen Leitvorstellungen<br />
immer mit der gesamten Konzept- und Organisationsentwicklung<br />
mit. Nach einem Konferenzbeschluss am 17.12.2003 wurde<br />
die Leitbilddiskussion dann im <strong>Jahre</strong> 2004 explizit gemäß dem nachfolgenden<br />
Zeitplan geführt .<br />
Zeitplan der Leitbildentwicklung<br />
17.12.2003 Einrichtung einer AG „Seminarentwicklung“ in der Gesamtkonferenz<br />
18.05.2004, 1. Beratung von Tischvorlagen zu Seminarentwicklungsthemen<br />
durch die AG „Seminarentwicklung“<br />
29.06.2004 2. Beratung von Tischvorlagen zu Seminarentwicklungsthemen<br />
durch die AG „Seminarentwicklung“<br />
12.07.2004 Beschluss der Gesamtkonferenz zur Erarbeitung eines<br />
Leitbildes unter besonderer Berücksichtigung von „Theorie-Praxis-Integration“<br />
und „Kooperation“.<br />
16.12.2004 Vorbereitungstagung zur Gesamtkonferenz (Leitbild-<br />
Erarbeitung) - Beschlussfassung in der Gesamtkonferenz<br />
24.01.2005 Studientag „Kooperation“ zu einer der Leitbildakzentuierungen<br />
mit der stellv. Leiterin GHS Neuwied<br />
Leitvorstellungen (oder Leitbild) des <strong>Studienseminar</strong>s für<br />
das Lehramt an Sonderschulen Neuwied<br />
Die nachfolgenden Leitvorstellungen bringen die gemeinsamen Grundannahmen,<br />
Orientierungen und Zielvorstellungen aller Ausbildungsbemühungen<br />
zum Ausdruck. Sie verdeutlichen Sichtweisen und klären<br />
Bezüge. Prinzipien, methodische Grundsätze und Strukturen der Seminararbeit<br />
beruhen auf ihnen.<br />
52
Menschenbild und Verständnis schulischen Lernens<br />
Jeder Mensch ist bildungs- und entwicklungsfähig und hat das Recht<br />
auf Förderung seiner Anlagen und Entwicklung seiner Fähigkeiten im<br />
Rahmen der gegebenen und zu entwickelnden gesellschaftlichen Ansprüche<br />
und Zusagen. Bildung und Entwicklung können nicht von außen<br />
gemacht werden, sondern vollziehen sich als eigenaktive Aneignungsprozesse<br />
des Individuums im Austausch mit einer gestalteten<br />
Lernumwelt und einem personalen Gegenüber.<br />
Sonderpädagogische Förderung<br />
Sonderpädagogische Förderung umfasst die Prävention, integrierte<br />
Fördermaßnahmen in anderen Schularten und die Förderung in Förderschulen.<br />
Die Ausbildung im Vorbereitungsdienst muss daher auch die<br />
verschiedenartigen Organisationsformen einer sonderpädagogischen<br />
Förderung außerhalb von Förderschulen berücksichtigen.<br />
Lehrerinnen- und Lehrerpersönlichkeit / Fachleiterinnen- und Fachleiterpersönlichkeit<br />
Eigenaktive Aneignungsprozesse erfordern Lehrende, die eine Lernund<br />
Entwicklungsbegleitung mit ganzheitlicher Wahrnehmung von Menschen<br />
sowie mit Einfühlungsvermögen und Empathiefähigkeit realisieren.<br />
Dazu gehört es authentisch, bewusst und intentional, didaktisch<br />
gültig, methodisch angemessen, situations- und adressatenorientiert<br />
sowie pädagogisch verantwortlich, alltagswirksam und nachhaltig zu<br />
handeln. Das gilt für Unterricht und Fördermaßnahmen wie für Ausbildungsveranstaltungen<br />
in gleicher Weise.<br />
Theorie-Praxis-Bezüge<br />
Die Qualifizierung für ein professionelles und zugleich alltagswirksames<br />
Handeln erfordert es, dass Theorie als Erklärungs- und Möglichkeitshorizont<br />
und Praxis als Wirklichkeitshorizont in Ausbildungssituationen so<br />
miteinander verschränkt werden, dass theoretische Auseinandersetzungen<br />
praxisbezogen und praktisches Handeln und Erproben theoriegeleitet<br />
sind.<br />
Seminardidaktisches Konzept<br />
Die angesprochenen Kompetenzen sind in Modellbildungsprozessen<br />
anzueignen. Fragestellungen und Aufgaben sind dabei aus Lebenssituationen<br />
und Lebenskontexten herauszulösen, exemplarisch zu verdichten<br />
und in selbstgesteuerten Auseinandersetzungen in sozialen Kontexten<br />
zu bearbeiten. Das erfordert einerseits, dass in Ausbildungsprozessen<br />
immer Handlungsfeldbezüge herausgestellt werden - nach Möglich-<br />
53
keit über direkte Begegnungen mit dem Handlungsfeld selbst - und<br />
andererseits, dass Rahmenvorgaben über individuell-spezifische Ausgestaltungen<br />
und Planungsbeteiligungsprozesse personalisiert zu (Erkenntnis-<br />
und Handlungs-) „Interessen“ werden.<br />
Inhaltlich bietet die Modularisierung der Ausbildungsinhalte eine Orientierung<br />
für Konkretisierungen und fachseminarübergreifende Abstimmungen.<br />
Qualifizierung und Beratung<br />
Mit dem erfolgreichen Abschluss des Vorbereitungsdienstes wird den<br />
Sonderschullehramtsanwärterinnen und –anwärtern bestätigt, dass sie<br />
zu „selbständiger Arbeit im Lehramt an Sonderschulen fähig“ sind.<br />
Diese Qualifikationsvermittlung macht die Verknüpfung von Beurteilungsprozessen<br />
mit entwicklungsorientierter, ausbildungswirksamer<br />
Beratung notwendig. Die Wertschätzung und Integrität der Personen<br />
wie auch die Zielvorstellung authentisch und verantwortlich handelnder<br />
Lehrerinnen und Lehrer erfordern in diesen Prozessen persönliche<br />
Gerechtigkeit, soziale Vergleichbarkeit und sachlich-kriterielle Transparenz.<br />
Nachhaltigkeit, Innovationsbereitschaft und Offenheit für Entwicklungen<br />
(neue Herausforderungen)<br />
Entwicklungen des Handlungsfelds und der Forschung müssen für die<br />
praktische Arbeit so fruchtbar gemacht werden, dass trotz der zwangsläufigen<br />
Spannung zwischen Anspruch und Wirklichkeit aktive, Berufszufriedenheit<br />
erhaltende Antworten möglich werden. Neben der Bereitschaft<br />
zu berufsbegleitender Fortbildung gehört zur Qualifikation daher<br />
auch die Fähigkeit, den Herausforderungen des beruflichen Alltags und<br />
dem Einsatz der eigenen Kräfte gleichzeitig verantwortlich Rechnung zu<br />
tragen.<br />
Kooperation<br />
Die Komplexität des Handlungsfeldes, die spezifischen Professionalisierungen<br />
und Perspektivenvielfalt der miteinander agierenden Personen<br />
wie auch die sukzessive Struktur des Qualifizierungsprozesses erfordern<br />
„Kooperation“ auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlicher<br />
Akzentuierung,<br />
� vor allem als Austausch und Abstimmung der direkt an der Ausbildung<br />
Beteiligten,<br />
� als Verschränkung und Integration von Ausbildung in aufeinander<br />
folgenden Phasen (Studium, Vorbereitungsdienst, Fortbildung) und<br />
54
� als Thema der Vorbereitung, Gestaltung und Reflexion eines gemeinsamen<br />
Handelns der in Unterricht und Erziehung Handelnden<br />
Gemeinsame Ausbildung der <strong>Studienseminar</strong>e Grund- und Hauptschulen<br />
und Sonderschulen Neuwied<br />
Die verschiedenartigen Organisationsformen einer sonderpädagogischen<br />
Förderung in Regelschulen erfordern in hohem Maße eine erfolgreiche<br />
Kommunikation und Kooperation von Lehrkräften aus Grund- und<br />
Hauptschulen und Sonderschulen. Diese können in besonderer Weise<br />
durch Begegnungen in den gemeinsamen Handlungsfeldern begünstigt<br />
werden. Die <strong>Studienseminar</strong>e Grund- und Hauptschulen sowie Sonderschulen<br />
Neuwied haben zu diesem Zwecke Seminare mit Lehramtsanwärtern<br />
an beiden <strong>Studienseminar</strong>en und Ausbildungsveranstaltungen<br />
in beiden Schularten eingerichtet.<br />
2.<strong>10</strong> Evaluation der Veranstaltungen des <strong>Studienseminar</strong>s<br />
Gegenstand einer Evaluation sind im <strong>Studienseminar</strong> Sonderschulen<br />
Neuwied:<br />
� Ausbildungsveranstaltungen<br />
� Fortbildungsveranstaltungen für die Ausbildenden<br />
� Beurteilungs- und Prüfungsvorgänge<br />
Die Evaluation der Ausbildungsveranstaltungen orientiert sich an Zielsetzungen,<br />
die im Rahmen der Modularisierung der Ausbildungsinhalte<br />
formuliert wurden. Sie bezieht sich auf die Einschätzung der erworbenen<br />
Kompetenzen und die Art und Weise der Vermittlungsprozesse. Sie<br />
wird von den Fachleiterinnen und Fachleitern und Lehramtsanwärterinnen<br />
und –anwärtern eigenverantwortlich als Auswertung von Einzelveranstaltungen,<br />
von thematischen Blöcken und als Abschlussevaluation<br />
des jeweiligen Seminars durchgeführt. Das Ergebnis wird gemäß Konferenzbeschluss<br />
an eine Evaluationsbeauftragte berichtet, die es kursbezogen<br />
auswertet und zusammenfasst.<br />
Die Fortbildungsveranstaltungen werden im Anschluss an die jeweilige<br />
Tagung per Rückmeldefragebogen und in der letzten Veranstaltung<br />
eines Kurses zusätzlich in einer Plenumsauswertung mit Ableitung von<br />
Konsequenzen und einer Fortschreibung des Fortbildungskonzepts für<br />
den Folgekurs vollzogen.<br />
Die Beurteilungsprozesse und Prüfungsvorgänge werden einmal mit<br />
dem ÖPR der Lehramtsanwärterinnen und -anwärter im Anschluss an<br />
55
einen Kurs und darüber hinaus im Rahmen der Projektangebote nach<br />
der Zweiten Staatsprüfung im Rahmen eines Auswertungsgesprächs im<br />
Hinblick auf Transparenz der Anforderungen, Vergleichbarkeit der Bewertungsprozesse<br />
und zwischenmenschlich stimmige Gestaltung der<br />
Situationen der Beurteilungs- und Prüfungssituationen reflektiert. Im<br />
Hinblick auf das Prüfungsgeschehen findet zusätzlich immer ein Rückblick<br />
auf das Prüfungsgeschehen mit den Prüfungsvorsitzenden statt,<br />
der damit auch Merkmale einer externen Evaluation aufweist.<br />
2.11 Ausblick<br />
Die Ausführungen zur Konzept- und Organisationsentwicklung in den<br />
vergangenen zehn <strong>Jahre</strong>n zeigen die Bemühungen des gesamten<br />
Kollegiums auf, eine tragfähige Ausbildungskonzeption und Organisationsstruktur<br />
für die Ausbildung von Förderschullehrerinnen und –lehrern<br />
im Vorbereitungsdienst zu schaffen. Ein solches Ausbildungskonzept<br />
kann jedoch angesichts der sich schnell verändernden gesellschaftlichen<br />
Verhältnisse und der darauf bezogenen Bildungsanforderungen<br />
nie abgeschlossenen sein, sondern muss weiterentwickelt und optimiert<br />
werden, ohne die Grundsätze auf zu geben.<br />
Die sich mit dem Ausbau der Schwerpunktschulen im Primar- und Sekundarbereich<br />
verändernde förderpädagogische Berufsrolle, die vielfältigen<br />
Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung in Schulen und vor allem die<br />
Lehrerbildungsreform, die eine Beteiligung der <strong>Studienseminar</strong>e an den<br />
fachdidaktischen Studien und in der Betreuung der Praktika in der ersten<br />
Ausbildungsphase vorsieht, bringen erhebliche Herausforderungen<br />
für die <strong>Studienseminar</strong>e mit sich.<br />
Die Erarbeitung curricularer Standards für den Vorbereitungsdienst, die<br />
Qualifizierung der betreuenden Lehrkräfte für die Praktika und die Mitgestaltung<br />
der im kommenden Jahr beginnenden Orientierungspraktika<br />
sind hier als unmittelbar zu bewältigende Aufgaben zu nennen.<br />
Mit den in den vergangenen zehn <strong>Jahre</strong>n erarbeiteten Konzepten und<br />
Strukturen sowie der Beteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />
des <strong>Studienseminar</strong>s in verschiedenen Arbeitsgruppen zur Lehrerbildungsreform<br />
wurde eine Erfolg versprechende Ausgangsbasis geschaffen,<br />
die zu erwartenden Veränderungen bezüglich der Zielsetzungen<br />
und Inhalte, der Organisationsstrukturen und der erweiterten Qualifikationsanforderungen<br />
an Ausbilderinnen und Ausbilder im Vorbereitungsdienst<br />
zu vollziehen.<br />
56
3 Konzepte der Fachrichtungen<br />
3.1 Blinden- und Sehbehindertenpädagogik<br />
Die Ausbildung der Förderschullehramtsanwärterinnen und -anwärter<br />
orientiert sich an der Komplexität und Vielfältigkeit des Handlungsfeldes<br />
an einer Schule für Blinde und Sehbehinderte. Besonderer Wert wird<br />
auf die unterrichtliche Integration spezifischer Fördermaßnahmen für<br />
Sehgeschädigte gelegt, z. B. die Verwirklichung der Prinzipien der Seherziehung,<br />
der Wahrnehmungsförderung, der lebenspraktischen Förderung,<br />
der Orientierungs- und Mobilitätserziehung, der Kommunikationsförderung,<br />
der Bewegungsförderung, der ästhetischen Bildung etc.<br />
Grundsätzlich richtet sich die Förderung, Erziehung und Bildung blinder<br />
und sehbehinderter Kinder und Jugendlicher nach den Lehrplänen der<br />
Regelschulen, jedoch blinden- bzw. sehbehindertengemäß modifiziert<br />
und unter Anwendung spezieller Schriftsysteme, z. B. Blindenkurzschrift,<br />
Mathematikschrift, Musiknotenschrift etc.<br />
Das Fachrichtungsseminar Sehgeschädigtenpädagogik muss sich<br />
aufgrund des besonderen Schulprofils und der Organisationsstruktur<br />
aber auch mit den verschiedenen Bildungsgängen innerhalb der Schule<br />
für Blinde und Sehbehinderte und anderen Förderschulen beschäftigen,<br />
da Sehschädigung häufig mit zusätzlichen Behinderungen einhergeht.<br />
Dadurch wird eine stark binnendifferenzierende Unterrichtsplanung<br />
erforderlich. Die Förderschwerpunkte Sprache, Hören, Lernen, ganzheitliche<br />
Entwicklung, motorische Entwicklung und emotionale Entwicklung<br />
werden ebenso thematisiert wie Aspekte der Frühförderung, der<br />
integrativen Beschulung und der Berufsbildung.<br />
Diagnostische Kompetenz, Medienkompetenz (z.B. Einsatz von Hilfsmitteln,<br />
Adaptationen im Bereich der Lehr-, Lern- und Arbeitsmittel sowie<br />
im Bereich der Lernumgebung, Computereinsatz bei Blinden, PC-<br />
Einstellungen und Software für Sehgeschädigte ), basale Fachdidaktik,<br />
Kooperation mit Elternhaus, Internat, außerschulischen Einrichtungen<br />
und Kollegen (Arbeiten im Team) sind Seminarinhalte, die in ihrer fachrichtungsspezifischen<br />
Ausgestaltung die grundlegenden Voraussetzungen<br />
individueller Förderplanung bilden und als Basis pädagogischen<br />
Handelns in allen Teilbereichen der Sehgeschädigtenpädagogik Verwendung<br />
finden.<br />
57
3.2 Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik<br />
Aufgaben und Ziele:<br />
„Die Aufgabe der mit der Erziehung und Bildung der hörgeschädigten<br />
Kinder betrauten Pädagogen ist es, durch die genaue Beobachtung der<br />
Entwicklungsschritte des Kindes die Wege zu finden und zu unterstützen,<br />
die es zur Erreichung seiner höchstmöglichen emotionalen, sozialen,<br />
sprachlichen und kognitiven Kompetenz führen.“ (Positionspapier<br />
des BDH, Die Förderung, Erziehung und Bildung hörgeschädigter Kinder<br />
und Jugendlicher. In: HörPäd 1 / 1999, S. 3)<br />
„Zur Unterstützung des Hörenlernens, zur Absicherung einer altersgemäßen<br />
Kommunikation müssen neurophysiologische Erkenntnisse und<br />
die neuen technischen Möglichkeiten für die Gesamtentwicklung berücksichtigt<br />
werden (ebda., S. 3).<br />
Beratung, Betreuung, Förderung sowie die schulische bzw. berufliche<br />
Ausbildung Hörgeschädigter war und ist eine soziale Aufgabe, die im<br />
frühesten Kindesalter beginnt und bis zum hohen Erwachsenenalter<br />
reicht.<br />
Ausbildungsschwerpunkte<br />
Die Ausbildung der Förderschullehramtsanwärter mit den Fachrichtungen<br />
Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik ist sehr komplex, da<br />
sich das Arbeitsfeld der Förderschullehrer an einer Schule für Gehörlose<br />
und Schwerhörige nicht nur auf die Unterrichtsarbeit, sondern ebenso<br />
auf die Bereiche der Pädagogischen Audiologie, der Frühförderung<br />
und der Integrierten Förderung in Regelkindergärten bzw. –schulen<br />
erstreckt.<br />
In diesem Zusammenhang muss auch die Identitäts- und Persönlichkeitsförderung<br />
Hörgeschädigter genannt werden.<br />
Die integrative Balance zwischen den beiden Welten der Gehörlosen<br />
und Hörenden verleiht diesem Bereich eine besondere Bedeutung.<br />
Das neue Fach „Hörgeschädigtenkunde“ mit seinen vielen Facetten will<br />
dem Rechnung tragen.<br />
Auch die Deutsche Gebärdensprache hat für einen Teil der Gehörlosen<br />
zunehmend an Bedeutung gewonnen und kann durchaus den Unterricht<br />
bereichern und die Lautsprachentwicklung unterstützen, sofern die<br />
Lehrperson gebärdensprachkompetent ist.<br />
58
Die Schulen für Hörgeschädigte müssen individuelle Angebote für die<br />
unterschiedlichsten hörgeschädigten Kinder machen.<br />
Das erfordert kompetente Hörgeschädigtenpädagogen, die bereit sind,<br />
sich in die verschiedensten Aufgabenbereiche einzuarbeiten.<br />
Die Ausbildung in den <strong>Studienseminar</strong>en versucht dem Rechnung zu<br />
tragen, indem zwar schwerpunktmäßig der Unterricht in den Mittelpunkt<br />
gerückt wird, die Förderschullehramtsanwärter aber auch in die anderen<br />
Aufgabenfelder eingeführt werden.<br />
3.3 Geistigbehindertenpädagogik<br />
Im Mittelpunkt der Ausbildung zum Förderschullehrer steht die Planung,<br />
Durchführung und Reflexion von Unterricht (Schwerpunktfachrichtung)<br />
bzw. von Fördermaßnahmen (weitere Fachrichtung) innerhalb des<br />
Förderschwerpunktes ganzheitliche Entwicklung. Diese finden sowohl<br />
an der Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung,<br />
als auch an Schwerpunktschulen und anderen Förderschulen statt.<br />
Charakterisiert ist dieser Prozess durch eine durchgehende Zusammenarbeit<br />
mit allen in der Klasse mitarbeitenden Kolleginnen und Kollegen<br />
(pädagogische Fachkräfte, Therapeuten...)<br />
Die Förderschullehramtsanwärter lernen dabei den Unterricht bzw.<br />
Fördermaßnahmen didaktisch und methodisch auf der Basis bildungstheoretischer<br />
Prinzipien vorzubereiten. Zielvorstellung ist hierbei, alle<br />
Kinder gemeinsam im Klassenverband zu unterrichten. Dabei liegt ein<br />
besonderes Augenmerk auf dem Ausbilden der individuellen Handlungsfähigkeit<br />
innerhalb eines handlungsorientierten Unterrichts mit dem<br />
Ziel "Selbstverwirklichung in sozialer Integration". Unter didaktischen<br />
Gesichtspunkten ist von den individuellen Förderbedürfnissen des einzelnen<br />
Schülers innerhalb einer zunehmend heterogener werdenden<br />
Schülerschaft auszugehen. Methodische Schwerpunkte hängen von<br />
den Fähigkeiten der jeweiligen Schüler und den sich durch die Sache<br />
selbst ergebenden Vermittlungswegen ab.<br />
Einen weiteren Ausbildungsschwerpunkt bildet das Erstellen von Förderplänen<br />
unter Verwendung der Schuleingangsdiagnostik, einer kontinuierlich<br />
verfolgten Förder- und Lernprozessdiagnostik und der Ableitung<br />
individueller Förder- und Lernziele auf der Grundlage systemischer<br />
Sichtweisen.<br />
Ausgangspunkt für die Erstellung von Förderplänen bei Fördermaßnahmen<br />
in der weiteren Fachrichtung ist das Erkennen individueller<br />
Fördernotwendigkeiten auf der Basis gesicherter Grundbedürfnisse in<br />
den Bereichen Kommunikation, Motorik, Lern- und Arbeitsverhalten,<br />
Sensorik, Kognition, Emotionalität und Selbstversorgung.<br />
59
Fachrichtungsspezifische Schwerpunkte, die für die Schwerpunktfachrichtung<br />
und die weitere Fachrichtung gelten, stellen dabei folgenden<br />
Bereiche dar:<br />
� der erweiterte Lernbegriff beim Lesen, Schreiben und in der Mathematik<br />
� Entwicklung von Handlungsfähigkeit im Hinblick auf das Leitziel der<br />
SFG Selbstverwirklichung in sozialer Integration<br />
� Kennen lernen und Einsetzen von Methoden der Unterstützten<br />
Kommunikation<br />
� die Werkstufe der SFG als Vorbereitung auf Arbeit, Wohnen, Partnerschaft<br />
und Freizeit<br />
� Unterricht mit Schülern mit einem erhöhten Förder- und Aufsichtsbedarf<br />
(Schüler mit Schwerst- und Mehrfachbehinderung, Umgang<br />
mit Verhaltensauffälligkeiten)<br />
� gemeinsames Unterrichten von Schülern mit und ohne Förderbedarf<br />
� Kooperation mit Eltern und außerschulischen Kooperationspartnern<br />
(Agentur für Arbeit, Jugendamt, Werkstatt für behinderte Menschen...)<br />
3.4 Körperbehindertenpädagogik<br />
Angesichts körperlicher Behinderung oder schwerer chronischer oder<br />
progredienter Erkrankungen brauchen Kinder als Akteure ihrer Entwicklung<br />
Lehrer/innen, die ein Menschenbild haben, das individuelle Lebenswege<br />
akzeptiert und unterstützt.<br />
Eine Beziehung, die Sicherheit vermittelt und eine positive Erwartung<br />
gegenüber den Kindern sind für sie auf ihrem Weg zu Autonomie,<br />
Selbstständigkeit, Selbsttätigkeit und neuen persönlichen Perspektiven<br />
unabdingbar. Aufgabe der Lehrerin ist es dabei unter Berücksichtigung<br />
der Lebensbedeutsamkeit die Schüler/innen modellhaft und partnerschaftlich<br />
zu begleiten.<br />
Das Ziel individuelle Entwicklungsmöglichkeiten wahrzunehmen und zu<br />
eröffnen verleiht den Aufgaben des Beratens, Beurteilens, förderdiagnostischen<br />
Handelns, Unterrichtens und Innovierens eigene Akzente.<br />
Das Kind und seine spezifischen Fähigkeiten, Interessen und Möglichkeiten<br />
sind dabei der Ausgangspunkt.<br />
"Die Faszination der Defizite und Behinderungen führt von den Kindern<br />
weg. Sie versachlicht die Arbeit und erweist sich doch als Sackgasse.<br />
Wir können den Kampf gegen eine (schwere) Behinderung nicht gewinnen,<br />
gleich was wir einsetzen. Aber wir riskieren, die Kinder zu verlie-<br />
60
en. Wir können nur in Bezogenheit mit den Kindern und nicht im Bann<br />
von Behinderungen und Störungen entdecken, wie sie sich entwickeln<br />
und wie wir sie dabei unterstützen können. Sie brauchen unsere Hilfe<br />
dringend. Aber es ist nicht so, dass wir sie entwickeln könnten. Sie<br />
können sich nur selbst entwickeln." (Haupt 2001)<br />
Unterricht, der den speziellen Bedürfnisse körperbehinderter Kindern<br />
gerecht wird steht im Zentrum der Ausbildungsveranstaltungen. Die<br />
fachrichtungsspezifischen Themen stammen aus den Bereichen:<br />
� Spezifische Bedingungen und Aufgaben des Unterrichtens und<br />
Erziehens von Kindern mit Körperbehinderung<br />
� Entwicklungsbedingungen und Lernvoraussetzungen<br />
� Förderdiagnostik<br />
� Unterstützte Kommunikation<br />
� Schüler/innen mit herausforderndem Verhalten<br />
� Schüler/innen mit begrenzter Lebenserwartung<br />
� Schüler/innen mit schwerster Behinderung<br />
� Hilfsmittel<br />
� Beraten<br />
� Kooperation der am Erziehungsprozess Beteiligten<br />
� Vorbereitung auf die nachschulische Situation<br />
� Basale Fachdidaktik<br />
3.5 Lernbehindertenpädagogik<br />
SCHWERPUNKTFACHRICHTUNG<br />
Angehende Förderschullehrerinnen und –lehrer sehen sich in der Schule<br />
mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit spezifischen Herausforderungen<br />
konfrontiert. Darüber hinaus befindet sich diese Schulform in einem die<br />
Fundamente betreffenden Wandlungsprozess. Das Seminar der Schwerpunktfachrichtung<br />
Lernbehindertenpädagogik muss die Lehramtsanwärterinnen<br />
und –anwärter darauf vorbereiten und befähigen, den beruflichen<br />
Anforderungen im Handlungsfeld entsprechen zu können. Diese sind:<br />
1. Unterricht an der SFL :<br />
Berücksichtigung der Vorgaben des Lehrplans, Erfüllung des gesellschaftlichen<br />
Bildungs- und Erziehungsauftrags, Unterstützung und Einbeziehung<br />
von Eltern, Arbeit als Klassenleiterin mit vielen Fächern in einer Klasse<br />
bzw. als Fachlehrer in vielen verschiedenen Klassen unter Einbeziehung<br />
außerschulischer Lernorte.<br />
61
2. Integration von beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen an der Regelschule<br />
a) Einsatz als Förderlehrer an der Grundschule:<br />
- Förderdiagnostische Lernbegleitung der beeinträchtigten oder<br />
benachteiligten Schülerinnen und Schüler<br />
- Beratung der Grundschulkolleginnen und -kollegen<br />
b) Tätigkeit an einer Schwerpunktschule:<br />
- Erstellung eines Förderplans für die beeinträchtigten Schülerinnen<br />
und Schüler<br />
- Kooperation mit den beteiligten Grundschulkolleginnen (Team-<br />
Teaching)<br />
- Verbindungsposition zwischen Schwerpunktschule, Stammschule<br />
und Eltern<br />
Auf die Plätze ….<br />
62<br />
Zeichnung: Reinhold Moravec<br />
SFL Bad Kreuznach<br />
3. Individualisierendes Lernen<br />
- Erkennen der unterschiedlichen Begabungen und Beeinträchtigungen<br />
- Erkennen und Organisieren der individuellen Lernmöglichkeiten<br />
- Organisation der individuellen Materialien und Medien
WEITERE FACHRICHTUNG<br />
Sonderpädagogik der weiteren Fachrichtung wird verstanden als die<br />
Bereitschaft und Fähigkeit, die Herausforderung besonderer pädagogischer<br />
Situationen an der Förderschule der 1. Fachrichtung, an Grundund<br />
Hauptschulen im Rahmen der integrierten Förderung und in Integrationsklassen<br />
an Grund- und Hauptschulen (Schwerpunktschulen)<br />
anzunehmen (fallspezifisches, situationsorientiertes Handeln in Problem-situationen).<br />
Daraus ergibt sich folgende seminardidaktische Struktur:<br />
� Grundlagenförderung für Lernprozesse im Fachunterricht mit einer<br />
fachrichtungsspezifischen Akzentuierung<br />
Beispiele können sein:<br />
- Wahrnehmungsförderung<br />
- Förderung des Aufgabenverständnisses<br />
- Förderung des sozial-kooperativen Verhaltens in Verbindung<br />
mit Unterricht oder<br />
� Förderung in schulischen Teilleistungsbereichen<br />
� Fachunterricht mit einer fachdidaktischen Akzentuierung<br />
Beispiele können sein:<br />
- Überwindung „didaktischer Stolpersteine“ durch gezielte Rechtschreibförderung<br />
oder Förderung des schriftsprachlichen Gestaltens<br />
im Zusammenhang mit der Textproduktion im Rahmen<br />
des Unterrichts<br />
- Beispiel Sachunterricht: Tiere auf dem Bauernhof in Verbindung<br />
mit u.a. Deutsch<br />
� Fachunterricht unter besonderer Berücksichtigung innerer Differenzierung,<br />
beispielsweise Biologieunterricht unter besonderer Berücksichtigung<br />
jeweils individueller Lernprobleme<br />
Die Entscheidung für die jeweilige konzeptionelle Akzentuierung sollte<br />
im Interesse einer offenen persönlichkeitsbildenden Seminararbeit gestaltet<br />
werden.<br />
3.6 Sprachbehindertenpädagogik<br />
Die Ausbildung in der Fachrichtung Sprachbehindertenpädagogik soll<br />
die FöLAA befähigen, Kinder und Jugendliche, die durch eine Sprachstörung<br />
in ihrer Kommunikationsfähigkeit, in ihrer Lernfähigkeit und in<br />
ihrer Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigt sind, in Regel- und Förderschulen<br />
zu fördern. Grundlage für die Förderung von Schüler / innen<br />
mit Sprachstörungen ist ein bestimmtes Verständnis von Sprache,<br />
Sprachgebrauch und Spracherwerb: Spracherwerb beginnt im Frühdia-<br />
63
log mit dem Erwerb vorsprachlicher kommunikativer Fähigkeiten. Er<br />
entwickelt sich weiter im gemeinsamen Handeln mit den Bezugspersonen.<br />
Dabei ist zu jedem Zeitpunkt der individuell erreichte Sprachentwicklungsstand<br />
als regelhaft zu verstehen. Das Kind erwirbt sich die<br />
pragmatischen, semantischen, phonetischen, phonologischen, morphologischen<br />
und syntaktischen Fähigkeiten aktiv und eigendynamisch,<br />
wobei in den Entwicklungsphasen verschiedene Lernprozesse und<br />
Lernstrategien eine Rolle spielen. Als sprachtragende Funktion gelten<br />
Sensorik, Motorik, Kognition, Emotion und Soziabilität. Die Ausbildung<br />
metasprachlicher Fähigkeiten sowie der Erwerb der Schriftsprache<br />
gehören auch zum Spracherwerb.<br />
Sprachsonderpädagogisches Handeln hat die Aufgabe, die Schüler in<br />
ihrer sozial-kommunikativen Handlungsfähigkeit zu fördern.<br />
Ziele dieses Handelns sind demnach:<br />
� Anbahnung, Aufbau und Erweiterung der den Spracherwerb und<br />
Sprachgebrauch bedingenden Fähigkeiten in den Bereichen Sensorik,<br />
Motorik, Kognition, Emotion und Soziabilität<br />
� Anbahnung, Aufbau und Erweiterung der sprachspezifischen Fähigkeiten<br />
auf der phonetisch-phonologischen, semantischlexikalischen,<br />
morphologisch-syntaktischen und pragmatischkommunikativen<br />
Sprachebene<br />
� Unterstützung bei der Selbstverwirklichung und Persönlichkeitsbildung<br />
Unterricht der die Schüler in ihrer sozial-kommunikativen Handlungsfähigkeit<br />
fördern will, muss sprach- und kommunikationsförderlich gestaltet<br />
werden:<br />
� er muss beziehungs- und dialogfähig machen und zur gemeinsamen<br />
Sprache befähigen<br />
� er muss konsequent Sprechanlässe schaffen<br />
� er muss Bewährungsfeld für sprachlich-kommunikatives Handeln<br />
sein<br />
� er muss kontinuierlich ein sprachliches Modell bieten<br />
Die Planung, Organisation, Durchführung und Reflexion von Unterricht<br />
muss den Lernbedingungen und den Förderbedürfnissen der Schüler/innen<br />
im Bereich der Sprache und den Forderungen der jeweiligen<br />
Fachdidaktik gerecht werden.<br />
Deswegen ist es auch notwendig, dass die FöLAA<br />
� didaktische und methodische Prinzipien kennen und erproben<br />
� und ihre Bedeutung für die Arbeit mit sprachbeeinträchtigten Kindern<br />
reflektieren.<br />
64
Förderpädagogisches Handeln im Förderschwerpunkt Sprache ist daher<br />
eingebunden in ein allgemeines pädagogisches Rahmenkonzept und<br />
hat zum Ziel, Kinder zu unterrichten und zu erziehen, nicht zu therapieren.<br />
Aufbauend auf die erste Ausbildungsphase sollen die FöLAA ihre bereits<br />
erworbenen fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Kenntnisse<br />
der Sprachbehindertenpädagogik in konkretes unterrichtliches<br />
Handeln umsetzen lernen.<br />
In einer umfassenden, pädagogischen Unterrichtsarbeit, die ganzheitlich,<br />
aber in sich differenziert an den Stärken und Schwächen der Kinder<br />
ansetzt, ist es notwendig die Schüler/innen in allen Funktions- bzw.<br />
Entwicklungsbereichen (Sensorik, Motorik, Kognition, Soziabilität, Emotionalität),<br />
die sprachliches Lernen direkt oder indirekt unterstützen, zu<br />
fördern. Dabei werden die einzelnen Förderbereiche nicht für sich angegangen,<br />
sondern über problemlösende Geschehnisse, die in gemeinsames<br />
Handeln eingebettet und in einem ganzheitlichen Kontext zu<br />
aktivieren sind.<br />
Anliegen der Ausbildung in der Fachrichtung Sprachbehindertenpädagogik<br />
ist zum einen die Realisierung sprachsonderpädagogischer Förderung<br />
als durchgängiges Prinzip im Unterricht, zum anderen die Realisierung<br />
spezifischer Förderangebote auf den verschiedenen Sprachebenen.<br />
Die Ausbildung in der Schwerpunktfachrichtung Sprachbehindertenpädagogik<br />
soll die FöLAA befähigen, ausgehend von den Bildungszielen<br />
und -inhalten der jeweiligen Schularten ein sprachförderndes Unterrichtskonzept<br />
zu entwickeln. Unter Berücksichtigung der Fachdidaktik,<br />
der Lernausgangslage und dem daraus abgeleiteten Förderbedarf der<br />
Schüler sollen sie Unterricht planen, durchführen und reflektieren.<br />
Die FöLAA sollen durch die Ausbildung in die Lage versetzt werden,<br />
� sprachliche und auch andere Kompetenzen der Schüler zu erfassen<br />
und Sprachförderziele zu bestimmen<br />
� Unterrichtsinhalte auf ihre immanenten sprachlichen Anforderungen<br />
und Fördermöglichkeiten zu untersuchen<br />
� Ziele und Inhalte fachspezifischen Unterrichtes und sprachsonderpädagogische<br />
Förderung in einem tragfähigen Konzept aufeinander<br />
zu beziehen<br />
� sich ein Methodenrepertoire anzueignen um die individuellen Förderpläne<br />
von Schülern im sprachfördernden Unterricht umzusetzen.<br />
Die Ausbildung in der weiteren Fachrichtung Sprachbehindertenpädagogik<br />
qualifiziert insbesondere für ein spezifisches situationsbezogenes,<br />
65
adressaten- und problemorientiertes Erfassen, Verstehen und Handeln -<br />
für förderschwerpunktbezogene Herausforderungssituationen, die professionelle<br />
Kompetenz und Performanz über das reguläre Unterrichtsangebot<br />
hinaus erfordern.<br />
Die Ausbildungsinhalte in der wFR Sprachbehindertenpädagogik beziehen<br />
sich vorrangig auf die Förderdiagnostik der Fachrichtung, die fallspezifische<br />
Konzeptbildung, förderschwerpunktbezogene Handlungsmodelle<br />
und Maßnahmen in Verbindung mit Unterricht.<br />
3.7 Verhaltensbehindertenpädagogik<br />
SCHWERPUNKTFACHRICHTUNG<br />
Veränderte Kindheit und Super-Nanny im Fernsehen<br />
Kaum ein Problem drängt sich - bedauerlicherweise - deutlicher in den<br />
Vordergrund aktuellen pädagogischen Geschehens: Kinder und Jugendliche<br />
sind verhaltensschwierig!<br />
Unter dem Schlagwort `Veränderte Kindheit´ lassen sich beispielhaft<br />
Begründungen finden:<br />
� Wandel der moralischen und familiären Strukturen<br />
(Überforderung, Gleichgültigkeit & Verwöhnung);<br />
� Zusammentreffen vielfältiger Kulturen<br />
(Was ist richtig - was ist falsch?);<br />
� mediale Überflutung (Die Playstation als bester Freund);<br />
� Perspektivlosigkeit (Zukunftsangst).<br />
Kinder und Jugendliche reagieren auf fehlenden Halt durchaus `verhaltenskreativ´,<br />
leider jedoch häufig sozial unangemessen mit:<br />
� Gewaltanwendung gegen Personen & Sachen;<br />
� Gleichgültigkeit und Desinteresse (z.B. gegenüber schulischen<br />
Belangen);<br />
� extremen Konzentrationsschwierigkeiten (Schlagwort `ADS´).<br />
Usw.; usw. - die Medien berichten! Die Lehrer klagen!<br />
Der Schulalltag wird schwierig - beileibe nicht nur an Förderschulen!<br />
66
Die Fachrichtung Verhaltensbehindertenpädagogik begegnet diesen<br />
aktuellen Herausforderungen mit drei spezifisch ausgerichteten Ausbildungsschwerpunkten:<br />
� Förderdiagnostik<br />
(Wie und wodurch ist das `Fehlverhalten´ eines Schülers bedingt?<br />
Wo gibt es realistische Eingriffsmöglichkeiten?)<br />
� Verbindung von Erziehung und Unterricht<br />
(Wie kann Schule dem Kind durch klare Strukturen & Unterrichtsinhalte<br />
Halt geben?)<br />
� Beratung<br />
(Entwicklung eines für alle Beteiligten `definiert-besseren´ Erziehungsumfeldes).<br />
Ein - bezogen auf die Problematik - wahrhaft schwieriges & gleichermaßen<br />
gesellschaftlich bedeutendes Unterfangen.<br />
Zur angemessenen Ausbildung der Lehramtanwärter unserer Fachrichtung<br />
entwickelten wir folgende, selbsterfahrungsbezogene Ausbildungsmodule:<br />
� Die Person des V-Lehrers (`Kompetenzprofil´);<br />
� Verfahren verhaltenspädagogischer Förderdiagnostik;<br />
� Planung, Umsetzung und Reflexion spezieller unterrichtlichter Fördermaßnahmen;<br />
- wirkungsvolle Interaktion- und Kommunikationsstrategien,<br />
- situativ-angemessene, strukturierte und offene(re) unterrichtliche<br />
Organisationsformen,<br />
- besondere Förderansätze (Spielpädagogik, Gestaltpädagogik,<br />
Erlebnispädagogik…)<br />
� Verhaltensstrukturierung von AD(H)S-Schülern (verhaltensmodifikatorische<br />
Ansätze,…)<br />
� Aggression und Gewalt als pädagogische Herausforderung<br />
� Förderansätze bei Schulangst und Vermeidungsverhalten<br />
� Möglichkeiten und Grenzen schulischer Beratung<br />
� Kooperation (Netzwerkarbeit mit Erziehungsberechtigten und Institutionen,<br />
z.B. Schulen, Jugendamt, Beratungsstellen, Agentur für<br />
Arbeit etc.)<br />
Unsere Gesellschaft benötigt angemessen agierende Schulen.<br />
Unsere Schulen brauchen wirkungsvoll ausgebildete Lehrer.<br />
Fachleiter und Referendare der Fachrichtung Verhaltensbehindertenpädagogik<br />
gestalten praxisfeste und innovativ ausgerichtete Lösungsstrategien.<br />
67
WEITERE FACHRICHTUNG<br />
Die weitere Fachrichtung Verhaltensbehindertenpädagogik zielt ab auf<br />
die Förderung von Kindern und Jugendlichen im sozial-emotionalen<br />
Bereich im Sinne einer integrativen Verzahnung von spezifischen verhaltenspädagogischen<br />
Anliegen mit der Förderung sachlich-fachlicher<br />
Inhalte.<br />
Diese verhaltenspädagogischen Maßnahmen verstehen sich als eine<br />
situations- und adressatenbezogene Förderung, die ausgelöst wurden<br />
durch eine situativ-fallspezifische Problemstellung.<br />
Nach einer förderdiagnostischen Phase des Erfassens dieser prägnant<br />
gewordenen Erscheinungsformen, des Interpretierens von Bedingungsund<br />
Bedeutungszusammenhängen sowie des Abwägens von Fördernotwendigkeiten<br />
und -möglichkeiten erfolgt eine entsprechende Konzeptbildung<br />
im Sinne einer Förderplanung. Deren integrative Umsetzung<br />
in Fördergruppen oder primär im Klassenrahmen bedarf der interprozessualen<br />
Kontrolle und Fortschreibung.<br />
Merkmale dieses verhaltenspädagogischen, integrativen Förderansatzes<br />
sind somit im Wesentlichen:<br />
� Unterrichtliche Einbettung von Fördermaßnahmen unter dem Gesichtspunkt<br />
der sozialemotionalen Förderung<br />
� Problem- und adressatenbezogene Konzeptbildung<br />
� Wechselseitige Bedingtheit von Unterricht und Erziehung<br />
� Prozessorientiertes Förderhandeln unter der kontinuierlichen Berücksichtigung<br />
diagnostischer, unterrichtlicher, erzieherischer und<br />
Maßnahmen bzw. Möglichkeiten<br />
� Erwerb und Umsetzung fachlicher und methodischer Kompetenzen<br />
� Förderung auf der Grundlage eines individualpädagogischen Verständnisses<br />
und gleichzeitig im Sinne eines ganzheitlichen Förderansatzes<br />
Die wechselseitige Bedingtheit von Unterricht und Erziehung findet auch<br />
dadurch ihre Entsprechung, dass die zentralen Leitaspekte von Unterricht<br />
'Intentionalität , Didaktische Gültigkeit', 'Methodische Plausibilität',<br />
'Schüler- und Situationsorientierung' sowie 'Pädagogische Situation' für<br />
den sachlich-fachlichen wie auch für den verhaltenspädagogischen<br />
Ansatz gleichermaßen relevant sind.<br />
Für den inhaltlichen Rahmen der Ausbildungsveranstaltungen, die für<br />
diesen adressatenbezogenen Förderansatz an den Schulen der Lehramtsanwärter<br />
stattfinden, haben sich unter dem Aspekt des Praxisbezugs<br />
folgende wesentlichen Themenbereiche herauskristallisiert:<br />
� Verfahren und Inhalte verhaltenspädagogischer Förderdiagnostik<br />
� Planung und Inhalte verhaltenspädagogischer Fördermaßnahmen,<br />
Förderkonzeptbildung - Interaktion - Kommunikation<br />
68
� Sozialerziehung<br />
� Unterrichtliche Umsetzung unter Einbeziehung pädagogischer u.<br />
therapeutischer Förderansätze<br />
� Ansätze der Spielpädagogik im Unterricht<br />
� Strukturierte/Lehrerzentrierte 'offene(-re)' Unterrichtsverfahren in der<br />
V-Förderung<br />
� Schulische Förderung 'hyperaktiver' Kinder und Jugendlicher<br />
� Aggression und Gewalt als pädagogische Herausforderung<br />
� Förderansätze bei Schulangst, Vermeidungsverhalten etc.<br />
� Lehrerverhalten, Kooperation, Beratung ... etc.<br />
Im Förderunterricht in den Klassen der Lehramtsanwärter lassen sich an<br />
den konkreten Förderansätzen mit den jeweiligen Lerngruppen prozessorientiertes<br />
Denken und Handeln zu präventiven verhaltensaufbauenden<br />
und auf vorhandene Störungsbereiche abzielende Interventionen<br />
in geeigneter Weise mit den Seminarteilnehmern reflektieren, vergleichen<br />
und fördern. Dabei sind die Verknüpfungen verhaltenstheoretischer<br />
Ansätze zu den konkret gegebenen Förderansätzen als Theorie-<br />
Praxis-Bezug von besonderer Bedeutung.<br />
Die Beratungssituationen bei Unterrichtsbesuchen helfen dabei, den<br />
Förderansatz weiter schüler- und situationsbezogen zu konkretisieren.<br />
Besonders wichtig ist hierbei eine kooperative Zusammenarbeit der<br />
Vertreter der Schulen und des Seminars.<br />
69
4 Seminarleiter und Stellvertreter, Verwaltungsangestellte,<br />
Fachleiterinnen und Fachleiter, Lehramtsanwärterinnen<br />
und Lehramtsanwärter<br />
Seminarleiter<br />
Ekkehard Kiersch (1996 – 2003), Waldemar Breiten (seit 2003)<br />
Stellvertretende Seminarleiter<br />
Waldemar Breiten (1996 – 2003); Martin Eggert (seit 2003)<br />
Verwaltungsangestellte<br />
Ursula Rohs, Anna Pfaff (1996 – 2005), Margarete Decker<br />
Fachleiterinnen und Fachleiter:<br />
(ehemalige Fachleiter kursiv gedruckt)<br />
Regina Abels-Schaefer, Elisabeth Adler, Hannelore Arndt-Becker, Ina<br />
Boettiger, Hans-Rudolf Bott, Maria-Anna Briesemann, Wolfgang Brückmann,<br />
Rolf Brüdern, Ursula Decker, Gretel Dornauf, Martin Eggert,<br />
Markus Falterbaum, Jutta Frankfurter, Stefanie Fricke, Christine Gabriel,<br />
Steffen Graf, Stefan Halm, Winfried Hehl, Jürgen Hoder, Birgit Kirsch-<br />
Schneider, Michael Knüttel, Johannes Knußmann, Klaus Leber, Doris<br />
Lemjimer-Zuleger, Gerhard Marx, Rosemarie Müller, Beate Neugebauer-Kraft,<br />
Manfred Rust, Holger Schäfer, Helga Schanz, Klaus Schemann,<br />
Rosemarie Schmidt, Heinz-Peter Schneider, Markus Schulz,<br />
Dr. Margit Theis-Scholz, Dr. Ingeborg Thümmel, Heinz Valerius, Roman<br />
Werle, Jutta Witzel, Martina Wolff-Wintermeier, Gisela Wrobel.<br />
Kooperativ ausbildende Fachleiter (GHS-Seminare)<br />
(im aktuellen Durchgang nicht kooperierende FL sind kursiv gedruckt)<br />
Ursula Ackermann, Diethelm Albrecht, Dorothe Altmeyer, Thomas Barkhausen,<br />
Katrin Barth, Werner Brudermanns, Rainer Caratiola, Reinhold<br />
Esser, Gudrun Friderichs, Heike Graf, Paul Groß, Karin Junginger,<br />
Ulrich Kähne, Heike Kessler-Husse, Peter Kirch, Steffen Klein, Norbert<br />
Knobloch, Ruth Köfer, Uwe Melchior, Klaus Nellinger, Hans-Theo Nieder,<br />
Dagmar Pascher, Brigitte Puderbach, Gerd Querbach, Jürgen<br />
Reitershan, Ingeborg Schädlich, Hans-Willi Schönberger, Dr. Werner<br />
Simon, Marion Sonntag, Dieter Steuernagel.<br />
70
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter<br />
1.08.1996 (Neuwied)<br />
Tanja Althof, Marion Appenfeller, Lars Bauermann, Nicole Borner, Markus<br />
Engel, Martin Ernst, Tanja Esch, Ulrike Friedrich, Anja Gawlita,<br />
Yvonne Graff, Martin Heine, Frank Hendriks, Daniela Keßler, Saskia<br />
Kleinegräber, Sandra Kölsch, Andrea Konter, Uwe Krause, Daniela<br />
Kunnen, Sabine Luppert, Edmée Meysenbourg, Barbara Neubauer,<br />
Hans Bernd Ott, Nils Petri, Florian Pommer, Nadine Rischard, Monika<br />
Römgens, Edith Rößler, Kerstin Roth, Markus Saftig, Ulrike Schäfer,<br />
Gudrun Siegel, Frauke Steinkrüger, Claudia Velten, Valeska von Oppen,<br />
Torsten Weiss, Daniela Wingerter<br />
1.02.1998 (Neuwied)<br />
Michael Atland, Martina Becker, Sandra Berkholz, Yvonne Bläser, Ina<br />
Boettiger, Sonja Brücken, Eva Christmann, Markus Clemens, Barbara<br />
Crusen, Beatrice Dickel, Annette Eichberger, Meike Fader, Anja Fischer,<br />
Simone Fixemer, Jaqueline Haese, Sigrid Hauser, Michael Heuser,<br />
Anette Horlacher, Bärbel Jacobs, Sabine Jäkle, Corinna Jeske,<br />
Simone Jung, Hendrik Jüngermann, Markus Junk, Birka Justrie, Stephanie<br />
Kall, Daniela Kleinbauer, Thomas Klesius, Michaela Kluske,<br />
Norbert Kube, Heike Marhofer, Manuela Massing, Christine Mattuschka,<br />
Thomas Mergen, Simone Milles, Karina Müller, Ija Rapp, Rita Regner,<br />
Michaela Rohn, Simone Rosbach, Esther Sayn, Nicole Schäfer, Daniela<br />
Schmatz, Bianca Kloft, Jörg Schönenberger, Sandra Schuster; Ellen<br />
Sefrin, Michaela Siegloff, Frauke Staaden, Ulrike Stein, Meike Stinner,<br />
Susanne Tschapke, Alexandra Victor, Roman Werle, Sabine Willeke,<br />
Dennis Zimmer<br />
1.08.1999 (Neuwied und Trier)<br />
Kerstin Adrian, Stefanie Barth, Jan Bechberger, Julia Berchem, Anja<br />
Beyer, Vera Bieg, Judith Blum, Karen Bremer, Ruth Brodam, Verena<br />
Buchholz, Eva-Maria Büning, Birgit Danner, Barbara Diehl, Jasmin<br />
Fattah, Jutta Feller, Simone Flockerzi, Natalie Frey, Christiane Friedrich,<br />
Silke Fritzen, Michaela Fröhlich, Christiane Gaul, Ulrike Geiger, Katja<br />
Gemmer, Roman Haag, Susanne Hannappel, Maike Hansen, Hanja Pia<br />
Haubner, Barbara Herder, Sabine Heymann, Bernadette Hirsch, Christina<br />
Hoffmann, Sebastian Husenbeth, Tanja Imbsweiler, Simone Jäger,<br />
Sylvia Jung-Dewald, Nicole Karen, Christiane Kautz, Franz Kiefer,<br />
Johanna Kiemes, Michaela Klein, Oliver Kneidl, Peter Kömmetter, Susanne<br />
Krämer, Martina Krauß, Eva Kukla, Karsten Kunde, Anita Kuttler,<br />
Christina Lauterbach, Anja Layes, Marc Melzer, Hildegard Moeren,<br />
Miriam Mohler, Andrea Niederberger, Birte Odenbach, Kirsten Oerding,<br />
71
Kerstin Pauly, Frank Peter, Martina Pieper, Ulrike Platz, Petra Pötz,<br />
geb. Fleschen, Pamela Reinhard, Alexander Roth, Nicole Rumpf, Maren<br />
Schäfer, Carmen Scheer, Verena Schmell, Sabine Schmelzer, Nicole<br />
Schmitt, Carsten Schneider, Nicole Schoberwalter, Heike Schuh, Melanie<br />
Schuster, Anja Sprengel, Ute Springob, Ivo Spuhler, Thomas Stephan,<br />
Alexander Stepp, Carmen Thönnes, Nina Tischleder, Nina Maria<br />
Velten, Silke Wagner, Elke Waßner, Nadja Weis, Karin Weisbrod, Melanie<br />
Weißler, Barbara Willig, Evi Zisterer<br />
Einstelltermin 01.02.2001 (Neuwied und Trier)<br />
Margret Angel, Andrea Bauer, Kerstin Bierther, Robert Britscho, Kerstin<br />
Burg, Nadine Christ, Renate Czybulka, Simone Derron, Susanne Deynet,<br />
Susanne Dreyer, Marco Emmerich, Christina Engels, Magdalene<br />
Franzen, Udo Gangolf, Nadja Geiß, Christine Glaser, Susanne Hammer,<br />
Monika Hansen, Stephanie Hees, Alexandra Heidrich, Jochen<br />
Höflich, Gül Hof-Oypan, Angela Hubach, Lotte Humbert, Brigid Johannsen,<br />
Sven Parick Jung, Marion Kaes, Harald Keller, Daniela Lay, Stefanie<br />
Lemke, Eva Maria Lenhard, Tina Linder, Thea Marmann, Alexandra<br />
Martin, Nicole Maurer, Ira Michel, Kerstin Müller, Julia Neuhaus, Janina<br />
Nonnast, Katja Othmer, Claudia Pauly, Nicole Redwanz, Hardis Regelin,<br />
Petra Risse, Tanja Rönz, Tina Rothkegel, Carsten Salomon, Holfer<br />
Schäfer, Christian Scheidel, Susanne Schmitz, Miriam Schnupp, Julia<br />
Schulz-Kraus, Miriam Simon, Christiane Staufer, Silke Steig, Claudia<br />
Temmel, Anja Thobald, Nina Unsöld, Anice vom Berg, Claudia Weichmann,<br />
Andrea Weidemann, Nicole Wirtz, Julia Witzmann, Ina Wunderlich,<br />
Jessica Zender<br />
Einstelltermin: 01.08.2002 Neuwied<br />
Tanja Abresch, Silke Bertgen, Andrea Braun, Christiane Busch, Katrin<br />
Busch, Claudia Cremer, Nathalie Dressler, Petra Falterbaum, Marco<br />
Fandel, Marietta Fein, Nicole Ferretti, Thomas Fey, Jennifer Flohr,<br />
Simone Follmann, Jenny Fricke, Silke Gehrmann, Nicole Gerhardt,<br />
Isabelle Graf, Stefan Heible, Ludger Heiligers, Michael Heimann, Pia<br />
Henn, Kerstin Hens, Sandra Hillen, Hürter Eva, Mona Johann, Marianne<br />
Jost, Doris Jung, Katja Jung, Nadja Kalkofen, Nadine Keil, Kerstin Kiefer,<br />
Mirjam Körbes, Daniela Krobb-Werz, Jochen Küppers, Sonja Küppers,<br />
Silke Lamprea, Beate Langens, Nicole Latz, Claudia Leonards,<br />
Jennifer Maas, Birgitt Menges, Nadja Moll, Birgitta Müller, Pia Müller,<br />
Katrin Nieß, Nina Overdick, Michael Peidel, Andreas Preußer, Niklas<br />
Quinten, Inge Reger, Magdalena Salz, Christina Scheidt, Tammo<br />
Scherr, Andrea Katharina Pütz, Tanja Schneider, Christian Schönig,<br />
72
Yvonne Schulski, Andreas Schümmer, Joespha Schürg, Anja Sievers,<br />
Esther Stadler, Gerrit Stakemeier, Siegrid Tischer, Nadine Wagner,<br />
Anna-Miriam Walter, Jutta Wenz-Kühn, Markus Wildner<br />
Einstelltermin: 01.02.2003 Trier<br />
Sonja Abeling, Stefanie Bonn, Kerstin Brost, Kerstin Coen, Ulrike Dücker,<br />
Klaus Peter Eiden, Martin Gärtner, Jan Peter Geisbüsch, Uwe<br />
Hees, Ruth Heidemann, Simone Herzberger, Ulrich Hilsamer, Andrea<br />
Kästner, Silke Nora Krings, Natalie Krütten, Silke Lamberty, Christine<br />
Lang, Julia Ludwig, Katrin Mühlhan, Birgit Overhoff, Silke Sauer, Markus<br />
Schleidweiler, Evelyn Stiegler, Claudia Theobald, Kathrin Hebenthal,<br />
Bärbel Walter, Matthias Webel, Janine Zippel<br />
Einstelltermin: 01.02.2004 Neuwied<br />
Claudia Baum, Sonja Baumgartner, Michaela Brehmer, Judith Brodam,<br />
Susen Chemnitz, Timo Chmura, Claudia Dinges, Andrea Eckes, Karin<br />
Flurer-Brünger, Petra Gehrmann, Linda Gelhard, Michaela Grätz, Svenja<br />
Grolm, Marion Herbert, Bettina Hettinger, Christina Hick, Susann<br />
Hüttig, Jörg Kilian, Martin Christoph Krötz, Petra Kuch, Johanna Kunze,<br />
Sonja Küppers, Kerstin Limp, Christine Matthias, Anette Müller, Dirk<br />
Nawra, Nadine Ohem, Tanja Ost, Stefanie Pätzold, Daniela Pfeiffer,<br />
Daniel Pfitzner, Jochen Sachsenhauser, Sucette Sauvageau, Nadine<br />
Schranz, Sandra Schumacher, Jeanette Schwalen, Daniela Seelig-<br />
Kreis, Petra Selle, Stephanie Siebert, Heidrun Stüber, Maria Tarnari,<br />
Kerstin Wagener, Judith Wax, Angela Weiß, Thomas Wildner, Daniela<br />
Will, Sandra Winter<br />
Einstelltermin: 01.08.2004 Trier<br />
Dorothea Arndt, Stefanie Bastian, Maik Bergmann, Daniela Bohrer,<br />
Fabian Faß, Markus Fischer, Simone Glößner, Sabine Goertz, Brit<br />
Heber, Claudia Heinz, Stefanie Hen tz, Alexandra Hovestadt, Jasmin<br />
Krause, Stefanie Linn, Franziska Lippold, Kerstin Mathieu, Meyer Kerstin,<br />
Michael-Oliver Neumann, Christian Nicolay, Kerstin Osieka, Stephanie<br />
Peiffer, Ulrike Rommelfanger, Anja Schoden, Christiane Schubert,<br />
Petra Simonis, Susanne Steins, Meinhard Volz, Margit Leonie von<br />
Blohn-Lang, Marc Zundel<br />
73
Einstelltermin: 01.08.2005 Neuwied<br />
Silvia Ackermann, Jens Berdan, Claudia Berg, Christoph Berger, Siglinde<br />
Bernd, Anne Bey, Sonja Binder, Stefanie Blautert, Sabrina Bohnenberger,<br />
Katja Both, Julia Braun, Diana Breitbach, Silke Brenner, Judith<br />
Büschleb, Christina Conrad, Silja Degel, Bianca Degro, Dagmar Elsen,<br />
Stefanie Erhart, Ruth Folz, Sinje Fuchs, Melanie Gehm, Sabine Geyermann,<br />
Marian Glaremin, Nicole Grimmeißen, Jens Haag, Julian Haas,<br />
Judith Hallas, Sabine Halmer, Maike Hoffmann, Karin Kaiser, Sabine<br />
Kessel, Anke Kilian, Nina Köberlein, Berit Korsen, Torsten Küpper,<br />
Jeanne Lange, Nicole Meurer, Axel Meyer zu Brickwedde, Dorothee<br />
Müller, Christiane Nowak, Tobias Pharow, Nicola Phiesel, Simone<br />
Rauch, Birgit Rettler, Anne Riehl, Anja Rodenbusch, Karina Rüster,<br />
Ramona Schäfer, Ute Scheibel, Miriam Schmidt, Alexa Schneider,<br />
Janine Schories, Peter Schütz, Anne Servatius, Karin Siegemund,<br />
Esther Steffen, Oliver Stickel, Karin Strauß, Andreas Swoboda, Katrin<br />
Thamm, Dorit Wiechert<br />
Einstelltermin: 01.02.2006 Trier<br />
Daniela Bach, Waltraud Boes, Marc André Boll, Miriam Christ, Bettina<br />
Didion, Marie Feltes, Goertz Sabine, Johannes Hoffmann, Katja Hörter,<br />
Caroline Joeres, Mirjam Kaiser, Julia Kronibus, Sarah Lang, Daniela<br />
Machwirth, Susanne Mehn, Dorothee Nassauer, Frank Politz, Esther<br />
Potter, Kathrin Römermann, Stefan Schmidt, Nora Schmitt, Simone<br />
Schön, Armin Steimer, Christine Waldner, Carmen Weber, Julian<br />
Wesch, Martina Wolff, Andrea Woll, Sarah Elisabeth Zewe, Marina<br />
Zilligen<br />
74
75<br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Seminarkonferenz am <strong>10</strong>.07.2006 (Foto: Oliver Stickel