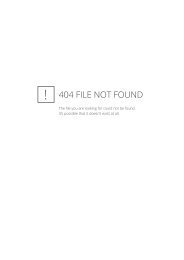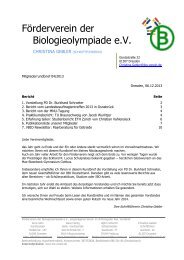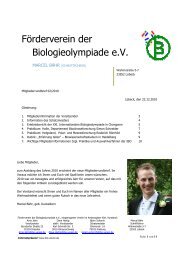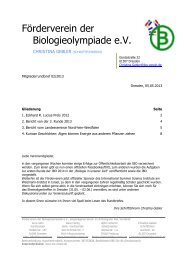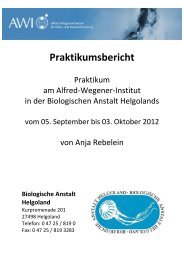Förderverein der Biologieolympiade eV
Förderverein der Biologieolympiade eV
Förderverein der Biologieolympiade eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>För<strong>der</strong>verein</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Biologieolympiade</strong> e.V.<br />
MARCEL BÄHR (SCHRIFTFÜHRER)<br />
Mitglie<strong>der</strong>rundbrief 02/2011<br />
Glie<strong>der</strong>ung:<br />
1. Resümee <strong>der</strong> Vereinsarbeit 2011, die Vorsitzenden<br />
2. Trauernachricht zum Tod von Dr. Eckhardt R. Lucius<br />
3. Ankündigung <strong>der</strong> Vorstandswahl am 21.02.2012<br />
4. Bericht zum Landesbeauftragtentreffen, Dr. Christiane Mühle<br />
5. Rubrik: Faszination Forschung mit einem Bericht von Dr. Falk Butter<br />
<strong>För<strong>der</strong>verein</strong> <strong>der</strong> <strong>Biologieolympiade</strong> e.V., eingetragener Verein im Amtsregister Kiel, Vorstand:<br />
Arne Jahn Dave Hartig Björn Schorch Marcel Bähr<br />
Vorsitzen<strong>der</strong> stellv. Vorsitzen<strong>der</strong> Schatzmeister Schriftführer<br />
Berzdorfer Straße 23 Karl-Schmidt-Str. 7 Glümerstr. 1A Wahmstraße 5-7<br />
01239 Dresden 38114 Braunschweig 79102 Freiburg 23552 Lübeck<br />
Arne.Jahn@iboverein.de <br />
Dave.Hartig@iboverein.de <br />
Bjoern.schorch@iboverein.de<br />
Wahmstraße 5-7<br />
23552 Lübeck<br />
6. Praktikum: Alfred-Wegner-Institut Helgoland, Meeresbiologie, Laura Staschko<br />
7. Praktikum: MPI Martinsried, Biochemie, Clara Bultmann<br />
8. Praktikum: MPI Golm, Pflanzenphysiologie, Eva Kúbicova<br />
9. Praktikum: BNI Hamburg, Tropenmedizin, Utz Ermel<br />
Bankverbindung: HypoVereinsbank, Kontonummer 387 353 828, Bankleitzahl 680 01 86 (Deutschland)<br />
Internetpräsenz: www.ibo-verein.de<br />
Marcel.baehr@ibo-verein.de<br />
Lübeck, den 09.12.2011<br />
Marcel.Baehr@ibo-verein.de<br />
3<br />
5<br />
6<br />
7<br />
9<br />
12<br />
14<br />
15<br />
17<br />
Seite 1 von 18
Liebe Mitglie<strong>der</strong>,<br />
das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir möchten Ihnen die weihnachtliche Vorfreude mit unserem<br />
zweiten Mitglie<strong>der</strong>rundbrief des Jahres 2011 versüßen. Der Rundbrief beinhaltet viele spannende<br />
Artikel, die Ihnen das fast vergangene Jahr ins Gedächtnis zurückrufen und Sie zu Gedanken an das<br />
Kommende bewegen sollen.<br />
Beson<strong>der</strong>s ans Herz legen möchte ich Ihnen den Artikel über die kommende Vorstandswahl. Wir<br />
werden wie<strong>der</strong> Briefwahlen anbieten, sodass auch jene Mitglie<strong>der</strong>, welche am 21.02.2012 nicht in Kiel<br />
sein können, eine Möglichkeit haben an <strong>der</strong> Wahl teilzunehmen.<br />
Ich möchte Sie, liebes Mitglied, an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir stets versuchen<br />
ausgewogen und umfassend zu berichten. Lei<strong>der</strong> erfahren wir nicht von allen aktuellen Ereignissen<br />
und Neuigkeiten. Daher möchte ich Sie bitten uns mitzuteilen, wenn Sie etwas erlebt haben, dass Sie<br />
Ihrem Verein mitteilen möchten. Schreiben Sie uns spannende, interessante, aufregende Dinge die<br />
Sie erlebt, Forschungsergebnisse, die Sie entdeckt haben. Möchten Sie auch ein Praktikum an einem<br />
renommierten Institut absolvieren o<strong>der</strong> möchten Sie ein Praktikum anbieten? Haben Sie eine<br />
Bachelor-, Master- o<strong>der</strong> Doktorarbeit zu vergeben? Nutzen Sie UNSEREN Rundbrief und kontaktieren<br />
Sie den Vorstand.<br />
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen des Rundbriefes und im Namen des Vorstandes ein frohes<br />
und besinnliches Weihnachtsfest im Kreis <strong>der</strong> Familie, sowie einen guten unfallfreien Rutsch ins neue<br />
Jahr.<br />
Ihr Schriftführer Marcel Bähr<br />
Seite 2 von 18
1. Resümee <strong>der</strong> Vereinsarbeit 2011<br />
Liebe Mitglie<strong>der</strong> des <strong>För<strong>der</strong>verein</strong>s <strong>der</strong> <strong>Biologieolympiade</strong> e.V.,<br />
ein bewegtes Jahr geht zu Ende. Der Rückblick<br />
wird durch den Abschied von Freund und Leiter<br />
<strong>der</strong> <strong>Biologieolympiade</strong> Dr. Eckhard R. Lucius<br />
überschattet.<br />
Trotzdem möchten wir das Fortschreiten <strong>der</strong><br />
Vereinsentwicklung resümieren.<br />
Die Zahl unserer Mitglie<strong>der</strong> hat sich auf 130<br />
vergrößert. Sowohl Schüler, Lehrer als auch<br />
Wissenschaftler gehören zu den<br />
Neumitglie<strong>der</strong>n. Damit bauen wir unser<br />
Netzwerk weiter aus und för<strong>der</strong>n den<br />
Austausch unter ähnlich Interessierten.<br />
Alle neuen Mitglie<strong>der</strong> möchten wir herzlich<br />
willkommen heißen und freuen uns sehr, dass<br />
sie den Verein unterstützen.<br />
Die Hauptaufgabe <strong>der</strong> Vereinsarbeit bestand<br />
darin Teilnehmer <strong>der</strong> dritten Auswahlrunde mit<br />
Praktika auszuzeichnen und diese zu<br />
vermitteln. Wir konnten in diesem Jahr vier<br />
Praktika bei langjährigen Kooperationspartnern<br />
vergeben. Darunter befindet sich Dr. Falk<br />
Butter vom Max-Planck-Institut für Biochemie<br />
in Martinsried. Von ihm stammt ebenfalls <strong>der</strong><br />
wissenschaftliche Artikel aus <strong>der</strong> Rubrik<br />
„Faszination Forschung“. Für sein Engagement<br />
danken wir ihm sehr.<br />
Darüber hinaus haben das Bernhard-Nocht-<br />
Institut für Tropenmedizin in Hamburg, das<br />
Alfred-Wegener-Institut in Helgoland und das<br />
Max-Planck-Institut für molekulare<br />
Pflanzenphysiologie in Potsdam Golm jeweils<br />
einen Schüler aufgenommen. Die Evaluationen<br />
waren bis auf eine Ausnahme von beiden<br />
Seiten sehr positiv. Darüber hinaus konnten wir<br />
bei <strong>der</strong> Auswahl eines Schülers für die<br />
Summerschool in Rehovot, Israel, behilflich<br />
sein.<br />
Ein beson<strong>der</strong>es Projekt in diesem Jahr war die<br />
Umsetzung des Schulpreises. Ein Punktesystem<br />
evaluiert die Schülerzahl und –herkunft, jener,<br />
Laura Staschko, Nick Plathe und Charlotte Gärtner (v.l.) mit den vom Schulpreis finanzierten Büchern.<br />
Seite 3 von 18
die in den letzten drei Jahren an den deutschen<br />
IBO-Auswahlrunden teilnahmen.<br />
In diesem Jahr hat das Carl-Friedrich Gauß<br />
Gymnasium Frankfurt (O<strong>der</strong>) mit Abstand den<br />
ersten Platz erreicht. Die Übergabe hat beim<br />
Finale <strong>der</strong> brandenburgischen Landesolympiade<br />
stattgefunden, die einen entscheidenden Teil<br />
<strong>der</strong> biologischen Ausbildung in Brandenburg<br />
darstellt. Vom Preisgeld hat sich die Schule<br />
neue Bücher aus vielen Bereichen <strong>der</strong> Biologie<br />
zugelegt. Wir hoffen, dass die Lehrer des<br />
Gymnasiums weiterhin so engagiert sind und<br />
Schüler für die Biologie begeistern können.<br />
Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit haben wir mit<br />
Hilfe <strong>der</strong> Firma Eppendorf aus Hamburg, einem<br />
langjährigen Unterstützer <strong>der</strong> IBO, einen<br />
kleinen Meilenstein errungen.<br />
Wir können unseren Verein nun mit einem<br />
professionellen Flyer und <strong>der</strong> Vorstand zudem<br />
mit Visitenkarten präsentieren.<br />
Für die Zukunft steht weiterhin das Ziel im<br />
Raum Gel<strong>der</strong> einzuwerben, was uns bisher<br />
noch nicht gelungen ist.<br />
Weitere Ideen betreffen die Vereinsarbeit. Wir<br />
planen die Vergabe eines Stipendiums an einen<br />
Studenten für ein Praktikum im Ausland; einen<br />
Facebook-Auftritt, <strong>der</strong> aktuell zur IBO und zum<br />
Verein informiert und Raum zur Diskussion<br />
bietet; sowie ein Austauschportal für<br />
Stellenangebote.<br />
Es würde uns freuen mit Ihnen über diese und<br />
an<strong>der</strong>e Themen ins Gespräch kommen.<br />
Möglichkeit dazu bietet insbeson<strong>der</strong>e die<br />
Mitglie<strong>der</strong>versammlung zu <strong>der</strong> wir Sie alle<br />
herzlich einladen.<br />
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine<br />
gemütlich Weihnachtszeit und viele Ideen für<br />
das neue Jahr.<br />
Arne Jahn und Dave Hartig<br />
Seite 4 von 18
2. Trauernachricht zum Tod von Dr. Eckhard R. Lucius<br />
Seit 1995 leitete Dr. Eckhard Lucius die<br />
Internationale <strong>Biologieolympiade</strong> Deutschland.<br />
Mit seinen Ideen, seiner Tatkraft und viel<br />
Herzblut entwickelte sich <strong>der</strong> Wettbewerb<br />
sowohl national als auch international zu einer<br />
überaus wertvollen Möglichkeit für Schüler ihr<br />
Wissen zu vertiefen, neue Freunde zu finden<br />
und geför<strong>der</strong>t zu werden.<br />
Eine ähnliche Entwicklung ging bei den<br />
Juniorolympiaden IJSO und EUSO vonstatten,<br />
<strong>der</strong>en Gründungsmitglied er war.<br />
Viele Schülerjahrgänge durften seinen<br />
Enthusiasmus für die Idee einer guten<br />
Ausbildung durch einen Wettbewerb miterleben<br />
und ließen sich von seinem heiteren Wesen<br />
mitreißen. Über die Jahre entwickelte sich eine<br />
stetig wachsende Gemeinschaft, die auf<br />
gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen<br />
zurückblicken kann.<br />
Mit seinem Ideenreichtum, seiner positiven<br />
Lebenseinstellung, seiner Lebenserfahrung,<br />
seiner Freundschaftlichkeit, Offenheit und<br />
seinem Humor war er <strong>der</strong> Begrün<strong>der</strong> dieser<br />
Gruppe und vielen ein Freund.<br />
Dr. Eckhard Lucius verstarb am 21.09.2011.<br />
Wir möchten seiner Familie unser aufrichtiges<br />
Beileid aussprechen.<br />
In stiller Trauer.<br />
Der Vorstand<br />
Seite 5 von 18
3. Ankündigung <strong>der</strong> Vorstandswahl am 21.02.2012 um 19 Uhr<br />
Am 21.02.2012 ist es wie<strong>der</strong> so weit. Nach<br />
zweijähriger Amtszeit findet die Vorstandswahl<br />
statt. In diesem Artikel möchte ich Ihnen, liebe<br />
Mitglie<strong>der</strong>, das Wahlverfahren erläutern.<br />
Der Vorstand besteht aus vier Positionen, die<br />
bis zum Wahltag von folgenden Mitglie<strong>der</strong>n<br />
besetzt sind:<br />
Erster Vorsitzen<strong>der</strong> Arne Jahn<br />
Stellvertreten<strong>der</strong><br />
Vorsitzen<strong>der</strong><br />
Dave Hartig<br />
Schatzmeister Björn Schorch<br />
Schriftführer Marcel Bähr<br />
Ich möchte Sie, liebes Vereinsmitglied, an<br />
dieser Stelle dazu ermutigen, sich für eine<br />
Position zur Wahl zu stellen!<br />
Bitte übermitteln Sie mir dazu eine Vorstellung<br />
ihrer Person, die ein Foto und ihre Motivation<br />
enthält (Kontakt siehe unten o<strong>der</strong> erste Seite).<br />
Anfang Januar werde ich einen Rundbrief<br />
versenden, <strong>der</strong> die „Steckbriefe“ <strong>der</strong><br />
Kandidaten enthält. Die Frist für die Abgabe<br />
<strong>der</strong> Kandidaturen ist <strong>der</strong> 08.01.2012.<br />
Die Wahl findet im Zuge <strong>der</strong><br />
Mitglie<strong>der</strong>versammlung am 21.02.2012 in <strong>der</strong><br />
Jugendherberge in Kiel (Johannisstraße 1) um<br />
19 Uhr statt. Eine Einladung zur<br />
Mitglie<strong>der</strong>versammlung werden Sie in Kürze<br />
erhalten.<br />
Falls Sie nicht persönlich bei <strong>der</strong> Wahl<br />
erscheinen können, bietet Ihnen <strong>der</strong> Verein die<br />
Möglichkeit <strong>der</strong> Briefwahl. Die Wahlunterlagen<br />
dazu können Sie ab sofort anfor<strong>der</strong>n. Bitte<br />
schicken Sie mir dazu einen Brief o<strong>der</strong> eine<br />
Email, die Ihre aktuelle Adresse enthält.<br />
Sie werden die Kandidatenliste, den<br />
Stimmzettel und zwei bereits frankierte und<br />
adressierte Briefumschläge erhalten. In einen<br />
Briefumschlag stecken Sie den Stimmzettel und<br />
in den zweiten legen Sie den ersten<br />
Briefumschlag. Bitte unterschreiben Sie nach<br />
Zukleben des Briefumschlages auf dem<br />
ÄUßEREN Umschlag. Dies soll als Siegel dienen.<br />
Gezählt werden alle Briefe, die bis zum<br />
17.02.2012 beim Schriftführer (Marcel Bähr,<br />
Wahmstraße 5-7, 23552 Lübeck) eingehen.<br />
Bei Fragen bzgl. des Wahlverfahrens können Sie mich gerne unter folgen<strong>der</strong> Adresse kontaktieren:<br />
marcel.baehr@ibo-verein.de<br />
Seite 6 von 18
4. Bericht zum Landesbeauftragtentreffen von Dr. Christiane Mühle<br />
Vom 13.-15.11. fand in Magdeburg das 17.<br />
Treffen <strong>der</strong> Landesbeauftragten des deutschen<br />
Auswahlverfahrens zur Internationalen<br />
Biologie-Olympiade statt. Seit 1996 wurden die<br />
IBO-Beauftragten aller Län<strong>der</strong> zunächst nach<br />
Kassel, später in wechselnde deutsche Städte<br />
jährlich eingeladen, um von Sonntag bis<br />
Dienstag gemeinsam zu diskutieren und sich<br />
untereinan<strong>der</strong> sowie mit <strong>der</strong> Geschäftsführung<br />
vom IPN in Kiel auszutauschen – und dieses<br />
Jahr mit großer Trauer lei<strong>der</strong> erstmals ohne Dr.<br />
Eckhard R. Lucius. Die Erinnerung an ihn blieb<br />
uns jedoch während <strong>der</strong> gesamten Zeit<br />
erhalten – während <strong>der</strong> Sitzungen wie bei einer<br />
kleinen Führung durch die Landeshauptstadt<br />
Sachsen-Anhalts, die natürlich nicht fehlen<br />
durfte.<br />
Zum Schwerpunkt des von Dennis Kappei und<br />
Christiane Mühle - langjährig an <strong>der</strong> IBO-<br />
Auswahl beteiligten Ehemaligen - geleiteten<br />
Treffens gehörte wie immer die Diskussion<br />
ihrer Vorschläge für die vier Aufgaben <strong>der</strong><br />
ersten Runde 2013. Zwar findet diese<br />
Olympiade erst im Juli 2013 in <strong>der</strong> Schweiz<br />
statt, aber <strong>der</strong> zeitliche Vorlauf ist nötig, denn<br />
schon im Frühjahr 2012 wird die endgültige<br />
Version <strong>der</strong> Aufgaben auf Plakaten an die<br />
Schulen verschickt und im Internet<br />
veröffentlicht. Dann bleibt den SchülerInnen<br />
bis zum Herbst Zeit zur Bearbeitung <strong>der</strong><br />
Hausarbeit mit dem Ziel <strong>der</strong> Qualifikation für<br />
die 2. Runde, die im November des<br />
Olympiadevorjahres als Klausur an den Schulen<br />
absolviert wird. Die Diskussion unserer<br />
Vorschläge mit den Landesbeauftragten –<br />
größtenteils auch Lehrern in Biologie – hilft bei<br />
<strong>der</strong> Anpassung des Niveaus, <strong>der</strong> Orientierung<br />
an Schulthemen wie <strong>der</strong>en Ergänzung aber<br />
auch bei <strong>der</strong> Formulierung <strong>der</strong> Texte z.B. unter<br />
Berücksichtigung <strong>der</strong> sogenannten Operatoren<br />
– Schlüsselwörtern in Aufgabenstellungen (z.B.<br />
Erörtern, Erklären, Erläutern) zur<br />
Standardisierung erwarteter Leistungen und<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen.<br />
Seit <strong>der</strong> Einführung <strong>der</strong> „3 aus 4“-Regel bei <strong>der</strong><br />
ersten Hausaufgabenrunde (nur die 3 besten<br />
Aufgabenlösungen werden gewertet)<br />
versuchen wir hier, jeweils zwei Aufgaben mit<br />
experimentellem Anteil zu gestalten. Zudem<br />
sollen sich die Komplexe aus einer Mischung<br />
verschiedener Fachgebiete und<br />
Schwierigkeitsgrade zusammensetzen, um auch<br />
schon sehr junge SchülerInnen zur Teilnahme<br />
an <strong>der</strong> IBO zu motivieren. Entsprechend hat<br />
Christiane in <strong>der</strong> statistischen Auswertung <strong>der</strong><br />
1. Runde 2012 u.a. gezeigt, dass jüngere<br />
TeilnehmerInnen JG 9-11 im Schnitt genau so<br />
gut abschneiden wie ältere SchülerInnen <strong>der</strong><br />
JG 12 und 13 – und das in allen vier Aufgaben.<br />
Auch wenn dies beson<strong>der</strong>s engagierte Jüngere<br />
sein mögen, so liegt hier doch noch ein großes<br />
Potential <strong>der</strong> frühen För<strong>der</strong>ung – und für uns<br />
auch <strong>der</strong> Erhöhung <strong>der</strong> Attraktivität <strong>der</strong><br />
Aufgaben für niedrigere Klassenstufen.<br />
So haben in <strong>der</strong> diesjährigen 1. Runde die<br />
Aufgabe zum Lotuseffekt fast alle SchülerInnen<br />
bearbeitet und im Schnitt auch am besten<br />
gelöst. Als leichter und schulnäher wurde von<br />
den TeilnehmerInnen offenbar auch die<br />
Energetik-Aufgabe gewertet – dabei hoffen wir<br />
möglichst viele Schüler anzusprechen und hohe<br />
Teilnehmerzahlen zu erhalten. Die Aufgaben<br />
aus <strong>der</strong> Biochemie/Genetik und Stoffwechsel<br />
stellten dagegen eine größere Herausfor<strong>der</strong>ung<br />
dar und helfen uns dadurch bei <strong>der</strong><br />
Differenzierung <strong>der</strong> Leistungen zur Auswahl für<br />
die 2. Runde. Interessant war auch die<br />
Auswertung <strong>der</strong> Teilnehmerzahlen nach<br />
Bundeslän<strong>der</strong>n o<strong>der</strong> Schulen – es gibt<br />
tatsächlich Schulen, die mit über 30<br />
SchülerInnen teilnehmen und dabei sogar sehr<br />
gute Ergebnisse erzielen.<br />
Entsprechend gab es dann auch eine<br />
Ideensammlung zu Möglichkeiten, mehr<br />
Schulen zur Teilnahme an <strong>der</strong> IBO zu bewegen<br />
– z.B. durch „Schulpatenschaften“ über<br />
Vereinsmitglie<strong>der</strong>, die sich um eine o<strong>der</strong><br />
mehrere Schulen in ihrer Umgebung kümmern<br />
und dort über die IBO informieren. Aus<br />
Rückmeldungen wissen wir, dass viele<br />
SchülerInnen immer noch sehr spät o<strong>der</strong> gar<br />
nicht von <strong>der</strong> IBO erfahren, da sie die<br />
Aufgaben und Informationen nicht erreichen.<br />
Ein in diesem Jahr erstmals vergebener<br />
Schulpreis für beson<strong>der</strong>s engagierte Schulen<br />
(siehe Bericht im letzten Newsletter) sowie<br />
beson<strong>der</strong>e Ehrung von betreuenden Lehrern<br />
soll die Unterstützung seitens <strong>der</strong> Betreuer und<br />
Seite 7 von 18
Einrichtungen beson<strong>der</strong>s würdigen und zu<br />
weiterer För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> SchülerInnen<br />
motivieren.<br />
Neben <strong>der</strong> Festlegung <strong>der</strong> Timetables für das<br />
nächste IBO-Jahr fand zum Abschluss noch ein<br />
reger und informativer Austausch <strong>der</strong><br />
Landesbeauftragten über die Tätigkeiten in den<br />
Län<strong>der</strong>n, Landesolympiaden – und Seminare<br />
sowie Anrechnungsmöglichkeiten <strong>der</strong> IBO-<br />
Teilnahme für SchülerInnen statt. Alle waren<br />
sich einig, die IBO-Auswahl in Deutschland<br />
auch in Eckhard Lucius’ Sinne und mit<br />
Unterstützung durch das IPN <strong>der</strong>zeit über die<br />
Leitung <strong>der</strong> Biologie-Didaktik, Prof. Ute Harms,<br />
mit großem Engagement weiter fortzuführen.<br />
14 <strong>der</strong> 16 Landesbeauftragten sowie Dennis Kappei und Christiane Mühle beim Treffen in Magdeburg<br />
Seite 8 von 18
5. Rubrik: Faszination Forschung mit einem Bericht von Dr. Falk Butter<br />
Verän<strong>der</strong>ungen im Erbgut passieren ständig in <strong>der</strong> Natur. Durch Züchtung hat die Menschheit sich<br />
dies zu Nutze gemacht. Die molekulare Ursachen werden jetzt mit hochmo<strong>der</strong>nen Verfahren<br />
erforscht.<br />
Geschmäcker sind verschieden. Mancher mag<br />
es vegetarisch, ein an<strong>der</strong>er Fisch und viele<br />
Verbraucher kaufen Fleisch. Der europäische<br />
Verbraucher bevorzugt seit den 50er Jahren<br />
mageres Schweinefleisch, auch wenn ein<br />
gewisser Fettanteil im Fleisch als<br />
Geschmacksträger benötigt wird. Dies führte in<br />
Europa im Vergleich zu an<strong>der</strong>en Regionen <strong>der</strong><br />
Welt zur Verbreitung von Schweinerassen mit<br />
geringem Fettanteil. Um dies zu erreichen,<br />
verwendeten Landwirte hierzu das<br />
jahrtausendealte Verfahren <strong>der</strong> Züchtung,<br />
wobei Elterntiere mit günstigen Eigenschaften<br />
verpaart werden und gelegentlich<br />
Nachkommen geboren werden, die diese<br />
Eigenschaften vereinen. Während die Züchtung<br />
jedoch auf beobachtbaren Eigenschaften, wie<br />
Grösse, Gewicht, Anzahl <strong>der</strong> Nachkommen o<strong>der</strong><br />
ähnlichem beruht, ist die molekulare Ursache in<br />
den allermeisten Fällen unbekannt. Doch<br />
welche Verän<strong>der</strong>ungen im Erbgut haben den<br />
Muskelanteil in europäischen Schweinerassen<br />
im Vergleich zu an<strong>der</strong>swo gezüchteten<br />
Schweinen erhöht? Ein Mancher würde einfach<br />
sagen: “Klar doch. Wachstumsfaktoren.“ Das<br />
ist richtig. Doch worin liegen die Unterschiede<br />
im Detail?<br />
Um dieser Frage auf den Grund zu gehen,<br />
muss man die Struktur des Erbgutes selbst<br />
untersuchen. Es enthält den Bauplan für jede<br />
einzelne Zelle eines Lebewesens und besteht<br />
aus langkettigen DNA-molekülen, die sich aus<br />
vier verschiedenen Bausteinen (Adenosin,<br />
Cytidin, Guanosin und Thymidin)<br />
zusammensetzen. Diese vier Bausteine in<br />
unterschiedlichster Abfolge ergeben die<br />
genetische Information, vergleichbar mit <strong>der</strong><br />
Speicherung von Daten in einem Computer.<br />
Diese genetischen Informationen werden nicht<br />
willkürlich aktiviert, son<strong>der</strong>n in den einzelnen<br />
Zellen, analog zu Computerprogrammen, in<br />
verschiedenen Routinen ausgeführt. Für die<br />
Regulation <strong>der</strong> genetischen Information<br />
werden Eiweisse benötigt, die an <strong>der</strong><br />
betreffenden Stelle <strong>der</strong> DNA binden.<br />
Erste Untersuchungen haben gezeigt, dass auf<br />
dem DNA-Molekül in <strong>der</strong> Nähe des wichtigen<br />
Wachstumsfaktors IGF2, eine Verän<strong>der</strong>ung<br />
aufgetreten ist, welche sich nur in<br />
europäischen Schweinerassen findet. Anstelle<br />
eines Guanosins, ist hier ein Adenosin<br />
anzutreffen. In Fachkreisen spricht man bei<br />
einer solchen Verän<strong>der</strong>ung von einem<br />
Einzelnukleotidpolymorphimus. Dieser<br />
Unterschied kann dazu führen, dass sich die<br />
Bindung eines Regulationseiweisses an dieser<br />
Stelle in <strong>der</strong> DNA än<strong>der</strong>t.<br />
Um dies zu untersuchen und ein mögliches<br />
Regulationseiweiss zu identifizieren, wurde das<br />
Verfahren <strong>der</strong> Massenspektrometrie<br />
angewendet. Ein Massenspektrometer ist eine<br />
Hochpräzisionswaage, die Massenunterschiede<br />
von einem Milliardstel immer noch exakt<br />
unterscheiden kann. Damit Eiweisse im<br />
Massenspektrometer analysiert werden<br />
können, muss man diese als erstes in kleinere<br />
Fragmente zerlegen. Diese Fragmente können<br />
dann mit einer elektrischen Ladung versehen,<br />
ins Massenspektrometer gesprüht und dort im<br />
Hochvakuum vermessen werden. Die Trennung<br />
und Detektion <strong>der</strong> geladenen Fragmente erfolgt<br />
Seite 9 von 18
dabei mittels elektrischer und magnetischer<br />
Fel<strong>der</strong> aufgrund ihrer Masse und Ladung. Mit<br />
Hilfe von komplexen Computeralgorithmen wird<br />
nach <strong>der</strong> Messung bestimmt, welche<br />
Fragmente in <strong>der</strong> zu untersuchenden Mischung<br />
vorhanden waren und von welchen Proteinen<br />
sie stammen.<br />
Versucht man nun, spezifisch an die DNA<br />
bindende Proteine von zwei verschiedenen<br />
Massenspektrometrieläufen miteinan<strong>der</strong> zu<br />
vergleichen, kann dies mitunter sehr schwierig<br />
sein. Neben Proteinen, welche die exakte<br />
Basenabfolge erkennen, wird das DNA-Molekül<br />
auch von an<strong>der</strong>en Proteinen aufgrund <strong>der</strong><br />
negativen Ladung <strong>der</strong> DNA gebunden. Ein<br />
Vergleich <strong>der</strong> bindenden Eiweisse aus zwei<br />
Proben ist dann aufgrund <strong>der</strong> hohen Anzahl <strong>der</strong><br />
verschiedenen Proteine sehr aufwendig.<br />
Um das Experiment zu vereinfachen, kann man<br />
die bindenden Proteine von beiden DNA-Stellen<br />
während eines einzigen<br />
Massenspektrometrieexperiments direkt durch<br />
ihre Intensität vergleichen. Hierfür wude ein<br />
mo<strong>der</strong>nes Verfahren entwickelt, dass die<br />
Markierung von Eiweissen durch den Einbau<br />
von stabilen Isotopen (im englischen: „Stable<br />
isotope labeling of amino acids in cell culture“<br />
o<strong>der</strong> kurz SILAC) ermöglicht. Bei dieser<br />
Methode werden Zellen ausserhalb des Körpers<br />
in einer Nährflüssigkeit, die alle nötigen<br />
Bestandteile für das Wachstum beinhaltet,<br />
vermehrt. Zu diesen Bestandteilen gehöhren<br />
auch Aminosäuren, die Grundbausteine <strong>der</strong><br />
Eiweiße.<br />
Diese Aminosäuren können entwe<strong>der</strong> zu <strong>der</strong> in<br />
<strong>der</strong> Natur vorkommenden leichten Form<br />
gehören, o<strong>der</strong> eine künstlich erzeugte Variante<br />
mit schwererer Masse sein. Diese synthetischen<br />
schweren Aminosäuren besitzen die gleichen<br />
biochemischen Eigenschaften, können jedoch<br />
im Massenspektrometer aufgrund ihrer<br />
Massendifferenz von <strong>der</strong> leichten Version<br />
unterschieden werden.<br />
Für das Experiment, wird die Zellmembran <strong>der</strong><br />
Zellen aufgebrochen und ein Zellextrakt<br />
gewonnen, <strong>der</strong> unter an<strong>der</strong>em die für uns<br />
interessanten Eiweisse enthält. Während <strong>der</strong><br />
schwere Zellextrakt mit dem Teilstück des<br />
DNA-Moleküls inkubiert wird, das ein Guanosin<br />
enthält, wird <strong>der</strong> leichte Zellextrakt zu dem<br />
gleichen Teilstück gegeben, welches jedoch ein<br />
Adenosin an dieser Stelle besitzt. Die<br />
nichtgebundenen Eiweisse werden abgetrennt<br />
und beide Ansätze jetzt vor dem Messen im<br />
Massenspektrometer vereinigt. Da sich die<br />
Proteine aus dem schweren vom leichten<br />
Zellextrakt in <strong>der</strong> Masse unterscheiden, lassen<br />
sich die bindenden Eiweisse den beiden DNA-<br />
Teilstücken eindeutig zuordnen. Dies<br />
vereinfacht die Bestimmung <strong>der</strong> unterschiedlich<br />
bindenden Eiweisse gegenüber <strong>der</strong> früher<br />
verwendeten Methode erheblich.<br />
Durch diesen neuen Ansatz war es möglich den<br />
Faktor zu identifizieren, <strong>der</strong> durch den<br />
Austausch von Guanosin zu Adenosin an dieser<br />
Stelle des DNA-Molekül nicht mehr binden<br />
kann. Bei diesem Eiweiss handelt es sich um<br />
einen Repressor, also einen negativen<br />
Regulator. Eine Überraschung wurde bei<br />
eingehen<strong>der</strong> Betrachtung dieses Repressors<br />
offenbar. Der identifizierte Regulationsfaktor<br />
war bislang vollständig unbekannt. Grund dafür<br />
ist, dass er nicht von einem klassischem Gen in<br />
<strong>der</strong> Vorstellung vieler Molekularbiologen<br />
stammt, son<strong>der</strong>n aus einem sogenannten<br />
Transposon entstand. Diese „hüpfenden Gene“<br />
nisten sich im Wirtsorganismus ein, um ihr<br />
eigenes Überleben zu sichern. Sie haben dabei<br />
die Fähigkeit Kopien von sich selbst an<br />
beliebigen Stellen im Erbgut zu erstellen.<br />
Wechselwirkungen mit dem Wirtsorganismus<br />
waren bislang kaum bekannt und in den<br />
wenigen bekannten Fällen wird vermutet, dass<br />
Transposons dabei keine positiven<br />
Auswirkungen auf ihren Wirt haben. Das<br />
jedoch in dieser Studie indentifizierte<br />
ursprünglich „hüpfende Gen“ ist jedoch schon<br />
im Erbgut des Wildschweins, also vor <strong>der</strong><br />
menschlichen Züchtung von Hausschweinen,<br />
enthalten und sorgte bereits dort für die<br />
Regulierung des Wachstums, nachdem es seine<br />
Fähigkeit aufgegeben hatte sich selbst zu<br />
kopieren.<br />
Durch Binden des Repressors wird die Menge<br />
des Wachstumsfaktors IGF2 in den<br />
Schweinerassen mit höherem Fettanteil<br />
herunterreguliert. Im Falle <strong>der</strong> muskulöseren<br />
Schweine war <strong>der</strong> Effekt des in <strong>der</strong> Züchtung<br />
entstandenen Einzelnukleotidpolymorphismus,<br />
dass <strong>der</strong> negative Regulator nicht mehr binden<br />
konnte. Dadurch wird mehr vom<br />
Wachstumsfaktor IGF2 produziert, was zu mehr<br />
Seite 10 von 18
Muskelmasse und folglich magererem Fleisch<br />
führt. Der Wunsch des europäischen<br />
Verbrauchers für diese Art von Schweinefleisch<br />
konnte durch gezielte Vermehrung von<br />
Schweinen mit mehr Muskelmasse und folglich<br />
weniger Fettanteil während des Zuchverfahrens<br />
erreicht werden. Molekularbiologisch betrachtet<br />
sind dabei Tiere ausgewählt wurden, bei denen<br />
eine spontane Verän<strong>der</strong>ung von Guanosin zu<br />
Adenosin in <strong>der</strong> Nähe des Wachstumsfaktors<br />
IGF2 aufgetreten ist.<br />
Die Originalarbeit wurde 2009 publiziert [Butter et al. (2009) A domesticated transposon mediates<br />
the effects of a single-nucleotide polymorphism responsible for enhanced muscle growth. EMBO Rep.<br />
11: 305-311) und ist in Zusammenarbeit mit dem IBO-Vereinsmitglied Dennis Kappei entstanden.<br />
Falk Butter legte in Dresden sein Abitur ab und nahm an den Auswahlrunden <strong>der</strong> IBO und IChO teil.<br />
Er studierte Biochemie in Leipzig und schloss Ende letzten Jahres seine Promotion am Max-Planck-<br />
Institut für Biochemie in Martinsried in <strong>der</strong> Gruppe von Matthias Mann mit Auszeichnung ab. Das<br />
übergreifende Thema seiner Forschung ist die Untersuchung von Protein-Nukleinsäure-Interaktionen,<br />
wobei die massenspektrometrische Technik einen Schwerpunkt darstellt. Im Speziellen beschäftigt er<br />
sich neben dem im Artikel dargestellten Thema mit Telomer-bindenden Proteinen.<br />
Falk war von 2003-2006 Schatzmeister des <strong>För<strong>der</strong>verein</strong>s und betreut schon seit mehreren Jahren<br />
FBO-Praktikanten.<br />
Wir sind ihm dafür sehr dankbar.<br />
Vereinsmitglie<strong>der</strong>, welche an einer Masterarbeit o<strong>der</strong> einem Praktikum für mehr als drei<br />
Monate auf dem Gebiet <strong>der</strong> Telomerforschung o<strong>der</strong> dem im Artikel beschriebenen Gebiet<br />
(SNP-spezifische Transkriptionsfaktoren) interessiert sind, wenden sich bitte direkt an<br />
ihn (butter@biochem.mpg.de).<br />
Seite 11 von 18
6. Praktikum: Helgoland, Meeresbiologie, Laura Staschko<br />
1. Einleitung<br />
Schon seit Jahren interessiere ich mich für<br />
Biologie und nehme an verschiedenen<br />
Wettbewerben teil. Im letzten Jahr nahm ich<br />
zum ersten Mal an <strong>der</strong> IBO teil und schaffte es<br />
bis in die 3. Runde. Durch den <strong>För<strong>der</strong>verein</strong> <strong>der</strong><br />
IBO wurde mir dieses Praktikum verliehen.<br />
Das Praktikum fand am Alfred- Wegener<br />
Institut auf Helgoland statt. „Das Alfred-<br />
Wegener-Institut für Polar- und<br />
Meeresforschung erforscht seit mehr als 25<br />
Jahren die Zusammenhänge des weltweiten<br />
Klimas und <strong>der</strong> speziellen Ökosysteme im Meer<br />
und an Land.“ [Zitat:<br />
http://www.awi.de/de/institut/<br />
06.10.2011; 15:56]. Meine Arbeitsgruppe<br />
beschäftigte sich mit Ozeanversauerung und<br />
den Auswirkungen des sinkenden pH-Wertes<br />
auf das Ökosystem Meer.<br />
Durch den sinkenden pH-Wert des Meeres<br />
wird es für Organismen mit Kalkschalen immer<br />
schwerer diese zu bilden o<strong>der</strong> vor <strong>der</strong><br />
Auflösung zu schützen. Die Ozeanversauerung<br />
stellt also eine Gefahr für alle Organismen mit<br />
kalkhaltigen Schalen dar.<br />
Die an<strong>der</strong>e Seite <strong>der</strong> Ozeanversauerung ist<br />
natürlich auch das Mehrangebot an CO₂ für die<br />
Fotosynthese von Algen und Pflanzen.<br />
Wie wirkt sich dieses Überangebot an CO₂ auf<br />
Algenkulturen aus? Wird ihre Population<br />
wachsen o<strong>der</strong> sinken? Än<strong>der</strong>t sich das<br />
stöchiometrische Verhältnis <strong>der</strong> Zellen? Weicht<br />
das Wachstum bei experimentellen<br />
Bedingungen von denen im Tag-Nacht-<br />
Rhythmus ab?<br />
Dies versuchte ich während meines Praktikums<br />
herauszufinden. In verschiedenen<br />
Experimenten untersuchte ich die<br />
Auswirkungen unterschiedlicher CO₂-<br />
Konzentrationen, Än<strong>der</strong>ungen von<br />
Stöchiometrie und Wachstum <strong>der</strong> Alge im Tag-<br />
Nacht Rhythmus.<br />
2. Projektinformationen<br />
Durch den fortschreitendenden Klimawandel<br />
steigt die CO₂-Konzentration nicht nur in <strong>der</strong><br />
Luft son<strong>der</strong>n auch im Meer. Durch dieses<br />
Mehrangebot an CO₂ sinkt <strong>der</strong> pH-Wert. Dieser<br />
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd<br />
dddddddd<br />
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd<br />
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd<br />
dddddd<br />
Prozess wird auch als Ozeanversauerung<br />
bezeichnet. Dieser Begriff fasst mehrere<br />
Prozesse zusammen die bei <strong>der</strong> Reaktion von<br />
CO₂ mit Meerwasser ablaufen.<br />
Seite 12 von 18
Ich habe mich in meinem Praktikum aber nicht<br />
mit den Auswirkungen des sinkenden pH-<br />
Wertes beschäftigt, son<strong>der</strong>n mit den Folgen <strong>der</strong><br />
hohen CO₂ -Konzentration für<br />
Algenpopulationen.<br />
Meine Arbeit lässt sich also grob in das Gebiet<br />
<strong>der</strong> Meeresökologie einordnen. Spezieller auf<br />
das Wachstum von Populationen und<br />
limitierende Faktoren.<br />
Das Wachstum von Algenpopulationen hängt<br />
von <strong>der</strong> Verfügbarkeit von Nährstoffen, Licht<br />
und störenden Stoffwechselprodukten ab.<br />
Während meines Praktikums beschäftigte ich<br />
3. Fazit/Rückblick:<br />
Das Praktikum am Alfred Wegener Institut hat<br />
mir sehr gut gefallen. Ich fand die Arbeit im<br />
Labor sehr spannend und hilfreich um seine<br />
praktischen Fähigkeiten (auch für die IBO) zu<br />
verbessern. Desweiteren half es eine gewisse<br />
Routine im Umgang mit typischen<br />
Laborgeräten (z.B. kalibrierbaren Pipetten) zu<br />
bekommen. Auch in <strong>der</strong> statistischen<br />
Auswertung von Daten konnte ich eine Menge<br />
dazulernen.<br />
mich noch etwas ausführlicher mit<br />
limitierenden Nährstoffen. Als solche kommen<br />
für Algen beson<strong>der</strong>s Stickstoff (N) und<br />
Phosphor (P) in Frage. Das Wachstum von<br />
Populationen wird durch den im Verhältnis am<br />
wenigsten vorhandenen Nährstoff<br />
eingeschränkt (Liebigs Prinzip des Minimums).<br />
Bei unbegrenzter Nährstoffzufuhr benötigt<br />
Phytoplankton pro 1Mol Phosphor, 16 Mol<br />
Stickstoff und 106 Mol Kohlenstoff. Dies wird<br />
als die sogenannte Redfield ratio bezeichnet<br />
(1:16:106).<br />
Mit <strong>der</strong> Arbeitsgruppe in <strong>der</strong> ich gearbeitet<br />
hatte habe ich mich sehr gut verstanden. Sie<br />
waren alle sehr nett und es war auch immer<br />
jemand da den ich um Hilfe bitten konnte,<br />
wenn es Probleme gab. Meine beiden<br />
Betreuer Prof. Maarten Boersma und Dr.<br />
Katherina School standen mir immer mit Rat<br />
und Tat zur Seite, so dass ich mich während<br />
<strong>der</strong> gesamten Zeit meines Praktikums gut<br />
betreut fühlte.<br />
Laura Staschko ist Schülerin des Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium. Sie nimmt dieses Jahr zum zweiten<br />
Mal an <strong>der</strong> IBO teil und hofft nach eigener Aussage „wie<strong>der</strong> in die dritte Runde zu kommen.“ Nach<br />
dem Abitur möchte sie gerne Medizin o<strong>der</strong> Biochemie studieren. Wir wünschen Laura weiterhin viel<br />
Erfolg.<br />
Seite 13 von 18
7. Praktikumsbericht: Max-Planck-Institut für Biochemie, Arbeitsgruppe Proteomics<br />
und Signaltransduktion, Clara Bultmann<br />
Durch den <strong>För<strong>der</strong>verein</strong> <strong>der</strong> <strong>Biologieolympiade</strong><br />
e.V. hatte ich diesen Sommer vom 16.8. bis<br />
zum 9.9. 2011 die Möglichkeit, am Max-Planck-<br />
Institut für Biochemie in <strong>der</strong> Arbeitsgruppe<br />
Proteomics und Signaltransduktion ein<br />
vierwöchiges Praktikum zu absolvieren.<br />
Die Arbeitsgruppe für Proteomics und<br />
Signaltransduktion beschäftigt sich unter<br />
an<strong>der</strong>em mit <strong>der</strong> Identifizierung und<br />
Quantifizierung <strong>der</strong> Proteine in Zellen, sowie<br />
<strong>der</strong>en Interaktionen untereinan<strong>der</strong> sowie mit<br />
DNA o<strong>der</strong> RNA mit Hilfe <strong>der</strong><br />
Massenspektrometrie und an<strong>der</strong>en Verfahren.<br />
Während meines Praktikums sollte ich 15<br />
Proteine darauf untersuchen, ob sie direkt an<br />
Telomere binden. Dabei war schon bekannt,<br />
dass diese Proteine an die Telomersequenz<br />
binden, allerdings wurden die Proteine nicht<br />
einzeln untersucht, sodass man nicht weiß, ob<br />
sie direkt an die Telomersequenz binden<br />
können o<strong>der</strong> nur an ein an<strong>der</strong>es Protein, das<br />
an die Telomersequenz binden kann. Deshalb<br />
musste ich zunächst die Proteine einzeln<br />
herstellen. Dafür habe ich zunächst die Gene,<br />
die für diese Proteine codieren, in<br />
Plasmidvektoren kloniert und in E.coli<br />
vervielfältigt. An dieser Stelle hat allerdings ein<br />
benötigtes Gerät nicht funktioniert, sodass sich<br />
die Weiterarbeit etwas verzögert hat und ich zu<br />
<strong>der</strong> eigentlichen Untersuchung <strong>der</strong> Interaktion<br />
mit <strong>der</strong> Telomersequenz nicht mehr gekommen<br />
bin. Deshalb habe ich stattdessen die Bindung<br />
eines Proteins mit und ohne UV-Bestrahlung an<br />
einen DNA-Schaden, <strong>der</strong> durch ein Medikament<br />
gegen Krebs in Krebszellen hervorgerufen wird<br />
und so zum Absterben dieser Zellen führt,<br />
untersucht.<br />
Als Telomere bezeichnet man repetitive, nicht<br />
codierende DNA-Abschnitte an den Enden<br />
linearer Chromosomen. Telomere erfüllen<br />
einige wichtige Aufgaben: Zum einen schützen<br />
sie die genetische Information, da bei je<strong>der</strong><br />
Replikation <strong>der</strong> DNA ein Stück an den Enden<br />
<strong>der</strong> Chromosomen verloren geht. Dank <strong>der</strong><br />
Telomere geht allerdings nur Länge verloren<br />
und keine wichtigen Informationen. Wenn nach<br />
vielen Zellteilungen und den damit<br />
einhergehenden Replikationen <strong>der</strong><br />
Chromosomen die Telomere eine bestimmte<br />
Länge unterschreiten, wird entwe<strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
Zellzyklus angehalten o<strong>der</strong> sogar <strong>der</strong><br />
programmierte Zelltod (Apoptose) eingeleitet.<br />
Eine weitere wichtige Aufgabe <strong>der</strong> Telomere<br />
einschließlich <strong>der</strong> daran bindenden Proteine ist<br />
es, die Enden <strong>der</strong> Chromosomen vor dem<br />
Kontrollsystem <strong>der</strong> Zelle zu tarnen, da dieses<br />
sie sonst als DNA-Doppelstrangbrüche<br />
erkennen würde.<br />
Insgesamt hat mir die Arbeit im Labor sehr gut<br />
gefallen und ich habe vor allem in praktischer,<br />
aber auch in theoretischer Hinsicht viel gelernt,<br />
was mir im Studium und im Beruf sicher<br />
weiterhelfen wird. Außerdem habe ich einen<br />
guten Einblick in wissenschaftliches Arbeiten<br />
und den Laboralltag bekommen und eine<br />
gewisse Routine bei <strong>der</strong> Laborarbeit erlangt.<br />
Für den freundlichen Umgang möchte ich mich<br />
nochmals bei <strong>der</strong> ganzen Arbeitsgruppe<br />
bedanken, beson<strong>der</strong>s bei meinem Betreuer Falk<br />
Butter und bei Marion Scheibe, die die<br />
Betreuung an zwei Tagen übernommen hat.<br />
Auch bei dem <strong>För<strong>der</strong>verein</strong> <strong>der</strong> Biologie<br />
Olympiade e.V. möchte ich mich bedanken, da<br />
er mir dieses Praktikum ermöglicht hat.<br />
Clara besucht die elfte Klasse des Adolf-Schmitthenner Gymnasium in Neckarbischofsheim. Sie ist im<br />
letzten Jahr durch ihr Schule auf die IBO aufmerksam geworden und hat es gleich bis in die vierte<br />
Runde geschafft. Nach dem Abitur möchte sie „auf jeden Fall etwas machen, dass mit Biologie zu tun<br />
hat, wahrscheinlich Molekularbiologie o<strong>der</strong> Biochemie. Wir wünschen Clara weiterhin alles Gute und<br />
viel Erfolg dabei.<br />
Seite 14 von 18
8. Praktikumsbericht: Max-Planck-Institut für Pflanzenphysiologie Arbeitsgruppe<br />
von Prof. Krajinski von Eva Kúbicova<br />
Von dem <strong>För<strong>der</strong>verein</strong> <strong>der</strong> Internationalen<br />
BiologieOlympiade.V. erhielt ich die<br />
Möglichkeit, ein vierwöchiges Praktikum am<br />
Max-Planck-Institut für molekulare<br />
Pflanzenphysiologie in Golm zu absolvieren.<br />
Ich wurde <strong>der</strong> Arbeitsgruppe von Prof.<br />
Krajinski zugeteilt, die sich mit <strong>der</strong><br />
arbuskulären Mykorrhizasymbiose (AM-<br />
Symbiose) beschäftigt. Hier wird die<br />
Leguminose Medicago truncatula als<br />
Modelpflanze und Glomusintra radices als<br />
Mykorrhizapilz verwendet.<br />
Mykorrhiza ist eine Form <strong>der</strong> Symbiose<br />
zwischen einer Pflanze und einem Pilz. Der Pilz<br />
bekommt von <strong>der</strong> Pflanze Assimilate und<br />
versorgt dafür die Pflanze mit Nährstoffen,<br />
v.a. mit Phosphaten und Nitraten. Bei <strong>der</strong> AM-<br />
Symbiose bildet <strong>der</strong> Pilz Hyphen, die die<br />
Gefäße <strong>der</strong> Pflanze durchdringen und<br />
baumartige Strukturen, sog. Arbuskeln, bilden.<br />
Dadurch wird <strong>der</strong> Stoffaustausch zwischen <strong>der</strong><br />
Pflanze und dem Pilz ermöglicht.<br />
Während meines Praktikums untersuchte ich<br />
die Unterschiede zwischen mykorrhizierten<br />
und nicht mykorrhizierten Pflanzen und den<br />
Einfluss des Phosphatgehalts im Boden auf die<br />
Mykorrhiza. In <strong>der</strong> restlichen Zeit bekam ich<br />
von verschieden Mitglie<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Arbeitsgruppe<br />
kleinere Aufgaben, sodass ich viele neue<br />
Erfahrungen im Bereich <strong>der</strong> Molekularbiologie<br />
sammeln konnte.<br />
Für die Untersuchungen wurden die Pflanzen<br />
(20 Stück) zuerst geerntet, mikroskopiert und<br />
bei -80°C eingefroren. Danach wurden sie<br />
gemörsert, bis ein feines Pulver entstand.<br />
Weiterhin wurde <strong>der</strong> Phosphatgehalt in den<br />
Pflanzen mithilfe von zwei verschieden<br />
Messverfahren bestimmt - mit <strong>der</strong><br />
Ionenchromatographie und mit <strong>der</strong><br />
Extinktionsmessung von gelöstem Phosphat.<br />
Es wurde ebenfalls rRNA aus den Wurzeln <strong>der</strong><br />
Pflanzen extrahiert und anschließend die qRT-<br />
PCR (quantitative real-time Polymerase-<br />
Kettenreaktion) durchgeführt, um<br />
herauszufinden, welche Gene bei <strong>der</strong> AM-<br />
Symbiose vermehrt exprimiert bzw. bei<br />
welchen Genen die Expression unterdrückt<br />
Abbildung 1: Arbuskeln in <strong>der</strong> Wurzel,<br />
Fluoreszenzmikroskop-Aufnahme<br />
Seite 15 von 18
wird. Bei dieser Art von PCR kann zusätzlich<br />
die relative Menge an Transkript bestimmt<br />
werden.<br />
Aus den Messungen des Phosphats ergab sich,<br />
dass bei den mykorrhizierten und nicht<br />
mykorrhizierten Pflanzen, die mit Phosphat<br />
gegossen wurden, keine großen Unterschiede<br />
im Phosphatgehalt zu erkennen waren (+P<br />
+myc: 18,38 · 10 -2 mg P/g Frischgewicht, +P -<br />
myc: 18,16 · 10 -2 g P/mg FG). Bei Pflanzen, die<br />
nur mit reinem Wasser ohne Phosphat<br />
gegossen wurden, weichen die<br />
Phosphatgehalte jedoch voneinan<strong>der</strong> ab (-P<br />
+myc: 8,71 · 10 -2 g P/mg FG, -P -myc: 6,50 ·<br />
10 -2 g P/mg FG). Dies ist dadurch zu erklären,<br />
dass die Mykorrhiza erst bei niedrigen<br />
Phosphatgehalten im Boden begünstigt und<br />
stärker ausgebildet wird.<br />
Durch qRT-PCR wurde ermittelt, wie stark die<br />
Expression verschiedener Gene in den<br />
mykorrhizierten und nicht mykorrhizierten<br />
Pflanzen ist. Bei zwei Primern war die Menge<br />
an Transkript bei den mykorrhizierten Pflanzen<br />
erhöht und bei den nicht mykorrhizierten<br />
Pflanzen lag sie bei null. Diese Primer können<br />
später dafür verwendet werden, um<br />
festzustellen, ob und wie stark eine Pflanze<br />
mykorrhiziert ist.<br />
Ich sammelte während des Praktikums<br />
wertvolle Erfahrungen und lernte vieles Neues,<br />
hatte aber auch viel Spaß. Weiterhin bekam<br />
ich einen Einblick in die Grundlagenforschung.<br />
Dies bestärkte mich darin, nach dem Studium<br />
in <strong>der</strong> Forschung tätig sein zu wollen.<br />
Außerdem lernte ich viele neue interessante<br />
Menschen kennen und erkundete in <strong>der</strong><br />
Freizeit Potsdam und Umgebung. Zum Schluss<br />
möchte ich mich beim Verein <strong>der</strong><br />
Internationalen BiologieOlympiade e.V. dafür<br />
bedanken, dass er mir dieses Praktikum<br />
ermöglichte.<br />
Eva Kúbicova ist eine talentierte Schülerin des Carl-Zeiss Gymnasium Jena. Sie nahm 2010 erfolgreich<br />
an <strong>der</strong> dritten Auswahlrunde <strong>der</strong> 21. IBO teil. 2011 erreichte Sie die vierte Auswahlrunde. Wir<br />
wünschen Eva für ihr Abitur und ihre weitere biologische Laufbahn alles Gute.<br />
Seite 16 von 18
9. Praktikumsbericht: Bernhardt-Nocht Institut für Tropenmedizin Hamburg,<br />
ein Bericht von Utz Ermel<br />
Seit meinem ersten Kontakt mit den Themen<br />
<strong>der</strong> Molekularbiologie durch die<br />
Landesbiologieolympiade Brandenburg<br />
begeisterten mich die fein abgestimmten<br />
Prozesse in Zellen und die Leichtigkeit mit <strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Mensch heutzutage darauf einwirken kann.<br />
Daher war ich auch immer sehr interessiert in<br />
diesem Gebiet <strong>der</strong> Biologie praktisch zu<br />
arbeiten. Deshalb erfolgte meine Bewerbung<br />
für das vierwöchige Praktikum am Bernhard-<br />
Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg,<br />
die zu meiner Freude angenommen wurde.<br />
Schon zu Beginn <strong>der</strong> Sommerferien konnte ich<br />
es kaum erwarten, endlich vom 18.7. bis<br />
12.08.2011 nach Hamburg zu fahren. Ich<br />
wurde als Praktikant von einem PhD-Studenten<br />
aus einer Malaria-Arbeitsgruppe betreut und<br />
half bei Arbeiten im Labor.<br />
Das Ziel <strong>der</strong> Arbeit, die <strong>der</strong> Leiter <strong>der</strong><br />
Arbeitsgruppe für meine Praktikumszeit<br />
veranschlagt hatte, war die Herstellung eines<br />
Plasmids mit an<strong>der</strong>en Resistenz- und<br />
Fluoreszenzeigenschaften als den bisherigen<br />
Vorhandenen. Dieser neue Vektor sollte zur<br />
Untersuchung <strong>der</strong> Lokalisation von Proteinen<br />
an verschiedenen Stellen in den Zellen <strong>der</strong><br />
Trophozoitenstadien <strong>der</strong> Malariaerreger dienen.<br />
Im Speziellen ging es dabei um Proteine, die<br />
für Endocytosevorgänge in <strong>der</strong> Zelle wichtige<br />
waren. Da die Malariaerreger in diesem<br />
Stadium <strong>der</strong> Krankheit in den Blutzellen leben<br />
und sich von endocytotisch eingeschlossenem<br />
Hämoglobin ernähren, bietet dieser Vorgang<br />
eine Bekämpfungsmöglichkeit und ist damit für<br />
Molekularbiologen interessant. Das Plasmid,<br />
sollte statt dem in <strong>der</strong> Ausgangsversion<br />
enthaltenen Fluoreszenzmarkers green<br />
fluorescent protein den Farbstoff mcherry<br />
enthalten. Außerdem musste eine neue<br />
Resistenz ersetzend für die Bestehende<br />
eingefügt werden, um später die Selektion<br />
doppelt transgener Zellen zu ermöglichen. Um<br />
diese Aufgabe zu erfüllen klonierte ich<br />
nacheinan<strong>der</strong> zuerst den Fluoreszenzmarker<br />
und dann den Selektionsmarker in den Plasmid<br />
klonieren. Für die zugehörige PCR hatte mein<br />
Betreuer bereits Primer vorbereitet und<br />
bestellt, die allerdings fehlerhaft waren und so<br />
dafür sorgten, dass ein Stopcodon zwischen<br />
Fluoreszensmarker und dem betrachteten Gen<br />
eingefügt wurde. Nach Bestellung neuer Primer<br />
setzten wir die Arbeit fort. Ich wurde in die<br />
Benutzung von Internettools und Programmen<br />
zur Planung von Restriktionschnitten und zur<br />
Analyse von Sequenzierungsergebnissen<br />
eingeführt, sodass ich diese während späterer<br />
Schritte selber benutzen konnte. Außerdem<br />
lernte ich die vielen, teilweise zeitaufwändigen<br />
Zwischenschritte bei <strong>der</strong> Klonierung kennen,<br />
die sonst nirgendwo in Abbildungen<br />
auftauchen. Lei<strong>der</strong> konnte ich in den vier<br />
Wochen das Plasmid nicht mehr in<br />
Malariaerreger einbringen bzw. solche, die das<br />
Plasmid enthalten unter dem<br />
Fluoreszenzmikroskop betrachten, da die Zeit<br />
dafür nicht ausreichte.<br />
Neben <strong>der</strong> Herstellung des Plasmids, die wie<br />
gesagt bis zum Ende <strong>der</strong> vier Wochen dauerte,<br />
da mehrere Gene eingebaut werden mussten,<br />
beschäftigte ich mich außerdem mit einer<br />
Verwandtschaftsanalyse <strong>der</strong> EHD-Proteinfamilie<br />
und erstellte dazu ein Kladogramm, das sich<br />
aus dem Vergleich <strong>der</strong> Proteinsequenzen ergab<br />
und lernte so mit Sequenzdatenbaken<br />
umzugehen. Außerdem führte einige Arbeiten<br />
durch, die nichts mit meiner eigentlichen<br />
Aufgabe zu tun hatten, mich aber persönlich<br />
interessierten, wie zum Beispiel einen Western<br />
Seite 17 von 18
Blot und konnte an einem<br />
Fluoreszenzmikroskop arbeiten und mir die<br />
sterilen Arbeitsbänke auf denen mit den<br />
Malariaerregern gearbeitet wurde anschauen.<br />
Durch dieses sehr interessante Praktikum<br />
konnte ich einen für mich sehr prägenden<br />
Eindruck <strong>der</strong> Wissenschaftswelt gewinnen.<br />
Beson<strong>der</strong>s gefallen hat mir, dass ich in <strong>der</strong><br />
Lage war, Arbeitstechniken, wie die PCR,<br />
Gelelektrophorese und Western Blotting, von<br />
denen ich bisher nur in Lehrbüchern gelesen<br />
hatte, selbst durchzuführen. Durch die<br />
wöchentlichen Besprechungen <strong>der</strong><br />
Arbeitsgruppe, an denen ich teilnehmen durfte<br />
und die auf Englisch abgehalten wurden und<br />
die Publikationen, die ich in Vorbereitung<br />
gelesen habe, wurde mir die Wichtigkeit <strong>der</strong><br />
englischen Sprache bewusst und ich musste<br />
lernen, dass man als Wissenschaftler auch mit<br />
Rückschlägen leben muss, da ich Arbeit durch<br />
fehlerhafte Planung einige Male wie<strong>der</strong>holen<br />
musste. Das Praktikum hat mir sehr viel Spaß<br />
gemacht und außerdem die Möglichkeit<br />
gegeben, eine neue Stadt kennenzulernen.<br />
Utz Ermel ist Schüler des Carl-Friedrich Gauß Gymnasium Frankfurt (O<strong>der</strong>). Er ist mehrfacher Sieger<br />
<strong>der</strong> Landesbiologie Olympiade Brandenburg. 2011 nahm er erfolgreich an <strong>der</strong> vierten Auswahlrunde<br />
zur 22. IBO teil. Utz ist seit diesem Jahr Mitglied unseres Vereins. Für sein Abitur und seien weitere<br />
biologische Laufbahn wünschen wir ihm alles Gute.<br />
Seite 18 von 18