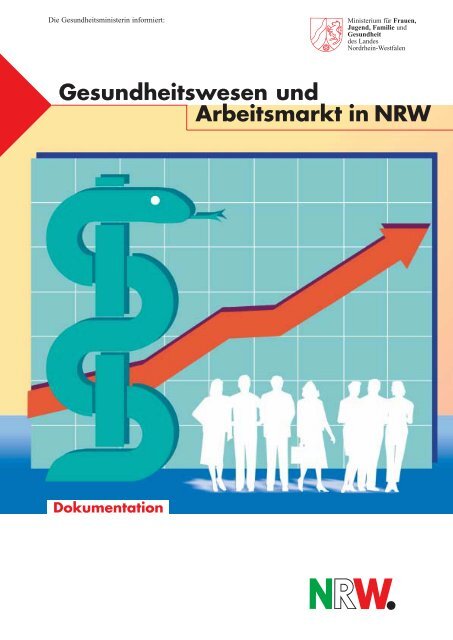Gesundheitswesen und Arbeitsmarkt in Nordrhein ... - QuePNet
Gesundheitswesen und Arbeitsmarkt in Nordrhein ... - QuePNet
Gesundheitswesen und Arbeitsmarkt in Nordrhein ... - QuePNet
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die Ges<strong>und</strong>heitsm<strong>in</strong>ister<strong>in</strong> <strong>in</strong>formiert:<br />
M<strong>in</strong>isterium für Frauen,<br />
Jugend, Familie <strong>und</strong><br />
Ges<strong>und</strong>heit<br />
des Landes<br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Arbeitsmarkt</strong> <strong>in</strong> NRW<br />
Dokumentation
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> <strong>und</strong> <strong>Arbeitsmarkt</strong><br />
<strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V.,<br />
Institut für Gerontologie an der Universität Dortm<strong>und</strong> (FfG)<br />
Institut Arbeit <strong>und</strong> Technik, Gelsenkirchen,<br />
Abteilung Dienstleistungssysteme (IAT)<br />
Mediz<strong>in</strong>ische Hochschule Hannover,<br />
Abteilung Epidemiologie, Sozialmediz<strong>in</strong><br />
<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitssystemforschung (MHH)<br />
Studie<br />
im Auftrag<br />
des M<strong>in</strong>isteriums für Frauen, Jugend, Familie <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit<br />
des Landes Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen
Vorwort<br />
Mit dieser Studie „<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> <strong>und</strong> <strong>Arbeitsmarkt</strong><br />
<strong>in</strong> NRW“ wird die erste detaillierte<br />
Längsschnittaufarbeitung der Ausbildungs- <strong>und</strong><br />
Beschäftigungsentwicklung für die Kernbereiche<br />
der ges<strong>und</strong>heitlichen Versorgung <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen für die Zeit von 1985 bis 1998/99 vorgelegt.<br />
Die Ergebnisse weisen vor allem auf die besondere<br />
wirtschafts- <strong>und</strong> arbeitsmarktpolitische Bedeutung<br />
der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft als größter<br />
Wirtschaftsbranche mit 957.280 Beschäftigten<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>em Anteil von 12,6 % an den Erwerbstätigen<br />
<strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen h<strong>in</strong>.<br />
Die e<strong>in</strong>zelnen Sektoren der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft<br />
werden <strong>in</strong> ihrer Entwicklung seit Mitte der<br />
80er-Jahre dargestellt; <strong>in</strong> diesem Zusammenhang<br />
werden erste strukturelle Verschiebungen von<br />
der stationären Versorgung zu Gunsten der ambulanten<br />
Versorgung deutlich. Insgesamt zeigt<br />
sich, dass der notwendige Strukturwandel <strong>in</strong><br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen h<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>er Dienstleistungsgesellschaft<br />
<strong>in</strong> den letzten 15 Jahren entscheidend<br />
von der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft mitgetragen<br />
worden ist.<br />
Das Qualifikationsniveau der Beschäftigten ist<br />
im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen<br />
sehr hoch. Das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> bietet vor allem<br />
für Frauen qualifizierte Berufsmöglichkeiten.<br />
Der Wissenstransfer zwischen Hochschulen<br />
<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>richtungen aller Versorgungsbereiche<br />
<strong>in</strong> den Regionen hat <strong>in</strong> dem<br />
genannten Zeitraum wesentlich zur Weiterentwicklung<br />
der Versorgungs<strong>in</strong>frastruktur <strong>und</strong> der<br />
Versorgungsqualität sowie zur Unterstützung<br />
neuer Produktionsbereiche beigetragen, vor<br />
allem im Bereich der Mediz<strong>in</strong>technik.<br />
Ich gehe davon aus, dass die Ergebnisse dieser<br />
Studie e<strong>in</strong>er konstruktiven politischen Me<strong>in</strong>ungsbildung<br />
mit dem Ziel der Weiterentwicklung<br />
der Infrastruktur des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s<br />
dienen <strong>und</strong> zur Popularisierung der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft<br />
als bedeutsamer Wirtschafts- <strong>und</strong><br />
Innovationsbranche <strong>in</strong> unserem Lande beitragen<br />
werden.<br />
Birgit Fischer<br />
M<strong>in</strong>ister<strong>in</strong> für Frauen, Jugend,<br />
Familie <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit<br />
des Landes Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen
1. EINFÜHRUNG UND ZUSAMMENFASSUNG 1<br />
Frerich Frerichs, Ra<strong>in</strong>er Fretschner, Josef Hilbert, Christiane Rohleder,<br />
Günter Roth, Matthias Wismar, Markus Wörz<br />
2. ENTWICKLUNG VON AUSBILDUNG UND BESCHÄFTIGUNG IM<br />
GESUNDHEITSWESEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN 9<br />
Ra<strong>in</strong>er Fretschner, Josef Hilbert, Christiane Rohleder, Günter Roth, Matthias Wismar,<br />
Markus Wörz, Malte Erbrich<br />
2.1. Auszubildende <strong>in</strong> den akademischen <strong>und</strong> nichtakademischen Ges<strong>und</strong>heitsberufen 10<br />
2.1.1. Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s 11<br />
2.1.2. Berufsbildende Schulen 15<br />
2.1.3. Hochschulen <strong>und</strong> Universitäten 17<br />
2.1.3.1. Fachhochschul- <strong>und</strong> Aufbaustudiengänge <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen 20<br />
2.1.4. Zusammenfassung 21<br />
2.2. Stationäre mediz<strong>in</strong>ische Versorgung 22<br />
2.2.1. Allgeme<strong>in</strong>e Krankenhäuser, sonstige Krankenhäuser sowie Vorsorge- <strong>und</strong><br />
Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen (1991 bis 1998) 23<br />
2.2.1.1. Allgeme<strong>in</strong>e Krankenhäuser (1991 – 1998) 24<br />
2.2.1.2. Sonstige Krankenhäuser (1991 – 1998) 30<br />
2.2.1.3. Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen (1991 – 1998) 31<br />
2.2.2. Akut- <strong>und</strong> Sonderkrankenhäuser (1965 – 1989) 34<br />
2.2.2.1. Akutkrankenhäuser (1965 – 1989) 35<br />
2.2.2.2. Sonderkrankenhäuser (1975 – 1989) 37<br />
2.2.3. Zusammenfassung <strong>und</strong> Interpretation 38<br />
2.3. Ambulante Ges<strong>und</strong>heitsversorgung 42<br />
2.3.1. Ärztliche <strong>und</strong> zahnärztliche Praxen 42<br />
2.3.2. Praxen nichtärztlicher Heilhilfsberufe 46<br />
2.3.3. Apotheken 51<br />
2.3.4. Zusammenfassung <strong>und</strong> Interpretation 53<br />
2.4. Beschäftigung <strong>in</strong> Altenhilfe <strong>und</strong> -pflege 54<br />
2.4.1. Datenlage 54<br />
2.4.2. Deskription 56<br />
2.4.3. Zwischenfazit 63<br />
2.5. Sonstige Beschäftigungsbereiche im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> 69<br />
2.5.1. Untere Ges<strong>und</strong>heitsbehörden<br />
2.5.2. Sonstige E<strong>in</strong>richtungen im öffentlichen Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Arbeitsschutz sowie der<br />
69<br />
öffentlichen Ges<strong>und</strong>heitsverwaltung 70<br />
2.5.3. Krankentransporte <strong>und</strong> Rettungsdienste 72<br />
2.5.4. Ges<strong>und</strong>heitsverwaltung 72<br />
2.5.4.1. Gesetzliche <strong>und</strong> private Krankenversicherungen 72
2.5.4.2. Gesetzliche Renten- <strong>und</strong> Unfallversicherung 73<br />
2.5.4.3. Organisationen der Leistungserbr<strong>in</strong>ger 74<br />
2.5.5. Ausbildungsstätten 74<br />
2.6. Zuliefer- <strong>und</strong> Nachbarbranchen 76<br />
2.6.1. Health Care Industrien 77<br />
2.6.1.1. Pharmazeutische Industrie 77<br />
2.6.1.2. Mediz<strong>in</strong>technik 79<br />
2.6.1.3. Biotechnologie 80<br />
2.6.1.4. Groß- <strong>und</strong> Fache<strong>in</strong>zelhandel mit mediz<strong>in</strong>ischen Produkten 81<br />
2.6.2. Ges<strong>und</strong>heitshandwerk 82<br />
2.6.3. Fitness <strong>und</strong> Freizeit 83<br />
2.6.4. Wellness- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitstourismus 85<br />
2.6.5. Beratung, Consult<strong>in</strong>g <strong>und</strong> Information 88<br />
2.6.6. Service-Dienstleistungen für mehr Lebensqualität 88<br />
2.6.7. Selbsthilfe 89<br />
2.6.8. Zusammenfassung <strong>und</strong> Interpretation 89<br />
2.7. Exkurs: Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> 91<br />
2.7.1. Qualifikation, E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> Aufstiegschancen 93<br />
2.8. Die Bedeutung der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft im Kontext der Nordrhe<strong>in</strong>-Westfälischen<br />
Gesamtwirtschaft 96<br />
3. EINFLUSSFAKTOREN AUF DIE BESCHÄFTIGUNGSENTWICKLUNG IN<br />
NORDRHEIN-WESTFALEN 99<br />
Günter Roth, Matthias Wismar<br />
3.1. E<strong>in</strong>führung, methodische Vorbemerkungen <strong>und</strong> Übersicht 99<br />
3.1.1. Sozialer, ökonomischer <strong>und</strong> kultureller Wandel 103<br />
3.1.2. Rechtliche <strong>und</strong> politisch-adm<strong>in</strong>istrative E<strong>in</strong>flüsse 104<br />
3.1.2.1. Qualität <strong>und</strong> Bedarfsdeckung 106<br />
3.1.2.2. Kostendämpfungspolitik 107<br />
3.1.2.3. Arbeitsrecht 109<br />
3.1.3. Mediz<strong>in</strong>isch-technischer Fortschritt 109<br />
3.1.3.1. Produkt<strong>in</strong>novationen 110<br />
3.1.3.2. Prozess<strong>in</strong>novationen 111<br />
3.1.3.3. Professionalisierung 111<br />
4. ANNAHMEN ÜBER ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNGSPFADE UND<br />
BESCHÄFTIGUNGSPERSPEKTIVEN DES GESUNDHEITSWESENS IN<br />
NORDRHEIN-WESTFALEN 114<br />
Ra<strong>in</strong>er Fretschner, Josef Hilbert, Christiane Rohleder, Günter Roth, Matthias Wismar,<br />
Markus Wörz
4.1. Allgeme<strong>in</strong>e Entwicklungstrends: Sozio-demographische, kulturelle <strong>und</strong> ökonomische<br />
Entwicklung 114<br />
4.2. Endogene Entwicklungstrends: Prozess- <strong>und</strong> Produkt<strong>in</strong>novationen, Vernetzung <strong>und</strong><br />
Integration sowie Professionalisierung 117<br />
4.3. Prognose der zukünftigen Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> der nordrhe<strong>in</strong>-westfälischen<br />
Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft bis 2015 119<br />
4.3.1. Prognose der zukünftigen Beschäftigungsentwicklung im ambulanten Sektor 119<br />
4.3.2. Prognose der zukünftigen Beschäftigungsentwicklung im stationären Sektor 123<br />
4.3.2.1. Prognose allgeme<strong>in</strong>e Krankenhäuser 123<br />
4.3.2.2. Prognose Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen 128<br />
4.3.2.3. Prognose sonstige Krankenhäuser 130<br />
4.3.3. Prognose der Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> der Altenhilfe <strong>und</strong> -pflege<br />
4.3.4. Prognose der zukünftigen Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> den Zuliefer<strong>in</strong>dustrien <strong>und</strong><br />
131<br />
Nachbarbranchen 133<br />
4.3.5. Prognose der Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong>sgesamt 136<br />
5. ANHANG 137<br />
5.1. Regionale Entwicklungspotenziale <strong>und</strong> –perspektiven 137<br />
5.1.1. Profil <strong>und</strong> Perspektiven der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft im Rhe<strong>in</strong>land<br />
Michael Neitzel<br />
137<br />
5.1.1.1. Strukturen der ambulanten <strong>und</strong> stationären Ges<strong>und</strong>heitsversorgung im Rhe<strong>in</strong>land 138<br />
5.1.1.2. Regionale Besonderheiten des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s im Rhe<strong>in</strong>land 140<br />
5.1.2. Profil <strong>und</strong> Perspektiven für Ostwestfalen-Lippe: Brückenschläge auf dem Weg zur<br />
vernetzten Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft<br />
Uwe Borchers, Brigitte Meier<br />
150<br />
5.1.2.1. Das Profil der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft <strong>in</strong> Ostwestfalen-Lippe 151<br />
5.1.2.2. Zukunftsregion für ges<strong>und</strong>heitswirtschaftliche Vernetzung: Handlungsfelder <strong>und</strong><br />
Entwicklungsperspektiven bis 2010 156<br />
5.1.2.3. Fazit: Regionales Innovationspotenzial <strong>und</strong> Herausforderungen für die<br />
Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft Ostwestfalen-Lippe 160<br />
5.1.3. Profil <strong>und</strong> Perspektiven der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft im Ruhrgebiet<br />
Ruth Kampherm, Sab<strong>in</strong>e Lange<br />
162<br />
5.1.3.1. Profil des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s im Ruhrgebiet 162<br />
5.1.3.2. Perspektiven für das Ruhrgebiet 169<br />
5.2. Fallstudie: Beschäftigungsentwicklung im niederländischen <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> 172<br />
Anja Hartmann, Toon Kerkhoff<br />
5.2.1. Versicherungs- <strong>und</strong> Versorgungsstrukturen 173<br />
5.2.2. Ges<strong>und</strong>heitspolitische Regulierung <strong>und</strong> Reformstrategien 175<br />
5.2.3. Beschäftigungsentwicklung im niederländischen <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> 179<br />
5.2.3.1. E<strong>in</strong> Überblick: Beschäftigungsentwicklung im Zuge der Kostendämpfung 180<br />
5.2.3.2. Ambulante <strong>und</strong> kl<strong>in</strong>ische Ges<strong>und</strong>heits<strong>in</strong>stitutionen 183<br />
5.2.3.3. Ambulante <strong>und</strong> kl<strong>in</strong>ische Pflege<strong>in</strong>stitutionen 186<br />
5.2.3.4. Mental healthcare <strong>und</strong> Public Health 189<br />
5.2.4. Zusammenfassung 191
5.3. Tabellenanhang 194<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Tabellenverzeichnis<br />
5.4. Literaturverzeichnis 218
E<strong>in</strong>führung <strong>und</strong> Zusammenfassung<br />
1. E<strong>in</strong>führung <strong>und</strong> Zusammenfassung<br />
Frerich Frerichs (FfG), Ra<strong>in</strong>er Fretschner (IAT), Josef Hilbert (IAT), Christiane Rohleder (FfG),<br />
Günter Roth (FfG), Matthias Wismar (MHH), Markus Wörz (MHH)<br />
E<strong>in</strong>führung<br />
Im Dezember 1999 ist die Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V., Institut für Gerontologie an<br />
der Universität Dortm<strong>und</strong> vom M<strong>in</strong>isterium für Frauen, Jugend, Familie <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit des Landes<br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen beauftragt worden, e<strong>in</strong>e Studie zu dem Thema “<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> <strong>und</strong> <strong>Arbeitsmarkt</strong><br />
<strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen“ durchzuführen.<br />
Ziel dieser Studie ist es, e<strong>in</strong>e Darstellung <strong>und</strong> Analyse der arbeitsmarktpolitischen Entwicklung im<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> nach Versorgungsbereichen vorzunehmen. Des weiteren soll e<strong>in</strong>e Darstellung <strong>und</strong><br />
Analyse der Nachfrageentwicklung von Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistungen <strong>in</strong> den sog. Kernbereichen (ambulanter<br />
<strong>und</strong> stationärer Sektor, Pflege <strong>und</strong> Ausbildung) <strong>und</strong> den sog. Schalenbereichen (Zuliefer<strong>in</strong>dustrien<br />
<strong>und</strong> Nachbarbranchen wie Ges<strong>und</strong>heitstourismus, Sport- <strong>und</strong> Freizeitangebote <strong>in</strong>cl. Wellness)<br />
erfolgen.<br />
Die vorliegende Studie “<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> <strong>und</strong> <strong>Arbeitsmarkt</strong> <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen” ist <strong>in</strong> geme<strong>in</strong>samer<br />
Verantwortung des Institutes für Gerontologie an der Universität Dortm<strong>und</strong> (FfG), des Institutes<br />
Arbeit <strong>und</strong> Technik Gelsenkirchen (IAT) <strong>und</strong> der Mediz<strong>in</strong>ischen Hochschule Hannover (MHH) verfasst<br />
worden. Die Projektleitung erfolgte durch Dr. Frerich Frerichs (FfG) <strong>und</strong> Dr. Josef Hilbert (IAT).<br />
Die Kapitel 2 <strong>und</strong> 4 liegen <strong>in</strong> geme<strong>in</strong>samer Autorenschaft von FfG, IAT <strong>und</strong> MHH. Das Kapitel 3<br />
wurde von MHH <strong>und</strong> FfG verfasst. Die Regionalstudien im Anhang sowie die Fallstudie zum <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
<strong>in</strong> den Niederlanden liegen <strong>in</strong> jeweiliger Verantwortung der Autor<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Autoren<br />
von der Ruhruniversität Bochum <strong>und</strong> der Universität Twente sowie dem Kommunalverband Ruhrgebiet,<br />
des Instituts für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- <strong>und</strong> Regionalentwicklung GmbH<br />
an der Ruhr-Universität Bochum <strong>und</strong> des Zentrums für Innovation <strong>in</strong> der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft<br />
Ostwestfalen-Lippe <strong>in</strong> Bielefeld. Nicht unerwähnt bleiben soll die hilfreiche Mitarbeit von Pawel<br />
Dejtrowski, Stefan Herbst, Thomas Rhiemeier, Diana Herbst, Frank Teichmann, Michaela Evans <strong>und</strong><br />
Mathias Gerz.<br />
Zusammenfassung<br />
Die Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft zählt zu den größten Branchen des Landes Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen. Ende der<br />
90er Jahre arbeiteten hier ca. 957.000 Beschäftigte. Dabei kann der Ges<strong>und</strong>heitssektor - im Gegensatz<br />
zu vielen anderen Wirtschaftszweigen - auf e<strong>in</strong>e außerordentlich positive Beschäftigungsentwicklung<br />
- 1 -
E<strong>in</strong>führung <strong>und</strong> Zusammenfassung<br />
zurückblicken: Zwischen 1985 <strong>und</strong> 1998 s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> dieser Branche gut 175.000 neue Arbeitsplätze entstanden,<br />
dies entspricht e<strong>in</strong>er Wachstumsrate von r<strong>und</strong> 22,4%.<br />
Diese positive Beschäftigungsentwicklung ist im Wesentlichen auf drei Ursachenkomplexe zurückzuführen:<br />
Erstens haben soziodemographische Entwicklungen, u.a. durch die Zunahme der Altenbevölkerung<br />
<strong>und</strong> durch Individualisierungstendenzen, den Beschäftigungszuwachs mit verursacht. Zweitens<br />
s<strong>in</strong>d starke E<strong>in</strong>flüsse sozial- <strong>und</strong> arbeitsrechtlicher Vorgaben festzustellen, z.B. durch E<strong>in</strong>führung von<br />
Qualitäts- <strong>und</strong> Bedarfsdeckungsmaßnahmen. Diese Vorgaben haben trotz gegenläufiger Tendenzen im<br />
Rahmen e<strong>in</strong>er Kostendämpfungspolitik zu e<strong>in</strong>em Anstieg der Beschäftigtenzahlen geführt. Schließlich<br />
hat sich auch der ökonomische sowie mediz<strong>in</strong>isch-technische Fortschritt mit Produkt- <strong>und</strong> Prozess<strong>in</strong>novationen<br />
auf den Anstieg der Beschäftigung positiv ausgewirkt.<br />
Zu dem bee<strong>in</strong>druckenden Beschäftigungsausbau haben vor allem die stationäre <strong>und</strong> ambulante Altenpflege,<br />
aber auch die positive Entwicklung der ‘nicht-ärztlichen’ Heilhilfs- <strong>und</strong> Pflegeberufe beigetragen.<br />
In den Blickpunkt der Aufmerksamkeit geraten zunehmend auch die Zuliefer- <strong>und</strong> Nachbarbranchen<br />
des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s, die zwar bislang e<strong>in</strong>en relativ kle<strong>in</strong>en – weitgehend privat f<strong>in</strong>anzierten -<br />
Anteil der Gesamtbeschäftigung stellen (14,6%), aber <strong>in</strong>teressante Innovationspotenziale für die Weiterentwicklung<br />
des gesamten Sektors be<strong>in</strong>halten. Insgesamt präsentiert sich also die Ges<strong>und</strong>heitsbranche<br />
als e<strong>in</strong> hidden champion des nordrhe<strong>in</strong>-westfälischen Strukturwandels, von dem auch <strong>in</strong> Zukunft<br />
neue Beschäftigungsimpulse für die gesamte Region zu erwarten s<strong>in</strong>d.<br />
- 2 -
E<strong>in</strong>führung <strong>und</strong> Zusammenfassung<br />
Tab. 1 Gesamtbeschäftigtenzahlen im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen 1998<br />
E<strong>in</strong>richtungen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s Beschäftigte<br />
absolut Anteil<br />
Insgesamt ca. 957.280 100,0%<br />
Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Arbeitsschutz 11.055 1,2<br />
Öffentlicher Ges<strong>und</strong>heitsdienst (Ges<strong>und</strong>heitsämter) 4.160 1<br />
0,4<br />
Sonstiges öffentliches Personal im Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Arbeitsschutz 5.375 0,6<br />
Mediz<strong>in</strong>ischer Dienst der Krankenkassen 1.520 0,2<br />
Ambulante Ges<strong>und</strong>heitsversorgung ca. 373.081 39,0<br />
Arztpraxen ca. 171.800 2<br />
17,9<br />
Zahnarztpraxen ca. 81.600 2<br />
Praxen nichtärztlicher mediz<strong>in</strong>ischer Berufe ca. 49.270 2<br />
Apotheken 27.411 2,9<br />
E<strong>in</strong>richtungen der ambulanten Pflege mit Versorgungsvertrag nach SGB XI ca. 43.000 4,5<br />
Stationäre <strong>und</strong> teilstationäre Ges<strong>und</strong>heitsversorgung 362.351 37,9<br />
Krankenhäuser 241.835 25,3<br />
Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen 13.516 1,4<br />
E<strong>in</strong>richtungen der teil- <strong>und</strong> vollstationären Pflege mit Versorgungsvertrag nach SGB XI ca. 107.000 11,2<br />
Krankentransporte/ Rettungsdienste 10.500 1,1<br />
Verwaltung ca. 50.000 5,2<br />
Krankenversicherung/ Sozialversicherung 46.400 4,8<br />
Organisationen der Leistungserbr<strong>in</strong>ger 3.600 0,4<br />
Ausbildungsstätten <strong>und</strong> Forschungse<strong>in</strong>richtungen ca. 10.000 1,0<br />
Vorleistungs-/Zuliefer<strong>in</strong>dustrien des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s 113.293 11,8<br />
Betriebe des Ges<strong>und</strong>heitshandwerks 39.038 3<br />
Pharmazeutische Industrie 28.000 2,9<br />
Mediz<strong>in</strong>technische Industrie 20.000 2,1<br />
Biotechnologie 6.000 0,6<br />
Groß- <strong>und</strong> Fache<strong>in</strong>zelhandel mit mediz<strong>in</strong>ischen Produkten 20.255 2,1<br />
Nachbarbranchen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s ca. 27.000 2,8<br />
Fitness/Wellness 5.000 0,5<br />
Ges<strong>und</strong>heitstourismus 17.000 1,8<br />
Servicedienstleistungen ca. 1.500 0,2<br />
Beratung, Consult<strong>in</strong>g <strong>und</strong> Information ca. 1.000 0,1<br />
Selbsthilfe<br />
1 Angaben aus dem Jahr 1996<br />
ca. 2.500 0,3<br />
2 Daten auf Praxisebene gemäß Angaben der Berufsgenossenschaft für Ges<strong>und</strong>heitsdienst <strong>und</strong> Wohlfahrtspflege, da kumulative Jahresstatistik<br />
liegen die Daten systematisch zu hoch<br />
3 Angaben aus dem Jahr 1994<br />
Quelle: FfG/ IAT<br />
- 3 -<br />
8,5<br />
5,1<br />
4,1
Kernsektoren<br />
E<strong>in</strong>führung <strong>und</strong> Zusammenfassung<br />
Die Kernsektoren, die ambulante <strong>und</strong> die stationäre Ges<strong>und</strong>heitsversorgung, bilden die größten Arbeitsfelder<br />
der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft, wobei mittlerweile <strong>in</strong> beiden Bereichen annähernd gleich viele<br />
Beschäftigte zu f<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d.<br />
Auf die ambulante Ges<strong>und</strong>heitsversorgung entfallen 39 % der Gesamtbeschäftigten des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s.<br />
In diesem Sektor stellen Arzt- <strong>und</strong> Zahnarztpraxen mit knapp 68% den weitaus größten Beschäftigtenanteil,<br />
auf den Plätzen zwei <strong>und</strong> drei folgen die Praxen nichtärztlicher mediz<strong>in</strong>ischer Berufe<br />
(r<strong>und</strong> 13,2%) <strong>und</strong> die E<strong>in</strong>richtungen der ambulanten Pflege (11,5%). Insgesamt ist die ambulante Ges<strong>und</strong>heitsversorgung<br />
seit 1985 um gut 82.000 Personen angewachsen. Von diesem Beschäftigungszuwachs<br />
entfallen mit rd. 26.000 Personen mehr als 30% alle<strong>in</strong> auf die ambulante Altenpflege. Der Blick<br />
auf die Professionen zeigt, dass von der Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong>sbesondere das Feld der nichtakademischen<br />
Ges<strong>und</strong>heitsberufe profitiert hat: Sprechst<strong>und</strong>enhelfer<strong>in</strong>nen weisen e<strong>in</strong>en Zuwachs um<br />
rd. 33.000 Personen auf <strong>und</strong> bilden mittlerweile nach den Krankenschwestern/-pflegern die zweitstärkste<br />
Berufsgruppe. Hohe Wachstumsraten f<strong>in</strong>den sich des weiteren bei den nicht-ärztlichen Heilhilfsberufen<br />
(Physiotherapeut/<strong>in</strong>nen, Logopäd/<strong>in</strong>nen, Ergotherapeut/<strong>in</strong>nen, Hebammen, med. Fußpfleger/<strong>in</strong>nen).<br />
Diese dynamische Entwicklung unterstreicht die zunehmende Bedeutung von therapeutischen<br />
<strong>und</strong> rehabilitativen Behandlungsformen <strong>in</strong> der mediz<strong>in</strong>ischen Versorgung.<br />
Auf die stationäre Ges<strong>und</strong>heitsversorgung entfallen knapp 38 % der Beschäftigten im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>.<br />
Dabei f<strong>in</strong>det sich der Großteil der Beschäftigten <strong>in</strong> den Krankenhäusern (66,7%). Dieser Bereich<br />
konnte <strong>in</strong> den letzten 15 Jahren e<strong>in</strong>en Beschäftigungszuwachs von r<strong>und</strong> 22.000 Beschäftigten - von rd.<br />
220.000 auf rd. 242.000 Beschäftigte - verzeichnen. Die E<strong>in</strong>richtungen der teil- <strong>und</strong> vollstationären<br />
Pflege weisen den zweithöchsten Beschäftigtenanteil <strong>in</strong> der stationären Ges<strong>und</strong>heitsversorgung auf.<br />
Das Beschäftigungswachstum fällt hier deutlich höher aus als im Krankenhausbereich: In den letzten<br />
15 Jahren erfolgte e<strong>in</strong> Zuwachs um r<strong>und</strong> 50.000 Personen, die Zahl der Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Arbeitnehmer<br />
stieg auf rd. 107.000 Beschäftigte. In Bezug auf die Professionen weist das Pflegepersonal<br />
sowohl den höchsten Beschäftigtenanteil als auch das größte absolute Beschäftigungswachstum auf.<br />
Demgegenüber ist im Krankenhaus <strong>in</strong> den Bereichen “Wirtschaft <strong>und</strong> Technik” sowie “Sonderdienste”<br />
e<strong>in</strong>e rückläufige Beschäftigungsentwicklung zu verzeichnen. Als ursächlich hierfür ist die Auslagerung<br />
von Dienstleistungen an Fremdanbieter (Outsourc<strong>in</strong>g) anzusehen.<br />
In Bezug auf die Kernsektoren des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s lässt sich abschließend konstatieren, dass trotz<br />
Budgetierung, Bettenabbau <strong>und</strong> Leistungsverdichtung e<strong>in</strong> mehr oder weniger kont<strong>in</strong>uierlicher Beschäftigungszuwachs<br />
beobachtet werden kann. Hiervon haben vor allem Frauen profitiert, deren Anteil<br />
an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 1998 fast 80% betrug. Hiermit korrespondiert die<br />
hohe Teilzeitquote, die von ca. 12% im Jahr 1980 auf fast e<strong>in</strong> Viertel der sozialversicherungspflichtig<br />
Beschäftigten angewachsen ist. Dieser Trend verweist darauf, dass das Arbeitsvolumen nicht <strong>in</strong> gleichem<br />
Umfang wie die absoluten Beschäftigungszahlen angestiegen ist. Nichtsdestotrotz ist die Beschäftigungsbilanz<br />
<strong>und</strong> das Wachstum im Ges<strong>und</strong>heitssektor beachtlich <strong>und</strong> übertrifft bei weitem andere<br />
als Zukunftsbranchen etikettierte Felder aus Industrie <strong>und</strong> Dienstleistungen. So s<strong>in</strong>d etwa <strong>in</strong> der<br />
nordrhe<strong>in</strong>-westfälischen IuK-Branche „nur“ zwischen 160.000 <strong>und</strong> 200.000 (je nach zu Gr<strong>und</strong>e gelegter<br />
Klassifikation) Menschen beschäftigt.<br />
- 4 -
Zuliefer<strong>in</strong>dustrien <strong>und</strong> Nachbarbranchen<br />
E<strong>in</strong>führung <strong>und</strong> Zusammenfassung<br />
Zum <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> s<strong>in</strong>d neben den angeführten Kernbereichen auch die Vorleistungs-<br />
/Zulieferbereiche <strong>und</strong> Nachbarbranchen zu zählen, die Produkte <strong>und</strong> Dienstleistungen mit Ges<strong>und</strong>heitsbezug<br />
herstellen. In diesen Teilbereichen der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalens arbeiten<br />
1998 ca. 140.000 Beschäftigte. Den größten Anteil nehmen hierbei die Betriebe des Ges<strong>und</strong>heitshandwerks<br />
mit rd. 28% <strong>und</strong> die pharmazeutische Industrie mit rd. 20% an. Wenngleich das Wachstum<br />
im Bereich der Vorleistungs-, Zuliefer- <strong>und</strong> Nachbarbranchen nicht so dynamisch ist wie im Durchschnitt<br />
der gesamten Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft, so kann dennoch auf e<strong>in</strong>e positive Beschäftigungsentwicklung<br />
mit e<strong>in</strong>em absoluten Wachstum um rd. 18.000 Beschäftigte zurückgeblickt werden. Bemerkenswert<br />
ist zum e<strong>in</strong>en die Entwicklung <strong>in</strong> der mediz<strong>in</strong>ischen Industrie <strong>in</strong>cl. der Gerontotechnik mit<br />
ca. 6.000 neuen Arbeitsplätzen. Positive Akzente mit ca. 5.000 neuen Arbeitsplätzen setzten des weiteren<br />
die freizeitbezogenen Dienstleistungen <strong>in</strong> den Bereichen Fitness/Wellness <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitstourismus.<br />
Schließlich ist beachtenswert, dass die pharmazeutische Industrie <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen e<strong>in</strong>e<br />
der wenigen Industriebranchen ist, die <strong>in</strong> den letzten Jahren kaum Beschäftigungsverluste zu verzeichnen<br />
hatte.<br />
Anders als <strong>in</strong> den Kernsektoren des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s ist die Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> den Zuliefer<strong>in</strong>dustrien<br />
<strong>und</strong> Nachbarbranchen weitaus stärker davon abhängig, auch privat f<strong>in</strong>anzierte Nachfrage<br />
zu mobilisieren, da e<strong>in</strong> Großteil der Produkte <strong>und</strong> Dienstleistungen nicht über die Sozialversicherungsträger<br />
f<strong>in</strong>anziert wird. Insofern lässt sich der Beschäftigungsanstieg <strong>in</strong> diesen Feldern auch<br />
als zunehmende Bereitschaft der Nachfrageseite <strong>in</strong>terpretieren, <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Lebensqualität privat<br />
zu <strong>in</strong>vestieren.<br />
E<strong>in</strong>blicke <strong>in</strong> nordrhe<strong>in</strong>-westfälische Teilregionen<br />
Für die Beurteilung der zukünftigen Perspektiven der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
s<strong>in</strong>d neben den landesweiten Globaldaten Analysen der regionalen Entwicklungspotenziale aufschlussreich.<br />
Bislang liegen jedoch kaum Expertisen vor, die e<strong>in</strong>en Überblick über die Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft<br />
<strong>in</strong> den nordrhe<strong>in</strong>-westfälischen Teilregionen bieten. Im Rahmen der vorliegenden Studie<br />
wurden vor diesem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> drei Regionalstudien <strong>in</strong> Auftrag gegeben. Sie ermöglichen erste qualitative<br />
E<strong>in</strong>blicke <strong>in</strong> die Entwicklung der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft <strong>in</strong> ausgewählten Teilregionen des<br />
Landes Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (Ruhrgebiet, Rhe<strong>in</strong>land, Ostwestfalen-Lippe), die allerd<strong>in</strong>gs durch weitere<br />
Forschung ergänzt <strong>und</strong> verifiziert werden müssen. Deutlich wird jedoch bereits zum jetzigen Zeitpunkt,<br />
dass es zwischen den Regionen e<strong>in</strong>ige Unterschiede <strong>in</strong> den Schwerpunktsetzungen gibt: Ostwestfalen-Lippe<br />
ist e<strong>in</strong>e der wichtigsten deutschen Kurregionen, das Rhe<strong>in</strong>land verfügt ebenfalls über<br />
<strong>in</strong>teressante <strong>und</strong> z. T. überregional bedeutsame Versorgungsangebote <strong>und</strong> hat sich <strong>in</strong> den letzten Jahren<br />
besonders bei der Biotechnologie e<strong>in</strong>en ausgezeichneten Ruf erworben. Das Ruhrgebiet ist im<br />
H<strong>in</strong>blick auf die Selbstversorgung relativ stark ausgebaut (wenngleich bei der Versorgung älterer<br />
Menschen e<strong>in</strong> leichter Nachholbedarf besteht); seit e<strong>in</strong>iger Zeit arbeitet das Ruhrgebiet daran, se<strong>in</strong>e<br />
fachlichen Potenziale auch überregional zu vermarkten.<br />
- 5 -
E<strong>in</strong>führung <strong>und</strong> Zusammenfassung<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus zeigen die Regionalstudien auch, dass es e<strong>in</strong>ige vielversprechende Ansatzpunkte gibt,<br />
die Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft auszubauen. Angestrebt wird nicht nur, <strong>in</strong> der jeweiligen Region für mehr<br />
Lebensqualität zu sorgen, sondern sich auch als Standort für ges<strong>und</strong>heitswirtschaftliche Kompetenz zu<br />
profilieren <strong>und</strong> so positive Effekte für Arbeit <strong>und</strong> Wettbewerbsfähigkeit bei den Forschungse<strong>in</strong>richtungen,<br />
Dienstleistungsanbietern <strong>und</strong> produzierenden Unternehmen (v.a. der Biotechnologie <strong>und</strong> der<br />
Mediz<strong>in</strong>- <strong>und</strong> Gerontotechnik) zu bewirken. Wenngleich entsprechende Konzepte erst am Anfang<br />
stehen, wird dennoch deutlich, <strong>in</strong> welche Richtung die e<strong>in</strong>zelnen Regionen sich bewegen wollen: Ostwestfalen-Lippe<br />
will mit wegweisenden Versorgungskonzepten se<strong>in</strong>e Ges<strong>und</strong>heitskompetenzen schärfen<br />
<strong>und</strong> diese dann überregional vermarkten; des weiteren sollen die vorhandenen Kur- <strong>und</strong> Rehaangebote<br />
besser vermarktet <strong>und</strong> neue Produkte <strong>und</strong> Dienstleistungen gef<strong>und</strong>en werden. Das Ruhrgebiet<br />
hat <strong>in</strong>teressante Potenziale bei der Mediz<strong>in</strong>- <strong>und</strong> Gerontotechnik <strong>und</strong> könnte diese ggf. <strong>in</strong> Kooperation<br />
mit Fachleuten aus den Universitätskl<strong>in</strong>iken des Reviers weiter ausbauen. Das Rhe<strong>in</strong>land setzt auch<br />
zukünftig auf die Biotechnologie <strong>und</strong> kann sich darüber h<strong>in</strong>aus im Bereich des Ges<strong>und</strong>heitstourismus<br />
stärker profilieren.<br />
Für alle drei Regionen wird deutlich, dass der Suchprozess nach Strategien zur Entwicklung der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft<br />
noch nicht abgeschlossen ist. Gleichzeitig zeigt sich, dass orientierende Leitbilder<br />
<strong>und</strong> aktivierende Institutionen gebraucht werden, da ansonsten die vorhandenen Potenziale nicht ausgeschöpft<br />
werden.<br />
E<strong>in</strong> Blick über die Grenze<br />
Mögliche Entwicklungspotenziale für die nordrhe<strong>in</strong>-westfälische Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft zeigen sich<br />
schließlich im <strong>in</strong>ternationalen Vergleich mit den Niederlanden. Obwohl die öffentlichen Ausgaben für<br />
Ges<strong>und</strong>heit e<strong>in</strong>en ger<strong>in</strong>geren Anteil am Bruttosozialprodukt ausmachen als <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik, ist<br />
der Beschäftigungsanteil des Ges<strong>und</strong>heitssektors an der Gesamtbeschäftigung dort höher. Bemerkenswert<br />
an der niederländischen Entwicklung s<strong>in</strong>d vor allem drei Aspekte:<br />
• E<strong>in</strong>es der wichtigsten Wachstumsfelder ist die Ges<strong>und</strong>heitsversorgung im Bereich Mental Health<br />
Care; diese nimmt womöglich e<strong>in</strong>e Entwicklung vorweg, die <strong>in</strong> Zukunft auch <strong>in</strong> Deutschland an<br />
Gewicht gew<strong>in</strong>nen wird. Bescheidener h<strong>in</strong>gegen nimmt sich bislang das Wachstum im Bereich der<br />
Altenpflege aus. Dies kann zum e<strong>in</strong>en mit der bereits <strong>in</strong> der Vergangenheit sehr hohen Versorgungsdichte<br />
<strong>in</strong> diesem Bereich, zum anderen mit der im Vergleich zu Deutschland ger<strong>in</strong>geren Zunahme<br />
der Altenbevölkerung erklärt werden.<br />
• In den Niederlanden wurde e<strong>in</strong>e gezielte Politik des upgrad<strong>in</strong>g mittlerer Qualifikationsebenen verfolgt;<br />
dies g<strong>in</strong>g e<strong>in</strong>her mit e<strong>in</strong>er steigenden Relevanz der Pflege- <strong>und</strong> Versorgungsberufe (care and<br />
nurs<strong>in</strong>g), die sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em entsprechenden Beschäftigungsanstieg niederschlug. Des weiteren expandierten<br />
ebenso wie <strong>in</strong> Deutschland die paramediz<strong>in</strong>ischen Berufe (Bewegungs- <strong>und</strong> Sprachtherapeut<strong>in</strong>nen<br />
sowie -therapeuten, Hebammen).<br />
• Die besondere Bedeutung der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft für die Beschäftigungsentwicklung ist nicht<br />
zuletzt dadurch bed<strong>in</strong>gt, dass die Teilzeitbeschäftigung <strong>in</strong> den Niederlanden systematisch ausge-<br />
- 6 -
E<strong>in</strong>führung <strong>und</strong> Zusammenfassung<br />
baut wurde <strong>und</strong> so vor allem für Frauen neue Beschäftigungsfelder <strong>und</strong> Erwerbsmöglichkeiten erschlossen<br />
werden konnten.<br />
E<strong>in</strong>flussfaktoren auf die Beschäftigungsentwicklung<br />
Für Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen bleibt festzuhalten, dass sich die <strong>in</strong>sgesamt positive Beschäftigungsentwicklung<br />
<strong>in</strong> den Kernsektoren der ambulanten <strong>und</strong> stationären Ges<strong>und</strong>heitsversorgung, aber auch <strong>in</strong><br />
den Zuliefer<strong>in</strong>dustrien <strong>und</strong> Nachbarbranchen, auf verschiedene Ursachen zurückführen lässt, deren<br />
konkrete Auswirkungen jedoch nur schwer zu quantifizieren s<strong>in</strong>d. Als wesentliche E<strong>in</strong>flussfaktoren<br />
haben sich die sozio-demographische Entwicklung, sozial- <strong>und</strong> arbeitsrechtliche Regulierungen sowie<br />
der ökonomische <strong>und</strong> mediz<strong>in</strong>isch-technische Fortschritt erwiesen. Die beschäftigungsfördernden E<strong>in</strong>flussfaktoren<br />
überwiegen <strong>und</strong> kompensieren die negativen Effekte der beschäftigungshemmenden<br />
Faktoren, so dass im Zeitraum von 1985 bis 1998 <strong>in</strong>sgesamt e<strong>in</strong>e positive Beschäftigungsentwicklung<br />
zu verzeichnen war.<br />
Die Kostendämpfungspolitik entfaltet zwar überwiegend beschäftigungshemmende Wirkungen, vor<br />
allem im Krankenhaussektor, wenngleich ke<strong>in</strong> e<strong>in</strong>deutiger Beschäftigungsabbau nachgewiesen werden<br />
kann. Insgesamt kann festgehalten werden, dass trotz forcierter Kostendämpfungspolitik die Beschäftigung<br />
im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> weiter gestiegen ist.<br />
Der demographische Wandel wirkt sich überwiegend positiv auf die Beschäftigung aus. Die enormen<br />
Zuwachsraten <strong>in</strong> der ambulanten Altenpflege lassen sich zwar nicht ausschließlich auf die Alterung<br />
der Gesellschaft zurückführen, sie spielt jedoch e<strong>in</strong>e herausragende Rolle beim Ausbau der stationären<br />
<strong>und</strong> ambulanten Pflegekapazitäten. Aus den sozio-demographischen Veränderungen resultieren zudem<br />
veränderte Nachfragestrukturen, die sich über die Bereitschaft, zusätzliche private Mittel aufzuwenden,<br />
vor allem <strong>in</strong> den Nachbarbranchen, aber auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnen Berufen des klassischen <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s<br />
beschäftigungsfördernd auswirken.<br />
Der mediz<strong>in</strong>isch-technische Fortschritt betrifft sowohl Produkt- als auch Prozess<strong>in</strong>novationen. Während<br />
Produkt<strong>in</strong>novationen durch e<strong>in</strong>e Ausweitung des Leistungsgeschehens sowie durch die Entwicklung<br />
neuer Produkte <strong>und</strong> Dienstleistungen beschäftigungsfördernde Effekte auslösen, können mit Prozess<strong>in</strong>novationen<br />
Rationalisierungsmaßnahmen <strong>und</strong> damit beschäftigungshemmende E<strong>in</strong>flüsse verb<strong>und</strong>en<br />
se<strong>in</strong>. Da Produkt<strong>in</strong>novationen <strong>in</strong> der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft jedoch dom<strong>in</strong>ieren, werden die<br />
beschäftigungshemmenden von den beschäftigungsfördernden Wirkungen überlagert.<br />
Der soziale <strong>und</strong> kulturelle Wandel, der sich u.a. <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er zunehmenden Frauenerwerbstätigkeit <strong>und</strong><br />
e<strong>in</strong>em steigenden Ges<strong>und</strong>heitsbewusstse<strong>in</strong> manifestiert, wirkt sich ebenfalls positiv auf die Beschäftigung<br />
<strong>in</strong> der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft aus. Insgesamt tragen Wertewandel, Individualisierungs- <strong>und</strong> Pluralisierungstendenzen<br />
zu e<strong>in</strong>er Ausweitung der Frauenerwerbstätigkeit bei.<br />
Blick <strong>in</strong> die Zukunft<br />
Für die Zukunft ist damit zu rechnen, dass das Wachstum der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft anhalten wird.<br />
Das Altern der Gesellschaft, der mediz<strong>in</strong>isch-technische Fortschritt <strong>und</strong> die wachsende Wertschätzung<br />
- 7 -
E<strong>in</strong>führung <strong>und</strong> Zusammenfassung<br />
des Gutes Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> der Bevölkerung s<strong>in</strong>d wichtige Faktoren, die optimistisch <strong>in</strong> die Zukunft blikken<br />
lassen. Wachstums- <strong>und</strong> beschäftigungshemmende E<strong>in</strong>flüsse s<strong>in</strong>d allerd<strong>in</strong>gs vom Druck auf die<br />
öffentlichen Haushalte <strong>und</strong> (über die paritätisch f<strong>in</strong>anzierten Sicherungssysteme) auf die Lohnnebenkosten<br />
zu erwarten. Mögliche Rationalisierungs<strong>in</strong>novationen könnten sich zusätzlich hemmend auf die<br />
Beschäftigungsentwicklung auswirken. E<strong>in</strong> Beschäftigungszuwachs lässt sich jedoch nicht nur aus<br />
qualitativen Zukunftsprojektionen ableiten, sondern auch aus den Ergebnissen e<strong>in</strong>iger quantitativ orientierter<br />
Studien bzw. Szenarien, die im Zusammenhang mit Debatten über die Zukunft der Arbeit<br />
erstellt wurden. Zuversichtlich stimmen zudem die Ergebnisse der Wirtschaftsforschung, die die generelle<br />
ökonomische Entwicklung für den Wirtschaftsraum B<strong>und</strong>esrepublik im Allgeme<strong>in</strong>en <strong>und</strong> den<br />
Wirtschaftsstandort Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im Besonderen als eher günstig e<strong>in</strong>schätzen.<br />
Die weitere Entwicklung der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft wird des weiteren durch allgeme<strong>in</strong>e endogene<br />
Entwicklungstrends im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> bestimmt. Verstärkte Vernetzungs- <strong>und</strong> Integrationsbestrebungen,<br />
Effizienz- <strong>und</strong> Qualitätsfortschritte, neue Produkte <strong>und</strong> Dienstleistungen sowie veränderte<br />
Qualifikationsstrukturen <strong>und</strong> Kompetenzabgrenzungen zwischen ärztlichen <strong>und</strong> nicht-ärztlichen Berufen<br />
werden die Beschäftigungsentwicklung zukünftig mitbestimmen. Internationale Vermarktungsstrategien<br />
sowohl der pharmazeutischen <strong>und</strong> mediz<strong>in</strong>technischen Industrie als auch der Dienstleistungen<br />
des Kernsektors werden aller Voraussicht nach zusätzliche private Nachfrage aktivieren <strong>und</strong> sich<br />
weiter positiv auf die Beschäftigung auswirken. Unsere Szenarien über die Beschäftigungsentwicklung<br />
bis 2015 lassen e<strong>in</strong> Beschäftigungsplus zwischen ca. 70.700 (untere Variante) <strong>und</strong> ca. 196.200<br />
(obere Variante) vermuten.<br />
- 8 -
Auszubildende <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen<br />
2. Entwicklung von Ausbildung <strong>und</strong> Beschäftigung im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
<strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
Ra<strong>in</strong>er Fretschner, Josef Hilbert, Christiane Rohleder, Günter Roth, Matthias Wismar, Markus<br />
Wörz, Malte Erbrich<br />
Die Zielsetzung des vorliegenden Gutachtens ist, plausible Annahmen zum E<strong>in</strong>fluss soziodemographischer<br />
Veränderungen, ökonomischen Wandels, rechtlicher E<strong>in</strong>griffe <strong>und</strong> des mediz<strong>in</strong>technischen<br />
Fortschritts auf die Beschäftigungsentwicklung seit den 50er Jahren im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalens zu entwickeln. Voraussetzung für diese Analyse ist e<strong>in</strong>e detaillierte Bestandsaufnahme<br />
der Entwicklung des Ausbildungs- <strong>und</strong> Beschäftigungsangebotes, die e<strong>in</strong>erseits berufsbezogenen<br />
Aspekten, andererseits den unterschiedlichen Dynamiken <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen Versorgungsbereichen<br />
Rechnung trägt.<br />
Die nachfolgenden Kapitel gliedern sich vor diesem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> wie folgt: Kapitel 2.1 beschäftigt<br />
sich mit der Entwicklung der Auszubildendenzahlen <strong>in</strong> den akademischen <strong>und</strong> nichtakademischen<br />
Ges<strong>und</strong>heitsberufen seit den 50er Jahren, die erste H<strong>in</strong>weise auf die Entwicklung des Bedarfs an qualifizierten<br />
Fachkräften im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> liefert. In den Kapiteln 2.2 bis 2.4 steht die Beschäftigungsentwicklung<br />
<strong>in</strong> Kernbereichen der ges<strong>und</strong>heitlichen <strong>und</strong> pflegerischen Versorgung - der stationären<br />
Akutpflege (Kap. 2.2), der ambulanten mediz<strong>in</strong>ischen Versorgung (Kap. 2.3) sowie der ambulanten,<br />
teil- <strong>und</strong> vollstationären Pflege (Kap. 2.4) - im Vordergr<strong>und</strong>. Berücksichtigung f<strong>in</strong>den aber auch<br />
die Arbeitsbereiche des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s, die schwerpunktmäßig dem Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Arbeitsschutz<br />
sowie der Ges<strong>und</strong>heitsverwaltung dienen (Kap. 2.5). Wesentlich, auch für die zukünftige Beschäftigungsentwicklung<br />
im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalens, s<strong>in</strong>d zudem die Trends <strong>in</strong> den<br />
Zuliefer- <strong>und</strong> Nachbarbranchen (Kap.2.6). Den Abschluss der Aufarbeitung der Beschäftigtendaten<br />
bilden e<strong>in</strong> Exkurs zur geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung (Kap. 2.7) sowie e<strong>in</strong> Vergleich des Beschäftigungsumfangs<br />
im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> mit anderen Branchen im Dienstleistungssektor <strong>und</strong> produzierenden<br />
Gewerbe (Kap. 2.8).<br />
E<strong>in</strong>e detaillierte Längsschnittaufarbeitung der Beschäftigungsentwicklung f<strong>in</strong>det sich für die Kernbereiche<br />
der ges<strong>und</strong>heitlichen Versorgung. Im Rahmen des Gutachtens konnte jedoch nicht für alle Arbeitsbereiche<br />
des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s e<strong>in</strong>e retrospektive Analyse der Beschäftigtendaten erfolgen. Dies<br />
liegt nicht zuletzt daran, dass im Gegensatz zum produzierenden Gewerbe, das statistisch <strong>in</strong> differenzierter<br />
Tiefe <strong>und</strong> Breite erfasst wird, der zunehmenden wirtschaftlichen <strong>und</strong> beschäftigungspolitischen<br />
Bedeutung des Dienstleistungssektors, <strong>und</strong> damit auch des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s, statistisch noch nicht<br />
<strong>in</strong> ausreichendem Maße Rechnung getragen worden ist. Aber bereits das vorliegende Datenmaterial<br />
erlaubt detaillierte E<strong>in</strong>blicke <strong>in</strong> die Beschäftigungsdynamik der letzten Jahre <strong>und</strong> Jahrzehnte <strong>und</strong> bildet<br />
die Gr<strong>und</strong>lage für die daran anschließende Interpretation der wesentlichen beschäftigungswirksamen<br />
E<strong>in</strong>flussfaktoren im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen.<br />
- 9 -
Auszubildende <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen<br />
2.1. Auszubildende <strong>in</strong> den akademischen <strong>und</strong> nichtakademischen Ges<strong>und</strong>heitsberufen<br />
Akademische <strong>und</strong> nichtakademische Ausbildungen <strong>in</strong> den Ges<strong>und</strong>heitsberufen haben seit den 50er<br />
Jahren an bildungspolitischem Stellenwert gewonnen. Alle<strong>in</strong> die Zahl der an Hochschulen <strong>und</strong> Schulen<br />
des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s Ausgebildeten stieg von etwas über 10.000 Personen Mitte der 50er Jahre<br />
auf fast 76.000 <strong>in</strong> 1998. E<strong>in</strong>schließlich der Auszubildenden im dualen System befanden sich 1998 ca.<br />
106.300 Schüler/<strong>in</strong>nen, Auszubildende <strong>und</strong> Student/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Ausbildung zu e<strong>in</strong>em Ges<strong>und</strong>heitsberuf.<br />
Tab. 2 Schüler/<strong>in</strong>nen, Auszubildende <strong>und</strong> Student/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen,<br />
1955 bis 1998<br />
Jahr <strong>in</strong>sgesamt Veränderungen<br />
<strong>in</strong><br />
%, 1985<br />
= 100<br />
davon an<br />
Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s<br />
- 10 -<br />
berufsbildenden Schulen Hochschulen<br />
zusam- <strong>in</strong> % von darunter zusam- <strong>in</strong> % von darunter zusam- <strong>in</strong> % von darunter<br />
men<strong>in</strong>sgesamt weiblich<br />
<strong>in</strong> %<br />
men<strong>in</strong>sgesamt weiblich<br />
<strong>in</strong> %<br />
men<strong>in</strong>sgesamt weiblich<br />
<strong>in</strong> %<br />
1955/56 10.143 6.199 95,8% 3.944 1<br />
1965 20.837 11.774 89,2% 9.063 1<br />
1975 47.020 30.618 84,6% 16.402<br />
1985 95.171 100,0% 33.006 34,7% 86,4% 27.507 28,9% 89,4% 34.658 36,4% 51,5%<br />
1986 94.816 99,6% 32.732 34,5% 86,6% 26.961 28,4% 89,4% 35.123 37,0% 50,3%<br />
1987 93.385 98,1% 32.237 34,5% 86,5% 25.625 27,4% 89,7% 35.523 38,0% 53,0%<br />
1988 95.231 100,1% 31.934 33,5% 86,0% 27.823 29,2% 90,8% 35.474 37,3% 54,0%<br />
1989 92.415 97,1% 31.497 34,1% 85,6% 26.134 28,3% 92,2% 34.784 37,6% 58,8%<br />
1990 92.779 97,5% 32.695 35,2% 85,0% 25.970 28,0% 92,8% 34.114 36,8% 57,3%<br />
1991 96.081 101,0% 34.865 36,3% 83,6% 27.859 29,0% 93,3% 33.357 34,7% 58,8%<br />
1992 98.253 103,2% 36.583 37,2% 81,8% 29.915 30,4% 92,7% 31.755 32,3% 59,9%<br />
1993 100.095 105,2% 38.767 38,7% 79,5% 30.377 30,3% 92,0% 30.951 30,9% 58,4%<br />
1994 101.552 106,7% 41.302 40,7% 77,7% 29.738 29,3% 91,5% 30.512 30,0% 57,5%<br />
1995 103.624 108,9% 43.768 42,2% 76,4% 29.928 28,9% 91,5% 29.928 28,9% 56,0%<br />
1996 105.841 111,2% 46.683 44,1% 76,0% 29.117 27,5% 91,2% 30.041 28,4% 54,6%<br />
1997 104.468 109,8% 44.403 42,5% 77,0% 29.195 27,9% 91,5% 30.870 29,5% 54,9%<br />
1998 2<br />
106.292 2 111,7% 2<br />
44.021 41,4% 77,9% 27.926 26,2% 91,4% 34.345 2<br />
32,3% 2<br />
54,7% 3<br />
1 nur deutsche Studierende<br />
2 <strong>in</strong>clusive Studierende der Ges<strong>und</strong>heitswissenschaften, -ökonomie, der Pflege, -management, -pädagogik, -wissenschaften <strong>und</strong> der Sportwissenschaften/<br />
des Sportmanagements – für diese Studiengänge liegen ke<strong>in</strong>e amtlichen Längsschnittdaten vor<br />
3 der Frauenanteil bezieht sich nur auf Studierende der Humanmediz<strong>in</strong>, der Psychologie <strong>und</strong> der Pharmazie<br />
Quellen: LDS: Statistik Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s, Berufsbildungsstatistik (seit 1978), Hochschulstatistik, eigene<br />
Recherchen, Berechnungen FfG<br />
Seit 1985 haben die Ausbildungen an den Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s ihren Anteil gegenüber den<br />
akademischen wie den dualen Ausbildungen vergrößert (s. Tab. 2). So waren 1985 34,7 % aller <strong>in</strong><br />
Ausbildung bef<strong>in</strong>dlichen Ges<strong>und</strong>heitsberufler Schüler/<strong>in</strong>nen an den Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s,<br />
während 36,4 % an Gesamthochschulen <strong>und</strong> Universitäten studierten. 1998 liegt demgegenüber der<br />
Anteil der Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s bereits bei über 41,4 %, während der Anteil der Student/<strong>in</strong>nen<br />
nur noch etwas über 32 % beträgt. Der Anteil der Ausbildungsberufe im dualen System am<br />
Gesamt der Erstausbildungen s<strong>in</strong>kt im Betrachtungszeitraum um über 2 Prozentpunkte <strong>und</strong> liegt 1998<br />
bei etwas über 26 %.
Auszubildende <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen<br />
Abb. 1 Vergleich der Anteile verschiedener Ausbildungsstätten im Bereich der Ges<strong>und</strong>heitsausbildungen<br />
1985 <strong>und</strong> 1998<br />
100%<br />
0%<br />
36,4%<br />
28,9%<br />
34,7%<br />
32,3%<br />
26,2%<br />
41,4%<br />
1985 1998<br />
- 11 -<br />
Hochschulen <strong>und</strong> Universitäten<br />
Berufsschulen<br />
Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s<br />
Quelle: LDS, Hochschulstatistik, Berufsbildungsstatistik, Statistik Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s, Darstellung FfG<br />
Der Anteil der weiblichen Auszubildenden differiert stark nach der jeweiligen Ausbildungsrichtung.<br />
Er liegt <strong>in</strong> den prestigeträchtigen akademischen Ausbildungen mit knapp 55 % am niedrigsten <strong>und</strong> <strong>in</strong><br />
den berufsbildenden Schulen mit über 90 % am höchsten. Die längsten Zeitreihen liegen für die<br />
Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s vor. Hier sank der Frauenanteil von knapp 96 % Mitte der 50er Jahre<br />
auf 78 % Ende der 90er Jahre. Ursächlich für diese Entwicklung ist e<strong>in</strong>erseits die „Öffnung“ der Ausbildungen<br />
zur Krankenpflege <strong>und</strong> zur Altenpflege für männliche Schüler, andererseits die Schaffung<br />
neuer Berufe, wie z.B. die Ausbildungen zur Massage, zur Krankengymnastik/ Physiotherapie oder<br />
zur Rettungsassistenz, <strong>in</strong> denen der Anteil der männlichen Schüler höher als <strong>in</strong> den Pflegeberufen liegt<br />
(s. Kap. 2.1.1)<br />
2.1.1. Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s<br />
In Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen erfolgen die Ausbildungen <strong>in</strong> den pflegerischen, mediz<strong>in</strong>isch-technischen <strong>und</strong><br />
nichtmediz<strong>in</strong>ischen therapeutischen Berufen <strong>in</strong> der überwiegenden Mehrheit an staatlich anerkannten<br />
Privatschulen, den „Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s“. Zuständig für die Schulzulassung sowie die<br />
Genehmigung von Ausbildungsstätten <strong>und</strong> -kapazitäten s<strong>in</strong>d die Bezirksregierungen. 1<br />
Die Bestandsaufnahme der Entwicklung der Schüler/<strong>in</strong>nenzahlen <strong>in</strong> Tab. 3 zeigt, dass seit den 50er<br />
Jahren die Zahl der Schüler/<strong>in</strong>nen an den Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s um e<strong>in</strong> Mehrfaches gestiegen<br />
ist, nicht zuletzt auch durch die Schaffung neuer Ausbildungsberufe. Zum 15.10.1998 befanden<br />
sich etwas über 44.000 Schüler/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er schulischen Ausbildung, über 65 % der Schüler/<strong>in</strong>nen<br />
entfallen dabei auf die zwei am stärksten besetzten Ausbildungsberufe – die Kranken- <strong>und</strong> die Altenpflege.<br />
Schulische Ausbildungen <strong>in</strong> den nichtakademischen Ges<strong>und</strong>heitsberufen haben über die Jahre an Attraktivität<br />
für Männer gewonnen. So sank der Frauenanteil an den Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s seit<br />
1 Folgende Ausbildungsgänge waren 1998 an den Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s angesiedelt: Krankenpflege,<br />
K<strong>in</strong>derkrankenpflege, Krankenpflegehilfe, Entb<strong>in</strong>dungspflege, med.-techn. Laboratoriumsassistenz, med.techn.<br />
Radiologieassistenz, med.-techn. Assistenz für Funktionsdiagnostik, veter<strong>in</strong>är-mediz<strong>in</strong>isch-technische<br />
Assistenz, pharmazeutisch-technische Assistenz, Physiotherapie, Massage/ med. Bademeister, Orthoptik,<br />
Diätassistenz, Ergotherapie, Logopädie, Altenpflege, Familienpflege/ Dorfhilfe, staatl. anerkannte Rettungsassistenz.
Auszubildende <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen<br />
1956 um fast 18 % auf 77,9 % im Jahr 1998. Ausbildungsberufe mit relativ hohen Männeranteilen<br />
s<strong>in</strong>d die Rettungsassistenz (93 %), die Massage (49 %), die Physiotherapie (31 %) sowie die Krankenpflege<br />
(25,5 %).<br />
Tab. 3 Schüler/<strong>in</strong>nen an den Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s 1956 – 1998<br />
Jahre <strong>in</strong>sge- <strong>in</strong> % darunter darunter<br />
samt 1975 = weiblich auslän- Krankenpflege Altenpflege<br />
100% <strong>in</strong> % von disch <strong>in</strong><br />
<strong>in</strong>sg. % von<br />
<strong>in</strong>sg.<br />
zusammen <strong>in</strong> % von<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
darunter<br />
weiblich <strong>in</strong><br />
% von<br />
zusammen <strong>in</strong> % von<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
darunter<br />
weiblich <strong>in</strong><br />
% von<br />
zusammen<br />
zusammen<br />
1956 6.199 95,8% 0,2% 3.742 60,4%<br />
1965 11.774 89,2% 6.937 44,2% 83,6%<br />
1975 30.618 100,0% 84,6% 4,6% 16.609 54,2% 79,0% 684 2,2% 78,9%<br />
1985 33.006 107,8% 86,4% 2,0% 20.061 60,8% 82,5% 2.531 7,7% 86,7%<br />
1986 32.732 106,9% 86,6% 2,2% 20.003 61,1% 83,0% 2.589 7,9% 87,0%<br />
1987 32.237 105,3% 86,5% 2,5% 19.180 59,5% 83,3% 2.892 9,0% 86,6%<br />
1988 31.934 104,3% 86,0% 3,0% 18.315 57,4% 82,7% 3.389 10,6% 86,1%<br />
1989 31.497 102,9% 85,6% 4,0% 17.880 56,8% 82,0% 3.597 11,4% 86,2%<br />
1990 32.695 106,8% 85,0% 5,2% 17.316 53,0% 80,9% 5.064 15,5% 86,5%<br />
1991 34.865 113,9% 83,6% 6,5% 17.054 48,9% 79,1% 6.384 18,3% 85,7%<br />
1992 36.583 119,5% 81,8% 7,7% 16.267 44,5% 77,6% 8.236 22,5% 85,2%<br />
1993 38.767 126,6% 79,5% 8,7% 16.415 42,3% 74,8% 9.379 24,2% 83,9%<br />
1994 41.302 134,9% 77,7% 9,1% 16.921 41,0% 72,4% 11.283 27,3% 82,0%<br />
1995 43.768 142,9% 76,4% 8,9% 17.450 39,9% 71,2% 13.109 30,0% 80,9%<br />
1996 46.683 152,5% 76,0% 8,6% 17.755 38,0% 71,1% 14.602 31,3% 79,9%<br />
1997 44.403 145,0% 77,0% 7,8% 16.631 37,5% 72,5% 13.394 30,2% 80,4%<br />
1998 44.021 143,8% 77,9% 7,5% 16.190 36,8% 74,5% 12.679 28,8% 80,7%<br />
Quelle: LDS, Statistik Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s, Berechnungen FfG<br />
Bezüglich der ausländischen Schüler/<strong>in</strong>nen s<strong>in</strong>d im Betrachtungszeitraum Schwankungen zu verzeichnen.<br />
Die höchsten Anteile ausländischer Schüler/<strong>in</strong>nen f<strong>in</strong>den sich Anfang bis Mitte der 90er Jahre.<br />
1994 waren über 9 % der Schüler/<strong>in</strong>nen an den Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s ausländischer Herkunft.<br />
Seitdem ist der Ausländeranteil leicht rückläufig. Er liegt 1998 bei 7,5%. Die ausgeprägtesten<br />
Anteile ausländischer Schüler/<strong>in</strong>nen mit 11-15 % weisen 1998 die Krankenpflegehilfe (14,9 %), die<br />
mediz<strong>in</strong>isch-technische Laboratoriumsassistenz (12,2 %) <strong>und</strong> die pharmazeutisch-technische Assistenz<br />
(11,2 %) auf. 2<br />
An den Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong>nerhalb des Betrachtungszeitraums Wachstumsphasen<br />
<strong>und</strong> solche rückläufiger Entwicklung. Bis Mitte der 80er Jahre erfolgt e<strong>in</strong> kont<strong>in</strong>uierlicher<br />
Ausbau der Ausbildungskapazitäten auf über 33.000 Schüler/<strong>in</strong>nen. Zwischen 1985 <strong>und</strong> 1990 geht die<br />
Schülerzahl z.T. als Folge nicht besetzter Ausbildungsplätze um 1.500 Personen oder 4,6 % zurück,<br />
um danach erneut bis 1996 um über 12.000 (+33,9 %) auf den Höchststand von knapp 46.700 Schü-<br />
2 Unterdurchschnittliche Anteile, d.h. weniger als 7,5 % ausländische Schüler/<strong>in</strong>nen, f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> den Ausbildungen<br />
zur K<strong>in</strong>derkrankenpflege (3,8 %), zur Entb<strong>in</strong>dungspflege (3 %), zur Physiotherapie (4,4 %), bei<br />
den Orthoptist<strong>in</strong>nen (2,7 %), <strong>in</strong> der Diätassistenz (3,9 %), der Ergotherapie (1,1 %), der Logopädie (2,2 %),<br />
der Rettungsassistenz (1,3 %), bei den veter<strong>in</strong>är-med. Assistent/<strong>in</strong>nen (0 %) sowie <strong>in</strong> der Familienpflege<br />
(4,6 %).<br />
- 12 -
Auszubildende <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen<br />
ler/<strong>in</strong>nen zu steigen. Seit 1996 s<strong>in</strong>d die Schülerzahlen wieder leicht rückläufig. Die Gesamtkapazität<br />
verr<strong>in</strong>gerte sich um ca. 2.600 Schüler/<strong>in</strong>nen oder 5,7 %. 3<br />
Diese allgeme<strong>in</strong>en Tendenzen basieren auf unterschiedlichen Trends <strong>in</strong> den verschiedenen Ausbildungsberufen.<br />
So resultiert der Anstieg der Schüler/<strong>in</strong>nen zwischen 1965 <strong>und</strong> 1985 vor allem aus dem<br />
Ausbau der Kapazitäten <strong>in</strong> den krankenpflegerischen Berufen. Die Zahl der Krankenpflegeschüler/<strong>in</strong>nen<br />
stieg von Mitte der 50er Jahre (3.742 Schüler/<strong>in</strong>nen) bis Mitte der 80er Jahre (20.061 Schüler/<strong>in</strong>nen)<br />
um über 16.000 Personen oder mehr als 400 %. Alle<strong>in</strong> auf die Ausbildung zur Krankenpflege<br />
entfielen 1985 über 60 % aller Schüler/<strong>in</strong>nen an den Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s. Die Zahl der<br />
K<strong>in</strong>derkrankenpflegeschüler/<strong>in</strong>nen lag 1985 bei etwas über 2.700 Personen, <strong>in</strong> der e<strong>in</strong>-jährigen Ausbildung<br />
zur Krankenpflegehilfe befanden sich ca. 900 Schüler/<strong>in</strong>nen.<br />
Abb. 2 Zuwachsraten <strong>in</strong> ausgewählten Ausbildungsgängen an den Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s<br />
1985 – 1998 (1985 = 100)<br />
900%<br />
800%<br />
700%<br />
600%<br />
500%<br />
400%<br />
300%<br />
200%<br />
100%<br />
0%<br />
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998<br />
Schüler/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong>sg. Ergotherapeuten/<strong>in</strong>nen Physiotherapeuten/<strong>in</strong>nen<br />
Logopäden/<strong>in</strong>nen Altenpflege<br />
Quelle: LDS, Statistik Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s, Darstellung FfG<br />
Seit Mitte der 80er Jahre haben die nichtärztlichen Heilhilfsberufe sowie die Altenpflege jedoch gegenüber<br />
den krankenpflegerischen Ausbildungen an Bedeutung gewonnen (s. Abb. 2). Die Schülerzahlen<br />
<strong>in</strong> den Ausbildungen Krankengymnastik <strong>und</strong> Massage (1985: 1.175 Schüler/<strong>in</strong>nen), die 1994<br />
weitgehend <strong>in</strong> die neugeordnete Ausbildung zur Physiotherapie überg<strong>in</strong>gen, stiegen bis 1998 (3.536)<br />
ebenso wie die <strong>in</strong> den 70er Jahren neu e<strong>in</strong>geführten Ausbildungsgänge <strong>in</strong> der Logopädie (1985: 102;<br />
1998: 588) <strong>und</strong> Beschäftigungs-/Arbeitstherapie/Ergotherapie (1985: 202; 1998: 1.768). E<strong>in</strong>en besonders<br />
starken Zuwachs erfuhr die Ausbildung zur Altenpflege. Hier erhöhten sich die Schülerzahlen<br />
zwischen 1985 <strong>und</strong> 1998 von knapp 2.500 auf über 12.000 Personen, wobei vor allem zwischen 1991<br />
33 1997 lag der Anteil der Schüler/<strong>in</strong>nen an den Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s an allen Schüler/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> beruflichen<br />
Schulen (1997: 471.052 Schüler/<strong>in</strong>nen) bei 9,4 %.<br />
- 13 -
Auszubildende <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen<br />
<strong>und</strong> 1996, d.h. im Umfeld der Neuordnung der Altenpflegeausbildung <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im Jahr<br />
1994, e<strong>in</strong> starker Ausbau der Ausbildungskapazitäten von knapp 6.400 auf 14.600 Schüler/<strong>in</strong>nen erfolgte.<br />
In den krankenpflegerischen Berufen f<strong>in</strong>det sich demgegenüber zwischen 1985 <strong>und</strong> 1998 e<strong>in</strong> Rückgang<br />
der Schülerzahlen (s. Abb. 3). Die Zahl der Krankenpflegeschüler/<strong>in</strong>nen sank um ca. 20 % von<br />
etwas über 20.000 auf ca. 16.100. In der K<strong>in</strong>derkrankenpflege erfolgte e<strong>in</strong>e Reduktion um ca. 700<br />
Schüler/<strong>in</strong>nen auf knapp 2.100 Personen <strong>und</strong> <strong>in</strong> der Krankenpflegehilfe fielen die Auszubildendenzahlen<br />
nach e<strong>in</strong>em zwischenzeitlichen Hoch im Jahr 1993 (1.549) auf ca. 840 Schüler/<strong>in</strong>nen. Die skizzierten<br />
Entwicklungen haben zur Folge, dass der Anteil der Pflegeberufe ((K<strong>in</strong>der)Krankenpflege,<br />
Krankenpflegehilfe <strong>und</strong> Altenpflege) an allen Schüler/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> den Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s<br />
zwar nur leicht von 76,8 % im Jahr 1985 auf 72,3 % im Jahr 1998 gesunken ist. Allerd<strong>in</strong>gs beträgt der<br />
Anteil der Krankenpflegeschüler/<strong>in</strong>nen an der Summe aller Schüler/<strong>in</strong>nen 1998 nur noch 36,8 %<br />
(1985: 60,8 %), während die Altenpflege ihren Anteil auf fast 29 % erhöhen konnte.<br />
Abb. 3 Entwicklung der Schülerzahl <strong>in</strong> ausgewählten krankenpflegerischen Ausbildungen<br />
an den Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s 1985 – 1998 (1985= 100)<br />
200%<br />
175%<br />
150%<br />
125%<br />
100%<br />
75%<br />
50%<br />
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998<br />
Schüler/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong>sg. Krankenpflege Krankenpflegehilfe K<strong>in</strong>derkrankenpflege<br />
Quelle: LDS, Statistik Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s, Darstellung FfG<br />
Insgesamt ist seit den 50er Jahren e<strong>in</strong>e deutliche Ausweitung der Gesamtschülerzahl an den Schulen<br />
des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s zu verzeichnen, die zum e<strong>in</strong>en auf e<strong>in</strong>em starken Ausbau <strong>in</strong> den Ausbildungen<br />
zur Krankenpflege <strong>und</strong> zur Altenpflege basiert, zum anderen auf e<strong>in</strong>er Erweiterung des Ausbildungsangebotes<br />
<strong>in</strong> den z.T. seit den 70er Jahren neu h<strong>in</strong>zugekommenen therapeutischen Heilhilfsberufen.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs erfolgen bereits seit Mitte der 80er Jahre <strong>in</strong> der Krankenpflege, seit Mitte der 90er Jahre <strong>in</strong><br />
der Altenpflege Kapazitätsreduktionen, die sich seit 1996 <strong>in</strong> <strong>in</strong>sgesamt s<strong>in</strong>kenden Schülerzahlen niederschlagen.<br />
- 14 -
2.1.2. Berufsbildende Schulen<br />
Auszubildende <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen<br />
Etwas über e<strong>in</strong> Viertel der Ausbildungen <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen f<strong>in</strong>det im dualen System statt. Ausbildungsstätten<br />
s<strong>in</strong>d hier vor allem die Arzt- <strong>und</strong> Zahnarztpraxen, Apotheken <strong>und</strong> Handwerksbetriebe,<br />
ergänzt durch theoretisch-praktische Ausbildungsanteile an berufsbildenden Schulen.<br />
1998 befanden sich <strong>in</strong>sgesamt ca. 28.000 Personen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er dualen Ausbildung zu e<strong>in</strong>em Ges<strong>und</strong>heitsberuf<br />
(s. Tab. 4). Seit Anfang der 80er Jahre stieg damit die Zahl der Auszubildenden um über 23 %. 4<br />
E<strong>in</strong> vorläufiger Höchststand wurde allerd<strong>in</strong>gs bereits 1993 mit über 30.000 Personen erreicht, danach<br />
erfolgte e<strong>in</strong> Rückgang um über 2.000 Auszubildende oder 8 %.<br />
Tab. 4 Auszubildende <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen im dualen System 1980 - 1998<br />
Jahr <strong>in</strong>sgesamt<br />
<strong>in</strong> %<br />
1980 =<br />
100<br />
davon<br />
Arzthelfer/<strong>in</strong> Zahnarzthelfer/<strong>in</strong> Apothekenhelfer/<strong>in</strong>,<br />
seit 1993 pharmazeutisch-kaufm.Angestellte/r<br />
zusammen <strong>in</strong> % von<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
zusammen<br />
- 15 -<br />
<strong>in</strong> % von<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
zusammen<br />
<strong>in</strong> % von<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
Ges<strong>und</strong>heitshandwerk<br />
1<br />
zusammen<br />
<strong>in</strong> % von<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
1980 22.660 100,0 11.051 48,8% 3.440 15,2% 2.616 11,5% 5.553 24,5%<br />
1985 27.507 121,4 11.328 41,2% 7.377 26,8% 2.836 10,3% 5.966 21,7%<br />
1986 26.961 119,0 11.312 42,0% 7.410 27,5% 2.548 9,5% 5.691 21,1%<br />
1987 25.625 113,1 10.455 40,8% 7.257 28,3% 2.303 9,0% 5.610 21,9%<br />
1988 27.823 122,8 12.695 45,6% 7.459 26,8% 2.138 7,7% 5.531 19,9%<br />
1989 26.134 115,3 11.951 45,7% 7.252 27,7% 2.013 7,7% 4.918 18,8%<br />
1990 25.970 114,6 12.406 47,8% 7.217 27,8% 1.991 7,7% 4.356 16,8%<br />
1991 27.859 122,9 13.841 49,7% 7.436 26,7% 2.085 7,5% 4.497 16,1%<br />
1992 29.915 132,0 14.444 48,3% 7.806 26,1% 2.328 7,8% 5.337 17,8%<br />
1993 30.377 134,1 14.822 48,8% 7.902 26,0% 1.931 6,4% 5.722 18,8%<br />
1994 29.738 131,2 14.135 47,5% 8.353 28,1% 1.408 4,7% 5.842 19,6%<br />
1995 29.928 132,1 13.888 46,4% 8.587 28,7% 1.739 5,8% 5.714 19,1%<br />
1996 29.117 128,5 12.885 44,3% 8.933 30,7% 1.784 6,1% 5.515 18,9%<br />
1997 29.195 128,8 12.542 43,0% 9.407 32,2% 1.829 6,3% 5.417 18,6%<br />
1998 27.926 123,2 11.668 41,8% 9.207 33,0% 1.865 6,7% 5.186 18,6%<br />
1 Zahntechniker/<strong>in</strong>nen, Augenoptiker/<strong>in</strong>nen, Hörgeräteakustiker/<strong>in</strong>nen Orthopädiemechaniker/<strong>in</strong>nen, Bandagist/<strong>in</strong>nen, Orthopädieschuhmacher/<strong>in</strong>nen,<br />
Brillenoptikschleifer/<strong>in</strong>nen, Pharmakant/<strong>in</strong>nen, Chirurgiemechaniker/<strong>in</strong>nen<br />
Quelle: LDS, Berufsbildungsstatistik, Berechnungen FfG<br />
Unter den Ges<strong>und</strong>heitsberufen stellen Ausbildungen <strong>in</strong> der Sprechst<strong>und</strong>enhilfe den größten Zweig<br />
<strong>in</strong>nerhalb des dualen Systems. Auf die Berufe Arzthelfer<strong>in</strong> <strong>und</strong> Zahnarzthelfer<strong>in</strong> entfallen 1998 fast<br />
75 % der Ausbildungsplätze. Beide Ausbildungsberufe s<strong>in</strong>d re<strong>in</strong>e Frauenberufe, der Anteil der weiblichen<br />
Auszubildenden beträgt annähernd 100 % (s. Tab. 5). Die Anteile ausländischer Auszubildender<br />
liegen mit 14,2 % bei den Arzthelfer/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> 12 % bei den Zahnarzthelfer/<strong>in</strong>nen im Durchschnitt<br />
höher als an den Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s, sie s<strong>in</strong>d allerd<strong>in</strong>gs leicht rückläufig (s. Anhang, Tab.<br />
A 1)<br />
4<br />
1997 betrug der Anteil der Auszubildenden <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen an den Schüler/<strong>in</strong>nen der Berufsschulen<br />
(285.897 Schüler/<strong>in</strong>nen) 10,2 %, am Gesamt der Schüler/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> beruflichen Schulen (471.052 Schüler/<strong>in</strong>nen)<br />
jedoch nur 5,9 %.
Auszubildende <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen<br />
Die Ausbildung zur Apothekenhelfer/<strong>in</strong> wurde 1993 durch e<strong>in</strong>e Neuregelung der Ausbildungsordnung<br />
<strong>in</strong> die 3-jährige Ausbildung zur/m pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten überführt. Während<br />
Mitte der 80er Jahre mit etwas über 2.800 Auszubildenden noch über 10 % der Ausbildungen im dualen<br />
System auf diese Ausbildungsrichtung entfielen, erfolgt bis 1998 e<strong>in</strong>e Reduktion auf etwas über<br />
1.800 Auszubildende, bzw. 6,7 %. Auch hier f<strong>in</strong>den sich fast ausschließlich weibliche Auszubildende,<br />
der Anteil ausländischer Auszubildender ist mit über e<strong>in</strong>em Viertel überdurchschnittlich hoch (s. Anhang<br />
Tab. A 1).<br />
Tab. 5 Anteil weiblicher Auszubildender <strong>in</strong> ausgewählten Ges<strong>und</strong>heitsberufen im dualen<br />
System 1980 - 1998<br />
Jahr Arzthelfer/<strong>in</strong> Zahnarzthelfer-<br />
/<strong>in</strong><br />
Apothekenhelfer/<strong>in</strong>,<br />
seit<br />
1993 pharmazeutischkaufm.Angestellte/r<br />
Ges<strong>und</strong>heits- darunter<br />
handwerkZahntechniker/<strong>in</strong> - 16 -<br />
Augenoptiker/<strong>in</strong><br />
Orthopädiemechaniker/<strong>in</strong><br />
<strong>und</strong><br />
Bandagist/-<strong>in</strong><br />
Hörgeräteakustiker/<strong>in</strong><br />
1980 99,9% 100,0% 99,9% 39,7% 39,0% 50,5% 4,7% 61,8%<br />
1985 99,9% 100,0% 100,0% 51,5% 50,8% 63,8% 9,7% 57,5%<br />
1990 99,9% 100,0% 99,8% 57,3% 56,3% 70,5% 13,7% 58,4%<br />
1995 99,8% 100,0% 99,4% 56,0% 55,9% 65,7% 36,8% 56,3%<br />
1996 99,8% 100,0% 99,4% 54,6% 53,4% 68,3% 38,2% 54,6%<br />
1997 99,7% 99,9% 99,3% 54,9% 54,3% 69,0% 36,5% 54,9%<br />
1998 99,7% 99,9% 99,4% 54,7% 54,2% 69,1% 37,2% 57,3%<br />
Quelle: LDS, Berufsbildungsstatistik, Berechnungen FfG<br />
In den verschiedenen Ausbildungen des Ges<strong>und</strong>heitshandwerks f<strong>in</strong>den sich 1998 mit ca. 5.200 Personen<br />
etwas über 18 % der Auszubildenden <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen im dualen System. Zahntechniker/<strong>in</strong>nen<br />
(2.879 Auszubildende) <strong>und</strong> Augenoptiker/<strong>in</strong>nen (1.162 Auszubildende) bilden mit 55,5 %<br />
bzw. 22,4 % die größten Berufsgruppen (s. Anhang, Tab. A 2). Im Ges<strong>und</strong>heitshandwerk f<strong>in</strong>det sich<br />
im Gegensatz zu allen anderen nichtakademischen Ausbildungsberufen im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> e<strong>in</strong> relativ<br />
ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. Die Zahl der weiblichen Auszubildenden liegt 1998 bei<br />
knapp 55 % mit leicht rückläufiger Tendenz. Den höchsten Frauenanteil 1998 weist mit knapp 70 %<br />
die Ausbildung zur/zum Augenoptiker/<strong>in</strong> auf. Aber auch <strong>in</strong> traditionell eher männlich geprägten Bereichen<br />
des Ges<strong>und</strong>heitshandwerks, wie z.B. der Orthopädiemechanik, konnten Frauen <strong>in</strong> den letzten<br />
Jahren an Boden gew<strong>in</strong>nen. Der Anteil der weiblichen Auszubildenden stieg von knapp 5 % Anfang<br />
der 80er Jahre auf über 37 % Ende der 90er. Der Anteil ausländischer Auszubildender sank im gesamten<br />
Ges<strong>und</strong>heitshandwerk zwischen 1993 <strong>und</strong> 1998 von 11,6 % auf 7,5 % (s. Anhang, Tab. A 2).<br />
Seit 1993 s<strong>in</strong>d die Auszubildendenzahlen <strong>in</strong> den dualen Ausbildungsberufen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s<br />
um 8 % zurückgegangen. Dieser Trend resultiert vor allem aus s<strong>in</strong>kenden Auszubildendenzahlen bei<br />
den Arzthelfer/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> im Ges<strong>und</strong>heitshandwerk.
Auszubildende <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen<br />
Abb. 4 Auszubildende <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen an berufsbildenden Schulen 1985 - 1998<br />
(1985 = 100)<br />
150%<br />
125%<br />
100%<br />
75%<br />
50%<br />
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998<br />
<strong>in</strong>sg. A rzth elfer/<strong>in</strong>n en<br />
Z ah narzthelfer/<strong>in</strong>n en Ges<strong>und</strong>heitshandwerk<br />
Apothekenhelfer/<strong>in</strong> / pharm azeut.-kaufm . Angestellte<br />
Quelle: LDS, Berufsbildungsstatistik, Darstellung FfG<br />
Die Zahl der Arzthelfer/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> Ausbildung nahm um über e<strong>in</strong> Fünftel von 14.822 im Jahr 1993 auf<br />
11.668 <strong>in</strong> 1998 ab. Und von 1997 auf 1998 g<strong>in</strong>g erstmals auch die Zahl der Zahnarzthelfer/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong><br />
Ausbildung um 2,1 % oder 200 Personen zurück. E<strong>in</strong>er Umfrage des Berufsverbandes der Arzt-,<br />
Zahnarzt- <strong>und</strong> Tierarzthelfer<strong>in</strong>nen aus dem Jahr 1999 folgend, setzt sich dieser Rückgang neu abgeschlossener<br />
Ausbildungsverträge <strong>in</strong> der Sprechst<strong>und</strong>enhilfe im Jahr 1999 fort (Berufsverband der<br />
Arzt-, Zahnarzt- <strong>und</strong> Tierarzthelfer<strong>in</strong>nen 2000). Im Ges<strong>und</strong>heitshandwerk reduzierte sich bis 1998 die<br />
Auszubildendenzahl ebenfalls seit e<strong>in</strong>em letzten Höchststand von etwas über 5.800 Personen im Jahr<br />
1994 um 11,2 %. Von langfristigen Reduzierungen s<strong>in</strong>d hier vor allem die großen Ausbildungsberufe<br />
betroffen, die Zahntechnik (1980: 3.556 Azubis, 1998: 2.879 Azubis) <strong>und</strong> die Augenoptik (1980:<br />
1.478, 1998: 1.162). Demgegenüber erfolgt z.B. bei den Orthopädiemechaniker/<strong>in</strong>nen/ Bandagist/<strong>in</strong>nen<br />
(1980: 211, 1998: 436) sowie den Hörgeräteakustiker/<strong>in</strong>nen (1980: 68, 1998: 316) e<strong>in</strong> kont<strong>in</strong>uierlicher<br />
Anstieg der Ausbildungszahlen, allerd<strong>in</strong>gs ausgehend von e<strong>in</strong>em deutlich niedrigeren<br />
Niveau (s. Anhang Tab. A 2).<br />
Für die Ausbildungen <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen, die im dualen System verortet s<strong>in</strong>d, lässt sich somit zwar<br />
für den gesamten Betrachtungszeitraum e<strong>in</strong> Ausbau der Ausbildungskapazitäten feststellen. Seit 1993<br />
f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong>sgesamt jedoch eher stagnierende oder rückläufige Tendenzen mit Ausnahme e<strong>in</strong>iger<br />
kle<strong>in</strong>erer Berufe im Ges<strong>und</strong>heitshandwerk.<br />
2.1.3. Hochschulen <strong>und</strong> Universitäten<br />
Im W<strong>in</strong>tersemester 1998/99 befanden sich <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen knapp 32.000 Personen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
der traditionellen Studiengänge für Ges<strong>und</strong>heitsberufe - der allgeme<strong>in</strong>en Mediz<strong>in</strong> <strong>und</strong> der Zahnmediz<strong>in</strong><br />
5 , der Pharmazie sowie der Psychologie.<br />
5 Die Hochschulstatistik differenziert <strong>in</strong>nerhalb der Humanmediz<strong>in</strong> zwischen „Allgeme<strong>in</strong>mediz<strong>in</strong>“ <strong>und</strong><br />
„Zahnmediz<strong>in</strong>“. Diese Term<strong>in</strong>ologie wird der folgenden Darstellung zu Gr<strong>und</strong>e gelegt.<br />
- 17 -
Auszubildende <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen<br />
Student/<strong>in</strong>nen der Allgeme<strong>in</strong>en Mediz<strong>in</strong> bilden dabei mit über 55 % die größte Gruppe unter den Studierenden,<br />
gefolgt von Psychologiestudent/<strong>in</strong>nen, auf die mittlerweile e<strong>in</strong> Anteil von 28 % entfällt,<br />
Tendenz steigend. Die Studiengänge Zahnmediz<strong>in</strong> <strong>und</strong> Pharmazie vere<strong>in</strong>en jeweils etwas über 8 % der<br />
Studierenden <strong>in</strong> akademischen Ges<strong>und</strong>heitsberufen auf sich.<br />
Tab. 6 Student/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> traditionellen akademischen Ges<strong>und</strong>heitsberufen 1955 bis 1998<br />
W<strong>in</strong>tersemester<br />
<strong>in</strong>sgesamt <strong>in</strong> %<br />
1985/86<br />
= 100<br />
davon<br />
Allgeme<strong>in</strong>e Mediz<strong>in</strong> Zahnmediz<strong>in</strong> Pharmazie Psychologie<br />
zusammen<br />
<strong>in</strong> % von zusammen <strong>in</strong> % von zusammen <strong>in</strong> % von zusammen <strong>in</strong> % von<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
53,9% 381 1<br />
9,7% 520 1<br />
13,2% 918 1,2<br />
23,3%<br />
69,6% 818 1<br />
9,0% 860 1<br />
9,5% 1.081 1<br />
11,9%<br />
8,2% 2.873 17,5%<br />
1955/56 3.944 1<br />
2.125 1<br />
1965/66 9.063 1<br />
6.304 1<br />
1975/76 16.402 10.759 65,6% 1.424 8,7% 1.346 1<br />
1985/86 34.658 100,0% 23.581 68,0% 3.069 8,9% 2.580 7,4% 5.428 15,7%<br />
1986/87 35.123 101,3% 23.933 68,1% 3.142 8,9% 2.582 7,4% 5.466 15,6%<br />
1987/88 35.523 102,5% 24.157 68,0% 3.204 9,0% 2.612 7,4% 5.550 15,6%<br />
1988/89 35.474 102,4% 24.105 68,0% 3.251 9,2% 2.600 7,3% 5.518 15,6%<br />
1989/90 34.784 100,4% 23.445 67,4% 3.256 9,4% 2.531 7,3% 5.552 16,0%<br />
1990/91 34.114 98,4% 22.752 66,7% 3.184 9,3% 2.518 7,4% 5.660 16,6%<br />
1991/92 33.357 96,2% 21.937 65,8% 3.108 9,3% 2.514 7,5% 5.798 17,4%<br />
1992/93 31.755 91,6% 20.535 64,7% 2.958 9,3% 2.364 7,4% 5.898 18,6%<br />
1993/94 30.951 89,3% 19.414 62,7% 2.816 9,1% 2.305 7,4% 6.416 20,7%<br />
1994/95 30.512 88,0% 18.540 60,8% 2.735 9,0% 2.325 7,6% 6.912 22,7%<br />
1995/96 29.928 86,4% 17.789 59,4% 2.615 8,7% 2.340 7,8% 7.184 24,0%<br />
1996/97 30.041 86,7% 17.585 58,5% 2.567 8,5% 2.355 7,8% 7.534 25,1%<br />
1997/98 30.870 84,6% 17.052 55,2% 2.656 8,6% 2.564 8,3% 8.598 27,9%<br />
1998/99 31.885 86,4% 17.787 55,8% 2.597 8,1% 2.576 8,1% 8.925 28,0%<br />
1 nur dt. Studierende<br />
2 nur angegeben als Kulturwissenschaft, e<strong>in</strong>schließlich Philosophie, Pädagogik, Geschichte, Kunstwissenschaft, Musikwissenschaft, Zeitungswissenschaft<br />
Quelle: LDS, Hochschulstatistik, Berechnungen FfG<br />
Die Frauenanteile liegen <strong>in</strong> den Studiengängen Pharmazie <strong>und</strong> Psychologie traditionell hoch. So lag<br />
bereits <strong>in</strong> den 50er <strong>und</strong> 60er Jahren der Anteil der weiblichen Studierenden <strong>in</strong> der Pharmazie über<br />
50 %; 1998 s<strong>in</strong>d fast 70 % der Pharmaziestudent/<strong>in</strong>nen weiblich. Allerd<strong>in</strong>gs dokumentiert dieser Trend<br />
weniger e<strong>in</strong>e geschlechtsspezifische Gleichstellung, sondern nach E<strong>in</strong>schätzung der B<strong>und</strong>esvere<strong>in</strong>igung<br />
Deutscher Apothekerverbände vor allem auch die mangelnde Attraktivität pharmazeutischer<br />
Berufe für Männer aufgr<strong>und</strong> der niedrigen Tarife <strong>in</strong> öffentlichen Apotheken (Oppenkowski 2000). In<br />
der Psychologie stieg der Anteil der weiblichen Studierenden von etwas über 42 % <strong>in</strong> den 60er Jahren<br />
auf knapp 70 % Ende der 90er Jahre (s. Tab. 7).<br />
- 18 -
Auszubildende <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen<br />
Tab. 7 Anteil weiblicher Studierender <strong>in</strong> den akademischen Ges<strong>und</strong>heitsberufen 1955 -<br />
1998<br />
W<strong>in</strong>tersemester allgeme<strong>in</strong>e<br />
Mediz<strong>in</strong><br />
Zahnmediz<strong>in</strong> Pharmazie Psychologie<br />
1955/56 32,1% 26,5% 67,9% 1<br />
1965/66 27,5% 22,6% 53,1% 1<br />
1975/76 28,5% 1<br />
18,2% 1<br />
46,5% 1<br />
- 19 -<br />
27,1% 1,2<br />
42,4% 1<br />
47,9% 1<br />
1985/86 43,2% 27,7% 64,0% 57,5%<br />
1990/91 44,9% 34,4% 67,2% 62,1%<br />
1995/96 47,0% 42,9% 72,3% 68,1%<br />
1998/99 49,5% 47,7% 69,8% 69,3%<br />
1) nur dtsch. Studierende<br />
2) WS 1955/56 nur angegeben als Kulturwissenschaft, e<strong>in</strong>schließlich Philosophie, Pädagogik, Geschichte, Kunstwissenschaft, Musikwissenschaft,<br />
Zeitungswissenschaft u.a.<br />
Quelle: LDS, Hochschulstatistik, Berechnungen FfG<br />
Aber auch die mediz<strong>in</strong>ischen Studiengänge haben sich <strong>in</strong> den letzten Jahrzehnten für Frauen geöffnet.<br />
In der Allgeme<strong>in</strong>en Mediz<strong>in</strong> stieg der Anteil der weiblichen Studierenden seit Mitte der 60er Jahre von<br />
27,5 % auf fast 50 %, <strong>in</strong> der Zahnmediz<strong>in</strong> von 22,6 % auf knapp 48 % im Jahr 1998. Der Anteil der<br />
ausländischen Studierenden lag 1998 <strong>in</strong> der Humanmediz<strong>in</strong> bei 12,2 % (s. Anhang, Tab. A 3).<br />
Abb. 5 Entwicklung der Studierendenzahlen <strong>in</strong> akademischen Ges<strong>und</strong>heitsberufen 1985 –<br />
1998 (1985 = 100)<br />
200%<br />
175%<br />
150%<br />
125%<br />
100%<br />
75%<br />
50%<br />
1985/86 1987/88 1989/90 1991/92 1993/94 1995/96 1997/98<br />
Studenten <strong>in</strong>sg. allg. Mediz<strong>in</strong> Zahnmediz<strong>in</strong> Pharmazie Psychologie<br />
Quelle: LDS, Hochschulstatistik, Darstellung FfG<br />
Bezüglich der quantitativen Entwicklung der Studierendenzahlen erfolgte im Gesamtbetrachtungszeitraum<br />
e<strong>in</strong> besonders starker Anstieg zwischen 1975 <strong>und</strong> 1985. Die Zahl der Studierenden erhöhte sich<br />
von ca. 16.400 auf 34.600 Personen oder um 110 %. In diesem Zeitraum verdoppelte sich <strong>in</strong> fast allen<br />
der zur Betrachtung stehenden Studiengängen die Studentenzahl.<br />
Seit Ende der 80er Jahre gehen <strong>in</strong> den akademischen Ges<strong>und</strong>heitsberufen <strong>in</strong>sgesamt die Studierendenzahlen<br />
zurück. Bis 1998 sank die Zahl der Studierenden von ca. 35.500 auf ca. 31.900, oder um<br />
10,2 %. Dieser Rückgang resultiert vor allem aus e<strong>in</strong>er Begrenzung der Studienplätze <strong>in</strong> der Allgeme<strong>in</strong>en<br />
Mediz<strong>in</strong>. Seit e<strong>in</strong>em Höchststand von über 24.000 Studierenden im W<strong>in</strong>tersemester 1987/88,
Auszubildende <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen<br />
reduzierte sich die Zahl der Mediz<strong>in</strong>student/<strong>in</strong>nen um über 25 % auf knapp 17.800. Auch <strong>in</strong> der<br />
Zahnmediz<strong>in</strong> erfolgte e<strong>in</strong>e Anpassung des Studienangebotes. Hier g<strong>in</strong>gen die Studentenzahlen seit<br />
dem W<strong>in</strong>tersemester 1989/90 um e<strong>in</strong> Fünftel von ca. 3.200 auf ca. 2.600 1998 zurück.<br />
Während <strong>in</strong> der Pharmazie die Studierendenzahlen seit Mitte der 80er Jahre weitgehend stagnieren,<br />
f<strong>in</strong>det sich im Studienfach Psychologie, vor allem seit Anfang der 90er Jahre, e<strong>in</strong>e Ausweitung des<br />
Studienangebotes. Gegenüber 1985 stieg die Zahl der Psychologiestudent/<strong>in</strong>nen um 64,4 % von etwas<br />
über 5.400 auf fast 9.000 Studierende.<br />
Für die akademischen Erstausbildungen bleibt festzuhalten, dass das Studienangebot <strong>in</strong> der Humanmediz<strong>in</strong><br />
angesichts drohender Überkapazitäten bei ausgebildeten Ärzt/<strong>in</strong>nen reduziert worden ist,<br />
während <strong>in</strong> der Pharmazie seit Mitte der 80er Jahre die Ausbildungskapazitäten weitgehend gleichgeblieben<br />
s<strong>in</strong>d. Weiterh<strong>in</strong> steigende Studentenzahlen f<strong>in</strong>den sich alle<strong>in</strong> für das Studium der Psychologie.<br />
2.1.3.1. Fachhochschul- <strong>und</strong> Aufbaustudiengänge <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen<br />
In den letzten Jahren wurden <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen verschiedene Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Aufbaustudiengänge<br />
sowie e<strong>in</strong> Fernstudiengang im Ges<strong>und</strong>heitsbereich an Fachhochschulen <strong>und</strong> Universitäten angesiedelt.<br />
So f<strong>in</strong>den sich aktuell an 4 Fachhochschulen – KFH Köln, FH Münster, Bielefeld <strong>und</strong> die Ev. FH<br />
Bochum - sowie an der Privatuniversität Witten-Herdecke Studiengänge im Bereich Pflegepädagogik,<br />
-management <strong>und</strong> –wissenschaften. Drei Universitäten <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Fachhochschule weisen im Bereich<br />
der Sportwissenschaften Studienangebote mit Schwerpunkten <strong>in</strong> der Rehabilitation/ Prävention oder<br />
aber auch gr<strong>und</strong>ständige Studiengänge im Bereich Sportmanagement aus. An vier Universitäten -<br />
Bielefeld, Düsseldorf, Köln <strong>und</strong> Münster - sowie zwei Fachhochschulen - Gelsenkirchen <strong>und</strong> Remagen<br />
- f<strong>in</strong>den sich Studienangebote <strong>in</strong> den Ges<strong>und</strong>heitswissenschaften <strong>und</strong> der Ges<strong>und</strong>heitsökonomie<br />
bzw. dem Krankenhausmanagement. Nicht immer handelt es sich dabei um Gr<strong>und</strong>- oder Aufbaustudiengänge,<br />
sondern z.T. um Schwerpunkte <strong>in</strong>nerhalb von gr<strong>und</strong>ständigen Studienangeboten. So besteht<br />
z.B. an der Universität Münster wie an der Fachhochschule Gelsenkirchen die Möglichkeit, <strong>in</strong>nerhalb<br />
der wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge Schwerpunkte auf die Krankenhausbetriebslehre/ das<br />
Krankenhausmanagement zu legen. Genaue Angaben bezüglich der Zahl der Studierenden konnten für<br />
diese Angebote nicht ermittelt werden. Die nachfolgende Tabelle beschränkt sich dementsprechend<br />
auf die Zahl der Studierenden <strong>in</strong> den gr<strong>und</strong>ständigen Studienangeboten, den Zusatzstudiengängen sowie<br />
dem Fernstudiengang „Angewandte Ges<strong>und</strong>heitswissenschaft“ an der Universität Bielefeld.<br />
- 20 -
Auszubildende <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen<br />
Tab. 8 Anzahl der Studierenden <strong>in</strong> den Studienbereichen Pflege, Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Sport-<br />
wissenschaften/-ökonomie <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen 1998<br />
Studienrichtung<br />
Studierende<br />
Anzahl <strong>in</strong> % von<br />
<strong>in</strong>sg.<br />
- 21 -<br />
davon an Universitäten<br />
<strong>in</strong> %<br />
Ges<strong>und</strong>heitswissenschaften/<br />
Ges<strong>und</strong>heitsökonomie, -wirtschaft<br />
ca. 800 32,5 % 75,0 %<br />
Pflege, -pädagogik, -management,<br />
-wissenschaften<br />
ca. 840 34,1 % 16,7 %<br />
Sportwissenschaften/-management ca. 820 33,3 % 88,0 %<br />
Insgesamt ca. 2.460 100 % 59,3 %<br />
Quelle: Eigene Erhebung <strong>und</strong> Berechnung FfG <strong>und</strong> IAT<br />
Die <strong>in</strong>sgesamt ca. 2.460 Studierenden verteilen sich im Jahr 1998 relativ gleichmäßig auf die drei zur<br />
Betrachtung stehenden großen Studienrichtungen. Deutlich wird allerd<strong>in</strong>gs, dass <strong>in</strong>sbesondere die<br />
Studienangebote im Bereich der Pflege schwerpunktmäßig an den Fachhochschulen angesiedelt s<strong>in</strong>d,<br />
während Studienmöglichkeiten im Bereich der Ges<strong>und</strong>heitswissenschaften oder des „Public Health“<br />
sowie im Bereich der Sportwissenschaften an den Universitäten angeboten werden.<br />
Angesichts der <strong>in</strong> allen E<strong>in</strong>richtungen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s steigenden Anforderungen im Bereich<br />
des Managements <strong>und</strong> der wirtschaftlichen Betriebsführung ist davon auszugehen, dass <strong>in</strong> den nächsten<br />
Jahren der Bedarf an akademisch qualifiziertem Personal noch zunehmen wird (Robert-Bosch-<br />
Stiftung 1992) <strong>und</strong> vor diesem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Ausweitung des Studienangebotes für qualifizierte<br />
Aufgaben im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> erfolgen wird.<br />
2.1.4. Zusammenfassung<br />
Ausbildungen <strong>in</strong> den akademischen <strong>und</strong> nichtakademischen Ges<strong>und</strong>heitsberufen haben unter bildungspolitischer<br />
Perspektive seit den 50er Jahren an deutlichem Stellenwert für den Ausbildungsmarkt<br />
gewonnen. 1998 bef<strong>in</strong>den sich knapp 104.000 Schüler/<strong>in</strong>nen, Auszubildende <strong>und</strong> Student/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>er Erstausbildung zu e<strong>in</strong>em Ges<strong>und</strong>heitsberuf; zählt man die neueren Studienangebote im Bereich<br />
der Ges<strong>und</strong>heitswissenschaften, Pflege <strong>und</strong> der Sportwissenschaften h<strong>in</strong>zu, erhöht sich die Zahl auf ca.<br />
106.300 Personen. Die Bedeutung schulischer Ausbildungsgänge gegenüber universitären Ausbildungen<br />
ist dabei seit Mitte der 80er Jahre gestiegen, über 41 % der Auszubildenden <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen<br />
f<strong>in</strong>den sich 1998 an den Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s.<br />
Fast 75 % aller Schüler/<strong>in</strong>nen, Auszubildenden <strong>und</strong> Student/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> den Ges<strong>und</strong>heitsberufen s<strong>in</strong>d<br />
weiblich, allerd<strong>in</strong>gs differieren die Anteile je nach Ausbildungsgang. In den prestigeträchtigen akademischen<br />
Ausbildungen, <strong>in</strong>sbesondere der Allgeme<strong>in</strong>- <strong>und</strong> der Zahnmediz<strong>in</strong>, liegt der Anteil der weiblichen<br />
Studierenden 1998 noch unter 50 %, während z.B. bezüglich der Sprechst<strong>und</strong>enhilfe von e<strong>in</strong>em<br />
re<strong>in</strong>en Frauenberuf gesprochen werden kann. Allerd<strong>in</strong>gs s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den letzten Jahren <strong>und</strong> Jahrzehnten<br />
Veränderungen <strong>in</strong> der Beteiligung der Geschlechter zu verzeichnen. Die Ausbildungen an den Schulen<br />
des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s haben für Männer etwas an Attraktivität gewonnen, während sich das Studium<br />
der Humanmediz<strong>in</strong> zunehmend für Frauen geöffnet hat.
Auszubildende <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen<br />
Die Aufarbeitung hat für den Gesamtbetrachtungszeitraum e<strong>in</strong>en deutlichen Zuwachs an Ausbildungskapazitäten<br />
<strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen gezeigt. In den großen Ausbildungsgängen, den Ausbildungen <strong>in</strong><br />
der Kranken- <strong>und</strong> Altenpflege, der Sprechst<strong>und</strong>enhilfe sowie dem Studium der Humanmediz<strong>in</strong>, s<strong>in</strong>d <strong>in</strong><br />
den 90er Jahren jedoch E<strong>in</strong>schnitte im Ausbildungsangebot festzustellen, die z.T. auf Anpassungen an<br />
erwartete niedrigere Bedarfe zurückzuführen s<strong>in</strong>d. Während z.B. noch <strong>in</strong> den späten 60er <strong>und</strong> frühen<br />
70er Jahren der Ausbau von Ausbildungskapazitäten für Mediz<strong>in</strong>er/<strong>in</strong>nen betrieben wurde, änderten<br />
sich unter dem E<strong>in</strong>druck der Kostendämpfungspolitik seit Mitte der 70er Jahre die Vorzeichen der<br />
politischen Debatte. Angenommen wurde, dass gerade auch die steigende Zahl der Ärzt/<strong>in</strong>nen zu der<br />
Leistungs- <strong>und</strong> Kostenausweitung im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> beiträgt (Döhler 1990; Alber/Bernadi-<br />
Schenkluhn 1992). Da die Länder sich zunächst auf e<strong>in</strong>e Studienplatzreduktion nicht e<strong>in</strong>igen konnten,<br />
<strong>in</strong>tervenierte der B<strong>und</strong> mit der 7. Verordnung zur Änderung der Approbationsordnung. Die Festschreibung<br />
kle<strong>in</strong>er Lerngruppen beschränkte die Kapazitäten der Hochschulen. In der Folge setzte e<strong>in</strong><br />
schrittweiser Rückgang der Studentenzahlen e<strong>in</strong>. Auch das rückgehende Angebot an Ausbildungsplätzen<br />
<strong>in</strong> der Sprechst<strong>und</strong>enhilfe ist e<strong>in</strong>e, diesmal allerd<strong>in</strong>gs mittelbare, Folge der Kostendämpfungspolitik.<br />
Angesichts der Budgetierung der ambulanten ärztlichen Versorgung gehen Arztpraxen z.T. dazu<br />
über, durch Abbau von Ausbildungsmöglichkeiten Kosten zu sparen. Auch <strong>in</strong> den Krankenhäusern ist<br />
seit E<strong>in</strong>führung der Budgetierung der Trend zu verzeichnen, über den Abbau von Ausbildungsplätzen<br />
Kosten zu senken.<br />
Diese Entwicklungen wurden bislang durch steigende Auszubildendenzahlen <strong>in</strong> den akademischen<br />
<strong>und</strong> schulischen therapeutischen Berufen wie der Psychologie, der Physiotherapie, der Logopädie <strong>und</strong><br />
der Ergotherapie ausgeglichen. Zudem wurden durch die Schaffung neuer Studiengänge im Bereich<br />
der Pflege- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitswissenschaften Möglichkeiten der beruflichen Höherqualifizierung geschaffen,<br />
die zukünftig noch an Gewicht gew<strong>in</strong>nen werden.<br />
2.2. Stationäre mediz<strong>in</strong>ische Versorgung<br />
Die Darstellung <strong>und</strong> Analyse der arbeitsmarktpolitischen Entwicklung im stationären Sektor sieht sich<br />
mit Problemen <strong>in</strong> Datenlage <strong>und</strong> Methodik konfrontiert. Das Jahr 1990 br<strong>in</strong>gt für die Krankenhausstatistik<br />
e<strong>in</strong>e tiefgreifende Zäsur mit sich. Die Krankenhausstatistik wurde vom Statistischen B<strong>und</strong>esamt<br />
nach der Systematik der Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) vom 10.04.1990 umgestellt. Die<br />
Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen wurden aus der Krankenhausstatistik ausgegliedert <strong>und</strong><br />
als eigenständiger Bereich ausgewiesen. Die alte Aufteilung der Krankenhäuser <strong>in</strong> Akut- <strong>und</strong> Sonderkrankenhäuser<br />
wurde durch e<strong>in</strong>e Neugliederung <strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>e <strong>und</strong> sonstige Krankenhäuser ersetzt.<br />
Inhaltlich unterscheidet sich die neu geschaffene Kategorisierung von der vorausgegangenen so gravierend,<br />
dass die bruchlose Darstellung <strong>und</strong> Analyse der Zeitreihen der Krankenhausstatistik nicht<br />
möglich s<strong>in</strong>d. H<strong>in</strong>zu kommt, dass die Sonderkrankenhäuser erst ab 1975 getrennt geführt werden <strong>und</strong><br />
dass nicht alle für unsere Fragestellung wichtigen Zeitreihen, wie z.B. zur Teilzeitarbeit, durchgängig<br />
erhoben wurden. Aus diesem Gr<strong>und</strong> erfolgt die Darstellung der Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> der<br />
stationären mediz<strong>in</strong>ischen Versorgung <strong>in</strong> zwei getrennten Zeitabschnitten: zum e<strong>in</strong>en für den Zeitraum<br />
- 22 -
Allgeme<strong>in</strong>e <strong>und</strong> sonstige Krankenhäuser, Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
nach der Umstellung der Krankenhausstatistik seit 1991 <strong>und</strong> daran anschließend für die weiter zurückliegenden<br />
Zeiträume.<br />
2.2.1. Allgeme<strong>in</strong>e Krankenhäuser, sonstige Krankenhäuser sowie Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
(1991 bis 1998)<br />
1998 waren <strong>in</strong> den drei Krankenhaustypen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen <strong>in</strong>sgesamt 255.351 Personen beschäftigt.<br />
87,2% der Beschäftigten entfielen dabei auf die allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäuser, 7,5% auf die<br />
sonstigen Krankenhäuser <strong>und</strong> 5,3% auf die Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen. 1991 arbeiteten<br />
251.514 Menschen im stationären Sektor. Die Zunahme bis 1998 betrug somit 1,5% bzw. 3.837<br />
Personen. Berechnet man die Vollzeitäquivalente 6 , so g<strong>in</strong>g die Beschäftigung von 217.215 im Jahr<br />
1991 auf 214.433 Vollzeitäquivalente im Jahr 1998 zurück, was e<strong>in</strong>em Rückgang um 1,3% entspricht<br />
(vgl. Abb. 6). 7<br />
Abb. 6 Entwicklung der Beschäftigtenzahlen im stationären Sektor 1991 - 1998<br />
Beschäftigte im stationären Sektor<br />
280.000<br />
260.000<br />
240.000<br />
220.000<br />
200.000<br />
180.000<br />
160.000<br />
140.000<br />
120.000<br />
100.000<br />
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998<br />
Jahr<br />
Beschäftigte <strong>in</strong>sgesamt Vollzeitäquivalente<br />
Quelle: LDS, Krankenhausstatistik, Berechnung <strong>und</strong> Darstellung MHH<br />
Im gleichen Zeitraum ist die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten stark gestiegen. Waren 1991 68.598<br />
Personen bzw. 27% teilzeitbeschäftigt, so betrug dieser Anteil 1998 32% oder 81.837 Personen. Dies<br />
entspricht e<strong>in</strong>er Zunahme der Teilzeitbeschäftigten von 1991 bis 1998 um 19%. Im Zeitraum 1991 bis<br />
6 Die Umrechnung wurde analog dem Vorgehen der Ges<strong>und</strong>heitsberichterstattung durchgeführt. Hierbei gehen<br />
Vollzeitstellen mit dem Faktor 1 <strong>und</strong> Teilzeitstellen mit dem Faktor 0,5 <strong>in</strong> die Berechnung e<strong>in</strong>.<br />
- 23 -
Allgeme<strong>in</strong>e <strong>und</strong> sonstige Krankenhäuser, Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
1998 blieb der Anteil der weiblichen Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen nahezu konstant: Er lag 1991 bei 72,8%<br />
(=183.221) <strong>und</strong> 1998 bei 73,2% (=186.955). Der Anteil der weiblichen Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen unterscheidet<br />
sich über die drei E<strong>in</strong>richtungsarten ger<strong>in</strong>gfügig. Er lag bei den allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäusern<br />
<strong>und</strong> den Vorsorge- oder Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen im Zeitraum 1991-1998 ungefähr bei 75 %. Bei<br />
den sonstigen Krankenhäusern betrug er dagegen im gleichen Zeitraum circa 64 %. Dies ist vor allem<br />
darauf zurückzuführen, dass der Anteil der männlichen Pflegekräfte <strong>in</strong> den sonstigen Krankenhäusern<br />
höher ist als <strong>in</strong> den übrigen E<strong>in</strong>richtungsarten.<br />
Die <strong>in</strong>dexierte Beschäftigungsentwicklung (1991=100) im stationären Sektor (s. Abb. 7) spiegelt für<br />
die Jahre von 1991 bis 1998 e<strong>in</strong>en <strong>in</strong>sgesamt relativ gleichmäßigen Verlauf wider. 1995 wurde e<strong>in</strong><br />
kle<strong>in</strong>er Beschäftigungshöhepunkt erreicht, gefolgt von e<strong>in</strong>em leichten Abs<strong>in</strong>ken. Die Beschäftigungsentwicklung<br />
<strong>in</strong>sgesamt ist fast identisch mit der Beschäftigungsentwicklung der allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäuser.<br />
Die sonstigen Krankenhäuser sowie die Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen h<strong>in</strong>gegen<br />
haben <strong>in</strong> dem Zeitraum erhebliche Ausschläge <strong>in</strong> der Beschäftigungszunahme bzw. -abnahme zu<br />
verzeichnen.<br />
Abb. 7 Die Beschäftigungsentwicklung im stationären Sektor 1991 – 1998 (1991=100)<br />
150%<br />
140%<br />
130%<br />
120%<br />
110%<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998<br />
allgeme<strong>in</strong>e KH sonstige KH Vorsorge- <strong>und</strong> Reha Insgesamt <strong>in</strong>sgesamt<br />
Quelle: LDS, Krankenhausstatistik, Berechnung FfG, Darstellung MHH<br />
2.2.1.1. Allgeme<strong>in</strong>e Krankenhäuser (1991 – 1998)<br />
Als allgeme<strong>in</strong>e Krankenhäuser werden E<strong>in</strong>richtungen bezeichnet, die über vollstationäre Fachabteilungen<br />
verfügen, wobei die Betten nicht ausschließlich für psychiatrische <strong>und</strong> neurologische Patient/<br />
7 Die letzte Arbeitszeitverkürzung fand zum 1. 4. 1990 statt. Die tarifliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt<br />
- 24 -
Allgeme<strong>in</strong>e <strong>und</strong> sonstige Krankenhäuser, Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
-<strong>in</strong>nen vorbehalten s<strong>in</strong>d. Bei den allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäusern werden Hochschulkl<strong>in</strong>iken, Plankrankenhäuser<br />
<strong>und</strong> Krankenhäuser mit <strong>und</strong> ohne Versorgungsauftrag unterschieden <strong>und</strong> zusätzlich nach<br />
Trägerschaft (öffentlich, freigeme<strong>in</strong>nützig, privat) differenziert.<br />
Tab. 9 Allgeme<strong>in</strong>e Krankenhäuser - absoluter <strong>und</strong> relativer Anteil der Beschäftigten nach<br />
Berufsgruppe<br />
Berufsgruppen 1991 <strong>und</strong> 1998<br />
1991 1998 1991 1998<br />
absolut darunter absolut darunter relativer Anteil der Beschäftigten <strong>in</strong> %<br />
weiblich <strong>in</strong><br />
weiblich<br />
%<br />
<strong>in</strong> %<br />
Pflegepersonal 87.148 86,2% 91.949 86,1% 40,17% 41,27%<br />
Wirtschafts- <strong>und</strong> Technikbereich<br />
35.951 71,2% 29.961 66,9% 16,57% 13,45%<br />
Ärzt/<strong>in</strong>nen 24.431 27,2% 1<br />
26.543 29,9% 1<br />
11,26% 11,91%<br />
Med.-tech. Assistenzberufe 24.364 91,8% 26.653 90,7% 11,23% 11,96%<br />
Funktionsdienst 18.222 78,3% 20.144 78,1% 8,40% 9,04%<br />
Verwaltung 14.221 67,6% 15.203 67,0% 6,56% 6,82%<br />
Vorsorge <strong>und</strong> Rehabilitation 5.729 77,2% 6.413 74,1% 2,64% 2,88%<br />
Sonderdienste 6.594 53,1% 5.685 45,1% 3,04% 2,55%<br />
Zahnärzt/<strong>in</strong>nen 287 - 259 32,0% 0,13% 0,12%<br />
Gesamt 216.947 75,2% 2 222.810 74,6% 2<br />
1) nur bezogen auf hauptamtliche Ärzt<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ärzte<br />
2) ohne Assistenz- <strong>und</strong> Belegärzt<strong>in</strong>nen<br />
Quelle: LDS, Krankenhausstatistik; Berechnung MHH<br />
- 25 -<br />
100,00% 100,00%<br />
1998 waren <strong>in</strong> den allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäusern Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalens 222.810 Personen beschäftigt.<br />
Die Summe der Beschäftigten stieg zwischen 1991 <strong>und</strong> 1998 um 3% bzw. 5.863 Personen. Mit e<strong>in</strong>em<br />
relativen Anteil von 41% ist das Pflegepersonal mit Abstand die numerisch bedeutendste Berufsgruppe,<br />
gefolgt von den Berufsgruppen Wirtschafts- <strong>und</strong> Technikbereich <strong>und</strong> Ärzte. E<strong>in</strong> Beschäftigungswachstum<br />
ist <strong>in</strong> allen Berufsgruppen mit Ausnahme der Zahnärzte, dem Wirtschafts- <strong>und</strong> Technikbereich<br />
sowie im Bereich der Sonderdienste/Sonstige zu verzeichnen. Der Anteil der weiblichen Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen<br />
blieb fast konstant (1991: 75,2%, 1998: 74,6%).<br />
Abb. 8 zeichnet die Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong>nerhalb des betrachteten Acht-Jahreszeitraums nach.<br />
Deutlich zu erkennen ist, dass die Gesamtbeschäftigung nach e<strong>in</strong>em Maximum im Jahre 1995 (+8,1%)<br />
wieder rückläufig ist (1998 + 3%). Die Berufsgruppen der Ärzte, der therapeutischen Berufe sowie der<br />
Funktionsdienst konnten sich dieser Trendumkehr entziehen <strong>und</strong> stagnieren auf hohem Niveau (Ärzte<br />
+8,6%) bzw. wachsen entgegen der allgeme<strong>in</strong>en Entwicklung weiter (+11,8% bzw. +10,5%). Über<br />
den gesamten Betrachtungszeitraum abnehmend ist der Wirtschafts- <strong>und</strong> Technikbereich (-16,7%),<br />
während der Bereich der Sonderdienste nach e<strong>in</strong>em kont<strong>in</strong>uierlichen Anstieg bis 1995 (+12,6%) bis<br />
1998 um -13,8% s<strong>in</strong>kt.<br />
seither 38,5 St<strong>und</strong>en.
Allgeme<strong>in</strong>e <strong>und</strong> sonstige Krankenhäuser, Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
Abb. 8 Allgeme<strong>in</strong>e Krankenhäuser - Beschäftigungsentwicklung nach ausgewählten Berufsgruppen<br />
1991-1998 (1991=100)<br />
115%<br />
110%<br />
105%<br />
100%<br />
95%<br />
90%<br />
85%<br />
80%<br />
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998<br />
Jahre<br />
Ärzte/-<strong>in</strong>nen Pflegepersonal med. techn. Assistenzberufe<br />
Funktionsdienst<br />
Beschäftigte <strong>in</strong>sgesamt<br />
Wirtschafts- <strong>und</strong> Technikbereich Sonderdienste/ Sonstiges<br />
Quelle: LDS, Krankenhausstatistik, Berechnung FfG, Darstellung MHH<br />
Den größten relativen Anteil am Wachstum zwischen 1991 <strong>und</strong> 1998 hatte das Pflegepersonal (s. Anhang,<br />
Tab. A 4). Obgleich die Beschäftigung <strong>in</strong> anderen Berufsgruppen prozentual stärker angestiegen<br />
ist, schlägt hier der große Anteil der Berufsgruppe an der Gesamtbeschäftigung zu Buche. Diese Entwicklung<br />
ist allerd<strong>in</strong>gs konterkariert worden durch den hohen relativen Anteil der Berufsgruppe Wirtschafts-<br />
<strong>und</strong> Technikbereich am Rückgang der Beschäftigung. Die zweitstärkste Berufsgruppe im<br />
Krankenhaussektor hat <strong>in</strong> der Krankenhausstatistik erheblich an Boden verloren.<br />
Die Entwicklung der Leistungsdaten ist charakterisiert durch e<strong>in</strong>en sukzessiven Abbau der Bettenzahlen.<br />
Zudem sank trotz steigender Fallzahlen die Zahl der Pflegetage <strong>in</strong>sgesamt deutlich. Dies ist auf<br />
die Verkürzung der Verweildauer zurückzuführen. Beide Trends führen zu e<strong>in</strong>er Intensivierung des<br />
Leistungsgeschehens, <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> der Krankenhauspflege. Die pflege<strong>in</strong>tensiven Tage kurz nach<br />
e<strong>in</strong>er Operation bleiben erhalten, während die Patientenfluktuation steigt.<br />
Dieser Trend hat nicht erst <strong>in</strong> den 90er Jahren e<strong>in</strong>gesetzt. Die Krankenhausstatistik belegt für die Jahre<br />
1965 bis 1989, dass sich <strong>in</strong> diesem Zeitraum e<strong>in</strong>e ganz ähnliche Entwicklung vollzogen hat. So blieb<br />
<strong>in</strong> dem 24 Jahre dauernden Zeitraum die Anzahl der Pflegetage mit e<strong>in</strong>em Zuwachs von 0,5% praktisch<br />
konstant. Die Fallzahlen h<strong>in</strong>gegen stiegen um 56,7%, während die Verweildauer um 37,1% absank.<br />
E<strong>in</strong>zig der Zuwachs an Betten um 5,1% steht <strong>in</strong> Kontrast zu den Leistungsdaten der 90er Jahre.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs wurde bei den Bettenkapazitäten der Höhepunkt bereits Mitte der 70er Jahre erreicht. Seither<br />
ist für Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen e<strong>in</strong>e langsame Reduktion zu beobachten.<br />
- 26 -
Allgeme<strong>in</strong>e <strong>und</strong> sonstige Krankenhäuser, Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
Abb. 9 Allgeme<strong>in</strong>e Krankenhäuser - Leistungsdaten 1990 bis 1998 (1990=100)<br />
115<br />
110<br />
105<br />
100<br />
95<br />
90<br />
85<br />
80<br />
75<br />
70<br />
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998<br />
Betten Fallzahlen Pflegetage Nutzungsgrad Verweildauer<br />
Quelle: LDS, Krankenhausstatistik; Berechnung FfG, Darstellung MHH<br />
E<strong>in</strong> weiterer wichtiger Indikator h<strong>in</strong>sichtlich der Leistungserbr<strong>in</strong>gung ist die altersspezifische Inanspruchnahme<br />
von Krankenhausdienstleistungen. Seit 1993 liegen hierzu Daten vor. Tab. 10 zeigt die<br />
Differenzierung von aus dem Krankenhaus 8 entlassenen Patient/<strong>in</strong>nen nach Altersgruppen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
zwischen 1993 <strong>und</strong> 1996. Durch die Tabelle wird Verschiedenes deutlich: Insgesamt<br />
ist die Anzahl der aus dem Krankenhaus entlassenen Patient/<strong>in</strong>nen zwischen 1993 <strong>und</strong> 1996 um<br />
418.006 Personen gestiegen. Bed<strong>in</strong>gt durch die demographische Entwicklung nimmt jedoch die Anzahl<br />
der unter 25-jährigen Patient/<strong>in</strong>nen kont<strong>in</strong>uierlich ab, die Anzahl der über 64-Jährigen nimmt<br />
dagegen stark zu. Der Anteil der über 64-Jährigen an der Fallzahlensteigerung beträgt 224.964 oder<br />
53,8%. Es steigt aber nicht nur der Anteil der 65-Jährigen <strong>und</strong> älteren. Vielmehr nimmt auch der Anteil<br />
dieser Jahrgänge relativ zur E<strong>in</strong>wohnerzahl pro Altersgruppe stark zu, während bei den anderen<br />
Altersgruppen nur leichte Zunahmen beziehungsweise Stagnation zu verzeichnen s<strong>in</strong>d.<br />
Folglich nimmt nicht nur der relative <strong>und</strong> absolute Anteil der 65-Jährigen <strong>und</strong> älteren an der Anzahl<br />
der aus dem Krankenhaus entlassenen Patient/<strong>in</strong>nen zu, sondern auch die Zahl der Krankenhausfälle<br />
<strong>in</strong>nerhalb dieser Altersgruppe.<br />
8 Krankenhäuser s<strong>in</strong>d hierbei allgeme<strong>in</strong>e <strong>und</strong> sonstige Krankenhäuser.<br />
- 27 -
Allgeme<strong>in</strong>e <strong>und</strong> sonstige Krankenhäuser, Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
Tab. 10 Aus dem Krankenhaus entlassene Patient/<strong>in</strong>nen (e<strong>in</strong>schließlich Sterbe- <strong>und</strong> St<strong>und</strong>enfälle)<br />
nach Altersgruppen <strong>und</strong> Geschlecht 1993 - 1996<br />
Alter von ... 1993 1994 1995 1996<br />
bis ... Jahren <strong>in</strong>sgesamt 1<br />
<strong>in</strong> % je 1000<br />
von E<strong>in</strong>w.<br />
<strong>in</strong>sg.<br />
2<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
1<br />
<strong>in</strong> % je 1000<br />
von E<strong>in</strong>w.<br />
<strong>in</strong>sg.<br />
2<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
1<br />
<strong>in</strong> % je 1000<br />
von E<strong>in</strong>w.<br />
<strong>in</strong>sg.<br />
2<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
1<br />
<strong>in</strong> % je 1000<br />
von E<strong>in</strong>w.<br />
<strong>in</strong>sg.<br />
2<br />
0 – 14 357.802 10,7 126,1 366.799 10,5 127,6 369.445 10,0 127,4 368.199 9,8 126,2<br />
15 – 24 294.707 8,9 139,2 293.273 8,4 144,9 289.916 7,9 147,9 281.905 7,5 146,5<br />
25 – 39 655.893 19,7 150,6 679.534 19,5 154,0 705.481 19,1 158,8 708.668 18,9 159,3<br />
40 – 64 1.036.268 31,1 182,3 1.083.991 31,1 190,1 1.164.718 31,6 203,5 1.181.211 31,5 205,1<br />
65 – 74 486.524 14,6 304,7 545.490 15,6 328,0 594.642 16,1 350,9 611.576 16,3 359,5<br />
75 <strong>und</strong> mehr 495.009 14,9 439,7 517.934 14,9 466,7 563.041 15,3 499,8 594.921 15,9 512,4<br />
Alter unbekannt<br />
2.339 0,1 x 145 0,0 x 192 0,0 0 68 0,0 0<br />
Insgesamt 3.328.542 100,0 187,9 3.487.166 100,0 196,0 3.687.435 100,0 206,6 3.746.548 100,0 209,1<br />
1) e<strong>in</strong>schließlich Patienten unbekannten Geschlechts<br />
2) je 1000 E<strong>in</strong>wohner/<strong>in</strong>nen pro Altersgruppe, mittlere Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung<br />
Quelle: LÖGD nach Angaben des LDS, Krankenhausstatistik<br />
E<strong>in</strong>en wesentlichen E<strong>in</strong>fluss auf das Leistungsgeschehen hatte auch der mediz<strong>in</strong>isch-technische Fortschritt.<br />
Dies lässt sich anhand von Transplantationschirurgie, Kardiologie, der Diffusion <strong>und</strong> Nutzung<br />
von Großgeräten sowie der Herzchirurgie nachweisen.<br />
Die Transplantationschirurgie hat sich <strong>in</strong> Deutschland seit den 60er Jahren etabliert. Erstmals <strong>in</strong><br />
Deutschland wurden Nieren 1963, e<strong>in</strong>e Lunge (isoliert) 1967, e<strong>in</strong>e Leber 1969, e<strong>in</strong> Herz ebenfalls<br />
1969 <strong>und</strong> das Pankreas 1979 transplantiert (Bruckenberger 1999).<br />
In der Kardiologie kommt vor allem der koronarangiographische Arbeitsplatz zum E<strong>in</strong>satz. Erste Versuche,<br />
mit Hilfe von Kathedern Zugang zum l<strong>in</strong>ken Herzen zu erlangen, wurden Anfang der 50er Jahre<br />
unternommen. Bereits 1964 wurden erste gefäßerweiternde E<strong>in</strong>griffe durchgeführt. Mitte der 70er<br />
Jahre wurde die Ballondillatation entwickelt. Im Laufe der 80er Jahre kamen zahlreiche technische<br />
Neuerungen <strong>und</strong> Verbesserungen h<strong>in</strong>zu (Perleth/Busse 1999).<br />
Andere mediz<strong>in</strong>ische Großgeräte kamen zwischen Mitte der 70er <strong>und</strong> 80er Jahre zum breitenwirksamen<br />
E<strong>in</strong>satz. Erste Berichte über die Inbetriebnahme von Computertomographen 9 <strong>in</strong> Deutschland liegen<br />
für das Jahr 1976 vor (Bruckenberger 1983). Die extrakorporale Stoßwellenlithotripsie wurde <strong>in</strong><br />
Deutschland <strong>in</strong> den frühen 70er Jahren durch die Firma Dornier entwickelt <strong>und</strong> nach der Testphase<br />
erstmals 1982 <strong>in</strong> der Universitätskl<strong>in</strong>ik München Großhadern e<strong>in</strong>gesetzt (Kirchberger 1993). Kernsp<strong>in</strong>tomographen<br />
wurden fast zeitgleich e<strong>in</strong>geführt, 1984 waren 18 b<strong>und</strong>esweit im E<strong>in</strong>satz (Statistisches<br />
B<strong>und</strong>esamt 1998). Transplantationsmediz<strong>in</strong>, Kardiologie, Großgeräte <strong>und</strong> die Herzchirurgie<br />
führten zu erheblichen Leistungsausweitungen.<br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen verfügte 1998 über 9 Transplantationsstandorte. Unter Berücksichtigung des<br />
Behandlungsorts <strong>und</strong> der Patientenherkunft weist Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen e<strong>in</strong>e relativ ausgeglichene<br />
Bilanz aus. Von 1992 bis 1998 steigerte sich b<strong>und</strong>esweit die Anzahl der Transplantationen (Herz, Nieren,<br />
Leber, Lungen, Pankreas) von 40 auf 48 pro 1 Mio. E<strong>in</strong>wohner/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> Deutschland. Dabei liegt<br />
9<br />
Anders als im B<strong>und</strong>esgebiet zählen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen Computertomographen nicht zu den Großgeräten.<br />
- 28 -
Allgeme<strong>in</strong>e <strong>und</strong> sonstige Krankenhäuser, Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
Deutschland im europäischen Vergleich zwischen Kroatien mit 14 <strong>und</strong> Spanien mit 86 Transplantationen<br />
pro Mio. E<strong>in</strong>wohner/<strong>in</strong>nen im Mittelfeld (Bruckenberger 1999).<br />
Die Kardiologie hat enorme Leistungsausweitungen aufzuweisen. E<strong>in</strong>e b<strong>und</strong>esweite Studie zur Diffusion<br />
<strong>und</strong> Nutzung von koronarangiographischen Arbeitsplätzen belegt für den Zeitraum von 1984 bis<br />
1996 e<strong>in</strong>en Anstieg des diagnostischen E<strong>in</strong>satzes (Angioplastie) des Gerätes um das 10fache auf<br />
450.000 Prozeduren <strong>und</strong> des therapeutischen gefäßerweiternden E<strong>in</strong>satzes um das 50fache auf 125.000<br />
Prozeduren (Perleth et al. 1999).<br />
Aber auch für andere Großgeräte ist e<strong>in</strong>e erhebliche Leistungsausweitung belegt worden. Tab. 11 zeigt<br />
die Entwicklung der Zahl <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen aufgestellter Großgeräte 10 .<br />
Bei der Herzchirurgie ist ebenfalls e<strong>in</strong> expansiver Trend im Leistungsgeschehen festzustellen. Zwischen<br />
1990 <strong>und</strong> 1998 stieg die Anzahl der herzchirurgischen Zentren von 12 auf 16. Im gleichen Zeitraum<br />
stieg die Anzahl der Herzoperationen unter E<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>er Herz-Lungen-Masch<strong>in</strong>e (e<strong>in</strong>schließlich<br />
Koronar-OP, Klappen-OP, OP angeborene Herzfehler, andere OP) von 10.882 auf 20.070. B<strong>und</strong>esweit<br />
war für den Zeitraum 1979 bis 1998 sogar e<strong>in</strong>e Verzehnfachung des Operationsaufkommens zu verzeichnen<br />
(Bruckenberger 1999).<br />
Tab. 11 Entwicklung der Großgerätedichte <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen 1991 bis 1997<br />
Jahr<br />
Kernsp<strong>in</strong>-Tomographen<br />
ärztl.<br />
Praxen<br />
Krankenhäuser<br />
E<strong>in</strong>w.<br />
pro<br />
Gerät<br />
<strong>in</strong><br />
1000<br />
Positronen-Emissions-Computer-<br />
Tomographen<br />
ärztl.<br />
Praxen<br />
Krankenhäuser<br />
E<strong>in</strong>w.<br />
pro<br />
Gerät<br />
<strong>in</strong><br />
1000<br />
Tele-Kobalt-Therapiegerät<br />
ärztl.<br />
Praxen<br />
Krankenhäuser<br />
E<strong>in</strong>w.<br />
pro<br />
Gerät<br />
<strong>in</strong><br />
1000<br />
- 29 -<br />
L<strong>in</strong>earbeschleuniger<br />
ärztl.<br />
Praxen<br />
Krankenhäuser<br />
E<strong>in</strong>w.<br />
pro<br />
Gerät<br />
<strong>in</strong><br />
1000<br />
KoronarangiographischeArbeitsplätze<br />
ärztl.<br />
Praxen<br />
Krankenhäuser<br />
E<strong>in</strong>w.<br />
pro<br />
Gerät<br />
<strong>in</strong><br />
1000<br />
Gerät zur extrakorporalenStoßwellenlithotripsie<br />
1991 26 25 338 0 4 4 311 5 58 273 2 35 466 2 70 239 4 14 958<br />
1993 51 31 215 0 4 4 419 5 56 289 5 36 431 2 73 235 4 15 930<br />
1994 67 32 179 0 4 4 439 5 53 306 5 39 403 4 77 219 5 17 807<br />
1995 68 33 176 1 6 2 545 4 45 363 3 47 356 4 81 209 5 18 774<br />
1996 79 46 143 1 7 2 236 3 41 406 5 60 275 9 80 201 4 19 777<br />
1997 69 56 143 1 8 1 994 1 44 398 4 50 332 5 93 183 4 17 854<br />
Quelle: LÖGD nach Angaben des M<strong>in</strong>isteriums für Arbeit, Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziales NRW<br />
Deutlich wird e<strong>in</strong>e Ausweitung des Leistungsgeschehens im stationären Sektor, der vorrangig auf Produkt<strong>in</strong>novationen<br />
beruht. Zwar lässt sich der Beschäftigungseffekt nicht exakt bestimmen, dennoch<br />
lassen sich z.B. für bildgebende Systeme wie den Computertomograph <strong>und</strong> den Kernsp<strong>in</strong>tomograph<br />
Anhaltspunkte festmachen. So liegt die tägliche Betriebszeit <strong>in</strong> der Mehrzahl der Fälle zwischen 8 <strong>und</strong><br />
12 St<strong>und</strong>en. Sie kann <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen aber auch 16 St<strong>und</strong>en erreichen. Der Personalbedarf im 8-<br />
St<strong>und</strong>en Betrieb wird auf e<strong>in</strong>en Arzt, zwei mediz<strong>in</strong>isch-technische Assistent<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e halbe Sekretariatskraft<br />
angesetzt, beim 12-St<strong>und</strong>en Betrieb s<strong>in</strong>d es zwei Ärzte, drei mediz<strong>in</strong>isch-technische<br />
Assistent<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Sekretär<strong>in</strong> (Statistisches B<strong>und</strong>esamt 1998). E<strong>in</strong>e unmittelbare Bestimmung<br />
des zusätzlichen Personalbedarfs aufgr<strong>und</strong> der Leistungsdaten ist allerd<strong>in</strong>gs nicht möglich.<br />
10 Großgeräte kommen nicht nur im stationären Sektor, sondern auch im ambulanten zum E<strong>in</strong>satz.<br />
ärztl.<br />
Praxen<br />
Krankenhäuser<br />
E<strong>in</strong>w.<br />
pro<br />
Gerät<br />
<strong>in</strong><br />
1000
Allgeme<strong>in</strong>e <strong>und</strong> sonstige Krankenhäuser, Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
2.2.1.2. Sonstige Krankenhäuser (1991 – 1998)<br />
Den sonstigen E<strong>in</strong>richtungen s<strong>in</strong>d die Krankenhäuser mit ausschließlich psychiatrischen <strong>und</strong> neurologischen<br />
Betten sowie die re<strong>in</strong>en Tages- <strong>und</strong> Nachtkl<strong>in</strong>iken 11 zugeordnet.<br />
1998 waren <strong>in</strong> den sonstigen Krankenhäusern 19.025 Personen beschäftigt. Auch hier hat das Pflegepersonal<br />
mit 54% an allen Beschäftigten den größten Anteil. Er liegt knapp 13 Prozentpunkte höher<br />
als bei den allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäusern <strong>und</strong> ist e<strong>in</strong> Indiz für die größere Bedeutung der Pflege <strong>in</strong> diesem<br />
Krankenhaustyp. Dies spiegelt sich auch im relativen Anteil der Berufsgruppe der Ärzte wider,<br />
der bei den sonstigen Krankenhäusern im Vergleich zu den allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäusern um ca. 5<br />
Prozentpunkte niedriger liegt.<br />
Tab. 12 Sonstige Krankenhäuser – absoluter <strong>und</strong> relativer Anteil der Beschäftigten nach<br />
Berufsgruppe<br />
Berufsgruppen 1991 <strong>und</strong> 1998<br />
1991 1998 1991 1998<br />
absolut darunter absolut darunter relativer Anteil der Beschäftigten <strong>in</strong> %<br />
weiblich <strong>in</strong><br />
weiblich<br />
%<br />
<strong>in</strong> %<br />
Pflegepersonal 12.333 64,0% 10.179 68,5% 51,71% 53,50%<br />
Wirtschafts- <strong>und</strong> Technikbereich<br />
3.955 64,7% 2.584 62,2% 16,58% 13,58%<br />
Ärzt/<strong>in</strong>nen 1.329 43,0% 1<br />
1.479 46,9% 1<br />
5,57% 7,77%<br />
Med.-tech. Assistenzberufe 951 90,6% 675 91,9% 3,99% 3,55%<br />
Funktionsdienst 1.530 62,1% 986 60,4% 6,41% 5,18%<br />
Verwaltung 1.460 53,2% 1.239 57,5% 6,12% 6,51%<br />
Vorsorge <strong>und</strong> Rehabilitation 1.432 59,5% 1.336 61,7% 6,00% 7,02%<br />
Sonderdienste 862 44,7% 547 46,8% 3,61% 2,88%<br />
Gesamt 23.852 62,3% 2<br />
1) nur bezogen auf hauptamtliche Ärzt<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ärzte<br />
2) ohne Assistenz- <strong>und</strong> Belegärzt<strong>in</strong>nen<br />
Quelle: LDS, Krankenhausstatistik, Berechnung MHH<br />
19.025 64,4% 2<br />
- 30 -<br />
100,00% 100,00%<br />
Die Beschäftigtenzahl <strong>in</strong> den sonstigen Krankenhäusern hat sich zwischen 1991 <strong>und</strong> 1998 entgegen<br />
dem Trend <strong>in</strong> den allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäusern um ca. 20% verr<strong>in</strong>gert. Die Anzahl der Beschäftigten<br />
ist um 4.827 Personen gesunken. Der Anteil der weiblichen Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen an allen Beschäftigten<br />
hat von 62,3 % im Jahr 1991 auf 64,4% im Jahr 1998 leicht zugenommen.<br />
11<br />
In re<strong>in</strong>en Tages- <strong>und</strong> Nachtkl<strong>in</strong>iken werden ausschließlich teilstationäre Behandlungen durchgeführt, d.h. die<br />
Patient/<strong>in</strong>nen s<strong>in</strong>d nur e<strong>in</strong>e begrenzte Zeit des Tages oder der Nacht untergebracht.
Allgeme<strong>in</strong>e <strong>und</strong> sonstige Krankenhäuser, Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
Abb. 10 Beschäftigungsentwicklung nach ausgewählten Berufsgruppen <strong>in</strong> sonstigen Krankenhäusern<br />
1991-1998 (1991=100)<br />
180%<br />
160%<br />
140%<br />
120%<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998<br />
Jahre<br />
Ärzte/<strong>in</strong>nen Pflegepersonal med.techn. Assistenzberufe<br />
Vorsorge/Reha. Wirtschafts-/Technikbereich Beschäftigte <strong>in</strong>sgesamt<br />
Quelle: LDS, Krankenhausstatistik, Berechnung FfG, Darstellung MHH<br />
Abb. 10 zeigt, dass der Rückgang <strong>in</strong> allen Berufsgruppen mit Ausnahme des ärztlichen Personals erfolgte.<br />
Nach e<strong>in</strong>em Beschäftigungszuwachs 1992 ist e<strong>in</strong> erster Rückgang 1993 um <strong>in</strong>sgesamt 3.514<br />
Stellen bzw. 14,7% <strong>und</strong> nach 1996 e<strong>in</strong> weiterer Rückgang um 12,1% zu verzeichnen. In der Betrachtung<br />
der Zeitreihen wird ebenfalls die vom generellen Trend abgekoppelte Entwicklung beim ärztlichen<br />
Personal sichtbar. Der Schrumpfungsprozess der Beschäftigung <strong>in</strong> sonstigen Krankenhäusern ist<br />
vor allem den Berufsgruppen Pflege <strong>und</strong> Wirtschafts- <strong>und</strong> Technikbereich geschuldet. In den beiden<br />
Berufsgruppen g<strong>in</strong>gen nach der Krankenhausstatistik 2.154 bzw. 1.371 Beschäftigungsverhältnisse<br />
verloren. Obwohl der Beschäftigungsrückgang <strong>in</strong> der Berufsgruppe Pflege unter dem Durchschnitt<br />
liegt, schlägt sich die Größe der Berufsgruppe auf die Gesamtbeschäftigungssituation nieder.<br />
2.2.1.3. Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen (1991 – 1998)<br />
1998 waren <strong>in</strong> Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen 13.516 Personen beschäftigt. Auch hier<br />
bildet das Pflegepersonal mit ca. 27% Anteil an allen Beschäftigten die größte Berufsgruppe. Ihr relativer<br />
Anteil ist allerd<strong>in</strong>gs erheblich niedriger als <strong>in</strong> den allgeme<strong>in</strong>en <strong>und</strong> sonstigen Krankenhäusern.<br />
Dafür haben die therapeutischen Berufe mit e<strong>in</strong>em Anteil von 18% e<strong>in</strong>e höhere Bedeutung für den<br />
Beschäftigungsstand als die ärztliche Berufsgruppe. Die Anzahl der Beschäftigten ist zwischen den<br />
Jahren 1991 <strong>und</strong> 1998 kräftig gestiegen. Der Anstieg betrug 26% bzw. 2.801 Personen.<br />
- 31 -
Allgeme<strong>in</strong>e <strong>und</strong> sonstige Krankenhäuser, Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
Tab. 13 Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen - absoluter <strong>und</strong> relativer Anteil der<br />
Berufgsgruppe<br />
Beschäftigten 1991 <strong>und</strong> 1998<br />
1991 1998 1991 1998<br />
absolut darunter absolut darunter relativer Anteil der Beschäftigten <strong>in</strong> %<br />
weiblich <strong>in</strong><br />
weiblich<br />
%<br />
<strong>in</strong> %<br />
Pflegepersonal 2.331 88,4% 3.587 87,6% 21,8% 26,5%<br />
Wirtschafts- <strong>und</strong> Technikbereich<br />
2.912 76,0% 2.940 72,0% 27,2% 21,8%<br />
Ärzt/<strong>in</strong>nen 935 39,1% 1<br />
1.117 40,3% 1<br />
8,7% 8,3%<br />
Med.-tech. Assistenzberufe 733 89,9% 830 88,0% 6,8% 6,1%<br />
Vorsorge <strong>und</strong> Rehabilitation 1.567 66,1% 2.413 67,3% 14,6% 17,9%<br />
Funktionsdienst 369 82,1% 535 75,1% 3,4% 4,0%<br />
Verwaltung 993 74,8% 1.322 79,1% 9,3% 9,8%<br />
Sonderdienste 875 74,1% 772 61,9% 8,2% 5,7%<br />
Gesamt 10.715 75,1% 2<br />
1) nur bezogen auf hauptamtliche Ärzt<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ärzte<br />
2) ohne Assistenz- <strong>und</strong> Belegärzt<strong>in</strong>nen<br />
Quelle: LDS, Krankenhausstatistik, Berechnung MHH<br />
13.516 74,0% 2<br />
- 32 -<br />
100,0% 100,0%<br />
Insbesondere die Beschäftigtenzahlen <strong>in</strong> den Berufsgruppen Pflegepersonal, Funktionsdienst <strong>und</strong> therapeutische<br />
Berufe haben stark zugenommen. Wie Tab. 13 belegt, hat es <strong>in</strong>folge des Wachstums Verschiebungen<br />
<strong>in</strong> der Rangfolge der e<strong>in</strong>zelnen Berufsgruppen gegeben. 1991 hatte die Berufsgruppe<br />
Wirtschafts- <strong>und</strong> Technikbereich gefolgt vom Pflegepersonal den größten Anteil an der Beschäftigung<br />
<strong>in</strong> Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen. 1998 hat die anteilsmäßige Reihenfolge gewechselt.<br />
Mit e<strong>in</strong>er Abnahme um 1,1 Prozentpunkte (von 75,1% im Jahr 1991 auf 74,0% im Jahr 1998) blieb der<br />
Anteil der weiblichen Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen nahezu gleich.<br />
Zwischen 1991 bis 1998 weist die Beschäftigungsentwicklung der Berufsgruppen <strong>in</strong> den Vorsorge<strong>und</strong><br />
Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen e<strong>in</strong>e starke Disparität auf (s. Abb. 11). Die Beschäftigtenzahl <strong>in</strong>sgesamt<br />
ist seit 1993 stark angestiegen <strong>und</strong> erreichte 1996 e<strong>in</strong>en Höhepunkt. Danach sackte sie deutlich<br />
ab. Überdurchschnittliches Wachstum verzeichnen die Berufsgruppen therapeutische Berufe (+<br />
54,0%), Pflegepersonal (+ 53,9%) <strong>und</strong> Funktionsdienst (+ 45,0%).<br />
Ab 1997 ist für alle Berufsgruppen e<strong>in</strong> E<strong>in</strong>bruch der Beschäftigtenzahlen zu verzeichnen. Am deutlichsten<br />
fand dieser E<strong>in</strong>bruch im Wirtschafts- <strong>und</strong> Technikbereich, bei den mediz<strong>in</strong>isch-technischen<br />
Assistenzberufen <strong>und</strong> bei den Ärzt/<strong>in</strong>nen statt. Das Beschäftigungswachstum <strong>in</strong>sgesamt <strong>in</strong> den Jahren<br />
1991 bis 1998 ist <strong>in</strong>sbesondere den Berufsgruppen Pflegepersonal <strong>und</strong> therapeutische Berufe geschuldet<br />
(s. Anhang, Tab. A 6).
Allgeme<strong>in</strong>e <strong>und</strong> sonstige Krankenhäuser, Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
Abb. 11 Beschäftigungsentwicklung nach ausgewählten Berufsgruppen <strong>in</strong> Vorsorge- <strong>und</strong><br />
Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen 1991-1998 (1991=100)<br />
170%<br />
160%<br />
150%<br />
140%<br />
130%<br />
120%<br />
110%<br />
100%<br />
90%<br />
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998<br />
Jahre<br />
Ärzte/<strong>in</strong>nen Pflegepersonal Vorsorge/Reha.<br />
Funktionsdienst Wirtschafts-/Technikbereich Beschäftigte <strong>in</strong>sgesamt<br />
Quelle: LDS, Krankenhausstatistik, Berechnung FfG, Darstellung MHH<br />
Bemerkenswert für den Bereich Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitation ist zudem die Anzahl von Rehabilitanden,<br />
die Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen <strong>in</strong> andere B<strong>und</strong>esländer „exportiert“. Aus Tab. 14 geht hervor, dass ke<strong>in</strong><br />
anderes B<strong>und</strong>esland so viele Rehabilitationsleistungen an Bewohnern des eigenen B<strong>und</strong>eslandes <strong>in</strong><br />
anderen B<strong>und</strong>esländern erbr<strong>in</strong>gen lässt wie Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen. Insofern kann es nicht überraschen,<br />
dass Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen, von den Stadtstaaten abgesehen, mit 11,5 Vorsorge- oder Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
pro 10.000 E<strong>in</strong>wohnern <strong>in</strong> Deutschland das schlechteste Verhältnis aufweist 12<br />
(Statistisches B<strong>und</strong>esamt 2000).<br />
12<br />
B<strong>und</strong>esweit beträgt das Verhältnis Vorsorge- oder Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen je 10.000 E<strong>in</strong>wohner/<strong>in</strong>nen<br />
23,3.<br />
- 33 -
Allgeme<strong>in</strong>e <strong>und</strong> sonstige Krankenhäuser, Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
Tab. 14 Rehabilitanden <strong>in</strong> der Gesetzlichen Rentenversicherung nach Wohnort <strong>und</strong> Ort der<br />
Rehabilitationsleistung im Jahr 1997<br />
Land/Regierungsbezirk Anzahl der Rehabilitanden nach<br />
Wohnort<br />
- 34 -<br />
Verhältnis Wohnort des Rehabilitanden<br />
<strong>und</strong> Ort der Rehabilitationsleistung<br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen 124.308 -50.458<br />
Düsseldorf 34.673 -29.943<br />
Köln 27.264 -17.261<br />
Münster 19.010 -17.918<br />
Detmold 16.043 +23.407<br />
Arnsberg 27.318 -8.743<br />
Schleswig-Holste<strong>in</strong> 17.736 +9.834<br />
Hamburg 10.717 -9.604<br />
Niedersachsen 49.700 -223<br />
Bremen 4.388 -4.266<br />
Hessen 42.459 +40.630<br />
Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz 29.810 +1.020<br />
Baden-Württemberg 78.877 +8253<br />
Bayern 91.770 -2.509<br />
Saarland 7.990 +49<br />
Berl<strong>in</strong> (West) 16.268 -15.512<br />
Berl<strong>in</strong> (Ost) 9.387 -9.085<br />
Brandenburg 18.752 +958<br />
Mecklenburg-Vorpommern 12.176 -1.533<br />
Sachsen 38.809 -13.376<br />
Sachsen-Anhalt 18.779 -3.885<br />
Thür<strong>in</strong>gen<br />
Quelle: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger 1998<br />
20.085 -1364<br />
2.2.2. Akut- <strong>und</strong> Sonderkrankenhäuser (1965 – 1989)<br />
Zwischen 1965 <strong>und</strong> 1975 weist die Krankenhausstatistik nur Akutkrankenhäuser aus, welche sich aus<br />
allgeme<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Fachkrankenhäusern zusammensetzten, ab 1975 wird die Gruppe der Sonderkrankenhäuser<br />
getrennt geführt, zu der sowohl psychiatrische, psychiatrisch-neurologische als auch Vorsorge-<br />
<strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen gehören. Die verschiedenen Gruppen s<strong>in</strong>d jedoch nicht identisch<br />
mit den Gruppen der Krankenhausstatistik nach 1991. Zudem wurde im Zeitverlauf die Erfassung<br />
<strong>und</strong> Kategorisierung der verschiedenen Berufsgruppen verändert. Kont<strong>in</strong>uierliche Längsschnittvergleiche<br />
s<strong>in</strong>d aus diesen Gründen nicht möglich.<br />
Abb. 12 zeigt den Anstieg der Beschäftigtenzahlen <strong>in</strong> den Krankenhäusern von 171.645 im Jahr 1975<br />
auf 215.632 Personen im Jahr 1989. Dies entspricht e<strong>in</strong>er Zunahme um 43.987 Personen oder 25,6%.<br />
Rechnet man die Beschäftigtenzahlen <strong>in</strong> Vollzeitäquivalente um, so ist e<strong>in</strong> Zuwachs von 156.372 im<br />
Jahr 1975 auf 190.401 Personen im Jahr 1989 zu verzeichnen ( = + 34.029 Beschäftigte oder +21,8%).
Allgeme<strong>in</strong>e <strong>und</strong> sonstige Krankenhäuser, Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
Unter Berücksichtigung der Arbeitszeitverkürzung vom 1.4.1989 13 ergibt sich für das Jahr 1989 e<strong>in</strong><br />
Wert von 185.640 Vollzeitbeschäftigten.<br />
Die Anzahl der Teilzeitkräfte ist im Zeitraum 1975 bis 1989 schneller gestiegen als die Beschäftigung<br />
<strong>in</strong>sgesamt. Sie stieg von 30.546 ( = 18% an der Gesamtbeschäftigung) im Jahr 1975 auf 50.463 ( =<br />
23% an der Gesamtbeschäftigung) im Jahr 1989. Dies entspricht e<strong>in</strong>em Zuwachs um 65,2%. Der Anteil<br />
der weiblichen Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen g<strong>in</strong>g im Untersuchungszeitraum leicht zurück. Er sank von<br />
76,8% im Jahr 1975 auf 73,8% im Jahr 1989.<br />
Abb. 12 Entwicklung der Beschäftigtenzahlen <strong>in</strong> Akut- <strong>und</strong> Sonderkrankenhäusern 1975 -<br />
1989<br />
Beschäftigte im stationären Sektor<br />
240.000<br />
220.000<br />
200.000<br />
180.000<br />
160.000<br />
140.000<br />
120.000<br />
100.000<br />
1975 1980 1985 1989<br />
Jahr<br />
Quelle: LDS, Krankenhausstatistik, Berechnung MHH<br />
Beschäftigte <strong>in</strong>sgesamt<br />
Vollzeitäquivalente<br />
Vollzeitäquivalente bere<strong>in</strong>igt um die Arbeitszeitverkürzung vom 1. 4. 1989<br />
2.2.2.1. Akutkrankenhäuser (1965 – 1989)<br />
Betrachtet man Tab. 15, so fällt für den Bereich der Akutkrankenhäuser auf, dass sowohl der relative<br />
als auch der absolute Anteil der Ärzte <strong>und</strong> des Pflegepersonals zwischen 1965 <strong>und</strong> 1989 stark zugenommen<br />
haben. Die e<strong>in</strong>zigen Bereiche, <strong>in</strong> denen die Beschäftigtenzahl abgenommen hat, s<strong>in</strong>d die Bereiche<br />
Wirtschaft <strong>und</strong> Verwaltung bzw. Wirtschaft <strong>und</strong> Technik. 14<br />
13 Die letzte Arbeitszeitverkürzung vor 1989 fand zum 1.1. 1974 statt (von 42 auf 40 St<strong>und</strong>en <strong>in</strong> der Woche).<br />
Sie liegt somit außerhalb unseres Untersuchungszeitraums <strong>und</strong> wird hier nicht berücksichtigt.<br />
14<br />
Infolge e<strong>in</strong>er Umstellung bei der Datenerfassung liegen für diese Berufsgruppe ke<strong>in</strong>e kont<strong>in</strong>uierlichen Zeitreihen<br />
vor.<br />
- 35 -
Allgeme<strong>in</strong>e <strong>und</strong> sonstige Krankenhäuser, Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
Tab. 15 Akutkrankenhäuser - absoluter <strong>und</strong> relativer Anteil der Beschäftigten 1965 <strong>und</strong><br />
1989<br />
Berufsgruppe<br />
1965 1989 1965 1989<br />
absolut darunter absolut darunter relativer Anteil der Beschäftigten <strong>in</strong> %<br />
weiblich<br />
weiblich <strong>in</strong><br />
<strong>in</strong> %<br />
%<br />
Ärzt/<strong>in</strong>nen 8.857 - 21.992 25,9% 8,34% 12,20%<br />
Zahnärzt/<strong>in</strong>nen 73 - 306 24,2% 0,07% 0,17%<br />
Pflegepersonal 35.790 - 83.437 86,3% 33,68% 6,27%<br />
med.-tech. Assistent/<strong>in</strong>nen 5.352 - 13.031 93,4% 5,04% 7,23%<br />
Vorsorge/ Rehabilitation 2.232 - 5.086 74,8% 2,10% 2,82%<br />
Hebammen/ Arbeitstherapeut/<strong>in</strong>nen<br />
677 - 1.991 96,5% 0,64% 1,10%<br />
Wirtschaft <strong>und</strong> Verwaltung 52.399 - - 49,31%<br />
Wirtschafts- <strong>und</strong> Technikbereich<br />
- - 34.145 71,7% - 18,94%<br />
Verwaltung - - 15.293 74,7% - 8,48%<br />
Sonderdienste 881 - 5.045 89,2% 0,83% 2,80%<br />
Gesamt 15<br />
106.261 - 180.326 75,3% 100,00% 100,00%<br />
Quelle: LDS, Krankenhausstatistik, Berechnung MHH<br />
Abb. 13 veranschaulicht die extremen Steigerungsraten beim Sonderdienst <strong>und</strong> bei den Hebammen.<br />
Analysiert man jedoch die Verteilung der Zuwächse am Gesamtwachstum (s. Anhang, Tab. A 7), so<br />
wird klar, dass zum allergrößten Teil das Pflegepersonal <strong>und</strong> zu e<strong>in</strong>em ger<strong>in</strong>geren Maße die<br />
Ärzt/<strong>in</strong>nen für das Gesamtwachstum verantwortlich s<strong>in</strong>d.<br />
Abb. 13 Die Beschäftigungsentwicklung ausgewählter Berufsgruppen <strong>in</strong> Akutkrankenhäusern<br />
1975-1989 (1975=100)<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
1975 1980 1985 1989<br />
Ärzt/-<strong>in</strong>nen Pflegepersonal Vorsorge-/Reha<br />
Hebammen/ Arbeitstherapeut/-<strong>in</strong>nen W irtschafts <strong>und</strong> Technikbereich Sonderdienst<br />
Gesamt<br />
Quelle: LDS Krankenhausstatistik, Berechnung: FfG, Darstellung MHH<br />
15 Geschlechtsspezifische Daten liegen für das Jahr 1965 nicht vor. Aus diesem Gr<strong>und</strong> kann hier der Anteil der<br />
weiblichen Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen nicht angegeben werden.<br />
- 36 -
Allgeme<strong>in</strong>e <strong>und</strong> sonstige Krankenhäuser, Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
2.2.2.2. Sonderkrankenhäuser (1975 – 1989)<br />
Tab. 16 Sonderkrankenhäuser - absoluter <strong>und</strong> relativer Anteil der Beschäftigten 1975 <strong>und</strong><br />
1989<br />
Berufsgruppe<br />
1975 1989 1975 1989<br />
absolut darunter absolut darunter relativer Anteil der Beschäftigten <strong>in</strong> %<br />
weiblich<br />
weiblich <strong>in</strong><br />
<strong>in</strong> %<br />
%<br />
Ärzt/<strong>in</strong>nen 1.245 32,0% 2.401 37,7% 5,23% 6,80%<br />
Zahnärzt/<strong>in</strong>nen - - 2 - 0,00% 0,01%<br />
Pflegepersonal 10.431 62,4% 15.932 67,2% 43,82% 45,13%<br />
med.-tech. Assistent/<strong>in</strong>nen 811 92,1% 1.082 93,1% 3,41% 3,06%<br />
Vorsorge/ Rehabilitation 969 58,7% 2.647 61,4% 4,07% 7,50%<br />
Hebammen/ Arbeitstherapeut/<strong>in</strong>nen<br />
289 50,5% 1.178 55,6% 1,21% 3,34%<br />
Wirtschaft <strong>und</strong> Technikbereich<br />
7.937 68,6% 8.436 67,7% 33,45% 23,89%<br />
Verwaltung 1.901 60,9% 2.999 64,5% 7,99% 8,49%<br />
Sonderdienste 223 68,6% 629 90,9% 0,94% 1,78%<br />
Gesamt 23.806 63,5% 35.306 65,5% 100,00% 100,00%<br />
Quelle: LDS, Krankenhausstatistik, Berechnung MHH<br />
Der absolute Beschäftigungszuwachs bei den Sonderkrankenhäusern zwischen 1975 <strong>und</strong> 1989 beträgt<br />
11.500 (+ 48%). Die Verteilung der Berufsgruppen ist ähnlich den Akutkrankenhäusern mit der Ausnahme,<br />
dass Vorsorge/Rehabilitation <strong>und</strong> Arbeitstherapie e<strong>in</strong>e wesentlich größere Rolle spielen. Der<br />
Anteil der weiblichen Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen an allen Beschäftigten hat von 63,5 % im Jahr 1975 auf<br />
65,5% im Jahr 1989 leicht zugenommen.<br />
Betrachtet man die Entwicklung der e<strong>in</strong>zelnen Beschäftigtengruppen bei den Sonderkrankenhäusern<br />
(s. Abb. 14) zeigt sich, dass hier die Berufsgruppen Hebammen/Arbeitstherapeut/<strong>in</strong>nen ( + 408%), der<br />
Sonderdienst ( + 282%) <strong>und</strong> die Berufe im Bereich der Vorsorge/ Rehabilitation ( + 273%) die größten<br />
Zuwächse zu verzeichnen haben. Ähnlich wie <strong>in</strong> den Akutkrankenhäusern basiert auch <strong>in</strong> Sonderkrankenhäusern<br />
das Gesamtwachstum vor allem auf e<strong>in</strong>em Ausbau des Pflegepersonals (s. Anhang, Tab. A<br />
8). Tab. A 8 zeigt zudem, dass bei den Sonderkrankenhäusern die Berufsgruppe Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitation<br />
e<strong>in</strong>e große Rolle bei der Herleitung des Gesamtwachstums spielt. Die Ärzt/<strong>in</strong>nen stehen bei<br />
den Sonderkrankenhäusern demgegenüber nur an dritter Stelle.<br />
- 37 -
Allgeme<strong>in</strong>e <strong>und</strong> sonstige Krankenhäuser, Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
Abb. 14 Die Beschäftigungsentwicklung ausgewählter Berufsgruppen <strong>in</strong> Sonderkrankenhäusern<br />
1975-1989 (1975=100)<br />
450,0%<br />
400,0%<br />
350,0%<br />
300,0%<br />
250,0%<br />
200,0%<br />
150,0%<br />
100,0%<br />
1975 1980 1985 1989<br />
Jahre<br />
Ärzte/-<strong>in</strong>nen Pflegepersonal<br />
Vorsorge/Rehabilitation Hebammen/Arbeitstherapeut/-<strong>in</strong>nen<br />
Wirtschafts- <strong>und</strong> Technikbereich<br />
Gesamt<br />
Sonderdienste/Sonstiges<br />
Quelle: LDS Krankenhausstatistik, Berechnung FfG, Darstellung MHH<br />
2.2.3. Zusammenfassung <strong>und</strong> Interpretation<br />
Die Gesamtbeschäftigtenzahl nahm im stationären Sektor <strong>in</strong> der Periode 1975 bis 1989 stetig zu. Das<br />
quantitative Wachstum ist vor allem auf das Pflegepersonal, die Ärzteschaft <strong>und</strong>, <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> den<br />
Sonderkrankenhäusern, auf die Berufsgruppe Vorsorge/Rehabilitation zurückzuführen. Als e<strong>in</strong>zige<br />
Berufsgruppe s<strong>in</strong>kt die Zahl der Beschäftigten im Wirtschafts- <strong>und</strong> Technikbereich seit 1975. Dieser<br />
Trend ist Folge e<strong>in</strong>es verstärkten Outsourc<strong>in</strong>gs von Aufgaben aus diesem Bereich. Mit e<strong>in</strong>em Rückgang<br />
um 3% von 76,8 % im Jahr 1975 auf 73,8 % im Jahr 1989, blieb der Anteil der weiblichen Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen<br />
nahezu konstant.<br />
Die Periode 1991 bis 1998 erweist sich demgegenüber als diskont<strong>in</strong>uierlicher, da die Beschäftigungsentwicklung<br />
nicht mehr stetig zunimmt. Die Gesamtbeschäftigtenzahl geht erstmalig von 1992 auf<br />
1993 um 8.438 Beschäftigte bzw. 0,4% zurück. Insgesamt erfolgt allerd<strong>in</strong>gs e<strong>in</strong> leichter Ausbau der<br />
Beschäftigtenzahl zwischen 1991 <strong>und</strong> 1998 um 3.837 Personen bzw. 1,5%. Bemerkenswert ist, dass<br />
die Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> den verschiedenen stationären Versorgungsbereichen sehr unterschiedlich<br />
verläuft. Während die Beschäftigtenzahlen <strong>in</strong> den Vorsorge- oder Rehae<strong>in</strong>richtungen im<br />
Zeitraum 1991 bis 1998 um 26% zunehmen, nimmt die Anzahl der Beschäftigten <strong>in</strong> den sonstigen<br />
Krankenhäusern im gleichen Zeitraum um 20% ab. In den allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäusern kann man bei<br />
e<strong>in</strong>er Zunahme von 2,7% nahezu von e<strong>in</strong>er Stagnation sprechen. Der Anteil der weiblichen Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen<br />
blieb <strong>in</strong> der Periode von 1991 (= 72,8% ) bis 1998 (= 73,2%) nahezu gleich.<br />
- 38 -
Allgeme<strong>in</strong>e <strong>und</strong> sonstige Krankenhäuser, Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
Auch auf der Ebene der Berufsgruppen s<strong>in</strong>d unterschiedliche Entwicklungen festzustellen. Besonders<br />
hervorzuheben ist Folgendes: Die Berufsgruppe der Ärzte nimmt als e<strong>in</strong>zige <strong>in</strong> allen E<strong>in</strong>richtungsarten<br />
<strong>in</strong> der Zeit von 1991 bis 1998 zu. Die <strong>in</strong> quantitativer H<strong>in</strong>sicht bedeutsamste Berufsgruppe, das Pflegepersonal,<br />
entwickelt sich <strong>in</strong> den drei Bereichen unterschiedlich: In den sonstigen Krankenhäusern ist<br />
e<strong>in</strong> Rückgang um 17,5% zu verzeichnen, <strong>in</strong> den allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäusern e<strong>in</strong>e leichte Zunahme<br />
um 4,5% <strong>und</strong> <strong>in</strong> den Vorsorge- <strong>und</strong> Rehae<strong>in</strong>richtungen vollzieht sich e<strong>in</strong>e der stärksten Zunahmen<br />
überhaupt (+44,6%). Die Berufsgruppe Sonderdienst/Sonstiges ist die e<strong>in</strong>zige Kategorie, die <strong>in</strong> allen<br />
drei E<strong>in</strong>richtungsarten zurückgeht. E<strong>in</strong>e Entwicklung, die vermutlich dem Outsourc<strong>in</strong>g geschuldet ist.<br />
Sozial- <strong>und</strong> arbeitsrechtliche Vorgaben, der mediz<strong>in</strong>isch-technische Fortschritt <strong>und</strong> der Wandel der<br />
sozialen <strong>und</strong> demographischen Bed<strong>in</strong>gungen s<strong>in</strong>d die Faktoren, deren Auswirkungen im Rahmen dieses<br />
Gutachtens auf die Beschäftigungsentwicklung überprüft werden. Im Folgenden wird die Relevanz<br />
dieses Faktorenbündels für die drei E<strong>in</strong>richtungsarten des stationären Sektors erörtert. 16<br />
Thesenartig lassen sich die Wirkungen der e<strong>in</strong>zelnen Faktoren wie folgt zusammenfassen:<br />
• Sozialrechtliche Maßnahmen hatten e<strong>in</strong>en ambivalenten Effekt auf die Beschäftigungsentwicklung.<br />
E<strong>in</strong>erseits wirkten die vielfältigen, seit den 80er Jahren getroffenen Kostendämpfungsmaßnahmen<br />
sehr wahrsche<strong>in</strong>lich beschäftigungshemmend. 17 Andererseits führten rechtliche Regelungen,<br />
die auf e<strong>in</strong>e verbesserte Bedarfsdeckung h<strong>in</strong>zielen zu Beschäftigungszuwächsen, <strong>in</strong>sbesondere<br />
beim Pflegepersonal.<br />
• Die Arbeitszeitverkürzung, die Zunahme der Teilzeitarbeit <strong>und</strong> die Arbeitszeitgesetzgebung wirkten<br />
sich positiv auf die Beschäftigung aus.<br />
• Ähnlich wie bei den sozialrechtlichen Maßnahmen ist beim mediz<strong>in</strong>isch-technischen Fortschritt<br />
von e<strong>in</strong>er ambivalenten Wirkung auf die Beschäftigung auszugehen. Während Produkt<strong>in</strong>novationen<br />
langfristig beschäftigungsfördernd wirken, ist der Effekt von Prozess<strong>in</strong>novationen 18 eher als<br />
beschäftigungshemmend anzusehen.<br />
Über den Beobachtungszeitraum h<strong>in</strong>weg war die Beschäftigungsbilanz für die Akut- bzw. allgeme<strong>in</strong>en<br />
Krankenhäuser positiv. Dabei unterschätzen die vorliegenden Zahlen die tatsächliche Beschäftigungssituation.<br />
Der Personalabbau <strong>in</strong> den Wirtschafts- <strong>und</strong> Technikbereichen <strong>in</strong> den Akut- bzw. allgeme<strong>in</strong>en<br />
Krankenhäusern seit 1975 ist m<strong>in</strong>destens teilweise dem sogenannten Outsourc<strong>in</strong>g geschuldet.<br />
Die Beschäftigungsentwicklung ist von gegenläufigen E<strong>in</strong>flüssen geprägt. So wurde e<strong>in</strong>erseits mit der<br />
Pflegepersonalregelung 19 , die mit dem Ges<strong>und</strong>heitsstrukturgesetz e<strong>in</strong>geführt wurde, e<strong>in</strong> wichtiger<br />
beschäftigungsfördernder Impuls gesetzt. Noch Ende der 80er Jahre wurde aufgr<strong>und</strong> von Berechnungen<br />
argumentiert, dass bei e<strong>in</strong>er Berücksichtigung der Verweildauerverkürzung sowie der Arbeitszeitverkürzung<br />
e<strong>in</strong> Mehrbedarf von 5.434 (17%) Planstellen <strong>in</strong> der Pflege bestünde (Mohr 1989). Ebenfalls<br />
e<strong>in</strong>e Unterdeckung des Versorgungsbedarfs wurde im Vorfeld der Formulierung des Kranken-<br />
16<br />
Die Erklärungsfaktoren werden <strong>in</strong> größerem Detail <strong>in</strong> Kapitel 3 dargestellt. Da sie jedoch auch an dieser<br />
Stelle aufgegriffen werden müssen, s<strong>in</strong>d Überschneidungen unvermeidlich.<br />
17<br />
Bei den Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen führten Kostendämpfungsmaßnahmen zweimal zu deutlichen,<br />
wenn auch zeitlich befristeten, Beschäftigungse<strong>in</strong>brüchen.<br />
18<br />
Vgl. zur Bedeutung des Begriffspaares Produkt- <strong>und</strong> Prozess<strong>in</strong>novationen Kapitel 3.1.3<br />
19<br />
Vgl. zu den Inhalten <strong>und</strong> Wirkungen der Pflegepersonalregelung: Kap. 3.1.2.1<br />
- 39 -
Allgeme<strong>in</strong>e <strong>und</strong> sonstige Krankenhäuser, Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
hausplans 1992-1996 durch e<strong>in</strong> Gutachten der Firma Dornier festgestellt. E<strong>in</strong> zusätzlicher Bedarf von<br />
6.000 Betten wurde konstatiert. Letztlich wurde e<strong>in</strong>e Reduktion um 1.000 Betten vere<strong>in</strong>bart (Klitzsch<br />
1992). Von 1991 bis 1998 wurden andererseits die Fördermittel nach dem KHG <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Wesfalen um 25,6% reduziert. Neben Berl<strong>in</strong> zählt Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen damit zu den Ländern, die ihr<br />
Fördermittelvolumen b<strong>und</strong>esweit am stärksten reduziert haben (Düll<strong>in</strong>gs 1999).<br />
Die E<strong>in</strong>führung der prospektiven F<strong>in</strong>anzierung durch die B<strong>und</strong>espflegesatzverordnung (BPflV) von<br />
1985, die verschiedenen Budgetformen <strong>und</strong> schließlich die ersten Schritte zur E<strong>in</strong>führung des neuen<br />
Entgeltsystems (Fallpauschalen <strong>und</strong> Sonderentgelte) durch die BPflV <strong>und</strong> das Ges<strong>und</strong>heitsstrukturgesetz<br />
haben zwar ke<strong>in</strong>en von den Daten ablesbaren e<strong>in</strong>deutigen Effekt auf die Beschäftigungsentwicklung<br />
h<strong>in</strong>terlassen. Dennoch s<strong>in</strong>d Impulse gesetzt worden, die zu e<strong>in</strong>er Verdichtung des Krankenhausgeschehens<br />
<strong>und</strong> Intensivierung der Arbeit geführt haben. Hier mag auch der Gr<strong>und</strong> für den Beschäftigungszuwachs<br />
bei den nicht-ärztlichen therapeutischen Berufen liegen. Die Verkürzung der Verweildauer<br />
wird durch e<strong>in</strong>e beschleunigte Patientenmobilisierung befördert. Laut e<strong>in</strong>er Umfrage <strong>in</strong> Krankenhäusern,<br />
die ärztliche Stellen abgebaut haben, war das neue Entgeltsystem nicht der primäre Gr<strong>und</strong><br />
hierfür. Allerd<strong>in</strong>gs haben im Jahr 1997 41,3% der befragten Krankenhäuser Stellen nicht besetzt. Gut<br />
e<strong>in</strong> Drittel gab dafür als Gr<strong>und</strong> das neue Entgeltsystem an (Asmuth et al. 1999). Folglich ersche<strong>in</strong>t es<br />
durchaus denkbar, dass die genannten Maßnahmen, vor allem die sektorale Budgetierung <strong>und</strong> die E<strong>in</strong>führung<br />
e<strong>in</strong>es neuen Entgeltsystems, e<strong>in</strong>en Trendbruch e<strong>in</strong>geleitet <strong>und</strong> auch den seit Mitte der 90er<br />
Jahre stattf<strong>in</strong>denden Beschäftigungsrückgang 20 (mit-)verursacht haben. Trifft dies zu, müsste sich der<br />
Beschäftigungsabbau, unter sonst gleichen Bed<strong>in</strong>gungen, zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> der Tendenz fortsetzen. Wird<br />
zudem ab dem Jahr 2003 e<strong>in</strong> durchgängiges pauschaliertes Entgeltsystem e<strong>in</strong>geführt, müsste sich die<br />
Tendenz darüber h<strong>in</strong>aus weiter verstärken. Dies detaillierter zu diskutieren wird Aufgabe des Prognoseteils<br />
se<strong>in</strong>.<br />
Insgesamt ist von e<strong>in</strong>er beschäftigungshemmenden Wirkung der Kostendämpfung im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er Effizienzsteigerung<br />
auszugehen. Inwieweit diese Effizienzsteigerung an ihre Grenzen geraten ist, steht zur<br />
Debatte, wobei Unterschiede auf der Ebene der e<strong>in</strong>zelnen Krankenhäuser zu untersuchen wären.<br />
E<strong>in</strong>e Reihe von Indizien legen die Vermutung nahe, dass sich das Leistungsgeschehen, nicht zuletzt<br />
durch den demographischen Wandel <strong>und</strong> den mediz<strong>in</strong>isch-technischen Fortschritt, <strong>in</strong>tensiviert hat.<br />
Steigerungen der Fallzahlen e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> der Bettenabbau sowie die Reduktion der Verweildauer<br />
andererseits zeigen dies an. Allerd<strong>in</strong>gs wurde wiederholt die Vermutung geäußert, dass die steigenden<br />
Fallzahlen m<strong>in</strong>destens zum Teil e<strong>in</strong>er höheren Wiedere<strong>in</strong>weisungsquote geschuldet seien, die durch<br />
das Vergütungssystem <strong>in</strong>duziert werde.<br />
An den Beispielen Kardiologie, Herzchirurgie, Transplantationsmediz<strong>in</strong> sowie dem E<strong>in</strong>satz von Großgeräten<br />
konnten die Auswirkungen des mediz<strong>in</strong>ischen Fortschritts auf das Leistungsgeschehen belegt<br />
werden. Die diagnostische <strong>und</strong> therapeutische Erschließung von Indikationen durch Produkt<strong>in</strong>novationen<br />
führte zu e<strong>in</strong>er Leistungsexpansion. Mit dieser Entwicklung s<strong>in</strong>d auch unmittelbare beschäftigungsfördernde<br />
Wirkungen sehr plausibel. Die leichten Beschäftigungszuwächse der mediz<strong>in</strong>isch-<br />
20 Wir gehen davon aus, dass es sich um e<strong>in</strong>en realen Beschäftigungsrückgang handelt <strong>und</strong> nicht nur um e<strong>in</strong><br />
statistisches Artefakt, da der Rückgang auch beim Pflegepersonal zu verzeichnen ist, mith<strong>in</strong> bei e<strong>in</strong>er Berufsgruppe,<br />
die nicht outgesourct wird.<br />
- 40 -
Allgeme<strong>in</strong>e <strong>und</strong> sonstige Krankenhäuser, Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
technischen Assistenzberufe <strong>und</strong> der Funktionsdienste <strong>in</strong> den allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäusern lassen sich<br />
aller Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit nach auf technische Innovationen zurückführen.<br />
Obgleich das Wirkmuster der E<strong>in</strong>flussfaktoren im Bereich der sonstigen Krankenhäuser dem der allgeme<strong>in</strong>en<br />
ähnelt, ist <strong>in</strong>sgesamt e<strong>in</strong> Beschäftigungsabbau festzustellen. Ähnlich wie bei den allgeme<strong>in</strong>en<br />
Krankenhäusern mit der Pflegepersonalregelung, wurde als Qualitäts- <strong>und</strong> Bedarfsdeckungsmaßnahme<br />
für die sonstigen Krankenhäuser die Psychiatriepersonalregelung e<strong>in</strong>geführt, die zwischen<br />
1993 <strong>und</strong> 1996 zu e<strong>in</strong>em deutlichen Beschäftigungszuwachs führte.<br />
Dieser E<strong>in</strong>fluss wurde allerd<strong>in</strong>gs überlagert durch e<strong>in</strong>e Entwicklung, die den Prozess<strong>in</strong>novationen<br />
zuzuordnen ist. Die psychiatrische Versorgung <strong>in</strong> Deutschland unterliegt <strong>in</strong> den letzten 20 Jahren allgeme<strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em Entwicklungstrend, der durch Dezentralisierung bestimmt ist. Im stationären Bereich<br />
werden <strong>in</strong> Fach- <strong>und</strong> Sonderkrankenhäusern für Psychiatrie die Bettenzahlen reduziert. Die Zahl der<br />
psychiatrischen Abteilungen an allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäusern sowie die Zahl der Tageskl<strong>in</strong>ken nimmt<br />
zu (Beske/Hallauer 1999).<br />
Kostendämpfungsmaßnahmen haben bei den Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen die stärkste<br />
Wirkung h<strong>in</strong>terlassen. Die Zunahme der Zahl der Behandlungsfälle <strong>und</strong> Pflegetage zwischen 1991 <strong>und</strong><br />
1996 führte zu e<strong>in</strong>em Personalzuwachs (Reister 1998). Im Jahr 1997 war jedoch e<strong>in</strong> Beschäftigungse<strong>in</strong>bruch<br />
zu verbuchen. Dieser wurde durch Maßnahmen im Rahmen des Wachstums- <strong>und</strong> Beschäftigungsförderungsgesetzes<br />
(WFG) vom 25. 10. 1996 (BGBl. I: 1461) verursacht. Erstmals wurde e<strong>in</strong><br />
sektorales Budget für den Bereich der Rehabilitation e<strong>in</strong>geführt. Zudem wurde die Dauer der Kur von<br />
vier auf drei Wochen verkürzt <strong>und</strong> das Antrags<strong>in</strong>tervall von drei auf vier Jahre verlängert. Von dem<br />
durch das WFG verursachten Beschäftigungsrückgang waren vor allem die Ärzte <strong>und</strong> die mediz<strong>in</strong>ischtechnischen<br />
Assistenzberufe betroffen. Allerd<strong>in</strong>gs ließ die deutliche Zunahme von Patienten <strong>und</strong> Pflegetagen<br />
1998 erkennen, dass es wieder aufwärts geht. In die gleiche Richtung weisen die teilweise<br />
wieder zunehmenden Beschäftigtenzahlen. Zudem ist anzumerken, dass e<strong>in</strong>e ähnliche Entwicklung im<br />
Bereich Vorsorge <strong>und</strong> Rehabilitation schon e<strong>in</strong>mal stattgef<strong>und</strong>en hat. Mit dem 2. Haushaltsstrukturgesetz<br />
vom 22. 12. 1981 (2. HStruktG) wurde <strong>in</strong> vergleichbarer Weise <strong>in</strong> das Leistungsrecht des Rehabilitationswesen<br />
e<strong>in</strong>gegriffen wie durch das WFG. Zwar erlaubt die statistische Erfassung vor 1989 ke<strong>in</strong>e<br />
Analyse der Beschäftigungssituation <strong>in</strong> Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen, aber aus der<br />
VDR-Statistik geht deutlich hervor, dass es im Gefolge des 2.HStruktG zu deutlichen Rückgängen bei<br />
den Aufwendungen für Rehabilitation <strong>und</strong> bei den stationär erbrachten mediz<strong>in</strong>ischen <strong>und</strong> sonstigen<br />
Leistungen an Erwachsenen kam. Ende der 80er wurde wieder der Stand vor dem 2. HStruktG erreicht.<br />
Es ist durchaus plausibel, dass sich erneut e<strong>in</strong>e ähnliche Entwicklung vollzieht. Ist das der Fall,<br />
dann ist es wahrsche<strong>in</strong>lich, dass die Anzahl der Beschäftigten <strong>in</strong> der Zukunft wieder m<strong>in</strong>destens den<br />
Stand von 1996 erreichen wird.<br />
Über alle E<strong>in</strong>richtungsarten h<strong>in</strong>weg spielten arbeitsrechtliche Regulierungen e<strong>in</strong>e wichtige Rolle. Die<br />
Verkürzung der wöchentlichen tariflichen Arbeitszeit ersche<strong>in</strong>t als beschäftigungsfördernd. Seit den<br />
50er Jahren bis heute wurde die wöchentliche tarifliche Arbeitszeit von 48 auf 38,5 Wochenst<strong>und</strong>en<br />
reduziert, was e<strong>in</strong>em Rückgang um ca. 20% entspricht. Der größte Teil dieses Rückgangs fand zwischen<br />
1958 <strong>und</strong> 1974 statt. Folglich ist auch hier die größte Wirkung auf die Beschäftigung anzusiedeln.<br />
Von 1989 bis heute wurde die wöchentliche tarifliche Arbeitszeit um 1,5 St<strong>und</strong>en reduziert.<br />
- 41 -
Allgeme<strong>in</strong>e <strong>und</strong> sonstige Krankenhäuser, Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
Der seit 1975 zu beobachtende Trend zu vermehrter Teilzeitarbeit ist vorwiegend dem sozialen Wandel<br />
<strong>und</strong>, damit e<strong>in</strong>hergehend, der zunehmenden Frauenerwerbstätigkeit geschuldet. Dieser Trend wird<br />
durch das 1996 <strong>in</strong> Kraft getretene Arbeitszeitgesetz zusätzlich verstärkt.<br />
2.3. Ambulante Ges<strong>und</strong>heitsversorgung<br />
Im vorliegenden Gutachten werden die Bereiche der ärztlichen <strong>und</strong> zahnärztlichen Versorgung (Kap.<br />
2.3.1), die Praxen der nichtärztlichen mediz<strong>in</strong>ischen Berufe (Kap. 2.3.2), die öffentlichen Apotheken<br />
(Kap. 2.3.3) sowie die E<strong>in</strong>richtungen der ambulanten Pflege (Kap. 2.4) zur ambulanten Versorgung<br />
gezählt. 1998 s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen <strong>in</strong>sgesamt ca. 373.000 Personen <strong>in</strong> der ambulanten Versorgung<br />
tätig. Ca. 68 % der Beschäftigten f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> (zahn)ärztlichen Praxen. Auf die nichtmediz<strong>in</strong>ischen<br />
Praxen entfallen knapp 13,2 % der Beschäftigten. Die ambulante Pflege <strong>und</strong> öffentliche Apotheken<br />
bilden mit 11,5 % bzw. 7,5 % die Tätigkeitsfelder mit dem ger<strong>in</strong>gsten Beschäftigungsumfang.<br />
Abb. 15 Beschäftigtenzahlen <strong>in</strong> der ambulanten Ges<strong>und</strong>heitsversorgung 1998<br />
Apotheken<br />
27.400<br />
nichtärztl.<br />
Heilhilfsberufe<br />
49.270<br />
ambulante Pflege<br />
43.000<br />
zahnärztl. Praxen<br />
81.600<br />
- 42 -<br />
ärztl. Praxen<br />
171.800<br />
Quelle: LDS, Berufsgenossenschaft für Ges<strong>und</strong>heitsdienst <strong>und</strong> Wohlfahrtspflege, Darstellung FfG<br />
2.3.1. Ärztliche <strong>und</strong> zahnärztliche Praxen<br />
1998 stellen die ärztlichen <strong>und</strong> zahnärztlichen Praxen mit ca. 253.000 Beschäftigten das größte Arbeitsfeld<br />
<strong>in</strong>nerhalb des ambulanten Sektors. Auf der Basis vorliegender statistischer Quellen - der Statistik<br />
der Berufsgenossenschaft für Ges<strong>und</strong>heitsdienst <strong>und</strong> Wohlfahrtspflege sowie der Mitgliederstatistik<br />
der Ärztekammern Nordrhe<strong>in</strong>- <strong>und</strong> Westfalen-Lippe - ist 1998 für die ärztlichen Praxen von ca.<br />
171.000 Berufstätigen (Selbständige <strong>und</strong> angestellt Beschäftigte) auszugehen, <strong>in</strong> den zahnärztlichen<br />
Praxen liegt der Beschäftigungsumfang bei ca. 81.000 Personen.<br />
E<strong>in</strong>schränkend ist hier allerd<strong>in</strong>gs h<strong>in</strong>zuzufügen, dass es sich bei der Mitgliederstatistik der Berufsgenossenschaft<br />
für Ges<strong>und</strong>heitsdienst <strong>und</strong> Wohlfahrtspflege um e<strong>in</strong>e Jahresauswertung handelt, <strong>in</strong> der<br />
nicht die Zahl der Stellen ausgewiesen wird, sondern die Anzahl der beschäftigt gemeldeten Personen
Ambulante Ges<strong>und</strong>heitsversorgung<br />
über den gesamten Zeitraum e<strong>in</strong>es Jahres aufaddiert wird. Erfolgt z.B. <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Jahr e<strong>in</strong> Personalwechsel,<br />
so gehen beide Beschäftigte <strong>in</strong> die Zahl der Arbeitnehmer/<strong>in</strong>nen e<strong>in</strong>. Die so ermittelten Beschäftigtenzahlen<br />
liegen damit, im Gegensatz zu den Mitgliederstatistiken der Ärzte- <strong>und</strong> Zahnärztekammern,<br />
systematisch zu hoch. Mangels anderer Quellen zum derzeitigen Zeitpunkt ersche<strong>in</strong>t der<br />
Rückgriff auf die Angaben der Berufsgenossenschaft jedoch gerechtfertigt.<br />
Den Angaben der Berufsgenossenschaft <strong>und</strong> der (Zahn)Ärztekammern folgend, praktizieren 1998 <strong>in</strong><br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen etwas über 23.817 selbstständige Ärzt/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> 18.436 Praxen mit ca. 148.000<br />
angestellt Beschäftigten. Im Bereich der zahnärztlichen Versorgung f<strong>in</strong>den sich 8.154 Praxen mit ca.<br />
72.000 Beschäftigten, die von über 9.600 selbstständigen Zahnärzt/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Kieferorthopäd/<strong>in</strong>nen<br />
geführt werden.<br />
Leider f<strong>in</strong>den sich bezüglich der Gesamtbeschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> (zahn)ärztlichen Praxen ke<strong>in</strong>e<br />
Längsschnittdaten. Um trotzdem e<strong>in</strong>en groben E<strong>in</strong>druck bezüglich der Beschäftigungstrends zu<br />
bekommen, soll zum Vergleich auf Daten aus der Volks- <strong>und</strong> Arbeitsstättenzählung 1987 zurückgegriffen<br />
werden. Damals wurden <strong>in</strong> Arztpraxen 82.392 Beschäftige (Selbstständige <strong>und</strong> Arbeitnehmer/<strong>in</strong>nen)<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> Zahnarztpraxen 41.126 Beschäftigte ermittelt. Zwar kann der prozentuale<br />
Beschäftigungszuwachs im Betrachtungszeitraum nicht genau beziffert werden, die nachfolgenden<br />
Betrachtungen auf Ebene der Berufe unterstreichen jedoch den Beschäftigungsausbau <strong>in</strong> diesem<br />
Zweig des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s.<br />
1998 bildet die freie Praxis nach Angaben der Ärztekammern für 41,7 % aller berufstätigen Ärzt/<strong>in</strong>nen<br />
<strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen den vorrangigen Beschäftigungsort. In Krankenhäusern f<strong>in</strong>den sich 45,2 %<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> sonstigen Arbeitsbereichen immerh<strong>in</strong> 13,2 % der erwerbstätigen Ärzt/<strong>in</strong>nen. Der Anteil der<br />
Zahnärzt/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> freier Praxis liegt mit 95,8 % aller berufstätigen Zahnärzt/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> 1996 wesentlich<br />
höher (s. Anhang, Tab. A 9 <strong>und</strong> Tab. A 10).<br />
Der Frauenanteil unter den niedergelassenen Ärzt/<strong>in</strong>nen liegt 1998 bei knapp 27 % (s. Tab. 17) <strong>und</strong><br />
damit niedriger als der Anteil Ärzt<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> Krankenhäusern <strong>und</strong> Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen,<br />
der etwas über 31 % beträgt. Diese arbeitsfeldspezifischen Unterschiede <strong>in</strong> der geschlechtsspezifischen<br />
Beteiligung fallen bei den Zahnärzt/<strong>in</strong>nen weniger <strong>in</strong>s Gewicht, da die überwiegende<br />
Mehrheit <strong>in</strong> freier Praxis tätig ist. 1996 waren etwas über 25 % der Zahnärzt/<strong>in</strong>nen weiblich.<br />
Zwar ist seit Mitte der 60er Jahre sowohl bei den Ärzt/<strong>in</strong>nen wie den Zahnärzt/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> freier Praxis<br />
e<strong>in</strong>e Zunahme des Frauenanteils um ca. 10 % zu verzeichnen. Festzuhalten bleibt jedoch, dass sich die<br />
kont<strong>in</strong>uierlich gestiegene Zahl weiblicher (Zahn)Mediz<strong>in</strong>studenten/<strong>in</strong>nen nur langsam auch <strong>in</strong> der<br />
Ausübung der ärztlichen Praxis niederschlägt.<br />
Die Aufarbeitung der zurückliegenden Entwicklungen bei den niedergelassenen (Zahn)Ärzt/<strong>in</strong>nen<br />
erweist sich <strong>in</strong>sofern als problematisch, als für unterschiedliche Zeiträume auf unterschiedliche Quellen<br />
zurückgegriffen werden muss, wobei die verschiedenen Statistiken jeweils andere Kategorien bei<br />
der Ausweisung der Erwerbsbereiche der (Zahn)Ärzt/<strong>in</strong>nen benutzen. Dies hat <strong>in</strong>sbesondere für die<br />
Berufsgruppe der Zahnärzt/<strong>in</strong>nen zur Folge, dass aufgr<strong>und</strong> des Quellenwechsels für die Jahre 1997<br />
<strong>und</strong> 1998 e<strong>in</strong> starker Anstieg der Zahnärzt/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> freier Praxis suggeriert wird, der eher statistischen<br />
Problemen geschuldet ist als e<strong>in</strong>er derart starken Ausweitung der Niederlassungen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen.<br />
- 43 -
Ambulante Ges<strong>und</strong>heitsversorgung<br />
Tab. 17 Ärzt/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Zahnärzt/<strong>in</strong>nen/ Kieferorthopäd/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> freier Praxis 1955-1998<br />
Jahr Ärzt/<strong>in</strong>nen Zahnärzt/<strong>in</strong>nen/ Kieferorthopäd/<strong>in</strong>nen<br />
<strong>in</strong> freier darunter Zuwachs <strong>in</strong> E<strong>in</strong>wohne- <strong>in</strong> freier darunter<br />
Praxis weiblich %, 1955 =<br />
100<br />
r<strong>in</strong>nen je<br />
Ärzt/<strong>in</strong><br />
Praxis 1<br />
Zuwachs <strong>in</strong> E<strong>in</strong>wohne-<br />
weiblich %, 1955 =<br />
100<br />
r<strong>in</strong>nen je<br />
Ärzt/<strong>in</strong><br />
1955 11.519 2<br />
- 100,0% 1253,8 7.090 4<br />
100,0% 2.037,0<br />
1965 13.125 2<br />
15,0% 113,9% 1269,4 7.316 4<br />
14,0% 103,2% 2.277,3<br />
1975 14.164 2<br />
16,5% 123,0% 1212,6 7.226 4<br />
17,3% 101,9% 2.376,9<br />
1985 16.568 3<br />
18,8% 143,8% 1007,2 8.202 4<br />
20,5% 115,7% 2.034,4<br />
1986 16.950 3<br />
- 147,1% 983,5 8.417 4<br />
20,9% 118,7% 1.980,6<br />
1987 17.230 3<br />
- 149,6% 969,9 8.762 4<br />
21,4% 123,6% 1.907,3<br />
1988 17.578 3<br />
- 152,6% 955,8 8.836 4<br />
21,0% 124,6% 1.901,4<br />
1989 18.219 3<br />
- 158,2% 930,6 8.983 4<br />
21,4% 126,7% 1.887,4<br />
1990 18.454 3<br />
20,7% 160,2% 934,4<br />
1991 19.293 3<br />
- 167,5% 903,1 8.824 4<br />
21,8% 124,5% 1.974,5<br />
1992 19.857 3<br />
21,8% 172,4% 885,8 9.272 4<br />
22,8% 130,8% 1.897,1<br />
1993 21.589 3<br />
23,6% 187,4% 820,9 9.563 4<br />
23,5% 134,9% 1.853,1<br />
1994 22.053 3<br />
24,1% 191,4% 806,4 10.093 4<br />
25,0% 142,4% 1.761,9<br />
1995 22.426 3<br />
24,6% 194,7% 795,8 10.076 4<br />
24,7% 142,1% 1.771,2<br />
1996 22.801 3<br />
25,1% 197,9% 785,7 10.142 4<br />
24,7% 143,0% 1.766,3<br />
1997 23.181 3<br />
25,6% 201,2% 772,8 11.420 5<br />
- 161,1% 6<br />
1.568,6 6<br />
1998 23.817 3<br />
26,8% 206,8% 754,5 11.503 5<br />
- 162,2% 6<br />
1.562,3 6<br />
1 e<strong>in</strong>schließlich Assistenzärzten bei Zahnärzt/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> freier Praxis<br />
2 Quelle für die Jahre 1955 – 1975: LDS, Stat. Berichte, „Im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> tätige Personen“, e<strong>in</strong>schließlich Assistenzärzten <strong>in</strong> freier<br />
Praxis<br />
3 Quelle: LÖGD nach Angaben der Ärztekammern Nordrhe<strong>in</strong> <strong>und</strong> Westfalen-Lippe<br />
4 Quelle für die Jahre 1955 – 1996: LDS, Stat. Berichte, „Im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> tätige Personen“<br />
5 Quelle: Zahnärztekammer Nordrhe<strong>in</strong> <strong>und</strong> Westfalen-Lippe, e<strong>in</strong>schließlich Vertretungen <strong>in</strong> Zahnarztpraxen<br />
6 Zuwachsraten aufgr<strong>und</strong> anderer Quelle nur bed<strong>in</strong>gt valide<br />
Quelle: LDS, Statistik Berufe des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s, LÖGD, (Zahn)Ärztekammern Nordrhe<strong>in</strong> <strong>und</strong> Westfalen-Lippe, eig.<br />
Berechnungen FfG<br />
Trotz dieser Probleme dokumentiert Tab. 17, dass sich die Zahl der niedergelassenen Ärzte <strong>und</strong> Ärzt<strong>in</strong>nen<br />
seit den 50er Jahren verdoppelt hat, während bei den Zahnärzt/<strong>in</strong>nen bis 1996 mit e<strong>in</strong>em<br />
Wachstum von etwas über 40 % e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere Zuwachsrate zu verzeichnen ist. Mit dem Ausbau der<br />
ambulanten ärztlichen Versorgung geht e<strong>in</strong>e deutliche Verbesserung der Versorgungsquoten e<strong>in</strong>her.<br />
Kamen 1955 auf e<strong>in</strong>en Arzt 1.253,8 E<strong>in</strong>wohner/<strong>in</strong>nen, so verbesserte sich dieses Verhältnis <strong>in</strong> 1998<br />
auf e<strong>in</strong>e/n Ärzt/<strong>in</strong> pro 754 E<strong>in</strong>wohner/<strong>in</strong>nen. Auch bei den Zahnärzt/<strong>in</strong>nen erfolgte e<strong>in</strong>e Verbesserung<br />
der Versorgungsdichte – zwischen 1955 <strong>und</strong> 1996 sank die Zahl der E<strong>in</strong>wohner/<strong>in</strong>nen pro Zahnärzt/<strong>in</strong><br />
von 2.037 auf ca. 1.766 Personen. 21<br />
Der Anstieg der (Zahn)Ärzt/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> freier Praxis resultiert vorrangig aus dem Zeitraum zwischen<br />
1985 <strong>und</strong> 1998. Während bei den Ärzt/<strong>in</strong>nen zwischen 1955 <strong>und</strong> 1985, d.h. <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er Zeitspanne<br />
von 30 Jahren, e<strong>in</strong> Zuwachs von etwas über 43,8 % oder 5.000 niedergelassenen Ärzt/<strong>in</strong>nen stattfand,<br />
stieg <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Zeitraum von nur 13 Jahren bis 1998 die Zahl der Ärzt/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> freier Praxis erneut um<br />
über 7.000 Personen. Überdurchschnittliche jährliche Steigerungsraten f<strong>in</strong>den sich dabei von 1990 auf<br />
1991 (+4,5 %), aber <strong>in</strong>sbesondere von 1992 auf 1993 (+8,7 %). Seitdem s<strong>in</strong>d abgeschwächte Zuwachsraten<br />
von 1,7-2,7 % jährlich zu verzeichnen.<br />
21<br />
Für die letzten zwei Jahre ist aufgr<strong>und</strong> der anderen Datenquelle nur e<strong>in</strong>e bed<strong>in</strong>gte Vergleichbarkeit der Entwicklung<br />
möglich.<br />
- 44 -
Ambulante Ges<strong>und</strong>heitsversorgung<br />
Unter den niedergelassenen Ärzt/<strong>in</strong>nen bilden Fachärzte für Allgeme<strong>in</strong>mediz<strong>in</strong> sowie praktische Ärzte<br />
<strong>und</strong> Ärzt<strong>in</strong>nen ohne Gebietsbezeichnung mit 8.231 Personen im Jahr 1998 die größte Gruppe. Dies<br />
bedeutet gegenüber e<strong>in</strong>em Stand von 6.041 Ärzt/<strong>in</strong>nen im Jahr 1980 e<strong>in</strong>e Steigerung um über 36 %.<br />
E<strong>in</strong> prozentual noch ausgeprägterer Zuwachs f<strong>in</strong>det sich bei den niedergelassenen Gynäkolog/<strong>in</strong>nen –<br />
die Zahl der Frauenärzt/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> freier Praxis stieg zwischen 1980 <strong>und</strong> 1998 von 1.336 auf 2.175 Personen<br />
<strong>und</strong> damit um über 60 % (s. Anhang, Tab. A 11).<br />
Auch bei den Zahnärzt/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> freier Praxis f<strong>in</strong>den sich Anfang der 90er Jahre überdurchschnittliche<br />
jährliche Steigerungsraten. Von 1991 auf 1992 <strong>und</strong> von 1993 auf 1994 stieg die Zahl der <strong>in</strong> freier Praxis<br />
tätigen Zahnärzt/<strong>in</strong>nen jeweils um über 5 %.<br />
Neben den (Zahn)Ärzt/<strong>in</strong>nen stellen Arzt- <strong>und</strong> Zahnarzthelfer<strong>in</strong>nen die größten Berufsgruppen <strong>in</strong> der<br />
ambulanten mediz<strong>in</strong>ischen Versorgung. Mangels Längsschnittdaten bezüglich der Gesamtbeschäftigungsentwicklung<br />
<strong>in</strong> (zahn)ärztlichen Praxen muss hier auf Angaben aus der Beschäftigtenstatistik<br />
zurückgegriffen werden. Demnach waren 1998 <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen über 112.000 Sprechst<strong>und</strong>enhelfer<strong>in</strong>nen<br />
sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter e<strong>in</strong>e kont<strong>in</strong>uierlich steigende Zahl an<br />
Teilzeitkräften (1980: 6,7 %, 1998: 15,6 %). Wie angesichts der Auszubildendenzahlen zu erwarten,<br />
liegt der Frauenanteil unter den Sprechst<strong>und</strong>enhelfer<strong>in</strong>nen, auch für die zurückliegenden Jahre, kont<strong>in</strong>uierlich<br />
bei fast 100 %. Der Anteil der Sprechst<strong>und</strong>enhelfer<strong>in</strong>nen mit ausländischer Herkunft stieg<br />
von 1,6 % im Jahr 1980 auf 5,7 % <strong>in</strong> 1993. Seitdem ist e<strong>in</strong> leichter Rückgang um 0,5 Prozentpunkte<br />
auf 5,2 % erfolgt.<br />
Tab. 18 Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Sprechst<strong>und</strong>enhelfer/<strong>in</strong>nen, Frauen- <strong>und</strong><br />
Ausländeranteile sowie Beschäftigungsverhältnis, 1980 - 1998<br />
Jahr <strong>in</strong>sgesamt <strong>in</strong> % 1980 = darunter<br />
100 weiblich <strong>in</strong> %<br />
von <strong>in</strong>sgesamt<br />
- 45 -<br />
ausländisch <strong>in</strong><br />
% von <strong>in</strong>sgesamt<br />
Teilzeit <strong>in</strong> %<br />
von <strong>in</strong>sgesamt<br />
1980 68.325 100,0% 99,6% 1,6% 6,7%<br />
1985 79.399 116,2% 99,7% 1,6% 8,1%<br />
1986 84.381 123,5% 99,6% 1,6% 8,7%<br />
1987 85.021 124,4% 99,7% 1,9% 9,1%<br />
1988 88.095 128,9% 99,7% 2,1% 9,5%<br />
1989 89.309 130,7% 99,7% 2,5% 10,0%<br />
1990 94.133 137,8% 99,7% 3,0% 11,1%<br />
1991 99.466 145,6% 99,6% 3,7% 11,9%<br />
1992 105.587 154,5% 99,6% 5,0% 12,9%<br />
1993 109.941 160,9% 99,6% 5,7% 13,5%<br />
1994 112.366 164,5% 99,6% 5,6% 14,0%<br />
1995 114.161 167,1% 99,5% 5,6% 14,6%<br />
1996 113.442 166,0% 99,5% 5,5% 14,9%<br />
1997 113.419 166,0% 99,4% 5,4% 15,1%<br />
1998 112.733 165,0% 99,4% 5,2% 15,6%<br />
Quelle: LAA, Beschäftigtenstatistik 31.12., Berechnungen FfG<br />
Bis 1995 war der Beschäftigungszuwachs bei den Sprechst<strong>und</strong>enhelfer<strong>in</strong>nen stetig steigend. Gegenüber<br />
1980 erhöhte sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten (Zahn)Arzthelfer<strong>in</strong>nen<br />
um über 67 % von 68.325 auf mehr als 114.000 Personen. Seit 1995 haben sich die Beschäftigungschancen<br />
jedoch verschlechtert. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sank bis 1998
Ambulante Ges<strong>und</strong>heitsversorgung<br />
um etwas über 1.400 Personen oder 1,3 %. E<strong>in</strong>er b<strong>und</strong>esweiten Erhebung des Berufsverbandes der<br />
Arzt-, Zahnarzt- <strong>und</strong> Tierarzthelfer<strong>in</strong>nen folgend, stieg parallel der Anteil der ger<strong>in</strong>gfügig Beschäftigten<br />
<strong>in</strong> Arztpraxen von 13 % im November 1996 auf 17 % im März 1999 (B<strong>und</strong>esverband der Arzt-,<br />
Zahnarzt- <strong>und</strong> Tierarzthelfer<strong>in</strong>nen 2000).<br />
Der abschließende <strong>in</strong>dexierte Vergleich der Beschäftigungsentwicklung (s. Abb. 16) zwischen 1985<br />
<strong>und</strong> 1998 bei Ärzt/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Zahnärzt/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> freier Praxis sowie sozialversicherungspflichtig beschäftigten<br />
Sprechst<strong>und</strong>enhelfer<strong>in</strong>nen zeigt, dass <strong>in</strong> allen drei Berufsgruppen bis Mitte/ Ende der 90er<br />
Jahre e<strong>in</strong> Beschäftigungsausbau stattgef<strong>und</strong>en hat. Während zwischen 1995 <strong>und</strong> Anfang der 90er Jahre<br />
jedoch die Zahl der Sprechst<strong>und</strong>enhelfer<strong>in</strong>nen prozentual wesentlich stärker als die Zahl der<br />
Ärzt/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Zahnärzt/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> freier Praxis gestiegen ist, f<strong>in</strong>den sich Ende der 90er Jahre rückläufige<br />
Zahlen sozialversicherungspflichtig beschäftigter Sprechst<strong>und</strong>enhelfer<strong>in</strong>nen, obwohl die Zahl der<br />
Ärzt/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Zahnärzt/<strong>in</strong>nen weiterh<strong>in</strong> leicht zunimmt.<br />
Abb. 16 Beschäftigungsentwicklung bei Ärzt/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Zahnärzt/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> freier Praxis sowie<br />
sozialversicherungspflichtig beschäftigten Sprechst<strong>und</strong>enhelfer<strong>in</strong>nen 1985 –<br />
1998 (1985 = 100)<br />
150%<br />
140%<br />
130%<br />
120%<br />
110%<br />
100%<br />
90%<br />
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998<br />
Ärzt<strong>in</strong>nen u. Ärzte Sprechst<strong>und</strong>enhelfer<strong>in</strong>nen Zahnärzte/ -<strong>in</strong>nen<br />
Quelle: Ärztekammern, LDS, Statistik Berufe des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s, Beschäftigtenstatistik, Darstellung FfG<br />
2.3.2. Praxen nichtärztlicher Heilhilfsberufe<br />
Innerhalb der Ges<strong>und</strong>heitsversorgung ist seit den 70er Jahren der Anteil der Leistungen der „nichtärztlichen<br />
Heilhilfsberufe“ 22 am Gesamtleistungsgeschehen gestiegen. Entfielen 1975 <strong>in</strong> den alten<br />
B<strong>und</strong>esländern erst 1,4 % der Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung auf Leistungen<br />
dieser Berufsgruppe, waren es 1995 mit 5,6 Mrd. DM bereits 2,6 % (Statistisches B<strong>und</strong>esamt<br />
1998: 319).<br />
22 Zu den nichtärztlichen Heilhilfsberufen <strong>in</strong> der ambulanten Versorgung werden im Rahmen des Gutachtens<br />
Heilpraktiker/<strong>in</strong>nen, Psycholog/<strong>in</strong>nen, Ergotherapeut/<strong>in</strong>nen/ Beschäftigungstherapeut/<strong>in</strong>nen, Logopäd/<strong>in</strong>nen,<br />
Masseure/ med. Bademeister/<strong>in</strong>nen, Physiotherapeut/<strong>in</strong>nen/ Krankengymnast/<strong>in</strong>nen sowie med. Fußpfleger/<strong>in</strong>nen<br />
gezählt.<br />
- 46 -
Ambulante Ges<strong>und</strong>heitsversorgung<br />
Im Gegensatz zu anderen Bereichen der stationären <strong>und</strong> ambulanten Ges<strong>und</strong>heitsversorgung ist die<br />
ambulante Versorgungssituation sowie die Zahl der Beschäftigten <strong>in</strong> den nichtärztlichen Heilhilfsberufen<br />
statistisch bislang nur unzureichend erschlossen, <strong>in</strong>sbesondere für zurückliegende Zeiträume. Um<br />
zum<strong>in</strong>dest e<strong>in</strong>en groben Überblick über die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen zu bekommen, wurde<br />
auf Daten der Berufsgenossenschaft für Ges<strong>und</strong>heitsdienst <strong>und</strong> Wohlfahrtspflege, die Statistik „Berufe<br />
des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s“ <strong>und</strong> die Beschäftigtenstatistik zurückgegriffen.<br />
Vor diesem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> können nur näherungsweise Aussagen bezüglich des Beschäftigungsumfangs<br />
<strong>in</strong> den nichtärztlichen mediz<strong>in</strong>ischen Praxen getroffen werden. Auf der Basis unterschiedlicher Quellen<br />
(siehe Fußnote 23) ist für das Jahr 1998 davon auszugehen, dass <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen ca.<br />
49.270 Personen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er nichtärztlichen mediz<strong>in</strong>ischen oder therapeutischen Praxis tätig s<strong>in</strong>d.<br />
Für die Mehrheit der Praxen <strong>in</strong> den nichtärztlichen Heilhilfsberufen wurde auf Angaben der Berufsgenossenschaft<br />
für Ges<strong>und</strong>heitsdienst <strong>und</strong> Wohlfahrtspflege zurückgegriffen. Dementsprechend ist, wie<br />
bereits im Zusammenhang mit den Beschäftigtendaten <strong>in</strong> Arzt- <strong>und</strong> Zahnarztpraxen ausführlich erläutert<br />
(vgl. Kap. 2.3.1), auch für diese Berufe anzunehmen, dass die Beschäftigtenzahlen aufgr<strong>und</strong> des<br />
kumulativen Charakters der berufsgenossenschaftlichen Statistik systematisch zu hoch liegen. Zugleich<br />
fehlen allerd<strong>in</strong>gs für die Berufsgruppen der Psycholog/<strong>in</strong>nen, der Hebammen <strong>und</strong> der Heilpraktiker/<strong>in</strong>nen<br />
Beschäftigtenangaben auf der Ebene der Praxis, so dass hier sozialversicherungspflichtig<br />
Angestellte nicht berücksichtigt s<strong>in</strong>d.<br />
Der größte Beschäftigtenanteil unter den nichtärztlichen Heilhilfsberufen entfällt 1998 mit über 44 %<br />
auf die physiotherapeutischen Praxen (s. Abb. 17). Hier weist die Statistik der Berufsgenossenschaft<br />
für Ges<strong>und</strong>heitsdienst <strong>und</strong> Wohlfahrtspflege 21.895 Personen <strong>in</strong> fast 4.600 Betrieben aus. 19 % der<br />
Beschäftigten <strong>in</strong> Praxen nichtärztlicher Heilhilfsberufe f<strong>in</strong>den sich bei den med. Fußpfleger/<strong>in</strong>nen.<br />
Hier s<strong>in</strong>d 9.300 Personen <strong>in</strong> 7.636 Praxen tätig. In diesem Bereich liegt zwar die Zahl der Betriebe<br />
wesentlich höher als bei den physiotherapeutischen/ krankengymnastischen Praxen, aber die Zahl der<br />
sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer/<strong>in</strong>nen ist ger<strong>in</strong>g.<br />
- 47 -
Ambulante Ges<strong>und</strong>heitsversorgung<br />
Abb. 17 Selbständige <strong>und</strong> angestellt Beschäftigte <strong>in</strong> nichtärztlichen mediz<strong>in</strong>ischen Praxen<br />
1998 23<br />
Praxen für med.<br />
Fußpflege<br />
9.296<br />
Heilpraktiker/<strong>in</strong>nen<br />
3.756<br />
Quelle: Berechnung <strong>und</strong> Darstellung FfG<br />
Psycholog/<strong>in</strong>nen<br />
3.350<br />
physiotherap. Praxen<br />
21.895<br />
- 48 -<br />
ergotherap. Praxen<br />
Hebammen 1.288<br />
524<br />
logopäd. Praxen<br />
1.723<br />
Massagepraxen<br />
7.446<br />
Auf die <strong>in</strong>sgesamt 2.044 Massagepraxen entfallen 1998 mit 7.446 Personen 15,1 % der Beschäftigten.<br />
Für Heilpraktiker/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> nichtärztliche Psychotherapeut/<strong>in</strong>nen fehlen Beschäftigtenzahlen auf Praxisebene.<br />
Hier ist davon auszugehen, dass die bislang ermittelten Anteile von 7,6 % bzw. 6,8 % an der<br />
Gesamtbeschäftigtenzahl untere Werte darstellen. Hebammen, Ergotherapeut/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Logopäd/<strong>in</strong>nen<br />
bilden mit Anteilen von 1,1 % bis 3,5 % die kle<strong>in</strong>sten Beschäftigtengruppen.<br />
Tab. 19 gibt e<strong>in</strong>en, wenn auch zeitlich begrenzten, E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> die Beschäftigungsdynamik der niedergelassenen<br />
Heilhilfsberufler. Nach Angaben der Berufsgenossenschaft für Ges<strong>und</strong>heitsdienst <strong>und</strong><br />
Wohlfahrtspflege stieg alle<strong>in</strong> zwischen 1996 <strong>und</strong> 1998 die Zahl der Berufstätigen <strong>in</strong> krankengymnastischen/<br />
physiotherapeutischen Praxen um ca. 6.000 Personen oder knapp 38 %. E<strong>in</strong> Teil dieses Anstiegs<br />
könnte aus der Neuordnung der Berufe <strong>in</strong> der Physiotherapie (Masseur- <strong>und</strong> Physiotherapeutengesetz)<br />
im Jahr 1994 resultieren, <strong>und</strong> der damit für Masseur/<strong>in</strong>nen verb<strong>und</strong>enen Möglichkeit, über e<strong>in</strong>e<br />
Fortbildung den Abschluss zur/m Physiotherapeuten/<strong>in</strong> zu erwerben. Denn parallel zur Ausweitung<br />
der krankengymnastischen Praxen reduzierte sich die Zahl der Massagepraxen von knapp 2.600 auf<br />
2.044 Praxen oder um 21 %. Die Zahl der Beschäftigten sank zwischen 1996 <strong>und</strong> 1998 mit über<br />
2.800 Personen oder knapp 28 % noch stärker. Das Angebot an logopädischen Praxen erhöhte sich <strong>in</strong><br />
zwei Jahren von 505 auf 591 Betriebe, die Zahl der Beschäftigten stieg um knapp 26 % oder ca. 350<br />
Personen. Bei den ergotherapeutischen Praxen f<strong>in</strong>det sich e<strong>in</strong> Zuwachs von 314 auf 396 Praxen <strong>und</strong><br />
e<strong>in</strong>e Personalzunahme um 42 % oder 380 Personen.<br />
23 Für die Berufsgruppen der Ergotherapeut/<strong>in</strong>nen, Logopäd/<strong>in</strong>nen, Masseur/<strong>in</strong>nen/ med. Bademeister/<strong>in</strong>nen,<br />
Physiotherapeut/<strong>in</strong>nen/ Krankengymnast/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> med. Fußpfleger/<strong>in</strong>nen wurden Gesamtbeschäftigtenangaben<br />
auf Praxisebene aus der Statistik der Berufsgenossenschaft für Ges<strong>und</strong>heitsdienst <strong>und</strong> Wohlfahrtspflege<br />
zu Gr<strong>und</strong>e gelegt. Für die Berufsgruppen der Heilpraktiker/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Hebammen wurde auf die Angaben<br />
aus der Statistik Berufe des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s aus dem Jahr 1996 zurückgegriffen, bere<strong>in</strong>igt um Beschäftigte<br />
<strong>in</strong> Krankenhäusern. Hier fehlen Angaben zur Zahl der neben den Ges<strong>und</strong>heitsberuflern <strong>in</strong> den Praxen<br />
Beschäftigten. Die Angaben zu den <strong>in</strong> freier Praxis tätigen Psycholog/<strong>in</strong>nen basieren auf Schätzungen der<br />
Landesgruppe des Berufsverbandes Deutscher Psycholog/<strong>in</strong>nen für NRW.
Ambulante Ges<strong>und</strong>heitsversorgung<br />
Tab. 19 Selbständige <strong>und</strong> angestellt Beschäftigte <strong>in</strong> Praxen von nichtärztlichen Heilhilfsbe-<br />
Jahr<br />
rufen 1996 - 1998<br />
Betriebe Selbständige <strong>und</strong> angestellt Beschäftigte<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
<strong>in</strong> %<br />
1996=<br />
100%<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
<strong>in</strong> %<br />
1996=<br />
100%<br />
davon<br />
Ergothera- Logopäd/<strong>in</strong>nen<br />
peut/<strong>in</strong>nen, (Sprachschule)<br />
Beschäftigungstherapeut/<strong>in</strong>nen<br />
zusammen<br />
<strong>in</strong> %<br />
von<br />
<strong>in</strong>sg.<br />
zusammen<br />
- 49 -<br />
<strong>in</strong> %<br />
von<br />
<strong>in</strong>sg.<br />
Masseur/<strong>in</strong>nen,<br />
med. Bademeister/<strong>in</strong>nen<br />
zusammen<br />
<strong>in</strong> %<br />
von<br />
<strong>in</strong>sg.<br />
Physiotherapeut/<strong>in</strong>nen/Krankengymnast/<strong>in</strong>nen<br />
zusammen<br />
<strong>in</strong> %<br />
von<br />
<strong>in</strong>sg.<br />
med. Fußpfleger/<strong>in</strong>nen<br />
zusammen<br />
1996 13.713 37.143 907 2,4% 1.369 3,7% 10.312 27,8% 15.869 42,7% 8.686 23,4%<br />
1997 14.293 104,2% 38.924 104,8% 1.100 2,8% 1.660 4,3% 8.448 21,7% 18.558 47,7% 9.158 23,5%<br />
1998 15.263 111,3% 41.648 112,1% 1.288 3,1% 1.723 4,1% 7.446 17,9% 21.895 52,6% 9.296 22,3%<br />
Quelle: Berufsgenossenschaft für Ges<strong>und</strong>heitsdienst <strong>und</strong> Wohlfahrtspflege, Berechnungen FfG<br />
E<strong>in</strong>e Sonderauswertung der Beschäftigtenstatistik für die Berufsordnung „Masseur/<strong>in</strong>nen, Krankengymnast/<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> verwandte Berufe“ (BKZ 852), zu der auch Bewegungstherapeut/<strong>in</strong>nen, Therapeut/<strong>in</strong>nen<br />
für Sprech- <strong>und</strong> Hör- sowie Sehstörungen, Beschäftigungs- <strong>und</strong> Kunsttherapeut/<strong>in</strong>nen gezählt<br />
werden, unterstreicht für den Zeitraum von 1991 bis 1998 die gr<strong>und</strong>sätzliche Ausweitung der<br />
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsmöglichkeiten für diese Berufsgruppen (s. Anhang, Tab.<br />
A 12). Insgesamt stieg zwischen 1991 <strong>und</strong> 1998 die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten<br />
um fast e<strong>in</strong> Drittel von 15.500 auf 20.500 Personen. Dabei s<strong>in</strong>d 1998 knapp 40 % der nichtärztlichen<br />
Heilhilfsberufler <strong>in</strong> Krankenhäusern sowie Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen, der Rest,<br />
ca. 12.000 Personen, <strong>in</strong> sonstigen Arbeitsbereichen beschäftigt. Leider liegen bezüglich der Entwicklung<br />
der Zahl der Selbständigen <strong>in</strong> diesen Berufen ke<strong>in</strong>e entsprechenden Statistiken vor.<br />
Für die Beschäftigungsentwicklung bei Heilpraktiker/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Hebammen f<strong>in</strong>den sich über die bis<br />
1996 von den Ges<strong>und</strong>heitsämtern geführte Statistik „Berufe des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s“ etwas längere<br />
Zeitreihen (s. Tab. 20). Auch sie können allerd<strong>in</strong>gs nur die groben Entwicklungstrends dokumentieren,<br />
da seitens das Landesamtes für Datenverarbeitung <strong>und</strong> Statistik bezüglich der Statistik der Berufe des<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s von e<strong>in</strong>er nicht unerheblichen Untererfassung bei den nichtärztlichen Heilhilfsberufen<br />
ausgegangen wird.<br />
Trotz der e<strong>in</strong>geschränkten Validität der Daten ist von e<strong>in</strong>em deutlichen Beschäftigungszuwachs zwischen<br />
1985 <strong>und</strong> 1996 <strong>in</strong> beiden Berufen auszugehen. Im Betrachtungszeitraum verdoppelte sich die<br />
Zahl der praktizierenden Heilpraktiker/<strong>in</strong>nen annähernd von 1.957 auf 3.756 Personen. Geht man zudem<br />
davon aus, dass <strong>in</strong> jeder zweiten Heilpraktikerpraxis e<strong>in</strong>e zweite Person angestellt tätig ist (Sahner/Rönnau<br />
1991), so wäre die Zahl der Beschäftigten von ca. 2.900 auf 5.634 Personen gestiegen.<br />
Trotz Geburtenrückgangs erhöhte sich auch die Zahl der erwerbstätigen Hebammen zwischen 1985<br />
<strong>und</strong> 1996 um über 60 % von ca. 1.600 auf 2.588 Personen. 1996 waren allerd<strong>in</strong>gs knapp 80 % aller<br />
Hebammen <strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäusern angestellt.<br />
<strong>in</strong> %<br />
von<br />
<strong>in</strong>sg.
Ambulante Ges<strong>und</strong>heitsversorgung<br />
Tab. 20 Heilpraktiker/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Hebammen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen 1985 - 1996<br />
Jahr Heilpraktiker/<strong>in</strong>nen Hebammen<br />
<strong>in</strong>sgesamt <strong>in</strong> %, 1985 = 100 <strong>in</strong>sgesamt <strong>in</strong> %, 1985 = 100 Darunter<br />
ohne Anstellung im<br />
Krankenhaus<br />
zusammen <strong>in</strong> %, 1985<br />
= 100<br />
1985 1.957 100,0% 1.608 100,0% 172 100,0%<br />
1986 2.223 113,6% 1.650 102,6% 167 97,1%<br />
1987 2.259 115,4% 1.723 107,2% 192 111,6%<br />
1988 2.285 116,8% 1.797 111,8% 207 120,3%<br />
1989 2.517 128,6% 1.882 117,0% 244 141,9%<br />
1990 k.A. k.A.<br />
1991 2.814 143,8% 2.017 125,4% 621 361,0%<br />
1992 2.809 143,5% 2.235 139,0% 443 257,6%<br />
1993 2.904 148,4% 2.407 149,7% 420 244,2%<br />
1994 3.177 162,3% 2.496 155,2% 422 245,3%<br />
1995 3.533 180,5% 2.515 156,4% 425 247,1%<br />
1996 3.756 191,9% 2.588 160,9% 524 304,7%<br />
Quelle: LDS, Statistik Berufe des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s, Krankenhausstatistik, Berechnungen FfG<br />
Für die nichtärztlichen Psychotherapeut/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> freien Praxen liegen nach Aussagen der Landesgruppe<br />
des Berufsverbandes Deutscher Psychologen Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen gegenwärtig ke<strong>in</strong>e validen Daten<br />
zum Beschäftigungsstand, geschweige denn zur Beschäftigungsentwicklung vor. E<strong>in</strong>er Mitgliederbefragung<br />
aus dem Jahr 1999 folgend, geht der Berufsverband allerd<strong>in</strong>gs davon aus, dass die Hälfte<br />
se<strong>in</strong>er ca. 4.800 Mitglieder selbstständig oder angestellt <strong>in</strong> freier Praxis tätig ist. Der verbandliche<br />
Organisationsgrad unter den Psycholog/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen beträgt jedoch nicht 100 %. Als<br />
Gr<strong>und</strong>lage für die geplante Kammerbildung für approbierte Psychotherapeut/<strong>in</strong>nen wird auf Landesebene<br />
von ungefähr 6.700 Psychotherapeut/<strong>in</strong>nen ausgegangen, von denen ca. 50 % <strong>in</strong> freier Praxis<br />
arbeiten. Somit s<strong>in</strong>d für das Basisjahr 1998 ca. 3.350 selbstständig oder abhängig <strong>in</strong> freier Praxis beschäftigte<br />
Psycholog/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen anzunehmen.<br />
Auch wenn die nichtärztlichen mediz<strong>in</strong>ischen <strong>und</strong> therapeutischen Praxen <strong>in</strong> der ambulanten Ges<strong>und</strong>heitsversorgung<br />
noch e<strong>in</strong>en relativ kle<strong>in</strong>en Teilbereich bilden <strong>und</strong> längere Zeitreihen zur Beschäftigungsentwicklung<br />
bislang fehlen, zeigt das vorliegende Datenmaterial bis 1998 e<strong>in</strong>e kont<strong>in</strong>uierliche<br />
Ausweitung der Beschäftigungsmöglichkeiten. Diese Entwicklung unterstreicht die zunehmende Bedeutung<br />
therapeutischer <strong>und</strong> rehabilitativer statt medikamentöser Behandlungsformen <strong>in</strong> der Ges<strong>und</strong>heitsversorgung.<br />
Auf Seiten der Patient/<strong>in</strong>nen wird diese Entwicklung positiv beurteilt. Da jedoch die<br />
<strong>Arbeitsmarkt</strong>bed<strong>in</strong>gungen für die meisten der nichtärztlichen Heilhilfsberufe gegenwärtig noch von<br />
der ökonomischen Beziehung zu den Kassenärzt/<strong>in</strong>nen bestimmt s<strong>in</strong>d, könnten sich perspektivisch<br />
E<strong>in</strong>griffe <strong>in</strong> die kassenärztlichen Budgets negativ auf die Berufschancen der nichtärztlichen Heilhilfsberufe<br />
auswirken. Bereits jetzt wird im Rahmen der Ges<strong>und</strong>heitsberichterstattung für Deutschland<br />
davon ausgegangen, dass z.B. die Wachstumsraten <strong>in</strong> den physiotherapeutischen Praxen nur noch mäßig<br />
steigen werden, bei gleichzeitig höheren Betriebskosten aufgr<strong>und</strong> e<strong>in</strong>es zunehmenden Bedarfs an<br />
technischen Hilfsmitteln (Statistisches B<strong>und</strong>esamt 1998: 321).<br />
- 50 -
2.3.3. Apotheken<br />
Ambulante Ges<strong>und</strong>heitsversorgung<br />
In Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen stieg zwischen 1955 <strong>und</strong> 1998 die Zahl der öffentlichen Apotheken um etwas<br />
über 200 % von 1.546 auf 4.849 Voll- <strong>und</strong> Zweigapotheken. Damit erhöhte sich die Apothekendichte<br />
von 10,7 Apotheken pro 100.000 E<strong>in</strong>wohner/<strong>in</strong>nen im Jahr 1955 auf 27 Apotheken pro 100.000 E<strong>in</strong>wohner/<strong>in</strong>nen<br />
<strong>in</strong> 1998. Allerd<strong>in</strong>gs war 1992 mit 4.912 öffentlichen Apotheken <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
die bislang höchste Zahl an E<strong>in</strong>richtungen erreicht. Die Zahl der Krankenhausapotheken stieg von 71<br />
(1955) auf 178 (1996) (s. Anhang, Tab. A 13).<br />
Tab. 21 Personal <strong>in</strong> Apotheken 1975 - 1998<br />
Jahr <strong>in</strong>sge- davon<br />
samt Apotheker/<strong>in</strong>nen pharm.- techn. Assistenten/ Apothekerassis- sonstiges Personal<br />
<strong>in</strong>nen<br />
tent/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> Apotheken<br />
zusam- <strong>in</strong> % darunter zusam- <strong>in</strong> % darunter zusam- <strong>in</strong> % zusam- <strong>in</strong> %<br />
men 1975 =<br />
100<br />
weiblich<br />
<strong>in</strong> % von<br />
men 1975 =<br />
100<br />
weiblich<br />
<strong>in</strong> % von<br />
men 1975 =<br />
100<br />
men 1994 =<br />
100<br />
zusamzusammenmen<br />
1975 7.066 100,0% 51,7% 2.855 100,0% 94,7% 1.494 100,0%<br />
1980 7.538 106,7% 50,2% 4.017 140,7% 97,1% 1.179 78,9%<br />
1985 8.213 116,2% 51,1% 5.405 189,3% 98,8% 1.270 85,0%<br />
1986 8.828 124,9% 51,9% 6.090 213,3% 98,8% 1.334 89,3%<br />
1987 8.797 124,5% 52,0% 6.497 227,6% 98,6% 1.279 85,6%<br />
1988 9.038 127,9% 52,8% 6.931 242,8% 98,5% 1.547 103,5%<br />
1989 8.905 126,0% 53,4% 7.058 247,2% 98,4% 1.437 96,2%<br />
1991 9.370 132,6% 53,7% 7.510 263,0% 98,0% 1.441 96,5%<br />
1992 9.533 134,9% 53,9% 7.599 266,2% 98,0% 1.385 92,7%<br />
1993 9.770 138,3% 55,7% 7.915 277,2% 98,2% 1.418 94,9%<br />
1994 1)<br />
26.123 9.595 135,8% 57,1% 7.994 280,0% 98,0% 1.048 70,1% 7.486 100,0%<br />
1995 1)<br />
26.679 9.739 137,8% 57,9% 8.096 283,6% 97,5% 1.042 69,7% 7.802 104,2%<br />
1996 1)<br />
26.896 9.987 141,3% 58,9% 8.414 294,7% 96,8% 1.032 69,1% 7.463 99,7%<br />
1997 1)<br />
27.697 10.092 142,8% 8.561 299,9% 932 62,4% 8.112 108,4%<br />
1998 1)<br />
27.411 10.305 145,8% 8.809 308,5% 909 60,8% 7.388 98,7%<br />
1) Angaben der Apothekerkammern Nordrhe<strong>in</strong> <strong>und</strong> Westfalen-Lippe zitiert nach den LÖGD<br />
2) Angaben der Apothekerkammern Nordrhe<strong>in</strong> <strong>und</strong> Westfalen-Lippe<br />
Quelle: LDS, Beschäftigte im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> <strong>und</strong> Jahresges<strong>und</strong>heitsbericht NRW, Berechnungen FfG<br />
1998 waren nach Angaben der Apothekerkammern Nordrhe<strong>in</strong> <strong>und</strong> Westfalen-Lippe <strong>in</strong>sgesamt 27.411<br />
Personen <strong>in</strong> Apotheken beschäftigt. 73 % aller Beschäftigten <strong>in</strong> öffentlichen <strong>und</strong> Krankenhausapotheken<br />
s<strong>in</strong>d pharmazeutisch ausgebildetes Personal, d.h. Apotheker/<strong>in</strong>nen, pharmazeutisch-technische<br />
Assistent/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Apothekerassistent/<strong>in</strong>nen. Der Anteil des sonstigen Personals beträgt 27 % oder<br />
knapp 7.400 Personen.<br />
Im Betrachtungszeitraum erfolgt e<strong>in</strong>e stetige Ausweitung der Beschäftigtenzahlen <strong>in</strong> Apotheken bis<br />
e<strong>in</strong>schließlich 1998. So stieg alle<strong>in</strong> die Zahl des pharmazeutischen Personals um über 75 % von<br />
11.400 Personen 1975 auf über 20.000 im Jahr 1998. Apotheker/<strong>in</strong>nen bilden dabei die größte Berufsgruppe.<br />
Ihre Zahl verdreifachte sich zwischen 1955 <strong>und</strong> 1998 <strong>und</strong> stieg von 3.115 (1955) auf 10.305<br />
- 51 -
Ambulante Ges<strong>und</strong>heitsversorgung<br />
(1998) Personen. 24 Alle<strong>in</strong> zwischen 1985 <strong>und</strong> 1998 erfolgte e<strong>in</strong> prozentualer Zuwachs bei den Apotheker/<strong>in</strong>nen<br />
von etwas über 25 %. Die Zahl der pharmazeutisch-technischen Assistent/<strong>in</strong>nen stieg<br />
zwischen 1985 <strong>und</strong> 1998 mit über 60 % oder 3.400 Personen auf mehr als 8.800 Beschäftigte. Bei den<br />
Apothekerassistent/<strong>in</strong>nen s<strong>in</strong>d demgegenüber seit 1993 rückläufige Beschäftigtenzahlen zu verzeichnen.<br />
Ihre Zahl reduzierte sich um fast 40 % von 1.400 auf etwas über 900 Angestellte (s. Tab. 21).<br />
Über 2/3 der Beschäftigten <strong>in</strong> Apotheken s<strong>in</strong>d weiblich. Während allerd<strong>in</strong>gs unter den pharmazeutisch-technischen<br />
Assistent/<strong>in</strong>nen über 96 % Frauen s<strong>in</strong>d, beträgt dieser Anteil bei den Apotheker/<strong>in</strong>nen<br />
nur ca. 60 %; er ist jedoch seit Mitte der 70er Jahre um etwas über 7 % gestiegen.<br />
Abb. 18 Pharmazeutisches Personal <strong>in</strong> Apotheken 1985-1998 (1985 = 100)<br />
180%<br />
160%<br />
140%<br />
120%<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
1985 1986 1987 1988 1989 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998<br />
pharmazeutisches Personal Apotheker/<strong>in</strong>nen<br />
pharmazeutisch technische Assistent/ <strong>in</strong>nen Apothekerassistent/ <strong>in</strong>nen<br />
Quelle: LDS, Statistik Berufe des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s, Apothekerkammern, Darstellung FfG<br />
Bislang hat das Arbeitsfeld Apotheke noch nicht an beschäftigungspolitischer Bedeutung verloren, die<br />
Berufsverbände befürchten für kommende Jahre angesichts der vergleichsweise ger<strong>in</strong>gen Bezahlung <strong>in</strong><br />
öffentlichen Apotheken sogar eher e<strong>in</strong>en Fachkräftemangel als e<strong>in</strong>en Fachkräfteüberschuss (Oppenschowski<br />
2000). Die verschiedenen E<strong>in</strong>griffe im Zuge der Ges<strong>und</strong>heitsstrukturreform, wie z.B. Erhöhung<br />
der Zuzahlungen, sche<strong>in</strong>en durch e<strong>in</strong>en zunehmenden Absatz nichtverschreibungspflichtiger<br />
Produkte abgefedert worden zu se<strong>in</strong>. Angesichts der bereits verm<strong>in</strong>derten Zahl öffentlicher Apotheken<br />
ist jedoch zukünftig nicht davon auszugehen, dass dieses Arbeitsfeld <strong>in</strong> großem Umfang zusätzliche<br />
Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnen wird.<br />
24 1998 arbeiteten nach Angaben der Apothekerkammern Nordrhe<strong>in</strong> <strong>und</strong> Westfalen-Lippe zudem 964 Apotheker/<strong>in</strong>nen<br />
<strong>in</strong> Industrie, Verwaltung, Fachorganisationen <strong>und</strong> Wissenschaft.<br />
- 52 -
Ambulante Ges<strong>und</strong>heitsversorgung<br />
2.3.4. Zusammenfassung <strong>und</strong> Interpretation<br />
1998 arbeiten <strong>in</strong> der ambulanten Ges<strong>und</strong>heitsversorgung <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen ca. 373.000 Personen,<br />
wobei ca. 68 % der Beschäftigten <strong>in</strong> (zahn)ärztlichen Praxen tätig s<strong>in</strong>d. Mit über 49.000 Beschäftigten<br />
stellen die Praxen der nichtärztlichen Heilhilfsberufe das zweitgrößte Arbeitsfeld dar, gefolgt<br />
von der ambulanten Pflege (43.000 Beschäftigte) (s. Kap. 2.4) <strong>und</strong> den Apotheken (27.400 Beschäftigte).<br />
Dabei ist seit den 50er Jahren e<strong>in</strong>e zunehmende Verbesserung der ambulanten Ges<strong>und</strong>heitsversorgung<br />
festzustellen – die Zahl der (zahn)ärztlichen <strong>und</strong> der nichtmediz<strong>in</strong>ischen Praxen stieg ebenso<br />
wie die Zahl der öffentlichen Apotheken, so dass die Versorgungsdichte <strong>in</strong> allen Bereichen zugenommen<br />
hat.<br />
Dementsprechend haben sich die Beschäftigungsmöglichkeiten verbessert. So hat sich seit den 50er<br />
Jahren die Zahl der Ärzt/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> freier Praxis verdoppelt, bei den Zahnärzt/<strong>in</strong>nen erfolgte e<strong>in</strong> Zuwachs<br />
von über 40 % <strong>und</strong> die Zahl der Apotheker/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> öffentlichen <strong>und</strong> Krankenhausapotheken<br />
verdreifachte sich. Von diesen Entwicklungen profitierten auch die nichtakademischen Ges<strong>und</strong>heitsberufe.<br />
Sprechst<strong>und</strong>enhelfer/<strong>in</strong>nen bilden mittlerweile nach den Krankenpflegekräften die zweitstärkste<br />
Berufsgruppe unter den nichtakademischen Ges<strong>und</strong>heitsberufen, der Bedarf an pharmazeutischtechnischen<br />
Assistent/<strong>in</strong>nen stieg <strong>und</strong> seit den 80er Jahren nimmt die Bedeutung der nichtärztlichen<br />
Heilhilfsberufe <strong>in</strong> der ambulanten Versorgung zu. Die stetigen Wachstumsraten <strong>in</strong> den 90er Jahren<br />
dokumentieren e<strong>in</strong> verändertes Verständnis geeigneter mediz<strong>in</strong>ischer Behandlungsmethoden <strong>und</strong> den<br />
wachsenden Stellenwert von Prävention <strong>und</strong> Rehabilitation. Aufgr<strong>und</strong> der ökonomischen Abhängigkeit<br />
vieler nichtärztlicher Ges<strong>und</strong>heitsberufe von den Kassenärzten ist die weitere <strong>Arbeitsmarkt</strong>entwicklung<br />
hier jedoch von den Weichenstellungen im Rahmen der Budgetierung, vom Ausbau ambulanter<br />
Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitation sowie von der Fähigkeit, private Nachfrage zu mobilisieren, abhängig.<br />
Der ambulante Sektor hat über den Beobachtungszeitraum somit e<strong>in</strong> erhebliches absolutes Wachstum<br />
zu verzeichnen, das jedoch <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Dynamik <strong>in</strong> der zweiten Hälfte der 90er Jahre nachlässt. Als beschäftigungshemmend<br />
erweisen sich dabei die Kostendämpfungsmaßnahmen im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>.<br />
Die ärztliche Bedarfsplanung, ursprünglich e<strong>in</strong>geführt, um die regionale Bedarfsdeckung auch durch<br />
die zahlenmäßig kle<strong>in</strong>en Facharztgruppen zu garantieren, änderte <strong>in</strong> den 80er Jahren sukzessive ihren<br />
Charakter h<strong>in</strong> zur Vermeidung e<strong>in</strong>es Überangebots. Seit 1993 legt das SGB V fest, dass neue Praxen<br />
<strong>in</strong> Gebieten, <strong>in</strong> denen das Angebot an Vertragsärzt/<strong>in</strong>nen der jeweiligen Fachrichtung den Versorgungsgrad<br />
um 110 % überschreitet, nicht mehr eröffnet werden können. In der Folge hat der B<strong>und</strong>esausschuss<br />
der Vertragsärzte <strong>und</strong> Krankenkassen Richtl<strong>in</strong>ien zur Klassifizierung <strong>und</strong> Planung von Niederlassungsgebieten<br />
def<strong>in</strong>iert. Dennoch s<strong>in</strong>d ländliche Bereiche meist noch "offen". Deutlich wird<br />
auch, dass die E<strong>in</strong>führung der regionalen Umverteilungsregelung ab dem 31. Januar 1993 zu e<strong>in</strong>er<br />
regelrechten Niederlassungswelle geführt hat. Die prozentuale Steigerung von 1992 auf 1993 betrug<br />
nie wieder erreichte 8,7 %, was die Drosselung der Zunahme <strong>in</strong> den Folgejahren mehr als kompensierte.<br />
Die Diskussion über den starken Anstieg der Arztzahlen hat den Blick auf die besonders kräftige Beschäftigungsentwicklung<br />
bei den Sprechst<strong>und</strong>enhilfen versperrt. Im Beobachtungszeitraum erfolgte<br />
e<strong>in</strong> starkes Wachstum <strong>in</strong> dieser Berufsgruppe. Jedoch gehen die Beschäftigtenzahlen seit 1995 zurück.<br />
- 53 -
Ambulante Ges<strong>und</strong>heitsversorgung<br />
Neuere Studienergebnisse aus Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz führen dies auf die sektorale Budgetierung zurück.<br />
Niedergelassene Ärzte <strong>und</strong> Ärzt<strong>in</strong>nen bauen angesichts der durch die Budgetierung beschränkten E<strong>in</strong>nahmesituation<br />
Personal ab, um Kosten zu sparen (Zentral<strong>in</strong>stitut für die Kassenärztliche Versorgung<br />
1998). Es ist plausibel, dass sich diese Ergebnisse auch auf Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen übertragen lassen.<br />
2.4. Beschäftigung <strong>in</strong> Altenhilfe <strong>und</strong> -pflege<br />
2.4.1. Datenlage<br />
Die seit Jahren bemängelte Datenlage im Bereich der Altenpflege (vgl. Alber 1990: 337, Schölkopf<br />
1998: 1, ders. 1999: 36) hat sich <strong>in</strong> den letzten zwei Jahren für Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen zwar verbessert,<br />
dennoch müssen gravierende E<strong>in</strong>schränkungen h<strong>in</strong>sichtlich der Darstellung der ‚abhängigen Variablen‘<br />
<strong>in</strong> Kauf genommen werden, die sich <strong>in</strong>sbesondere auf die weiter zurückliegenden Jahre <strong>und</strong><br />
generell auf die Differenzierung (nach Bereichen, Geschlecht <strong>und</strong> Nationalität) beziehen. Aufgr<strong>und</strong><br />
der fehlenden e<strong>in</strong>heitlichen Regelung per B<strong>und</strong>esrecht wurden die Altenpfleger<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Altenpfleger<br />
<strong>in</strong> der jährlich ersche<strong>in</strong>enden Beschäftigtenstatistik der B<strong>und</strong>esanstalt für Arbeit <strong>und</strong> im vom Statistischen<br />
B<strong>und</strong>esamt ebenso jährlich durchgeführten Mikrozensus dem Bereich der Sozialarbeiter<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Sozialarbeiter sowie der Sozialpfleger<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Sozialpfleger zugeordnet (ausführlich: Schölkopf<br />
1999a: 57). Zwar werden seit 1993 im Mikrozensus die Erwerbstätigen <strong>in</strong> der Altenpflege als eigene<br />
Berufsgruppe ausgewiesen. Damit s<strong>in</strong>d allerd<strong>in</strong>gs nicht alle Beschäftigten im Bereich der Altenhilfe<strong>und</strong><br />
-pflege erfasst. 25 Auch ist aufgr<strong>und</strong> der Stichprobengröße (1% der Bevölkerung) e<strong>in</strong>e Hochrechnung<br />
nach B<strong>und</strong>esländern <strong>in</strong> Teilbereichen wenig zuverlässig. Die Differenzierung nach Altersstufen,<br />
Geschlecht oder Beschäftigungsverhältnissen kann deshalb nur e<strong>in</strong>geschränkt verwendet werden.<br />
Dann wurden <strong>in</strong> den Volks- <strong>und</strong> Berufszählungen von 1970 <strong>und</strong> 1987 der Beruf der Altenpflege zwar<br />
erfasst, doch erneut mit der Gruppe der Sozialarbeit ausgewertet. Zum Teil können diese Lücken mit<br />
Informationen der seit 1970 erschienenen Statistik der Wohlfahrtsverbände gefüllt werden. Allerd<strong>in</strong>gs<br />
s<strong>in</strong>d damit nur ca. zwei Drittel aller E<strong>in</strong>richtungen erfasst, ferner fehlt auch hier e<strong>in</strong>e Differenzierung<br />
nach B<strong>und</strong>esländern sowie nach Geschlecht <strong>und</strong> Nationalität der Beschäftigten, so dass daraus nur,<br />
aber immerh<strong>in</strong>, globale Entwicklungstrends abgeleitet werden können. 26<br />
25 Die Angaben beruhen auf Angaben der Befragten. Da die <strong>in</strong> der Altenpflege Beschäftigten oft ke<strong>in</strong>e Ausbildung<br />
als Altenpfleger<strong>in</strong>nen oder –pfleger, sondern andere Abschlüsse (z.B. Krankenschwestern) oder nur<br />
praktisch erworbene Kenntnisse haben, ersche<strong>in</strong>en diese Daten nicht sehr zuverlässig. Zudem unterscheidet<br />
der Mikrozensus nicht nach dem Status der erworbenen Ausbildung.<br />
26 Weitere Anhaltspunkte könnten theoretisch aus den zwischen Kostenträgern <strong>und</strong> Anbietern vere<strong>in</strong>barten<br />
Personalschlüsseln gewonnen werden, die für die Jahre 1988, 1990 <strong>und</strong> 1994 vorliegen (vgl. Hirnschützer<br />
1988, Jopen 1990, Allemeyer 1994). Allerd<strong>in</strong>gs muss dabei berücksichtigt werden, dass diese Werte nur Planungen<br />
widerspiegeln. Dann weisen die Personalschlüssel unterschiedliche Zuschnitte sowohl im Zeitablauf<br />
als auch zwischen den B<strong>und</strong>esländern auf, so dass diese kaum die Beschäftigungslage für diese Jahre zuverlässig<br />
abbilden (vgl. Jopen 1990, Allemeyer 1994).<br />
- 54 -
Ambulante <strong>und</strong> stationäre Altenhilfe<br />
Noch schwieriger gestaltet sich die Datenlage bei den Beschäftigtenzahlen im Bereich der ambulanten<br />
Pflege. Hier existieren zwar relativ zusammenhängend Angaben zu den <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>dekrankenpflege<br />
Beschäftigten, die vom Statistischen B<strong>und</strong>esamt zwischen 1953 <strong>und</strong> 1975 veröffentlicht wurden. In<br />
diesem – seit den sechziger Jahren vom Nachwuchsmangel <strong>und</strong> Niedergang gezeichneten – Bereich<br />
waren jedoch nicht nur <strong>und</strong> nicht <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie Altenpfleger<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> –pfleger, sondern neben den<br />
dom<strong>in</strong>ierenden Krankenschwestern z.B. auch die sogenannten ‚Dorf- <strong>und</strong> Familienhelfer<strong>in</strong>nen‘ vertreten.<br />
Erst <strong>in</strong> den siebziger Jahren richtete sich die Aufmerksamkeit auf verschiedene z.T. neue Formen<br />
‚ambulanter‘ oder mobiler sozialer Dienste, die primär von der Wohlfahrtspflege, vere<strong>in</strong>zelt auch<br />
im Rahmen der kommunalen Sozialverwaltung angeboten wurden, z.B. als „Sozialstationen“ oder<br />
auch Altenbegegnungsstätten; d.h., hier werden verschiedene Dienstleistungen angeboten, worunter<br />
auch solche der Geme<strong>in</strong>dekrankenpflege <strong>und</strong> der Dorf- <strong>und</strong> Familienhilfe subsumiert s<strong>in</strong>d. Dazu liegen<br />
aus den achtziger Jahren lediglich für das Jahr 1984 Daten für Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen vor, die aus<br />
e<strong>in</strong>er Untersuchung des Deutschen Vere<strong>in</strong>s für öffentliche <strong>und</strong> private Fürsorge stammen (Höft-<br />
Dzemski 1987). Außerdem veröffentlichte das Landes<strong>in</strong>stitut für öffentlichen Ges<strong>und</strong>heitsdienst <strong>in</strong><br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (loegd), basierend auf Daten des Statistischen Landesamtes die Zahl der Geme<strong>in</strong>depflegestationen,<br />
e<strong>in</strong>schließlich der Hauspflege für das Jahr 1993-1996, wobei auch die Zahl der<br />
dort Beschäftigten (Krankenschwestern, Krankenpfleger, sonstige Pflegekräfte) erfasst wurde.<br />
Mit der E<strong>in</strong>führung der Pflegeversicherung 27 wurde sowohl der Begriff der Pflegebedürftigkeit als<br />
auch jener der Pflegee<strong>in</strong>richtung neu def<strong>in</strong>iert. So erfolgte zum 1.7.1996 e<strong>in</strong>e Neue<strong>in</strong>stufung der Bewohner<br />
von Alten- <strong>und</strong> Pflegeheimen sowie der Abschluss von Versorgungsverträgen. Dies führt e<strong>in</strong>erseits<br />
dazu, dass zahlreiche Bewohner von Altenheimen als nicht pflegebedürftig im S<strong>in</strong>ne des PflegeVG<br />
e<strong>in</strong>gestuft wurden. 28 Daraus folgte, dass E<strong>in</strong>richtungen, die ke<strong>in</strong>en Versorgungsvertrag haben<br />
<strong>und</strong> ältere Bürger ohne Pflegebedürftigkeit betreuen, <strong>in</strong> den folgenden Bestandsdaten nicht enthalten<br />
s<strong>in</strong>d. Andererseits führte die Neuorganisation <strong>in</strong>folge des PflegeVG auch dazu, dass zahlreiche Plätze<br />
<strong>in</strong> Alten- <strong>und</strong> Beh<strong>in</strong>dertenheimen sowie <strong>in</strong> Krankenhäusern <strong>in</strong> Pflegeplätze umgewandelt wurden.<br />
Deshalb ist e<strong>in</strong> Vergleich der Kapazitäten <strong>und</strong> der Beschäftigungslage <strong>in</strong> der Altenpflege vor <strong>und</strong> nach<br />
E<strong>in</strong>führung der Pflegeversicherung nur sehr e<strong>in</strong>geschränkt möglich.<br />
Als relativ aktuelle Quelle enthält die Studie des Wissenschaftlichen Institutes der Ortskrankenkassen<br />
(Gerste/Rehbe<strong>in</strong> 1998) annähernd flächendeckende <strong>und</strong> nach B<strong>und</strong>esländern gegliederte Daten, welche<br />
bereits die Situation nach E<strong>in</strong>führung der Pflegeversicherung abbilden. Leider liefert diese jedoch<br />
für Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen völlig lückenhafte Informationen. Zudem stammen die Daten zum Teil bereits<br />
aus dem Jahr 1996. Dann gibt es zwar e<strong>in</strong>e B<strong>und</strong>esstatistik zum Leistungsgeschehen der Gesetzlichen<br />
Pflegeversicherung <strong>in</strong>sgesamt, nicht jedoch für die e<strong>in</strong>zelnen B<strong>und</strong>esländer. Schließlich sollten<br />
nach dem PflegeVG seit 1996 jährlich vollständige Erhebungen zum Pflegebedarf sowie zur Pflegeversorgung<br />
(e<strong>in</strong>schließlich der dort Beschäftigten) durchgeführt werden (§ 109 SGB XI). Diese Re-<br />
27 Das „Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit (Pflege-Versicherungsgesetz –<br />
PflegeVG)“ vom 26. Mai 1994 (BGBl I, S. 1014, 2797), trat nach zwanzig-jähriger Diskussion am 1.1.1995<br />
als 5. Säule des Sozialversicherungssystems <strong>und</strong> als XI. Buch des Sozialgesetzbuches (SGB) stufenweise <strong>in</strong><br />
Kraft. Leistungen zur häuslichen Pflege s<strong>in</strong>d ab 1.4.1995 <strong>und</strong> die Leistungen zur stationären Pflege ab<br />
1.7.1996 zu beziehen.<br />
28 Darunter gab es zahlreiche Fälle, die zwar e<strong>in</strong>en Pflegebedarf aufwiesen, der jedoch unterhalb der Leistungsschwelle<br />
des Pflege-VG blieb, was als sogenannte Pflegestufe 0 bezeichnet wurde.<br />
- 55 -
Ambulante <strong>und</strong> stationäre Altenhilfe<br />
gelung wurde jedoch bis Mitte 1999 nicht vollzogen, deren Umsetzung wurde erst zum Stichtag<br />
15.12.1999 e<strong>in</strong>geleitet, so dass daraus noch ke<strong>in</strong>e Daten vorliegen.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der verzögerten Verwirklichung der b<strong>und</strong>esweiten Pflegestatistik machte das Land Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
im Rahmen se<strong>in</strong>er Zuständigkeit für die „Planung <strong>und</strong> Förderung“ der Pflege<strong>in</strong>frastruktur<br />
nach § 9 SGB XI 29 <strong>und</strong> des danach erlassenen Landespflegegesetzes von se<strong>in</strong>em Recht Gebrauch,<br />
eigene Erhebungen zu tätigen. Vom zuständigen Landesm<strong>in</strong>isterium wurden deshalb <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
differenzierte Vollerhebungen zur Pflege<strong>in</strong>frastruktur <strong>in</strong> die Wege geleitet. Diese<br />
Erhebungen wurden zuerst zum Stichtag 31.3.1997 <strong>und</strong> dann zum 15.12.1998 <strong>in</strong> den Kreisen <strong>und</strong><br />
kreisfreien Städten durch die jeweils zuständigen Sozialplaner<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> –planer durchgeführt. Darauf<br />
basierend wurden hier verwendete Auswertungen im Rahmen der Evaluation des Landespflegegesetzes<br />
angestellt, womit erstmals e<strong>in</strong> zuverlässiges <strong>und</strong> recht vollständiges Bild der Pflege<strong>in</strong>frastruktur<br />
vorliegt (vgl. Eifert/Krämer/Roth 1999). 30 Zwar liegen nicht aus allen 54 Kreisen <strong>und</strong> kreisfreien<br />
Städten vollständige Auswertungen vor, für den Stichtag 31. März 1997 waren dies 50, zum Stichtag<br />
15. Dezember 1998 waren es 47, so dass es erforderlich war, Hochrechnungen unter Berücksichtigung<br />
der Zahl der E<strong>in</strong>wohner vorzunehmen. 31<br />
2.4.2. Deskription<br />
Wegen der mangelhaften Datenlage können sowohl für Deutschland als auch Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im<br />
Folgenden lediglich Trendaussagen unter gewissen Vorbehalten getroffen werden. Während dem Mikrozensus<br />
von 1970 zufolge <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland <strong>in</strong>sgesamt nur ca. 8.000 Beschäftigte<br />
<strong>in</strong> der Altenpflege registriert worden waren, waren es im Jahr 1987 etwa 81.000, die Zahl hätte sich<br />
also verzehnfacht (vgl. Schölkopf 1998: 5). Auch Anfang bis Ende der neunziger Jahre ist laut Mikrozensus<br />
e<strong>in</strong> Wachstum der Beschäftigtenzahlen <strong>in</strong> der Altenpflege festzustellen. So wurden im Jahr<br />
1993 bereits 177.000 Beschäftigte registriert (Schölkopf 1998: 5), wobei jedoch nicht nach stationärer<br />
<strong>und</strong> ambulanter Altenpflege unterschieden wird. Allerd<strong>in</strong>gs darf vermutet werden, dass, <strong>in</strong>sbesondere<br />
1970, ke<strong>in</strong>e vollständige Erfassung vorlag, so dass das Wachstum tatsächlich wohl eher ger<strong>in</strong>ger war<br />
(s. Fußnote 25). Weiter können zuverlässigere Hochrechnungen auf der Basis der Berufs- <strong>und</strong> Arbeitsstättenzählung<br />
von 1987 herangezogen werden. Diese geht davon aus, dass 1987 <strong>in</strong>sgesamt 195.000<br />
29 Gesetz zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes (Landespflegegesetz Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen – PfG<br />
NW) vom 19. März 1996, Gesetz- <strong>und</strong> Verordnungsblatt für das Land Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (GV NW), 50.<br />
Jg., Nr. 16, S. 137. Bekanntmachung des Inkrafttretens vom 10. Juni 1996, GV NW S. 205.<br />
30 Die Daten wurden <strong>in</strong> den Kreisen <strong>und</strong> kreisfreien Städten erhoben sowie geprüft (vgl. ausführlich: Eifert/Krämer/Roth<br />
1999). Der Fragebogen der Erhebung von 1997 (vgl. Bergstermann et al. 1998, Anhang)<br />
wurde für 1998 nur ger<strong>in</strong>gfügig modifiziert <strong>und</strong> entspricht weitgehend dem der b<strong>und</strong>esweiten Pflegestatistik<br />
nach § 109 SGB XI, so dass auch künftig weitere Vergleiche möglich s<strong>in</strong>d.<br />
31<br />
In E<strong>in</strong>zelfällen war unter Umständen der Rücklauf <strong>in</strong> den Kreisen <strong>und</strong> kreisfreien Städten von Seiten der<br />
E<strong>in</strong>richtungen – vor allem im ambulanten Bereich – nicht vollständig. In wenigen Fällen mussten deshalb<br />
kaum plausibel ersche<strong>in</strong>ende ‚Ausreißer‘ ausgeschlossen werden. Jedoch konnten für den stationären Bereich<br />
die hier vorgenommenen Hochrechnungen aus den Bestandsdaten der Kreise <strong>und</strong> kreisfreien Städte zum<br />
31.3.1997 mit den Bestandsdaten der Landschaftsverbände vom Mai 1997 verglichen werden, die <strong>in</strong> der Regel<br />
nur bis ca. 2,5% höher lagen. Diese ger<strong>in</strong>ge Differenz ersche<strong>in</strong>t angesichts des etwas späteren Stichtages<br />
- 56 -
Ambulante <strong>und</strong> stationäre Altenhilfe<br />
Personen <strong>in</strong> Heimen der Altenhilfe <strong>in</strong> Deutschland (alte B<strong>und</strong>esländer) beschäftigt waren; werden<br />
Zivildienstleistende <strong>und</strong> andere Ehrenamtliche e<strong>in</strong>gerechnet, käme e<strong>in</strong>e Summe von ca. 205.000 <strong>in</strong> der<br />
stationären Altenhilfe „Tätigen“ zustande (vgl. Engels/Friedrich 1992: 4). Darauf basierende Hochrechnungen<br />
weisen die Zahl der <strong>in</strong> der Pflege Beschäftigten für 1988/89 mit 122.000 aus, was e<strong>in</strong>em<br />
Anteil von 57% der auf der Basis der Werte von 1987 errechneten Zahl der Gesamtbeschäftigten<br />
(216.000) zu diesem Zeitpunkt entspricht. Davon waren rd. 155.000 (72%) Voll- <strong>und</strong> 61.000 (28%)<br />
Teilzeitkräfte.<br />
Tab. 22 Kapazitäten <strong>und</strong> Beschäftigte der Wohlfahrtsverbände <strong>in</strong> der Altenhilfe <strong>in</strong><br />
Deutschland (1970-1996)<br />
Jahr Betten oder<br />
Plätze 1<br />
Veränderung<br />
geg. Vorjahr <strong>in</strong><br />
Prozent<br />
Verhältnis zum<br />
Ausgangswert <strong>in</strong><br />
%<br />
Beschäftigte<br />
ges.<br />
- 57 -<br />
Veränderung<br />
geg. Vorjahr <strong>in</strong><br />
Prozent<br />
Verhältnis zum<br />
Ausgangswert <strong>in</strong><br />
%<br />
Anteil Vollzeitkräfte<br />
<strong>in</strong><br />
%<br />
1970 185.021 100,00 44.900 100,00 78,73<br />
1973 208.546 12,71 112,71 55.370 23,32 123,32 72,40<br />
1975 231.257 10,89 124,99 62.970 13,73 140,24 70,23<br />
1977 241.270 4,33 130,40 71.457 13,48 159,15 70,62<br />
1981 266.133 10,31 143,84 82.822 15,90 184,46 70,41<br />
1984 290.614 9,20 157,07 94.834 14,50 211,21<br />
1987 303.751 4,52 164,17 118.942 25,42 264,90<br />
1990 335.201 10,35 181,17 130.274 9,53 290,14 69,24<br />
1993 2<br />
401.290 19,72 216,89 157.498 20,90 350,78 62,48<br />
1993 3<br />
1996 3<br />
441.094 100,00 174.051 100,00 64,68<br />
418.853 -5,04 94,96 205.756 18,22 118,22 60,89<br />
1 In Altenwohnungen, Altenwohnheimen, Altenheimen, Altenpflegeheimen <strong>und</strong> Altenkrankenheimen<br />
2 Zahlen für Westdeutschland<br />
3 Zahlen für Gesamtdeutschland<br />
Quelle: B<strong>und</strong>esarbeitsgeme<strong>in</strong>schaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V.<br />
E<strong>in</strong>e bessere E<strong>in</strong>schätzung der Wachstumsdynamik bietet die recht verlässliche Datenquelle der Wohlfahrtsverbände,<br />
die allerd<strong>in</strong>gs nicht für Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen vorliegt. 32 Wie die vorangegangene Tabelle<br />
zeigt, waren alle<strong>in</strong>e bei den Wohlfahrtsverbänden, die ca. 70% des gesamten Angebotes stellen<br />
dürften, 1970 schon 45.000 Beschäftigte <strong>in</strong>sgesamt <strong>in</strong> der stationären Altenhilfe. Wird angenommen,<br />
dass etwa die Hälfte im Pflegebereich tätig war, dann ersche<strong>in</strong>t die Unterschätzung durch den Mikrozensus<br />
sehr wahrsche<strong>in</strong>lich. Mit den Daten wird zudem bestätigt, dass die Zahl der Beschäftigten <strong>in</strong><br />
Altenheimen der Wohlfahrtsverbände – die zwischen 1970 <strong>und</strong> 1993 um das 3,5-fache gestiegen ist –<br />
deutlich schneller angewachsen ist als die Zahl der Plätze. Zwar g<strong>in</strong>g das Beschäftigungswachstum<br />
stärker auf das Konto der Teil- <strong>und</strong> weniger auf das der Vollzeitkräfte, was mit e<strong>in</strong>er Verm<strong>in</strong>derung<br />
des Anteils der Vollzeitkräfte von 78,7% im Jahr 1970 auf nur noch gut 60% im Jahr 1996 e<strong>in</strong>her<br />
g<strong>in</strong>g. Jedoch bleibt auch unter E<strong>in</strong>beziehung dieser Tatsache e<strong>in</strong> Beschäftigungswachstum, das deutlich<br />
über der Zunahme der Kapazitäten lag (vgl. Schölkopf 1998: 6): 33 Kamen im Jahr 1970 noch ca.<br />
4,6 Plätze auf e<strong>in</strong>e Vollzeitkraft, so waren dies im Jahr 1996 lediglich noch 2,5 Plätze.<br />
der Daten der Landschaftsverbände <strong>und</strong> der zu verzeichnenden Wachstumsdynamik plausibel <strong>und</strong> unterstützt<br />
damit die Reliabilität der hier verwendeten Daten.<br />
32<br />
E<strong>in</strong>e dah<strong>in</strong>gehende Anfrage sowohl bei der B<strong>und</strong>es- als auch Landesarbeitsgeme<strong>in</strong>schaft wurde negativ beschieden.<br />
33<br />
In Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen war das Wachstum der Zahl der Plätze <strong>in</strong> Altenheimen noch etwas stärker als im<br />
B<strong>und</strong>esdurchschnitt: hier verdreifachten sich die Gesamtkapazitäten zwischen 1961 <strong>und</strong> 1994. Die Zahl der
Ambulante <strong>und</strong> stationäre Altenhilfe<br />
In Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen wurden Daten zur Zahl der Beschäftigten <strong>in</strong> der Altenpflege zwar im Rahmen<br />
der Volkszählung von 1970 erhoben, jedoch auch hier zusammen mit der Gruppe der Sozialarbeiter<br />
ausgewertet. Nach der Arbeitsstättenzählung von 1987 waren <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen <strong>in</strong>sgesamt<br />
54.900 Personen <strong>in</strong> Altenheimen beschäftigt. Das Statistische Landesamt weist für 1988 rd. 52.000<br />
Beschäftigte (ohne Zivildienstleistende etc.) aus. Allerd<strong>in</strong>gs s<strong>in</strong>d hier Teilzeitkräfte auf Vollzeitstellen<br />
umgerechnet, so dass die Zahl der tätigen Personen im Jahre 1988 sogar etwa bei 60.000 gelegen haben<br />
dürfte (Engels/Friedrich 1996: 6). Die von Engels/Friedrich für das Jahr 1989 vorgenommene<br />
Hochrechnung (1996: 9 f., 28 f.) geht von <strong>in</strong>sgesamt 61.000 Beschäftigten <strong>in</strong> Altenheimen aus, wovon<br />
ca. 35.500 oder 58,1% im Pflegebereich tätig waren. Ferner waren knapp 37.000 Vollzeit- (oder 71%)<br />
<strong>und</strong> knapp 18.000 Teilzeitbeschäftigte (29%) zu verzeichnen.<br />
Die folgende Tab. 23 unterstreicht, dass auch nach der E<strong>in</strong>führung der Pflegeversicherung <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
e<strong>in</strong> Anstieg der Beschäftigtenzahl <strong>in</strong> Pflegeheimen zwischen dem 31.3.1997 <strong>und</strong> dem<br />
15.12.1998 von ca. 92 Tsd. auf über 107 Tsd. stattfand. Dieses Plus von ca. 15.000 Beschäftigten entspricht<br />
gegenüber dem Ausgangswert e<strong>in</strong>er Steigerung um ca. 16%, umgerechnet auf e<strong>in</strong> volles Kalenderjahr<br />
von über 10%. Noch stärker stieg sogar die Zahl der Pflegefachkräfte. Beide Wachstumsraten<br />
lagen deutlich über dem der Kapazitäten. Da sich außerdem die Quote an Vollbeschäftigten <strong>in</strong><br />
den Pflegeheimen kaum änderte, ist auch nach dieser Rechnung e<strong>in</strong> klarer Anstieg der Beschäftigung<br />
zu verzeichnen.<br />
Tab. 23 Beschäftigte <strong>in</strong> Pflegeheimen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (1997-1998)<br />
31.03.97 15.12.98 Veränderung Prozentuale Veränderung<br />
absolut Gesamt ∅ Pro Jahr<br />
Beschäftigte <strong>in</strong> Pflegeheimen 92.398 107.538 15.140 16,4 9,6<br />
Anteil Vollzeitbeschäftigter <strong>in</strong> % 47,53 47,71 0,18 0,4 0,22<br />
Geschätzte Zahl Vollzeitbeschäftigte <strong>in</strong><br />
Pflegeheimen<br />
43.914 51.304 7.390 16,8 9,9<br />
Pflegefachkräfte <strong>in</strong> Pflegeheimen 25.862 31.230 5.367 20,8 12,1<br />
1 Erfasst wurden Beschäftigte <strong>in</strong> Pflegee<strong>in</strong>richtungen (auch: teilstationär) mit Versorgungsvertrag nach SGB XI.<br />
Quelle: Eigene Berechnung nach Angaben der Kreise <strong>und</strong> kreisfreien Städte.<br />
Der Bereich der ambulanten sozialen Dienste – <strong>in</strong> dem die Altenpflege neben der Kranken- oder Familienpflege<br />
nur e<strong>in</strong>en Teil e<strong>in</strong>nimmt – fand erst <strong>in</strong> den siebziger Jahren e<strong>in</strong>e verstärkte politische<br />
Aufmerksamkeit. Die dem vorausgehende Krise <strong>und</strong> den Niedergang der ‚Geme<strong>in</strong>dekrankenpflege‘<br />
zeigt die folgende Tabelle.<br />
Pflegeplätze wuchs <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen zwischen 1971 <strong>und</strong> 1994 um mehr als das 5,5-fache. Dennoch<br />
kann gesagt werden, dass der Trend des Wachstums der Platzkapazitäten <strong>in</strong> Altenheimen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen im Großen <strong>und</strong> Ganzen dem im B<strong>und</strong>esgebiet entsprach.<br />
- 58 -
Ambulante <strong>und</strong> stationäre Altenhilfe<br />
Tab. 24 Beschäftigte <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>dekrankenpflege <strong>in</strong> Deutschland (altes B<strong>und</strong>esgebiet)<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (1961-1977)<br />
Deutschland (altes B<strong>und</strong>esgebiet) Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
Anzahl Veränderung geg.<br />
Vorjahr <strong>in</strong> %<br />
Verhältnis zum<br />
Ausgangswert <strong>in</strong><br />
%<br />
- 59 -<br />
Anzahl Veränderung geg.<br />
Vorjahr <strong>in</strong> %<br />
Verhältnis zum<br />
Ausgangswert <strong>in</strong><br />
%<br />
1961 12.303 100,00 2.474 100,00<br />
1962 12.618 2,56 102,56 2.456 -0,73 99,27<br />
1965 11.766 -6,75 95,64 2.414 -1,71 97,57<br />
1966 11.356 -3,48 92,30 2.389 -1,04 96,56<br />
1967 11.400 0,39 92,66 2.425 1,51 98,02<br />
1968 11.139 -2,29 90,54 2.449 0,99 98,99<br />
1969 10.642 -4,46 86,50 2.298 -6,17 92,89<br />
1970 10.169 -4,44 82,65 2.147 -6,57 86,78<br />
1971 9.803 -3,60 79,68 1.977 -7,92 79,91<br />
1972 9.560 -2,48 77,70 2.145 8,50 86,70<br />
1973 9.172 -4,06 74,55 1.876 -12,54 75,83<br />
1974 9.070 -1,11 73,72 1.891 0,80 76,43<br />
Quelle: Erstellung <strong>und</strong> Berechnung FfG nach: Schölkopf 1999a: 356<br />
E<strong>in</strong>e erste seriöse Schätzung der Kapazitäten ambulanter Pflegedienste im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es moderneren<br />
Verständnisses gab es im Rahmen e<strong>in</strong>er B<strong>und</strong>-Länder-Arbeitsgruppe, die für 1979/80 zu e<strong>in</strong>er Summe<br />
von 14.000 Vollzeitkräften gelangte. Berücksichtigt wurden Geme<strong>in</strong>dekrankenpflege- <strong>und</strong> Sozialstationen,<br />
ohne Leistungen der Haus- <strong>und</strong> Familienpflege, deren Volumen auf ca. 20% geschätzt wurde<br />
(Schölkopf 1998: 6 f.). Die Erhebung des Deutschen Vere<strong>in</strong>s für öffentliche <strong>und</strong> private Fürsorge<br />
durch Höft-Dzemski stellte für das Jahr 1985 knapp 36.400 Pflegekräfte <strong>in</strong> der ambulanten Alten-,<br />
Kranken-, Haus- <strong>und</strong> Familienpflege sowie Dorfhilfe fest, was umgerechnet ca. 22.000 Vollzeitkräfte<br />
bedeutete (Schölkopf 1998: 7). Friedrich/Engels (1996: 16 ff.) errechneten wiederum basierend auf<br />
verschiedenen Stichproben für das Jahr 1991 e<strong>in</strong>e Summe von ca. 43.000 Pflegekräften <strong>in</strong> Sozialstationen<br />
(mit Alten-, Kranken- <strong>und</strong> Familienpflege), darunter ca. 23.000 Fachkräfte <strong>und</strong> ca. 26.000<br />
Kräfte <strong>in</strong> Vollzeitäquivalenten. Daraus wird erneut nahegelegt, dass sich das Personal <strong>in</strong> ambulanten<br />
Pflegediensten <strong>in</strong> diesen zehn Jahren ungefähr verdoppelt haben müsste.<br />
Nach der wiederum recht zuverlässigen Gesamtstatistik der Wohlfahrtsverbände – diese stellten bis<br />
Ende der achtziger Jahre 80-90% aller Kapazitäten – war der ambulante Pflegebereich tatsächlich bis<br />
Ende der siebziger Jahre eher stagnierend bis rückläufig, seitdem jedoch (d.h. seit Beg<strong>in</strong>n der <strong>in</strong>tensiven<br />
Förderung von Sozialstationen) bis Anfang der neunziger Jahre durch e<strong>in</strong>e kräftige Expansion,<br />
sprich e<strong>in</strong>er ungefähren Verdoppelung der Kapazitäten, geprägt (Tab. 25). Allerd<strong>in</strong>gs wuchs die Zahl<br />
der Vollzeitkräfte nicht so stark wie die der Teilzeitkräfte, so dass der Anteil der Vollzeitbeschäftigten<br />
<strong>in</strong> dieser Zeit von über 60 auf ca. 50% sank. Außerdem fiel das Wachstum vergleichsweise ger<strong>in</strong>ger<br />
aus als im Bereich der Heimpflege, so dass die aufgezeigte Expansion der ambulanten Pflegedienste<br />
nur zu e<strong>in</strong>er leichten Erhöhung der Versorgungsniveaus bezogen auf die Altenbevölkerung führte. Gab<br />
es im Jahr 1970 noch ca. 0,82 Beschäftigte pro 100 über 75-Jährigen, so waren es im Jahr 1993 0,95;<br />
zwischenzeitlich sank diese Quote sogar <strong>in</strong>folge der wachsenden Anzahl von Senioren <strong>und</strong> der stagnierenden<br />
Kapazität ambulanter Pflegedienste, so dass sich erst seit Anfang der achtziger <strong>und</strong> <strong>in</strong>sbesondere<br />
seit Anfang der neunziger Jahre die Versorgungslage hier wieder deutlich verbesserte (vgl.<br />
Schölkopf 1998: 8).
Ambulante <strong>und</strong> stationäre Altenhilfe<br />
Tab. 25 Kapazitäten ambulanter Pflegedienste der Wohlfahrtsverbände <strong>in</strong> Deutschland<br />
(1970-1996)<br />
Jahr E<strong>in</strong>richtungen<br />
gesamt<br />
Veränderung geg.<br />
Vorjahr <strong>in</strong> %<br />
Verhältnis<br />
zum Ausgangswert<br />
<strong>in</strong> %<br />
Beschäftigtegesamt<br />
- 60 -<br />
Veränderung geg.<br />
Vorjahr <strong>in</strong> %<br />
Verhältnis<br />
zum Ausgangswert<br />
<strong>in</strong> %<br />
Vollzeitbeschäftigte<br />
Anteil<br />
Vollzeitkräfte<br />
1970 10.275 100,00 21.145 12.925 61,13<br />
1973 9.362 -8,89 91,11 20.026 -5,29 94,71 11.845 59,15<br />
1975 8.953 -4,37 87,13 19.136 -4,44 90,50 11.369 59,41<br />
1977 8.293 -7,37 80,71 22.151 15,76 104,76 11.465 51,76<br />
1981 5.499 -33,69 53,52 23.655 6,79 111,87 12.691 53,65<br />
1984 5.183 -5,75 50,44 28.324 19,74 133,95 14.705 51,92<br />
1987 5.380 3,80 52,36 30.525 7,77 144,36<br />
1990 5.788 7,58 56,33 34.268 12,26 162,06 19.942 58,19<br />
1993 a<br />
5.356 -7,46 52,13 41.593 21,38 196,70 21.278 51,16<br />
6.250 100,00 49.808 100,00 26.879 53,97<br />
1996 6.812 8,99 108,99 65.300 31,10 131,10 29.900 45,79<br />
Enthalten s<strong>in</strong>d Dienste der Geme<strong>in</strong>dekrankenpflege, Haus- <strong>und</strong> Familienpflege, Sozialstationen, Dorfhilfe <strong>und</strong> Mobile soziale Dienste.<br />
a Zahlen für Westdeutschland<br />
b Zahlen für Gesamtdeutschland<br />
Quelle: Berechnungen FfG nach Gesamtstatistik der BAG der Freien Wohlfahrtspflege.<br />
1993 b<br />
Während die Statistik der Geme<strong>in</strong>dekrankenpflege im Jahr 1975 für Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen nur noch<br />
1.675 Beschäftigte ausweist (Schölkopf 1999a: 356), wurden im Jahr 1982 zum<strong>in</strong>dest 2.240 Fachkräfte<br />
<strong>in</strong> der ambulanten Pflege vom Land gefördert, 1985 waren es 2.750, 1991 3.500 sowie 1994:<br />
5.570 (Schölkopf 1999a: 361). Damit wird, da den Förderrichtl<strong>in</strong>ien vergleichbare Kriterien zu Gr<strong>und</strong>e<br />
liegen, e<strong>in</strong> klarer Anstieg (gute Verdopplung <strong>in</strong> zehn Jahren) der Zahl der Pflegekräfte <strong>in</strong> ambulanten<br />
Diensten seit Beg<strong>in</strong>n der achtziger Jahre <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen nahegelegt. Nach Untersuchungen<br />
des Sozialm<strong>in</strong>isteriums (1984) <strong>und</strong> des Statistischen Landesamtes <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (1987)<br />
gab es 1984 <strong>in</strong>sgesamt 12.143 Beschäftigte <strong>in</strong> ambulanten Pflegediensten, wobei 7.476 <strong>in</strong> Sozialstationen,<br />
664 <strong>in</strong> Geme<strong>in</strong>de-, Kranken- <strong>und</strong> Altenpflegediensten, 1.480 <strong>in</strong> Haus- <strong>und</strong> Familienpflegestationen,<br />
1.440 <strong>in</strong> mobilen sozialen Hilfsdiensten <strong>und</strong> 1.083 <strong>in</strong> sonstigen sozialen Diensten arbeiteten<br />
(Bäcker et al. 1989: 281). Drei Jahre später waren bereits 17.153 Beschäftigte <strong>in</strong> diesem Bereich zu<br />
verzeichnen, wovon 11.487 <strong>in</strong> Sozialstationen, 1.130 <strong>in</strong> Geme<strong>in</strong>de-, Kranken- <strong>und</strong> Altenpflegediensten,<br />
1.052 <strong>in</strong> Haus- <strong>und</strong> Familienpflegestationen, 2.322 <strong>in</strong> mobilen sozialen Hilfsdiensten <strong>und</strong> 1.162<br />
<strong>in</strong> sonstigen sozialen Diensten tätig waren. Das heißt, dass <strong>in</strong> der Summe für die <strong>in</strong> ambulanten Pflegediensten<br />
Beschäftigten e<strong>in</strong>e Zunahme gegenüber dem Ausgangswert <strong>in</strong> Höhe von 41% konstatiert<br />
werden kann. Bei e<strong>in</strong>er Unterscheidung nach Berufsgruppen zeigt sich jedoch, dass im Jahr 1987 lediglich<br />
5% ausgebildete Altenpfleger<strong>in</strong>nen, 39% Helfer<strong>in</strong>nen der Altenpflege, Haus- <strong>und</strong> Familiensowie<br />
Dorfpflege <strong>und</strong> 24% Krankenschwestern oder –pfleger zu f<strong>in</strong>den waren (Bäcker et al. 1989:<br />
281).<br />
Die Zunahme der Beschäftigung <strong>in</strong> ambulanten Pflegediensten, so unterstreichen die folgenden Tab.<br />
26 <strong>und</strong> Tab. 27, beschleunigte sich <strong>in</strong> den neunziger Jahren, wobei die Tatsache, dass Leistungen für<br />
ambulante Pflege im Rahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung seit Ende der achtziger Jahre <strong>und</strong><br />
solche des PflegeVG seit dem 1.4.1995 gewährt wurden, ganz offensichtlich e<strong>in</strong>en kräftigen Schub der<br />
Entwicklung bewirkt hat (vgl. MAGS NW 1995). So stieg zwischen 1993 <strong>und</strong> 1996 die Zahl der Beschäftigten<br />
<strong>in</strong> „Geme<strong>in</strong>depflegestationen“ mit deutlich zweistelligen jährlichen Wachstumsraten
Ambulante <strong>und</strong> stationäre Altenhilfe<br />
sprunghaft an, <strong>und</strong> zwar von 12.234 auf 17.329, d.h., <strong>in</strong>sgesamt wuchs die Zahl der hier Beschäftigten<br />
<strong>in</strong> nur drei Jahren fast mit dem Faktor 1,5. Bezogen auf Berufsgruppen waren an diesem Wachstum<br />
die Krankenschwestern <strong>und</strong> Krankenpfleger <strong>in</strong> nur ger<strong>in</strong>gem Umfang <strong>und</strong> die „sonstigen Pflegekräfte“,<br />
wozu die Altenpfleger<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> –pfleger zählen, besonders stark beteiligt.<br />
Tab. 26 Geme<strong>in</strong>depflegestationen e<strong>in</strong>schließlich E<strong>in</strong>richtungen der Hauskrankenpflege <strong>in</strong><br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (1993-1996)<br />
Jahr Stationen<br />
gesamt<br />
VeränderunggegenüberVorjahr<br />
<strong>in</strong> %<br />
Veränderung<br />
gegenüber<br />
Ausgangswert<br />
<strong>in</strong> %<br />
Geme<strong>in</strong>depflegestationen<br />
Veränderunggegenüber<br />
Vorjahr <strong>in</strong><br />
%<br />
- 61 -<br />
VeränderunggegenüberAusgangswert<br />
<strong>in</strong> %<br />
Andere<br />
E<strong>in</strong>richtungen<br />
der<br />
Hauskrankenpflege<br />
Veränderunggegenüber<br />
Vorjahr <strong>in</strong><br />
%<br />
VeränderunggegenüberAusgangswert<br />
<strong>in</strong> %<br />
1993 1.204 100,00 135 100,00 969 100,00<br />
1994 1.408 16,94 116,98 113 -16,30 83,70 1.228 26,73 126,73<br />
1995 1.442 2,41 119,77 79 -30,09 58,52 1.346 9,61 138,91<br />
1996 1.490 3,33 123,75 92 16,46 68,15 1.362 1,19 140,56<br />
Quelle: Berechnungen FfG nach Landesamt für Datenverarbeitung <strong>und</strong> Statistik, Jahresges<strong>und</strong>heitsbericht, Landes<strong>in</strong>stitut<br />
für öffentlichen Ges<strong>und</strong>heitsdienst (http://www.loegd.nrw.de/Loegd/) (Indikator 6.18z)<br />
Tab. 27 Beschäftigte <strong>in</strong> Geme<strong>in</strong>depflegestationen e<strong>in</strong>schließlich E<strong>in</strong>richtungen der Hauskrankenpflege<br />
<strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (1993-1996)<br />
Jahr Beschäftigte<br />
<strong>in</strong><br />
Geme<strong>in</strong>depflegestationen<br />
gesamt<br />
Veränderunggegenüber<br />
Vorjahr <strong>in</strong><br />
%<br />
VeränderunggegenüberAusgangswert<br />
<strong>in</strong> %<br />
Krankenschwestern<br />
<strong>und</strong> -<br />
pfleger<br />
gesamt<br />
Veränderunggegenüber<br />
Vorjahr <strong>in</strong><br />
%<br />
VeränderunggegenüberAusgangswert<br />
<strong>in</strong> %<br />
Sonstige<br />
Pflegekräfte<br />
gesamt<br />
Veränderunggegenüber<br />
Vorjahr <strong>in</strong><br />
%<br />
VeränderunggegenüberAusgangswert<br />
<strong>in</strong> %<br />
1993 12.234 100,00 6.476 100,00 5.658 100,00<br />
1994 14.255 16,52 116,52 7.399 14,25 114,25 6.727 18,89 118,89<br />
1995 15.367 7,80 125,61 7.784 5,20 120,20 7.443 10,64 131,55<br />
1996 17.329 12,77 141,65 8.315 6,82 128,40 8.857 19,00 156,54<br />
Quelle: Berechnungen FfG nach Landesamt für Datenverarbeitung <strong>und</strong> Statistik, Jahresges<strong>und</strong>heitsbericht, Landes<strong>in</strong>stitut<br />
für öffentlichen Ges<strong>und</strong>heitsdienst (http://www.loegd.nrw.de/Loegd/) (Indikator 6.18z)<br />
Auch bei den ambulanten Pflegediensten ist e<strong>in</strong> direkter Vergleich über den Zeitpunkt der E<strong>in</strong>führung<br />
des PflegeVG nicht möglich. Ohne Zweifel wurde jedoch durch das PflegeVG e<strong>in</strong> Boom <strong>in</strong> diesem<br />
Bereich ausgelöst (vgl. MAGS NW 1995), der nach den vorliegenden Daten auch <strong>in</strong> den Jahren 1997<br />
bis 1998 anhielt: So arbeiteten im März 1997 schätzungsweise gut 37 Tsd. <strong>und</strong> im Dezember 1998<br />
knapp 43 Tsd. Beschäftigte <strong>in</strong> ambulanten Pflegediensten mit Leistungen nach SGB XI (s. Tab. 28).<br />
D.h., dass <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen zwischen 1997 <strong>und</strong> 1998 umgerechnet e<strong>in</strong>e Steigerung des Beschäftigungsvolumens<br />
nach SGB XI um knapp 8% pro Jahr realisiert wurde. Bei der Auswertung der<br />
Daten gab es zwei Kreise, deren Werte z.T. zweifelhaft waren, 34 so dass der gegen ‚Ausreißer‘ robuste<br />
Median, der bei e<strong>in</strong>em Zuwachs der Zahl der Beschäftigten <strong>in</strong> ambulanten Pflegediensten nach SGB<br />
XI von 13,4% lag, zuverlässiger als das arithmetische Mittel ersche<strong>in</strong>t. E<strong>in</strong> Zuwachs von gut 7% ist<br />
auch bei den Pflegefachkräften zu verbuchen. Zu den Pflegefachkräften zählen die dreijährigen Ausbildungen<br />
<strong>in</strong> der Altenpflege, Kranken- <strong>und</strong> K<strong>in</strong>derkrankenpflege. Zur besseren E<strong>in</strong>schätzung der<br />
34 So weist die Stadt Krefeld im Untersuchungszeitraum e<strong>in</strong> Plus von über 82% <strong>und</strong> die Stadt Hagen e<strong>in</strong> Plus<br />
von über 63% aus, was auf e<strong>in</strong>e mögliche mangelnde Erfassung im Jahr 1997 verweist; deshalb blieben diese<br />
Werte bei der Hochrechnung unberücksichtigt.
Ambulante <strong>und</strong> stationäre Altenhilfe<br />
Kopfzahlen ist an dieser Stelle der Anteil der Vollzeitbeschäftigten zu berücksichtigen. Dieser Anteil<br />
lag im Durchschnitt 1997 bei 35,9% <strong>und</strong> 1998 bei lediglich 32,2%, was e<strong>in</strong>er Abnahme von 3,7 Prozentpunkten<br />
entspricht. Wird jeweils die Quote der Vollzeitbeschäftigten auf die Summe der Gesamtbeschäftigten<br />
umgelegt, so bleibt jedoch auch unter dem Strich e<strong>in</strong> Wachstum der Beschäftigung <strong>in</strong><br />
der ambulanten Pflege (nach SGB XI) von 4,5% zwischen den Stichtagen 1997 <strong>und</strong> 1998.<br />
Tab. 28 Beschäftigte <strong>in</strong> ambulanten Pflegediensten nach SGB XI <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
(1997-1998)<br />
31.03.97 15.12.98 Differenz<br />
- 62 -<br />
Differenz <strong>in</strong> % des<br />
Ausgangswertes<br />
Gesamt ∅ Pro Jahr<br />
Beschäftigte gesamt 36.783 42.836 6.053 16,46 9,63<br />
Anteil Vollzeitkräfte <strong>in</strong> % 35,85 32,17 -3,68 -10,25 -6,00<br />
Pflegefachkräfte gesamt 18.407 20.689 2.282 12,40 7,26<br />
Pflegebedürftige pro Beschäftigten 2,02 2,15 0,13 6,33 3,71<br />
Pflegebedürftige pro Fachkraft 3,92 4,38 0,46 11,73 6,87<br />
Beschäftigte je 1.000 E<strong>in</strong>wohner 2,04 2,38 0,34 16,87 9,87<br />
Beschäftigte je 1.000 Ew. über 65 Jahre 12,66 14,41 1,75 13,79 8,07<br />
Erfasst wurden Beschäftigte ambulanter Pflegedienste mit Versorgungsvertrag <strong>und</strong> Leistungen nach SGB XI.<br />
Quelle: Berechnung FfG nach Angaben der Kreise <strong>und</strong> kreisfreien Städte.<br />
Abschließend f<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> der unten folgenden Tabelle die Zahl der <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen <strong>in</strong>sgesamt<br />
beschäftigten „Altenpfleger“ nach Hochrechnungen aus der Berufsstatistik des Mikrozensus für<br />
den Zeitraum von 1993-1999 (s. Tab. 29). Diese Angaben enthalten nicht nur Erwerbstätige <strong>in</strong> Pflegeheimen,<br />
sondern auch solche <strong>in</strong> ambulanten Pflegediensten, zudem werden mit der Kategorie „Altenpfleger“<br />
Beschäftigte im Arbeitsbereich Altenpflege auf der Basis von Selbstangaben der Befragten<br />
erfasst, unabhängig von der Art der Ausbildung (s. Kap. 2.4.1, Fußnote 25). Trotz dieser Problematik<br />
lassen sich die aufgezeigten Wachstumstendenzen mit den vorliegenden Daten untermauern. Danach<br />
hat sich die Zahl der „Altenpfleger<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> –pfleger“ laut Mikrozensus von 47.200 im Jahr 1993 auf<br />
70.600 im Jahr 1999 erhöht, d.h. sie ist <strong>in</strong> nur sechs Jahren mit dem Faktor 1,5 gestiegen. Die größten<br />
Sprünge fanden von 1995 auf 1996 <strong>und</strong> von 1997 auf 1998 statt, als die Wachstumsraten klar zweistellig<br />
waren. Beide Sprünge dürften e<strong>in</strong>deutig im ursächlichen Zusammenhang mit den beiden Stufen<br />
des Inkrafttretens der Gewährung von Leistungen nach dem PflegeVG (ambulant zum 1.4.1995; stationär<br />
zum 1.7.1996) stehen.<br />
Ferner bestätigt die folgende Tabelle, dass fast ausschließlich Frauen <strong>in</strong> der Altenpflege beschäftigt<br />
waren. Ihr Anteil war zwar leicht rückläufig, jedoch lag dieser auch im Jahr 1999 noch bei knapp 87%.<br />
Schließlich war die Entwicklung des Anteils der Voll- oder annähernd Vollzeitbeschäftigten um den<br />
Wert von zwei Drittel schwankend, ebenso wie der Anteil der Beschäftigten ohne Ausbildung, der<br />
zwischen 18 <strong>und</strong> 20% variierte.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs liegt die Summe aller Erwerbstätigen <strong>in</strong> der Altenpflege <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen aktuell<br />
sicherlich weit höher (s. Kap. 2.4.1, Fußnote 25). Nach den aufgezeigten – recht zuverlässigen – Zahlen<br />
der Bestandserhebungen der Kreise <strong>und</strong> kreisfreien Städte waren alle<strong>in</strong>e <strong>in</strong> Pflegeheimen nach<br />
SGB XI im Jahr 1998 fast 100.000 Beschäftigte. Davon waren ca. drei Viertel unmittelbar <strong>in</strong> der Pflege<br />
beschäftigt <strong>und</strong> es gab alle<strong>in</strong>e über 30.000 Fachkräfte; h<strong>in</strong>zu kommen noch e<strong>in</strong>mal über 40 Tausend<br />
Pflegekräfte <strong>in</strong> ambulanten Pflegediensten, die Leistungen nach SGB XI erbrachten.
Ambulante <strong>und</strong> stationäre Altenhilfe<br />
Tab. 29 Beschäftigte „Altenpfleger<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> –pfleger“ 1 <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (1993-1999)<br />
laut Mikrozensus<br />
Jahr Beschäftigte<br />
gesamt<br />
Veränderung gegenüber<br />
Vorjahr <strong>in</strong><br />
%<br />
Verhältnis<br />
zum Ausgangswert<br />
<strong>in</strong><br />
%<br />
Frauenanteil an<br />
Beschäftigten<br />
gesamt <strong>in</strong> %<br />
- 63 -<br />
Anteil ohne Berufsausbildung<br />
an<br />
Beschäftigten<br />
gesamt <strong>in</strong> %<br />
1993 47.200 100,0 90,3 17,8 2<br />
Anteil Beschäftigte<br />
mit 35 Std. pro Woche<br />
<strong>und</strong> mehr an Gesamt<br />
<strong>in</strong> %<br />
66,3<br />
1994 3<br />
1995 50.100 6,1 106,1 87,4 17,0 2<br />
63,1<br />
1996 58.000 15,8 122,9 89,7 20,2 65,9<br />
1997 59.900 3,3 126,9 85,3 20,2 68,6<br />
1998 67.100 12,0 142,2 87,2 19,7 61,1<br />
1999 70.600 5,2 149,6 86,8 18,7 65,0<br />
1 Die Berufssystematik, die dem Mikrozensus zu Gr<strong>und</strong>e liegt, umfasst unter dem Begriff “Altenpfleger<strong>in</strong> <strong>und</strong> Altenpfleger” Selbstangaben<br />
von Personen, die im Bereich der Altenpflege beschäftigt s<strong>in</strong>d, unabhängig von der Art der Ausbildung (vgl. Fußnote 25).<br />
2 Diese Werte s<strong>in</strong>d aufgr<strong>und</strong> e<strong>in</strong>es Standardfehlers von über 10% nur e<strong>in</strong>geschränkt aussagefähig.<br />
3 Angaben für 1994 waren nicht verfügbar.<br />
Quelle: Berechnungen FfG nach LDS (Mikrozensus)<br />
2.4.3. Zwischenfazit<br />
Trotz der e<strong>in</strong>gangs geschilderten Datenproblematik kann konstatiert werden, dass <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen seit den fünfziger Jahren e<strong>in</strong> enormes Personalwachstum <strong>in</strong> der Altenhilfe realisiert wurde.<br />
So hat sich die Zahl der Beschäftigten alle<strong>in</strong>e zwischen 1987 <strong>und</strong> 1998, d.h. <strong>in</strong> gut zehn Jahren, ungefähr<br />
verdoppelt: Die Zahl der Beschäftigten <strong>in</strong> Altenheimen <strong>und</strong> Altenpflegeheimen wuchs von 50-<br />
60.000 auf m<strong>in</strong>destens ca. 110.000 Beschäftigte <strong>in</strong> Pflegeheimen <strong>und</strong> von ca. 17.000 auf ca. 43.000<br />
Beschäftigte <strong>in</strong> ambulanten Pflegediensten an. Da <strong>in</strong> der Erhebung von 1998 lediglich die E<strong>in</strong>richtungen<br />
mit Versorgungsvertrag nach SGB XI erfasst wurden, könnte diesen Zahlen eher e<strong>in</strong>e Unter- als<br />
e<strong>in</strong>e Überschätzung des Beschäftigungswachstums zu Gr<strong>und</strong>e liegen.<br />
Trotz der e<strong>in</strong>geschränkten Datenlage kann h<strong>in</strong>sichtlich der Beschäftigung von Frauen <strong>in</strong> der Altenpflege<br />
immerh<strong>in</strong> so viel gesagt werden, dass hier <strong>in</strong>sgesamt weit überwiegend Frauen arbeiten, obwohl<br />
der Frauenanteil unter den Beschäftigten <strong>in</strong> den neunziger Jahren von ca. 90% im Jahr 1993 auf 87%<br />
im Jahr 1999 etwas zurück g<strong>in</strong>g. Ke<strong>in</strong>e Aussagen können allerd<strong>in</strong>gs nach den vorliegenden Daten zur<br />
Beschäftigungslage von Ausländern <strong>in</strong> diesem Bereich <strong>und</strong> für beide Teilpopulationen <strong>in</strong> Bezug auf<br />
die jeweiligen Teilbereiche getroffen werden.<br />
Im Großen <strong>und</strong> Ganzen verlief die aufgezeigte enorme Expansion der Kapazitäten <strong>und</strong> Beschäftigung<br />
<strong>in</strong> der Altenhilfe relativ analog zum Wirtschaftswachstum <strong>und</strong> zur Zunahme der Altenbevölkerung.<br />
Insgesamt war das Wachstum der Kapazitäten <strong>in</strong> der Altenhilfe sogar noch stärker als jenes der Bevölkerung<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong>sbesondere das der Altenbevölkerung, d.h., die Versorgungsquoten (Plätze pro E<strong>in</strong>wohner<br />
im Alter von 65 <strong>und</strong> älter) wuchsen zwischen 1961 <strong>und</strong> 1994, bezogen auf die Plätze <strong>in</strong> Altenheimen<br />
von 3,1 (1961) auf 5,1 (1994) <strong>und</strong> <strong>in</strong>sbesondere im Pflegebereich, deutlich an (vgl. Schölkopf<br />
1999a). Ebenso zeigt der vergleichende Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung, d.h., das Wachstum<br />
des Brutto<strong>in</strong>landsproduktes (BIP) (s. Anhang, Tab. A 15), dass der Ausbau der Kapazitäten <strong>in</strong> der<br />
Altenpflege von den sechziger Jahren bis heute <strong>in</strong>sgesamt relativ analog zur wirtschaftlichen Entwicklung<br />
verlief. Zwar gab es Zeiten, <strong>in</strong> denen das wirtschaftliche Wachstum schneller verlief als der
Ambulante <strong>und</strong> stationäre Altenhilfe<br />
Ausbau der Kapazitäten <strong>in</strong> der Altenhilfe – so <strong>in</strong>sbesondere Mitte bis Ende der siebziger <strong>und</strong> Mitte bis<br />
Ende der achtziger Jahre –, jedoch gab es auch Phasen, <strong>in</strong> denen die Expansion <strong>in</strong> der Altenhilfe rasanter<br />
vonstatten g<strong>in</strong>g als jene des BIP – so Anfang bis Mitte der achtziger Jahre. Im vergleichbaren<br />
Zeitraum von 1966-1994 stieg das BIP um das 2,04-fache, die Kapazitäten <strong>in</strong> der Altenpflege um das<br />
1,99-fache.<br />
Sowohl die Beschäftigung als auch die Versorgungsquoten wuchsen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen etwas<br />
dynamischer als im B<strong>und</strong>esgebiet. Allerd<strong>in</strong>gs muss berücksichtigt werden, dass hier die Versorgungsniveaus<br />
<strong>in</strong> den sechziger Jahren unter dem Durchschnitt lagen, so dass Nachholeffekte zum Tragen<br />
kamen (vgl. Eifert/Krämer/Roth 2000). Das Wachstum der Kapazitäten der Pflegeheime verlief auch<br />
nach der E<strong>in</strong>führung der Pflegeversicherung schneller als jenes der Bevölkerung <strong>in</strong>sgesamt 35 <strong>und</strong> der<br />
Altenbevölkerung. Während im Jahr 1997 lediglich für 4,4% der 65-Jährigen <strong>und</strong> älteren e<strong>in</strong> Pflegeplatz<br />
<strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen zur Verfügung stand, lag der Wert im Jahr 1998 bereits bei 4,7% <strong>und</strong><br />
damit – trotz der e<strong>in</strong>geschränkten Vergleichbarkeit – deutlich über dem Wert von 2,6 des Jahres 1994.<br />
Übrigens nimmt Deutschland – trotz der Zurechnung zum ‚konservativen Wohlfahrtsstaatstypus‘ – im<br />
<strong>in</strong>ternationalen Vergleich – wie so oft – e<strong>in</strong>e mittlere Position bei den Versorgungsniveaus der stationären<br />
Altenhilfe e<strong>in</strong> (vgl. Alber/Schölkopf 1999; Schölkopf 1999b), wobei die Niederlande an der<br />
Spitze der OECD-Länder liegen. 36 Deutlich im h<strong>in</strong>teren Feld liegt Deutschland Anfang der 90er Jahre<br />
zwar noch beim Verhältnis von Beschäftigten zu Pflegebedürftigen, 37 während es bei den – allerd<strong>in</strong>gs<br />
nur e<strong>in</strong>geschränkt vergleichbaren – Versorgungsniveaus mit ambulanten Pflegediensten mit ca. 3<br />
professionell versorgten Pflegebedürftigen pro 100 Menschen im Alter von 65 <strong>und</strong> älter wiederum im<br />
h<strong>in</strong>teren Mittelfeld (Rang 11 von 19) rangiert. Auch hier weist Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen noch e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>geres<br />
Versorgungsniveau auf als der B<strong>und</strong>esdurchschnitt. 38 Da allerd<strong>in</strong>gs vom PflegeVG e<strong>in</strong> kräftiger<br />
Impuls für das Wachstum von Nachfrage <strong>und</strong> Angebot gerade des ambulanten, aber auch des stationären<br />
Pflegeangebotes <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e entsprechende erhebliche Ausweitung der Beschäftigung ausgegangen<br />
35 Zu beiden Stichtagen lag diese Versorgungsquote etwas unterhalb des B<strong>und</strong>esdurchschnitts von 8,5 Plätzen<br />
je 1.000 E<strong>in</strong>wohner (vgl. Gerste/Rehbe<strong>in</strong> 1998: 15). Diese Versorgungsquote schwankt zwischen 6,2 Plätzen<br />
<strong>in</strong> Thür<strong>in</strong>gen <strong>und</strong> 11,7 Plätzen <strong>in</strong> Schleswig-Holste<strong>in</strong> (Gerste/Rehbe<strong>in</strong> ebenda).<br />
36 Während die Niederlande, Dänemark <strong>und</strong> das Vere<strong>in</strong>igte Königreich im Jahr 1990 Spitzenwerte von 10-12<br />
aufweisen, liegen Kanada, F<strong>in</strong>nland, Neuseeland, Belgien, Norwegen, Japan <strong>und</strong> Australien im vorderen<br />
Mittelfeld mit 6 bis 7 Plätzen pro 100 65-Jährigen <strong>und</strong> älteren; Deutschland führt mit 5,4 die zweite ‚mittlere‘<br />
Gruppe an, zu der auch noch Schweden, USA, Frankreich, Irland <strong>und</strong> Österreich (4,6) gerechnet werden<br />
können, während Italien, Spanien <strong>und</strong> Portugal als ‚Schlusslichter‘ nur Werte von ca. 2 aufweisen (vgl.<br />
Schölkopf 1999b: 254).<br />
37 Während hier z.B. <strong>in</strong> den Niederlanden <strong>und</strong> Dänemark Anfang der 90er Jahre auf e<strong>in</strong> Pflegebett e<strong>in</strong>e Pflegekraft<br />
kam, war das Verhältnis <strong>in</strong> Deutschland – ähnlich wie <strong>in</strong> Italien, Frankreich <strong>und</strong> Portugal – etwa e<strong>in</strong>s zu<br />
drei.<br />
38 Auch die Versorgungsdichte mit ambulanten Pflegediensten verbesserte sich <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen zwischen<br />
1997 <strong>und</strong> 1998, das heißt, dass der Beschäftigungszuwachs stärker war, als jener der Bevölkerung (s.<br />
Anhang, Tab. A 19). Die relative Verbesserung der Versorgungslage <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen ist ebenfalls zu<br />
konstatieren, wenn die Beschäftigtenzahl auf je 1.000 E<strong>in</strong>wohner über 65 Jahre bezogen wird. Der Wert pro<br />
E<strong>in</strong>wohner <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen von 1998 liegt mit 0,2 E<strong>in</strong>heiten etwas über dem B<strong>und</strong>esdurchschnitt<br />
(vgl. Gerste/Rehbe<strong>in</strong> 1998: 24). Allerd<strong>in</strong>gs muss berücksichtigt werden, dass im B<strong>und</strong>esdurchschnitt e<strong>in</strong>e<br />
deutlich höhere Quote an Vollzeitpersonal (43,8%) vorlag (Gerste/Rehbe<strong>in</strong> 1998: 25). Bei Berücksichtigung<br />
des durchschnittlichen Anteils an Vollbeschäftigten <strong>in</strong> ambulanten Diensten <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen ergibt<br />
sich nur noch e<strong>in</strong>e Versorgungsdichte von 0,75 pro 1.000 E<strong>in</strong>wohner, die noch deutlich unter der des B<strong>und</strong>esdurchschnitts<br />
von 1,4 liegt.<br />
- 64 -
Ambulante <strong>und</strong> stationäre Altenhilfe<br />
ist, dürfte sich die deutsche Position <strong>und</strong> auch die von Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im <strong>in</strong>ternationalen Vergleich<br />
<strong>in</strong>zwischen deutlich verbessert haben – e<strong>in</strong>e Entwicklung, die sich auch <strong>in</strong> den nächsten Jahren<br />
aufgr<strong>und</strong> des Impulses der Pflegeversicherung weiter fortsetzen sollte.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich kann für die enorme Expansion der Beschäftigung <strong>in</strong> der Altenhilfe <strong>in</strong> Deutschland mit<br />
e<strong>in</strong>er hohen Plausibilität aufgezeigt werden, dass – neben den ‚notwendigen‘ ökonomischen <strong>und</strong> sozialen<br />
Bed<strong>in</strong>gungen – <strong>in</strong>sbesondere die Rolle staatlicher Institutionen sowie die der Parteipolitik e<strong>in</strong>e<br />
ganz entscheidende war (vgl. Schölkopf 1999a: 334 ff.). Die Ursachen für die Expansion s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>erseits<br />
<strong>in</strong> Aktivitäten der Länderverwaltungen zu suchen. Bereits <strong>in</strong> den 50er Jahren haben nach <strong>und</strong><br />
nach alle B<strong>und</strong>esländer mehr oder weniger anspruchsvolle politische Planungen im Bereich der Altenhilfe<br />
<strong>in</strong> die Wege geleitet <strong>und</strong> erhebliche Subventionen für den Ausbau der Infrastruktur für alte <strong>und</strong><br />
pflegebedürftige Menschen bereitgestellt, ohne dass soziale <strong>und</strong> politische Bewegungen, öffentlicher<br />
Druck oder explizite gesetzliche Verpflichtungen (wie dies <strong>in</strong> der GKV mit dem Bedarfspr<strong>in</strong>zip der<br />
Fall ist) vorhanden waren. Ferner muss das Engagement von Kommunalverwaltungen sowie von<br />
Fachverbänden, wie dem Deutschen Städtetag <strong>und</strong> dem Deutschen Vere<strong>in</strong> für öffentliche <strong>und</strong> private<br />
Fürsorge genannt werden. Zudem nahmen die Wohlfahrtsverbände als dom<strong>in</strong>ierende Anbieter mittelbar<br />
auch die Interessen von Betroffenen wahr.<br />
Wegweisend war <strong>und</strong> ist <strong>in</strong> diesem Feld oft e<strong>in</strong> ‚Netzwerk‘ von ‚Fachleuten‘, Fachverwaltungen <strong>und</strong><br />
Fachpolitikern (vgl. Roth 1999a), <strong>in</strong> dem es dank <strong>in</strong>formeller Prozesse im Nachh<strong>in</strong>e<strong>in</strong> oft schwer festzustellen<br />
ist, von wem der Impuls für politische Programme aus welchen Gründen kam. Dazu trägt<br />
entscheidend bei, dass schlagkräftige Interessenorganisationen der Betroffenen ebenso fehlen wie Gewerkschaften<br />
oder Berufsverbände, die – im Gegensatz zum <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> im engeren S<strong>in</strong>ne –<br />
nur vergleichsweise schwach vertreten s<strong>in</strong>d. Dass das Feld der Altenpflege von staatlichen Institutionen,<br />
Wohlfahrts- <strong>und</strong> Fachverbänden geprägt wurde, liegt im weiteren S<strong>in</strong>ne auch an der spezifischen<br />
Institutionalisierung des deutschen Sozialstaats, <strong>in</strong> dem die sozialen Dienste <strong>in</strong> der politischen Aufmerksamkeit<br />
eher e<strong>in</strong> unauffälliges Dase<strong>in</strong> führten, weil e<strong>in</strong>erseits die Subsidiarität staatlicher Leistungen<br />
<strong>und</strong> der Vorrang der Familie betont wurde, <strong>und</strong> andererseits, weil das System der korporatistischen<br />
adm<strong>in</strong>istrativen Interessenvermittlung soziale <strong>und</strong> politische Probleme oft antizipierte, was für<br />
die deutsche Sozialpolitik von generell großer Bedeutung ist.<br />
Schließlich gibt es <strong>in</strong> diesem Sektor zum<strong>in</strong>dest für e<strong>in</strong>ige Phasen auch e<strong>in</strong>e Plausibilität für die Parteiendifferenzhypothese<br />
<strong>und</strong> den E<strong>in</strong>fluss politischer Parteien; danach waren <strong>in</strong>sbesondere Vertreter der<br />
Sozialdemokraten beim Ausbau der Pflege<strong>in</strong>frastruktur <strong>und</strong> der Altenheime nach dem 2. Weltkrieg<br />
<strong>und</strong> Christdemokraten beim Ausbau des Angebotes ambulanter Pflegedienste ab Mitte der siebziger<br />
Jahre Vorreiter. Hier darf nicht vernachlässigt werden, dass der Anteil der älteren Menschen zwischen<br />
den fünfziger <strong>und</strong> neunziger Jahren zwischen knapp 25 <strong>und</strong> 30% der gesamten Wählerschaft ausmachte<br />
(Schölkopf 1999b: 270).<br />
In der Nachkriegszeit begann Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen zwar als erstes B<strong>und</strong>esland bereits 1953 e<strong>in</strong>e f<strong>in</strong>anzielle<br />
Förderung der Altenhilfe (also noch nicht unter der erst 1956-1958 <strong>und</strong> seit 1967 regierenden<br />
SPD); die konkrete Planung startete jedoch erst im Jahr 1975 <strong>in</strong> Form des ersten Landesaltenplans,<br />
nachdem 1958 wiederum erste ‚Vorüberlegungen‘ begonnen hatten (MAGS NW 1972, 1975; Schölkopf<br />
1999a: 185). Gleichwohl traten <strong>in</strong> dieser Zeit überwiegend die sozialdemokratisch regierten Länder<br />
früher <strong>und</strong> <strong>in</strong>tensiver <strong>in</strong> die Planung <strong>und</strong> Förderung der stationären Altenhilfe e<strong>in</strong> <strong>und</strong> auch <strong>in</strong><br />
- 65 -
Ambulante <strong>und</strong> stationäre Altenhilfe<br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen war erst seit Ende der sechziger Jahre e<strong>in</strong>e massive Ausweitung der staatlichen<br />
Förderung zu erkennen. Wie stark die parteipolitische Dissonanz im ansonsten eher durch e<strong>in</strong>e ‚große<br />
Koalition‘ <strong>und</strong> den ‚mittleren Weg‘ geprägten deutschen Sozialpolitik jedoch im E<strong>in</strong>zelnen war (vgl.<br />
Schmidt 1997; ders. 1999b), muss hier dah<strong>in</strong>gestellt bleiben. War der Impuls gegeben, machten sich<br />
die Fachverwaltungen mehr oder weniger eifrig an den Ausbau der politischen Programme <strong>und</strong> Planungen,<br />
wobei e<strong>in</strong> Faktor der Wettbewerb zwischen den B<strong>und</strong>esländern war. In der Folge der sechziger<br />
<strong>und</strong> siebziger Jahre bestimmte, so Schölkopf (ebenda), überwiegend die Variable des E<strong>in</strong>flusses<br />
der M<strong>in</strong>isterialbürokratie, weniger wiederum e<strong>in</strong> direkter E<strong>in</strong>fluss der Wohlfahrtsverbände den recht<br />
starken Ausbau politischer Planungen <strong>und</strong> Programme <strong>in</strong> der Altenpolitik. 39<br />
In den siebziger <strong>und</strong> achtziger Jahren wurde allgeme<strong>in</strong> <strong>in</strong> Deutschland – nach F<strong>in</strong>anzrestriktionen,<br />
e<strong>in</strong>zelnen Feststellungen von ‚Bedarfsdeckung‘ sowie kurzen Förderstops – e<strong>in</strong>erseits e<strong>in</strong>e Neuorientierung<br />
zugunsten von Pflegeplätzen <strong>und</strong> andererseits zugunsten des ambulanten Bereichs (Förderung<br />
von Sozialstationen) e<strong>in</strong>geleitet, was hauptsächlich durch die Fachverwaltungen bee<strong>in</strong>flusst wurde<br />
(Schölkopf 1999a: 196). Sowohl für die Förderstopps wie auch für die H<strong>in</strong>wendung der politischen<br />
Aufmerksamkeit zum ambulanten Bereich waren jedoch auch <strong>in</strong>stitutionelle Aspekte von ausschlaggebender<br />
Bedeutung. Denn der Anstieg der Sozialhilfekosten, der wiederum zu e<strong>in</strong>em großen Teil auf<br />
den Anstieg bei den Ausgaben für Hilfe zur Pflege <strong>in</strong> E<strong>in</strong>richtungen zurückzuführen war, belastete<br />
<strong>in</strong>sbesondere die Haushalte der Länder, die selbst Sozialhilfeträger waren, schwer. 40 Ansonsten verblieb<br />
diese Belastung überwiegend bei den Kommunen <strong>und</strong> tangierte die Länder lediglich mittelbar<br />
(vgl. Pr<strong>in</strong>z 1983; Klanberg/Pr<strong>in</strong>z 1983; Schoch 1994). Deshalb entschieden sich alle Länder, welche<br />
die Sozialhilfekosten direkt aus ihrem Haushalt bestreiten mussten (z.B. Hamburg), Ende der siebziger,<br />
Anfang der achtziger Jahre für e<strong>in</strong>en Förderstopp (vgl. Schölkopf 1999a: 238 f.).<br />
Primär <strong>in</strong>folge des Kostenanstieges <strong>in</strong> der Heimpflege erfolgte <strong>in</strong> den siebziger Jahren also e<strong>in</strong>e Neuorientierung<br />
<strong>und</strong> Reform der traditionellen, <strong>in</strong> der Personalbesetzung rückläufigen <strong>und</strong> bis zu diesem<br />
Zeitpunkt kaum staatlich direkt geförderten, „Geme<strong>in</strong>dekrankenpflege“. Deren E<strong>in</strong>richtungen sollten<br />
<strong>in</strong> „Sozialstationen“ oder „Sozialzentren“ umgewandelt werden <strong>und</strong> neben der Kranken- <strong>und</strong> Altenpflege<br />
auch andere soziale Aufgaben wahrnehmen. Hier kam die Initiative eher von der parteipolitischen<br />
als von der adm<strong>in</strong>istrativen Seite <strong>und</strong> eher von der CDU als von der SPD, wobei <strong>in</strong>sbesondere<br />
Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz, das se<strong>in</strong>e f<strong>in</strong>anzielle Förderung 1970 begann, Vorreiter war (vgl. Schölkopf 1999a:<br />
270 ff.). Neben dem, dass der Slogan ‚ambulant‘ vor ‚stationär‘ eben f<strong>in</strong>anzielle E<strong>in</strong>sparungen versprach,<br />
wirkte auch die <strong>in</strong> Fachkreisen allgeme<strong>in</strong> zunehmende Kritik an Erziehungs- <strong>und</strong> Versorgungs<strong>in</strong>stitutionen<br />
im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>, wobei wiederum der Prestigegew<strong>in</strong>n ‚mobiler‘ <strong>und</strong> flexibler<br />
39 Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen lag zu Beg<strong>in</strong>n der siebziger Jahre noch deutlich unter dem B<strong>und</strong>esdurchschnitt der<br />
F<strong>in</strong>anzförderung der Altenhilfe. Übrigens lag das von der SPD regierte Hessen mit weitem Vorsprung an der<br />
Spitze, wobei wiederum die konservativ regierten Länder Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz, Bayern <strong>und</strong> das Saarland noch<br />
vor anderen von der SPD regierten Ländern folgten.<br />
40 Die Ausgaben für Hilfe zur Pflege (der Löwenanteil entfällt auf Hilfe <strong>in</strong> E<strong>in</strong>richtungen) haben sich zwischen<br />
1970 <strong>und</strong> 1994 ca. verzehnfacht (auch unter Berücksichtigung der Inflation (vgl. Pr<strong>in</strong>z 1995, S. 43 f.; Neuhäuser<br />
1996)). Als Ursache für diese Entwicklung ist zwar auch der Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen<br />
oder Hilfeempfänger verantwortlich; etwa doppelt so stark legten jedoch die durchschnittlichen ‚Preise‘ für<br />
Pflegeleistungen <strong>in</strong> E<strong>in</strong>richtungen zu, was sich grob am Anstieg der Kosten pro Hilfeempfänger im genannten<br />
Zeitraum ablesen lässt (Pr<strong>in</strong>z 1995, S. 43 f.). Letzteres ist <strong>in</strong>sbesondere auf das Personalwachstum <strong>und</strong><br />
bauliche Verbesserungen zurückzuführen.<br />
- 66 -
Ambulante <strong>und</strong> stationäre Altenhilfe<br />
sozialer Dienste auch mit dem der erzieherischen Profession <strong>und</strong> deren Differenzierung zu tun hat<br />
(vgl. Roth 1999a).<br />
In der Folge verlief die Förderpolitik <strong>in</strong> der stationären Altenhilfe <strong>in</strong> den achtziger Jahren allerd<strong>in</strong>gs<br />
une<strong>in</strong>heitlich <strong>und</strong> nicht der Parteiendifferenz entsprechend: Während e<strong>in</strong>ige Länder ihre Förderung<br />
ganz oder vorübergehend e<strong>in</strong>stellten oder zum<strong>in</strong>dest drastisch verm<strong>in</strong>derten (Berl<strong>in</strong>, Bremen, Hamburg,<br />
Niedersachsen, Saarland, Schleswig-Holste<strong>in</strong>), hielten anderen Länder ihre Förderung relativ<br />
unverändert aufrecht (Hessen <strong>und</strong> Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz) <strong>und</strong> wieder andere weiteten diese sogar stark aus<br />
(Bayern, Baden-Württemberg), weil sie nach wie vor e<strong>in</strong>en starken Bedarf <strong>in</strong>sbesondere im Bereich<br />
der Pflege sahen. Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen teilte zwar die E<strong>in</strong>schätzung des unverändert bestehenden Bedarfs,<br />
es verm<strong>in</strong>derte zwischen 1980 <strong>und</strong> 1989 dennoch se<strong>in</strong> jährliches Fördervolumen um mehr als<br />
die Hälfte.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs erfolgte <strong>in</strong> den neunziger Jahren wieder e<strong>in</strong>e neuerliche Steigerung der öffentlichen Förderung<br />
der Altenhilfe (vgl. Schölkopf 1999a: 337). Auch <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen wurde seit den neunziger<br />
Jahren mit dem 2. Landesaltenplan (MAGS 1991) e<strong>in</strong>e stärkere Förderung von Pflegeplätzen angestrebt<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>e erhebliche Ausweitung der Fördermittel für Pflegee<strong>in</strong>richtungen vollzogen, wobei<br />
sich – wie auch <strong>in</strong> den meisten anderen Ländern – das Engagement des zuständigen Fachm<strong>in</strong>isteriums<br />
bemerkbar machte. 41<br />
Neben der Landespolitik förderten auch Reformen im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> auf der B<strong>und</strong>esebene den<br />
Ausbau des Pflegeangebotes <strong>und</strong> das Wachstum der Beschäftigung <strong>in</strong> der Altenpflege. So sah das<br />
Ges<strong>und</strong>heitsreformgesetz, das am 20.12.1988 verabschiedet wurde, erstmals im Rahmen der Krankenversicherung<br />
begrenzte Leistungen <strong>in</strong> der häuslichen Pflege bei Schwerpflegebedürftigkeit vor (vgl.<br />
Rothgang 1997: 17). Dah<strong>in</strong>gehende Leistungen wurden 1991 stark ausgeweitet (vgl. Rothgang 1997:<br />
165 ff.).<br />
Entscheidende Impulse für den Ausbau der Pflege<strong>in</strong>frastruktur – <strong>und</strong> der Beschäftigung – g<strong>in</strong>gen<br />
schließlich seit 1995 vom Pflege-VG aus. Die vom Deutschen Vere<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>sam mit den Kommunen<br />
<strong>und</strong> Wohlfahrtsverbänden seit den siebziger Jahren immer lauter vorgetragenen Forderungen e<strong>in</strong>er<br />
gesetzlichen Pflegeversicherung wurden endlich im Jahr 1994 weitgehend realisiert. Entscheidend für<br />
den – wenn auch erst nach langer Diskussion <strong>und</strong> <strong>in</strong> etwas abgeänderter Form zustande gekommenen<br />
– Erfolg dieser Forderung war, dass es diesen Akteuren gelungen ist, die f<strong>in</strong>anzpolitischen Organisations<strong>in</strong>teressen<br />
mit sozialpolitischen <strong>und</strong> fachlichen Argumenten zu verb<strong>in</strong>den (vgl. Haug/Rothgang<br />
1996), die allgeme<strong>in</strong>e Geltungskraft <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e objektive Rationalität beanspruchen <strong>und</strong> an bewährte<br />
sozialpolitische Strukturen <strong>und</strong> Leitideen anschließen konnten (vgl. Gött<strong>in</strong>g/H<strong>in</strong>richs 1993: 69; Roth<br />
1999b).<br />
Mit der E<strong>in</strong>führung der Pflegeversicherung wurde e<strong>in</strong>e Beschleunigung des Ausbaus der Pflege<strong>in</strong>frastruktur<br />
<strong>und</strong> der dort stattf<strong>in</strong>denden Beschäftigung erreicht. Dies ist vor allem auf das enorm ausgeweitete<br />
F<strong>in</strong>anzvolumen zurückzuführen, das <strong>in</strong> diesem Sektor von öffentlicher Seite heute zur Verfügung<br />
steht <strong>und</strong> welches gegenüber dem von Anfang der neunziger Jahre, das weit überwiegend durch<br />
41 Bezogen auf die Zahl der 65-Jährigen <strong>und</strong> älteren lag Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen nun an der Spitze der Förderung<br />
der Altenhilfe der westlichen B<strong>und</strong>esländer. Dah<strong>in</strong>ter folgten Baden-Württemberg <strong>und</strong> Bayern sowie Hessen,<br />
die alle relativ viel <strong>in</strong> diesen Bereich <strong>in</strong>vestierten.<br />
- 67 -
Ambulante <strong>und</strong> stationäre Altenhilfe<br />
die Sozialhilfe bereitgestellt wurde, <strong>in</strong> Höhe von ca. 15,57 Mrd. DM ungefähr verdoppelt wurde (vgl.<br />
Rothgang 1997; Roth 1998). Alle<strong>in</strong>e die gesetzliche Pflegeversicherung wendete 1998 ca. 31 Mrd.<br />
DM auf (vgl. B<strong>und</strong>esarbeitsblatt 10/99: 105). Daneben wurden durch die Art der Regulierung, so z.B.<br />
durch die Anreize zur Stärkung des Wettbewerbs, verschiedene Regime der Kostenbegrenzung 42 sowie<br />
durch die Reform des Subsidiaritätsbegriffs, unterschiedliche Wirkungen auf die Beschäftigung erzielt.<br />
Gesichert ist, dass der ambulante Bereich <strong>und</strong> die häusliche Pflege e<strong>in</strong>e klare Stärkung <strong>und</strong><br />
Ausweitung erfahren haben <strong>und</strong> der oft befürchtete ‚Heimsog‘ bisher ausblieb. Bei den ambulanten<br />
Pflegediensten fand e<strong>in</strong>e geradezu explosive Zunahme statt, womit auch e<strong>in</strong>e kräftige Zunahme der<br />
Beschäftigung e<strong>in</strong>herg<strong>in</strong>g.<br />
Auch nach dem Erlass des PflegeVG spielen die B<strong>und</strong>esländer <strong>und</strong> ihre Förderpolitik e<strong>in</strong>e rechtlich<br />
erstmals festgelegte Rolle <strong>in</strong> der Altenpflege: So erklärt der – aufgr<strong>und</strong> des politischen Drucks der<br />
Länder – aufgenommene § 9 SGB XI diese „verantwortlich für die Vorhaltung e<strong>in</strong>er leistungsfähigen,<br />
zahlenmäßig ausreichenden <strong>und</strong> wirtschaftlichen pflegerischen Versorgungsstruktur“. Und: „Das Nähere<br />
zur Planung <strong>und</strong> Förderung der Pflegee<strong>in</strong>richtungen ist durch Landesrecht zu bestimmen.“ Unter<br />
den daraufh<strong>in</strong> ergangenen Länderregelungen, die zum Teil sehr unterschiedliche Akzente setzen, kann<br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen als Vertreter e<strong>in</strong>er qualitativ anspruchsvollen Steuerung gelten (Eifert/Rothgang<br />
1998; Eifert/Krämer/Roth/Rothgang 1999; Eifert/Krämer/Roth 1999).<br />
Zusammenfassend ist für den Sektor der Altenpflege davon auszugehen, dass die genannten Faktoren<br />
(Bevölkerung, Wirtschaftswachstum, Frauenerwerbstätigkeit, Institutionenpolitik) im Wechselspiel auf<br />
das aufgezeigte Wachstum der Beschäftigung <strong>und</strong> der Pflege<strong>in</strong>frastruktur <strong>in</strong> der Altenpflege e<strong>in</strong>wirkten,<br />
wobei <strong>in</strong>sbesondere der Institutionenpolitik e<strong>in</strong>e Schlüsselposition zukam. Welchem Faktor im<br />
E<strong>in</strong>zelnen welches Gewicht zukam, müssten jedoch weitergehende differenzierte Untersuchungen<br />
zeigen.<br />
42 Diese konnten jedoch nur zum Teil ihre Wirksamkeit entfalten (dazu: Roth/Rothgang 1999a <strong>und</strong> b).<br />
- 68 -
Sonstige Beschäftigungsbereiche im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
2.5. Sonstige Beschäftigungsbereiche im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
Unter die sonstigen Beschäftigungsbereiche im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> fallen zum e<strong>in</strong>en die Arbeitsbereiche<br />
Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Arbeitsschutz. Hier s<strong>in</strong>d auf der kommunalen Ebene vor allen D<strong>in</strong>gen die unteren<br />
Ges<strong>und</strong>heitsbehörden, auf der Landesebene E<strong>in</strong>richtungen im Bereich des Wasserschutzes, der<br />
Lebensmittelkontrolle, der Lebensmittelüberwachung, der Kommunalhygiene <strong>und</strong> Umweltmediz<strong>in</strong>,<br />
der Gewerbeaufsicht, das Landesges<strong>und</strong>heitsm<strong>in</strong>isterium <strong>und</strong> das Landes<strong>in</strong>stitut für den öffentlichen<br />
Ges<strong>und</strong>heitsdienst sowie E<strong>in</strong>richtungen des B<strong>und</strong>es mit Sitz <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen, d.h. die B<strong>und</strong>esanstalt<br />
für Arbeitsschutz <strong>und</strong> –mediz<strong>in</strong>, das B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Ges<strong>und</strong>heit, die B<strong>und</strong>eszentrale für<br />
ges<strong>und</strong>heitliche Aufklärung <strong>und</strong> das Deutsche Institut für mediz<strong>in</strong>ische Dokumentation <strong>und</strong> Information,<br />
zu nennen.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus fallen unter die sonstigen Bereiche des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s auch das Krankentransport-<br />
<strong>und</strong> Rettungswesen sowie die verschiedenen E<strong>in</strong>richtungen der Ges<strong>und</strong>heitsverwaltung, d.h. die<br />
E<strong>in</strong>richtungen der Kranken- <strong>und</strong> Sozialversicherung <strong>und</strong> die Organisationen der Leistungserbr<strong>in</strong>ger.<br />
Zudem wird das Lehrpersonal <strong>in</strong> den unterschiedlichen Ausbildungsstätten für Berufe des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s<br />
<strong>in</strong> die Betrachtung mit aufgenommen. Angesichts der z.T. ger<strong>in</strong>gen Beschäftigtenzahlen<br />
sowie der häufig nicht vorhandenen Zeitreihen zur Beschäftigungsentwicklung auf der Landesebene<br />
erfolgt für die meisten Arbeitsbereiche nur e<strong>in</strong>e Bestandsaufnahme der Beschäftigten für das Basisjahr<br />
1998.<br />
2.5.1. Untere Ges<strong>und</strong>heitsbehörden<br />
Aufgaben mediz<strong>in</strong>ischer Überwachung, Prävention, Information sowie Dokumentation des Ges<strong>und</strong>heitszustands<br />
wie der ges<strong>und</strong>heitlichen Versorgung der Bevölkerung fallen <strong>in</strong> den Aufgabenbereich<br />
der unteren Ges<strong>und</strong>heitsbehörden. Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen verfügt auf der Ebene der Kreise <strong>und</strong> kreisfreien<br />
Städte über 54 Ges<strong>und</strong>heitsämter. 1996 waren dort <strong>in</strong>sgesamt 4.160 Personen beschäftigt. 43<br />
Gegenüber den 60er Jahren haben sich die Beschäftigtenzahlen <strong>in</strong> den Ges<strong>und</strong>heitsämtern damit um<br />
etwas über 10 % von 4.633 auf 4.160 Beschäftigte verr<strong>in</strong>gert.<br />
43<br />
Im Zuge des 1997 verabschiedeten Gesetzes über den öffentlichen Ges<strong>und</strong>heitsdienst entfiel die gesetzliche<br />
Verpflichtung des Landesamtes für Datenverarbeitung <strong>und</strong> Statistik zur zentralen Datenhaltung der Statistik<br />
Berufe des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s, so dass für das Jahr 1996 letztmals Daten aus dieser Statistik auf der Landesebene<br />
vorliegen.<br />
- 69 -
Sonstige Beschäftigungsbereiche im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
Abb. 19 Beschäftigte <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsämtern (ohne Verwaltungspersonal) 1985 – 1996 (1985 =<br />
100)<br />
130%<br />
120%<br />
110%<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996<br />
(Zahn-)Ärzte/-<strong>in</strong>nen Sozialarbeiter/-<strong>in</strong>nen (Zahn)Arzthelfer<strong>in</strong>nen<br />
sonstiges Personal <strong>in</strong>sgesamt<br />
Quelle: LDS, Statistik Berufe des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s, Darstellung FfG<br />
Verwaltungs- <strong>und</strong> Büropersonal bilden 1996 mit 27 % (1.135 Personen) die größte Beschäftigtengruppe<br />
<strong>in</strong> den Ges<strong>und</strong>heitsämtern, gefolgt von (Zahn)Ärzt/<strong>in</strong>nen, die etwas über e<strong>in</strong> Fünftel der Beschäftigten<br />
stellen (866 Personen). Weitere große Berufsgruppen s<strong>in</strong>d die (Zahn)Arzthelfer<strong>in</strong>nen mit 16,9 %<br />
(702 Personen) <strong>und</strong> die Sozialarbeiter/<strong>in</strong>nen mit 14,1 % (586 Personen) (s. Anhang, Tab. A 14).<br />
E<strong>in</strong> Blick auf die Beschäftigungsentwicklung der nicht dem Verwaltungspersonal zugehörigen Berufsgruppen<br />
seit Mitte der 80er Jahre zeigt, dass sich nach e<strong>in</strong>em zwischenzeitlichen Ausbau der Personalkapazitäten<br />
im öffentlichen Ges<strong>und</strong>heitsdienst, die Beschäftigtenzahlen 1996 wieder dem Ausgangsniveau<br />
annähern.<br />
Dabei g<strong>in</strong>g der Beschäftigungsabbau vor allem auf Kosten des sonstigen Fachpersonals <strong>in</strong> den Ges<strong>und</strong>heitsämtern,<br />
wie z.B. den sozialmediz<strong>in</strong>ischen Assistent/<strong>in</strong>nen, den Ges<strong>und</strong>heitsaufseher/<strong>in</strong>nen<br />
sowie dem mediz<strong>in</strong>isch-technischen Personal. Aber auch bei den Sozialarbeiter/<strong>in</strong>nen erfolgte e<strong>in</strong>e<br />
Personalreduktion. Ärzt/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> (Zahn)Arzthelfer/<strong>in</strong>nen konnten demgegenüber den Ausbaustand<br />
von Anfang der 90er Jahre weitestgehend halten.<br />
2.5.2. Sonstige E<strong>in</strong>richtungen im öffentlichen Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Arbeitsschutz sowie der<br />
öffentlichen Ges<strong>und</strong>heitsverwaltung<br />
Öffentliches Personal ist nicht nur <strong>in</strong> den kommunalen Ges<strong>und</strong>heitsämtern tätig, sondern auch <strong>in</strong> den<br />
oberen Ges<strong>und</strong>heitsbehörden, im Arbeitsschutz, z.B. den staatlichen Gewerbeaufsichtsämtern, <strong>in</strong> B<strong>und</strong>ese<strong>in</strong>richtungen<br />
zur Prävention <strong>und</strong> –<strong>in</strong>formation, hier ist für Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen auf die B<strong>und</strong>eszentrale<br />
für ges<strong>und</strong>heitliche Aufklärung h<strong>in</strong>zuweisen, oder auch auf kommunaler Ebene <strong>in</strong> Ambulato-<br />
- 70 -
Sonstige Beschäftigungsbereiche im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
rien <strong>und</strong> ärztlichen Beratungsstellen. Außerdem ist im Zusammenhang mit den Aufgaben des Ges<strong>und</strong>heitsschutzes<br />
das Personal des Mediz<strong>in</strong>ischen Dienstes der Krankenkassen zu nennen.<br />
Die Personalstandsstatistik des öffentlichen Dienstes liefert bezüglich der auf B<strong>und</strong>es-, Länder- <strong>und</strong><br />
kommunaler Ebene öffentlich Beschäftigten im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> jährliche Informationen bezüglich<br />
des Beschäftigungsstandes. Demnach s<strong>in</strong>d 1998 landesweit etwas über 9.000 Personen <strong>in</strong> den oben<br />
genannten Bereichen tätig. Hierunter s<strong>in</strong>d knapp 1.100 Personen <strong>in</strong> E<strong>in</strong>richtungen des B<strong>und</strong>es beschäftigt.<br />
Zwar verbleibt das Ges<strong>und</strong>heitsm<strong>in</strong>isterium bis auf weiteres <strong>in</strong> Bonn. Da jedoch im Zuge des<br />
Regierungsumzuges auch e<strong>in</strong>e Dependance <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> eröffnet wurde, ist von e<strong>in</strong>er Reduktion der Beschäftigtenzahlen<br />
im Verlauf des Jahres 1999 auszugehen. Auf der Landesebene weist die Personalstandsstatistik<br />
1.520 Beschäftigte aus, von denen alle<strong>in</strong> 86 % im Arbeitsschutz tätig s<strong>in</strong>d. Auf der<br />
kommunalen Ebene s<strong>in</strong>d der Statistik folgend 6.400 Personen im Ges<strong>und</strong>heitsschutz angestellt, darunter<br />
mit 3.660 Personen über die Hälfte <strong>in</strong> den Ges<strong>und</strong>heitsämtern. Auf sonstige Maßnahmen des<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s wie Ambulatorien, ärztliche Beratungsstellen, aber auch Geme<strong>in</strong>depflegestationen<br />
entfallen mit knapp 2.300 Personen 35,8 % der kommunal im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Beschäftigten. Doppelzählungen<br />
zur Bestandsaufnahme der pflegerischen Infrastruktur <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen lassen<br />
sich <strong>in</strong>sbesondere für die Geme<strong>in</strong>depflegestationen allerd<strong>in</strong>gs nicht ausschließen.<br />
Tab. 30 Personal des B<strong>und</strong>es, des Landes <strong>und</strong> der Kommunen <strong>in</strong> ausgewählten Bereichen<br />
des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s, 1998<br />
Funktion / Aufgabenbereich<br />
Bezeichnung<br />
Personal des B<strong>und</strong>es <strong>in</strong> NRW<br />
Beschäftigte<br />
1104 Arbeitsschutz 351<br />
1501 obere Verwaltung 524<br />
1504 Ges<strong>und</strong>heitliche Aufklärung 125<br />
1505 Information <strong>und</strong> Dokumentation<br />
Personal des Landes NRW<br />
94<br />
211 Versicherungsbehörden 65<br />
254 Arbeitsschutz 1<br />
1.245<br />
311 Ges<strong>und</strong>heitsbehörden -<br />
314 Maßnahmen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s 2<br />
Personal der Geme<strong>in</strong>den / GV<br />
210<br />
408 Versicherungsamt 452<br />
50 Ges<strong>und</strong>heitsämter 3.660<br />
54 Sonstige E<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong> Maßnahmen der Ges<strong>und</strong>heitspflege 3<br />
2.291<br />
Insgesamt 9.035<br />
1 Gewerbeaufsichtsämter, Landes<strong>in</strong>stitute für Arbeitsschutz<br />
2 Hygiene<strong>in</strong>stitute, E<strong>in</strong>richtungen der Arzneimittel- <strong>und</strong> Lebensmittelkontrolle, mediz<strong>in</strong>ische Untersuchungsämter<br />
3 Ambulatorien, ärztliche Beratungsstellen, Geme<strong>in</strong>depflegestationen<br />
Quelle: LDS, Statistisches B<strong>und</strong>esamt, Personalstandsstatistik, Berechnungen FfG<br />
Ohne das bereits gesondert ausgewiesene Personal der Ges<strong>und</strong>heitsämter ist somit für den öffentlichen<br />
Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Arbeitsschutz für 1998 von ca. 5.375 Beschäftigten auszugehen.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus muss an dieser Stelle der Mediz<strong>in</strong>ische Dienst der Krankenkassen Berücksichtigung<br />
f<strong>in</strong>den. Im Mediz<strong>in</strong>ischen Dienst der Krankenkassen sowie der Geschäftsstelle des Mediz<strong>in</strong>ischen<br />
Dienstes der Spitzenverbände NRW waren 1998 <strong>in</strong>sgesamt 1.521 Personen beschäftigt, darunter ca.<br />
440 Ärzt/<strong>in</strong>nen, wobei <strong>in</strong> den letzten Jahren steigende Beschäftigtenzahlen zu konstatieren s<strong>in</strong>d. Nach<br />
- 71 -
Sonstige Beschäftigungsbereiche im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
Aussagen der zuständigen Sachbearbeiter ist auch <strong>in</strong> Zukunft mit e<strong>in</strong>er Ausweitung der Personalkapazitäten<br />
des MDK zu rechnen.<br />
2.5.3. Krankentransporte <strong>und</strong> Rettungsdienste<br />
Für den Bereich der Krankentransporte <strong>und</strong> Rettungsdienste konzentrierte sich die Recherche der Beschäftigtenzahlen<br />
auf die großen Anbieter - die Feuerwehr sowie die vier großen freigeme<strong>in</strong>nützigen<br />
Organisationen – das deutsche Rote Kreuz, den Malteser Hilfsdienst, die Johanniterunfallhilfe sowie<br />
den Arbeiter-Samariter-B<strong>und</strong>. 44 Den Angaben der Organisationen folgend, waren 1998 ca. 10.500<br />
Personen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im Krankentransport- <strong>und</strong> Rettungswesen beschäftigt, wobei die<br />
Feuerwehr mit Abstand den größten Arbeitgeber darstellt.<br />
2.5.4. Ges<strong>und</strong>heitsverwaltung<br />
Zu den Bereichen der Ges<strong>und</strong>heitsverwaltung werden im Rahmen des vorliegenden Gutachtens die<br />
gesetzlichen <strong>und</strong> privaten Krankenversicherungen, Teile des Personals der gesetzlichen Renten- <strong>und</strong><br />
Unfallversicherung sowie die Organisationen der Leistungserbr<strong>in</strong>ger gezählt. Für diese Arbeitsbereiche<br />
liegen <strong>in</strong> der Regel auf Landesebene ke<strong>in</strong>e fortlaufenden Statistiken vor, die e<strong>in</strong>e retrospektive<br />
Aufarbeitung der Beschäftigungsentwicklung erlauben würden. Aus diesem Gr<strong>und</strong> beschränkt sich die<br />
Ausweisung der Beschäftigtendaten auf das Basisjahr 1998. Dabei wurden die vorliegenden Daten<br />
über eigene schriftliche <strong>und</strong> mündliche Recherchen zusammengestellt. Im Ergebnis ist für diesen Bereich<br />
des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s 1998 e<strong>in</strong>e Gesamtbeschäftigtenzahl von ca. 50.000 Personen zu Gr<strong>und</strong>e<br />
zu legen.<br />
2.5.4.1. Gesetzliche <strong>und</strong> private Krankenversicherungen<br />
Im Rahmen des Gutachtens wurden alle gesetzlichen <strong>und</strong> privaten Krankenversicherungen mit Sitz <strong>in</strong><br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen mit der Bitte um Beschäftigtendaten für das Jahr 1998 angesprochen. Berücksichtigung<br />
fanden dabei auch die Hauptgeschäftsstellen der Krankenversicherungen, die ihren Sitz <strong>in</strong><br />
NRW haben, wie z.B. die AOK, die IKK oder die BKK. Für das Basisjahr ergeben sich zum 31.12.<br />
folgende Beschäftigtenzahlen.<br />
Insgesamt s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen ca. 43.800 Personen <strong>in</strong> privaten <strong>und</strong> gesetzlichen Krankenversicherungen<br />
beschäftigt. Etwas über 76 % der landesweit Beschäftigten s<strong>in</strong>d dabei für die gesetzlichen<br />
Krankenversicherungen tätig, auf die privaten Krankenversicherer entfallen knapp 24 % (s. Tab. 31).<br />
44 Zwar gibt es mittlerweile auch private Unternehmen, <strong>in</strong>sbesondere im Bereich der Krankentransporte. Angesichts<br />
der bereits auf B<strong>und</strong>esebene ger<strong>in</strong>gen Zahl von Beschäftigten – der B<strong>und</strong>esverband Eigenständiger<br />
Rettungsdienste geht Mitte der 90er Jahre davon aus, dass <strong>in</strong> b<strong>und</strong>esweit r<strong>und</strong> 200 Unternehmen 2.500 Beschäftigte<br />
tätig s<strong>in</strong>d (vgl. Hofmann/Mill/Schneider 1996: 31) – wurde für die Landesebene mit Blick auf die<br />
aufwendige Recherche auf die Berücksichtigung dieser Organisationen verzichtet.<br />
- 72 -
Sonstige Beschäftigungsbereiche im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
Tab. 31 Beschäftigte <strong>in</strong> Krankenversicherungen 1998<br />
Krankenversicherungen Beschäftigte <strong>in</strong> %<br />
Gesetzliche Krankenversicherung 33.398 76,2%<br />
Private Krankenversicherung 10.412 23,8%<br />
Insgesamt 43.810 100,0%<br />
Quelle: Eigene Erhebung <strong>und</strong> Berechnung FfG<br />
2.5.4.2. Gesetzliche Renten- <strong>und</strong> Unfallversicherung<br />
Ortsansässige Träger der Rentenversicherung <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen s<strong>in</strong>d die Landesversicherungsanstalten<br />
Rhe<strong>in</strong>prov<strong>in</strong>z <strong>und</strong> Westfalen sowie die B<strong>und</strong>esknappschaft mit Sitz <strong>in</strong> Bochum. Von den<br />
Beschäftigten dieser Träger werden im vorliegenden Gutachten allerd<strong>in</strong>gs nur diejenigen dem <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
zugerechnet, die im Leistungsbereich Rehabilitation tätig s<strong>in</strong>d.<br />
Um die Größe dieses Personenkreises zu berechnen, wurden zunächst über e<strong>in</strong>e Eigenrecherche die<br />
Gesamtbeschäftigtenzahlen der Versicherungsträger ermittelt, allerd<strong>in</strong>gs ohne Berücksichtigung der<br />
Beschäftigten <strong>in</strong> Eigenbetrieben. Gemäß der BASYS-Studie aus dem Jahr 1996 zur b<strong>und</strong>esweiten Zahl<br />
der im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Beschäftigten erfolgte die Berechnung des Anteils der im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
Tätigen über den Anteil der Beschäftigten im Bereich der Rehabilitation der Rentenversicherung der<br />
Arbeiter. Dieser Anteil beträgt laut Angaben des VDR 13 % (vgl. Hofmann/ Mill/ Schneider 1996:<br />
33).<br />
Angesichts e<strong>in</strong>er Gesamtbeschäftigtenzahl von ca. 10.260 Personen bei den ortsansässigen Trägern der<br />
Rentenversicherung <strong>in</strong> NRW ergibt sich über diese Berechnung für den Bereich der Rehabilitation e<strong>in</strong><br />
Beschäftigungsumfang von ca. 1.330 Beschäftigten.<br />
Für den Arbeitsbereich Unfallversicherung s<strong>in</strong>d unterschiedliche Organisationen zuständig. Hierzu<br />
gehören die gewerblichen <strong>und</strong> landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften, die Geme<strong>in</strong>deunfallversicherungsverbände,<br />
staatliche Ausführungsbehörden, die Eigenunfallversicherungen der Städte <strong>und</strong> die<br />
Feuerwehrunfallkassen. Am personal<strong>in</strong>tensivsten erweisen sich <strong>in</strong> diesem Bereich die gewerblichen,<br />
landwirtschaftlichen sowie die See-Berufsgenossenschaften. B<strong>und</strong>esweit entfallen über 86 % des <strong>in</strong>sgesamt<br />
ca. 23.500 Personen umfassenden Verwaltungspersonals der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung<br />
auf die Berufsgenossenschaften (vgl. a.a.O.: 34). Auch die Beschäftigten der Träger der<br />
Unfallversicherung können jedoch nur z.T. dem <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> zugerechnet werden. So geht die<br />
BASYS-Studie z.B. davon aus, dass 25 % der Arbeitszeit der <strong>in</strong> der Verwaltung tätigen Beschäftigten<br />
auf die Abwicklung von Maßnahmen aus dem Ges<strong>und</strong>heitsbereich entfällt (a.a.O.: 34). In Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen haben 8 der <strong>in</strong>sgesamt b<strong>und</strong>esweit 35 gewerblichen Berufsgenossenschaften ihren Sitz,<br />
darüber h<strong>in</strong>aus f<strong>in</strong>den sich zwei landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften.<br />
Über alle Organisationen im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
h<strong>in</strong>weg ist von etwas über 5.000 Beschäftigten <strong>in</strong> der Verwaltung auszugehen. Geht man davon aus,<br />
dass hiervon 25 % mit Maßnahmen aus dem Ges<strong>und</strong>heitsbereich beschäftigt s<strong>in</strong>d, so ergibt sich für<br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen e<strong>in</strong>e ungefähre Zahl von 1.250 Beschäftigten der gesetzlichen Unfallversicherung<br />
im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>.<br />
- 73 -
Sonstige Beschäftigungsbereiche im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
2.5.4.3. Organisationen der Leistungserbr<strong>in</strong>ger<br />
Zu den Organisationen der Leistungserbr<strong>in</strong>ger zählen u.a. die Ärzte-, Zahnärzte- <strong>und</strong> Apothekerkammern,<br />
die Kassen(zahn)ärztlichen Vere<strong>in</strong>igungen, die Berufsverbände sowie die Verwaltungsbereiche<br />
der Wohlfahrtsverbände. Im Rahmen des Gutachtens erfolgte e<strong>in</strong>e schriftliche Befragung der ortsansässigen<br />
b<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> landesbezogenen Kammern <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen sowie der Kassenärztlichen<br />
<strong>und</strong> Kassenzahnärztlichen Vere<strong>in</strong>igungen. Dabei s<strong>in</strong>d alle<strong>in</strong> bei der Berufsgruppe der Apotheker/<strong>in</strong>nen<br />
die B<strong>und</strong>esorganisationen außerhalb Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalens angesiedelt.<br />
Tab. 32 Beschäftigte <strong>in</strong> Organisationen der Ärzt/<strong>in</strong>nen, Zahnärzt/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Apotheker/<strong>in</strong>nen<br />
1998<br />
Organisationen der Leistungserbr<strong>in</strong>ger Beschäftigte <strong>in</strong> %<br />
Ärzte (Kassenärztliche (B<strong>und</strong>es)Vere<strong>in</strong>igung(en), (B<strong>und</strong>es)-<br />
Ärztekammer(n))<br />
2.412 78,8%<br />
Zahnärzte (Kassenzahnärztliche (B<strong>und</strong>es)Vere<strong>in</strong>igung(en), (B<strong>und</strong>es)Zahnärztekammer(n))<br />
568 18,5%<br />
Apotheker (Apothekerkammern, Apothekerverbände) 82 2,7%<br />
Insgesamt<br />
Quelle: Eigene Erhebung <strong>und</strong> Berechnung FfG<br />
3.062 100%<br />
Insgesamt s<strong>in</strong>d 1998 knapp 3.060 Personen <strong>in</strong> den Kammern bzw. Kassen(zahn)ärztlichen Vere<strong>in</strong>igungen<br />
beschäftigt, wobei alle<strong>in</strong> 56,9 % der Beschäftigten auf die Kassenärztlichen Vere<strong>in</strong>igungen<br />
entfallen.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus ist davon auszugehen, dass <strong>in</strong> den landesweiten Berufsverbänden sowie den Wohlfahrtsorganisationen<br />
m<strong>in</strong>destens weitere 500-600 Personen für den Bereich des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s<br />
tätig s<strong>in</strong>d.<br />
2.5.5. Ausbildungsstätten<br />
Angesichts der hohen Zahl an Auszubildenden <strong>in</strong> den Ges<strong>und</strong>heitsberufen darf bei e<strong>in</strong>er Bestandsaufnahme<br />
der Beschäftigten im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> das Personal der Bildungse<strong>in</strong>richtungen nicht fehlen,<br />
zumal der Ausbau der Ausbildungskapazitäten zum<strong>in</strong>dest Anfang bis Mitte der 90er Jahre zu e<strong>in</strong>em<br />
steigenden Bedarf an Lehrkräften geführt hat.<br />
Abb. 20 Hauptberufliches Lehrpersonal <strong>in</strong> Ausbildungen zu Ges<strong>und</strong>heitsberufen 1998<br />
Quelle: LDS, Darstellung FfG<br />
2.576<br />
700<br />
- 74 -<br />
5.989<br />
Hochschulen Schulen des Ges<strong>und</strong>heitsw esens Berufskollegs
Sonstige Beschäftigungsbereiche im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
Insgesamt s<strong>in</strong>d 1998 ca. 9.265 Personen als hauptberufliche Lehrkräfte <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsausbildungen<br />
tätig, davon knapp 64,6 % an den Hochschulen, knapp 28 % an den Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s<br />
<strong>und</strong> etwas über 7,6 % an Berufskollegs.<br />
Tab. 33 Lehrkräfte an den Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s 1998<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
darunter davon<br />
weiblich, <strong>in</strong><br />
% von <strong>in</strong>sg.<br />
hauptberufliche<br />
Lehrkräfte 1<br />
zusammen<br />
<strong>in</strong> % von<br />
<strong>in</strong>sg.<br />
nebenberufliche Lehrkräfte<br />
zusammen<br />
<strong>in</strong> % von davon<br />
<strong>in</strong>sg. Ärzt/<strong>in</strong>nen<br />
- 75 -<br />
<strong>in</strong> % von<br />
<strong>in</strong>sg.<br />
sonstige <strong>in</strong> % von<br />
<strong>in</strong>sg.<br />
16.495 49,5% 2.576 15,6% 13.919 84,4% 5.927 35,9% 7.992 48,5%<br />
1 Lehrkräfte, die 19 oder mehr Wochenst<strong>und</strong>en unterrichten<br />
Quelle: LDS, Statistik Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s, Berechnungen FfG<br />
An den Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s arbeiten 1998 ca. 16.500 Lehrkräfte. Darunter bef<strong>in</strong>den sich<br />
nur etwas über 15 % hauptamtliche Lehrkräfte, während die überwiegende Mehrheit nebenberuflich<br />
tätig ist. 42,6 % der nebenberuflichen Lehrkräfte s<strong>in</strong>d Ärzt/<strong>in</strong>nen. Während bei den hauptberuflichen<br />
Lehrkräften über 70 % weiblich s<strong>in</strong>d, liegt bei den nebenberuflichen Lehrkräften mit 54,5 % der Männeranteil<br />
etwas höher.<br />
Für die berufsbildenden Schulen f<strong>in</strong>det sich weniger differenziertes Material, da sich das allgeme<strong>in</strong>bildende,<br />
aber auch das fachpraktische Lehrpersonal nicht immer den e<strong>in</strong>zelnen Ausbildungsgängen e<strong>in</strong>deutig<br />
zuordnen lässt. Auf der Basis e<strong>in</strong>er Sonderauswertung des Landesamtes für Datenverarbeitung<br />
<strong>und</strong> Statistik 45 kann jedoch zum<strong>in</strong>dest e<strong>in</strong>e grobe Abschätzung des unteren Beschäftigungsumfangs an<br />
berufsbildenden Schulen erfolgen. Demnach entfallen an den ehemaligen Berufsschulen 10.966 Wochenst<strong>und</strong>en<br />
auf Ges<strong>und</strong>heitsausbildungen, an den ehemaligen Kollegschulen 2.757 Wochenst<strong>und</strong>en.<br />
Geht man von e<strong>in</strong>er durchschnittliche Wochenst<strong>und</strong>enzahl aller vollzeit- <strong>und</strong> teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte<br />
von 19,5 Unterrichtsst<strong>und</strong>en aus, so s<strong>in</strong>d ungefähr 700 Lehrer/<strong>in</strong>nen an den Berufskollegs <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsausbildungen<br />
tätig.<br />
An den Hochschulen f<strong>in</strong>den sich für die Studiengänge Allgeme<strong>in</strong>e Mediz<strong>in</strong> <strong>und</strong> Zahnmediz<strong>in</strong> sowie<br />
Pharmazie <strong>und</strong> Psychologie <strong>in</strong>sgesamt ca. 9.110 haupt- <strong>und</strong> nebenberufliche Lehrkräfte. 46<br />
Die Anteile des hauptberuflichen Hochschulpersonals differieren stark zwischen der Humanmediz<strong>in</strong> <strong>und</strong><br />
der Pharmazie. Während <strong>in</strong> der Humanmediz<strong>in</strong> fast 85 % des Personals hauptberuflich auf Dauer oder<br />
auf Zeit beschäftigt ist, liegt dieser Anteil <strong>in</strong> der Pharmazie nur bei 70 %. Unter den knapp 6.000 hauptberuflichen<br />
Lehrkräften <strong>in</strong> der Humanmediz<strong>in</strong> bef<strong>in</strong>den sich aber alle<strong>in</strong> 3.526 wissenschaftliche <strong>und</strong><br />
künstlerische Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen auf Zeit, von denen 67,1 % <strong>in</strong> der kl<strong>in</strong>isch-praktischen Humanmediz<strong>in</strong><br />
45 Für die Ausbildungsberufe, die an den Berufskollegs (ehemalige Berufsschulen <strong>und</strong> Kollegschulen) angesiedelt<br />
s<strong>in</strong>d, wurden für e<strong>in</strong>e Woche im Oktober 1998 die jeweiligen Wochenst<strong>und</strong>en ermittelt <strong>und</strong> um Doppelzählungen<br />
aufgr<strong>und</strong> gekoppelter Unterrichtse<strong>in</strong>heiten bere<strong>in</strong>igt.<br />
46 Zur Bestimmung des Lehrpersonals an Hochschulen wurde für die Humanmediz<strong>in</strong> <strong>und</strong> die Pharmazie auf<br />
Angaben der Hochschulstatistik zurückgegriffen. Da das Lehrpersonal nur auf Ebene der Lehr- <strong>und</strong> Forschungsbereiche<br />
ausgewiesen wird, waren Angaben für den Studiengang Psychologie nicht verfügbar. Aus<br />
diesem Gr<strong>und</strong> musste hier e<strong>in</strong>e grobe Abschätzung der Zahl der Lehrkräfte erfolgen.
Sonstige Beschäftigungsbereiche im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
arbeiten. E<strong>in</strong> Großteil des <strong>in</strong> der Hochschulstatistik ausgewiesenen Lehrpersonals entfällt somit wahrsche<strong>in</strong>lich<br />
auf Doktorand/<strong>in</strong>nen, die nur <strong>in</strong> begrenztem Umfang Lehrverpflichtungen nachkommen.<br />
Tab. 34 Wissenschaftliches <strong>und</strong> künstlerisches Personal an Hochschulen 1998<br />
Fakultät/ Lehrkräfte an den Hochschulen<br />
Studiengang <strong>in</strong>sgesamt darunter davon<br />
weiblich, <strong>in</strong> % hauptberufliche Lehrkräfte nebenberufliche Lehrkräfte<br />
von <strong>in</strong>sgesamt zusammen <strong>in</strong> % von zusammen <strong>in</strong> % von<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
Humanmediz<strong>in</strong> 7.159 32,6 % 5.989 83,7% 1.170 16,3%<br />
Pharmazie 448 39,5 % 314 70,1% 134 29,9%<br />
Psychologie<br />
(geschätzt)<br />
ca. 1.503 ca. 1.053 ca. 450<br />
Insgesamt ca. 9.110 100,0% 7.356 80,7% 1.754 19,3%<br />
Quelle: LDS, Hochschulstatistik sowie Schätzungen auf der Basis der Hauptfachstudent/<strong>in</strong>nen Psychologie, Berechnungen<br />
FfG<br />
Der Frauenanteil unter den Lehrkräften liegt <strong>in</strong> der Humanmediz<strong>in</strong> bei knapp e<strong>in</strong>em Drittel, <strong>in</strong> der<br />
Pharmazie mit knapp 40 % etwas höher. Der Anteil der Professor<strong>in</strong>nen beträgt <strong>in</strong> der Humanmediz<strong>in</strong><br />
allerd<strong>in</strong>gs nur 5,7 % <strong>und</strong> <strong>in</strong> der Pharmazie nur 4,8 %.<br />
2.6. Zuliefer- <strong>und</strong> Nachbarbranchen<br />
Während das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> im engeren S<strong>in</strong>ne statistisch weitestgehend erschlossen ist, bestehen<br />
<strong>in</strong> den Zuliefer- <strong>und</strong> Nachbarbranchen nach wie vor große Lücken <strong>in</strong> der Beschäftigtenstatistik. Da es<br />
sich hier jedoch um e<strong>in</strong>en unter wirtschafts- <strong>und</strong> beschäftigungspolitischen Gesichtspunkten bedeutsamen<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> Zukunft mit hoher Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit weiter expandierenden Wachstumsmarkt handelt,<br />
ist es notwendig, auch die dort vorhandenen Beschäftigungspotenziale zu identifizieren.<br />
Zu den Zuliefer- <strong>und</strong> Nachbarbranchen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s zählen neben den Health Care Industrien<br />
(Pharmazeutische Industrie, Mediz<strong>in</strong>technik <strong>und</strong> Biotechnologie), die ges<strong>und</strong>heitsbezogenen<br />
Handwerksberufe (Akustiker, Optiker etc.), die Bereiche Fitness <strong>und</strong> Freizeit, der Ges<strong>und</strong>heitstourismus,<br />
Beratungs-, Consult<strong>in</strong>g- <strong>und</strong> Informationsdienstleistungen sowie die verschiedenen Servicedienstleistungen<br />
für mehr Lebensqualität. Geme<strong>in</strong>sam ist diesen Beschäftigungsfeldern, dass sie nicht<br />
e<strong>in</strong>deutig dem <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> zuzuordnen s<strong>in</strong>d, jedoch e<strong>in</strong>en wesentlichen oder gar überwiegenden<br />
Teil ihrer Wertschöpfung im Bereich ges<strong>und</strong>heitsbezogener Aktivitäten erbr<strong>in</strong>gen. Aufgr<strong>und</strong> der zunehmenden<br />
Bedeutung der sich professionalisierenden Selbsthilfegruppen <strong>und</strong> -<strong>in</strong>itiativen bietet es<br />
sich an, auch die Beschäftigungseffekte durch Selbsthilfeaktivitäten im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> abzuschätzen.<br />
Neue Anforderungen an Integration <strong>und</strong> Vernetzung zwischen der stationären <strong>und</strong> ambulanten Versorgung,<br />
aber auch zwischen den Kernsektoren des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s <strong>und</strong> den Randbereichen <strong>und</strong><br />
Nachbarbranchen sowie e<strong>in</strong>e systematische Angebotsentwicklung, die der steigenden Nachfrage nach<br />
sozialen <strong>und</strong> ges<strong>und</strong>heitsbezogenen Dienstleistungen entspricht, lassen es s<strong>in</strong>nvoll ersche<strong>in</strong>en, auch<br />
die Nachbarbranchen – etwa im Fitness- <strong>und</strong> Wellnessbereich – den beschäftigungsrelevanten Feldern<br />
des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s zuzuordnen. Da <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen Branchen <strong>und</strong> Tätigkeitsfeldern unterschied-<br />
- 76 -
Zuliefer- <strong>und</strong> Nachbarbranchen<br />
liche Trends wirksam werden, ist es notwendig, diese Trends jeweils gesondert darzustellen <strong>und</strong> die<br />
daraus resultierenden Beschäftigungseffekte abzuleiten.<br />
2.6.1. Health Care Industrien<br />
Die Health Care Industrien stellen den Leistungsanbietern <strong>und</strong> Patient/<strong>in</strong>nen Arzneimittel, technische<br />
Hilfsmittel <strong>und</strong> Geräte zur Verfügung, die dabei helfen sollen, Krankheiten zu verh<strong>in</strong>dern, diese möglichst<br />
schnell <strong>und</strong> zuverlässig zu diagnostizieren, zu heilen oder ihre Auswirkungen auf die Lebensqualität<br />
erträglicher zu machen (vgl. Statistisches B<strong>und</strong>esamt 1998: 346). Wie diese Def<strong>in</strong>ition zeigt,<br />
lassen sich die Beschäftigten der Health Care Industrien e<strong>in</strong>deutig dem <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> zuordnen,<br />
da ihre Produkte <strong>und</strong> Dienstleistungen als Vorleistungen ausschließlich <strong>in</strong> die Kernsektoren des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s<br />
e<strong>in</strong>gehen. Im Folgenden werden zu den Health Care Industrien neben der pharmazeutischen<br />
Industrie auch die Mediz<strong>in</strong>- <strong>und</strong> Gerontotechnik sowie die moderne Bio- <strong>und</strong> Gentechnologie<br />
gezählt.<br />
2.6.1.1. Pharmazeutische Industrie<br />
Die pharmazeutische Industrie zählt zu den dom<strong>in</strong>anten Zuliefer<strong>in</strong>dustrien des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s. In<br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen waren 1998 r<strong>und</strong> 28.000 Menschen <strong>in</strong> diesem Industriezweig beschäftigt. In Tab.<br />
35 ist die Entwicklung der pharmazeutischen Industrie <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen zwischen 1995 <strong>und</strong><br />
1998 nach Regierungsbezirken dargestellt:<br />
Tab. 35 Pharmazeutische Industrie Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen: Betriebe <strong>und</strong> Beschäftigte 1995 -<br />
1998<br />
1995 1996 1997 1998<br />
Betriebe Beschäftigte<br />
Betriebe Beschäftigte<br />
- 77 -<br />
Betriebe Beschäftigte<br />
Betriebe Beschäftigte<br />
NRW 45 12.641 47 13.175 45 13.158 43 38.382<br />
Düsseldorf 8 1.547 8 1.961 6 1.880 7 1.852<br />
Köln 16 4.830 17 4.951 17 4.883 17 30.258<br />
Münster 7 1.856 8 1.905 7 2.052 8 2.084<br />
Detmold 7 1.931 7 1.991 8 2.015 5 1.862<br />
Arnsberg 7 2.478 7 2.368 7 2.327 7 2.327<br />
Quelle: LDS 1999, Berechnungen IAT<br />
Mitte der 90er Jahre schwankte die Beschäftigtenzahl <strong>in</strong> der pharmazeutischen Industrie zwischen ca.<br />
12.600 <strong>und</strong> 13.200 Beschäftigten. Die außergewöhnliche Beschäftigungszunahme im Regierungsbezirk<br />
Köln im Jahre 1998 ist im Wesentlichen auf e<strong>in</strong>e Umstellung der Erhebungsmodalitäten des Landesamtes<br />
für Datenverarbeitung <strong>und</strong> Statistik zurückzuführen. Bayer Leverkusen, bis 1998 unter dem<br />
Wirtschaftszweig „Chemische Industrie“ geführt, wird seit 1998 der Kategorie ”Herstellung pharmazeutischer<br />
Erzeugnisse” zugeordnet Die vom Landesamt für Datenverarbeitung <strong>und</strong> Statistik angegebene<br />
Beschäftigtenzahl von 38.382 Personen im Pharmabereich muss deshalb nach unten korrigiert<br />
werden. E<strong>in</strong>e plausible Schätzung, die <strong>in</strong> Interviews mit Vertretern der pharmazeutischen Verbände<br />
bestätigt wurde, kann von r<strong>und</strong> 28.000 Beschäftigten <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen ausgehen. Wie zudem
Zuliefer- <strong>und</strong> Nachbarbranchen<br />
aus Tab. 35 ersichtlich ist, lässt sich im Bereich der pharmazeutischen Industrie <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>deutige regionale Schwerpunktsetzung im Rhe<strong>in</strong>land (vor allem <strong>in</strong> den Regierungsbezirken<br />
Köln <strong>und</strong> Düsseldorf) konstatieren.<br />
Durch ihren hohen Forschungs- <strong>und</strong> Entwicklungsanteil bed<strong>in</strong>gt, stellt die pharmazeutische Industrie<br />
überdurchschnittlich viele (hoch)qualifizierte Arbeitsplätze zur Verfügung. R<strong>und</strong> zwei Drittel (66%)<br />
der Beschäftigten bef<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Angestelltenverhältnis, nur r<strong>und</strong> e<strong>in</strong> Drittel (34%) s<strong>in</strong>d Arbeiter.<br />
1998 absolvierten b<strong>und</strong>esweit r<strong>und</strong> 3.200 Personen e<strong>in</strong>e Ausbildung <strong>in</strong> der pharmazeutischen<br />
Industrie, wobei r<strong>und</strong> zwei Drittel der Ausbildungsplätze auf den naturwissenschaftlich-technischen,<br />
r<strong>und</strong> e<strong>in</strong> Drittel auf den kaufmännischen Bereich entfielen (vgl. B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Ges<strong>und</strong>heit et<br />
al. 1998). Da die Entwicklung neuer Medikamente hohe Investitionen <strong>in</strong> Forschung <strong>und</strong> Entwicklung<br />
erforderlich macht, wird die Nachfrage nach qualifiziertem Personal nach E<strong>in</strong>schätzung des B<strong>und</strong>esverbandes<br />
der pharmazeutischen Industrie <strong>in</strong> Zukunft weiter steigen.<br />
Die zukünftige Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> der pharmazeutischen Industrie wird maßgeblich durch<br />
die Faktoren Selbstmedikation <strong>und</strong> Export bestimmt. Sowohl die Selbstmedikation als auch der OTC-<br />
Verkauf (over the counter) s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den letzten Jahren stark expandiert, der Umsatzrückgang verschreibungspflichtiger<br />
Medikamente wird bislang jedoch nicht durch Umsatzsteigerungen im Bereich der<br />
Selbstmedikation kompensiert. Dennoch kann festgehalten werden, dass die weitere Entwicklung des<br />
Pharmaziemarktes <strong>und</strong> somit auch der Beschäftigung <strong>in</strong> höherem Maße als heute durch die Entwicklungen<br />
des Selbstmedikationsmarktes bestimmt se<strong>in</strong> wird.<br />
Tab. 36 Arzneimittelmarkt <strong>in</strong> Deutschland 1998 (zu Endverbraucherpreisen)<br />
Mrd. DM Anteil (<strong>in</strong> %)<br />
Rezeptpflichtige Arzneimittel 37,2 70<br />
Verordnete rezeptfreie Arzneimittel 7,2 14<br />
Selbstmedikation mit rezeptfreien Arzneimitteln <strong>in</strong> der<br />
Apotheke<br />
7,6 14<br />
Selbstmedikation mit freiverkäuflichen Arzneimitteln <strong>in</strong><br />
Drogerien <strong>und</strong> Verbrauchermärkten<br />
1,3 2<br />
Gesamt 53,3 100<br />
Quelle: BAH 1999<br />
Neben dem Verkauf von Arzneimitteln <strong>in</strong> b<strong>und</strong>esweit r<strong>und</strong> 21.552 Apotheken werden freiverkäufliche<br />
Arzneimittel auch <strong>in</strong> anderen Absatzstätten angeboten. Hierzu zählten 1998 etwa r<strong>und</strong> 6.800 Drogerien,<br />
9.900 Drogeriemärkte, 7.090 Verbrauchermärkte <strong>und</strong> 2.510 Reformhäuser. Zu den umsatzstärksten<br />
Arzneimitteln (nach Indikationsbereichen) zählen Husten- <strong>und</strong> Erkältungsmittel, Magen- <strong>und</strong><br />
Verdauungsmittel, Schmerzmittel sowie Vitam<strong>in</strong>e <strong>und</strong> M<strong>in</strong>eralstoffe. Wie der folgenden Tabelle zu<br />
entnehmen, übersteigt der Umsatz mit freiverkäuflichen Arzneimitteln <strong>in</strong> Drogeriemärkten, Verbrauchermärkten<br />
<strong>und</strong> Reformhäusern den entsprechenden Umsatz <strong>in</strong> Apotheken.<br />
- 78 -
Zuliefer- <strong>und</strong> Nachbarbranchen<br />
Tab. 37 Freiverkäufliche Arzneimittel nach Absatzkanälen <strong>in</strong> Deutschland 1998<br />
Mio. DM<br />
Apotheken 938<br />
Drogeriemärkte 898<br />
Verbrauchermärkte 373<br />
Reformhäuser 223<br />
Gesamt 2.443<br />
Quelle: BAH 1998<br />
Die pharmazeutische Industrie zeichnet sich durch ihre ausgesprochene Exportorientierung aus – über<br />
50% des Umsatzes werden durch den Export erzielt. Im Jahr 1998 betrug der Exportüberschuss<br />
10,8%. Diese Daten lassen sich als Indikatoren für die hohe Produktqualität <strong>in</strong>terpretieren.<br />
Wie e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>ternational vergleichende Studie belegt, hat der Pharmastandort Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen die<br />
besten Voraussetzungen, um auch <strong>in</strong> Zukunft <strong>in</strong>novative pharmazeutische Produkte bis zur Patentreife<br />
zu entwickeln <strong>und</strong> national sowie <strong>in</strong>ternational zu vermarkten. Als positive Standortfaktoren werden<br />
die Produktivität <strong>und</strong> Qualifikation der Mitarbeiter <strong>und</strong> Mitarbeiter<strong>in</strong>nen sowie die hervorragende<br />
Infrastruktur <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen genannt. Verbesserungspotenziale bestehen <strong>in</strong> den ”weichen<br />
Faktoren”, z.B. der Orientierung an wissenschaftlichen <strong>und</strong> technologischen Neuerungen sowie der<br />
Kooperations<strong>in</strong>tensität zwischen Wissenschaft <strong>und</strong> Wirtschaft (vgl. Landes<strong>in</strong>itiative Health Care<br />
NRW 1998).<br />
2.6.1.2. Mediz<strong>in</strong>technik<br />
In der Mediz<strong>in</strong>technik arbeiten b<strong>und</strong>esweit r<strong>und</strong> 120.000 Beschäftigte. In den r<strong>und</strong> 1.700 nordrhe<strong>in</strong>westfälischen<br />
Mediz<strong>in</strong>technikunternehmen waren Mitte der 90er Jahre ca. 20.000 Menschen beschäftigt<br />
(vgl. MWMTV 1999) 47 . Die Mediz<strong>in</strong>technik<strong>in</strong>dustrie ist, ähnlich wie die pharmazeutische Industrie,<br />
überwiegend durch kle<strong>in</strong>e <strong>und</strong> mittlere Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong><br />
Mitarbeitern geprägt. Die nordrhe<strong>in</strong>-westfälischen Mediz<strong>in</strong>technikanbieter s<strong>in</strong>d vor allem <strong>in</strong> den<br />
Marktsegmenten bildgebende Verfahren, Strahlentechnik, Kardiologie, Lasertherapiesysteme sowie<br />
Produktion <strong>und</strong> Vertrieb mediz<strong>in</strong>ischer E<strong>in</strong>malartikel aktiv. Aufgr<strong>und</strong> der vorherrschenden Kostendämpfungspolitik<br />
erweisen sich jene Produkte <strong>und</strong> Dienstleistungen als besonders erfolgreich, die zu<br />
e<strong>in</strong>er nachhaltigen Kostensenkung im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> beitragen. ”Dazu zählen vor allem EDV Produkte<br />
(e<strong>in</strong>schl. Datenaustausch), mediz<strong>in</strong>ische Geräte, Therapieverfahren <strong>und</strong> mehrfach nutzbare Verbrauchsartikel,<br />
die im Rahmen e<strong>in</strong>er Reorganisation <strong>und</strong> Rationalisierung im wichtigsten Kostensektor,<br />
dem Kl<strong>in</strong>ikbereich, e<strong>in</strong>gesetzt werden” (MWMTV 1999).<br />
47 Nicht auszuschließen s<strong>in</strong>d im Bereich der Mediz<strong>in</strong>- <strong>und</strong> Gerontotechnik Doppelzählungen, da <strong>in</strong> den Angaben<br />
des MWMTV 1999 teilweise auch Beschäftigte der E<strong>in</strong>richtungen des Ges<strong>und</strong>heitshandwerkes erfasst<br />
s<strong>in</strong>d, die <strong>in</strong> dieser Studie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er eigenen Kategorie Ges<strong>und</strong>heitshandwerk aufgeführt s<strong>in</strong>d. Wird jedoch <strong>in</strong><br />
Rechnung gestellt, dass mediz<strong>in</strong>- <strong>und</strong> gerontotechnische Produkte <strong>und</strong> Dienstleistungen auch <strong>in</strong> anderen Betrieben<br />
<strong>und</strong> E<strong>in</strong>richtungen hergestellt werden, die von der Statistik nicht erfasst werden, lassen sich diese<br />
Daten durchaus als valide bezeichnen.<br />
- 79 -
Zuliefer- <strong>und</strong> Nachbarbranchen<br />
Wie die pharmazeutische Industrie zeichnet sich auch die mediz<strong>in</strong>technische Industrie durch e<strong>in</strong>e ausgesprochen<br />
hohe Exportquote, vor allem im Bereich der Elektromediz<strong>in</strong>, aus. Durch den steigenden<br />
Bedarf an moderner Gerontotechnik aufgr<strong>und</strong> des demographischen Wandels <strong>und</strong> der steigenden Zahl<br />
älterer <strong>und</strong> hochbetagter Menschen ist davon auszugehen, dass auch die Inlandsnachfrage nach Produkten<br />
<strong>und</strong> Dienstleistungen der Mediz<strong>in</strong>- <strong>und</strong> Gerontotechnik weiter ansteigen wird.<br />
2.6.1.3. Biotechnologie<br />
Die Ermittlung der Beschäftigtenzahl <strong>in</strong> biotechnologischen Unternehmen stößt auf e<strong>in</strong>ige Schwierigkeiten,<br />
da die relativ junge Branche bislang statistisch nicht erfasst ist. Als Querschnittstechnologie<br />
lässt sie sich nur schwer <strong>in</strong> die Wirtschaftszweigstatistik e<strong>in</strong>gliedern, so dass auf e<strong>in</strong>zelne Studien zurückgegriffen<br />
werden muss. Es stellt sich dann jedoch das Problem, dass die Beschäftigtenzahl mit den<br />
zu Gr<strong>und</strong>e gelegten Abgrenzungskriterien variiert, so dass e<strong>in</strong>e Vergleichbarkeit der e<strong>in</strong>zelnen Studien<br />
bzw. e<strong>in</strong>e Schätzung sehr schwierig wird.<br />
Tab. 38 Beschäftigte <strong>in</strong> der deutschen Biotech-Industrie 1998<br />
Anzahl Mitarbeiter Mitarbeiter <strong>in</strong> BioTech<br />
KMU mit 100% BioTech 173 4.013 4.013<br />
KMU mit >50% BioTech 269 7.218 4.422<br />
Großunternehmen mit BioTech 23 189.000 20.517<br />
Summe 465 200.231 28.952<br />
Quelle: Schitag/Ernst/Young 1998; Berechnungen IAT<br />
Die restriktive Def<strong>in</strong>ition biotechnologischer Unternehmen, die der Erhebung von Schitag/Ernst/Young<br />
zu Gr<strong>und</strong>e liegt, erlaubt lediglich die Erfassung sogenannter ”core-Biotech-<br />
Unternehmen”. Da es sich bei der modernen Biotechnologie jedoch um e<strong>in</strong>e ”Querschnittstechnologie”<br />
handelt, bedarf es e<strong>in</strong>er weniger starren Kategorisierung, die auch die Erfassung von Beschäftigten<br />
erlaubt, die <strong>in</strong> Unternehmen tätig s<strong>in</strong>d, die nicht zu den Kern-Biotechunternehmen zählen.<br />
Zu anderen Ergebnissen kommt die Unternehmenszählung der Landes<strong>in</strong>itiative Bio-Gen-Tec-NRW,<br />
die e<strong>in</strong>e stärker differenzierte Kategorisierung biotechnischer Unternehmen vornimmt. Der Landes<strong>in</strong>itiative<br />
zufolge lassen sich drei Kategorien biotechnologischer Unternehmen unterscheiden:<br />
• Kategorie I: Unternehmen, die mit modernen biotechnologischen Verfahren forschen, produzieren<br />
oder arbeiten bzw. Firmen, die sich <strong>in</strong> der biotechnologischen Forschung engagieren <strong>und</strong> aufgr<strong>und</strong><br />
ihrer Größe, Ausrichtung oder Marktbedeutung der Biotech-Branche zuzurechnen s<strong>in</strong>d;<br />
• Kategorie II: Unternehmen, die <strong>in</strong> nennenswertem Umfang technische Produkte oder Biotechnologie-spezifische<br />
Dienstleistungen für Firmen der Kategorie I anbieten <strong>und</strong> nicht selbst zur Kategorie<br />
I zählen;<br />
• Kategorie III: EDV <strong>und</strong> IT, Beratungsdienstleistungen sowie Kapitalgesellschaften.<br />
In Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen existieren im Februar 2000 dieser Klassifizierung zufolge 129 Unternehmen<br />
der Kategorie I, 135 Unternehmen der Kategorie II sowie 59 Unternehmen der Kategorie III. Nicht mit<br />
berücksichtigt s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> dieser Zählung die universitären <strong>und</strong> außeruniversitären Forschungse<strong>in</strong>richtun-<br />
- 80 -
Zuliefer- <strong>und</strong> Nachbarbranchen<br />
gen, die sich ebenfalls ausschließlich oder überwiegend mit biotechnologischer Forschung <strong>und</strong> Anwendung<br />
befassen.<br />
Nach Angaben der Landes<strong>in</strong>itiative Health Care NRW s<strong>in</strong>d landesweit r<strong>und</strong> 400 Unternehmen <strong>und</strong><br />
Forschungse<strong>in</strong>richtungen im Bereich der Bio- <strong>und</strong> Gentechnologie tätig, davon r<strong>und</strong> die Hälfte der<br />
Betriebe <strong>in</strong> den wachstumsstarken <strong>und</strong> <strong>in</strong>novativen Ges<strong>und</strong>heitsbranchen Diagnostika (22%), Pharma<br />
(12%) <strong>und</strong> Analytik (10%). Insgesamt beläuft sich die Zahl der Beschäftigten <strong>in</strong> diesen Sektoren auf<br />
r<strong>und</strong> 6.000 Personen (vgl. MWMTV 1999). Der Schwerpunkt der nordrhe<strong>in</strong>-westfälischen Biotechnologie<br />
liegt mit 80% der Projekte <strong>und</strong> Beschäftigten e<strong>in</strong>deutig im Bereich der ”roten Biotechnologie”,<br />
d.h. im Bereich mediz<strong>in</strong>ischer Anwendungen (Diagnostik <strong>und</strong> Therapieentwicklung) sowie der<br />
”grauen Biotechnologie”, d.h. der biologischen Verfahrenstechnik (vgl. Geschäftsbericht Bio-Gen-Tec<br />
NRW 1999).<br />
Nach e<strong>in</strong>er Studie der Prognos AG im Auftrag des Wissenschaftszentrums Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen wird<br />
für das Jahr 2001 e<strong>in</strong> Umsatz der kommerziellen Biotechnologie von ca. 4,1 Mrd DM <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
prognostiziert, der vor allem durch e<strong>in</strong>e weitere Umsatzsteigerung <strong>in</strong> den Bereichen Therapeutika<br />
<strong>und</strong> Diagnostika getragen wird (vgl. Kaiser 1997: 16). In ihrer Abschätzung geht die Prognos-<br />
Studie von e<strong>in</strong>er Verdoppelung der 1996 bestehenden 1.800 Arbeitsplätze <strong>in</strong> den nordrhe<strong>in</strong>westfälischen<br />
Core-Biotechnologie-Unternehmen bis 2001 auf 3.600 Beschäftigte aus. Nicht berücksichtigt<br />
s<strong>in</strong>d hier jedoch jene Beschäftigungseffekte, die aus weiteren Unternehmensneugründungen<br />
resultieren. In den Zuliefer- <strong>und</strong> Dienstleistungsunternehmen wird mit e<strong>in</strong>er Beschäftigungszunahme<br />
um r<strong>und</strong> 50% von 2.300 Beschäftigten im Jahre 1996 auf ca. 3.600 Beschäftigte <strong>in</strong> 2001 gerechnet.<br />
”Unter Berücksichtigung der durch diese Arbeitsplätze wiederum ausgelösten E<strong>in</strong>kommenseffekte (ca.<br />
1.200 zusätzliche Arbeitsplätze) werden somit <strong>in</strong>sgesamt etwa 4.300 neue Arbeitsplätze im Zuge der<br />
weiteren Entwicklung der kommerziellen Biotechnologie <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen entstehen. Im Jahr<br />
2001 s<strong>in</strong>d daher voraussichtlich ca. 10.000 Arbeitsplätze direkt <strong>und</strong> <strong>in</strong>direkt mit der Bio- <strong>und</strong> Gentechnologie-Branche<br />
verknüpft. E<strong>in</strong>e Substitution an anderer Stelle ist dabei allerd<strong>in</strong>gs nicht berücksichtigt”<br />
(Kaiser 1997: 27).<br />
Die Biotechnologiebranche <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen ist überwiegend kle<strong>in</strong>- <strong>und</strong> mittelbetrieblich<br />
strukturiert. Die Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeiter s<strong>in</strong>d aufgr<strong>und</strong> der ausgeprägten<br />
Forschungs- <strong>und</strong> Entwicklungsanteile überdurchschnittlich hoch. Da es sich bei der Bio- <strong>und</strong> Gentechnologie<br />
jedoch weniger um e<strong>in</strong>e beschäftigungs<strong>in</strong>tensive als vielmehr e<strong>in</strong>e äußerst kapital<strong>in</strong>tensive<br />
Branche handelt, ist ohne e<strong>in</strong>e massive politische Förderung <strong>in</strong> nächster Zeit mit e<strong>in</strong>em weiteren Ausbau<br />
der Beschäftigung nicht zu rechnen. Positive <strong>Arbeitsmarkt</strong>effekte s<strong>in</strong>d vielmehr <strong>in</strong> den direkt angrenzenden<br />
Feldern F<strong>in</strong>anzierung, Dienstleistung, Verwaltung, Transfer <strong>und</strong> Anwendung zu erwarten.<br />
Da hier jedoch schon heute teilweise Überkapazitäten bestehen, ist davon auszugehen, dass sich die zu<br />
erwartenden Beschäftigungseffekte nur zum Teil <strong>in</strong> neuen Arbeitsplätzen niederschlagen werden, sondern<br />
vielmehr die Absicherung bereits vorhandener Arbeitsplätze im Mittelpunkt stehen wird.<br />
2.6.1.4. Groß- <strong>und</strong> Fache<strong>in</strong>zelhandel mit mediz<strong>in</strong>ischen Produkten<br />
Die aktuellsten Beschäftigtenzahlen für den Großhandel mit mediz<strong>in</strong>ischen Produkten liefert die Handels-<br />
<strong>und</strong> Gaststättenzählung des Jahres 1993. Hier wurden im Großhandel mit pharmazeutischen Er-<br />
- 81 -
Zuliefer- <strong>und</strong> Nachbarbranchen<br />
zeugnissen <strong>und</strong> mediz<strong>in</strong>ischen Hilfsmitteln 15.055 Beschäftigte <strong>in</strong> 870 Arbeitsstätten gezählt, wobei<br />
der Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen mit 8.294 Beschäftigten den größten Beschäftigtenanteil<br />
verzeichnete.<br />
Tab. 39 Arbeitsstätten <strong>und</strong> Beschäftigte im Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen<br />
<strong>und</strong> mediz<strong>in</strong>ischen Hilfsmitteln (Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen; 30.04.1993)<br />
Arbeitsstätten Beschäftigte<br />
Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen 147 8.294<br />
Großhandel mit mediz<strong>in</strong>ischen <strong>und</strong> orthopädischen Artikeln <strong>und</strong><br />
Laborbedarf<br />
584 5.144<br />
Großhandel mit Dentalbedarf 139 1.617<br />
Insgesamt 870 15.055<br />
Quelle: LDS, Handels- <strong>und</strong> Gaststättenzählung 1993<br />
Die Zahl der Beschäftigten im Fache<strong>in</strong>zelhandel mit mediz<strong>in</strong>ischen <strong>und</strong> orthopädischen Produkten<br />
erhöhte sich nach Angaben des Landesamtes für Datenverarbeitung <strong>und</strong> Statistik zwischen 1994 <strong>und</strong><br />
1997 von 2.100 auf 4.000 Beschäftigte, während die Zahl der Unternehmen im gleichen Zeitraum nur<br />
leicht von 174 auf 179 Unternehmen stieg.<br />
Tab. 40 Unternehmen <strong>und</strong> Beschäftigte im Fache<strong>in</strong>zelhandel mit mediz<strong>in</strong>ischen <strong>und</strong> orthopädischen<br />
Produkten Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen 1994 - 1997<br />
Unternehmen Beschäftigte<br />
1994 175 2.100<br />
1995 177 2.900<br />
1996 179 3.300<br />
1997 179 4.000<br />
Quelle: LDS 1996, LDS 1998<br />
Damit waren im nordrhe<strong>in</strong>-westfälischen Groß- <strong>und</strong> Fache<strong>in</strong>zelhandel mit mediz<strong>in</strong>ischen Produkten<br />
19.055 Personen beschäftigt. Noch nicht <strong>in</strong> dieser Aufzählung enthalten s<strong>in</strong>d die Beschäftigten <strong>in</strong><br />
Drogerien <strong>und</strong> vergleichbaren E<strong>in</strong>richtungen des E<strong>in</strong>zelhandels, die ebenfalls mediz<strong>in</strong>ische Produkte -<br />
vor allem frei verkäufliche Arzneimittel - <strong>in</strong> ihrem Sortiment führen. 1998 waren nach Angaben des<br />
Statistischen Landesamtes 12.200 Personen <strong>in</strong> nordrhe<strong>in</strong>-westfälischen Drogeriemärkten <strong>und</strong> vergleichbaren<br />
E<strong>in</strong>richtungen beschäftigt. Wird von e<strong>in</strong>em Umsatzanteil mediz<strong>in</strong>ischer Produkte <strong>in</strong> der<br />
Höhe von ca. 10% ausgegangen, <strong>und</strong> legt man diesen Anteil auch bei den Beschäftigten zu Gr<strong>und</strong>e,<br />
waren 1998 r<strong>und</strong> 1.200 Personen <strong>in</strong> diesem Bereich beschäftigt. Die Gesamtbeschäftigtenzahl im<br />
Groß- <strong>und</strong> Fache<strong>in</strong>zelhandel <strong>in</strong>klusive Drogeriemärkten <strong>und</strong> vergleichbaren E<strong>in</strong>richtungen beläuft sich<br />
damit auf 20.255 Personen.<br />
2.6.2. Ges<strong>und</strong>heitshandwerk<br />
Da für das Ges<strong>und</strong>heitshandwerk ke<strong>in</strong>e aktuellen Beschäftigtenangaben vorliegen, muss auf die<br />
Handwerkszählung 1995 zurückgegriffen werden. Danach stellt die Berufsgruppe der Zahntechniker/<strong>in</strong>nen<br />
mit 19.038 Personen (50,6%) die größte Beschäftigtengruppe dar, gefolgt von den Augenoptiker/<strong>in</strong>nen<br />
mit 11.053 (28,3%) <strong>und</strong> den Orthopädiemechaniker/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Bandagist/<strong>in</strong>nen mit<br />
- 82 -
Zuliefer- <strong>und</strong> Nachbarbranchen<br />
4.117 Personen (10,5%). Mit e<strong>in</strong>em Beschäftigtenanteil unter 10% der Gesamtbeschäftigten im Ges<strong>und</strong>heitshandwerk<br />
folgen schließlich die Orthopädieschuhmacher/<strong>in</strong>nen mit 2.620 (6,7%) sowie die<br />
Hörgeräteakustiker/<strong>in</strong>nen mit 1.495 Beschäftigten (3,8%). Insgesamt waren damit 1995 39.038 Personen<br />
<strong>in</strong> 4.487 Unternehmen des Ges<strong>und</strong>heitshandwerks tätig.<br />
Tab. 41 Unternehmen <strong>und</strong> Beschäftigte im Ges<strong>und</strong>heitshandwerk Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalens<br />
1995<br />
Handwerksunternehmen<br />
(31.03.1995)<br />
Beschäftigte (30.09.1994)<br />
<strong>in</strong>sgesamt darunter Arbeitnehmer/-<strong>in</strong>nen*<br />
Augenoptiker/<strong>in</strong>nen 1.840 11.053 9.475<br />
Hörgeräteakustiker/<strong>in</strong>nen 109 1.495 1.409<br />
Orthopädiemechaniker/<strong>in</strong>nen/<br />
Bandagist/<strong>in</strong>nen<br />
300 4.117 3.874<br />
Orthopädieschuhmacher/<strong>in</strong>nen 533 2.620 2.045<br />
Zahntechniker/<strong>in</strong>nen 1.705 19.753 18.865<br />
Gesamt 4.487 39.038 35.668<br />
*Angestellte, Arbeiter/-<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Auszubildende<br />
Quelle: LDS, Handwerkszählung, Berechnungen IAT<br />
Für die Berufsgruppen der Zahntechniker/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> der Augenoptiker/<strong>in</strong>nen liegt vom Landesarbeitsamt<br />
e<strong>in</strong>e Zeitreihe für die 90er Jahre vor, die e<strong>in</strong>e leichte Beschäftigungszunahme der sozialversicherungspflichtig<br />
Beschäftigten <strong>in</strong> diesem Zeitraum ausweist; seit 1997 s<strong>in</strong>d die Zahlen allerd<strong>in</strong>gs wieder<br />
rückläufig:<br />
Tab. 42 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Ges<strong>und</strong>heitshandwerk<br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen 1991 - 1999<br />
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999<br />
Zahntechniker/<strong>in</strong>nen 12.316 13.718 14.274 14.638 14.859 15.075 15.270 14.421 12.410<br />
Augenoptiker/<strong>in</strong>nen 5.993 6.076 6.321 6.282 6.309 6.383 6.491 6.389 6.231<br />
Quelle: Landesarbeitsamt Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen, Beschäftigtenstatistik<br />
2.6.3. Fitness <strong>und</strong> Freizeit<br />
Die Fitnessbranche stellt e<strong>in</strong>e der Schnittstellen zwischen ges<strong>und</strong>heitsbezogenen Dienstleistungen <strong>und</strong><br />
den Nachbarbranchen Sport <strong>und</strong> Freizeit dar. Im Verlauf der 90er Jahre lassen sich enorme Zuwachsraten<br />
sowohl <strong>in</strong> Bezug auf Beschäftigung als auch auf der Nachfrageseite feststellen. So stieg die Zahl<br />
der Fitness-Anlagen b<strong>und</strong>esweit von 4.100 zu Beg<strong>in</strong>n der 90er Jahre auf 5.850 im Jahre 1998. Im gleichen<br />
Zeitraum hat sich die Zahl der Mitglieder von 1,7 Mio. auf 3,56 Mio. im Jahre 1997 mehr als<br />
verdoppelt.<br />
- 83 -
Zuliefer- <strong>und</strong> Nachbarbranchen<br />
Tab. 43 Strukturdaten der Fitnesswirtschaft (BRD 1990 bis 1998)<br />
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998<br />
Anzahl der Fitness-Center 4.100 4.500 4.750 5.000 5.300 5.400 5.500 5.700 5.850<br />
Anzahl der Mitglieder (<strong>in</strong> Millionen DM) 1,7 1,8 2,0 2,7 3,2 3,3 3,4 3,56 k.A.<br />
Umsatz der Fitness-Center <strong>in</strong> DM 1,6 1,9 2,12 2,5 2,7 3,36 3,5 3,64 k.A.<br />
Quelle: Kamberovic/Schwarze 1999<br />
In den Fitness-Centern <strong>und</strong> –studios fanden sich 1997 80.761 Arbeitsplätze, die sich wie folgt auf die<br />
Beschäftigten verteilten: 15.040 Vollzeitarbeitsplätze, 51.585 Teilzeitarbeitsplätze <strong>und</strong> 14.136 Honorarkräfte.<br />
Durchschnittlich arbeiten <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen Studios 2,6 Vollzeitbeschäftigte, 9,1 Teilzeitbeschäftigte<br />
sowie 2,5 Honorarkräfte. Das ges<strong>und</strong>heitsbezogene Qualifikationsprofil der Fitness-Tra<strong>in</strong>er erstreckt<br />
sich von Diplomsportlehrer/<strong>in</strong>nen (die meist e<strong>in</strong>e Zusatzqualifikation <strong>in</strong> den Bereichen Prävention <strong>und</strong><br />
Rehabilitation besitzen) über Gymnastiklehrer/<strong>in</strong>nen bis h<strong>in</strong> zu Krankengymnast/<strong>in</strong>nen (Physiotherapeut/<strong>in</strong>nen).<br />
Da für Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen ke<strong>in</strong>e gesonderten Beschäftigtendaten vorliegen, müssen hier plausible<br />
Schätzungen vorgenommen werden. Wird davon ausgegangen, dass r<strong>und</strong> ¼ aller Beschäftigten der<br />
Fitnessbranche <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen arbeiten, kann die Beschäftigtenzahl dieser Branche auf r<strong>und</strong><br />
20.000 Personen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen geschätzt werden. Wird ebenfalls e<strong>in</strong>e Quote von ¼ ges<strong>und</strong>heitsrelevanten<br />
Tätigkeiten vorausgesetzt, beläuft sich die Anzahl der Beschäftigten <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen auf ca. 5.000 Personen.<br />
Auf den bestehenden Qualifizierungs- <strong>und</strong> Weiterbildungsbedarf, der durch die zunehmende Tendenz<br />
zur Integration <strong>und</strong> Verknüpfung im Bereich ges<strong>und</strong>heitsbezogener Dienstleistungen entsteht, reagieren<br />
die Industrie- <strong>und</strong> Handelskammern mit zusätzlichen Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungsangeboten <strong>in</strong> diesem<br />
Segment. Die IHK Münster etwa bietet seit e<strong>in</strong>iger Zeit den Weiterbildungslehrgang zum<br />
”Fachwirt für Fitness <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit” an, der sowohl Kompetenzen im kaufmännischen Bereich als<br />
auch im Bereich Ges<strong>und</strong>heit (Prävention <strong>und</strong> Rehabilitation) vermittelt. Zudem bieten <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen die Universitäten Bielefeld <strong>und</strong> Köln die Diplom-Sportstudiengänge mit der Schwerpunktsetzung<br />
Präventions- <strong>und</strong> Rehabilitationssport bzw. Beh<strong>in</strong>dertensport an. Darüber h<strong>in</strong>aus besteht an<br />
der Universität Bochum die Möglichkeit, das Zusatzstudium ”Prävention <strong>und</strong> Rehabilitation durch<br />
Sport” zu absolvieren (vgl. Cachay/Thiel 1999: 47f.).<br />
Die Gütegeme<strong>in</strong>schaft Ges<strong>und</strong>heitssportzentrum e.V. hat die Förderung <strong>und</strong> Qualitätssicherung des<br />
Ges<strong>und</strong>heitssports zum Ziel; sie prüft auf Antrag ges<strong>und</strong>heitsorientierte Fitnesse<strong>in</strong>richtungen nach<br />
festgelegten Qualitätskriterien <strong>und</strong> zeichnet bei erfolgreicher Prüfung die E<strong>in</strong>richtungen mit dem<br />
RAL-Gütezeichen ‚Fitnesszentrum‘ aus. Zu den Qualitätskriterien zählen u.a. Studiennachweise <strong>in</strong><br />
den Bereichen Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gslehre <strong>und</strong> Sportmediz<strong>in</strong>, regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen, das Angebot<br />
e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>dividuellen Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsplanung nach mediz<strong>in</strong>ischen <strong>und</strong> sportwissenschaftlich f<strong>und</strong>ierten<br />
Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsmethoden sowie e<strong>in</strong> ganzheitliches Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsangebot, <strong>in</strong>clusive Herz-Kreislauftra<strong>in</strong><strong>in</strong>g, präventives<br />
Rückentra<strong>in</strong><strong>in</strong>g, Entspannung <strong>und</strong> Gymnastik. In der B<strong>und</strong>esrepublik besitzen derzeit 101<br />
Fitness-Studios das RAL-Zertifikat ”Ges<strong>und</strong>heitszentrum”. Von diesen haben über die Hälfte (52)<br />
ihren Standort <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen.<br />
- 84 -
Zuliefer- <strong>und</strong> Nachbarbranchen<br />
2.6.4. Wellness- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitstourismus<br />
E<strong>in</strong> neuer Trend im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> ist die Verknüpfung von Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistungen <strong>und</strong> touristischen<br />
Angeboten. Gerade <strong>in</strong> Regionen, die durch e<strong>in</strong>e traditionelle Bäder<strong>in</strong>frastruktur geprägt<br />
s<strong>in</strong>d, bietet sich die Integration von Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Tourismusdienstleistungen an, um zusätzliche<br />
private Nachfrage – auch von ausländischen K<strong>und</strong>en - zu mobilisieren. Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen besitzt<br />
mit 39 Kur- <strong>und</strong> Heilbädern e<strong>in</strong>e ausgesprochen starke Bäder-Infrastruktur. Der Ges<strong>und</strong>heitstourismus<br />
bietet neue Möglichkeiten, vor allem <strong>in</strong> den Bereichen Prävention, Rehabilitation <strong>und</strong> Wellness, vorhandene<br />
Arbeitsplätze zu sichern <strong>und</strong> durch <strong>in</strong>novative Angebote neue Beschäftigungsfelder zu erschließen.<br />
Neben der Angebotsseite, lassen sich auch auf der Nachfrageseite e<strong>in</strong>deutige Präferenzen für Ges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>und</strong> Wellness beobachten. Laut e<strong>in</strong>er Studie des Instituts für Freizeitwirtschaft besitzt Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen e<strong>in</strong>e überdurchschnittliche Anzahl an potenziellen Kur- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsurlaubern. Mit<br />
22,9% ist der Anteil an der Zielgruppe der Kururlauber <strong>in</strong> NRW am höchsten, die Reisemotive ”Etwas<br />
für die Ges<strong>und</strong>heit tun”, ”körperliche Bewegung/sportliche Betätigung”, ”Genuss <strong>und</strong> Wohlbef<strong>in</strong>den”<br />
stehen bei dieser Zielgruppe an oberster Stelle (vgl. Institut für Freizeitwirtschaft 1999: 15ff.).<br />
Da die Beschäftigten <strong>in</strong> Kur- <strong>und</strong> Rehabilitationskl<strong>in</strong>iken im Rahmen dieser Studie schon <strong>in</strong> der Statistik<br />
der stationären Versorgung erfasst s<strong>in</strong>d, lassen sich hier lediglich die „sek<strong>und</strong>ären“ Arbeitsplätze<br />
<strong>in</strong> den Beherbergungsbetrieben der nordrhe<strong>in</strong>-westfälischen Kur- <strong>und</strong> Heilbäder ermitteln. Die folgende<br />
Tabelle weist die Anzahl der Beherbergungsbetriebe (e<strong>in</strong>schließlich Sanatorien <strong>und</strong> Krankenhäuser),<br />
der angebotenen Betten sowie der <strong>in</strong>- <strong>und</strong> ausländischen Gästeübernachtungen <strong>in</strong> den Kur- <strong>und</strong><br />
Heilbädern Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalens 1999 aus.<br />
Tab. 44 Tourismus <strong>in</strong> nordrhe<strong>in</strong>-westfälischen Kur- <strong>und</strong> Heilbädern 1999<br />
Geöffnete Betriebe<br />
(Juni<br />
1999)<br />
angebotene<br />
Betten (Juni<br />
1999)<br />
Übernachtungen (Januar-Juni 1999)<br />
<strong>in</strong>sgesamt darunter aus dem Ausland<br />
Hotels 519 22.392 1.212.074 231.343<br />
Gasthöfe 230 4.094 157.310 26.613<br />
Pensionen 481 10.330 508.625 27.916<br />
Hotel garnis 66 2.178 101.891 22.762<br />
Erholungs- <strong>und</strong> Ferienheime<br />
160 11.117 779.541 9.305<br />
Ferienhäuser, Ferienwohnungen<br />
177 6.716 279.771 64.589<br />
Gesamt 1.633 56.827 3.039.212 382.528<br />
Zum Vergleich: Sanatorien,Kurkrankenhäuser<br />
Quelle: LDS; Berechnungen IAT<br />
98 17.759 2.085.771 10.152<br />
Da vom Landesamt für Datenverarbeitung <strong>und</strong> Statistik ke<strong>in</strong>e Beschäftigtenzahlen für die Beherbergungsbetriebe<br />
vorliegen, müssen auch hier Schätzungen vorgenommen werden. Für das Segment der<br />
”klassischen Hotellerie” (Hotels, Gasthöfe, Pensionen <strong>und</strong> Hotel garnis) sowie für das Segment der<br />
sogenannten Parahotellerie (Erholungsheime, Ferienhäuser <strong>und</strong> -wohnungen) <strong>in</strong> den nordrhe<strong>in</strong>-<br />
- 85 -
Zuliefer- <strong>und</strong> Nachbarbranchen<br />
westfälischen Heil- <strong>und</strong> Kurbäderorten lässt sich die Zahl der Beschäftigten schätzen, deren Arbeitsplätze<br />
direkt <strong>und</strong> <strong>in</strong>direkt vom regionalen Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Wellnesstourismus abhängig s<strong>in</strong>d. Dieser<br />
Schätzwert ergibt sich, wenn die Beschäftigtenzahlen gemäß Gastgewerbestatistik von 1997 des Landesamtes<br />
für Datenverarbeitung <strong>und</strong> Statistik NRW (vgl. LDS 1999) zu Gr<strong>und</strong>e gelegt <strong>und</strong> anteilig für<br />
die Beherbergungsbetriebe <strong>in</strong> den Kur- <strong>und</strong> Heilbädern berechnet werden. Somit ergeben sich für die<br />
oben genannten Heilbäder <strong>und</strong> Kurorte <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen folgende Beschäftigtenzahlen:<br />
Tab. 45 Beschäftigte <strong>in</strong> Beherbergungsbetrieben <strong>in</strong> Kur- <strong>und</strong> Heilbädern <strong>in</strong><br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
Beherbergungsbetriebe Beschäftigte<br />
Hotels 6.612<br />
Gasthöfe 646,8<br />
Pensionen 735<br />
Hotel garnis 622,5<br />
Erholungs- <strong>und</strong> Ferienheime k.A.<br />
Ferienhäuser/Ferienwohnungen 146,2<br />
Insgesamt 8.762,5<br />
Quelle: LDS; Berechnungen IAT<br />
Zusätzliche Beschäftigung im Segment des Ges<strong>und</strong>heitstourismus entsteht <strong>in</strong> angrenzenden Bereichen.<br />
Zu den Unternehmen mit direkter touristischer Abhängigkeit zählen etwa die Unternehmen der Personenbeförderung,<br />
Reisemittler <strong>und</strong> –veranstalter sowie die örtlichen Fremdenverkehrsstellen. Zu den<br />
<strong>in</strong>direkt vom Tourismus abhängigen Dienstleistern zählen der E<strong>in</strong>zelhandel vor Ort, Anbieter von<br />
Unterhaltungs-, Kultur- <strong>und</strong> Sportangeboten sowie die Fremdenverkehrsabteilungen der jeweiligen<br />
Gebietskörperschaften (vgl. Hübner/Born 1999: 13). Werden diese zusätzlichen Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
mit berücksichtigt, kann mit e<strong>in</strong>em Beschäftigungspotenzial von r<strong>und</strong> 17.000 direkt oder<br />
<strong>in</strong>direkt im Bereich des Ges<strong>und</strong>heitstourismus Beschäftigten <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen ausgegangen<br />
werden.<br />
Tab. 46 Ausländer-Kurverkehr 1987-1997 (westliche B<strong>und</strong>esländer)<br />
Ausländische Gäste Übernachtungen <strong>in</strong> Tsd. Durchschnittliche<br />
Aufenthaltsdauer<br />
1987 246.522 1.506 6,1<br />
1988 242.356 1.510 6,2<br />
1989 247.211 1.527 6,2<br />
1990 264.940 1.612 6,1<br />
1991 327.511 1.654 5,0<br />
1992 311.393 1.622 5,2<br />
1993 240.818 1.534 6,4<br />
1994 236.027 1.492 6,3<br />
1995 233.854 1.440 6,2<br />
1996 214.260 1.622 7,5<br />
1997 251.988 1.307 5,2<br />
Quelle: Deutscher Bäderverband 1998<br />
Die Übernachtungszahl ausländischer Gäste <strong>in</strong> Kurkl<strong>in</strong>iken <strong>und</strong> Sanatorien Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalens ist<br />
im Verhältnis zu den Übernachtungszahlen <strong>in</strong> anderen Beherbergungsbetrieben deutlich unterreprä-<br />
- 86 -
Zuliefer- <strong>und</strong> Nachbarbranchen<br />
sentiert. Dass hier durchaus weitere Potenziale vorhanden s<strong>in</strong>d, ist aus Tab. 46 ersichtlich, da die<br />
Übernachtungszahl ausländischer Gäste <strong>in</strong> den anderen Beherbergungsbetrieben bei annähernd<br />
400.000 Übernachtungen liegt.<br />
Bei Grönemeyer f<strong>in</strong>det sich e<strong>in</strong> Plädoyer für e<strong>in</strong>e stärkere Verknüpfung regionaler Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong><br />
Touristikangebote: ”Die Entwicklung der Modethemen Ges<strong>und</strong>heit, Lebensqualität, Freizeit, Ökoernährung,<br />
Fitness <strong>und</strong> Sport, Wellness, Beauty usw. weist darauf h<strong>in</strong>, dass K<strong>und</strong>en bereit s<strong>in</strong>d, private<br />
Mittel aufzuwenden, um Ges<strong>und</strong>heit ‚e<strong>in</strong>zukaufen‘. Der Wettbewerb um private Mittel mit verwandten<br />
Branchen, wie dem Tourismus, nimmt zu, aber auch die Kooperationspotenziale steigen. Die<br />
Überw<strong>in</strong>dung der typischen Abkopplung von Kl<strong>in</strong>iken <strong>und</strong> Tourismusstandorten ist als Chance zu<br />
begreifen” (Grönemeyer 2000: 337). Mit zusätzlichen Wellnessangeboten besteht für die Kur- <strong>und</strong><br />
Heilbäder die Möglichkeit, neue Zielgruppen zu erschließen, um somit den Rückgang der Sozialkuren<br />
zu kompensieren (Nahrstedt 1998).<br />
Abb. 21 Entwicklung der Sozialkuren 1975 bis 1997 (westliche B<strong>und</strong>esländer)<br />
2400000<br />
2000000<br />
1600000<br />
1200000<br />
800000<br />
400000<br />
0<br />
1975<br />
1976<br />
1977<br />
1978<br />
1979<br />
1980<br />
1981<br />
1982<br />
1983<br />
1984<br />
1985<br />
1986<br />
1987<br />
1988<br />
- 87 -<br />
1989<br />
1990<br />
1991<br />
1992<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
Zur Kompensation der Rückgänge im Bereich der Sozialkuren wird e<strong>in</strong>e gezielte Förderung des Ges<strong>und</strong>heitsvorsorgetourismus<br />
oder Wellnesstourismus angestrebt. Die Unterschiede zwischen beiden<br />
Formen des Tourismus bestehen vor allem h<strong>in</strong>sichtlich der F<strong>in</strong>anzierungsformen, der Reisemotive der<br />
Kurgäste sowie der <strong>in</strong> Anspruch genommenen Angebote (s. Tab. 47).<br />
Als wesentlich erachten Ges<strong>und</strong>heitsurlauber e<strong>in</strong>e natürliche <strong>und</strong> ges<strong>und</strong>e Umwelt, e<strong>in</strong>e ges<strong>und</strong>e Ernährung,<br />
die Möglichkeit zu ärztlicher Untersuchung <strong>und</strong> Betreuung vor Ort sowie e<strong>in</strong> ausreichendes<br />
Angebot an ges<strong>und</strong>heitsspezifischen Angeboten, etwa im Bereich der Ges<strong>und</strong>heitsbildung (vgl. Lohmann<br />
1997: 37). In Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen hat bislang vor allem der Fremdenverkehrsverband Teutoburger<br />
Wald e.V. se<strong>in</strong>e Anstrengungen <strong>in</strong>tensiviert, den Ges<strong>und</strong>heitsvorsorgetourismus als Ergänzung<br />
des traditionellen Kurangebotes zu etablieren. Mit se<strong>in</strong>en Image-Prospekten Wellness Vital wirbt er für<br />
den Heilgarten Deutschlands. „Mit Golfen im <strong>und</strong> am Teutoburger Wald, mit e<strong>in</strong>er Radroute zwischen<br />
den Kurorten sowie mit besonderen Kulturangeboten wird das neue touristische Kurprodukt<br />
‚Wellness‘ genauer ausgelegt” (Nahrstedt 1998: 156).
Zuliefer- <strong>und</strong> Nachbarbranchen<br />
Tab. 47 Abgrenzungskriterien zwischen Ges<strong>und</strong>heitsvorsorgetourismus <strong>und</strong><br />
Kur/Rehabilitationstourismus<br />
Abgrenzungskriterium Ges<strong>und</strong>heitsvorsorgetourismus Kur/Rehabilitationstourismus<br />
F<strong>in</strong>anzierung Vorwiegend Selbstzahler (z.T. Zusatzversicherungen)<br />
Motivation der Reisenden Ges<strong>und</strong>heitsförderung, primäre Prävention<br />
- 88 -<br />
Mehrheitlich über Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Zusatzversicherungen<br />
Heilung, L<strong>in</strong>derung, sek<strong>und</strong>äre <strong>und</strong> tertiäre<br />
Prävention<br />
Beanspruchte Angebote Bewegung, Ernährung, Entspannung Mediz<strong>in</strong>ische Betreuung<br />
Gästeart Ges<strong>und</strong>e Kranke<br />
Entscheid Eigen<strong>in</strong>itiative/Freiwilligkeit Ärztliche E<strong>in</strong>weisung<br />
Aufenthaltsdauer Wochenende oder 1-2 Wochen M<strong>in</strong>destens 3 Wochen<br />
Ziele Allgeme<strong>in</strong>es Wohlbef<strong>in</strong>den Vom Arzt def<strong>in</strong>iert<br />
Quelle: Lanz/Kaufmann 1999: 61; leicht modifiziert<br />
2.6.5. Beratung, Consult<strong>in</strong>g <strong>und</strong> Information<br />
Unsere (vorsichtigen) Schätzungen für den Sektor Beratungs- <strong>und</strong> Informationsdienstleistungen für<br />
das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> gehen von ca. 1.000 Beschäftigten aus. Nach Angaben des B<strong>und</strong>esverbandes<br />
Deutscher Unternehmensberater (BDU) erzielte die Consult<strong>in</strong>g-Branche 1997 12% ihres Umsatzes<br />
durch die Beratung von E<strong>in</strong>richtungen des Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Sozialwesens (BDU 1998). E<strong>in</strong>ige Beratungsfirmen<br />
haben sich ausschließlich auf die Beratung von Krankenhäusern, Kl<strong>in</strong>iken <strong>und</strong> Pflegediensten<br />
spezialisiert. Mit der Bedeutungszunahme betriebswirtschaftlicher Orientierungen wird der<br />
Bedarf an professioneller Beratung <strong>und</strong> Unterstützung vermutlich weiter steigen.<br />
2.6.6. Service-Dienstleistungen für mehr Lebensqualität<br />
Vorsichtige Schätzungen gehen von m<strong>in</strong>destens 1.500 Beschäftigten im Bereich der Dienstleistungen<br />
für mehr Lebensqualität aus. Diese Zahl ist jedoch als Untergrenze zu betrachten, es ist wahrsche<strong>in</strong>lich<br />
e<strong>in</strong> höherer Beschäftigungsumfang anzunehmen. Da <strong>in</strong> der amtlichen Statistik ke<strong>in</strong>e Differenzierung<br />
nach E<strong>in</strong>richtungen vorgenommen wird, lassen sich hier auch ke<strong>in</strong>e präzisen Aussagen über das Ausmaß<br />
der Beschäftigung <strong>in</strong> den E<strong>in</strong>richtungen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s treffen.<br />
Zu den Service-Dienstleistungen lassen sich zählen:<br />
• Kosmetische Pflege: Fußpflege/Maniküre/Friseure (hier handelt es sich ausschließlich um personenbezogene<br />
Dienstleistungen <strong>in</strong> den E<strong>in</strong>richtungen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s)<br />
• Hausnotrufdienste<br />
• Essen auf Rädern
2.6.7. Selbsthilfe<br />
Zuliefer- <strong>und</strong> Nachbarbranchen<br />
Die beschäftigungspolitische Relevanz von ges<strong>und</strong>heitsbezogener Selbsthilfe wird bislang kaum thematisiert.<br />
Mit Blick auf die wachsende Zahl von Selbsthilfegruppen – Mitte der 90er Jahre waren r<strong>und</strong><br />
2,65 Millionen Menschen <strong>in</strong> r<strong>und</strong> 67.500 Selbsthilfegruppen organisiert - ist jedoch davon auszugehen,<br />
dass <strong>in</strong> diesen Bereichen sowohl durch Hauptamtlichentätigkeit - vor allem <strong>in</strong> den kommunalen<br />
Selbsthilfekontaktstellen (KISS) - als auch durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen <strong>und</strong> durch Honorartätigkeiten<br />
neue Beschäftigungsperspektiven erschlossen werden können. ”E<strong>in</strong> weiteres Wachstum<br />
<strong>in</strong> der Ges<strong>und</strong>heitsselbsthilfe sche<strong>in</strong>t nicht unwahrsche<strong>in</strong>lich, nicht zuletzt, da die Selbsthilfeorganisationen<br />
zur Professionalisierung drängen <strong>und</strong> z.T. auch gedrängt werden” (Hilbert/Ittermann 1998:<br />
32).<br />
Aktuellen Schätzungen zufolge ist b<strong>und</strong>esweit mit m<strong>in</strong>destens 10.000 Arbeitsplätzen zu rechnen, unter<br />
der Annahme, dass auf 1.000.000 Menschen m<strong>in</strong>destens 100 Arbeitsplätze durch Selbsthilfe entstehen.<br />
Da sich die Selbsthilfegruppen nach wie vor <strong>in</strong> starkem Maße auf die westlichen B<strong>und</strong>esländer konzentrieren,<br />
kann von m<strong>in</strong>destens 2.500 Arbeitsplätzen durch Selbsthilfe <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen ausgegangen<br />
werden. In diese Schätzung mit e<strong>in</strong>bezogen s<strong>in</strong>d Beschäftigte bei den B<strong>und</strong>es-, Landes- <strong>und</strong><br />
Kommunalstellen der Selbsthilfeorganisationen, Beschäftigte <strong>in</strong> den Unterstützungse<strong>in</strong>richtungen für<br />
Selbsthilfe, Beschäftigte <strong>in</strong> der Selbsthilfeförderung bei den kommunalen Ges<strong>und</strong>heitsämtern, die<br />
Mitarbeiter <strong>in</strong> den Wohlfahrtsverbänden sowie Beschäftigungseffekte, die aus der Nachfrage von<br />
Selbsthilfegruppen oder –organisationen resultieren.<br />
2.6.8. Zusammenfassung <strong>und</strong> Interpretation<br />
Insgesamt stellt sich die Beschäftigungssituation <strong>in</strong> den Zuliefer<strong>in</strong>dustrien <strong>und</strong> Nachbarbranchen des<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s wie folgt dar: Als beschäftigungs<strong>in</strong>tensivste Branche erweisen sich das Ges<strong>und</strong>heitshandwerk<br />
mit 39.038 Beschäftigten (28,1%) sowie die pharmazeutische Industrie mit 28.000<br />
Beschäftigten (20,1%). Die Mediz<strong>in</strong>- <strong>und</strong> Gerontotechnik erreicht mit 20.000 Beschäftigten immerh<strong>in</strong><br />
noch e<strong>in</strong>en Anteil von 14,4%. Weniger Beschäftigte vere<strong>in</strong>igen die Nachbarbranchen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s<br />
(Fitness, Beratung, Service-Dienstleistungen für mehr Lebensqualität) auf sich, wenngleich<br />
der Ges<strong>und</strong>heitstourismus mit 12,2% bzw. r<strong>und</strong> 17.000 Beschäftigten e<strong>in</strong> ähnlich hohes Beschäftigungsniveau<br />
erreicht wie die mediz<strong>in</strong>- <strong>und</strong> gerontotechnische Industrie.<br />
- 89 -
Zuliefer- <strong>und</strong> Nachbarbranchen<br />
Tab. 48 Gesamtbild: Beschäftigung <strong>in</strong> den Zuliefer<strong>in</strong>dustrien <strong>und</strong> Nachbarbranchen 1998<br />
Branche<br />
Beschäftigte<br />
absolut <strong>in</strong> % Tendenz<br />
Pharmazeutische Industrie 28.000 20,13 stagnierend<br />
Mediz<strong>in</strong>technik 20.000 14,38 Untergrenze<br />
Biotechnologie 6.000 4,31 leicht steigend<br />
Fache<strong>in</strong>zelhandel mit mediz<strong>in</strong>ischen Produkten 4.000 2,88<br />
Großhandel mit mediz<strong>in</strong>ischen Produkten 15.055 10,82<br />
Ges<strong>und</strong>heitshandwerk 39.038 28,07 steigend<br />
Fitness <strong>und</strong> Freizeit 5.000 3,59 steigend<br />
Ges<strong>und</strong>heitstourismus 17.000 12,22 Untergrenze<br />
Beratung, Consult<strong>in</strong>g <strong>und</strong> Information ca. 1000 0,72<br />
Service-Dienstleistungen ca. 1.500 1,08<br />
Selbsthilfe ca. 2.500 1,80 Untergrenze<br />
Gesamt 139.093 100 steigend<br />
Quelle: IAT<br />
Allerd<strong>in</strong>gs f<strong>in</strong>den sich für die e<strong>in</strong>zelnen Arbeitsfelder <strong>und</strong> Branchen z.T. recht unterschiedliche Trends<br />
<strong>und</strong> E<strong>in</strong>flussfaktoren der Beschäftigungsentwicklung, die im Folgenden e<strong>in</strong>gehender behandelt werden.<br />
So wirkt sich z.B. die Kostendämpfungspolitik beschäftigungshemmend auf die pharmazeutische<br />
Industrie aus, da diese e<strong>in</strong>em enormen Rationalisierungsdruck ausgesetzt ist. Dennoch ist die Pharma-<br />
Industrie durch ihren hohen Dienstleistungsanteil (Forschung <strong>und</strong> Entwicklung, Market<strong>in</strong>g) bislang<br />
wenig vom Personalabbau im produzierenden Gewerbe betroffen. Besonders problematisch für die<br />
Beschäftigung ist die geplante „Positiv-Liste“ für Medikamente e<strong>in</strong>zuschätzen, da mit e<strong>in</strong>em weiteren<br />
Rückgang der Nachfrage nach verschreibungspflichtigen Medikamenten gerechnet wird, der nur teilweise<br />
durch e<strong>in</strong>en Anstieg der Selbstmedikation kompensiert werden kann.<br />
Der steigende Bedarf an Mediz<strong>in</strong>- <strong>und</strong> vor allem an Gerontotechnik hat sich positiv auf die Beschäftigungssituation<br />
<strong>in</strong> der mediz<strong>in</strong>technischen Industrie ausgewirkt. Dieser Trend wird aufgr<strong>und</strong> des demographischen<br />
Wandels, Produkt<strong>in</strong>novationen <strong>und</strong> Verknüpfungen von Technik <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
weiterh<strong>in</strong> anhalten. Die hohe Exportquote sowohl der Mediz<strong>in</strong>techik als auch der pharmazeutischen<br />
Industrie haben maßgeblich zum Wachstum dieser Branchen beigetragen. Das Wachstum der Biotechnologie<br />
hat vor allem <strong>in</strong>direkte Auswirkungen auf die Beschäftigung <strong>in</strong> der pharmazeutischen Industrie.<br />
Produkt<strong>in</strong>novationen, die durch die Biotechnologie möglich werden, gehen zum e<strong>in</strong>en als Prozess<strong>in</strong>novationen<br />
<strong>in</strong> diesen Sektor e<strong>in</strong> (biotechnologische Verfahren für neue Medikamente), aber auch<br />
als Produkt<strong>in</strong>novationen.<br />
Generell f<strong>in</strong>det sich heute e<strong>in</strong>e zunehmende Bereitschaft, private Mittel für ges<strong>und</strong>heitsbezogene<br />
Dienstleistungen <strong>in</strong> den Bereichen Fitness, Wellness, Ges<strong>und</strong>heitstourismus <strong>und</strong> Selbstmedikation<br />
aufzuwenden. Produkt<strong>in</strong>novationen, etwa die Verknüpfung von Technik <strong>und</strong> Dienstleistungen, führen<br />
zu neuen Angeboten, die zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnen. Dies gilt beispielsweise<br />
für Service-Dienstleistungen, Kommunikationsdienstleistungen etc.<br />
Das Wachstum der Wellness-Angebote lässt sich auch darauf zurückführen, dass viele Kur- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
Personal abbauen. Durch den Rückgang der Sozialkurgäste besteht die<br />
Notwendigkeit, neue <strong>und</strong> <strong>in</strong>novative Angebote zu entwickeln, um neue K<strong>und</strong>engruppen zu erreichen.<br />
Dies bedeutet freilich, dass die Bedeutungszunahme von Wellness-Angeboten letztendlich e<strong>in</strong>e Verschiebung<br />
vom Kur- <strong>und</strong> Rehabereich <strong>in</strong> den Wellnessbereich darstellt.<br />
- 90 -
Exkurs: Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
2.7. Exkurs: Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> 48<br />
Die bisherigen Ausführungen haben sehr deutlich gezeigt, dass das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> durch e<strong>in</strong>en<br />
hohen Anteil an weiblichen Beschäftigten gekennzeichnet ist. Dementsprechend haben der Ausbau<br />
von Beschäftigungsmöglichkeiten wie restriktive Rahmenbed<strong>in</strong>gungen direkte Auswirkungen auf die<br />
Frauenerwerbstätigkeit <strong>in</strong> NRW. Vor diesem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> beschäftigen sich die nachfolgenden Ausführungen<br />
e<strong>in</strong>gehender mit den geschlechtsspezifischen Implikationen des <strong>Arbeitsmarkt</strong>es <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>.<br />
In Bezug auf die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung bestehen deutliche Unterschiede <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen<br />
Sektoren der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft. Die auffallendsten Unterschiede verlaufen entlang der L<strong>in</strong>ie<br />
zwischen akademischen <strong>und</strong> nichtakademischen Qualifikationen (s. Tab. 49).<br />
Tab. 49 Akademische <strong>und</strong> nichtakademische Berufe im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
Akademische Ges<strong>und</strong>heitsfachberufe Nichtakademische Ges<strong>und</strong>heitsfachberufe<br />
Ärzt<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ärzte Berufe <strong>in</strong> der Primärversorgung<br />
Zahnärzt<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Zahnärzte Diagnostisch-technische Berufe<br />
Pharmazeut<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Pharmazeuten Pflegeberufe<br />
Apotheker<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Apotheker Therapeutisch-rehabilitative Berufe<br />
Psycholog<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Psychologen Präventionsberufe<br />
Ges<strong>und</strong>heitswissenschaftler<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitswissen- Berufe des Ges<strong>und</strong>heitshandwerks<br />
schaftler Körperpflegeberufe<br />
Seit e<strong>in</strong>igen Jahren auch Pflegewissenschaft <strong>und</strong> Pflegemanagement<br />
Sonstige akademische Berufe wie Mediz<strong>in</strong><strong>in</strong>formatiker/<strong>in</strong>nen<br />
oder Krankenhausbetriebswirtschaftler/<strong>in</strong>nen<br />
Ges<strong>und</strong>heitsverwaltungsberufe<br />
So ist der Frauenanteil <strong>in</strong> den akademischen Ges<strong>und</strong>heitsfachberufen, die mit höheren E<strong>in</strong>kommens<strong>und</strong><br />
Karrierechancen ausgestattet s<strong>in</strong>d, wesentlich ger<strong>in</strong>ger als <strong>in</strong> den nichtakademischen Ges<strong>und</strong>heitsfachberufen<br />
(mit ger<strong>in</strong>geren E<strong>in</strong>kommens- <strong>und</strong> Karrierechancen): „Die akademischen Ges<strong>und</strong>heitsdienstberufe<br />
s<strong>in</strong>d noch immer e<strong>in</strong>e Männerdomäne. Außerdem ist hier der Anteil der Teilzeit- <strong>und</strong><br />
ger<strong>in</strong>gfügig Beschäftigten mit 11,7% sehr viel niedriger als bei allen Erwerbstätigen im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
(25,0%)“ (Statistisches B<strong>und</strong>esamt 1998).<br />
Insgesamt beträgt der Frauenanteil <strong>in</strong> den fünf dom<strong>in</strong>ierenden akademischen Berufen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s<br />
(Ärzt<strong>in</strong>nen, Zahnärzt<strong>in</strong>nen, Apotheker<strong>in</strong>nen, Sozialarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Psycholog<strong>in</strong>nen)<br />
etwas mehr als e<strong>in</strong> Drittel (35,8%). In Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sgesamt ca. 33.300 Frauen <strong>in</strong> den<br />
akademischen Berufen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s beschäftigt; die Zahl der Männer beträgt <strong>in</strong> diesen Berufen<br />
ca. 59.800. Den höchsten Frauenanteil stellen die Sozialarbeiter<strong>in</strong>nen mit 67,5%, danach folgen<br />
48 Der Exkurs stellt die Zusammenfassung e<strong>in</strong>er ausführlichen Studie zur geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung<br />
im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> dar, die von Paul Wolters, Sab<strong>in</strong>e Voelker <strong>und</strong> Norbert Nothbaum, Fakultät für<br />
Ges<strong>und</strong>heitswissenschaften, Universität Bielefeld im Auftrag der Projektnehmer erstellt worden ist.<br />
- 91 -
Exkurs: Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
mit Anteilen von jeweils über 50% Apotheker<strong>in</strong>nen, Kieferorthopäd<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Psycholog<strong>in</strong>nen. Bei<br />
den Ärzt<strong>in</strong>nen liegt der Frauenanteil bei 32,4%; er ist mit 22,3% unter den Ärzt/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> freier Praxis<br />
am ger<strong>in</strong>gsten, mit 45,0% bei den Ärzt/<strong>in</strong>nen ohne ärztliche Tätigkeit am höchsten.<br />
Dagegen beträgt der Frauenanteil <strong>in</strong> ausgewählten nichtakademischen Ges<strong>und</strong>heitsberufen (s. Tab. 50)<br />
<strong>in</strong>sgesamt 84,7%; der Anteil der weiblichen Beschäftigten ist damit mehr als doppelt so hoch wie im<br />
akademischen Bereich. Zu den fast ausschließlich von Frauen ausgeübten Berufen (d.h. Berufe mit<br />
e<strong>in</strong>em Frauenanteil von über 95%) zählen Sprechst<strong>und</strong>enhelfer<strong>in</strong>nen, Hebammen, Diätassistent<strong>in</strong>nen,<br />
K<strong>in</strong>derkrankenschwestern, mediz<strong>in</strong>isch-technische Assistent<strong>in</strong>nen sowie mediz<strong>in</strong>isch-technische Laborassistent<strong>in</strong>nen.<br />
Bei den Krankenschwestern <strong>und</strong> -pflegern <strong>in</strong>sgesamt liegt der Frauenanteil bei<br />
84,0%. Der niedrigste Frauenanteil f<strong>in</strong>det sich mit 48,4% bei den Masseur<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> mediz<strong>in</strong>ischen<br />
Bademeister<strong>in</strong>nen.<br />
Tab. 50 Frauenanteile <strong>in</strong> ausgewählten Berufsgruppen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s<br />
Berufsgruppe<br />
Frauen<br />
Männer<br />
absolut <strong>in</strong> %<br />
Krankenschwestern/ -pfleger 61.786 84,3 11.508<br />
Ärzt/<strong>in</strong>nen gesamt 21.305 32,41 43.438<br />
K<strong>in</strong>derkrankenschwestern, -pfleger 9.532 99,06 91<br />
Ärzt/<strong>in</strong>nen im Krankenhaus 8.649 31,79 18.071<br />
Sonstiges Krankenpflegepersonal 8.594 70,04 3.690<br />
Krankenpflegehelfer/<strong>in</strong>nen 7.829 84,65 1.423<br />
Apotheker/<strong>in</strong>nen gesamt 6.241 57,17 4.674<br />
Med.-techn. Laborassistent/<strong>in</strong>nen 5.768 96,49 44<br />
Apotheker/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> öffentlichen Apotheken 5.629 59,21 3.876<br />
Ärzt/<strong>in</strong>nen ohne ärztliche Tätigkeit 5.538 45,04 6.826<br />
Ärzt/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> freier Praxis 4.561 22,34 15.550<br />
Zahnärzt/<strong>in</strong>nen gesamt 4.485 29,27 10.837<br />
Med.-techn. Radiologieassistent/<strong>in</strong>nen 3.367 92,80 261<br />
Ärzt/<strong>in</strong>nen mit sonstiger ärztlicher Tätigkeit 2.557 44,65 2.992<br />
Zahnärzt/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> freier Praxis 2.311 24,04 7.301<br />
Krankengymnast/<strong>in</strong>nen 2.224 82,50 475<br />
Hebammen 2.035 99,99 --<br />
Zahnärzt/<strong>in</strong>nen ohne zahnärztliche Tätigkeit 1.099 33,86 2.147<br />
Zahnärzt/<strong>in</strong>nen sonstige Tätigkeit 965 46,36 1.117<br />
Med.-techn. Assistent/<strong>in</strong>nen 962 95,60<br />
Ergotherapeut/<strong>in</strong>nen 953 64,87 517<br />
Diätassistent/<strong>in</strong>nen 933 98,04 19<br />
Sozialarbeiter/<strong>in</strong>nen 802 67,50 387<br />
Masseur/<strong>in</strong>nen, med. Bademeister/<strong>in</strong>nen 748 48,44 797<br />
Psycholog/<strong>in</strong>nen 495 52,75 443<br />
Apotheker/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> sonstigen Bereichen 368 38,79 580<br />
Zahnärzt/<strong>in</strong>nen, Kieferorthopäd/<strong>in</strong>nen 293 50,31 289<br />
Apotheker/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> Krankenhäusern 244 52,88 218<br />
Logopäd/<strong>in</strong>nen 188 87,00 28<br />
Zahnärzt/<strong>in</strong>nen im Krankenhaus 120 31,31 263<br />
Heilpädagog/<strong>in</strong>nen 105 81,86 23<br />
Zytologieassistent<strong>in</strong>nen 41 92,26 --<br />
Die vorstehende Tabelle zeigt im Überblick die absolute <strong>und</strong> relative Zahl der weiblichen Beschäftigten<br />
<strong>in</strong> den verschiedenen Berufsgruppen. Da für die verschiedenen Bereiche Daten aus je unterschied-<br />
- 92 -
Exkurs: Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
lichen Jahren vorliegen, s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> dieser Tabelle als „bester vergleichbarer Schätzer“ jeweils die Mittelwerte<br />
der Daten aus allen vorliegenden Jahren aufgeführt.<br />
2.7.1. Qualifikation, E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> Aufstiegschancen<br />
Die überproportionale Beschäftigung von Frauen <strong>in</strong> den nichtakademischen Ges<strong>und</strong>heitsberufen impliziert<br />
wesentlich ger<strong>in</strong>gere E<strong>in</strong>kommens- <strong>und</strong> Aufstiegschancen. Selbst im akademischen Bereich<br />
arbeiten Frauen stärker <strong>in</strong> den unterdurchschnittlich entlohnten Bereichen, etwa im öffentlichen Ges<strong>und</strong>heitsdienst.<br />
Die Karriere- <strong>und</strong> Aufstiegsmöglichkeiten <strong>in</strong> den nichtakademischen Berufen s<strong>in</strong>d wesentlich ger<strong>in</strong>ger<br />
als <strong>in</strong> den akademischen Berufen. Für Krankenschwestern etwa steht als Endpunkt der normalen Kl<strong>in</strong>iklaufbahn<br />
die Pflegeleitung e<strong>in</strong>er Station. Zusätzlich hierzu besteht lediglich die Möglichkeit, durch<br />
Weiterqualifizierungs- <strong>und</strong> Fortbildungsmaßnahmen verschiedene Spezialisierungen zu erwerben. Die<br />
Möglichkeiten e<strong>in</strong>er Universitätslaufbahn (zumeist an Fachhochschulen) wurden erst seit wenigen<br />
Jahren entwickelt.<br />
Den Angehörigen der akademischen Ges<strong>und</strong>heitsberufe h<strong>in</strong>gegen steht die Universitätslaufbahn<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich offen. Neben der normalen Kl<strong>in</strong>iklaufbahn – an deren Ende die Position des Chefarztes<br />
steht – besteht für Ärzte die Möglichkeit, weitere Tätigkeitsbereiche zu erschließen, etwa <strong>in</strong> den Bereichen<br />
Mediz<strong>in</strong><strong>in</strong>formatik, Forschung <strong>und</strong> Entwicklung, Market<strong>in</strong>g <strong>und</strong> Vertrieb, pharmazeutische<br />
Industrie oder Kl<strong>in</strong>ikmanagement. Zusätzlich steht den Angehörigen der akademischen Berufe die<br />
freiberufliche Tätigkeit offen. Frauen <strong>in</strong> akademischen Professionen erreichen allerd<strong>in</strong>gs nur äußerst<br />
selten privilegierte Positionen. So s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen lediglich 4% der Chefarztstellen <strong>und</strong><br />
2% der Lehrstühle mit Frauen besetzt (Wolters 1999).<br />
Derzeit lassen sich jedoch Tendenzen sowohl e<strong>in</strong>er politisch gesteuerten als auch e<strong>in</strong>er schleichenden<br />
Aufwertung der nichtakademischen Ges<strong>und</strong>heitsfachberufe beobachten. Durch die Akademisierung<br />
der Pflegeberufe, die politisch durch die E<strong>in</strong>richtung diverser Studiengänge für Pflege, Pflegemanagement<br />
oder Pflegepädagogik gefördert wird, verbessern sich die Karriere- <strong>und</strong> E<strong>in</strong>kommenschancen<br />
der überwiegend weiblichen Pflegekräfte. Dieser Prozess steht <strong>in</strong> Deutschland jedoch erst an se<strong>in</strong>em<br />
Anfang, wie der Vergleich mit den Niederlanden zeigt (s. Kap. 5.2). Neben die Akademisierung der<br />
Pflege werden Prozesse der Professionalisierung nichtärztlicher Berufe treten, die zu e<strong>in</strong>er Aufwertung<br />
dieser Tätigkeiten beitragen. Schon heute ist absehbar, dass sich die Arbeitsteilung zwischen<br />
ärztlichem <strong>und</strong> nichtärztlichem Personal weiter zugunsten letzterem verschieben wird. Der Prozess der<br />
Aufwertung nichtakademischer <strong>und</strong> paramediz<strong>in</strong>ischer Berufe wird sich allerd<strong>in</strong>gs nur dann positiv<br />
auf die Beschäftigungssituation von Frauen auswirken, wenn er gleichzeitig von entsprechenden Arbeits-<br />
<strong>und</strong> Ausbildungsformen begleitet wird, die den Besonderheiten der weiblichen Erwerbsbiographien<br />
Rechnung tragen. Die Professionalisierung der Frauenarbeit im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> hat bislang<br />
nur <strong>in</strong> ger<strong>in</strong>gem Maße zu e<strong>in</strong>er Aufwertung weiblicher Tätigkeiten geführt: „Schlechte Entlohnung,<br />
e<strong>in</strong>geschränkte soziale Sicherung, ger<strong>in</strong>ge Karrierechancen, Schichtarbeit sowie hohe physische <strong>und</strong><br />
psychische Belastungen spielen weiterh<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e große Rolle. Nach e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>samen Erhebung vom<br />
B<strong>und</strong>es<strong>in</strong>stitut für Berufsbildung <strong>und</strong> dem Institut für <strong>Arbeitsmarkt</strong>- <strong>und</strong> Berufsforschung <strong>in</strong> den Jah-<br />
- 93 -
Exkurs: Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
ren 1991/92 liegt zum Beispiel das monatliche Bruttoe<strong>in</strong>kommen <strong>in</strong> den Ges<strong>und</strong>heitsdienstberufen<br />
ohne Ärzt<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ärzte im Vergleich zum Durchschnittskennwert 100 bei 84%“ (Fuz<strong>in</strong>ski u.a.<br />
1997: 191).<br />
Die weitere Entwicklung der Beschäftigungssituation von Frauen wird entscheidend von der Entwicklung<br />
der Aus-, Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung abhängen. Aus Sicht der (zukünftigen) weiblichen Beschäftigten<br />
wird es von zentraler Bedeutung se<strong>in</strong>, dass Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungsmodelle entwickelt<br />
werden, die wirkliche Karriere- <strong>und</strong> Aufstiegsmöglichkeiten eröffnen. Zum Teil s<strong>in</strong>d bereits Modifikationen<br />
<strong>in</strong> den Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungskonzepten sichtbar, zum Teil werden derzeit erste Reformmodelle<br />
entwickelt. Beispiele hierfür s<strong>in</strong>d etwa die derzeitigen Veränderungen im Rahmen der Krankenpflegeausbildung<br />
mit geme<strong>in</strong>samer Gr<strong>und</strong>ausbildung <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>jährigen Spezialisierung oder<br />
die E<strong>in</strong>richtung von pflegewissenschaftlichen Studiengängen an Fachhochschulen <strong>und</strong> Universitäten.<br />
Für die heute im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> beschäftigten Frauen ist jedoch zu erwarten, dass der steigende<br />
Kostendruck zu sich weiter verschärfenden Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen führen wird. Dies drückt sich etwa <strong>in</strong><br />
Stellenstreichungen, E<strong>in</strong>sparungen oder dem E<strong>in</strong>satz niedrig qualifizierter Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen für höher<br />
qualifizierte Tätigkeiten bei nicht tätigkeitsangemessener Vergütung aus.<br />
Der hohe Innovationsbedarf im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> <strong>in</strong> Richtung Effizienz <strong>und</strong> Qualität wird für die<br />
Beschäftigten wachsende Anforderungen an ihr Engagement, ihre Qualifikation <strong>und</strong> ihre Flexibilität<br />
stellen. Von dieser Entwicklung profitieren werden jene Frauen, die die Möglichkeit e<strong>in</strong>er zusätzlichen<br />
Qualifizierung erhalten <strong>und</strong> die bereit s<strong>in</strong>d, diese Qualifikationsmöglichkeiten auch dann zu nutzen,<br />
wenn dies e<strong>in</strong>en Wechsel <strong>in</strong> typische Männerdomänen bedeutet bzw. die aufgr<strong>und</strong> ihres privaten Umfeldes<br />
oder aufgr<strong>und</strong> gezielter Förderung berufliche <strong>und</strong> private Anforderungen vere<strong>in</strong>baren können.<br />
Von den Vorteilen dieser Entwicklung abgeschnitten s<strong>in</strong>d Frauen mit K<strong>in</strong>dern, die nur halbtags arbeiten<br />
können oder wollen, sowie Frauen, die e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>geres Qualifikationsniveau aufweisen <strong>und</strong> Fortbildungsmöglichkeiten<br />
nicht erhalten bzw. nur unzureichend nutzen oder nutzen können.<br />
Günstige Arbeitsperspektiven für Frauen könnten sich auch aus der Entwicklung ergeben, dass neben<br />
den öffentlichen <strong>und</strong> halböffentlich getragenen Leistungen auch privat f<strong>in</strong>anzierte Angebote mit Ges<strong>und</strong>heitsbezug<br />
an Bedeutung gew<strong>in</strong>nen. Sie bieten neue <strong>und</strong> wahrsche<strong>in</strong>lich wachsende Beschäftigungsmöglichkeiten.<br />
Zusätzlich bieten sich Möglichkeiten zu <strong>in</strong>novativen Existenzgründungen, die<br />
bereits heute von vielen Frauen wahrgenommen werden. Allerd<strong>in</strong>gs ist die Beschäftigungssicherheit <strong>in</strong><br />
diesen neuen Berufsfeldern nicht mehr <strong>in</strong> gleichem Maße gegeben wie im traditionellen Bereich des<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s.<br />
Diese Entwicklung stellt an weibliche Beschäftigte die Anforderung, auch neue Fachgebiete zu erschließen<br />
- den E<strong>in</strong>satz von Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnologien im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>,<br />
Projektmanagement oder betriebswirtschaftliches Know-how. Auch im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> werden<br />
qualifizierte Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen im Verlauf ihres Berufslebens zunehmend häufiger zwischen den verschiedenen<br />
Bereichen wechseln (müssen). Dies bedeutet zwar, wie <strong>in</strong> anderen Wirtschaftsbereichen<br />
ebenfalls zu beobachten ist, den Verlust e<strong>in</strong>er lebenslangen Perspektive bei e<strong>in</strong>em Arbeitgeber. Diese<br />
Entwicklung kann aber auch als Chance begriffen werden, um das Qualifikationsniveau der Beschäftigten<br />
weiter auszubauen.<br />
- 94 -
Exkurs: Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
Über das Existenzgründungsgeschehen <strong>in</strong> der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft liegen bislang ke<strong>in</strong>e verläßlichen<br />
statistischen Daten vor. Mit Rückgriff auf die Statistik der Deutschen Ausgleichsbank lassen sich dennoch<br />
e<strong>in</strong>ige Trendaussagen treffen. So lässt sich zeigen, dass die Zahl der Förderzusagen <strong>in</strong> der nordrhe<strong>in</strong>-westfälischen<br />
Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Sozialwirtschaft seit 1994 kont<strong>in</strong>uierlich gestiegen ist, seither<br />
bewegt sich der Anteil der Förderzusagen <strong>in</strong> diesem Bereich zwischen 8,5% <strong>und</strong> 10,9% am Fördervolumen<br />
der Deutschen Ausgleichsbank. 1990 weist die deutsche Ausgleichsbank 385 Förderzusagen<br />
aus, 1994 erhöhte sich die Zahl auf 702 <strong>und</strong> stieg bis 1999 kont<strong>in</strong>uierlich auf 1605 Förderzusagen an.<br />
Auch die <strong>in</strong>terne Verteilung im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> ist aufschlussreich. Während die Förderzusagen <strong>in</strong><br />
den Segmenten Apotheken, Fache<strong>in</strong>zelhandel, Arzt- <strong>und</strong> Zahnarztpraxen e<strong>in</strong> ‚durchschnittliches‘<br />
Wachstum aufweisen, ist die Zunahme im Segment „<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>/ andere nicht genannte“ überdurchschnittlich<br />
hoch. Hierzu zählen neben ambulanten Pflegediensten auch therapeutische E<strong>in</strong>richtungen.<br />
Nach Schätzungen von Unternehmensberater<strong>in</strong>nen beim G.I.B.-Workshop „Existenzgründungen<br />
im Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Sozialbereich“ beträgt der Anteil der weiblichen Existenzgründer r<strong>und</strong> 70%.<br />
Es ist zu vermuten, dass sich Existenzgründer<strong>in</strong>nen nicht überwiegend <strong>in</strong> den traditionellen Sektoren<br />
der ambulanten Ges<strong>und</strong>heitsversorgung engagieren, sondern <strong>in</strong> den Randbereichen <strong>und</strong> Nachbarbranchen,<br />
hier vor allem im Bereich der alternativen Mediz<strong>in</strong> <strong>und</strong> im therapeutischen Sektor.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der unzureichenden Datengr<strong>und</strong>lage lassen sich nur sehr begrenzt Aussagen über die zukünftige<br />
Entwicklung ableiten. Deshalb sollen abschließend zwei mögliche Entwicklungspfade umrissen<br />
werden. Im Status-quo-Szenario, d.h. bei unveränderten Rahmenbed<strong>in</strong>gungen, wird sich die Zahl<br />
der Existenzgründer<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> absehbarer Zeit vermutlich nicht wesentlich erhöhen. Im alternativen<br />
Reform-Szenario h<strong>in</strong>gegen, das sich an den Erfahrungen <strong>in</strong> den Niederlanden (s. Kap. 5.2) orientiert,<br />
könnte die Zahl der Existenzgründer<strong>in</strong>nen erheblich zunehmen. Dies setzt jedoch veränderte politische<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> Gewichtsverschiebungen zwischen den Berufsgruppen im Ges<strong>und</strong>heitssektor<br />
sowie e<strong>in</strong>e stärker an betriebwirtschaftlichen Erfordernissen orientierte Qualifikation der Existenzgründer<strong>in</strong>nen<br />
voraus.<br />
Status-quo-Szenario: Wie gezeigt, s<strong>in</strong>d die Ausgaben der Deutschen Ausgleichsbank im Bereich der<br />
Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Sozialwirtschaft im Vergleich mit anderen Förderbereichen recht hoch. Da angesichts<br />
politischer <strong>und</strong> f<strong>in</strong>anzieller Restriktionen nicht mit e<strong>in</strong>er Ausweitung der GKV-getragenen Leistungen<br />
zu rechnen ist, werden sich Existenzgründer/<strong>in</strong>nen – aber auch die etablierten Anbieter/<strong>in</strong>nen -<br />
<strong>in</strong> den Kernbereichen der Ges<strong>und</strong>heitsversorgung e<strong>in</strong>em zunehmenden Wettbewerb um knappe Ressourcen<br />
ausgesetzt sehen. Für weibliche Existenzgründer, die überwiegend <strong>in</strong> den nachgeordneten<br />
Leistungsbereichen tätig s<strong>in</strong>d, erschwert die ärztliche Schlüsselstellung zusätzlich e<strong>in</strong>e Marktpositionierung,<br />
da pflegerische <strong>und</strong> therapeutische Berufsgruppen vom Überweisungsverhalten <strong>und</strong> der Kooperationsbereitschaft<br />
der Ärzteschaft abhängen. Unter diesen Bed<strong>in</strong>gungen – Ausgabendeckelung<br />
<strong>und</strong> ärztliche Schlüsselstellung – s<strong>in</strong>d die Ausgangsbed<strong>in</strong>gungen für e<strong>in</strong>e erfolgreiche Existenzgründung<br />
denkbar ungünstig. Erfolgversprechender s<strong>in</strong>d dagegen Gründungen <strong>in</strong> den Randbereichen <strong>und</strong><br />
Nachbarbranchen, die nicht der Budgetierung unterliegen <strong>und</strong> Spielräume für unternehmerisches Handeln<br />
eröffnen. Um unter den heute schon absehbaren Wettbewerbsbed<strong>in</strong>gungen bestehen zu können,<br />
s<strong>in</strong>d jedoch betriebswirtschaftliche Qualifikationen erforderlich, die neben unternehmerischen Managementkenntnissen<br />
auch e<strong>in</strong>e ausgesprochene Markt- <strong>und</strong> K<strong>und</strong>enorientierung vermitteln. E<strong>in</strong> profes-<br />
- 95 -
Exkurs: Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
sionelles Unterstützungs- <strong>und</strong> Beratungsangebot für Existenzgründer<strong>in</strong>nen ist hier neben f<strong>in</strong>anziellen<br />
Unterstützungsangeboten dr<strong>in</strong>gend geboten.<br />
Reform-Szenario: Die Erfahrungen aus den Niederlanden lehren, dass Wettbewerb im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
durchaus zu e<strong>in</strong>em Ausbau der Beschäftigung beitragen kann. Dies erfordert jedoch strukturelle<br />
Anpassungsleistungen im Ges<strong>und</strong>heitssystem, die den nicht-ärztlichen Ges<strong>und</strong>heitsberufen zum e<strong>in</strong>en<br />
e<strong>in</strong>e Ausweitung der Kompetenzen, zum anderen e<strong>in</strong>e Steigerung der E<strong>in</strong>kommenschancen bieten. Da<br />
dies e<strong>in</strong>en Interessenkonflikt mit den etablierten Akteuren bedeuten kann, sche<strong>in</strong>t diese Strategie <strong>in</strong><br />
der B<strong>und</strong>esrepublik derzeit nicht ohne Widerstände durchsetzbar zu se<strong>in</strong>. Die niederländische Entwicklung<br />
macht deutlich, dass die Beschäftigungszunahme der pflegerischen <strong>und</strong> therapeutischen Berufe<br />
mit E<strong>in</strong>kommenszuwächsen <strong>und</strong> Kompetenzerweiterungen zusammenhängt. Als goldener Mittelweg<br />
könnte <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen die folgende Strategie erfolgreich se<strong>in</strong>: Existenzgründer<strong>in</strong>nen<br />
bieten Leistungen an, die durch die GKV gr<strong>und</strong>f<strong>in</strong>anziert werden, ergänzen diese Basisleistungen jedoch<br />
durch Angebotspakete, die der privaten F<strong>in</strong>anzierung unterliegen. Auch hier werden die Gründer<strong>in</strong>nen<br />
vor Herausforderungen gestellt, deren Bewältigung neben hohen fachlichen Qualifikationen<br />
ausgeprägte betriebswirtschaftliche Orientierungen voraussetzen. Wettbewerbs- <strong>und</strong> K<strong>und</strong>enorientierung,<br />
Market<strong>in</strong>gkenntnisse <strong>und</strong> die Fähigkeit zur Kooperation mit anderen Anbietern etc. s<strong>in</strong>d hierfür<br />
unverzichtbare Kompetenzen. Mit der vom Gesetzgeber angestrebten <strong>in</strong>tegrierten Versorgung (§ 140<br />
SGB V) eröffnen sich vermutlich neue Chancen für Existenzgründer<strong>in</strong>nen. Von zahlreichen Beobachtern<br />
<strong>und</strong> Gestaltern der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft werden <strong>in</strong>tegrierte Versorgungsstrukturen als e<strong>in</strong>e<br />
Möglichkeit zur Profilierung von Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistern <strong>in</strong>terpretiert. Die Entwicklung der <strong>in</strong>tegrierten<br />
Versorgung ist zwar noch ungewiss, doch erste Pilotprojekte <strong>in</strong> diesem Bereich zeigen, dass<br />
sich durch <strong>in</strong>tegrierte Versorgungsstrukturen private Nachfrage aktivieren lässt. E<strong>in</strong>zelne Krankenhäuser<br />
etwa erweitern ihr Angebot um Beratungsdienste oder Angebote zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong><br />
Prävention <strong>und</strong> erschließen sich dadurch neue Möglichkeiten der Patientenb<strong>in</strong>dung. Gleichzeitig bieten<br />
sich für Existenzgründer<strong>in</strong>nen Möglichkeiten, mit bereits etablierten Anbietern zu kooperieren <strong>und</strong><br />
von deren Ruf zu profitieren, da <strong>in</strong>tegrierte Versorgungsstrukturen die Bündelung unterschiedlicher<br />
Kompetenzen <strong>und</strong> Anbieter voraussetzen.<br />
Es besteht ke<strong>in</strong> Zweifel daran, dass der Bereich der privat f<strong>in</strong>anzierten Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistungen<br />
ergänzend zur <strong>und</strong> jenseits der GKV <strong>in</strong> Zukunft an Bedeutung gew<strong>in</strong>nt. Neue Geschäftsfelder für Existenzgründer<strong>in</strong>nen<br />
werden sich deshalb vermutlich weniger <strong>in</strong> den Kernbereichen der Ges<strong>und</strong>heitsversorgung<br />
erschließen lassen, als vielmehr <strong>in</strong> den von privaten F<strong>in</strong>anzierungsformen geprägten Randbereichen<br />
<strong>und</strong> Nachbarbranchen.<br />
2.8. Die Bedeutung der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft im Kontext der Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfälischen Gesamtwirtschaft<br />
In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Beschäftigungslage <strong>und</strong> -entwicklung für die verschiedenen<br />
Teilbereiche des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s <strong>in</strong> NRW präsentiert <strong>und</strong> diskutiert. Die Addition der verschiedenen<br />
Teilbereiche (Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Arbeitsschutz, ambulante Versorgung, stationäre <strong>und</strong> teilstationäre<br />
Versorgung, Krankentransporte/Rettungsdienste/Verwaltung, Vorleistungs- bzw. Zuliefer-<br />
- 96 -
Bedeutung der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft<br />
<strong>in</strong>dustrien, Nachbarbranchen <strong>und</strong> sonstige Wirtschaftszweige im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>) ergibt, dass fast<br />
957.000 Menschen im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalens tätig s<strong>in</strong>d. 49<br />
In der NRW-Gesamtwirtschaft waren 1999 nach Angaben des Landesamtes für Datenverarbeitung <strong>und</strong><br />
Statistik r<strong>und</strong> 7,6 Millionen Menschen erwerbstätig. Mit ihren 957.000 Erwerbstätigen ist die NRW-<br />
Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft mith<strong>in</strong> für ca. 12,6 % der Erwerbstätigkeit <strong>in</strong> NRW verantwortlich; d.h. etwa<br />
jeder 8. Erwerbstätige <strong>in</strong> NRW ist direkt im Ges<strong>und</strong>heitsbereich aktiv.<br />
Um weitergehend e<strong>in</strong>ordnen zu können, wie sich die arbeitsmarktpolitische Bedeutung des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s<br />
für Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen darstellt, bietet es sich an, die Bedeutung des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s<br />
mit der anderer Wirtschaftsbereiche zu vergleichen. Für diesem Vergleich wurde nicht auf die<br />
amtliche Systematik der Wirtschaftszweige der B<strong>und</strong>esanstalt für Arbeit zurückgegriffen, sondern die<br />
Beschäftigtendaten des Landesarbeitsamtes wurden zu Wirtschaftsclustern zusammengefasst. Dabei<br />
wurden - ähnlich wie für die Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft - nicht nur die Beschäftigten <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen<br />
Vergleichsbereichen selbst, sondern auch <strong>in</strong> angeschlossenen bzw. direkt abhängigen Branchen gezählt<br />
<strong>und</strong> zu e<strong>in</strong>em jeweils entsprechenden Cluster zusammengefasst. E<strong>in</strong>e detaillierte Darstellung der<br />
e<strong>in</strong>zelnen Wirtschaftsunterklassen, die den Clustern zu Gr<strong>und</strong>e liegen, f<strong>in</strong>det sich im Anhang (s. Anhang,<br />
Tab. A 18).<br />
Vor der Interpretation der Vergleichsdaten muss darauf h<strong>in</strong>gewiesen werden, dass diese aus Ressourcengründen<br />
im Rahmen der vorliegenden Studie bei weitem nicht so detailliert erfasst <strong>und</strong> diskutiert<br />
werden konnten, wie dies bei den Ges<strong>und</strong>heitswirtschaftsdaten der Fall war. Methodisch ist vor allem<br />
auf zwei Aspekte h<strong>in</strong>zuweisen:<br />
• Bei den Vergleichszahlen handelt es sich um beschäftigte Arbeitnehmer <strong>und</strong> Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen.<br />
Selbständig Tätige konnten im Gegensatz zur Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft ke<strong>in</strong>e Berücksichtigung f<strong>in</strong>den.<br />
Würden sie <strong>in</strong> die Daten der Vergleichsbranchen mite<strong>in</strong>bezogen, läge die Zahl der dort tätigen<br />
Menschen <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> der Kulturwirtschaft höher <strong>und</strong> würde <strong>in</strong> etwa die Größe erreichen,<br />
die bereits im sog. Kulturwirtschaftsbericht des Landes NRW angegeben ist, dessen Zahlen wir als<br />
zusätzliche Vergleichsmöglichkeit ebenfalls noch mit aufgenommen haben.<br />
• E<strong>in</strong>ige Cluster weisen Überlappungen auf <strong>und</strong> lassen sich deshalb nicht immer trennscharf von<br />
anderen abgrenzen. Um dennoch ´sauber´ argumentieren zu können, mussten <strong>in</strong> zwei Fällen e<strong>in</strong>deutige<br />
Zuordnungsentscheidungen gefällt werden. Die Informations- <strong>und</strong> Kommunikationsbranche<br />
ist deshalb nicht - wie <strong>in</strong> manchen anderen Studien (vgl. Hilbert u.a. 1999) - im S<strong>in</strong>ne von<br />
Medienwirtschaft <strong>in</strong>terpretiert <strong>und</strong> aus diesem Gr<strong>und</strong>e ohne den Funk- <strong>und</strong> Fernsehbereich erfasst;<br />
dieser wird vielmehr unter der Rubrik Kulturwirtschaft mitgezählt. Und beim Bergbau wurde die<br />
Gew<strong>in</strong>nung von Kohle mitgezählt, dann allerd<strong>in</strong>gs bei der Energiewirtschaft unberücksichtigt gelassen<br />
(s. Anhang, Tab. A 18).<br />
Die Abb. 22 gibt e<strong>in</strong>en Überblick über die Ergebnisse des Vergleichs der verschiedenen Wirtschaftsbereiche.<br />
Dabei wird deutlich, dass das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> e<strong>in</strong>e der arbeitsmarktmäßig bedeutsamsten<br />
Branchen der NRW-Wirtschaft ist. Hier s<strong>in</strong>d über 160.000 Menschen mehr tätig als im Baugewerbe,<br />
dem Bergbau <strong>und</strong> <strong>in</strong> der Energiewirtschaft zusammen; <strong>und</strong> die Automobil<strong>in</strong>dustrie br<strong>in</strong>gt es lediglich<br />
49<br />
E<strong>in</strong>e tabellarische Übersicht über diese Aufsummierung f<strong>in</strong>det sich bereits im Kapitel 1 "E<strong>in</strong>führung <strong>und</strong><br />
Zusammenfassung".<br />
- 97 -
Bedeutung der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft<br />
auf gut 26% des Beschäftigungsvolumens, das <strong>in</strong> der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft vorzuf<strong>in</strong>den ist. Selbst<br />
Branchen, die wegen ihrer <strong>in</strong> den letzten Jahren günstigen Beschäftigungsentwicklung im öffentlichen<br />
Interesse ganz oben standen, etwa die IuK-Branche oder die Kulturwirtschaft, haben beschäftigungsmäßig<br />
im Vergleich mit der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft nur e<strong>in</strong>e bescheidene Bedeutung.<br />
Abb. 22 <strong>Arbeitsmarkt</strong>bedeutung ausgewählter Wirtschaftsbereiche <strong>in</strong> NRW 1998-1999<br />
Ges<strong>und</strong>heit<br />
Kultur (Wirtschaftsbericht)<br />
Kultur (LAA-NRW)<br />
IuK<br />
Automobil<br />
Energie<br />
Bergbau<br />
Baugewerbe<br />
94.105<br />
158.144<br />
156.538<br />
160.516<br />
255.000<br />
250.868<br />
- 98 -<br />
541.405<br />
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000<br />
Quelle: LAA NRW, Clusterbildung, Berechnungen <strong>und</strong> Darstellung IAT<br />
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft für den <strong>Arbeitsmarkt</strong> <strong>in</strong> NRW e<strong>in</strong>e der bedeutsamsten<br />
Branchen ist. Sie hat ihr Gewicht <strong>in</strong> den letzen 30 Jahren durch e<strong>in</strong>en systematischen <strong>und</strong><br />
kont<strong>in</strong>uierlichen Ausbau der Versorgungsangebote entwickelt <strong>und</strong> auf diese Weise <strong>in</strong> entscheidendem<br />
Maße zum Ausbau des Dienstleistungssektors beigetragen. Ob <strong>und</strong> unter welchen Umständen <strong>und</strong><br />
Voraussetzungen dieser Wachstumsprozess sich fortsetzen kann, wird Gegenstand der Ausführungen<br />
<strong>in</strong> Kapitel 4 se<strong>in</strong>.<br />
957.280
E<strong>in</strong>flussfaktoren auf die Beschäftigungsentwicklung<br />
3. E<strong>in</strong>flussfaktoren auf die Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen<br />
Günter Roth, Matthias Wismar<br />
3.1. E<strong>in</strong>führung, methodische Vorbemerkungen <strong>und</strong> Übersicht<br />
Im Folgenden sollen laut der Zielsetzung des Gutachtens „plausible Annahmen darüber aufgezeigt<br />
werden, wie sich durch Demographie, ökonomischen sowie mediz<strong>in</strong>isch-wissenschaftlichen Fortschritt<br />
<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsrecht veränderte Nachfrage- <strong>und</strong> Versorgungsstrukturen auf die Entwicklung<br />
der Beschäftigung <strong>in</strong> der ‚Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft‘ wie im Bereich der Altenhilfe <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen seit den fünfziger Jahren auswirkten“.<br />
Abb. 23 Untersuchte E<strong>in</strong>flussfaktoren auf die Beschäftigungsentwicklung im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalens<br />
Sozioökonomie-Demografie<br />
Quelle: Erstellung MHH<br />
Sozial- <strong>und</strong><br />
arbeitsrechtliche Vorgaben<br />
Mediz<strong>in</strong>isch-technischer<br />
Fortschritt<br />
- 99 -<br />
Beschäftigungsentwicklung<br />
im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
Zunächst ist zu beachten, dass mehrfache Bed<strong>in</strong>gungszusammenhänge <strong>und</strong> Wechselwirkungen zwischen<br />
diesen Faktoren bestehen. Die E<strong>in</strong>flussfaktoren der demographischen, gesellschaftlichen <strong>und</strong><br />
ökonomischen Entwicklung s<strong>in</strong>d allgeme<strong>in</strong>erer Natur <strong>und</strong> wirken auf die politischen <strong>und</strong> adm<strong>in</strong>istrativen<br />
Entscheidungen zu sozial- <strong>und</strong> arbeitsrechtlichen Vorgaben. Darüber h<strong>in</strong>aus wirken die demographischen,<br />
sozialen <strong>und</strong> ökonomischen Faktoren auch direkt auf die Beschäftigung im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>,<br />
z.B. durch e<strong>in</strong>e steigende Frauenerwerbstätigkeit. Gr<strong>und</strong>sätzlich produziert erst e<strong>in</strong>e günstige<br />
ökonomische Entwicklung e<strong>in</strong> Wohlfahrtsniveau, das die Entwicklung <strong>und</strong> Anwendung des Mediz<strong>in</strong>ischen<br />
Fortschritts ermöglicht. Dann erschließen sich durch Wertewandel, Individualisierung <strong>und</strong> Pluralisierung<br />
neue Märkte, wie z.B. die sogenannten "Life-Style" Medikamente. Aber auch die demographische<br />
Entwicklung selbst nimmt durch die steigende Lebenserwartung <strong>und</strong> die dadurch bed<strong>in</strong>gten<br />
Veränderungen im Krankheitspanorama E<strong>in</strong>fluss auf den mediz<strong>in</strong>isch-technischen Fortschritt <strong>und</strong> die<br />
Nutzung der durch ihn hervorgebrachten Innovationen. Gleichzeitig unterliegt die E<strong>in</strong>führung <strong>und</strong><br />
Anwendung von Innovationen sozial- <strong>und</strong> arbeitsrechtlichen Vorgaben, wie z.B. <strong>in</strong> der Großgerätepla-
E<strong>in</strong>flussfaktoren auf die Beschäftigungsentwicklung<br />
nung (Döhler/Manow-Borgwardt 1992), dem Health Technology Assessment (Busse/Schwartz 1997),<br />
dem Ausschluss von Medikamenten von der Erstattungsfähigkeit durch Negativlisten oder der E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung<br />
von neuen Ges<strong>und</strong>heitsberufen <strong>in</strong> die gesetzliche Krankenversicherung (GKV).<br />
Vorliegende Forschungsansätze tragen diesem vielfältigen Wirkungsgefüge unterschiedlich Rechnung.<br />
Die quantitativ vergleichende Forschung arbeitet mit Variablen politischer, sozialer <strong>und</strong> ökonomischer<br />
Makrostrukturen <strong>und</strong> erklärt anhand der Analyse von Aggregatdaten (Schubert 1991) z.B. die Unterschiede<br />
der Höhe von Ges<strong>und</strong>heitsausgaben verschiedener Wohlfahrtsstaaten (vgl. Schmidt 1999). Die<br />
Evaluationsforschung (Wollmann 1991; Schwartz et al. 1995; Badura/Strodtholz 1998) befasst sich<br />
vorrangig mit der Erfassung der <strong>in</strong>tendierten <strong>und</strong> nicht-<strong>in</strong>tendierten Wirkungen politischadm<strong>in</strong>istrativen<br />
Handelns. Untersuchungsgegenstand s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> aller Regel E<strong>in</strong>zelmaßnahmen oder Maßnahmenbündel.<br />
Der E<strong>in</strong>flussfaktor mediz<strong>in</strong>isch-technischer Fortschritt ist Gegenstand der ökonomischen<br />
Wissenschaften, Techniksoziologie (Rammert 1994) <strong>und</strong> kl<strong>in</strong>ischen Epidemiologie. Untersucht<br />
werden, i.d.R. an e<strong>in</strong>zelnen Technologien, Genese <strong>und</strong> Diffusionsprozesse sowie soziale, ökonomische,<br />
ethische <strong>und</strong> mediz<strong>in</strong>ische Entwicklungen.<br />
Die Wirkverhältnisse der verschiedenen E<strong>in</strong>flussfaktoren untere<strong>in</strong>ander, die unterschiedlichen analytischen<br />
Zugänge <strong>und</strong> die Natur der verwendeten Daten erschweren e<strong>in</strong>e methodisch e<strong>in</strong>deutige Abgrenzung<br />
<strong>und</strong> Quantifizierung aller E<strong>in</strong>flussfaktoren. Deshalb sprechen wir nicht von unabhängigen (erklärenden)<br />
<strong>und</strong> abhängigen (zu erklärenden) Variablen, sondern, methodisch bescheidener, von E<strong>in</strong>flussfaktoren.<br />
50 Die Datenlage erlaubt zudem <strong>in</strong> Teilbereichen nur e<strong>in</strong>e gut begründete Schätzung der Gesamtbeschäftigungseffekte<br />
über den Zeitraum von 1985 bis 1998. Dies gilt für die E<strong>in</strong>richtungen des<br />
stationären Sektors aufgr<strong>und</strong> der Umstellung der Krankenhausstatistik 1989/1990, für die Untererfassung<br />
der nicht-ärztlichen Heilhilfsberufe im ambulanten Sektor sowie für die stationäre <strong>und</strong> ambulante<br />
Altenpflege. Ähnliche Probleme liegen <strong>in</strong> den Sektoren Zuliefer<strong>in</strong>dustrien <strong>und</strong> Nachbarbranchen vor.<br />
Auch die Ausprägung der e<strong>in</strong>zelnen E<strong>in</strong>flussfaktoren ist über den Beobachtungszeitraum nicht e<strong>in</strong>heitlich.<br />
Die E<strong>in</strong>schätzung der Wirkung der E<strong>in</strong>flussfaktoren unterliegt somit e<strong>in</strong>er qualitativen Bewertung, die<br />
auf Plausibilitätsannahmen beruht. E<strong>in</strong> ähnliches Problem ergibt sich aus den vorliegenden Zeitreihen<br />
zur Beschäftigungsentwicklung. Sie be<strong>in</strong>halten zwangsläufig kumulative Effekte, die den unterschiedlichen<br />
E<strong>in</strong>flussfaktoren nicht exakt zugeordnet werden können. In Fällen kompensierender Wirkungen<br />
muss e<strong>in</strong>e Unterschätzung durch Plausibilitätsannahmen vermieden werden.<br />
In der Gesamtschau der folgenden Tabelle (s. Tab. 51) lassen sich zur Beschäftigungsentwicklung im<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen für den Zeitraum von 1985 bis 1998 e<strong>in</strong>e Reihe von Globalaussagen<br />
treffen:<br />
• Die Beschäftigungsentwicklung fiel <strong>in</strong>sgesamt positiv aus, die Anzahl der Beschäftigten im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
ist zwischen 1985/87 <strong>und</strong> 1998 m<strong>in</strong>destens um ca. 163.500 gestiegen, jedoch unterschiedlich<br />
nach Sektoren.<br />
50 Dies ersche<strong>in</strong>t im Lichte der <strong>in</strong>ternationalen Ges<strong>und</strong>heitssystemforschung, die sich stärker an Kontexten<br />
(Saltman/Figueras 1997) <strong>und</strong> Herausforderungen (Abel-Smith et al. 1995) im S<strong>in</strong>ne von E<strong>in</strong>flussfaktoren orientiert,<br />
als durchaus legitim.<br />
- 100 -
E<strong>in</strong>flussfaktoren auf die Beschäftigungsentwicklung<br />
• E<strong>in</strong> hohes absolutes Wachstum war <strong>in</strong>sbesondere im ambulanten Sektor, <strong>in</strong> der ambulanten <strong>und</strong><br />
stationären Pflege <strong>und</strong> im stationären Sektor zu verzeichnen.<br />
• Gemessen an der Beschäftigtenzahl von 1987 erfolgte vor allem <strong>in</strong> der Altenpflege bis 1998 e<strong>in</strong><br />
enormes Wachstum, d.h. m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>e Verdopplung <strong>in</strong> gut zehn Jahren – selbst wenn die Datenrestriktionen<br />
zu vorsichtigen Aussagen zw<strong>in</strong>gen.<br />
• Insgesamt haben die beschäftigungsfördernden, die wachstums- <strong>und</strong> beschäftigungshemmenden<br />
E<strong>in</strong>flussfaktoren mehr als kompensiert.<br />
• Die Beschäftigungswirkung der E<strong>in</strong>flussfaktoren weist über die Sektoren h<strong>in</strong>weg erhebliche Unterschiede<br />
auf. In fast allen Sektoren setzt offenbar der E<strong>in</strong>flussfaktor des ökonomischen Wachstums<br />
<strong>und</strong> die wachsende Altenbevölkerung positive Beschäftigungsimpulse. Für den E<strong>in</strong>flussfaktor<br />
mediz<strong>in</strong>isch-technischer Fortschritt lassen sich, mit Ausnahme der Prozess<strong>in</strong>novationen, ebenso<br />
überwiegend positive Beschäftigungseffekte nachweisen, wenngleich nicht für alle Sektoren.<br />
• Für den E<strong>in</strong>flussfaktor sozial- <strong>und</strong> arbeitsrechtliche Vorgaben, der komplett unter politischadm<strong>in</strong>istrativer<br />
Kontrolle steht, f<strong>in</strong>det sich ke<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>heitliche beschäftigungspolitische Zielrichtung.<br />
Dieses resultiert daraus, dass je nach Sektor <strong>und</strong> Phase sehr unterschiedliche Regulierungen<br />
<strong>und</strong> politisch-adm<strong>in</strong>istrative Strukturen bestehen.<br />
Im Folgenden sollen Plausibilitätsannahmen zu den verschiedenen E<strong>in</strong>flussfaktoren <strong>in</strong> Bezug auf die<br />
Beschäftigungsentwicklung im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen aufgezeigt werden. Dabei<br />
werden vor allem allgeme<strong>in</strong>e Wirkungsweisen beschrieben, die auf der Makroebene für alle Sektoren<br />
mehr oder m<strong>in</strong>der relevant s<strong>in</strong>d.<br />
- 101 -
Tab. 51 Übersicht zur Beschäftigungsentwicklung <strong>und</strong> zu E<strong>in</strong>flussfaktoren - <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen 1985 -1998<br />
E<strong>in</strong>flussfaktoren auf die Beschäftigungsentwicklung<br />
Allgeme<strong>in</strong>e Sonstige Kran- Vorsorge- <strong>und</strong> Stationäre Al- Ambulante Ambulanter Zuliefer<strong>in</strong>duNachbarbran- Krankenhäuser kenhäuserRehabilitationstenpflege Altenpflege Sektor strienchene<strong>in</strong>richtungen<br />
Quantitatives Wachstum<br />
Absolutes Wachstum 1985-1989 a)<br />
+14.538 +3.242 -<br />
Absolutes Wachstum 1991-1998 a)<br />
+5.863 - 4.827 + 2.801<br />
Absolutes Wachstum 1985-1998 + 21.617 ca. 50-60.000 b)<br />
ca. 26.000 b)<br />
+ 55.836 c) ca. +10.000 ca. +8.000<br />
Indexiertes Wachstum 1985-1998<br />
(1985 = 100) 111 ca. 180-200 b)<br />
ca. 250 b)<br />
144 c) ca. 109 ca. 130<br />
Qualitative Bewertung der E<strong>in</strong>flussfaktoren<br />
Sozioökonomie-Demographie<br />
Demographischer Wandel (�) (�) (�) � � (�) (�)<br />
Ökonomischer Wandel (��) (��) (��) � � (�) (�) (�)<br />
Wertewandel/ Individualisierung/Pluralis. (�) (�) (�) � � (�) (�) (�)<br />
Sozial- <strong>und</strong> arbeitsrechtl. Vorgaben<br />
Qualität <strong>und</strong> Bedarfsdeckung � � � � (�)<br />
Kostendämpfungspolitik (�) V (�) � (�) (�) (�)<br />
Arbeitsrecht (�) (�) (�) (�) (�) (�)<br />
Mediz<strong>in</strong>isch-technischer Fortschritt<br />
Produkt<strong>in</strong>novationen (�) � �<br />
Prozess<strong>in</strong>novationen (�) � V (�) (�) (�) (�) � �<br />
Professionalisierung (�) (�) �<br />
� = beschäftigungsfördernd, � = beschäftigungshemmend, ( ) = Annahme plausibel, lässt sich aber anhand der Daten nicht e<strong>in</strong>deutig belegen, V = beschäftigungsverlagernd<br />
a) Umstellung Krankenhausstatistik (siehe entsprechendes Kap.).<br />
b) Angaben für die Altenpflege beziehen sich auf den Zeitraum 1987-1998; vgl. im E<strong>in</strong>zelnen Kap. 1.5.<br />
c) Diese Zahl be<strong>in</strong>haltet eher e<strong>in</strong>e Unterschätzung, da für bestimmte Berufsgruppen nur Zeitreihen bis 1996 vorhanden s<strong>in</strong>d. Dies gilt für Krankengymnast/<strong>in</strong>nen, Logopäd/<strong>in</strong>nen, Beschäftigungs- <strong>und</strong><br />
Arbeitstherapeut/<strong>in</strong>nen, Masseur/<strong>in</strong>nen, Masseur/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> med. Bademeister/<strong>in</strong>nen, Heilpraktiker/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Hebammen ohne Anstellung im Krankenhaus.<br />
- 102 -
E<strong>in</strong>flussfaktoren auf die Beschäftigungsentwicklung<br />
3.1.1. Sozialer, ökonomischer <strong>und</strong> kultureller Wandel<br />
E<strong>in</strong>schlägig gilt als Erklärung der wachsenden Nachfrage von Ges<strong>und</strong>heitsleistungen – <strong>und</strong> damit auch<br />
der wachsenden Beschäftigung <strong>in</strong> diesem Bereich – primär die Struktur der Bevölkerungsentwicklung<br />
(vgl. Deutscher B<strong>und</strong>estag 1998). Diese wird oft als unausweichliche, ursprüngliche Kraft angesehen,<br />
worauf der Staat e<strong>in</strong>fach tätig werden müsse (vgl. Leiser<strong>in</strong>g 1992: 137). Die heute gegenüber früher<br />
deutlich längere Lebenserwartung 51 führe dazu, dass es sowohl absolut als auch prozentual immer<br />
mehr alte <strong>und</strong> vor allem hochbetagte Menschen <strong>in</strong> Deutschland gebe, womit der Bedarf an Versorgungse<strong>in</strong>richtungen<br />
wachse, weil die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit, krank oder pflegebedürftig zu werden eben<br />
mit dem Alter, <strong>und</strong> vor allem <strong>in</strong> sehr hohem Alter stark ansteigt. Darüber h<strong>in</strong>aus wird <strong>in</strong> klassischen<br />
„sozialökonomischen“ Theorien die ökonomische Entwicklung als Triebkraft für den wachsenden Sozial-<br />
<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitssektor genannt (vgl. Wilensky 1975). 52<br />
Ohne Zweifel haben diese Erklärungsansätze e<strong>in</strong>e große empirische Evidenz, auch nach den vorliegenden<br />
Daten zur Entwicklung der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen. So verlief z.B. die<br />
Expansion der Kapazitäten <strong>und</strong> Beschäftigung <strong>in</strong> der Altenhilfe im Großen <strong>und</strong> Ganzen relativ analog<br />
zum Wirtschaftswachstum <strong>und</strong> zur Zunahme der Altenbevölkerung. Dieser Bef<strong>und</strong> entspricht dem von<br />
M.G. Schmidt, wonach der Stand <strong>und</strong> das Wachstum des Anteils der öffentlichen Ges<strong>und</strong>heitsausgaben<br />
am Sozialprodukt der OECD-Staaten zwischen 1960-1997 um so höher ausfallen, je höher Stand<br />
<strong>und</strong> Wachstum des Anteils der 65-Jährigen <strong>und</strong> älteren waren (1999a: 238). Darüber h<strong>in</strong>aus, so<br />
Schmidt, gab es auch e<strong>in</strong>en positiven statistischen Zusammenhang zwischen Ges<strong>und</strong>heitsausgaben<br />
<strong>und</strong> Brutto<strong>in</strong>landsprodukt, dieser E<strong>in</strong>fluss hatte aber e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>geres Gewicht als die Seniorenquote <strong>und</strong><br />
der „Grad etatistischer Problemlösungsrout<strong>in</strong>en“.<br />
Ferner wird zur Erklärung wachsender sozialer <strong>und</strong> ges<strong>und</strong>heitlicher Dienste auf Aspekte des gesellschaftlichen<br />
<strong>und</strong> kulturellen Wandels verwiesen, die jedoch wiederum <strong>in</strong> vielfältigen Wechselwirkungen<br />
zue<strong>in</strong>ander stehen. Als Variablen gelten die Veränderung der Zusammensetzung <strong>und</strong> des Verständnisses<br />
der Familien (‚Individualisierung‘) ebenso wie die steigende Erwerbstätigkeit von Frauen.<br />
Durch die Auflösung traditioneller sozialer B<strong>in</strong>dungen <strong>und</strong> gesteigerter regionaler Mobilität nimmt<br />
das private Sorge- <strong>und</strong> Pflegepotenzial ab, d.h. die Nachfrage rational, ökonomisch <strong>und</strong> rechtlich def<strong>in</strong>ierter<br />
<strong>und</strong> professionell erbrachter Dienstleistungen, die traditionell <strong>und</strong> selbstverständlich unentgeltlich<br />
durch die Familien (vor allem durch Frauen) geleistet wurden, wie die Alten- <strong>und</strong> Krankenpflege,<br />
wird nicht nur als Ausnahme, sondern als Regel gesellschaftlich akzeptiert. Tatsächlich weisen z.B.<br />
Kle<strong>in</strong>/Salaske (1994a u. b) nach, dass Alle<strong>in</strong>lebende (darunter vor allem Frauen) signifikant häufiger<br />
Altenheime nutzen als Verheiratete. Zudem ist von der vergleichenden Wohlfahrtsstaatenforschung<br />
für den Zeitraum von 1961 bis 1995 belegt worden, dass die Ges<strong>und</strong>heitsausgaben um so höher s<strong>in</strong>d,<br />
je größer der Anteil der Frauen an der Erwerbsbevölkerung ist (Schmidt 1999). Allerd<strong>in</strong>gs muss dabei<br />
beachtet werden, dass auch hier Wechselwirkungen bestehen, weil gerade der Ausbau des Ges<strong>und</strong>-<br />
51<br />
Die Alterung der Gesellschaft wird auf der anderen Seite durch ger<strong>in</strong>gere Geburtenraten bed<strong>in</strong>gt.<br />
52<br />
Ausführlich zur vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung siehe: Schmidt 1997. Zur Analyse der Ges<strong>und</strong>heitsausgaben<br />
siehe ausführlich: Schmidt (1999a).<br />
- 103 -
E<strong>in</strong>flussfaktoren auf die Beschäftigungsentwicklung<br />
heitsbereichs wiederum die Frauenerwerbstätigkeit fördert. Zwar ist die Frauenerwerbstätigkeit <strong>in</strong><br />
Deutschland im <strong>in</strong>ternationalen Vergleich relativ ger<strong>in</strong>g. Dennoch ist sie für das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
von hoher Relevanz, da sich hier Berufe mit hohen Frauenanteilen f<strong>in</strong>den (Krankenpflege, Sprechst<strong>und</strong>enhilfe).<br />
Der steigenden Frauenerwerbstätigkeit liegen wiederum gesellschaftliche <strong>und</strong> kulturelle Veränderungen<br />
der ‚Modernisierung‘ zu Gr<strong>und</strong>e, die allgeme<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e zunehmende Flexibilität, ‚Enttraditionalisierung‘<br />
<strong>und</strong> ‚Rationalisierung‘ von Lebensverhältnissen sowie den Wandel von Werten <strong>und</strong> E<strong>in</strong>stellungen<br />
mit sich br<strong>in</strong>gen (vgl. Alber 1982). Die sogenannte ‚Pluralisierung‘ bezieht sich auf die Ausdifferenzierung<br />
privater Lebensstile. Bed<strong>in</strong>gt durch die Zunahme des gesellschaftlichen Wohlstands verfügen<br />
die Menschen über mehr Gestaltungsmöglichkeiten ihrer Lebensumstände (Schulze 1992; Beck<br />
1986). Diese Zunahme von Wahlmöglichkeiten macht auch vor dem <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> nicht halt. Die<br />
Menschen möchten nicht nur behandelt werden, sondern auch über die Art der Behandlung mitentscheiden.<br />
Die Folge ist e<strong>in</strong>e vermehrte Nachfrage nach alternativen Behandlungsmethoden, aber auch<br />
nach nicht rezeptpflichtigen Arzneimitteln. Die steigende Bedeutung von Ges<strong>und</strong>heit wirkt sich auch<br />
auf die Nachbarbranchen (z.B. Fitness, Wellness) aus. Wertewandel, Individualisierungs- <strong>und</strong> Pluralisierungstendenzen<br />
führen also auf der Nachfrageseite zu e<strong>in</strong>em gesteigerten Bedarf an Dienstleistungen<br />
im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>, ob dieser sich nun <strong>in</strong> der ambulanten <strong>und</strong> stationären Pflege niederschlägt<br />
oder <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er größeren Nachfrage nach nicht-ärztlichen mediz<strong>in</strong>ischen Dienstleistungen, wie z.B. die<br />
Behandlung durch Heilpraktiker/<strong>in</strong>nen.<br />
3.1.2. Rechtliche <strong>und</strong> politisch-adm<strong>in</strong>istrative E<strong>in</strong>flüsse<br />
Der Seite des gesellschaftlichen <strong>und</strong> ökonomischen Wandels <strong>und</strong> der daraus resultierenden Nachfrage<br />
professioneller Ges<strong>und</strong>heitsleistungen entspricht die Entwicklung des Angebotes, das se<strong>in</strong>erseits die<br />
Nachfrageentwicklung bee<strong>in</strong>flusst. Zu beidem tragen Institutionen mit ihren rechtlichen Regelungen<br />
<strong>und</strong> Leistungen entscheidend bei. Lange wurden die Ursachen für die Ausweitung staatlicher sozialpolitischer<br />
Leistungen alle<strong>in</strong>e der ökonomischen Entwicklung auf der e<strong>in</strong>en <strong>und</strong> dem Druck der ‚objektiven‘<br />
sozialen <strong>und</strong> politischen ‚Probleme‘ auf der anderen Seite zugeschrieben. Erst <strong>in</strong> den letzten<br />
Jahren richtete sich die Aufmerksamkeit <strong>in</strong> der Sozial- <strong>und</strong> Politikwissenschaft stärker auf die staatlichen<br />
<strong>und</strong> politischen Institutionen als relativ autonome Akteure. Diese haben, ungeachtet bestimmter<br />
Problemlagen, Wahlmöglichkeiten <strong>und</strong> sie prägen selbst wiederum gesellschaftliche Entwicklungen.<br />
Dah<strong>in</strong>gehende Analysen zeigen, dass diese Institutionen zum e<strong>in</strong>en auch aus eigenem Antrieb bestimmte<br />
Themen, Regulierungen, Programme etc. vorantreiben 53 <strong>und</strong> zum anderen e<strong>in</strong>er eigengesetzlichen,<br />
auch historisch determ<strong>in</strong>ierten, Funktionslogik unterliegen. Diese zeigt sich z.B. <strong>in</strong> Form der<br />
sogenannten ‚Verrechtlichung, <strong>in</strong> Phänomenen der ‚Pfadabhängigkeit‘ oder im Beharrungsvermögen<br />
von Institutionen (vgl. Roth 1999).<br />
53 Hier kann dah<strong>in</strong>gestellt bleiben, woraus diese Interessen resultieren. E<strong>in</strong>erseits könnten die politischadm<strong>in</strong>istrativen<br />
Eliten aus Weitsicht bestimmte Programme <strong>in</strong>itiieren (vgl. für die Sozialpolitik: Heclo 1974),<br />
wobei auf der anderen Seite auch das z.B. f<strong>in</strong>anziell motivierte Eigen<strong>in</strong>teresse sowie Aspekte des Macht<strong>in</strong>teresses<br />
der staatlichen Akteure nicht unbeachtet bleiben sollten (vgl. Downs 1967; Niskanen 1971, 1975,<br />
1991).<br />
- 104 -
E<strong>in</strong>flussfaktoren auf die Beschäftigungsentwicklung<br />
In diesem Zusammenhang darf nicht unerwähnt bleiben, dass <strong>in</strong> Deutschland e<strong>in</strong>e hohe gesellschaftliche<br />
Zustimmung zu den E<strong>in</strong>richtungen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s besteht ({Wasem 1999 ID: 1177}).<br />
Diese Werthaltung wirkt als Anforderung auf das politisch-adm<strong>in</strong>istrative System. Deutliche E<strong>in</strong>schnitte<br />
im Leistungsgeschehen können zu e<strong>in</strong>em erheblichen politischen Druck führen, der nicht nur<br />
durch die Leistungsanbieter <strong>und</strong> ihre politischen Verbände ausgeübt wird, sondern sich auch <strong>in</strong> Wahlkämpfen<br />
<strong>und</strong> Wahlergebnissen widerspiegelt. H<strong>in</strong>zu kommen „Verteilungskoalitionen“, d.h. Strukturen<br />
der adm<strong>in</strong>istrativen Interessenvermittlung, die weitere Wachstumsimpulse für die Beschäftigung<br />
im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> mit sich br<strong>in</strong>gen. M.G. Schmidt zeigt z.B. (1999a: 238), dass je älter e<strong>in</strong>e Demokratie<br />
<strong>und</strong> je etatistischer die Problemlösungsrout<strong>in</strong>en im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> der OECD-Staaten<br />
s<strong>in</strong>d, 54 desto höher ist auch der jeweilige Anteil der öffentlichen Ges<strong>und</strong>heitsausgaben am Sozialprodukt<br />
<strong>und</strong> desto höher war deren Wachstum von 1960/61-1996/97. Im Rahmen von ‚Eigendynamik‘<br />
müssen im übrigen auch die Beschäftigten <strong>und</strong> die sozialen Dienste <strong>und</strong> E<strong>in</strong>richtungen selbst sowie<br />
deren Interessenvertretungen als treibende Kräfte für den Ausbau der sozialen Dienste e<strong>in</strong>bezogen<br />
werden. 55<br />
Schließlich ist der klassische Erklärungsansatz der „Parteiendifferenzthese“, wonach christdemokratisch-konservative<br />
<strong>und</strong> sozialdemokratische Regierungen <strong>und</strong> Regime sich <strong>in</strong> puncto Regulierungstypus<br />
<strong>und</strong> Ausgabenhöhe wohlfahrtsstaatlicher Leistungen deutlich unterscheiden, 56 mittlerweile etwas<br />
umstritten. So zeigen neuere vergleichende Untersuchungen, dass Faktoren, wie der gewerkschaftliche<br />
Organisationsgrad, die Regierungsbeteiligung von L<strong>in</strong>ksparteien <strong>und</strong> der Stimmenanteil sozialdemokratischer<br />
Parteien, die <strong>in</strong> bivariaten Tests durchaus signifikante E<strong>in</strong>flüsse auf die Entwicklung der<br />
Ges<strong>und</strong>heitsausgaben verzeichneten, nur noch wenig Erklärungskraft <strong>in</strong> multivariaten Tests boten<br />
(Schmidt 1999a: 237). Außerdem muss, wie e<strong>in</strong>gangs erwähnt, der Bezugspunkt der Analyse entsprechend<br />
beachtet werden: Je tiefer <strong>und</strong> detaillierter die Betrachtung der Beschäftigungsentwicklung e<strong>in</strong>zelner<br />
Sektoren angelegt ist, desto weniger s<strong>in</strong>d globale Variablen wie die Parteiendifferenz entscheidend<br />
<strong>und</strong> desto eher kommen <strong>in</strong>sbesondere e<strong>in</strong>zelne rechtliche Regulierungen <strong>und</strong> sektorspezifische<br />
Aspekte als Erklärung <strong>in</strong> Betracht. Allerd<strong>in</strong>gs erweist sich die Hypothese der Parteiendifferenz für die<br />
vorliegende Untersuchung für die Entwicklung der Beschäftigung <strong>in</strong> der Altenpflege durchaus als relevant.<br />
Denn dieser Sektor ist sehr stark von der, seit den fünfziger Jahren von den Landesregierungen<br />
mehr oder weniger <strong>in</strong>formell geleisteten, Förderpolitik <strong>und</strong> erst seit der 1994 erlassenen Pflegeversicherung<br />
von e<strong>in</strong>er differenzierten rechtlichen Regulierung geprägt.<br />
Auf der Ebene konkreter sozialrechtlicher Vorgaben mit Auswirkungen auf die Beschäftigung lassen<br />
sich Qualitäts- <strong>und</strong> Bedarfsdeckungsmaßnahmen, die Kostendämpfungspolitik <strong>und</strong> arbeitsrechtliche<br />
Vorgaben (Arbeitszeitverkürzung, Ruhepausen, Teilzeitarbeit u.ä.) unterscheiden. Dabei s<strong>in</strong>d für das<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen folgende E<strong>in</strong>flüsse festzustellen:<br />
54<br />
Diese s<strong>in</strong>d operationalisiert als Anteil der Staatsausgaben außerhalb des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s am Brutto<strong>in</strong>landsprodukt<br />
<strong>in</strong> Prozent.<br />
55<br />
So korreliert die Höhe der Ges<strong>und</strong>heitsausgaben (<strong>in</strong> % vom BIP) signifikant positiv mit der Ärztedichte (vgl.<br />
Schmidt 1999a: 238).<br />
56<br />
Während der sozialdemokratische Typus sich vor allem durch e<strong>in</strong>e relativ starke ‚Dekommodifizierung‘<br />
(‚Umverteilung‘) <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e hohe ‚Staatsdienerquote‘ auszeichnet, kennzeichnet den christdemokratischenkonservativen<br />
Typus (u.a. Deutschland) <strong>in</strong>sbesondere e<strong>in</strong>e Zurückhaltung bei der aktiven Bereitstellung sozialer<br />
<strong>und</strong> ges<strong>und</strong>heitlicher Dienste (vgl. Esp<strong>in</strong>g-Andersen 1990; Schmidt 1998).<br />
- 105 -
E<strong>in</strong>flussfaktoren auf die Beschäftigungsentwicklung<br />
• Qualitäts- <strong>und</strong> Bedarfsdeckungsmaßnahmen haben <strong>in</strong> den allgeme<strong>in</strong>en <strong>und</strong> sonstigen Krankenhäusern<br />
deutlich beschäftigungsfördernd gewirkt <strong>und</strong> zu e<strong>in</strong>er Zunahme <strong>in</strong>sbesondere des Pflegepersonals<br />
geführt. Für die Krankenhäuser war der Effekt allerd<strong>in</strong>gs nur von kurzer Dauer.<br />
• Qualitäts- <strong>und</strong> Bedarfsdeckungsmaßnahmen resultieren <strong>in</strong> der Altenpflege im Gegensatz zum Bereich<br />
der Krankenversicherung traditionell auf e<strong>in</strong>em Zusammenspiel <strong>in</strong>formeller politischadm<strong>in</strong>istrativer<br />
Netzwerke. Erst mit der Verabschiedung der Gesetzlichen Pflegeversicherung im<br />
Jahre 1994 gibt es hier e<strong>in</strong>e rechtliche Regulierung, deren Strukturen sich zudem – im Gegensatz<br />
zur Krankenversicherung – nicht alle<strong>in</strong> an Qualitäts- <strong>und</strong> Bedarfsdeckung, sondern wesentlich an<br />
der Budget- <strong>und</strong> Kostensicherung orientieren.<br />
• Die Qualitäts- <strong>und</strong> Bedarfsdeckungsmaßnahmen (z.B. Pflegepersonal- <strong>und</strong> Psychatriepersonalregelung)<br />
konkurrieren aus steuerungstheoretischer Sicht mit den Zielen der prospektiven F<strong>in</strong>anzierung<br />
der Krankenhäuser, da e<strong>in</strong> Spannungsverhältnis zwischen Bedarfsplanung <strong>und</strong> marktwirtschaftlichen<br />
Mechanismen besteht (Schwartz/Wismar 1998).<br />
• Die seit Ende der siebziger/Mitte der achtziger Jahre aufkommende Kostendämpfungspolitik entfaltet<br />
beschäftigungshemmende Effekte vor allem <strong>in</strong> den Krankenhäusern, dem ambulanten Sektor<br />
<strong>und</strong> z.T. <strong>in</strong> den Zuliefer- <strong>und</strong> Nachbarbranchen. Zum nachweislichen bzw. plausiblen Beschäftigungsabbau<br />
hat sie jedoch nur <strong>in</strong> Ausnahmefällen geführt.<br />
• Arbeitszeitverkürzung, Arbeitszeitgesetz <strong>und</strong> der Ausbau der Teilzeitarbeit haben beschäftigungsfördernd<br />
gewirkt.<br />
3.1.2.1. Qualität <strong>und</strong> Bedarfsdeckung<br />
Bedarf- <strong>und</strong> Bedarfsdeckung gehören – ähnlich wie der Begriff der mediz<strong>in</strong>ischen Notwendigkeit - zu<br />
den unbestimmten Rechtsbegriffen, die für das deutsche <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> stilbildend s<strong>in</strong>d. Dabei<br />
beruht die Eigentümlichkeit auf der Bedarfsdef<strong>in</strong>ition. Es handelt sich nicht um e<strong>in</strong>en epidemiologischen<br />
oder normativ begründeten Bedarf, sondern vielmehr um den „tatsächlich“ aufgelaufenen <strong>und</strong><br />
damit meist retrospektiven Bedarf. Verantwortlich für die Bedarfsdeckung s<strong>in</strong>d im ambulanten Sektor<br />
aufgr<strong>und</strong> des Sicherstellungsauftrags die Kassenärztlichen Vere<strong>in</strong>igungen, für die Pflegeversicherung<br />
die Pflegekassen, für die allgeme<strong>in</strong>en <strong>und</strong> sonstigen Krankenhäuser mit der Krankenhausplanung die<br />
Länder. Reha- <strong>und</strong> Vorsorgee<strong>in</strong>richtungen sowie die Zuliefer- <strong>und</strong> Nachbarbranchen unterliegen ke<strong>in</strong>er<br />
Bedarfsplanung.<br />
In den sozialen <strong>und</strong> ges<strong>und</strong>heitlichen Diensten s<strong>in</strong>d Qualität <strong>und</strong> Bedarfsdeckung eng an e<strong>in</strong>e quantitativ<br />
<strong>und</strong> qualitativ ausreichende Personalkapazität geb<strong>und</strong>en. Vor diesem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> spielen dah<strong>in</strong>gehende<br />
Personalvorgaben e<strong>in</strong>e zentrale Rolle. Der Bedarf an Pflegepersonal im Krankenhaus wurde<br />
anhand der 1964 e<strong>in</strong>geführten sogenannten Anhaltszahlen def<strong>in</strong>iert. Diese gaben die Anzahl der Pflegem<strong>in</strong>uten<br />
für e<strong>in</strong>en Patiententag an. Aufgr<strong>und</strong> der retrospektiven Inanspruchnahme konnte somit<br />
kalkuliert werden, wie hoch der Bedarf an Pflegekräften ist. Die Anhaltszahlen wurden immer wieder<br />
angeglichen, um Arbeitszeitverkürzungen, aber auch größeren Pflegeaufwand durch Innovationen<br />
aufzunehmen (Deutsche Krankenhausgesellschaft 1969; Golombek 1986).<br />
Bis Inkrafttreten des GSG im Jahr 1993 hatten die Krankenhäuser e<strong>in</strong>en Anspruch darauf, dass die<br />
<strong>in</strong>dividuellen Selbstkosten vollständig aus den Erlösen der Pflegesätze <strong>und</strong> öffentlichen Fördermittel<br />
- 106 -
E<strong>in</strong>flussfaktoren auf die Beschäftigungsentwicklung<br />
gedeckt wurden. Mit der Ablösung des Selbstkostendeckungspr<strong>in</strong>zips durch die prospektive F<strong>in</strong>anzierung<br />
hätten auch die Anhaltszahlen ihre Bedeutung verlieren müssen. Jedoch wurden sie gleichzeitig<br />
<strong>in</strong> modifizierter Form als Pflegepersonalregelung <strong>und</strong> Psychiatriepersonalregelung zeitlich begrenzt<br />
wieder e<strong>in</strong>geführt. Die Pflegepersonalregelung trat zum 1. Januar 1993 <strong>in</strong> Kraft. 1995 wurde sie vorzeitig<br />
ausgesetzt, da der vom Gesetzgeber <strong>in</strong>tendierte Zuwachs von 13.000 neuen Pflegestellen b<strong>und</strong>esweit<br />
um 8.000 überschritten wurde. 1997 wurde die Pflegepersonalregelung schließlich aufgehoben.<br />
Analog zur Pflegepersonalregelung <strong>in</strong> den allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäusern wurde im Psychiatriebereich<br />
die Psychiatriepersonalregelung 1991 verabschiedet <strong>und</strong> <strong>in</strong> den Jahren 1993-1996 umgesetzt. Mit ihr<br />
kam es erstmals zu e<strong>in</strong>er leistungsorientierten Personalbemessung, die sich nicht nur an Betten- <strong>und</strong><br />
Patientenzahlen sondern auch am Schweregrad der Krankheit orientierte (Vitt et al. 1994; Bartels<br />
1994). 57 Dies führte <strong>in</strong> den sonstigen Krankenhäusern zu e<strong>in</strong>em leichten Anstieg der Beschäftigung<br />
beim Pflegepersonal bis 1995.<br />
Im ambulanten Sektor wurde durch das Gesetz über die Berufe des psychologischen Psychotherapeuten<br />
<strong>und</strong> des K<strong>in</strong>der- <strong>und</strong> Jugendlichenpsychotherapeuten, zur Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch<br />
<strong>und</strong> anderer Gesetze die psychotherapeutische Praxis <strong>in</strong> die vertragsärztliche Versorgung<br />
aufgenommen. Da die psychotherapeutisch tätigen Ärzt/<strong>in</strong>nen nicht der Bedarfsplanung unterliegen,<br />
s<strong>in</strong>d hier bei unveränderter Rechtslage weitere Wachstumsschübe anzunehmen. 58<br />
Wie bereits ausgeführt wurde, unterliegt die Bedarfsdeckung <strong>in</strong> der Altenpflege besonderen politisch<strong>in</strong>stitutionellen<br />
Bed<strong>in</strong>gungen, die <strong>in</strong> der sektorspezifischen Analyse verdeutlicht wurden. Allerd<strong>in</strong>gs<br />
kann <strong>in</strong>sbesondere am Beispiel des Pflege-Versicherungsgesetzes aufgezeigt werden, dass – trotz e<strong>in</strong>es<br />
im Vergleich zur GKV sehr schwach ausgeprägten Gr<strong>und</strong>satzes der Bedarfsorientierung <strong>und</strong> dem<br />
Schwerpunkt der ‚Budgetorientierung‘ (vgl. Rothgang 1994) – von dieser <strong>in</strong>stitutionellen Verankerung<br />
klare Beschäftigungsimpulse ausg<strong>in</strong>gen. Zudem hat die Verabschiedung der Heimm<strong>in</strong>destpersonalverordnung<br />
im Jahr 1993 zu e<strong>in</strong>er qualitativen Veränderung der Personalstrukturen <strong>in</strong> der stationären<br />
Altenhilfe geführt.<br />
3.1.2.2. Kostendämpfungspolitik<br />
Die Kostendämpfungspolitik wurde <strong>in</strong> der Folge des Haushaltsstrukturgesetzes von 1975 <strong>und</strong> zielgerichtet<br />
ab 1977 im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> e<strong>in</strong>geführt. Auf der Seite des Angebotes umfasst ihr Arsenal<br />
verschiedene Budgetierungsmaßnahmen, neue F<strong>in</strong>anzierungsformen (Ablösung des Selbstkostenkostendeckungspr<strong>in</strong>zips<br />
durch die prospektive F<strong>in</strong>anzierung), neue Vergütungsmechanismen (Fallpauschalen,<br />
Sonderentgelte, Basis- <strong>und</strong> Abteilungspflegesätze, Ord<strong>in</strong>ationsgebühr), Richtgrößen, Abstaffelungen,<br />
Fehlbelegungsabgaben sowie Preisabschläge <strong>und</strong> -moratorien. Auf der Nachfrageseite ste-<br />
57 Mit der Psych-PV werden psychiatrisch Kranke e<strong>in</strong>zelnen Behandlungsgruppen zugeordnet. Den jeweiligen<br />
Behandlungsgruppen s<strong>in</strong>d pro Berufsgruppe M<strong>in</strong>utenwerte zugeordnet, woraus sich unter Berücksichtigung<br />
der Wochenarbeitszeit e<strong>in</strong>e M<strong>in</strong>dest-Personalbesetzung errechnen lässt.<br />
58 Die prozentuale Zunahme der psychotherapeutisch tätigen Ärzt/<strong>in</strong>nen betrug im B<strong>und</strong>esgebiet von 1997 auf<br />
1998 +15,3 % (Durchschnitt aller Arztgruppen +1,5%) <strong>und</strong> von 1998 auf 1999 +20,4% (Durchschnitt aller<br />
Arztgruppen +0,1%) [KBV-Daten].<br />
- 107 -
E<strong>in</strong>flussfaktoren auf die Beschäftigungsentwicklung<br />
hen Leistungsausgrenzung, Festbetrags- <strong>und</strong> Zuzahlungsregelungen, Kostenerstattungsregelungen<br />
(komb<strong>in</strong>iert mit Festbeträgen), e<strong>in</strong>e Negativliste für Arzneimittel, Anspruchsbegrenzung sowie Bonus-<br />
Regelungen (Schwartz et al. 1997).<br />
Das Spektrum von Kostendämpfungsmaßnahmen variiert zwischen re<strong>in</strong>em Kostenabbau bzw. Privatisierung<br />
der Krankheitskosten <strong>und</strong> effizienzsteigernden Maßnahmen. Obwohl sie nur <strong>in</strong> Ausnahmefällen<br />
unmittelbar auf die Beschäftigung ausgerichtet s<strong>in</strong>d, entfalten sie z.T. beschäftigungshemmende<br />
Wirkungen, die jedoch oft nur von kurzer Dauer waren. Die stärkste beschäftigungshemmende Wirkung<br />
h<strong>in</strong>terließ die Kostendämpfungspolitik <strong>in</strong> den stationären Vorsorge- oder Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen.<br />
Das Wachstums- <strong>und</strong> Beschäftigungsförderungsgesetz vom 25. September 1996 führte die<br />
Budgetierung sowie die Verlängerung des Anspruchs<strong>in</strong>tervalls <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Verkürzung der Therapiedauer<br />
e<strong>in</strong>. Die Folge war e<strong>in</strong> massiver Beschäftigungsrückgang (Schwartz/Wismar 1998). Andere Kostendämpfungsmaßnahmen<br />
konnten ke<strong>in</strong>e ähnlich markante Wirkung entfalten. So hat z.B. die Ablösung<br />
des Selbstkostendeckungspr<strong>in</strong>zips <strong>in</strong> den allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäusern zwar zu e<strong>in</strong>er Reduktion<br />
der Pflegetage geführt, e<strong>in</strong>e effektive Kostendämpfung konnte jedoch nicht hergestellt werden (Busse/Schwartz<br />
1997).<br />
Die sektorale Budgetierung im ambulanten Sektor wird mittelbar für e<strong>in</strong>e beschäftigungshemmende<br />
Wirkung verantwortlich gemacht, die zum Beschäftigungsabbau bei den Sprechst<strong>und</strong>enhilfen ab 1995<br />
beigetragen hat. Dies zum<strong>in</strong>dest belegt für Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz e<strong>in</strong>e durch das (Zentral<strong>in</strong>stitut für die Kassenärztliche<br />
Versorgung 1998) durchgeführte Befragung. Die Ursache liegt <strong>in</strong> der konsequenteren<br />
Budgetierungspolitik im ambulanten Sektor, die mit dem GSG vom 21.12. 1992 e<strong>in</strong>geführt wurde. So<br />
wurde u.a. das Wachstum des Budgets gesetzlich an die E<strong>in</strong>nahmesituation der Krankenkassen angeb<strong>und</strong>en.<br />
Um Kosten zu sparen, haben viele niedergelassene Ärzt/<strong>in</strong>nen von E<strong>in</strong>stellungen abgesehen<br />
<strong>und</strong> Personal abgebaut. E<strong>in</strong>e ähnlich beschäftigungshemmende Wirkung ist auch für die nichtärztlichen<br />
Heilhilfsberufe festzustellen. Aufgr<strong>und</strong> der ökonomischen Abhängigkeit von den Vertragsärzten,<br />
stellt sich der weitere Ausbau der Beschäftigtenzahlen <strong>in</strong> diesen Berufsgruppen als schwierig dar.<br />
Der Versuch, die Vertragsarztzahlen zu regulieren, um e<strong>in</strong>e Überversorgung <strong>und</strong> damit e<strong>in</strong>e nicht erwünschte<br />
Leistungs- <strong>und</strong> Kostenausweitung zu vermeiden, hat e<strong>in</strong>e beschäftigungsdämpfende Wirkung<br />
gezeigt, d.h., es kam zu e<strong>in</strong>er Wachstumsverlangsamung der Vertragsarztzahlen. Die Instrumente,<br />
die e<strong>in</strong>gesetzt wurden, s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>erseits die Reduktion der Studienplatzkapazitäten, andererseits die<br />
mit dem GSG verschärfte Bedarfszulassung, die letztlich e<strong>in</strong>e regionale Zulassungsbeschränkung darstellt.<br />
Von 1985 bis zum Inkrafttreten des GSG lagen die jährlichen prozentualen Steigerungsraten der<br />
Vertragsärzte zwischen 1,3 <strong>und</strong> 4,6 %, <strong>in</strong> den Jahren danach zwischen 1,7 <strong>und</strong> 2,4 %. Allerd<strong>in</strong>gs<br />
führte die E<strong>in</strong>führung der regionalen Umverteilungsregelung ab dem 31. Januar 1993 zu e<strong>in</strong>er regelrechten<br />
Niederlassungswelle. Die prozentuale Steigerung von 1992 auf 1993 betrug nie wieder erreichte<br />
8,7%, was die Drosselung der Zunahme <strong>in</strong> den Folgejahren mehr als kompensierte.<br />
Die Ausgrenzung von Bagatellarzneimitteln, die Erhöhung der Zuzahlung (alle<strong>in</strong> zwischen 1977 <strong>und</strong><br />
1998 wurde die Zuzahlung elf mal modifiziert), die Festbetragsregelung, das Preismoratorium oder der<br />
Preisabschlag haben auf Teile der Pharma<strong>in</strong>dustrie Auswirkungen gehabt. Folglich s<strong>in</strong>d hier Beschäftigungsrückgänge<br />
plausibel. Es ist allerd<strong>in</strong>gs zu beachten, dass Teile der deutschen Pharma<strong>in</strong>dustrie<br />
stark exportorientiert s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> folglich von Umsatze<strong>in</strong>bußen nicht <strong>in</strong> dem Maße betroffen wie ausschließlich<br />
<strong>in</strong>ländisch arbeitende Unternehmen. H<strong>in</strong>zu kommt, dass <strong>in</strong>sbesondere beim Preismoratori-<br />
- 108 -
E<strong>in</strong>flussfaktoren auf die Beschäftigungsentwicklung<br />
um <strong>und</strong> dem Preisabschlag, die mit Art. 29 des GSG e<strong>in</strong>geführt wurden, die großen Pharmafirmen<br />
aufgr<strong>und</strong> ihrer breit gefächerten Produktpaletten die Möglichkeit hatten, ihr gesamtes Angebot neu zu<br />
strukturieren <strong>und</strong> somit die Ausfälle zu kompensieren (Wismar 1996; Busse/Howorth 1996). Auch der<br />
Wegfall der Bagatellarzneimittel hat eher zu Umschichtungsprozessen geführt, die durch e<strong>in</strong>e Kompensation<br />
<strong>in</strong> der Verschreibungspraxis begründet s<strong>in</strong>d. So wurden effektivere <strong>und</strong> teurere Arzneimittel<br />
verschrieben, statt der nicht mehr erstattungsfähigen Bagatellarzneimittel (Reichelt 1994). Generell ist<br />
somit festzuhalten, dass die verschiedenen E<strong>in</strong>griffe der Kostendämpfungspolitik zwar e<strong>in</strong>e beschäftigungshemmende<br />
Wirkung entfalteten, jedoch nur <strong>in</strong> den seltensten Fällen e<strong>in</strong> Personalabbau oder auch<br />
nur e<strong>in</strong>e Stagnation erfolgte.<br />
3.1.2.3. Arbeitsrecht<br />
Durch die Verkürzung der wöchentlichen tariflichen Arbeitszeit ersche<strong>in</strong>t e<strong>in</strong> beschäftigungsfördernder<br />
Effekt <strong>in</strong> allen untersuchten Sektoren plausibel. Auch konnte <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen e<strong>in</strong> Trend<br />
zur Teilzeitbeschäftigung <strong>in</strong> Krankenhäusern belegt werden. Zwischen 1985 <strong>und</strong> 1998 belief sich die<br />
Arbeitszeitverkürzung, bezogen auf den B<strong>und</strong>esangestellten Tarifvertrag, allerd<strong>in</strong>gs nur auf 3,8%. So<br />
wurde die wöchentliche tarifliche Arbeitszeit zum 01.04.1989 von 40 auf 39 St<strong>und</strong>en <strong>und</strong> zum<br />
01.04.1990 auf 38,5 St<strong>und</strong>en reduziert. Seit den fünfziger Jahren bis Mitte der achtziger Jahre erfolgte<br />
e<strong>in</strong>e Arbeitszeitverkürzung von ursprünglich 48 Wochenst<strong>und</strong>en auf 40, dieser Rückgang war mit gut<br />
16% des Ausgangswertes also weitaus höher.<br />
Seit dem 01.01.1996 gilt auch für den Ärztlichen Dienst <strong>und</strong> den Pflegedienst <strong>in</strong> Krankenhäusern das<br />
bereits zum 01.07.1994 <strong>in</strong> Kraft getretene Arbeitszeitgesetz (ArbZG) une<strong>in</strong>geschränkt. Laut § 1 des<br />
ArbZG besteht der Zweck der gesetzlichen Regelung dar<strong>in</strong>, die Sicherheit <strong>und</strong> den Ges<strong>und</strong>heitsschutz<br />
der Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Arbeitnehmer bei der Arbeitszeitgestaltung zu gewährleisten <strong>und</strong> die<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für flexible Arbeitszeiten zu verbessern. Im Vorfeld wurde, <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> Zusammenhang<br />
mit der Ruhezeitregelung § 5 ArbZG, die Befürchtung geäußert, dass mit der korrekten<br />
Anwendung der entsprechenden Regelungen e<strong>in</strong> zusätzlicher Stellenbedarf <strong>in</strong> den Krankenhäusern<br />
anfalle. Da jedoch <strong>in</strong> vielen Krankenhäusern zusätzliche Stellen nicht zu f<strong>in</strong>anzieren waren, wurden<br />
neue Arbeitszeitmodelle propagiert (Freizeitausgleich für Bereitschaftsdienste, E<strong>in</strong>führung von zeitversetzten<br />
Diensten bzw. Zwischendiensten, E<strong>in</strong>führung/ Ausbau von flexiblen Arbeitszeitmodellen,<br />
Pausenregelung im Nachtdienst, z.B. durch Spr<strong>in</strong>gerwache, teilweise Umwandlung der Nachtdienste<br />
<strong>in</strong> Bereitschaftsdienste) (Asmuth et al. 1999). E<strong>in</strong>e Folge war die Flexibilisierung der Personalplanung<br />
im Krankenhaus für den Pflegedienst. So wurden laut e<strong>in</strong>er b<strong>und</strong>esweit durchgeführten Studie im Jahr<br />
1997 <strong>in</strong> 30,8% der Krankenhäuser vermehrt Vollzeitstellen <strong>in</strong> Teilzeitstellen umgewandelt (Asmuth/Blum/Fack-Asmuth/Gumbrich/Müller/Offermanns<br />
1999).<br />
3.1.3. Mediz<strong>in</strong>isch-technischer Fortschritt<br />
Der mediz<strong>in</strong>isch-technische Fortschritt wird aus ökonomischer Perspektive <strong>in</strong> Produkt- <strong>und</strong> Prozess<strong>in</strong>novationen<br />
unterschieden (Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
1998). Produkt<strong>in</strong>novationen erbr<strong>in</strong>gen neue „Outcomes“ <strong>in</strong> Prävention, Diagnostik, Therapie <strong>und</strong> Re-<br />
- 109 -
E<strong>in</strong>flussfaktoren auf die Beschäftigungsentwicklung<br />
habilitation, während Prozess<strong>in</strong>novationen die Effizienz bereits vorhandener Versorgungsangebote<br />
steigern. Neben den Produkt- <strong>und</strong> Prozess<strong>in</strong>novationen werden auch Professionalisierungstendenzen<br />
von Ges<strong>und</strong>heitsprofessionen behandelt.<br />
Kernaussagen:<br />
• Produkt<strong>in</strong>novationen dom<strong>in</strong>ieren im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> <strong>und</strong> führen durch e<strong>in</strong>e Ausweitung des<br />
Leistungsgeschehens zu beschäftigungsfördernden Effekten. Diese lassen sich jedoch nicht quantifizieren.<br />
• Prozess<strong>in</strong>novationen s<strong>in</strong>d nur <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen klar nachweisbar. Dort, wo sie auf die Gliederung<br />
der Versorgungsketten wirken, s<strong>in</strong>d sie meist im Rahmen von Qualitäts- <strong>und</strong> Bedarfsdeckungsmaßnahmen<br />
entstanden.<br />
• Die nichtärztlichen Heilhilfsberufe haben sich e<strong>in</strong>e Nachfrage mit beschäftigungsfördernder Wirkung<br />
geschaffen, die allerd<strong>in</strong>gs teilweise durch die sozialrechtlichen Vorgaben begrenzt wird.<br />
3.1.3.1. Produkt<strong>in</strong>novationen<br />
Produkt<strong>in</strong>novationen werden neben dem demographischen Wandel häufig als e<strong>in</strong>e Haupttriebfeder der<br />
Kosten- <strong>und</strong> Leistungsentwicklung benannt (Krämer 1996; Krämer 1989). Begründet wird dies mit<br />
dem Umstand, dass die Zahl der Produkt<strong>in</strong>novationen die der Prozess<strong>in</strong>novationen übersteigt<br />
(Bruckenberger 1990; 1987) <strong>und</strong> es nur <strong>in</strong> seltenen Fällen zu e<strong>in</strong>er Substitution kommt.<br />
An den Beispielen Kardiologie, Herzchirurgie, Transplantationsmediz<strong>in</strong> sowie dem E<strong>in</strong>satz von Großgeräten<br />
konnten die Auswirkungen des mediz<strong>in</strong>ischen Fortschritts auf das Leistungsgeschehen belegt<br />
werden Die diagnostische <strong>und</strong> therapeutische Erschließung von Indikationen durch Produkt<strong>in</strong>novationen<br />
führt zu e<strong>in</strong>er Leistungsexpansion. Mit dieser Entwicklung s<strong>in</strong>d auch unmittelbare beschäftigungsfördernde<br />
Wirkungen verb<strong>und</strong>en. Die leichten Beschäftigungszuwächse der mediz<strong>in</strong>isch-technischen<br />
Assistenzberufe <strong>und</strong> der Funktionsdienste <strong>in</strong> den allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäusern lassen sich aller Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit<br />
auf technische Innovationen zurückführen.<br />
Dabei s<strong>in</strong>d zusätzliche Beschäftigungseffekte nicht berücksichtigt, die sich z.B. aus der Anschlussbehandlung<br />
ergeben. Freilich muss beachtet werden, dass der Zeitpunkt der E<strong>in</strong>führung von Produkt<strong>in</strong>novationen<br />
<strong>und</strong> ihre Diffusionsgeschw<strong>in</strong>digkeit sich unterscheiden. Der Beschäftigungseffekt wirkt<br />
über größere Zeiträume. Es muss allerd<strong>in</strong>gs auch angemerkt werden, dass der E<strong>in</strong>satz von Mediz<strong>in</strong>technik<br />
allgeme<strong>in</strong> durch Kostendämpfungsmaßnahmen befördert wird. Dies lässt sich an der Budgetierung<br />
im ambulanten Bereich beobachten: Dem Wertverfall der Punkte wird durch die gesteigerte Anwendung<br />
mediz<strong>in</strong>isch-technischer Apparate begegnet, womit der berüchtigte Hamsterradeffekt e<strong>in</strong>tritt<br />
(Schwartz/Busse 1996).<br />
Für die Erklärung des mediz<strong>in</strong>ischen Fortschritts konkurrieren mehrere Thesen. Die sogenannte<br />
"Technologie-Anstoß-Hypothese" hebt als primäre Triebfeder Basis<strong>in</strong>novationen hervor, die wiederum<br />
Folgeentwicklungen e<strong>in</strong>leiten. Diese münden <strong>in</strong> neuen Produkten <strong>und</strong> Verfahren. E<strong>in</strong> weiterer<br />
Ansatz ist die sogenannte "Nachfrage-Hypothese". Unterstellt wird, dass zukünftige Ertragserwartungen<br />
die Forschungs- <strong>und</strong> Entwicklungsaktivitäten von Unternehmen bestimmen (Sachverständigenrat<br />
1998). In diesem S<strong>in</strong>ne können sich antizipative Unternehmensstrategien auf den demographischen<br />
Wandel <strong>und</strong> die dadurch bed<strong>in</strong>gten Veränderungen im Morbiditätspanorama beziehen.<br />
- 110 -
E<strong>in</strong>flussfaktoren auf die Beschäftigungsentwicklung<br />
Neben dem demographischen Wandel spielen allerd<strong>in</strong>gs auch sozialrechtliche Interventionen bei der<br />
Diffusion von Großgeräten e<strong>in</strong>e Rolle. Jedoch gelten die seit Anfang der 80er Jahre e<strong>in</strong>geführten Regelungen<br />
zur Steuerung der Diffusion <strong>und</strong> regionalen Verteilung von mediz<strong>in</strong>isch-technischen Großgeräten<br />
weitgehend als gescheitert. Mit dem 2. NOG wurde die seit dem GSG geltende sektorenübergreifende<br />
Großgerätesteuerung auf Landesebene aufgehoben (Sachverständigenrat 1998).<br />
3.1.3.2. Prozess<strong>in</strong>novationen<br />
Die Bestimmung der Beschäftigungswirkungen von Prozess<strong>in</strong>novationen ist ungleich komplizierter.<br />
Zum e<strong>in</strong>en ist <strong>in</strong> vielen Fällen die Grenze zu den Produkt<strong>in</strong>novationen schwer zu ziehen. Nur wenn die<br />
Kosten <strong>und</strong> die Outcomes e<strong>in</strong>er Innovation e<strong>in</strong>deutig s<strong>in</strong>d, lässt sich die Prozess<strong>in</strong>novation klar von<br />
der Produkt<strong>in</strong>novation unterscheiden. Zum anderen können tendenziell beschäftigungshemmende Effekte<br />
e<strong>in</strong>er Prozess<strong>in</strong>novation durch Mengeneffekte ausgeglichen oder sogar mehr als kompensiert<br />
werden.<br />
Als Prozess<strong>in</strong>novation gilt z.B. die Ablösung der radiologischen Gallenste<strong>in</strong>diagnostik durch die sonografische.<br />
Häufig wird auch die m<strong>in</strong>imal-<strong>in</strong>vasive Chirurgie als Prozess<strong>in</strong>novation angeführt. Die<br />
Behandlung durch die "Schlüssellochtechnologie" schont den Patienten <strong>und</strong> ermöglicht e<strong>in</strong>e raschere<br />
Mobilisierung. Damit entfallen Pflegetage, die bei e<strong>in</strong>er konventionellen Operation notwendig wären.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs ist unklar, ob tatsächlich die Operationsmethode effizienter ist. Der Operationsaufwand ist<br />
größer, die Operation dauert länger <strong>und</strong> die Frage der möglichen Komplikationen muss von Fall zu<br />
Fall geklärt werden.<br />
Prozess<strong>in</strong>novationen, die zu e<strong>in</strong>er Verm<strong>in</strong>derung der Ausgaben, niedrigeren Komplikationsraten oder<br />
ger<strong>in</strong>geren Belastungen für den Patienten führen, können dennoch beschäftigungsfördernd wirken.<br />
Dies ist dann der Fall, wenn Mittel frei werden, um e<strong>in</strong>e größere Patientenzahl zu behandeln oder<br />
wenn die Behandlung auch auf Risikogruppen ausgedehnt werden kann, für die die ältere Behandlungsmethode<br />
nicht <strong>in</strong> Frage gekommen wäre.<br />
Prozess<strong>in</strong>novationen können auch durch Veränderungen <strong>in</strong> den Versorgungsketten wirken. Hierbei ist<br />
allerd<strong>in</strong>gs anzumerken, dass z.B. die Umwidmung von Krankenhaus- <strong>in</strong> Pflegebetten oder die Umsetzung<br />
des dezentralen Psychiatriekonzepts gleichzeitig e<strong>in</strong>e Qualitäts- <strong>und</strong> Bedarfsdeckungsmaßnahme<br />
ist (Flöhl 2000). E<strong>in</strong> ähnliches Beispiel ist im organisatorischen Fortschritt der Behandlung des Diabetes<br />
mellitus zu sehen. Nach der vorherrschenden Me<strong>in</strong>ung der Fachvertreter liegen die wesentlichen<br />
Probleme <strong>in</strong> der Diabetesbetreuung vor allem <strong>in</strong> der Umstrukturierung der Versorgungskette. Verschiedene<br />
Modellprojekte versuchen hier neue Wege zu gehen. Ob aber <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Gesamtkostenkalkulation<br />
kle<strong>in</strong>ere, gleiche oder größere Ersparnisse den direkten <strong>und</strong> <strong>in</strong>direkten Kosten gegenüberstehen,<br />
kann nicht e<strong>in</strong>deutig beantwortet werden. Auch <strong>in</strong> diesem Fall müssen Prozess<strong>in</strong>novationen nicht notwendigerweise<br />
beschäftigungshemmende Wirkung entfalten.<br />
3.1.3.3. Professionalisierung<br />
Die Professionalisierung (Bauch 1996) der Ärzteschaft, obgleich vollständig abgeschlossen, ist von<br />
überragender Bedeutung auch für die nicht-ärztlichen Berufe des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s. Denn die ge-<br />
- 111 -
E<strong>in</strong>flussfaktoren auf die Beschäftigungsentwicklung<br />
glückte Monopolisierung weitreichender Bereiche der ges<strong>und</strong>heitlichen Dienstleistungen, die Dom<strong>in</strong>anz<br />
der mediz<strong>in</strong>ischen Wissensbasis <strong>und</strong> die hervorgehobene Stellung <strong>in</strong> der Versorgungskette determ<strong>in</strong>ieren<br />
zu e<strong>in</strong>em Gutteil die Professionalisierungschancen der nicht-ärztlichen Heilberufe.<br />
Der Wertewandel <strong>in</strong> der Bevölkerung hat allerd<strong>in</strong>gs zu e<strong>in</strong>er Kritik der exklusiven Position der Ärzte<br />
geführt. Die <strong>in</strong> den 70er Jahren aufkommende sozialmediz<strong>in</strong>ische Kritik am <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> (Ilich<br />
1976; McKeown 1976) <strong>und</strong> die im Rahmen der neuen Sozialen Bewegung entstandene Ges<strong>und</strong>heitsbewegung<br />
(Deppe 1987) haben die Monopolstellung der Ärzteschaft nachhaltig <strong>in</strong> Frage gestellt.<br />
Gleichzeitig wurden mit der Kostendämpfungspolitik ihre E<strong>in</strong>kommenschancen <strong>und</strong> berufliche Autonomie<br />
tangiert (Behaghel 1994). E<strong>in</strong>e professions<strong>in</strong>terne Identitätsbildung wird zunehmend erschwert.<br />
Dies kommt auch <strong>in</strong> der abnehmenden Zufriedenheit der Ärzteschaft mit ihren Verbänden <strong>und</strong> Körperschaften<br />
zum Ausdruck (Brechtel/Schnee 1999).<br />
Trotz ihrer zahlenmäßigen Bedeutung, kann die Professionalisierung der Krankenpflege nicht als abgeschlossen<br />
gelten, wenngleich seit den 90er Jahren wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der<br />
Pflege gesetzt wurden. Pflege als marktfähige Dienstleistung hat sich nach e<strong>in</strong>er sehr langen Tradition<br />
der vorberuflichen, re<strong>in</strong> karitativen Krankenpflege <strong>in</strong> Deutschland erst im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert schrittweise<br />
als ärztliche Assistenztätigkeit neu konzipiert. In der Altenpflege war diese Entwicklung noch stärker<br />
verzögert <strong>und</strong> hat erst seit den späten 80er Jahren <strong>und</strong> schließlich <strong>in</strong> den 90er Jahren mit E<strong>in</strong>führung<br />
des PflegeVG e<strong>in</strong>e erhebliche Beschleunigung erfahren. Ungeachtet der zunehmenden Marktfähigkeit<br />
der Krankenpflege konnte die e<strong>in</strong>geleitete Verberuflichung nicht vollständig vollzogen werden. Die<br />
Pflege blieb – von der Ausbildungssituation her betrachtet - e<strong>in</strong> mediz<strong>in</strong>alisierter Sonderberuf. Die<br />
Verwissenschaftlichung der Ausbildung <strong>und</strong> damit e<strong>in</strong>her gehend ihre Ablösung vom mediz<strong>in</strong>ischen<br />
Wissen des Arztes ist erst <strong>in</strong> jüngster Zeit angestrebt worden. Pflegestudiengänge gibt es mittlerweile<br />
an zahlreichen Fachhochschulen <strong>und</strong> drei Universitäten, weitere s<strong>in</strong>d geplant. Die Autonomie der<br />
Krankenpflege ist noch immer begrenzt, wenngleich, die Tradition als "Heilberuf im Schatten des<br />
Arztes" spätestens seit der Pflegenotstandsdiskussion Ende der 80er Jahre nicht mehr konsensfähig ist<br />
(Schaeffer et al. 1998).<br />
Mit dem Psychotherapeutengesetz, das nicht die Psychotherapie <strong>in</strong> Deutschland regelt, sondern vielmehr<br />
e<strong>in</strong> Berufsgesetz ist, wird e<strong>in</strong>erseits der Beruf der Psychotherapeut/<strong>in</strong>nen formal den Heilberufen<br />
der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, <strong>und</strong> Apotheker gleichgestellt. Andererseits werden die Psychotherapeut/<strong>in</strong>nen<br />
<strong>in</strong> das System der GKV e<strong>in</strong>gegliedert. Verb<strong>und</strong>en ist damit die Ablösung vom Delegationsverfahren<br />
(Geuter 1999). Gleichzeitig geht die "Verkammerung" des Berufsbilds Psychotherapeut/<strong>in</strong><br />
voran. Damit werden <strong>in</strong> eigener Regie die Überwachung der E<strong>in</strong>haltung der Berufspflichten<br />
<strong>und</strong> der Standesnormen sowie Fort- <strong>und</strong> Weiterbildungsmaßnahmen betrieben. In Niedersachsen, Berl<strong>in</strong><br />
<strong>und</strong> Bremen wurden diese bereits 1999 abgeschlossen, <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen läuft gegenwärtig<br />
noch das Gesetzgebungsverfahren (Bühr<strong>in</strong>g 2000).<br />
Wenn auch von e<strong>in</strong>em niedrigen Ausgangsniveau ausgehend, verzeichneten im ambulanten Sektor die<br />
Berufsgruppen Heilpraktiker/<strong>in</strong>nen, Logopäd/<strong>in</strong>nen, Krankengymnast/<strong>in</strong>nen/Physiotherapeut/<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Beschäftigungstherapeut/<strong>in</strong>nen erhebliche Zuwächse im Untersuchungszeitraum. Dabei s<strong>in</strong>d die<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen ihrer Professionalisierung schwierig. Heilpraktiker/<strong>in</strong>nen s<strong>in</strong>d für die GKV nicht<br />
zugelassen (Beske/Hallauer 1999). Die anderen Professionen hängen am Tropf der ärztlichen Verordnungen,<br />
die aufgr<strong>und</strong> von Budgetierungsmaßnahmen nicht immer umfangreich fließen. Das starke<br />
- 112 -
E<strong>in</strong>flussfaktoren auf die Beschäftigungsentwicklung<br />
Wachstum dieser Berufe sche<strong>in</strong>t aber auf e<strong>in</strong>em erheblichen Nachfragepotenzial <strong>in</strong> der Bevölkerung<br />
zu beruhen.<br />
- 113 -
Ausblick <strong>und</strong> Prognose<br />
4. Annahmen über zukünftige Entwicklungspfade <strong>und</strong> Beschäftigungsperspektiven<br />
des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
Ra<strong>in</strong>er Fretschner, Josef Hilbert, Christiane Rohleder, Günter Roth, Matthias Wismar, Markus<br />
Wörz<br />
Die E<strong>in</strong>schätzung, dass das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> auch <strong>in</strong> Zukunft zu den Wachstumsbranchen zu zählen<br />
se<strong>in</strong> wird, setzt sich unter <strong>Arbeitsmarkt</strong>expert/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Kennern des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s zunehmend<br />
durch. E<strong>in</strong>e Vielzahl von Veröffentlichungen der letzten Jahre sehen die Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft als<br />
Zukunftsbranche mit Chancen für Wachstum <strong>und</strong> Beschäftigung. 59 Im Folgenden wird die zukünftige<br />
Entwicklung zentraler E<strong>in</strong>flussfaktoren <strong>und</strong> Herausforderungen dargestellt, die diese E<strong>in</strong>schätzung<br />
plausibel machen, aber auch H<strong>in</strong>weise auf mögliche Hemmnisse geben. Daran anschließend werden<br />
für die vier Teilbereiche ambulante Versorgung, stationäre Versorgung, Altenhilfe sowie Zuliefer<strong>in</strong>dustrien<br />
<strong>und</strong> Nachbarbranchen Prognosen zur zukünftigen Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> Form alternativer<br />
Entwicklungsszenarien entworfen.<br />
4.1. Allgeme<strong>in</strong>e Entwicklungstrends: Sozio-demographische, kulturelle <strong>und</strong><br />
ökonomische Entwicklung<br />
Die Auswirkungen der gesellschaftlichen <strong>und</strong> demographischen Entwicklung auf Wachstum <strong>und</strong> Beschäftigung<br />
im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> lassen sich nur grob umreißen. Die Bevölkerungsprognose des Landesamtes<br />
für Datenverarbeitung <strong>und</strong> Statistik NRW sieht die Zahl der über 80-Jährigen <strong>und</strong> älteren<br />
von ca. 657.000 im Jahr 1998 um r<strong>und</strong> 30% auf ca. 855.000 im Jahr 2015 steigen. Die Zahl der 75 bis<br />
79-Jährigen wird von ca. 556.000 auf ca. 775.000 um r<strong>und</strong> 39% zunehmen bei e<strong>in</strong>em gleichzeitigen<br />
Rückgang der Gesamtbevölkerung um 1,2% bis 2015. Demgegenüber wird der Anstieg der 65 bis 74-<br />
Jährigen ger<strong>in</strong>ger ausfallen. Er erreicht im Jahr 2007 e<strong>in</strong>en Höhepunkt <strong>und</strong> wird im Jahr 2015 sogar<br />
unter das Niveau von 1998 s<strong>in</strong>ken.<br />
59 Vgl. hierzu etwa Oberender/Hebborn 1994; Bandemer/Hilbert 1996; Hilbert 2000; Nefiodow 1996; SVRA-<br />
KAiG 1996; Bandemer/Hilbert/Schulz 1998; Henzler/Späth 1998; Grönemeyer 1999; Katthagen/Buckup<br />
1999.<br />
- 114 -
Ausblick <strong>und</strong> Prognose<br />
Abb. 24 Die Bevölkerungsprognose des Landesamtes für Datenverarbeitung <strong>und</strong> Statistik<br />
des Landes Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen bis zum Jahr 2015 (1998 = 100)<br />
150,00%<br />
140,00%<br />
130,00%<br />
120,00%<br />
110,00%<br />
100,00%<br />
90,00%<br />
Quelle: LDS<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015<br />
65 bis 74 Jahre 75 bis 79 Jahre 80 Jahre <strong>und</strong> ältere Bev. Insgesamt<br />
Die Frage, ob die Alterung der Gesellschaft e<strong>in</strong>en erhöhten Versorgungsbedarf nach sich zieht, wird<br />
kontrovers diskutiert. Der Medikalisierungsthese steht die Kompressionsthese gegenüber (vgl. zum<br />
folgenden B<strong>und</strong>estags-Drucksache 13/11460 1998: 220). Erstere besagt, dass sowohl die Gesamtmorbidität<br />
<strong>in</strong> Relation zur Gesamtbevölkerung, als auch die altersspezifische Morbidität wegen des mediz<strong>in</strong>ischen<br />
Fortschritts zunehmen werden. Damit e<strong>in</strong>her geht die Annahme, dass viele Erkrankungen<br />
nicht erst am Lebensende, sondern schon im jungen Lebensalter auftreten <strong>und</strong> zu e<strong>in</strong>er Chronifizierung<br />
von Krankheiten führen. Auf der anderen Seite geht die Kompressionsthese davon aus, dass zukünftig<br />
der größte Teil des Lebenszyklus <strong>in</strong>folge e<strong>in</strong>er verbesserten mediz<strong>in</strong>ischen Versorgung <strong>und</strong><br />
e<strong>in</strong>er gesünderen Lebensweise frei von chronischen Krankheiten zugebracht wird. Lebensabschnitte<br />
mit ges<strong>und</strong>heitlichen E<strong>in</strong>schränkungen werden dieser Auffassung zufolge mit der steigenden Lebenserwartung<br />
<strong>in</strong> das höhere Lebensalter verschoben. Die Lebensphase mit e<strong>in</strong>er erhöhten Morbidität werde<br />
mith<strong>in</strong> komprimiert. Der Gew<strong>in</strong>n an Lebensjahren gehe mit e<strong>in</strong>er gleichzeitigen Abnahme der<br />
Krankheitsbelastung für alle Altersgruppen e<strong>in</strong>her.<br />
Diesen beiden entgegengesetzten Thesen steht der vermittelnde Ansatz von R.C. Kane gegenüber. Er<br />
besagt, dass sich der Ges<strong>und</strong>heitszustand der Bevölkerung e<strong>in</strong>erseits verbessert, jedoch andererseits<br />
der Anteil an beh<strong>in</strong>derten <strong>und</strong> <strong>in</strong> jüngerem Lebensalter ges<strong>und</strong>heitlich bee<strong>in</strong>trächtigten Menschen ansteigt.<br />
Somit kann man zusammenfassend festhalten, dass <strong>in</strong> der wissenschaftlichen Literatur h<strong>in</strong>sichtlich<br />
der Frage, ob <strong>und</strong> wie die Behandlungsbedürftigkeit <strong>und</strong> damit der Versorgungsbedarf <strong>in</strong>folge des<br />
demographischen Wandels zunehmen wird, ke<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>igkeit herrscht.<br />
Die bisherige Entwicklung lässt jedoch eher darauf schließen, dass mit dem demographischen Wandel<br />
e<strong>in</strong> Mehrbedarf an professionellen Hilfs- <strong>und</strong> Pflegeangeboten sowie geronto-mediz<strong>in</strong>ischen Leistun-<br />
- 115 -
Ausblick <strong>und</strong> Prognose<br />
gen e<strong>in</strong>hergehen wird, der nur durch e<strong>in</strong>en Ausbau der entsprechenden Hilfs- <strong>und</strong> Pflegekapazitäten<br />
gedeckt werden kann (vgl. Naegele 1999: 81ff).<br />
Bislang wurde die Wirkung des demographischen Wandels vor allem unter dem Gesichtspunkt behandelt,<br />
ob mit e<strong>in</strong>er erhöhten Nachfrage nach Ges<strong>und</strong>heitsdienstleistungen zu rechnen ist. Die s<strong>in</strong>kenden<br />
Geburtenraten werfen jedoch auch die Frage auf, ob es <strong>in</strong> Zukunft e<strong>in</strong> ausreichendes Potenzial an<br />
Pflegekräften geben wird. So wurde bereits Anfang der 90er Jahre prognostiziert, dass es <strong>in</strong>folge des<br />
Geburtenrückgangs zu erheblichen Rekrutierungsproblemen im Pflegebereich kommen wird (Alber<br />
1990) – e<strong>in</strong>e Entwicklung, die gegenwärtig <strong>in</strong> den Niederlanden beobachtet werden kann. Allerd<strong>in</strong>gs<br />
wird das Erwerbspersonenpotenzial erst ab dem Jahr 2010 leicht <strong>und</strong> ab dem Jahr 2015 drastisch demopraphisch<br />
bed<strong>in</strong>gt zurückgehen (vgl. Deutscher B<strong>und</strong>estag 1998: 215). In Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
besteht zudem noch ke<strong>in</strong> Anlass zur Sorge um mangelndes Interesse an Pflegeberufen: Im Jahr 1992<br />
betrug das Verhältnis von neu belegbaren Ausbildungsplätzen zu Ausbildungs<strong>in</strong>teressierten 1:3, im<br />
Jahr 1997 1:12 (Rohleder/Krämer 1998: 47). Problematisch <strong>in</strong> diesem Zusammenhang ersche<strong>in</strong>t eher<br />
der <strong>in</strong> Kap. 2.1.1 deutlich gewordene Abbau von Ausbildungskapazitäten im Bereich der Kranken<strong>und</strong><br />
Altenpflege.<br />
E<strong>in</strong>en nicht unwesentlichen E<strong>in</strong>fluss auf die Beschäftigung <strong>in</strong> der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft haben die<br />
sozialen <strong>und</strong> kulturellen Wandlungsprozesse. Mit zunehmendem Wohlstand, der weiteren Individualisierung<br />
<strong>und</strong> Pluralisierung steigt das Bedürfnis nach ges<strong>und</strong>heitlichem Wohlbef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Lebensqualität.<br />
In Zukunft wird das Gut Ges<strong>und</strong>heit e<strong>in</strong>en steigenden Stellenwert <strong>in</strong> der Bedürfnis- <strong>und</strong> Wertehierarchie<br />
der Bevölkerung e<strong>in</strong>nehmen (vgl. Wasem 1999: 13). Die Bereitschaft, wachsende Teile des<br />
verfügbaren Haushaltse<strong>in</strong>kommens <strong>in</strong> ges<strong>und</strong>heitsbezogene Leistungen zu <strong>in</strong>vestieren, wird steigen.<br />
Wachstumspotenziale bieten sich etwa im Bereich der nichtärztlichen mediz<strong>in</strong>ischen Heilhilfsberufe,<br />
<strong>in</strong>sbesondere bei den Berufen, deren Leistungen nicht e<strong>in</strong>em strengen öffentlichen Kostenmanagement<br />
unterliegen, aber auch <strong>in</strong> den Bereichen Wellness, Fitness, Sicherheit <strong>und</strong> Schönheit. Wie <strong>in</strong>ternational<br />
vergleichende Studien zeigen, ist die Bedeutung privater Mittel für die Ges<strong>und</strong>heitsversorgung <strong>in</strong> der<br />
B<strong>und</strong>esrepublik bislang eher unterdurchschnittlich; dies gilt auch im Vergleich mit Ländern, die durch<br />
e<strong>in</strong>e vorwiegend staatlich organisiertes Ges<strong>und</strong>heitssystem gekennzeichnet s<strong>in</strong>d (s. Anhang, Tab. A<br />
21).<br />
Als e<strong>in</strong> weiterer Effekt des sozialen <strong>und</strong> kulturellen Wandels ist mit e<strong>in</strong>er Ausweitung der Frauenerwerbstätigkeit<br />
zu rechnen. Hier besteht gerade auch <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen e<strong>in</strong> Nachholbedarf, der im<br />
Ges<strong>und</strong>heitsheitswesen zu e<strong>in</strong>em sich selbst verstärkenden Effekt beitragen kann: Da die familiale<br />
Pflege überwiegend von bislang nichterwerbstätigen Frauen übernommen wird, steigt bei deren E<strong>in</strong>tritt<br />
<strong>in</strong>s Erwerbsleben auch die Nachfrage nach professionellen Pflegeleistungen.<br />
Schließlich wirkt sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung entscheidend auf die zukünftigen Beschäftigungsperspektiven<br />
im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> aus. Insbesondere von der Gesamtzahl <strong>und</strong> –quote der<br />
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten werden (im Rahmen des deutschen Sozialversicherungssystems)<br />
wichtige Weichenstellungen gesetzt. Sollte sich die E<strong>in</strong>nahmeseite der GKV <strong>und</strong> der Pflegeversicherung<br />
<strong>in</strong> Zukunft <strong>in</strong>folge e<strong>in</strong>er günstigen wirtschaftlichen Entwicklung positiver darstellen als<br />
<strong>in</strong> den letzten Jahren, entstehen neue Chancen für mehr Beschäftigung. Die Mehrzahl der prognostisch<br />
arbeitenden Wirtschaftsforscher sieht diesbezüglich den kommenden Jahren eher zuversichtlich entgegen<br />
<strong>und</strong> nimmt e<strong>in</strong> Wachstum des BSP von jährlich 1-2% an (Deutscher B<strong>und</strong>estag 1998: 218 f.).<br />
- 116 -
Ausblick <strong>und</strong> Prognose<br />
Wie nachhaltig der Niederschlag der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung für die Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft<br />
se<strong>in</strong> wird, hängt auch davon ab, ob <strong>und</strong> wie die rechtlichen F<strong>in</strong>anzierungsbed<strong>in</strong>gungen geändert<br />
werden. Diskutiert wird hier vor allem über e<strong>in</strong>e Ausweitung der Versicherungspflicht.<br />
Weitere Mittel könnten dadurch gewonnen werden, dass verstärkt ausländische K<strong>und</strong>en angeworben<br />
werden. Der <strong>in</strong>ternationale Dienstleistungstransfer – auch <strong>in</strong> der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft - hat sich <strong>in</strong><br />
den letzten Jahren <strong>in</strong>tensiviert. Auf die hohe Exporttätigkeit der Zuliefer<strong>in</strong>dustrien – vor allem der<br />
pharmazeutischen <strong>und</strong> mediz<strong>in</strong>technischen Industrie – wurde <strong>in</strong> den vorangegangenen Kapiteln schon<br />
h<strong>in</strong>gewiesen. Doch auch im Kernsektor des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s <strong>in</strong>tensivieren sich die Anstrengungen<br />
e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>ternationalen Vermarktung der Produkte <strong>und</strong> Dienstleistungen 60 . Wachstum <strong>und</strong> Beschäftigung<br />
<strong>in</strong> der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft werden erheblich davon profitieren, wenn es gel<strong>in</strong>gt, private <strong>in</strong>- <strong>und</strong><br />
ausländische K<strong>und</strong>/<strong>in</strong>nen für die Produkte <strong>und</strong> Dienstleistungen dieser Branche zu gew<strong>in</strong>nen.<br />
4.2. Endogene Entwicklungstrends: Prozess- <strong>und</strong> Produkt<strong>in</strong>novationen, Vernetzung<br />
<strong>und</strong> Integration sowie Professionalisierung<br />
Über die Möglichkeit weiterer Produktivitätsfortschritte im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> wird derzeit lebhaft<br />
gestritten. Wenngleich im Bereich personenbezogener Dienstleistungen Produktivitätssteigerungen<br />
durch Rationalisierung nur bed<strong>in</strong>gt möglich s<strong>in</strong>d, bestehen durchaus Produktivitäts- <strong>und</strong> Wirtschaftlichkeitsreserven<br />
im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> 61 , die durch e<strong>in</strong>en effizienten Mittele<strong>in</strong>satz <strong>und</strong> neue Organisations-<br />
<strong>und</strong> Technike<strong>in</strong>satzkonzepte erschlossen werden können. Die Erschließung solcher Produktivitätsreserven<br />
br<strong>in</strong>gt zwar kurzfristig Anpassungsdruck für die bestehenden Strukturen <strong>und</strong> kann <strong>in</strong><br />
E<strong>in</strong>zelfällen auch Arbeitsplätze gefährden, mittel- <strong>und</strong> langfristig s<strong>in</strong>d Produktivitätssteigerungen jedoch<br />
e<strong>in</strong>e unerläßliche Voraussetzung dafür, Ressourcen zur Befriedigung des wachsenden Bedarfs<br />
<strong>und</strong> für neue Produkte <strong>und</strong> Dienstleistungen frei zu setzen.<br />
Die Anstrengungen zur Produktivitäts- <strong>und</strong> Qualitätssteigerung haben derzeit e<strong>in</strong>en Schwerpunkt bei<br />
der Förderung der Telemediz<strong>in</strong>, die neue <strong>und</strong> kostengünstige Möglichkeiten e<strong>in</strong>er patientenorientierten<br />
Kommunikation zwischen den Experten eröffnet – auch <strong>und</strong> gerade über die Grenzen der Institutionen<br />
<strong>und</strong> E<strong>in</strong>richtungen h<strong>in</strong>weg. E<strong>in</strong> vielleicht noch wichtigeres Arbeitsfeld für Produktivitätsanstrengungen<br />
s<strong>in</strong>d das Qualitätsmanagement <strong>und</strong> das Benchmark<strong>in</strong>g. Beim letztgenannten Ansatz geht es nicht<br />
nur darum, billiger <strong>und</strong> besser zu werden, sondern auch um die Identifizierung zukunftsfähiger Potenziale.<br />
Zu denken ist hier an Dienstleistungsansätze, die durch e<strong>in</strong>e spezifische Komb<strong>in</strong>ation sozialer,<br />
ges<strong>und</strong>heitsbezogener <strong>und</strong> sonstiger Dienstleistungen – oftmals gestützt auf moderne IuK-<br />
Technologien - <strong>in</strong>novative Angebote entwickeln.<br />
60 Seit 1998 arbeitet etwa e<strong>in</strong> Kuratorium zur Förderung der deutschen Mediz<strong>in</strong> im Ausland, dem derzeit r<strong>und</strong><br />
85 Kl<strong>in</strong>iken sowie die Deutsche Krankenhausgesellschaft <strong>und</strong> der B<strong>und</strong>esverband Deutscher Privatkrankenanstalten<br />
angehören. Das Kuratorium bemüht sich u.a. um Verträge mit ausländischen Krankenkassen, auf<br />
deren Gr<strong>und</strong>lage dann Patienten <strong>in</strong> Deutschland versorgt werden sollen. „Diese Kl<strong>in</strong>iken dürften <strong>in</strong> den nächsten<br />
Jahren fünf bis zehn Prozent ihrer Betten durch Ausländer auslasten“, schätzt Dieter Thomae, der Vorstandsvorsitzende<br />
des Kuratoriums (Wirtschaftswoche 14.01.1999).<br />
61 Als Beispiele für bislang nicht erschlossene Wirtschaftlichkeitsreserven lassen sich etwa das Überangebot an<br />
spezifischen Leistungen, e<strong>in</strong> verzögerter E<strong>in</strong>satz mediz<strong>in</strong>ischer <strong>und</strong> mediz<strong>in</strong>technischer Innovationen, die<br />
mangelnde Abstimmung zwischen den verschiedenen Leistungsanbietern, überteuerte Vorprodukte, e<strong>in</strong>e kostentreibende<br />
Lagerhaltung, unnötig hohe <strong>in</strong>terne Abstimmungskosten etc. anführen.<br />
- 117 -
Ausblick <strong>und</strong> Prognose<br />
Hier werden bereits Schnittstellen zur zunehmend notwendigen Vernetzung <strong>und</strong> Integration im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
angesprochen. E<strong>in</strong>e höhere Bedeutung im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> wird <strong>in</strong> Zukunft vor<br />
allem die Vernetzung <strong>und</strong> Integration stationärer <strong>und</strong> ambulanter Versorgung e<strong>in</strong>nehmen. Mit der<br />
ortsnahen Koord<strong>in</strong>ierung, d.h. der Dezentralisierung der Fe<strong>in</strong>steuerung von Planungs- <strong>und</strong> Versorgungsaktivitäten,<br />
ist e<strong>in</strong> Instrument entwickelt worden, um vorhandene Wirtschaftlichkeitsreserven zu<br />
erschließen <strong>und</strong> gleichzeitig das Versorgungsniveau zu verbessern (vgl. Badura/Siegrist 1996). Vere<strong>in</strong>zelte<br />
Ansätze e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>tegrierten Ges<strong>und</strong>heitsversorgung bestehen durch die Etablierung von Ges<strong>und</strong>heitsnetzwerken<br />
<strong>in</strong> Form von Ärztenetzen oder dezentral organisierten Ges<strong>und</strong>heitszentren. Für<br />
beide Ansätze gilt, dass die Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation nicht exakt abgeschätzt<br />
werden können; wahrsche<strong>in</strong>lich ist jedoch, dass sich die positiven <strong>und</strong> negativen Beschäftigungseffekte<br />
wechselseitig neutralisieren.<br />
Daneben gew<strong>in</strong>nt die Integration <strong>und</strong> Verknüpfung ges<strong>und</strong>heitsbezogener Dienstleistungen mit den<br />
Nachbarbranchen <strong>und</strong> Randbereichen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s e<strong>in</strong>e wachsende Bedeutung, da man sich<br />
hiervon Synergieeffekte verspricht, die zu e<strong>in</strong>em Ausbau der Beschäftigung führen können. Die Anreicherung<br />
des Dienstleistungsangebots aus den Branchen Sport <strong>und</strong> Freizeit, Wohnen sowie Ernährung<br />
mit ges<strong>und</strong>heitsbezogenen Komponenten wird gleichfalls zur Erschließung neuer Beschäftigungsfelder<br />
beitragen. Gute Aussichten für <strong>in</strong>novative Produkte <strong>und</strong> Dienstleistungen bieten sich <strong>in</strong><br />
den Bereichen Ges<strong>und</strong>heitserhaltung, Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsmonitor<strong>in</strong>g.<br />
Diese Zukunftstrends im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> werden e<strong>in</strong>en steigenden Bedarf an hoch qualifiziertem<br />
Personal nach sich ziehen. Bereits <strong>in</strong> den letzten Jahren wurden die Qualifizierungsmöglichkeiten für<br />
Berufe im Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Sozialwesen ausgeweitet <strong>und</strong> qualitativ angehoben. Als e<strong>in</strong> besonderes<br />
Merkmal ist der Trend zur Akademisierung e<strong>in</strong>iger nichtärztlicher Ges<strong>und</strong>heitsberufe, <strong>in</strong>sbesondere<br />
im Pflegebereich, hervorzuheben. Dieser Prozess wird sich <strong>in</strong> Zukunft noch verstärken. Dabei werden<br />
drei Aspekte e<strong>in</strong>e wesentliche Rolle spielen:<br />
• Akademisierung der Pflegeberufe: Die Akademisierung der Pflegeberufe wird weiter voranschreiten,<br />
nicht zuletzt auch deshalb, weil sich über akademische Qualifizierungen die Karriere<strong>und</strong><br />
E<strong>in</strong>kommenschancen des Pflegepersonals verbessern lassen. Mit der Debatte um e<strong>in</strong>en absehbaren<br />
Pflegenotstand zu Ende der 80er Jahre wurden erstmals die mangelnde Anerkennung sowie<br />
die schlechten Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> der Pflege thematisiert <strong>und</strong> politisch mit e<strong>in</strong>er Aufwertung<br />
der Pflege durch die E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>schlägiger Studiengänge reagiert. Der Trend zur Akademisierung<br />
wird sich langfristig auf die Arbeitsteilung <strong>und</strong> Kompetenzabgrenzung zwischen ärztlichem<br />
<strong>und</strong> nichtärztlichem Personal auswirken (vgl. Wessl<strong>in</strong>g/Wirth 1996).<br />
• Bedeutungszuwachs betriebswirtschaftlich orientierter Managementfunktionen <strong>und</strong> entsprechender<br />
Qualifikationen: Nicht zuletzt durch den zunehmenden Wettbewerbs- <strong>und</strong> Kostendruck im<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> werden betriebswirtschaftliche Qualifikationen e<strong>in</strong>e unabd<strong>in</strong>gbare Voraussetzung<br />
se<strong>in</strong>, um im Wettbewerb um knappe f<strong>in</strong>anzielle Ressourcen <strong>und</strong> zur Mobilisierung zusätzlicher<br />
privat f<strong>in</strong>anzierter Nachfrage erfolgreich bestehen zu können.<br />
• Aktive Professionalisierung weiterer Berufsfelder: In vielen Berufen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s lassen<br />
sich aktive Professionalisierungstendenzen feststellen, die u.a. dazu führen können, dass die<br />
entsprechenden Berufsgruppen e<strong>in</strong>e verstärkte Nachfrage nach eigenen Leistungen mobilisieren.<br />
Dies gilt für e<strong>in</strong>e Vielzahl von therapeutischen Berufen (Psychotherapeut/<strong>in</strong>nen, Physiothera-<br />
- 118 -
Ausblick <strong>und</strong> Prognose<br />
peut/<strong>in</strong>nen, Musiktherapeut/<strong>in</strong>nen), aber auch für Berufe <strong>in</strong> den verschiedenen Bereichen der alternativen<br />
Mediz<strong>in</strong> (Homöopath/<strong>in</strong>nen, Heilpraktiker/<strong>in</strong>nen).<br />
Die dargestellten Trends <strong>und</strong> e<strong>in</strong> Blick <strong>in</strong> die Niederlande machen vor allem e<strong>in</strong>es deutlich: Neue<br />
Qualifikationen <strong>und</strong> aufgewertete Berufe setzen sich durch <strong>und</strong> erschließen neue Arbeitsfelder <strong>und</strong><br />
E<strong>in</strong>satzbereiche. Sie treten dabei jedoch nicht nur <strong>in</strong> Konkurrenz zu bestehenden Anbietern, sondern<br />
bieten auch komplementär zu diesen ihre Produkte <strong>und</strong> Dienstleistungen an <strong>und</strong> mobilisieren verstärkt<br />
privat getragene Nachfrage. Unter dem Gesichtspunkt der Beschäftigungsförderung ist Qualifizierung<br />
mith<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e wichtige Schubkraft.<br />
4.3. Prognose der zukünftigen Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> der nordrhe<strong>in</strong>westfälischen<br />
Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft bis 2015<br />
Trotz der bekannten <strong>und</strong> deshalb hier nicht weiter ausgeführten generellen Bedenken h<strong>in</strong>sichtlich der<br />
Zuverlässigkeit sozial- <strong>und</strong> wirtschaftswissenschaftlicher Prognosen werden im Folgenden für die<br />
Bereiche der ambulanten <strong>und</strong> stationären Versorgung, für die Altenhilfe <strong>und</strong> –pflege sowie für die<br />
Zuliefer<strong>in</strong>dustrien <strong>und</strong> Nachbarbranchen gesonderte Prognosen über mögliche Trends der Beschäftigungsentwicklung<br />
bis 2015 erstellt. Die wesentlichen Indikatoren, welche die zukünftige Entwicklung<br />
bestimmen, wurden <strong>in</strong> der Analyse der zurückliegenden Entwicklung seit den fünfziger Jahren bestimmt.<br />
Aufgr<strong>und</strong> begründeter theoretischer <strong>und</strong> analytischer Bef<strong>und</strong>e – auch unter E<strong>in</strong>bezug der Ergebnisse<br />
<strong>in</strong>ternational vergleichender Forschungen – <strong>und</strong> der dort aufgeführten zentralen E<strong>in</strong>flussgrößen<br />
(Demographie, Ökonomie, kultureller Wandel, politisch-<strong>in</strong>stitutionelle Weichenstellungen) lassen<br />
sich die folgenden Tendenzen e<strong>in</strong>er zukünftigen Entwicklung, zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong>nerhalb möglicher ‚Korridore‘<br />
als unterschiedliche ‚Szenarien‘, abschätzen.<br />
4.3.1. Prognose der zukünftigen Beschäftigungsentwicklung im ambulanten Sektor<br />
Im Rückblick erweist sich der ambulante Bereich als e<strong>in</strong>er der stärksten Wachstumssektoren. Für das<br />
quantitative Wachstum von ca. 55.000 Beschäftigten im Zeitraum von 1985 bis 1998 waren vor allem<br />
die Arzt- <strong>und</strong> Zahnarztpraxen <strong>und</strong> hier <strong>in</strong>sbesondere die Sprechst<strong>und</strong>enhilfen verantwortlich, aber<br />
auch im Bereich der nichtärztlichen Heilhilfsberufe s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> größerem Umfang Arbeitsplätze entstanden.<br />
Zwar gehen wir nicht davon aus, dass sich der bisherige Wachstumstrend auch zukünftig gleichermaßen<br />
fortsetzt. Trotzdem werden für den ambulanten Sektor bis 2015 Beschäftigungsgew<strong>in</strong>ne<br />
prognostiziert, die je nach Szenario zwischen ca. 30.000 <strong>und</strong> ca. 60.000 Arbeitsplätzen liegen. 62<br />
Den Ärzt/<strong>in</strong>nen kommt dabei im ambulanten Sektor e<strong>in</strong>e Schlüsselstellung zu, da sie zum e<strong>in</strong>en selbst<br />
als Arbeitgeber <strong>in</strong> Ersche<strong>in</strong>ung treten <strong>und</strong> zum anderen durch ihr Verschreibungsverhalten beschäftigungswirksam<br />
für andere Berufsgruppen werden. Dabei nahm die Zahl der Ärzt/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> freier Praxis<br />
zwischen 1985 <strong>und</strong> 1998 von 16.568 auf 23.817 Personen oder um 44 % zu. In der Zukunft wird das<br />
62 Die Entwicklung der Erwerbstätigen <strong>in</strong> E<strong>in</strong>richtungen der ambulanten Pflege mit Versorgungsvertrag nach<br />
SGB XI wird <strong>in</strong> der Prognose der Altenpflegeberufe abgehandelt. Zudem ist allerd<strong>in</strong>gs mit e<strong>in</strong>em Anwachsen<br />
der ambulanten Krankenpflege nach SGB V zu rechnen.<br />
- 119 -
Ausblick <strong>und</strong> Prognose<br />
Wachstum der niedergelassenen Ärzt/<strong>in</strong>nen wesentlich ger<strong>in</strong>ger ausfallen, da mit der GKV-<br />
Ges<strong>und</strong>heitsreform 2000 die Zulassungsvoraussetzungen verschärft wurden. Bislang lief die geltende<br />
Bedarfsplanung auf e<strong>in</strong>e regionale Umverteilungsregelung h<strong>in</strong>aus, <strong>in</strong> der jeder Arzt sich niederlassen<br />
kann, wenn auch nicht am Ort se<strong>in</strong>er Wahl (Hiddemann 1999). Mit der GKV-Ges<strong>und</strong>heitsreform 2000<br />
wurde als Sofortmaßnahme der § 101 Abs. 2 Nr. 3 SGB V gestrichen, der den B<strong>und</strong>esausschuss der<br />
Ärzte <strong>und</strong> Krankenkassen dazu verpflichtete, die bestehenden Verhältniszahlen zur Gewährleistung<br />
des Zugangs e<strong>in</strong>er ausreichenden M<strong>in</strong>destzahl von Ärzt/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Zahnärzt/<strong>in</strong>nen anzupassen. 63 Diese<br />
Regelung hat zur Folge, dass <strong>in</strong> den Planungsbereichen, <strong>in</strong> denen Überversorgung erreicht ist, ke<strong>in</strong>e<br />
Neuzulassungen mehr möglich se<strong>in</strong> werden (Hiddemann 1999). Die GKV-Ges<strong>und</strong>heitreform 2000<br />
sieht vor, dass ab dem 1. Januar 2003 e<strong>in</strong>e Bedarfszulassung aufgr<strong>und</strong> gesetzlich festgelegter Verhältniszahlen<br />
erfolgt. Damit wäre der Schritt von der regionalen Umverteilungsregelung zu e<strong>in</strong>er objektiven<br />
Zulassungsbegrenzung vollzogen. Das B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Ges<strong>und</strong>heit hat e<strong>in</strong> wissenschaftliches<br />
Institut damit beauftragt, bis zum 31. Dezember 2001 die erforderliche Datengr<strong>und</strong>lage für die<br />
Bedarfszulassung auf der Basis von Verhältniszahlen zu erstellen. In welchem Rahmen sich diese<br />
Verhältniszahlen bewegen <strong>und</strong> damit auch, ob sie die Niederlassungsmöglichkeiten der Ärzte erweitern<br />
oder e<strong>in</strong>schränken, ist derzeit nicht abzusehen. 64<br />
Wenn die gegenwärtigen Regelungen zur Bedarfsplanung bestehen bleiben, dann ist die Anzahl der<br />
noch zu besetzenden Vertragsarztsitze sehr begrenzt (s. Anhang, Tab. A 22 <strong>und</strong> Tab. A 23). Die Gesamtzahl<br />
der offenen Sitze beträgt 1.427. Werden diese Arztsitze bis zum Jahr 2015 besetzt, würde<br />
dies e<strong>in</strong>em Wachstum von 6,0 % entsprechen. 65<br />
Unsere Prognose nimmt die gegenwärtig noch zur Verfügung stehenden Vertragsarztsitze als unteres<br />
Entwicklungsszenario. Die noch offenen Sitze entsprechen e<strong>in</strong>em jährlichen Wachstum von 0,4%.<br />
Beim oberen Szenario gehen wir davon aus, dass ab dem Jahr 2003 e<strong>in</strong>e großzügigere Lösung für die<br />
Niederlassungsmöglichkeit der Ärzt/<strong>in</strong>nen gef<strong>und</strong>en wird. Hier könnte das jährliche Wachstum durchaus<br />
1% im Jahr betragen. 66 Zusätzlich wird angenommen, dass durch die <strong>in</strong>tegrierte Versorgung, bei<br />
63 Diese Regelung wurde notwendig, um e<strong>in</strong>e erneute Zulassungswelle zu verh<strong>in</strong>dern, wie sie vor der E<strong>in</strong>führung<br />
des Ges<strong>und</strong>heitsstrukturgesetzes (GSG) stattgef<strong>und</strong>en hatte. Das GSG führte die heute geltende Bedarfsplanung<br />
e<strong>in</strong> <strong>und</strong> befristete die bedarfsunabhängige Zulassung bis zum 31.03.1993. Diese Befristung<br />
führte zu e<strong>in</strong>er massiven Niederlassungswelle (sogenannter „Vorzieheffekt“). Mit der Streichung des § 101<br />
Abs. 2 Nr. 3 SGB V kann e<strong>in</strong> erneuter Vorzieheffekt ausgeschlossen werden.<br />
64 Es bleibt zudem abzuwarten, ob die Ärzteschaft nicht gegen die neuen gesetzlichen Verhältniszahlen vor dem<br />
B<strong>und</strong>esverfassungsgericht klagen wird, falls diese <strong>in</strong> deren Wahrnehmung zu restriktiv ausfallen. Bereits<br />
1960 wurden die damals geltenden Verhältniszahlen (1:500 für Ärzte <strong>und</strong> 1:900 für Zahnärzte) vom B<strong>und</strong>esverfassungsgericht<br />
für gr<strong>und</strong>gesetzwidrig erklärt (Alber 1992). Ob e<strong>in</strong>e Klage erfolgreich se<strong>in</strong> wird, hängt<br />
davon ab, welches Gut das B<strong>und</strong>esverfassungsgericht höher werten wird: Das Recht auf Berufsfreiheit nach<br />
Art. 12 GG oder das Allgeme<strong>in</strong>wohl<strong>in</strong>teresse an der f<strong>in</strong>anziellen Stabilität der GKV (vgl. hierzu ausführlicher<br />
Hiddemann 1999).<br />
65 Hierbei ist allerd<strong>in</strong>gs zu beachten, dass mehr als die Hälfte der noch zu vergebenden Arztsitze auf die der<br />
Bedarfsplanung erst seit kurzem unterliegenden ärztlichen Psychotherapeut/<strong>in</strong>nen zurückzuführen ist. Bei<br />
dieser Arztgruppe übersteigt die Anzahl der noch zu vergebenden Sitze vermutlich das Angebot an entsprechend<br />
weitergebildeten Ärzt/<strong>in</strong>nen. Ohne die ärztlichen Psychotherapeut/<strong>in</strong>nen beträgt die Wachstumsmöglichkeit<br />
nur noch 644 Sitze oder 2,8% bis zum Jahr 2015.<br />
66 An niederlassungswilligen Ärzt/<strong>in</strong>nen herrscht derzeit ke<strong>in</strong> Mangel. Es gibt 80.000 weitergebildete<br />
Ärzt/<strong>in</strong>nen außerhalb der ambulanten Versorgung. Jährlich kommen ca. 12.000 h<strong>in</strong>zu. B<strong>und</strong>esweit gibt es<br />
aber <strong>in</strong>sgesamt nur ca. 5.400 Zulassungsmöglichkeiten (B<strong>und</strong>estags-Drucksache 14/1245 1999).<br />
- 120 -
Ausblick <strong>und</strong> Prognose<br />
der Leistungen vom stationären <strong>in</strong> den ambulanten Sektor verschoben werden, e<strong>in</strong> neuer Bedarf auch<br />
für niedergelassene Ärzt/<strong>in</strong>nen geschaffen wird.<br />
Abb. 25: Szenarien der Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> Arzt- <strong>und</strong> Zahnarztpraxen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong><br />
Westfalen bis 2015<br />
120.000<br />
110.000<br />
100.000<br />
90.000<br />
80.000<br />
70.000<br />
60.000<br />
50.000<br />
40.000<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
Arztpraxen (+0,4% p.a.) Arztpraxen (+1,0% p.a. ab dem Jahr 2004)<br />
Zahnarztpraxen (+1,6% p.a.) Zahnarztpraxen (+2,4 % p.a.)<br />
Quelle: Berechnung <strong>und</strong> Erstellung MHH<br />
Bei den Zahnarztzahlen ist es <strong>in</strong> der Vergangenheit nie zu e<strong>in</strong>em gleich starken Wachstum gekommen<br />
wie bei den Arztzahlen, da die Ausbildungskapazitäten im Fach Zahnmediz<strong>in</strong> nicht so ausgebaut wurden<br />
wie <strong>in</strong> der Allgeme<strong>in</strong>mediz<strong>in</strong> <strong>und</strong> es zudem nur selten gelang, alle Planstellen zu besetzen (Alber<br />
1992). Derzeit gibt es bei den Zahnärzt/<strong>in</strong>nen ke<strong>in</strong>e gesperrten Planungsbereiche. Folglich s<strong>in</strong>d hier<br />
stärkere Steigerungsraten zu erwarten als bei den niedergelassenen Ärzt/<strong>in</strong>nen. Das untere Szenario ist<br />
die Übertragung e<strong>in</strong>er Prognose des Instituts für Ges<strong>und</strong>heits-System-Forschung Kiel für das B<strong>und</strong>esgebiet<br />
auf Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (Kassenzahnärztliche B<strong>und</strong>esvere<strong>in</strong>igung 1999), das obere Szenario<br />
dagegen schreibt den Wachstumstrend bei den niedergelassenen Zahnärzten im Zeitraum 1991 bis<br />
1998 fort.<br />
Abb. 25 verdeutlicht <strong>in</strong> zwei Szenarien die mögliche Beschäftigungsentwicklung bei Arzt- <strong>und</strong> Zahnarztpraxen.<br />
Es wurde unterstellt, dass auf e<strong>in</strong>en niedergelassenen Arzt oder Zahnarzt vier Helfer<strong>in</strong>nen<br />
kommen. 67 Andere Berufsgruppen, die <strong>in</strong> Arzt- bzw. Zahnarztpraxen tätig s<strong>in</strong>d (etwa Physiotherapeut/<strong>in</strong>nen,<br />
Re<strong>in</strong>igungskräfte etc.), s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der vorliegenden Prognose nicht enthalten.<br />
67 Diese Annahmen beruhen auf Alber (1992: 91) <strong>und</strong> Angaben der Kassenzahnärztlichen B<strong>und</strong>esvere<strong>in</strong>igung<br />
(1999: 142). Da Sprechst<strong>und</strong>enhilfen <strong>in</strong> der amtlichen Statistik nicht getrennt nach Arzt- <strong>und</strong> Zahnarztpraxen<br />
vorliegen, mussten die jeweiligen Anteile für das Ausgangsjahr 1998 geschätzt werden. Da <strong>in</strong> die Prognose<br />
nur (Zahn-)Ärzte <strong>und</strong> Sprechst<strong>und</strong>enhilfen e<strong>in</strong>bezogen werden, wurden nicht die Angaben der Statistik der<br />
Berufsgenossenschaft für Ges<strong>und</strong>heitsdienst <strong>und</strong> Wohlfahrtspflege herangezogen, sondern die Statistiken der<br />
- 121 -
Ausblick <strong>und</strong> Prognose<br />
In Bezug auf die Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> Apotheken sche<strong>in</strong>t e<strong>in</strong>e ähnliche Sättigung e<strong>in</strong>getreten<br />
zu se<strong>in</strong> wie bei den niedergelassenen Ärzt/<strong>in</strong>nen. In der zweiten Hälfte der 90er Jahre wuchs die Beschäftigung<br />
hier durchschnittlich um 1,2% jährlich. Wir gehen von e<strong>in</strong>em weiteren künftigen Wachstum<br />
aus, das zwischen 0,5 <strong>und</strong> maximal 1% jährlich liegt.<br />
Bei den nichtärztlichen Heilhilfsberufen haben wir mit Ausnahme der Berufsgruppe Masseure/ med.<br />
Bademeister überdurchschnittliche Wachstumsraten festgestellt. Die zukünftige Entwicklung dieser<br />
Berufe hängt ganz entscheidend von zwei Faktoren ab. Erstens von der zukünftigen F<strong>in</strong>anzausstattung<br />
der GKV <strong>und</strong> zweitens von der Mobilisierung privater Mittel. Unter günstigen Voraussetzungen <strong>in</strong><br />
beiden Bereichen s<strong>in</strong>d Steigerungsraten zwischen 1,5 <strong>und</strong> 3% denkbar. 68<br />
Abb. 26 Szenarien der Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> Apotheken <strong>und</strong> ausgewählten nichtärztlichen<br />
Heilhilfsberufe <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong> Westfalen bis 2015<br />
55.000<br />
50.000<br />
45.000<br />
40.000<br />
35.000<br />
30.000<br />
25.000<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015<br />
Beschäftigte <strong>in</strong> ausgewählten nichtärztlichen Heilhilfsberufen (e<strong>in</strong>schließlich der Heilpraktiker) (+1,5% p.a.)<br />
Beschäftigte <strong>in</strong> ausgewählten nichtärztlichen Heilhilfsberufen (e<strong>in</strong>schließlich der Heilpraktiker) (+3% p.a.)<br />
Beschäftigte <strong>in</strong> Apotheken (+0,5% p.a.)<br />
Beschäftigte <strong>in</strong> Apotheken (+1% p.a.)<br />
Quelle: Berechnung <strong>und</strong> Erstellung MHH<br />
Unterstützt wird diese optimistische Prognose dadurch, dass sich die „Arztlastigkeit“ des deutschen<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s im <strong>in</strong>ternationalen Vergleich (Döhler 1997; Haug 1995; Rothgang 1995) etwas<br />
abzumildern sche<strong>in</strong>t. In Zukunft dürften im ambulanten Sektor die nichtärztlichen mediz<strong>in</strong>ischen Be-<br />
Ärztekammern (für die Ärzte <strong>und</strong> Zahnärzte) <strong>und</strong> Landesarbeitsämter (für die Sprechst<strong>und</strong>enhilfen). Aus diesem<br />
Gr<strong>und</strong> liegen die Ausgangswerte für die Arzt- <strong>und</strong> Zahnarztpraxen <strong>in</strong> Abb. 25 niedriger als die <strong>in</strong> Tab. 1<br />
angegebenen Werte. Da die Zahlenwerte der Statistik der Berufsgenossenschaft für Ges<strong>und</strong>heitsdienst <strong>und</strong><br />
Wohlfahrtspflege <strong>in</strong>folge e<strong>in</strong>er kumulativen Jahreserfassung systematisch zu hoch liegen wie <strong>in</strong> Kapitel 2.3.1<br />
erläutert <strong>und</strong> die Prognose sich auf (Zahn-)Ärzte <strong>und</strong> Sprechst<strong>und</strong>enhilfen beschränkt, ersche<strong>in</strong>t diese Vorgehensweise<br />
gerechtfertigt.<br />
68 Die Ausnahme hiervon bilden die Hebammen, deren Zahl vermutlich zurückgehen wird, sobald die Frauen<br />
der geburtenstarken Jahrgänge das gebärfähige Alter verlassen haben. Hebammen im ambulanten Sektor fallen<br />
jedoch wegen ihrer ger<strong>in</strong>gen Anzahl nicht <strong>in</strong>s Gewicht <strong>und</strong> werden im Folgenden vernachlässigt.<br />
- 122 -
Ausblick <strong>und</strong> Prognose<br />
rufe stärker wachsen als die Ärzt/<strong>in</strong>nen. Hierbei kommt vor allem den Heilpraktiker/<strong>in</strong>nen e<strong>in</strong>e hervorgehobene<br />
Stellung zu, da sie im Gegensatz zu anderen nichtärztlichen mediz<strong>in</strong>ischen Berufen nicht<br />
nur für e<strong>in</strong>en bestimmten Teilaspekt der Ges<strong>und</strong>heit zuständig s<strong>in</strong>d, sondern gr<strong>und</strong>sätzlich für e<strong>in</strong> sehr<br />
breites Spektrum an Krankheiten <strong>und</strong> Leiden <strong>in</strong> Anspruch genommen werden können. Aber auch andere<br />
Berufsgruppen können zunehmend <strong>in</strong> Konkurrenz zu den Ärzten treten, wie die beiden folgenden<br />
Beispiele <strong>in</strong> aller Kürze zeigen.<br />
Schon seit langem wird von den Ges<strong>und</strong>heitswissenschaften für die zahnärztlichen Praxen e<strong>in</strong>e deutliche<br />
Anhebung der Prophylaxehelfer<strong>in</strong>nen-Zahnarztrelation gefordert, die heute noch bei 1:25 liegt.<br />
Experten sehen e<strong>in</strong>e Verschiebung dieser Relation <strong>in</strong> Richtung 2:1 als funktional <strong>und</strong> effizient an<br />
(Schreiber 1997).<br />
In den Praxen der niedergelassenen Ärzt/<strong>in</strong>nen könnten <strong>in</strong> Zukunft Krankenschwestern/pfleger e<strong>in</strong>e<br />
größere Rolle spielen. Im Rahmen e<strong>in</strong>er multizentrischen, randomisierten Fallkontrollstudie wurde <strong>in</strong><br />
England die mediz<strong>in</strong>ische Versorgung von Patienten mit Trivialerkrankungen durch Krankenschwestern/pfleger<br />
evaluiert. Insbesondere die Akzeptanz durch die Patient/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> die Sicherheit der<br />
Behandlung wurden h<strong>in</strong>terfragt. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Krankenschwestern/pfleger<br />
sehr effektiv Trivialerkrankungen behandeln können <strong>und</strong> von den Patient/<strong>in</strong>nen – z.T.<br />
besser beurteilt als die Ärzt/<strong>in</strong>nen – akzeptiert werden (Shum et al. 2000). Zudem konnten Krankenschwestern/pfleger<br />
Trivialerkrankungen gut diagnostizieren <strong>und</strong> <strong>in</strong>sgesamt kosteneffizienter als ihre<br />
ärztlichen Kollegen arbeiten (Venn<strong>in</strong>g et al. 2000).<br />
4.3.2. Prognose der zukünftigen Beschäftigungsentwicklung im stationären Sektor<br />
Mitte der 90er Jahre wurde e<strong>in</strong>e lange Phase des Beschäftigungswachstums im stationären Sektor beendet.<br />
Zwischen 1975 <strong>und</strong> 1989 stieg die Beschäftigtenzahl <strong>in</strong> den Krankenhäusern um 44.000 Personen<br />
oder 26%. Für den drei Jahre längeren Prognosezeitraum von 1998 bis 2015 h<strong>in</strong>gegen ist von e<strong>in</strong>er<br />
nahezu stagnierenden Beschäftigungsentwicklung auszugehen. Aufbauend auf die E<strong>in</strong>zelprognosen<br />
für die drei E<strong>in</strong>richtungsarten f<strong>in</strong>det der Beschäftigungskorridor se<strong>in</strong>e obere Grenze bei e<strong>in</strong>em<br />
Zugew<strong>in</strong>n von ca. 10.600 (+4%) Beschäftigungsverhältnissen, se<strong>in</strong>e untere bei e<strong>in</strong>em Verlust von<br />
15.600 (-6%).<br />
H<strong>in</strong>ter diesem Gesamttrend verbergen sich z.T. gravierende Wandlungsprozesse der e<strong>in</strong>zelnen Krankenhaustypen.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der Unterschiede <strong>in</strong> Trägerschaft, politischer Regulierung, Patientengut <strong>und</strong><br />
Stellung <strong>in</strong> der Versorgungskette zwischen den drei Krankenhaustypen, zeichnen sich divergierende<br />
Entwicklungsdynamiken ab, die im Folgenden im E<strong>in</strong>zelnen behandelt werden.<br />
4.3.2.1. Prognose allgeme<strong>in</strong>e Krankenhäuser<br />
Der maximale Prognosekorridor für die Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> den allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäusern<br />
unterliegt zwei unterschiedlichen Szenarien:<br />
- 123 -
Ausblick <strong>und</strong> Prognose<br />
1. Im Wesentlichen wird sich die Beschäftigungsentwicklung wie gehabt fortsetzen. Der Beschäftigungsabbau<br />
<strong>in</strong> der zweiten Hälfte der 90er Jahre war ke<strong>in</strong>e Trendwende, sondern beruhte nur auf<br />
kurzfristigen Friktionen.<br />
2. Die allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäuser bef<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er f<strong>und</strong>amentalen Umbruchsituation, die aus<br />
der Umstellung des Entgeltsystems <strong>und</strong> dem Wandel ihrer Position <strong>in</strong> der Versorgungskette resultiert<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em nachhaltigen Personalabbau mündet.<br />
Aufgr<strong>und</strong> dieser beiden entgegengesetzten Szenarien ist e<strong>in</strong> breiter, maximaler Beschäftigungskorridor<br />
zu veranschlagen (Abb. 27). Bis zum Jahr 2015 ist e<strong>in</strong> maximaler Zugew<strong>in</strong>n von 50.000 (22%) bzw.<br />
e<strong>in</strong> Verlust von 57.000 (-25%) Beschäftigungsverhältnissen theoretisch denkbar. Der wahrsche<strong>in</strong>liche<br />
Beschäftigungskorridor wird allerd<strong>in</strong>gs eher durch e<strong>in</strong>e Beschäftigungsstagnation nach oben <strong>und</strong><br />
durch e<strong>in</strong>en Abbau von ca. 20.000 Beschäftigungsverhältnissen nach unten begrenzt.<br />
Abb. 27 Beschäftigungsprognose allgeme<strong>in</strong>e Krankenhäuser NRW 1998-2015<br />
275.000<br />
250.000<br />
225.000<br />
200.000<br />
175.000<br />
150.000<br />
125.000<br />
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15<br />
Fallzahlenreduktion +Effizienzsteigerung 1% p.a. Fallzahlenreduktion um 22%<br />
Fortschreibung Fallzahlen Fortschreibung + Teilzeit<br />
Quelle: Berechnung <strong>und</strong> Erstellung MHH<br />
Gr<strong>und</strong>lagen der Prognose – Fallzahlentwicklung, demographischer Faktor <strong>und</strong> mediz<strong>in</strong>ischer<br />
Fortschritt<br />
In der Vergangenheit war die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen weitgehend von der Entwicklung<br />
der Bettenzahlen wie der der Pflegetage abgekoppelt. Nur die Arzt-Fall-Relation - <strong>und</strong> noch etwas<br />
ausgeprägter - die Pflegekraft-Fall-Relation waren e<strong>in</strong>igermaßen stabil. Dies mag dem Umstand geschuldet<br />
se<strong>in</strong>, dass die diagnose-, therapie- <strong>und</strong> pflege<strong>in</strong>tensiven Tage gleich nach der E<strong>in</strong>weisung<br />
stattf<strong>in</strong>den. Der ärztliche <strong>und</strong> pflegerische Aufwand m<strong>in</strong>imiert sich danach.<br />
- 124 -
Ausblick <strong>und</strong> Prognose<br />
Deshalb wählen wir die Entwicklung der Fallzahlen 69 als Ausgangspunkt unserer Prognose für die<br />
allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäuser. Es ist davon auszugehen, dass die Entwicklung der Fallzahlen zwischen<br />
1991 <strong>und</strong> 1998 bereits e<strong>in</strong>e Reaktion auf den demographischen Wandel darstellt. Ebenso ist anzunehmen,<br />
dass der mediz<strong>in</strong>isch-technische Fortschritt, der sich bisher sukzessive im Leistungsgeschehen<br />
niedergeschlagen hat, repräsentiert ist. 70 Die weitere Entwicklung des demographischen Wandels lässt<br />
sich anhand der Bevölkerungsprognose des Landesamtes für Datenverarbeitung <strong>und</strong> Statistik relativ<br />
gut abschätzen. 71 Dabei kommt <strong>in</strong>sbesondere der Entwicklung der höheren Altersgruppen e<strong>in</strong>e besondere<br />
Bedeutung zu, da bereits gegenwärtig auf die über 65-Jährigen ca. 30% der Krankenhausfälle<br />
entfallen. Bis zum Jahr 2007 wird die wachsende Zahl der 65-Jährigen <strong>und</strong> älteren <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen zu e<strong>in</strong>em Anstieg der Fallzahlen führen, da die Krankenhaushäufigkeit <strong>in</strong> dieser Altersklasse<br />
höher als <strong>in</strong> den jüngeren ist. Ab 2007 nimmt die Altersklasse der 65-74-Jährigen relativ <strong>und</strong> absolut<br />
wieder ab <strong>und</strong> s<strong>in</strong>kt 2015 sogar unter den Ausgangswert von 1998 (s. Abb. 24) 72 .<br />
Das Wachstumsszenario<br />
Im Wachstumsszenario wird von e<strong>in</strong>er ungebremsten Entwicklung der Fallzahlen ausgegangen. Die<br />
Versuche e<strong>in</strong>er sozialrechtlichen Regulierung der Anreizstrukturen, die z.B. im Krankenhaussektor<br />
e<strong>in</strong>e Konzentration auf Kernaufgaben, e<strong>in</strong>e Steigerung der Effizienz <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Reduktion der unnötigen<br />
Krankenhausüberweisungen beabsichtigen, s<strong>in</strong>d politisch gescheitert oder aber aus technischen Gründen<br />
nicht implementier- bzw. handhabbar. Zudem wird die sektorale Budgetierung aufgehoben oder<br />
zeigt <strong>in</strong>folge vieler Ausnahmeregelungen wenig Wirkung.<br />
Beschäftigungswirkung des Fallzahlentrends<br />
Der demographische Faktor <strong>und</strong> der mediz<strong>in</strong>isch-technische Fortschritt s<strong>in</strong>d daher für e<strong>in</strong>e Fortsetzung<br />
des Fallzahlentrends bis zum Jahr 2007 verantwortlich zu machen. Danach wird sich diese Entwicklung,<br />
zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> Bezug auf die älteren Bevölkerungsteile, verlangsamen. 73 Legt man die Fall-<br />
Personalrelation von 1998 zu Gr<strong>und</strong>e, so errechnet sich bis zum Jahr 2015 e<strong>in</strong> Zuwachs von annähernd<br />
30.000 Beschäftigungsverhältnissen.<br />
69 Die Zahl der im Berichtsjahr stationär behandelten Patienten. St<strong>und</strong>enfälle werden hierbei nicht als Fall mit-<br />
gezählt.<br />
70 Dies unterstellt, dass bis zum Jahr 2015 ke<strong>in</strong> sprunghafter mediz<strong>in</strong>isch-technischer Fortschritt stattf<strong>in</strong>den<br />
wird.<br />
71 Allerd<strong>in</strong>gs nur unter dem Vorbehalt, dass die Krankheitslast der jeweiligen Altersklasse 1998 identisch mit<br />
der im Jahr 2015 ist.<br />
72 Der demographische E<strong>in</strong>fluss ist hier nur unter dem Gesichtspunkt der Alten behandelt worden. Im Jahr 2015<br />
rücken jedoch die geburtenstarken Jahrgänge <strong>in</strong>s sechste Lebensjahrzehnt e<strong>in</strong> <strong>und</strong> werden somit potenzielle<br />
Opfer von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Bedeutung dieser Altersgruppe für das Leistungsgeschehen ist<br />
heute noch nicht abzusehen. Unter anderem bleibt es ungewiss, ob die Krankheitslast der 50-Jährigen im Jahr<br />
2015 der Krankheitslast der 50-Jährigen im Jahr 1998 entspricht.<br />
73 Unserer Kalkulation folgend, steigen die Fallzahlen im Zeitraum von 1998-2007 von 3,6 Mio. auf 4,1 Mio.,<br />
um dann weitgehend zu stagnieren.<br />
- 125 -
Fallzahlentrend <strong>und</strong> Teilzeitbeschäftigung<br />
Ausblick <strong>und</strong> Prognose<br />
Neben der Fortsetzung des Fallzahlanstiegs wird die wachsende Bedeutung der Teilzeitarbeit erhebliche<br />
beschäftigungsfördernde Effekte hervorbr<strong>in</strong>gen. Unter der Annahme, dass der Anteil der Teilzeitbeschäftigten<br />
<strong>in</strong> den Jahren bis 2015 von 32% (Stand 1998) auf bis zu 40% 74 weiter ansteigt, würde<br />
die Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse noch e<strong>in</strong>mal um 20.000 zunehmen. E<strong>in</strong>e Verkürzung der<br />
Wochenarbeitszeit <strong>und</strong> daraus resultierend zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse, sche<strong>in</strong>en demgegenüber<br />
gegenwärtig nicht auf der Tagesordnung zu stehen.<br />
Das Abbauszenario<br />
Diesem Wachstumsszenario steht e<strong>in</strong> Abbauszenario entgegen, das im Wesentlichen auf e<strong>in</strong>er politisch<br />
<strong>in</strong>duzierten Umsteuerung des Krankenhaussektors beruht. Der Krankenhaussektor <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen – wie <strong>in</strong>sgesamt <strong>in</strong> Deutschland – bef<strong>in</strong>det sich im Umbruch. Dieser wurde bereits <strong>in</strong> den<br />
80er Jahren mit der Ablösung des Selbstkostendeckungspr<strong>in</strong>zips durch die prospektive F<strong>in</strong>anzierung<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> den 90er Jahren mit der schrittweisen E<strong>in</strong>führung von Fallpauschalen <strong>und</strong> Sonderentgelten e<strong>in</strong>geleitet.<br />
2003 soll diese Entwicklung mit der E<strong>in</strong>führung von sogenannten DRGs zum Abschluss<br />
kommen.<br />
Reduktion der Fallzahlen<br />
Zunächst wird die gleiche Fallzahlentwicklung wie im Wachstumsszenario zu Gr<strong>und</strong>e gelegt. Allerd<strong>in</strong>gs<br />
wird im Abbauszenario von e<strong>in</strong>er sozialrechtlich bewirkten sukzessiven Verm<strong>in</strong>derung der<br />
Krankenhausfälle um 22% ausgegangen. Diese Zahl bezieht sich auf e<strong>in</strong> Gutachten des MDS, das<br />
unnötige Krankenhausüberweisungen nachzuweisen sucht (Mediz<strong>in</strong>ischer Dienst der Spitzenverbände<br />
der Krankenkassen, 2000). Die Instrumente der Vermeidung unnötiger Krankenhausüberweisungen<br />
s<strong>in</strong>d:<br />
• Modellversuche <strong>und</strong> Strukturverträge im Rahmen der Kodexmodelle, die Krankenhausüberweisungen<br />
zu verm<strong>in</strong>dern suchen;<br />
• Integrationsversorgung, bei der Leistungen, die im Krankenhaus erbracht werden, <strong>in</strong> den ambulanten<br />
Sektor gezogen werden;<br />
• ambulantes Operieren;<br />
• Lotsen- <strong>und</strong> „Gatekeep<strong>in</strong>g“-Funktion des Hausarztes zur Vermeidung von Krankenhausüberweisungen;<br />
• Fehlbelegungsprüfungen durch den Mediz<strong>in</strong>ischen Dienst der Krankenkassen.<br />
Unter dieser Prämisse blieben die Fallzahlen bis zum Jahr 2007 trotz demographischen Wandels <strong>und</strong><br />
mediz<strong>in</strong>isch-technischen Fortschritts konstant, um schließlich bis 2015 auf 3,2 Mio. Fälle abzus<strong>in</strong>ken.<br />
74 Die 40% Marke stellt ke<strong>in</strong>e echte Trendfortschreibung dar, da rückblickend Daten zur Teilzeibeschäftigung<br />
nur bis 1991 vorliegen. Allerd<strong>in</strong>gs stieg zwischen 1991 <strong>und</strong> 1998 der Anteil der Teilzeitbeschäftigten <strong>in</strong> den<br />
Krankenhäusern von 27,3% auf 32,0%. Zudem lässt sich der Literatur e<strong>in</strong> zunehmender Trend zur Ermöglichung<br />
von Teilzeitarbeitsverhältnissen <strong>in</strong> den Krankenhäusern ablesen.<br />
- 126 -
Ausblick <strong>und</strong> Prognose<br />
E<strong>in</strong> statisches Verhältnis von Fallzahlen zu Beschäftigten vorausgesetzt, würde sich diese Entwicklung<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Beschäftigungsabbau bis 2015 von ca. 26.000 Stellen niederschlagen.<br />
Fallzahlenreduktion <strong>und</strong> Effizienzsteigerung<br />
Wird jedoch unterstellt, dass sich dieses Verhältnis durch schrittweise Effizienzsteigerungen der Versorgung<br />
<strong>in</strong> den allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäusern wandelt, so ist der beschäftigungse<strong>in</strong>sparende Effekt<br />
noch höher anzusetzen. Maßnahmen zur Effizienzsteigerung s<strong>in</strong>d:<br />
• Verkürzung der Verweildauer durch Verlegung <strong>in</strong> E<strong>in</strong>richtungen der Rehabilitation zur Anschlussheilbehandlung;<br />
• Verkürzung der Verweildauer durch frühzeitige Entlassung <strong>und</strong> Versorgung durch ambulante<br />
Pflegedienste.<br />
Bei e<strong>in</strong>er Kalkulation von e<strong>in</strong>em Prozent Effizienzgew<strong>in</strong>n pro Jahr, ist mit e<strong>in</strong>em Abbau von weiteren<br />
31.000 Beschäftigungsverhältnissen zu rechnen.<br />
Das maximale Abbauszenario ersche<strong>in</strong>t auf den ersten Blick unrealistisch hoch, im Ländervergleich<br />
stellt sich der Fall anders dar. Von den Stadtstaaten e<strong>in</strong>mal abgesehen, die bekanntlich ihr Umland<br />
mitversorgen, weist NRW e<strong>in</strong>e außerordentlich hohe Kapazität bei den allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäusern<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>e verschw<strong>in</strong>dend kle<strong>in</strong>e bei den Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen auf. Der Vergleich<br />
mit Baden-Württemberg ist besonders <strong>in</strong>struktiv, da hier e<strong>in</strong>e „<strong>in</strong>formelle“ Umwidmung von allgeme<strong>in</strong>en<br />
Krankenhäusern <strong>und</strong> Betten <strong>in</strong> Vorsorge- oder Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong> Betten derselben<br />
vorgenommen wurde. Wird die daraus resultierende Personalverschiebung auf NRW hochgerechnet,<br />
so ergibt sich e<strong>in</strong> Abbaupotenzial von 65.000 Beschäftigten bzw. 29%.<br />
Flankierende Faktoren<br />
Es existieren e<strong>in</strong>e Reihe flankierender Faktoren, die e<strong>in</strong>en weiteren Kapazitätsabbau <strong>in</strong> der Zukunft<br />
nahelegen. Hierunter fallen <strong>in</strong>sbesondere die hohe Bettendichte Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalens im <strong>in</strong>nerdeutschen<br />
Vergleich, die Rückführung der Fördermittel <strong>und</strong> Gutachten anderer Experten, die weitere Kapazitätsreduktionen<br />
vorhersagen.<br />
Der Vergleich der Eckdaten legt auch zukünftig e<strong>in</strong>e Reduktion der Kl<strong>in</strong>ik- <strong>und</strong> Bettenanzahl nahe. Im<br />
<strong>in</strong>nerdeutschen Vergleich weist Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen – abgesehen von den Stadtstaaten - die höchste<br />
Bettendichte bei allgeme<strong>in</strong>en <strong>und</strong> sonstigen Krankenhäusern auf (Statistisches B<strong>und</strong>esamt 1998; Statistisches<br />
B<strong>und</strong>esamt 2000). Aber auch der <strong>in</strong>ternationale Vergleich der Verweildauern zeigt für<br />
Deutschland überdurchschnittlich hohe Werte. 1994 lag Deutschland bei den Verweildauern <strong>in</strong> der EU<br />
(12 Staaten) mit 14,7 Tagen an dritter Stelle. 75<br />
Die Weichen für e<strong>in</strong>en Kapazitätsabbau s<strong>in</strong>d bereits gestellt. Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen zählt zu den Ländern,<br />
die ihr Fördermittelvolumen im b<strong>und</strong>esweiten Vergleich überdurchschnittlich zurückgeschraubt<br />
75 Die höchsten Verweildauern hatten die Niederlande bzw. Luxemburg mit 19,6 bzw. 15,6 Tagen. Den niedrigsten<br />
Wert erreichte Dänemark mit 7,2 Tagen (Schneider et al. 1998). Hierbei ist allerd<strong>in</strong>gs zu beachten,<br />
dass diese Daten auch die unterschiedliche Arbeitsteilung zwischen ambulantem <strong>und</strong> stationärem Sektor widerspiegeln<br />
<strong>und</strong> nicht als alle<strong>in</strong>iger Indikator für Effizienz gelten können.<br />
- 127 -
Ausblick <strong>und</strong> Prognose<br />
haben. 1991 betrugen die Fördermittel noch 1.270,2 Mio. DM, 1998 waren es 945,2 Mio. DM. Dies<br />
entspricht e<strong>in</strong>em Rückgang von 325 Mio. DM bzw. 25,6% (Düll<strong>in</strong>gs 1999).<br />
Gegenwärtig werden Gutachten oder deren bereits vorveröffentlichte Ergebnisse diskutiert, die für die<br />
Zukunft des deutschen bzw. nordrhe<strong>in</strong>-westfälischen Krankenhaussektors wesentliche Umbrüche prognostizieren.<br />
U.a. ist von e<strong>in</strong>em drastischen Bettenabbau (Arthur Andersen Health Care 2000) <strong>und</strong> <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em Gutachten des Instituts für Ges<strong>und</strong>heitssystemforschung von erheblichen Überkapazitäten die<br />
Rede. 76 Für die Prognose der Beschäftigungsentwicklung s<strong>in</strong>d diese Aussagen nur von e<strong>in</strong>geschränkter<br />
Relevanz, da bisher ke<strong>in</strong> Zusammenhang zwischen Betten- <strong>und</strong> Beschäftigungsabbau nachgewiesen<br />
werden konnte (s. Abb. 9, Kap. 2.2.1.1). Allerd<strong>in</strong>gs könnte die Verdichtung des Krankenhausgeschehens<br />
durch Bettenabbau <strong>und</strong> Schließung von Häusern ohne gleichzeitigen Personalabbau an ihre<br />
Grenzen stoßen.<br />
Zudem ist davon auszugehen, dass der Personalabbau <strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäusern mit Verlagerungseffekten<br />
<strong>in</strong> den ambulanten Sektor e<strong>in</strong>hergeht. So ist e<strong>in</strong> verstärkter Bedarf an ambulant erbrachten<br />
Leistungen <strong>und</strong> e<strong>in</strong> dementsprechender Beschäftigungszuwachs zu erwarten. Dies betrifft<br />
nicht nur Ärzt/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> nichtmediz<strong>in</strong>ische therapeutische Berufe, sondern z.B. auch ambulante Pflegedienste,<br />
die sich zukünftig e<strong>in</strong>er wachsenden Nachfrage nach SGB V f<strong>in</strong>anzierten Leistungen gegenüber<br />
sehen dürften.<br />
4.3.2.2. Prognose Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
Die Beschäftigung <strong>in</strong> den Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen wird bis zum Jahr 2015, wenn<br />
auch von niedriger Basis ausgehend, erheblich zunehmen. Am Ende des Prognosezeitraums wird diese<br />
E<strong>in</strong>richtungsart von der Beschäftigungsbedeutung die sonstigen Krankenhäuser überholt haben. Der<br />
Beschäftigungskorridor, der durch das maximale <strong>und</strong> das m<strong>in</strong>imale Wachstum gebildet wird, liegt<br />
zwischen 7.000 <strong>und</strong> 16.000 h<strong>in</strong>zu gewonnenen Beschäftigungsverhältnissen. Das entspricht e<strong>in</strong>em<br />
Beschäftigungswachstum von 50-116%. Der als wahrsche<strong>in</strong>lich anzunehmende Korridor wird durch<br />
e<strong>in</strong>en Zugew<strong>in</strong>n von ca. 8.500 <strong>und</strong> 13.500 Beschäftigungsverhältnissen e<strong>in</strong>gegrenzt, was e<strong>in</strong>er Steigerung<br />
um 62 bzw. 100% entspricht.<br />
Die erstaunlichen Wachstumspotenziale der Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbesondere<br />
vier Faktoren geschuldet:<br />
• Verkürzung der Verweildauer <strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäusern ab 2003 zu Gunsten von mehr<br />
Überweisungen <strong>in</strong> Reha-E<strong>in</strong>richtungen durch das pauschalierte Entgeltsystem;<br />
• Veränderung im Krankheitspanorama;<br />
• Ausschöpfung des nordrhe<strong>in</strong>-westfälischen Rehabilitationspotenzials;<br />
• gegen Ende der Untersuchungsperiode rücken die geburtenstarken Jahrgänge <strong>in</strong> die Rehatypischen<br />
Altersklassen (55-59 Jahre) e<strong>in</strong>. Gerade bei den 55-Jährigen <strong>und</strong> Jüngeren besteht für<br />
76 E<strong>in</strong> weiteres Gutachten, das die vorliegenden Bef<strong>und</strong>e durch e<strong>in</strong>e differenzierte Betrachtung des Kapazitätsbestandes<br />
relativieren soll, ist von der nordrhe<strong>in</strong>-westfälischen Krankenhausgesellschaft bei der BASYS<br />
GmbH <strong>und</strong> der I+G Ges<strong>und</strong>heitsforschung <strong>in</strong> Auftrag gegeben worden.<br />
- 128 -
Ausblick <strong>und</strong> Prognose<br />
die Träger der Reha e<strong>in</strong> starker Anreiz, durch rehabilitative Interventionen die Erwerbsfähigkeit<br />
wiederherzustellen ("Reha statt Rente").<br />
Abb. 28 Beschäftigungsprognose Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen NRW 1998-<br />
2015<br />
30.000<br />
28.000<br />
26.000<br />
24.000<br />
22.000<br />
20.000<br />
18.000<br />
16.000<br />
14.000<br />
12.000<br />
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014<br />
Quelle: Berechnung <strong>und</strong> Erstellung MHH<br />
wahrsche<strong>in</strong>licher Korridor maximales Wachstum<br />
m<strong>in</strong>imales Wachstum wahrsche<strong>in</strong>licher Korridor<br />
Die bereits erwähnte E<strong>in</strong>führung e<strong>in</strong>es durchgängigen pauschalierten Entgeltsystems ab dem Jahr<br />
2003 wird für die allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäuser starke Anreize setzen, die Verweildauer <strong>in</strong> noch stärkerem<br />
Maße zu reduzieren. Um Patienten möglichst schnell entlassen zu können, ist mit verstärkten<br />
Maßnahmen zur Patientenmobilisierung zu rechnen. Aber auch die Verlegung von Patienten der allgeme<strong>in</strong>en<br />
Krankenhäuser, die ihre <strong>in</strong>tensiven Behandlungs- <strong>und</strong> Pflegetage h<strong>in</strong>ter sich haben, <strong>in</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
wird für die Krankenhäuser an Attraktivität gew<strong>in</strong>nen. Alle<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Verschiebung<br />
von durchschnittlich e<strong>in</strong>em Pflegetag pro Fall von allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäusern <strong>in</strong> Vorsorge-<br />
oder Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen könnte e<strong>in</strong>en Beschäftigungsgew<strong>in</strong>n von 6.200 bis 9.100 Arbeitsplätzen<br />
zur Folge haben (s. Anhang, Tab. A 24).<br />
Die zukünftig steigende Bedeutung der Rehabilitation wird durch Verschiebungen im Krankheitspanorama<br />
verstärkt. Die zunehmende Chronifizierung von Erkrankungen lassen Reha-Angebote vielfach<br />
als adäquatere Antwort ersche<strong>in</strong>en.<br />
Unter beschäftigungspolitischen Aspekten muss <strong>in</strong> Zukunft auch die zahlenmäßig nicht unerhebliche<br />
Differenz zwischen der Anzahl der Rehabilitanden, die <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen ihren Wohnsitz haben,<br />
<strong>und</strong> der Anzahl der <strong>in</strong> NRW rehabilitierten Patient/<strong>in</strong>nen gesehen werden. Unter Berücksichtigung von<br />
Wohnort <strong>und</strong> Patientenwanderung hat Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen <strong>in</strong> der gesetzlichen Rentenversicherung<br />
im Jahr 1997 e<strong>in</strong> Defizit von 50.000 Patienten der Rehabilitation ausgewiesen. Gel<strong>in</strong>gt es, die Rehabi-<br />
- 129 -
Ausblick <strong>und</strong> Prognose<br />
litanden im eigenen Land zu versorgen, so könnte dies bis zu 4.300 neue Arbeitsplätze schaffen (s.<br />
Anhang, Tab. A 25).<br />
Freilich darf nicht unerwähnt bleiben, dass e<strong>in</strong>e Reihe von Faktoren das Beschäftigungswachstum<br />
hemmen können. Diese liegen vor allem<br />
• <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzierbarkeit der Reha;<br />
• dem organisatorischen Interesse der Träger der Rehabilitation;<br />
• dem politischen Willen, sektorale Verschiebungen zuzulassen <strong>und</strong><br />
• <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em überdurchschnittlichen Ausbau ambulanter Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen 77 .<br />
4.3.2.3. Prognose sonstige Krankenhäuser<br />
Bei der Prognose der Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> den sonstigen Krankenhäusern ist anders als bei<br />
den allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäusern <strong>und</strong> den E<strong>in</strong>richtungen der Vorsorge <strong>und</strong> Rehabilitation nicht mit<br />
e<strong>in</strong>er Trendwende zu rechnen. Deshalb ersche<strong>in</strong>t es <strong>in</strong> diesem Fall opportun, den Personalabbau der<br />
Vergangenheit <strong>in</strong> abgemildeter Form fortzuschreiben.<br />
Unter dieser Prämisse ist e<strong>in</strong> Beschäftigungsabbau bis zum Jahr 2015 zu erwarten, dessen obere Grenze<br />
bei 2.900 Beschäftigungsverhältnissen bzw. 15% liegt <strong>und</strong> dessen Maximalwert bei 4.100 Beschäftigungsverhältnissen<br />
bzw. 21% liegt.<br />
Abb. 29 Beschäftigungsprognose sonstige Krankenhäuser NRW 1998-2015<br />
20.000<br />
19.000<br />
18.000<br />
17.000<br />
16.000<br />
15.000<br />
14.000<br />
13.000<br />
12.000<br />
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014<br />
jährlicher Rückgang um 1,4%<br />
jährlicher Rückgang um 1,4% bei gleichzeitigem Anstieg der Teilzeitarbeit auf 40%<br />
Quelle: Berechnung <strong>und</strong> Erstellung MHH<br />
77 Vgl. zu diesem letzten Aspekt detailliert Koch/Bürger 1996.<br />
- 130 -
Ausblick <strong>und</strong> Prognose<br />
4.3.3. Prognose der Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> der Altenhilfe <strong>und</strong> -pflege<br />
Zunächst zu den Ergebnissen des Rückblicks: Alle<strong>in</strong>e zwischen 1987 <strong>und</strong> 1998, d.h. <strong>in</strong> gut zehn Jahren,<br />
hat sich die Zahl der Beschäftigten <strong>in</strong> der Altenpflege wie dargestellt ungefähr verdoppelt. Im<br />
Großen <strong>und</strong> Ganzen verlief die enorme Expansion der Kapazitäten <strong>und</strong> Beschäftigung <strong>in</strong> der Altenhilfe<br />
relativ analog zur Zunahme der Altenbevölkerung <strong>und</strong> zum Wirtschaftswachstum. Über den gesamten<br />
Zeitraum zwischen 1961 <strong>und</strong> 1994 war das Wachstum der Kapazitäten <strong>in</strong> der Altenhilfe jedoch<br />
noch stärker als jenes der Bevölkerung <strong>und</strong> <strong>in</strong>sbesondere das der Altenbevölkerung, d.h., die Versorgungsquoten<br />
(Plätze pro E<strong>in</strong>wohner im Alter von 65 <strong>und</strong> älter) wuchsen <strong>in</strong>sbesondere im Pflegebereich<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> der neueren Zeit deutlich an. Während sich die Beschäftigtenzahl zwischen 1987 <strong>und</strong><br />
1998 verdoppelte <strong>und</strong> oft zweistellige jährliche Wachstumsraten aufwies, stieg die Zahl der über 65-<br />
Jährigen nur mit dem Faktor 1,17 <strong>und</strong> die jährlichen Wachstumsraten lagen zwischen 1 <strong>und</strong> 2%.<br />
Der vergleichende Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung, d.h., das Wachstum des Brutto<strong>in</strong>landsproduktes<br />
(BIP) (s. Anhang, Tab. A 15), zeigt, dass es zwar Zeiten gab, <strong>in</strong> denen das wirtschaftliche<br />
Wachstum schneller verlief als der Ausbau der Kapazitäten <strong>in</strong> der Altenhilfe – so <strong>in</strong>sbesondere Mitte<br />
bis Ende der siebziger <strong>und</strong> Mitte bis Ende der achtziger Jahre –, jedoch gab es auch Phasen, <strong>in</strong> denen<br />
die Expansion <strong>in</strong> der Altenhilfe rasanter vonstatten g<strong>in</strong>g als jene des BIP – so Anfang bis Mitte der<br />
achtziger Jahre <strong>und</strong> <strong>in</strong> den letzten zehn Jahren. Während sich <strong>in</strong> den letzten zehn Jahren die Zahl der<br />
Beschäftigten <strong>in</strong> der Altenhilfe <strong>und</strong> –pflege ungefähr verdoppelte, mit jährlichen Wachstumsraten von<br />
durchschnittlich 2,5%, legte das BIP (<strong>in</strong>flationsbere<strong>in</strong>igt) lediglich mit dem Faktor 1,3 zu.<br />
E<strong>in</strong> weiterer Aspekt, der dafür spricht, dass das Wachstum der Beschäftigung <strong>in</strong> der Altenpflege auch<br />
künftig <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen eher über als unter der Zunahme der Altenbevölkerung <strong>und</strong> dem wirtschaftlichen<br />
Wachstum liegen könnte, ist, dass die Versorgungslage <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen im Jahr<br />
1997 <strong>und</strong> 1998 sowohl mit Blick auf Gesamtdeutschland als auch auf die OECD-Länder noch etwas<br />
unter dem Durchschnitt vergleichbarer Werte Mitte der neunziger Jahre lag, d.h., dass diesbezüglich<br />
Nachholbedarf konstatiert werden kann.<br />
H<strong>in</strong>zu kommt der seit der E<strong>in</strong>führung der Pflegeversicherung generell <strong>und</strong> auch <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen zu beobachtende (wenn auch leichte) Rückgang der Inanspruchnahme von Geldleistungen,<br />
d.h. des häuslichen Pflegepotenzials. Ob dieser Rückgang nun aufgr<strong>und</strong> der Überlastung von Pflegepersonen,<br />
des kulturellen Wandels, der zunehmenden Frauenerwerbsquote (auch hier hat Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen noch e<strong>in</strong>en Nachholbedarf vor sich) oder aus anderen Gründen (erneut demographische) 78<br />
e<strong>in</strong>getreten ist, kann hier dah<strong>in</strong>gestellt bleiben. Damit e<strong>in</strong>her g<strong>in</strong>g jedenfalls e<strong>in</strong> Wachstum der Inanspruchnahme<br />
professioneller Altenpflege <strong>und</strong> damit der Beschäftigung, das alle<strong>in</strong>e zwischen 1997 <strong>und</strong><br />
1998 bei ca. 10% lag.<br />
Die besonders starke Expansion der Beschäftigung <strong>in</strong> der Altenpflege wurde nicht zuletzt durch politisch-<strong>in</strong>stitutionelle<br />
Entscheidungen <strong>und</strong> die Ausweitung der Bereitstellung öffentlicher Mittel gefördert,<br />
wobei die Schaffung der Pflegeversicherung <strong>und</strong> die dadurch bewirkte Mobilisierung erheblicher<br />
F<strong>in</strong>anzvolum<strong>in</strong>a <strong>in</strong> den letzten Jahren e<strong>in</strong>en besonders starken Wachstumsschub auslösten (vgl. Eifert<br />
78<br />
Alle<strong>in</strong> aus demographischen Gründen kommt es zu e<strong>in</strong>em Rückgang des sogenannten ‚Töchterpflegepotenzials‘.<br />
- 131 -
Ausblick <strong>und</strong> Prognose<br />
et al. 1999; Roth 2000). Dieses Wachstum wird jedoch aller Voraussicht nach zukünftig aus verschiedenen<br />
Gründen nicht <strong>in</strong> gleichem Maße anhalten, schon weil e<strong>in</strong>er Ausweitung der öffentlichen wie<br />
privaten F<strong>in</strong>anzmittel <strong>und</strong> Beiträge – <strong>und</strong> damit auch dem Wachstum der Beschäftigung <strong>in</strong> diesem<br />
Sektor – Grenzen gesetzt se<strong>in</strong> dürften. Allerd<strong>in</strong>gs lassen sich die dah<strong>in</strong>gehenden politischen Entwicklungen<br />
ebenso kaum zuverlässig prognostizieren wie die Bereitschaft zum verstärkten E<strong>in</strong>satz privater<br />
Mittel für Pflegeleistungen.<br />
E<strong>in</strong> nicht unbedeutender Faktor stellt ferner das Arbeitskräftepotenzial dar, das ebenso demographisch<br />
bed<strong>in</strong>gt rückläufig se<strong>in</strong> wird, beg<strong>in</strong>nend allerd<strong>in</strong>gs erst ab dem Jahre 2010 <strong>und</strong> erst ab dem Jahr 2015<br />
stärker werdend (vgl. Deutscher B<strong>und</strong>estag 1998: 215). Ferner stellt sich die Frage, <strong>in</strong>wiefern das<br />
schw<strong>in</strong>dende Arbeitskräftepotenzial durch Migration oder eben durch die steigende Frauenerwerbstätigkeit<br />
sowie e<strong>in</strong>e längere Lebensarbeitszeit ausgeglichen werden wird. E<strong>in</strong> weiterer Faktor, der auf<br />
die Realisierung der Beschäftigungspotenziale <strong>in</strong> der Altenpflege wirkt, ist die Frage der Rationalisierungsreserven<br />
im Pflegesektor. Diese gelten zwar mit Baumol bei sozialen Dienstleistungen als systematisch<br />
begrenzt, aber im E<strong>in</strong>zelnen werden hier dennoch für den Pflegebereich durchaus große<br />
Reserven angenommen (vgl. BMA 1998).<br />
Wie oben dargestellt wurde, wird bis zum Jahr 2015 <strong>in</strong>sbesondere e<strong>in</strong>e Zunahme der Hochaltrigen <strong>in</strong><br />
Höhe von ca. 30% prognostiziert. Darauf aufbauend wird e<strong>in</strong>e ähnlich starke Zunahme der Zahl der<br />
Pflegebedürftigen von 1,6 Mio. (1995) auf 2,1 Mio. im Jahr 2015 abgeschätzt (vgl. Deutscher B<strong>und</strong>estag<br />
1998: 471). Ferner ersche<strong>in</strong>t es durchaus wahrsche<strong>in</strong>lich, dass auch künftig e<strong>in</strong>e positive wirtschaftliche<br />
Entwicklung – zum<strong>in</strong>dest entsprechend dem langjährigen Niveau von e<strong>in</strong>em jährlichen<br />
Plus von ca. 1-2% – e<strong>in</strong>treten wird (vgl. Deutscher B<strong>und</strong>estag 1998: 218 f.). Wird zudem e<strong>in</strong> gewisses<br />
Maß an politischer <strong>und</strong> rechtlicher Kont<strong>in</strong>uität unterstellt <strong>und</strong> darüber h<strong>in</strong>aus angenommen, dass auch<br />
weiterh<strong>in</strong> eher e<strong>in</strong>e Verbesserung als Verschlechterung der Pflegequalität gesellschaftlich <strong>und</strong> politisch<br />
gewünscht ist – was aufgr<strong>und</strong> der Tatsache, dass (gute) Pflege vor allem entsprechendes Personal<br />
erfordert, eher weiter Personalwachstum <strong>in</strong> der Altenpflege <strong>in</strong>duziert – so lassen sich verschiedene<br />
Szenarien der künftigen Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> der Altenpflege aufzeigen. Diese liegen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
möglichen Korridor mit jährlichen Wachstumsraten von 1,5-3%. Dieses gilt allerd<strong>in</strong>gs unter der<br />
Voraussetzung, dass alle anderen genannten Faktoren ausgeblendet bleiben, d.h., <strong>in</strong>sbesondere, dass<br />
der entsprechende Arbeitskräftebedarf – wie auch immer (z.B. durch E<strong>in</strong>wanderung, steigende Frauenerwerbsquote,<br />
drastische Erhöhung der Lebensarbeitszeit) – gedeckt werden könnte <strong>und</strong> dass die<br />
dafür benötigten F<strong>in</strong>anzmittel (öffentlich oder privat) bereit gestellt werden sowie unter der Annahme,<br />
dass die Arbeitszeiten konstant bleiben <strong>und</strong> nicht erhebliche Rationalisierungspotenziale frei werden.<br />
Wird alle<strong>in</strong>e die demographische Prognose auf die Beschäftigungsentwicklung angewandt, so läge die<br />
Zunahme <strong>in</strong> etwa auf der Höhe der unteren Grenze des Korridors. Vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> der zurückliegenden<br />
enormen Expansion der Beschäftigung <strong>in</strong> der Altenpflege, e<strong>in</strong>es positiven jährlichen Wirtschaftswachstum<br />
von 1-2% <strong>und</strong> der genannten zusätzlichen Effekte (Rückgang <strong>in</strong>formeller Pflegepotenziale,<br />
Qualitätsverbesserungen etc.) ersche<strong>in</strong>t jedoch e<strong>in</strong> kräftigeres Wachstum der Beschäftigung<br />
<strong>in</strong> der Altenpflege von ca. 2-3% pro Jahr durchaus möglich zu se<strong>in</strong>, so dass bis zum Jahr 2015 die<br />
Zahl der Beschäftigten <strong>in</strong> der Altenpflege von heute ca. 150 Tsd. auf ca. 200-250 Tsd. ansteigen<br />
könnte.<br />
- 132 -
Ausblick <strong>und</strong> Prognose<br />
Abb. 30 Szenarien der Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> der Altenpflege <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen bis 2015<br />
270.000<br />
250.000<br />
230.000<br />
210.000<br />
190.000<br />
170.000<br />
150.000<br />
Quelle: Berechnung <strong>und</strong> Erstellung FfG<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
Jährliches Wachstum von 1,5% Jährliches Wachstum von 2%<br />
Jährliches Wachstum von 2,5% Jährliches Wachstum von 3%<br />
4.3.4. Prognose der zukünftigen Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> den Zuliefer<strong>in</strong>dustrien<br />
<strong>und</strong> Nachbarbranchen<br />
Die Zahl der Beschäftigten <strong>in</strong> den Zuliefer<strong>in</strong>dustrien <strong>und</strong> Nachbarbranchen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s<br />
nahm im Zeitraum von 1985 <strong>und</strong> 1998 um r<strong>und</strong> 18.000 auf <strong>in</strong>sgesamt r<strong>und</strong> 139.000 Personen zu. Aus<br />
den dargestellten Entwicklungstrends (s. Kap. 2.6) lassen sich für die Zukunft folgende Annahmen der<br />
Beschäftigungsentwicklung ableiten:<br />
Die sozio-demographische Entwicklung – vor allem die Alterung der Gesellschaft – wird sich wesentlich<br />
auf die Beschäftigungssituation <strong>in</strong> den Zuliefer<strong>in</strong>dustrien auswirken. So ist e<strong>in</strong>e weiter steigende<br />
Nachfrage nach mediz<strong>in</strong>- <strong>und</strong> gerontotechnischen Produkten <strong>und</strong> Dienstleistungen zu erwarten (vgl.<br />
Reents 1996: II-1). Es ist anzunehmen, dass sich der Wachstumstrend der letzten Jahre auch im Zeitraum<br />
bis 2015 fortsetzt. Selbst wenn von e<strong>in</strong>er leicht abgeschwächten Nachfrage nach Hilfs- <strong>und</strong> Unterstützungsleistungen<br />
aufgr<strong>und</strong> von Sättigungsersche<strong>in</strong>ungen ausgegangen wird, ist mit e<strong>in</strong>er positiven<br />
Beschäftigungsentwicklung zu rechnen, vor allem dann, wenn die mediz<strong>in</strong>- <strong>und</strong> gerontotechnische<br />
Industrie weiterh<strong>in</strong> <strong>in</strong> Produkt- <strong>und</strong> Dienstleistungs<strong>in</strong>novationen für mehr Lebensqualität im Alter<br />
<strong>in</strong>vestiert. Die schon heute im Vergleich zu anderen <strong>in</strong>dustriellen Sektoren überdurchschnittlich hohen<br />
- 133 -
Ausblick <strong>und</strong> Prognose<br />
FuE-Ausgaben der Mediz<strong>in</strong>- <strong>und</strong> Gerontotechnik, aber auch der pharmazeutischen Industrie, lassen<br />
e<strong>in</strong>en weiteren <strong>in</strong>novationsbed<strong>in</strong>gten Beschäftigungsausbau plausibel ersche<strong>in</strong>en.<br />
E<strong>in</strong>en Sonderfall stellt die moderne Biotechnologie dar, da die positive Beschäftigungsentwicklung im<br />
Bereich biotechnologischer Verfahren <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie auf politische Maßnahmen <strong>und</strong> Förderprogramme<br />
zurückzuführen ist. In Zukunft ist hier zwar mit e<strong>in</strong>em weiteren, aber dennoch ger<strong>in</strong>ger ausfallendem<br />
Wachstum als bisher zu rechnen. Die als Prozess<strong>in</strong>novationen <strong>und</strong> Vorleistungen <strong>in</strong> die Produktion<br />
pharmazeutischer Erzeugnisse e<strong>in</strong>gehenden Produkte <strong>und</strong> Dienstleistungen der Biotechnologie<br />
werden vor allem positive Impulse <strong>in</strong> der pharmazeutischen Industrie setzen, so dass dort e<strong>in</strong> leichtes<br />
Beschäftigungswachstum erfolgt. Denn die beschäftigungsfördernden Effekte der modernen Bio- <strong>und</strong><br />
Gentechnologie wirken sich nicht direkt <strong>in</strong> der Branche selbst, sondern vielmehr über <strong>in</strong>direkte Effekte<br />
<strong>und</strong> E<strong>in</strong>kommenseffekte <strong>in</strong> den Anwendungsbereichen, etwa <strong>in</strong> der Chemischen Industrie (<strong>in</strong>klusive<br />
pharmazeutische Industrie) oder <strong>in</strong> der Nahrungsmittel<strong>in</strong>dustrie, aus.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus werden vor allem die F<strong>in</strong>anzierungsmodalitäten die Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> den<br />
Nachbarbranchen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s bee<strong>in</strong>flussen. Dabei kommt den privaten Ressourcen, die<br />
zusätzlich zu den öffentlichen <strong>und</strong> halböffentlichen Mitteln für die Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft mobilisiert<br />
werden können, e<strong>in</strong> hoher Stellenwert zu. Dafür, dass gute Chancen bestehen, entsprechende private<br />
F<strong>in</strong>anzressourcen zu aktivieren, sprechen folgende Annahmen:<br />
• Verbraucher s<strong>in</strong>d gr<strong>und</strong>sätzlich sehr stark an ges<strong>und</strong>heitsbezogenen Angeboten <strong>in</strong>teressiert.<br />
• Das Altern der Gesellschaft wird diese gr<strong>und</strong>sätzlich günstige Stimmung noch erhöhen, da bei<br />
älteren Menschen das Interesse an Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Lebensqualität stärker ausgeprägt ist als bei<br />
jüngeren.<br />
• Die wachsende Individualisierung der Gesellschaft wird dazu führen, dass Hilfspotenziale, die<br />
heute <strong>in</strong>formell <strong>in</strong> Familien erbracht werden, zukünftig über den Markt bezogen werden.<br />
• Das Entstehen von „Hybridprodukten“, bei denen Produkte aus anderen Branchen mit ges<strong>und</strong>heitsbezogenen<br />
Produkten angereichert werden (z.B. Ges<strong>und</strong>heitstourismus oder betreutes bzw.<br />
Service-Wohnen), wird mehr Aufmerksamkeit <strong>und</strong> Kaufkraft für das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> mobilisieren.<br />
Die Tragweite dieser Entwicklung wird freilich davon abhängen, ob <strong>und</strong> <strong>in</strong> wieweit es gel<strong>in</strong>gt, die<br />
Ges<strong>und</strong>heitskompetenz <strong>und</strong> K<strong>und</strong>enorientierung der Anbieter zu stärken <strong>und</strong> entsprechende Dienstleistungen<br />
(regional, national <strong>und</strong> <strong>in</strong>ternational) zu vermarkten.<br />
Insbesondere <strong>in</strong> Bezug auf die Produkte <strong>und</strong> Dienstleistungen, die nicht dem Kernsektor der ambulanten<br />
<strong>und</strong> stationären Versorgung zuzuordnen s<strong>in</strong>d, wird die Mobilisierung zusätzlicher privater<br />
Kaufkraft e<strong>in</strong>en besonderen Stellenwert e<strong>in</strong>nehmen. Im Kontext privater <strong>und</strong> gemischter F<strong>in</strong>anzierung<br />
wird zudem die Anwerbung ausländischer K<strong>und</strong>en an Bedeutung gew<strong>in</strong>nen. Der <strong>in</strong>ternationale<br />
Dienstleistungstransfer – auch <strong>in</strong> der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft - hat sich <strong>in</strong> den letzten Jahren <strong>in</strong>tensiviert.<br />
Auf die hohe Exportabhängigkeit der Zuliefer<strong>in</strong>dustrien – vor allem der pharmazeutischen <strong>und</strong><br />
mediz<strong>in</strong>technischen Industrie – wurde <strong>in</strong> Kapitel 2.6 bereits h<strong>in</strong>gewiesen. In Zukunft könnten auch die<br />
Nachbarbranchen – vor allem <strong>in</strong> den Bereichen Ges<strong>und</strong>heitstourismus oder Wellness – von der stei-<br />
- 134 -
Ausblick <strong>und</strong> Prognose<br />
genden ausländischen Nachfrage nach den Angeboten der nordrhe<strong>in</strong>-westfälischen Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft<br />
profitieren.<br />
Abb. 31 Szenarien der Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> den Zuliefer<strong>in</strong>dustrien <strong>und</strong> Nachbarbranchen<br />
<strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen bis 2015<br />
170.000<br />
165.000<br />
160.000<br />
155.000<br />
150.000<br />
145.000<br />
140.000<br />
135.000<br />
- 135 -<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
Jährliches Wachstum von 0,5% Jährliches Wachstum von 1%<br />
Quelle: Berechnung <strong>und</strong> Erstellung IAT<br />
Wird <strong>in</strong> Rechnung gestellt, dass das Wachstum <strong>in</strong> den Zuliefer<strong>in</strong>dustrien <strong>und</strong> Nachbarbranchen des<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s <strong>in</strong> den letzten Jahren zwar ger<strong>in</strong>ger ausgefallen ist als <strong>in</strong> den Kernsektoren der<br />
ambulanten <strong>und</strong> stationären Versorgung, aber dennoch e<strong>in</strong>en Beitrag zur positiven Beschäftigungsentwicklung<br />
<strong>in</strong> der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft <strong>in</strong>sgesamt geleistet hat, lassen sich für die Zukunft ebenfalls<br />
positive Entwicklungen vermuten. Bei e<strong>in</strong>em (unterstellten) jährlichen Wachstum zwischen 0,5% <strong>und</strong><br />
1% ergibt sich e<strong>in</strong>e Beschäftigungszunahme, die sich zwischen 12.300 (untere Grenze des Korridors)<br />
<strong>und</strong> ca. 25.600 neuen Arbeitsplätzen (obere Grenze des Korridors) bewegt. Die untere Grenze des<br />
Korridors wird realisiert, wenn von e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>fachen Fortsetzung der zurückliegenden Beschäftigungsentwicklung<br />
ausgegangen wird. Die Realisierung der oberen Grenze des Korridors h<strong>in</strong>gegen ist nur<br />
dann zu erwarten, wenn durch e<strong>in</strong> zielgerichtetes Market<strong>in</strong>g, durch die Vernetzung der Angebote <strong>und</strong><br />
die konsequente struktur- <strong>und</strong> wirtschaftspolitische Förderung der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft e<strong>in</strong>e weitere<br />
Mobilisierung der endogenen Innovationspotenziale <strong>und</strong> dadurch e<strong>in</strong>e Aktivierung zusätzlicher privater<br />
Nachfrage erfolgen kann.
Ausblick <strong>und</strong> Prognose<br />
4.3.5. Prognose der Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong>sgesamt<br />
In der Zusammenschau der gesonderten Prognosen ergibt sich folgendes Gesamtbild: Bei Zugr<strong>und</strong>elegung<br />
des positiven Szenarios besteht die Möglichkeit, dass bis zum Jahr 2015 r<strong>und</strong> 196.200 neue Arbeitsplätze<br />
<strong>in</strong> der nordrhe<strong>in</strong>-westfälischen Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft entstehen. Selbst wenn sich die anspruchsvollen<br />
Voraussetzungen des Positiv-Szenarios nicht vollkommen realisieren lassen, kann von<br />
e<strong>in</strong>em Beschäftigungswachstum von immerh<strong>in</strong> noch r<strong>und</strong> 70.700 neuen Arbeitsplätzen ausgegangen<br />
werden.<br />
Tab. 52 Prognose der Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> der gesamten Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft<br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalens bis 2015<br />
Unteres Szenario Oberes Szenario<br />
Ambulante Versorgung +30.000 +60.000<br />
Stationäre Versorgung -15.600 +10.600<br />
Altenhilfe <strong>und</strong> –pflege +44.000 +100.000<br />
Zuliefer<strong>in</strong>dustrien <strong>und</strong><br />
Nachbarbranchen<br />
+12.300 +25.600<br />
GESAMT +70.700 +196.200<br />
Quelle: Berechnung <strong>und</strong> Erstellung IAT, FfG, MHH<br />
Die Realisierung des Positiv-Szenarios ist jedoch ke<strong>in</strong> „Selbstläufer“, im Gegenteil, die Sicherung <strong>und</strong><br />
der Ausbau der Beschäftigung <strong>in</strong> der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft s<strong>in</strong>d äußerst voraussetzungsreich. Vor<br />
allem die Innovationsfähigkeit der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft ist gefordert, die Qualität <strong>und</strong> Effizienz der<br />
Produkte <strong>und</strong> Dienstleistungen zu erhöhen, um damit den vorhandenen Nachfragepotenzialen e<strong>in</strong> entsprechend<br />
anspruchsvolles Angebot vorhalten zu können. Unter diesen Voraussetzungen bestehen<br />
gute Chancen, den hidden champion des Strukturwandels auch <strong>in</strong> Zukunft weiter auf Erfolgskurs zu<br />
halten.<br />
- 136 -
5. Anhang<br />
Regionalstudie Rhe<strong>in</strong>land<br />
5.1. Regionale Entwicklungspotenziale <strong>und</strong> –perspektiven<br />
Die Analyse der Ausbildungs- <strong>und</strong> Beschäftigungsentwicklung im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalens hat die zentralen E<strong>in</strong>flussfaktoren auf die landesweite Beschäftigungsentwicklung identifiziert<br />
<strong>und</strong> daraus Prognosen für die zukünftigen Beschäftigungsmöglichkeiten im Ges<strong>und</strong>heitsbereich<br />
entwickelt. Zur Beurteilung der möglichen Perspektiven im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> soll abschließend der<br />
bisherige Focus der Betrachtung um Regionalstudien erweitert werden, denn erste E<strong>in</strong>blicke <strong>in</strong> regionale<br />
Versorgungsstrukturen <strong>und</strong> mögliche Entwicklungspfade bieten nicht zuletzt den verschiedenen<br />
Akteuren im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung der Versorgungslandschaft.<br />
Die folgenden drei Regionalstudien verdeutlichen die regional z.T. sehr unterschiedlichen Voraussetzungen<br />
<strong>und</strong> Entwicklungspotenziale des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen <strong>und</strong> erarbeiten<br />
kle<strong>in</strong>räumige Handlungsempfehlungen. Da sich verschiedene Regionen auf den Weg machen, sich als<br />
Ges<strong>und</strong>heitsregionen zu profilieren, ist e<strong>in</strong>e auf die nordrhe<strong>in</strong>-westfälischen Teilregionen ausgerichtete<br />
Betrachtung s<strong>in</strong>nvoll. Allerd<strong>in</strong>gs können im Rahmen dieser Studie nur erste qualitative Bestandsaufnahmen<br />
geleistet werden, die perspektivisch durch weitere Analysen der regionalen Entwicklungsmöglichkeiten<br />
ergänzt werden müssen.<br />
5.1.1. Profil <strong>und</strong> Perspektiven der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft im Rhe<strong>in</strong>land<br />
Michael Neitzel (Institut für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- <strong>und</strong> Regionalentwicklung<br />
GmbH an der Ruhr-Universität Bochum)<br />
Im Folgenden wird die Region Rhe<strong>in</strong>land mit den adm<strong>in</strong>istrativen Grenzen des Regierungsbezirks<br />
Köln gleichgesetzt, der sich im Südwesten Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalens erstreckt. Unter siedlungsstrukturellen<br />
Gesichtspunkten ist die Region sehr heterogen aufgebaut: hochverdichtete Großstädte wie Köln<br />
<strong>und</strong> Leverkusen im Osten, südlich am Rhe<strong>in</strong> die lange Jahre durch die Regierungsfunktionen geprägte<br />
Verwaltungsmetropole Bonn, die Stadt Aachen am westlichen Ausläufer des Bezirks <strong>und</strong> dazwischen<br />
eher ländlich geprägte Kreise mit unterschiedlicher wirtschaftlicher Bedeutung. Auch aus dem Blickw<strong>in</strong>kel<br />
des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s gibt es bemerkenswerte Unterschiede: Während die Region Bonn im<br />
traditionellen <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Akzente setzt, haben Unternehmen, Forschungse<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong><br />
Organisationen der Bio- <strong>und</strong> Gentechnologie, e<strong>in</strong>er Diszipl<strong>in</strong>, die heute vielfach auch mit Health Care<br />
oder Life Sciences bezeichnet wird, e<strong>in</strong> enges Netzwerk entlang der Entwicklungsachse Aachen, Köln,<br />
Leverkusen bis h<strong>in</strong>auf nach Düsseldorf gesponnen.<br />
- 137 -
Regionalstudie Rhe<strong>in</strong>land<br />
Im Folgenden wird der Status-Quo <strong>in</strong>nerhalb des Regierungsbezirks anhand des traditionellen <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s<br />
beschrieben. Daran anschließend werden die beiden genannten Schwerpunkte - die<br />
Region Bonn mit e<strong>in</strong>er stärkeren Profilierung der tradierten Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong> die Aktivitäten<br />
im Bereich der Bio- <strong>und</strong> Gentechnologie - dargestellt.<br />
5.1.1.1. Strukturen der ambulanten <strong>und</strong> stationären Ges<strong>und</strong>heitsversorgung im Rhe<strong>in</strong>land<br />
Das traditionelle <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> weist e<strong>in</strong>e für die Struktur der Region typische Komb<strong>in</strong>ation aus<br />
stationärer <strong>und</strong> ambulanter Basisversorgung auf. In der Region hatten zum 31.12.1997 <strong>in</strong>sgesamt 82<br />
allgeme<strong>in</strong>e Krankenhäuser ihren Sitz, 18 davon <strong>in</strong> der Stadt Köln, 10 im Rhe<strong>in</strong>-Sieg-Kreis <strong>und</strong> 9 <strong>in</strong> der<br />
Stadt Bonn. H<strong>in</strong>zu kommen noch 26 Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong> 16 sonstige<br />
Krankenhäuser.<br />
Im Regierungsbezirk Köln befand sich 1997 e<strong>in</strong> Fünftel aller Betten des Landes. Bezogen auf die Bevölkerungszahl<br />
entspricht dies e<strong>in</strong>em Versorgungsgrad von 6,3 Betten/1.000 E<strong>in</strong>wohner gegenüber 7,1<br />
Betten pro 1.000 E<strong>in</strong>wohner im Landesdurchschnitt. Die Städte Bonn (12,4 Betten/1.000 E<strong>in</strong>wohner)<br />
<strong>und</strong> Aachen (9,6 Betten/1.000 E<strong>in</strong>wohner) weisen die höchsten, der Erftkreis <strong>und</strong> der Rhe<strong>in</strong>-Sieg-<br />
Kreis (3,5 bzw. 3,4 Betten/1.000 E<strong>in</strong>wohner) die niedrigsten Versorgungsgrade auf. Dies spricht dafür,<br />
dass die großen Städte für die benachbarten Kreise Versorgungsfunktionen mit übernehmen. Positiv<br />
gestaltete sich die Entwicklung für die Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen; ihre Zahl erhöhte<br />
sich im Regierungsbezirk Köln von 12 auf 26 E<strong>in</strong>richtungen; im Rhe<strong>in</strong>isch-Oberbergischen Kreis <strong>und</strong><br />
im Rhe<strong>in</strong>-Sieg-Kreis wurden sogar 3 bzw. 5 neue E<strong>in</strong>richtungen eröffnet.<br />
Rückblickend zeigt sich, dass sich die Krankenhäuser <strong>in</strong> der Region den Bemühungen der Kostendämpfung<br />
im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> nicht entziehen konnten. Der Regierungsbezirk hat seit 1990 allerd<strong>in</strong>gs<br />
nur e<strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>es Krankenhaus verloren, während <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen <strong>in</strong>sgesamt 15 E<strong>in</strong>richtungen<br />
geschlossen wurden bzw. mit anderen Krankenhäusern fusioniert haben. Innerhalb der<br />
Region gab es aber sowohl Gew<strong>in</strong>ner als auch Verlierer: <strong>in</strong> der Stadt Bonn wie auch im Landkreis<br />
Euskirchen <strong>und</strong> im Oberbergischen Kreis s<strong>in</strong>d E<strong>in</strong>richtungen fortgefallen, dagegen s<strong>in</strong>d zusätzliche<br />
allgeme<strong>in</strong>e Krankenhäuser im Landkreis Düren <strong>und</strong> dem Erftkreis entstanden. Deutlicher lässt sich die<br />
Kostendämpfung an den Veränderungen der Bettenkapazitäten ablesen. Sie verr<strong>in</strong>gerten sich von 1990<br />
bis 1997 um 4,5 Prozent auf 26.546 Betten. Im Regierungsbezirk Köln fiel damit der Bettenabbau<br />
stark unterdurchschnittlich aus, denn im Landesdurchschnitt g<strong>in</strong>gen rd. 10 Prozent der Betten im gleichen<br />
Zeitraum verloren.<br />
In der ambulanten Versorgung hatten 8.735 Ärzte <strong>in</strong> freier Praxis (per 31.12.1996; ohne Ärzte mit<br />
Krankenhaustätigkeit) im Regierungsbezirk Köln ihren Sitz. Ihre Zahl hat sich gegenüber 1991 parallel<br />
zum Landesdurchschnitt um rd. 14 Prozent erhöht. Geändert hat sich die Bedeutung e<strong>in</strong>zelner<br />
Fachgruppen: Die Zahl der Zahnärzte hat sich um 25 Prozent erhöht, die Zahl der Ärzte anderer Fachbereiche<br />
konnte lediglich um 9 Prozent zulegen.<br />
Ergänzt <strong>und</strong> abger<strong>und</strong>et wird das Angebot <strong>in</strong>nerhalb des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s durch die mediz<strong>in</strong>ischen<br />
Fakultäten <strong>und</strong> Institute der Universitäten Köln <strong>und</strong> Bonn sowie der rhe<strong>in</strong>isch-westfälischen Techni-<br />
- 138 -
Regionalstudie Rhe<strong>in</strong>land<br />
schen Hochschule <strong>in</strong> Aachen mit den jeweils angeschlossenen Universitätskl<strong>in</strong>iken bzw. mediz<strong>in</strong>ischen<br />
E<strong>in</strong>richtungen.<br />
Das Beschäftigungsniveau der traditionellen Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft lässt sich mit der Zahl der im Ges<strong>und</strong>heits-<br />
<strong>und</strong> Veter<strong>in</strong>ärwesen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zum<strong>in</strong>dest für die Kernbereiche<br />
der ges<strong>und</strong>heitlichen Versorgung grob abschätzen, allerd<strong>in</strong>gs werden <strong>in</strong> dieser Wirtschaftsgruppe<br />
nicht alle Beschäftigten geführt, die dem <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> zugerechnet werden können. Nach<br />
dieser Abgrenzung arbeiteten im Rhe<strong>in</strong>land 93.966 Beschäftigte im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> (per<br />
31.12.1997).<br />
Abb. 32 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Veter<strong>in</strong>ärwesen im<br />
Rhe<strong>in</strong>land 1997<br />
In e<strong>in</strong>er langfristigen Betrachtung zeigt sich, dass sich die Beschäftigung im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> im<br />
Regierungsbezirk Köln <strong>und</strong> <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen nahezu parallel entwickelt hat. Seit 1980 hat die<br />
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung dynamisch zugenommen <strong>und</strong> konnte bis 1997 im Regierungsbezirk<br />
Köln um 58 Prozent zulegen (NRW 54 Prozent). Die Gesamtzahl der Beschäftigten aller<br />
Wirtschaftsbereiche hat sich dagegen nur um moderate 8,4 Prozent erhöht (NRW 1,8 Prozent). Die<br />
jährlichen Steigerungsraten lagen im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> fast immer deutlich über 1,5 Prozent <strong>und</strong> bescherten<br />
der Region <strong>in</strong> den Boom-Phasen der Jahre 1986 <strong>und</strong> 1990 sogar Zuwächse von bis zu 4,4<br />
bzw. 4,9 Prozent. Erst <strong>in</strong> den Jahren 1996 <strong>und</strong> 1997 hat sich das Wachstum spürbar abgeschwächt.<br />
Zwar steigt die Zahl der Arbeitnehmer des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s im Regierungsbezirk Köln mit etwas<br />
über 1 Prozent p.a. noch leicht an, 1997 deutete sich aber mit dem ersten absoluten Rückgang <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
seit 1980 e<strong>in</strong> zwischenzeitliches Ende des Wachstumstrends an.<br />
Innerhalb des Regierungsbezirks konnten die Stadt Aachen (Plus 89,4 Prozent) <strong>und</strong> der Landkreis<br />
Euskirchen (Plus 74,6 Prozent) die größten Beschäftigungszuwächse (seit 1980) registrieren. Die Stadt<br />
Bonn hat dagegen nur unterdurchschnittlich von dem positiven Entwicklungstrend profitiert (+ 41,1<br />
Prozent).<br />
- 139 -
Regionalstudie Rhe<strong>in</strong>land<br />
Hohe Beschäftigungsanteile - gemessen an der Gesamtbeschäftigung - hat das Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Veter<strong>in</strong>ärwesen<br />
<strong>in</strong> der Stadt Aachen (10,1 Prozent) sowie im Landkreis Euskirchen (9,1 Prozent) <strong>und</strong> <strong>in</strong> der<br />
Stadt Bonn (9,0 Prozent).<br />
5.1.1.2. Regionale Besonderheiten des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s im Rhe<strong>in</strong>land<br />
Aus dem Blickw<strong>in</strong>kel des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s kristallisieren sich im Rhe<strong>in</strong>land zwei verschiedene<br />
Entwicklungsl<strong>in</strong>ien heraus, die im Folgenden kurz beschrieben <strong>und</strong> <strong>in</strong> Bezug auf die Beschäftigungseffekte<br />
bewertet werden sollen. Zum e<strong>in</strong>en handelt es sich um e<strong>in</strong>e Fortentwicklung des traditionellen<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s <strong>in</strong> der Region Bonn: „Ges<strong>und</strong> <strong>in</strong> die Zukunft“ ist der Slogan, mit dem sich die<br />
Region als Ges<strong>und</strong>heitsstandort überregional profilieren will. Zum anderen handelt es sich um den<br />
Auf- <strong>und</strong> Ausbau der Bio- <strong>und</strong> Gentechnologie, die <strong>in</strong> Teilbereichen dem <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> zuzurechnen<br />
ist. Unternehmen <strong>und</strong> Institutionen dieser Branche präsentieren sich als BioRegio Rhe<strong>in</strong>land<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Verb<strong>und</strong>, der sich räumlich von Aachen über Köln <strong>und</strong> Leverkusen bis nach Düsseldorf erstreckt.<br />
Ges<strong>und</strong>heitsregion Bonn: Ges<strong>und</strong> <strong>in</strong> die Zukunft<br />
Die Stadt Bonn sowie die Landkreise Rhe<strong>in</strong>-Sieg <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen <strong>und</strong> Ahrweiler <strong>in</strong> Rhe<strong>in</strong>land-<br />
Pfalz haben sich <strong>in</strong> verschiedenen Feldern zu e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>samen Entwicklungsstrategie entschlossen,<br />
die durch die Strukturförderungsgesellschaft (sfg) Bonn/Rhe<strong>in</strong>-Sieg/Ahrweiler koord<strong>in</strong>iert wird. Diese<br />
Abgrenzung der Region Bonn ist auch für die Analyse des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s zweckmäßig, obwohl<br />
die Teilregionen unterschiedliche <strong>in</strong>haltliche Schwerpunkte gesetzt haben. Bspw. hat der Landkreis<br />
Ahrweiler als Kurstandort Bedeutung erlangt, während <strong>in</strong> der Stadt Bonn <strong>und</strong> im Rhe<strong>in</strong>-Sieg-Kreis die<br />
E<strong>in</strong>richtungen der ambulanten <strong>und</strong> stationären (Basis-)Versorgung Standortvorteile entwickelt haben.<br />
Das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> der Region Bonn ist - vorwiegend durch die Vielzahl der E<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong><br />
der niedergelassenen Ärzte <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esstadt Bonn - durch e<strong>in</strong>en sowohl quantitativ wie auch qualitativ<br />
hohen Stand der mediz<strong>in</strong>ischen Versorgung gekennzeichnet.<br />
Die quantitative Dimension der mediz<strong>in</strong>ischen Versorgung wird anhand e<strong>in</strong>es Vergleichs verschiedener<br />
Indikatoren für die Stadt Bonn mit dem Land NRW besonders augenfällig:<br />
• In der ambulanten Versorgung s<strong>in</strong>d 1.044 Ärzte <strong>in</strong> freier Praxis <strong>in</strong> Bonn tätig. Rd. 3,5 niedergelassene<br />
Ärzte (<strong>in</strong>kl. Zahnärzte) kommen auf 1.000 E<strong>in</strong>wohner. Damit ist der Versorgungsgrad fast<br />
doppelt so hoch wie im Landesdurchschnitt (1,8 Ärzte/1.000 E<strong>in</strong>wohner) <strong>und</strong> deutlich höher als<br />
im Regierungsbezirk Köln (2,1 Ärzte/1.000 E<strong>in</strong>wohner) (Stand: jeweils 31.12.1996).<br />
• Für die stationäre Versorgung halten die Krankenhäuser 3.769 Betten vor, das s<strong>in</strong>d 12,4 Betten pro<br />
1.000 E<strong>in</strong>wohner. Im Landesdurchschnitt s<strong>in</strong>d es nur 7,1 Betten/1.000 E<strong>in</strong>wohner, im Regierungsbezirk<br />
Köln durchschnittlich nur 6,3 Betten/1.000 E<strong>in</strong>wohner. Demgegenüber liegt dieser Wert<br />
mit 3,4 Betten/1.000 E<strong>in</strong>wohner im Rhe<strong>in</strong>-Sieg-Kreis deutlich niedriger.<br />
• Im Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Veter<strong>in</strong>ärwesen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Stadt Bonn 13.088 Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig<br />
beschäftigt; damit entfallen rd. 43 Beschäftigte auf 1.000 E<strong>in</strong>wohner. Im Landes-<br />
- 140 -
Regionalstudie Rhe<strong>in</strong>land<br />
durchschnitt s<strong>in</strong>d es 24,1 <strong>und</strong> im Durchschnitt des Regierungsbezirkes 22,2 Beschäftigte pro 1.000<br />
E<strong>in</strong>wohner.<br />
Stadt <strong>und</strong> Region Bonn zeichnen sich durch e<strong>in</strong>e Vielzahl von anerkannten Privatkl<strong>in</strong>iken <strong>und</strong> allgeme<strong>in</strong>en<br />
Krankenhäusern mit mediz<strong>in</strong>ischen Schwerpunkten aus. E<strong>in</strong> kurzer Überblick verdeutlicht das<br />
Spektrum der E<strong>in</strong>richtungen:<br />
So hat die Dardenne Augenkl<strong>in</strong>ik <strong>in</strong> Bonn-Bad Godesberg - Schwerpunkte s<strong>in</strong>d Operationen des grauen<br />
Star, des grünen Star <strong>und</strong> Hornhauttransplantationen - weltweite Bekanntheit erlangt. Gleiches gilt<br />
für die Robert-Jancker-Kl<strong>in</strong>ik im Bereich der Onkologie. Von besonderer Bedeutung s<strong>in</strong>d weitere<br />
Privatkl<strong>in</strong>iken: Angiosan - Fachkl<strong>in</strong>ik für Gefäß-, Enddarmerkrankungen <strong>und</strong> Chirurgie, das Neurologische<br />
Rehabilitations-Zentrum “Godeshöhe”, die Kaiser-Karl-Kl<strong>in</strong>ik für Orthopädie, die Orthopädische<br />
Kl<strong>in</strong>ik Dr. Fleega sowie die Medeco-Zahnkl<strong>in</strong>ik.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus haben die Rhe<strong>in</strong>ischen Kl<strong>in</strong>iken, die vom Landschaftsverband Rhe<strong>in</strong>land getragen<br />
werden, ihren Sitz <strong>in</strong> Bonn; Schwerpunkte liegen im Bereich der allgeme<strong>in</strong>en sowie der Jugend- <strong>und</strong><br />
Gerontopsychiatrie. Das St. Josef-Hospital verfügt über e<strong>in</strong>e Kältekammer für e<strong>in</strong>e ganzheitliche Kältetherapie,<br />
das St. Marien-Hospital verweist auf besondere Stärken im Bereich der Gefäßchirurgie <strong>und</strong><br />
der Neonatologie (Behandlung von Frühgeburten). H<strong>in</strong>zu kommt die mediz<strong>in</strong>ische Kompetenz der<br />
Mediz<strong>in</strong>ischen E<strong>in</strong>richtungen der Rhe<strong>in</strong>ischen-Friedrich-Wilhelms-Universität, die <strong>in</strong> den Bereichen<br />
Radiologie, Lebertransplantation <strong>und</strong> K<strong>in</strong>derurologie führend s<strong>in</strong>d.<br />
Im Rhe<strong>in</strong>-Sieg-Kreis hat die Johanniter K<strong>in</strong>derkl<strong>in</strong>ik <strong>in</strong> St. August<strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Schwerpunkt K<strong>in</strong>derkardiologie<br />
e<strong>in</strong>gerichtet. Auf die Behandlung von Herzkrankheiten hat sich das Krankenhaus Siegburg<br />
GmbH spezialisiert; das dort errichtete Herzzentrum gilt b<strong>und</strong>esweit als e<strong>in</strong>es der größten.<br />
Neben den Kl<strong>in</strong>iken <strong>und</strong> Krankenhäusern s<strong>in</strong>d weitere Unternehmen <strong>und</strong> Institutionen dem <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
direkt oder <strong>in</strong>direkt zurechenbar wie z.B. Arzneimittelhersteller, Fitness- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitszentren,<br />
Sanitätshäuser sowie Hersteller von Verbandstoffen usw. Zudem gibt es zwei Heilpraktikerschulen<br />
<strong>in</strong> Bonn <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e <strong>in</strong> Siegburg. Als überregional tätige E<strong>in</strong>richtungen treten die Zentralstelle<br />
der Länder für Ges<strong>und</strong>heitsschutz bei Mediz<strong>in</strong>produkten <strong>und</strong> das B<strong>und</strong>es<strong>in</strong>stitut für Arzneimittel <strong>und</strong><br />
Mediz<strong>in</strong>produkte h<strong>in</strong>zu. Am Standort Bonn s<strong>in</strong>d etwas über 60 Ausschüsse, Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaften,<br />
Verbände <strong>und</strong> Vere<strong>in</strong>e des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s präsent, darunter u.a. der B<strong>und</strong>esges<strong>und</strong>heitsausschuss,<br />
der B<strong>und</strong>esverband der pharmazeutischen Industrie, der B<strong>und</strong>esverband Deutscher Privatkrankenanstalten,<br />
die Forschungsvere<strong>in</strong>igung der Arzneimittelhersteller <strong>und</strong> der Hartmannb<strong>und</strong>. H<strong>in</strong>zu kommt<br />
das B<strong>und</strong>esges<strong>und</strong>heitsm<strong>in</strong>isterium, das se<strong>in</strong>en ersten Dienstsitz <strong>in</strong> der Stadt Bonn hat.<br />
Handlungsfelder für den Ausbau des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s <strong>in</strong> der Region Bonn<br />
Das breite Spektrum mediz<strong>in</strong>ischer E<strong>in</strong>richtungen ist auf den bisherigen Status der Stadt Bonn zurückzuführen.<br />
In der ehemaligen Hauptstadt Deutschlands gab es e<strong>in</strong>en überdurchschnittlichen Anteil von<br />
Privatpatienten - Verwaltungsbeamte <strong>in</strong> den M<strong>in</strong>isterien <strong>und</strong> nachgeordneten Behörden <strong>und</strong> Botschaftsangehörige<br />
sowie deren Familien <strong>und</strong> Mitarbeiter - von denen das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> profitieren<br />
konnte.<br />
Vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> des Hauptstadtbeschlusses des Deutschen B<strong>und</strong>estages vom 20. Juni 1991, mit<br />
dem die Verlagerung des Großteils der Regierungsfunktionen von Bonn nach Berl<strong>in</strong> besiegelt wurde,<br />
- 141 -
Regionalstudie Rhe<strong>in</strong>land<br />
musste auch die Situation des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s neu bewertet werden. Angesichts des drohenden<br />
Verlustes wichtiger Nachfragergruppen - Verwaltungsbeamte <strong>und</strong> Botschaftsangehörige, die mit vielen<br />
Botschaften nach Berl<strong>in</strong> abwandern sollten, - hat die Region bereits frühzeitig mit e<strong>in</strong>er Neuorientierung<br />
des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s begonnen. Im Jahre 1994 hat e<strong>in</strong>e holländische Unternehmensberatung<br />
auf die besondere Bedeutung des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s h<strong>in</strong>gewiesen <strong>und</strong> Empfehlungen für den Ausbau<br />
der Ges<strong>und</strong>heitsregion abgegeben. Weitere Studien - z.B. für die Entwicklung des Kreises Ahrweiler -<br />
schlossen sich an. In den Jahren 1996 <strong>und</strong> 1997 wurde im Auftrag von Hans-Böckler-Stiftung,<br />
MWMTV NRW <strong>und</strong> der ÖTV Bonn vom Institut für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt<strong>und</strong><br />
Regionalentwicklung (InWIS) e<strong>in</strong>e Analyse der Wachstums- <strong>und</strong> Beschäftigungspotenziale im<br />
Bereich der ges<strong>und</strong>heitsbezogenen <strong>und</strong> sozialen Dienste vorgenommen. Als Ergebnis der empirischen<br />
Untersuchung zeichneten sich verschiedene Handlungsfelder ab, <strong>in</strong> denen die Region aufgr<strong>und</strong> der<br />
vorhandenen mediz<strong>in</strong>ischen Kompetenzen Stärken aufzuweisen hat:<br />
• Region Bonn als Zielort für den traditionellen Ges<strong>und</strong>heitstourismus.<br />
• Region Bonn als Anbieter von Dienstleistungen <strong>in</strong> den Bereichen Fitness <strong>und</strong> Wellness.<br />
• Region Bonn als Politikschwerpunkt für „Umwelt <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit“, im Kern mit dem B<strong>und</strong>esges<strong>und</strong>heitsm<strong>in</strong>isterium<br />
<strong>und</strong> den ansässigen Verbänden.<br />
• Region Bonn als Standort für Ges<strong>und</strong>heitskongresse, wozu die Liegenschaften des ehemaligen<br />
B<strong>und</strong>estages genutzt werden könnten.<br />
• Region Bonn als Forschungsschwerpunkt zu Themen wie Telemediz<strong>in</strong>, Geriatrie <strong>und</strong> Gerontologie.<br />
Von entscheidender Bedeutung für den Ausbau des Ges<strong>und</strong>heitsstandortes Bonn ist es, die erkennbaren<br />
Veränderungen der Nachfrage aufzunehmen <strong>und</strong> bei der Gestaltung der sektoralen Entwicklungsstrategie<br />
zu berücksichtigen. Denn „der Patient“ wandelt sich immer mehr zum verantwortungsbewussten<br />
<strong>und</strong> kritischen Konsumenten. Die zentrale Expansionschance für das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> ist<br />
daher dar<strong>in</strong> zu sehen, durch e<strong>in</strong>e Ausdifferenzierung des Angebotsspektrums auf die stattf<strong>in</strong>dende<br />
Ausdifferenzierung der Nachfrage unterschiedlicher Konsumentengruppen zu reagieren. Neben dem<br />
Aufbau von mediz<strong>in</strong>ischen Spezialkompetenzen, z.B. <strong>in</strong> Form von Stroke-Units, der Gerontopsychiatrie<br />
<strong>und</strong> Telemediz<strong>in</strong>, können zusätzliche Leistungen, die auf e<strong>in</strong>e Qualitäts- <strong>und</strong> Komfortsteigerung<br />
des bestehenden Angebotes gerichtet s<strong>in</strong>d, dazu beitragen, Kaufkraftpotenziale e<strong>in</strong>kommensstärkerer<br />
Patienten mit höheren Ansprüchen an den Komfort für die E<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> der Region Bonn zu erschließen.<br />
Um dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch e<strong>in</strong>e abgestimmte Vorgehensweise der E<strong>in</strong>richtungen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s<br />
erforderlich. E<strong>in</strong>e zentrale Koord<strong>in</strong>ationsstelle könnte die Funktion übernehmen, die<br />
verschiedenen E<strong>in</strong>richtungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Interessenlagen zu koord<strong>in</strong>ieren<br />
<strong>und</strong> neue Projekt- bzw. Produktideen, die vielfach nur <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Netzwerk mit mehreren Partnern unterschiedlicher<br />
Kompetenzen realisiert werden können, <strong>in</strong> die Praxis umzusetzen. Der R<strong>und</strong>e Tisch,<br />
der im Rahmen des Modellprojektes „Ortsnahe Koord<strong>in</strong>ierung“ entstanden ist, hat sich bereits mit<br />
solchen Themenstellungen beschäftigt. Aber erst <strong>in</strong> jüngster Zeit haben sich Überlegungen konkretisiert,<br />
e<strong>in</strong>en Koord<strong>in</strong>ator abzustellen, der sich mit Themen r<strong>und</strong> um den Ges<strong>und</strong>heitsstandort Bonn<br />
beschäftigt.<br />
- 142 -
Regionalstudie Rhe<strong>in</strong>land<br />
E<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>sames Vorgehen verschiedener E<strong>in</strong>richtungen konnte zuletzt bei der Präsentation des Ges<strong>und</strong>heitsstandortes<br />
im Ausland erreicht werden. Als e<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>schaftsarbeit von elf allgeme<strong>in</strong>en<br />
Kl<strong>in</strong>iken <strong>und</strong> Krankenhäusern, zwölf Uni-Kl<strong>in</strong>iken, sieben Hotels <strong>und</strong> der Tourismus & Congress<br />
GmbH wurde e<strong>in</strong>e Ges<strong>und</strong>heits-Broschüre <strong>in</strong> arabischer Sprache erstellt, mit der im Rahmen e<strong>in</strong>er<br />
mediz<strong>in</strong>ischen Fachmesse <strong>in</strong> Kairo um ausländische Patienten geworben werden soll. Erst <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
weiteren Schritt wird e<strong>in</strong>e Broschüre <strong>in</strong> deutscher Sprache für <strong>in</strong>ländische Zielgruppen ersche<strong>in</strong>en. Für<br />
ausländische K<strong>und</strong>en ist e<strong>in</strong>e zentrale Anlaufstelle geplant, die e<strong>in</strong>en Komplettservice - von der Vermittlung<br />
der geeigneten Kl<strong>in</strong>ik, e<strong>in</strong>es adäquaten Hotels bis h<strong>in</strong> zur Abrechnung der Kosten – bieten<br />
soll; die F<strong>in</strong>anzierung wird durch die Kl<strong>in</strong>iken <strong>und</strong> Hotels sichergestellt. Übergangsweise übernimmt<br />
die Tourismus & Congress GmbH diese Aufgaben.<br />
Wachstumspotenziale s<strong>in</strong>d für die Vermarktung <strong>in</strong>novativer Produkte auf so genannten Hybrid-<br />
Märkten zu erkennen, die aus der immer enger werdenden Verflechtung von den Bereichen Ges<strong>und</strong>heit,<br />
Freizeit <strong>und</strong> Ernährung entstehen. Die Region Bonn hat gute Chancen, an diesen neuen Komb<strong>in</strong>ationen<br />
von Kultur, Events, Landschaft, Ges<strong>und</strong>heit, Freizeit <strong>und</strong> Fitness teilzuhaben. In der Stadt<br />
Bonn besitzt vor allem der Stadtbezirk Bad Godesberg e<strong>in</strong> positives Image, das auf se<strong>in</strong>e langjährige<br />
Kurort-Tradition zurückgeht. Hier wird geprüft, ob das Angebot durch Wellnesse<strong>in</strong>richtungen ergänzt<br />
werden könnte.<br />
In die gleiche Richtung zielt auch das im letzten Jahr im Kreis Ahrweiler e<strong>in</strong>gerichtete “Dienstleistungszentrum<br />
Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Fitness”, das fünf Jahre aus B<strong>und</strong>esmitteln unterstützt wird. Dieses<br />
Zentrum beherbergt zwei E<strong>in</strong>zelprojekte: Zum e<strong>in</strong>en die geme<strong>in</strong>samen Maßnahmen des kreisweiten<br />
Touristik-Service Ahr, Rhe<strong>in</strong>, Eifel (Tour) <strong>und</strong> des Kur- <strong>und</strong> Verkehrsvere<strong>in</strong>s Bad Neuenahr-<br />
Ahrweiler (KVV), <strong>und</strong> zum anderen das “Studien- <strong>und</strong> Informationszentrum Ges<strong>und</strong>heit, Lebensqualität<br />
<strong>und</strong> We<strong>in</strong>” der Deutschen We<strong>in</strong>akademie. Mit dem Dienstleistungszentrum wird das Ziel verfolgt,<br />
den Kreis Ahrweiler als Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Fitnessregion sowie den Ges<strong>und</strong>heitsstandort Region Bonn<br />
zu e<strong>in</strong>em b<strong>und</strong>esweiten Zentrum für das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> auszubauen. Die neue E<strong>in</strong>richtung soll u.a.<br />
<strong>in</strong>novative Produkte entwickeln <strong>und</strong> Vertriebsnetze aufbauen, regionale Anbieter zertifizieren, e<strong>in</strong><br />
Daten- <strong>und</strong> Informationssystem aufbauen, Konzepte für Ges<strong>und</strong>heitsdienstleister entwickeln <strong>und</strong> Kongresse<br />
<strong>und</strong> Tagungen <strong>in</strong> der Region etablieren. Dabei wirkt sich der Ruf der bereits bekannten Kur-<br />
Städte Bad Neuenahr, Bad Breisig <strong>und</strong> Bad Bodendorf positiv aus.<br />
Chancen <strong>und</strong> Risiken für die Region Bonn<br />
Die Aussichten für das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Region Bonn wie auch anderswo aufgr<strong>und</strong> verschiedener<br />
angebots- <strong>und</strong> nachfrageseitig wirkender Faktoren als positiv zu werten. Entscheidend für<br />
den weiteren Ausbau des Ges<strong>und</strong>heitsstandortes ist allerd<strong>in</strong>gs, bestehende K<strong>und</strong>enbeziehungen zu<br />
festigen <strong>und</strong> neue K<strong>und</strong>engruppen außerhalb der Region zu erschließen. Die Beschäftigungseffekte<br />
s<strong>in</strong>d dabei nur schwer zu beziffern. Angesichts des hohen Versorgungsniveaus dürfte es für die Stadt<br />
Bonn bereits als Erfolg anzusehen se<strong>in</strong>, wenn die bestehenden Arbeitsplätze <strong>in</strong> den Kernbereichen des<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s erhalten werden können. Für den Rhe<strong>in</strong>-Sieg-Kreis <strong>und</strong> den Kreis Ahrweiler fällt<br />
diese E<strong>in</strong>schätzung besser aus. Positive Beschäftigungseffekte werden sich für den Ges<strong>und</strong>heitstourismus<br />
ergeben, falls K<strong>und</strong>engruppen gewonnen werden können, die komb<strong>in</strong>ierte Produkte aus Ge-<br />
- 143 -
Regionalstudie Rhe<strong>in</strong>land<br />
s<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Tourismus - wie z.B. Health- oder Wellness-Urlaube oder mediz<strong>in</strong>ische Kurzchecks für<br />
Manager oder andere <strong>in</strong>teressierte Gruppen - nachfragen.<br />
Das Konzept kann scheitern, falls es nicht gel<strong>in</strong>gen sollte, die Region national wie <strong>in</strong>ternational bekannt<br />
zu machen. In diesem Fall können lukrative <strong>und</strong> zahlungskräftige K<strong>und</strong>engruppen aus dem<br />
Ausland nicht erreicht werden.<br />
Anders als traditionelle Kurstandorte <strong>in</strong> Deutschland wird die Region Bonn – zum<strong>in</strong>dest was die Stadt<br />
Bonn <strong>und</strong> den Rhe<strong>in</strong>-Sieg-Kreis betrifft - auch noch nicht stark genug mit dem Thema „Ges<strong>und</strong>heit“<br />
<strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung gebracht. Akteure aus der Region betrachten daher den sich abzeichnenden (Ges<strong>und</strong>heits-)Wettbewerb<br />
zwischen Bonn <strong>und</strong> Berl<strong>in</strong> sowie die Konkurrenz, die aus anderen Städten heranwächst,<br />
mit gewisser Sorge. Für die Stadt <strong>und</strong> die Region Bonn wird es notwendig se<strong>in</strong>, die Beziehungen<br />
zu den Botschaften - <strong>in</strong> Bonn oder <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> - systematisch weiterzuentwickeln <strong>und</strong> zu nutzen, um<br />
<strong>in</strong> Zukunft verstärkt ausländische Staatsbürger für e<strong>in</strong>en Aufenthalt <strong>in</strong> der Region zu gew<strong>in</strong>nen.<br />
Als problematisch ist e<strong>in</strong>e noch zu ger<strong>in</strong>ge Kooperation zwischen den E<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> der Region<br />
anzusehen, die erforderlich ist, um <strong>in</strong>novative Produkte <strong>und</strong> Dienstleistungen entwickeln <strong>und</strong> umsetzen<br />
zu können. Nachteilig wirkt sich auch das Fehlen e<strong>in</strong>es e<strong>in</strong>heitlichen Konzeptes für den Ausbau<br />
zur Ges<strong>und</strong>heitsregion aus.<br />
Gefahr droht, falls wichtige Bauste<strong>in</strong>e für das Profil der Ges<strong>und</strong>heitsregion aus der Region gelöst werden<br />
sollten. Zwar versichert das B<strong>und</strong>esges<strong>und</strong>heitsm<strong>in</strong>isterium, dass hochrangige Gesprächspartner<br />
bspw. für Verbände weiterh<strong>in</strong> am ersten Dienstsitz <strong>in</strong> Bonn anzutreffen se<strong>in</strong> werden, aber dennoch<br />
erwägen e<strong>in</strong>ige Verbände den Umzug nach Berl<strong>in</strong>, wie zuletzt der AOK-B<strong>und</strong>esverband, der diese<br />
Entscheidung aber zurückgestellt hat.<br />
E<strong>in</strong> Fortzug des Ges<strong>und</strong>heitsm<strong>in</strong>isteriums hätte fatale Folgen für die weitere Entwicklung des Ges<strong>und</strong>heitsstandortes<br />
<strong>und</strong> für die Beschäftigungssituation. Zu den direkten Arbeitsplatzverlusten <strong>in</strong>nerhalb<br />
des M<strong>in</strong>isteriums kämen noch weitere Arbeitsplätze h<strong>in</strong>zu, die <strong>in</strong> den fortziehenden E<strong>in</strong>richtungen<br />
wegfallen könnten. Für den AOK-B<strong>und</strong>esverband war e<strong>in</strong> Verlust von 450 Arbeitsplätzen im Gespräch,<br />
3.000 Arbeitsplätze könnten fortfallen, falls alle umzugswilligen E<strong>in</strong>richtungen ihre Überlegung<br />
<strong>in</strong> die Tat umsetzen würden. H<strong>in</strong>zu kommen die <strong>in</strong>direkten Beschäftigungsverluste dadurch, dass<br />
die Attraktivität des Standortes für die Ansiedlung weiterer E<strong>in</strong>richtungen s<strong>in</strong>kt.<br />
Im letzten Jahr haben die Personal- <strong>und</strong> Betriebsräte des B<strong>und</strong>esges<strong>und</strong>heitsm<strong>in</strong>isteriums, der B<strong>und</strong>esverbände<br />
der Allgeme<strong>in</strong>en Orts-, Innungs- <strong>und</strong> Betriebskrankenkassen, der Kassenärztlichen <strong>und</strong> Kassenzahnärztlichen<br />
B<strong>und</strong>esvere<strong>in</strong>igung <strong>und</strong> weitere Verbände daher e<strong>in</strong>e “Initiative Politikschwerpunkt<br />
Ges<strong>und</strong>heit Rhe<strong>in</strong>-Ruhr (IG RR)” zur Stärkung des Politikschwerpunktes Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> Bonn <strong>und</strong><br />
Umgebung <strong>in</strong>s Leben gerufen. Die Interessenvertreter des Personals wollen <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie die Arbeitsplätze<br />
<strong>und</strong> die Kaufkraft, die von dem Ges<strong>und</strong>heitsm<strong>in</strong>isterium <strong>und</strong> den eng verb<strong>und</strong>enen Organisationen<br />
abhängen, <strong>in</strong> Bonn behalten.<br />
BioRegio Rhe<strong>in</strong>land: Mit Health Care <strong>und</strong> Life Sciences im Aufw<strong>in</strong>d<br />
In Deutschland war für biotechnologische Aktivitäten lange Zeit e<strong>in</strong> eher ungünstiges Umfeld auszumachen.<br />
Die kontroverse Debatte zum Thema Gentechnik der 70er <strong>und</strong> 80er Jahre hatte <strong>in</strong> der Öffent-<br />
- 144 -
Regionalstudie Rhe<strong>in</strong>land<br />
lichkeit <strong>in</strong>sgesamt zu e<strong>in</strong>er negativen E<strong>in</strong>stellung gegenüber der Bio- <strong>und</strong> Gentechnologie geführt.<br />
Zudem waren die rechtlichen Voraussetzungen für gen- <strong>und</strong> biotechnische Forschung <strong>und</strong> Produktion<br />
im Vergleich zu anderen Staaten <strong>und</strong> Regionen <strong>in</strong> Deutschland vielfach ungünstiger, so dass die Bio<strong>und</strong><br />
Gentechnologie erst sehr spät den typischen Entwicklungspfaden anderer Staaten folgen konnte.<br />
Die Biotechnologie weist e<strong>in</strong> breites Spektrum von Anwendungen auf. Im Wesentlichen lässt sie sich<br />
<strong>in</strong> folgende Kernanwendungsbereiche gruppieren: Mediz<strong>in</strong> <strong>und</strong> pharmazeutische Industrie, Landwirtschaft<br />
<strong>und</strong> Ernährungs<strong>in</strong>dustrie, Zellstoff- <strong>und</strong> Papier<strong>in</strong>dustrie <strong>und</strong> die Umweltbiotechnologie. Positive<br />
Erwartungen werden vor allem mit den Gebieten Mediz<strong>in</strong> <strong>und</strong> Landwirtschaft verb<strong>und</strong>en. Betrachtet<br />
man die ökonomischen <strong>und</strong> technologischen Potenziale der Biotechnologie, so s<strong>in</strong>d neben den<br />
Kernunternehmen der Biotechnologie, die z.B. <strong>in</strong> der Forschung <strong>und</strong> Produktion tätig s<strong>in</strong>d, auch Zulieferer<br />
<strong>und</strong> Händler, Abnehmer <strong>und</strong> Dienstleister mit e<strong>in</strong>zubeziehen.<br />
Quantitativ ist die Bio- <strong>und</strong> Gentechnologie nur sehr schwer abzubilden. Das liegt im Wesentlichen<br />
daran, dass weder die biotechnische Industrietätigkeit, noch die biotechnischen Forschungs- <strong>und</strong> Entwicklungsaktivitäten<br />
(F+E) <strong>in</strong> der amtlichen Statistik differenziert erfasst werden. Dadurch, dass sich<br />
zahlreiche Unternehmen aus den Industriegruppen Chemie, Pharma <strong>und</strong> Nahrungsmittelproduktion<br />
u.a. biotechnologischer Methoden <strong>und</strong> Verfahren bedienen, lässt sich der Anteil dieser Aktivitäten<br />
<strong>in</strong>sgesamt nicht näher bestimmen.<br />
BioRegio Rhe<strong>in</strong>land: Gew<strong>in</strong>ner-Region des BioRegio-Wettbewerbs<br />
In der deutschen Forschungspolitik genießt die Biotechnologie schon seit längerem e<strong>in</strong>en hohen Stellenwert.<br />
1990 legte das damalige B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Forschung <strong>und</strong> Technologie (BMFT) e<strong>in</strong><br />
Programm ”Biotechnologie 2000” auf, Ende 1995 wurde mit der Ausschreibung zum BioRegio-<br />
Wettbewerb zudem e<strong>in</strong> neuer Akzent <strong>in</strong> der Förderpolitik gesetzt, da sich die BioRegio-Förderung <strong>in</strong><br />
diesem Wettbewerb nicht auf e<strong>in</strong>zelne Unternehmen oder Technologiefelder, sondern auf die regionalen<br />
Infrastrukturen konzentriert hat. Der Wettbewerb zielte darauf ab, diejenigen Regionen zu fördern,<br />
die bereits gute Voraussetzungen für e<strong>in</strong>e Förderung besitzen <strong>und</strong> deren Entwicklung zu „centers<br />
of excellence“ vorangetrieben werden soll. Für die Teilnahme am Wettbewerb haben sich 17 Regionen<br />
konstituiert, <strong>in</strong> denen das Kooperationsnetzwerk aus universitären <strong>und</strong> außeruniversitären Forschungse<strong>in</strong>richtungen,<br />
Transfer- <strong>und</strong> Existenzförderungse<strong>in</strong>richtungen, Wirtschaftsförderungen, Market<strong>in</strong>gagenturen<br />
<strong>und</strong> bestehenden Unternehmen bereits weit fortgeschritten ist.<br />
Aus dem BioRegio Wettbewerb g<strong>in</strong>g die Region Rhe<strong>in</strong>land - für den Wettbewerb grob umschrieben<br />
mit den Städten Köln, Leverkusen, Düsseldorf, Wuppertal <strong>und</strong> Aachen sowie e<strong>in</strong>igen weiteren kreisangehörigen<br />
Geme<strong>in</strong>den der Landkreise Aachen <strong>und</strong> Düren - neben dem Rhe<strong>in</strong>-Neckar-Dreieck <strong>und</strong><br />
der Region München als Gew<strong>in</strong>ner<strong>in</strong> hervor.<br />
- 145 -
Regionalstudie Rhe<strong>in</strong>land<br />
Abb. 33 Bio- <strong>und</strong> Gentechnologie im Regierungsbezirk Köln<br />
Innerhalb der adm<strong>in</strong>istrativen Grenzen des Regierungsbezirks Köln bef<strong>in</strong>den sich nach dem Bio-Gen-<br />
Tec Atlas <strong>in</strong>sgesamt 43 Unternehmen der Bio- <strong>und</strong> Gentechnologie, rd. e<strong>in</strong> Viertel davon <strong>in</strong> der Stadt<br />
Köln. Diese Unternehmen beschäftigten 7.543 Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen; die Beschäftigtenzahl <strong>in</strong> der Region<br />
dürfte darunter liegen, da zum Teil Tochterunternehmen <strong>und</strong> Niederlassungen an <strong>in</strong>- <strong>und</strong> ausländischen<br />
Standorten <strong>in</strong> diese Zahlen mit e<strong>in</strong>geflossen s<strong>in</strong>d. Die sieben größten Unternehmen mit mehr als<br />
100 Beschäftigten zeigt die folgende Tabelle:<br />
Tab. 53 Große Bio- <strong>und</strong> Gentechnologieunternehmen mit 100 <strong>und</strong> mehr Beschäftigten<br />
Name <strong>und</strong> Sitz<br />
des Unternehmens<br />
Tätigkeitsfelder,<br />
Indikationen<br />
- 146 -<br />
Zahl der Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen<br />
absolut davon F & E<br />
Grünenthal GmbH, Stolberg Schmerz, Infektionen, Hormone, Immunologie, Fibr<strong>in</strong>olytika 3.787 300<br />
GMD – Forschungszentrum U.a. Softwareentwicklung zur Analyse von Genomdaten <strong>und</strong><br />
Informationstechnik GmbH, Genomprodukten<br />
St. August<strong>in</strong><br />
1.150 1.150<br />
Rhône-Poulenc Rorer U.a. Onkologie, Asthma, Allergie, Gentechnologie 1.080 k.A.<br />
Deutschland GmbH, Köln<br />
MACHEREY-NAGEL<br />
GmbH & Co. KG, Düren<br />
Entwicklung, Herstellung <strong>und</strong> Vertrieb von Produkten für die<br />
Analytik, Filtartion <strong>und</strong> Nuke<strong>in</strong>säureaufre<strong>in</strong>igung<br />
360 8<br />
INBIFO, Köln Sicherheitstoxikologie, Inhalationstoxikologie 150 150<br />
Biohit Deutschland GmbH,<br />
Köln<br />
Amsco F<strong>in</strong>n-Aqua GmbH,<br />
Hürth<br />
Insgesamt<br />
Entwicklung <strong>und</strong> Produktion manueller <strong>und</strong> elektronischer<br />
Pipetten, Dispenser<br />
Produktion <strong>und</strong> Entwicklung von Gefriertrocknungsanlagen<br />
für die Biotech- <strong>und</strong> Pharma<strong>in</strong>dustrie<br />
140 27<br />
100 5<br />
6.767 1.640
Regionalstudie Rhe<strong>in</strong>land<br />
An den Unternehmens- <strong>und</strong> Beschäftigtenzahlen kann man ablesen, dass die Bio- <strong>und</strong> Gentechnologiebranche<br />
eher kle<strong>in</strong>betrieblich bzw. mittelständisch strukturiert ist, denn die hier nicht gesondert<br />
aufgeführten weiteren 36 Unternehmen beschäftigen im Durchschnitt rd. 20 Mitarbeiter.<br />
Das Gesamtkonzept für die BioRegio Rhe<strong>in</strong>land, das für den BioRegio-Wettbewerb von der Kienbaum-Unternehmensberatung<br />
entwickelt wurde, basiert auf e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>tegrativen Ansatz e<strong>in</strong>er Vielzahl<br />
von E<strong>in</strong>zelkonzepten. Mit dem Gesamtkonzept soll die Entwicklung von bio- <strong>und</strong> gentechnologischen<br />
Unternehmen <strong>in</strong> der Region gefördert <strong>und</strong> Defizite <strong>in</strong>sbesondere im Technologietransfer beseitigt<br />
werden.<br />
Das folgende Schaubild zeigt die zentralen Bauste<strong>in</strong>e des Gesamtkonzeptes. Im Vordergr<strong>und</strong> stehen<br />
die verschiedenen Netzwerke, die die Basis zur Förderung von Existenzgründern <strong>und</strong> Unternehmenserweiterungen<br />
bilden. Sie werden als Instrumente für e<strong>in</strong>en effizienten Technologietransfer <strong>und</strong> auch<br />
für die landesweite Förderung der Bio- <strong>und</strong> Gentechnologie e<strong>in</strong>gesetzt: das Biotech-Kompetenz-<br />
Netzwerk, das Biotech-Beratungs- <strong>und</strong> Coach<strong>in</strong>g-Netzwerk Rhe<strong>in</strong>land, das Biotech-Kapital-Netzwerk<br />
sowie das Patentberatungsnetzwerk mit 17 Patentanwälten.<br />
Abb. 34 Das Bio-Gen-Tec-Netzwerk<br />
© InW IS 1999<br />
BioTech<br />
Beratungs <strong>und</strong><br />
C oach<strong>in</strong>g-<br />
Netzw erk<br />
BioTech<br />
Kom petenz-<br />
Netzw erk<br />
BioG enTec<br />
NRW<br />
BioTech-<br />
Kapital-<br />
Netzw erk<br />
- 147 -<br />
Patent<br />
beratungs<br />
Netzw erk<br />
Die Netzwerke werden zum Teil von der im Jahre 1994 gegründeten Landes<strong>in</strong>itiative Bio-Gen-Tec<br />
NRW e.V. aufgebaut <strong>und</strong> koord<strong>in</strong>iert. Die Netzwerke stehen somit nicht nur der BioRegio Rhe<strong>in</strong>land,<br />
sondern auch anderen Standorten für Biotechnologie <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen – z.B. dem Münsterland<br />
– zur Verfügung. Die Initiative ist e<strong>in</strong>e zentrale Informations- <strong>und</strong> Koord<strong>in</strong>ierungsplattform für alle<br />
Akteure <strong>in</strong> der Region <strong>und</strong> im ganzen Land NRW. Ihre Aufgaben reichen vom Ideentransfer, der Verbesserung<br />
des Management-Know-hows <strong>und</strong> der F<strong>in</strong>anzierungsmöglichkeiten für Unternehmen bis<br />
h<strong>in</strong> zur Interessenvertretung der Unternehmen. Für die BioRegio Rhe<strong>in</strong>land stellt die Landes<strong>in</strong>itiative<br />
e<strong>in</strong>e zentrale Schnittstelle zwischen den e<strong>in</strong>zelnen Netzwerken der BioRegio dar. Die e<strong>in</strong>zelnen Netzwerke<br />
bzw. E<strong>in</strong>zelkonzepte haben folgende Funktionen:
Regionalstudie Rhe<strong>in</strong>land<br />
• Das Kompetenznetzwerk besetzt die Schnittstelle zwischen Forschung <strong>und</strong> Wirtschaft. Koord<strong>in</strong>atoren<br />
fragen die wissenschaftlichen Aktivitäten der Universitäten <strong>und</strong> Forschungszentren sowie die<br />
Interessen der Wirtschaft ab <strong>und</strong> werten sie aus. Anhand dieser Informationen können gezielt<br />
Kontakte für Projekte vermittelt <strong>und</strong> sowohl nationale wie auch <strong>in</strong>ternationale Partner für Kooperationen<br />
benannt werden.<br />
• Mit dem Beratungs- <strong>und</strong> Coach<strong>in</strong>g-Netzwerk werden die bereits <strong>in</strong> der Region vorhandenen Beratungsleistungen<br />
durch Bio-Gen-Tec als zentrale Anlaufstelle gebündelt. Experten verschiedener<br />
Fachdiszipl<strong>in</strong>en stehen <strong>in</strong> dem koord<strong>in</strong>ierten Beraterpool zur Verfügung. Ziel ist es, Existenzgründer<br />
<strong>und</strong> Jung-Unternehmer bei Managementaufgaben zu unterstützen.<br />
• Der Berater-Pool führt beratende Institutionen aus verschiedenen Fachbereichen - wie z.B. Unternehmensberatungen,<br />
Förderprogrammberater, Patentanwälte, Steuerberater <strong>und</strong> Wirtschaftsprüfer<br />
sowie Market<strong>in</strong>g- <strong>und</strong> F<strong>in</strong>anzierungsexperten - zusammen. Über den Coach<strong>in</strong>g-Pool werden erfahrene<br />
Coaches mit langjähriger Berufserfahrung <strong>in</strong> der Pharma- <strong>und</strong>/oder High-Tech-Branche<br />
vermittelt, die junge Unternehmen <strong>in</strong> der Start-up-Phase beraten <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Unternehmensbeteiligung<br />
anstreben.<br />
• Unter der Koord<strong>in</strong>ation der Bio-Gen-Tec haben sich mehrere Beteiligungs- <strong>und</strong> Venture Capital-<br />
Gesellschaften zum Biotech-Kapital-Netzwerk (BTK) zusammengeschlossen, das jungen Unternehmen<br />
der Bio- <strong>und</strong> Gentechnologie den Zugang zum erforderlichen Eigen- bzw. Risikokapital<br />
erleichtern soll. Zwischen den Kapitalgebern des BTK f<strong>in</strong>det e<strong>in</strong> regelmäßiger Austausch über<br />
e<strong>in</strong>gereichte <strong>und</strong> geförderte Projekte statt.<br />
Zusätzlich zu diesen eher zentral wirkenden Netzwerken wurden weitere Konzepte entwickelt, die zu<br />
e<strong>in</strong>er Verbesserung des Technologietransfers beitragen sollen: Bspw. wurde e<strong>in</strong> Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit<br />
erarbeitet, um dem <strong>in</strong>teressierten Publikum die Facetten der Bio- <strong>und</strong> Gentechnologie<br />
transparent zu machen. Mit Mitteln des B<strong>und</strong>esforschungsm<strong>in</strong>isteriums bef<strong>in</strong>det sich das Deutsche<br />
Referenzzentrum für Ethik <strong>in</strong> den Biowissenschaften (DRZE) <strong>in</strong> Aufbau, um den Informationstransfer<br />
zwischen Wissenschaft, Wirtschaft <strong>und</strong> Öffentlichkeit auch aus ethischer Sicht zu beleuchten. Im universitären<br />
Bereich ist e<strong>in</strong> Studiengang Gentechnologie geplant, <strong>und</strong> die „Biotechnologische Studenten<strong>in</strong>itiative“,<br />
der Studenten der Hochschulen Köln, Düsseldorf <strong>und</strong> Aachen angehören, soll dazu beitragen,<br />
den Studenten frühzeitig im Studium praxisbezogene Kenntnisse zu vermitteln. Die IHK-Köln<br />
bietet für Techniker <strong>und</strong> Naturwissenschaftler/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong>sbesondere aus den Bereichen Biologie <strong>und</strong><br />
Chemie e<strong>in</strong>en Zertifikationslehrgang an, der <strong>in</strong> mehreren Unterrichtse<strong>in</strong>heiten vor allem betriebswirtschaftliche<br />
Qualifikationen vermittelt.<br />
Das Modell des Ressourcen-Shar<strong>in</strong>g stellt e<strong>in</strong> weiteres Anreizsystem für Existenzgründer dar. Freie<br />
Kapazitäten der <strong>in</strong>vestitionsaufwendigen Großgeräte von Forschungse<strong>in</strong>richtungen können - vor allem<br />
Nachts oder an Wochenenden - von Unternehmensgründern genutzt werden, sofern der Forschungsbetrieb<br />
dadurch nicht gestört wird. Die Bio-Gen-Tec hat hierzu Rahmenverträge mit Universitäten <strong>und</strong><br />
Unternehmen entwickelt.<br />
Perspektiven für die Bio- <strong>und</strong> Gentechnologie im Rhe<strong>in</strong>land<br />
Angesichts der statistischen Abgrenzungsprobleme <strong>und</strong> der Risiken des Geschäftes mit der Bio- <strong>und</strong><br />
Gentechnologie ist es schwierig, e<strong>in</strong>e Beschäftigungsprognose für die BioRegio Rhe<strong>in</strong>land aufzustel-<br />
- 148 -
Regionalstudie Rhe<strong>in</strong>land<br />
len. Allgeme<strong>in</strong>e Trends werden sich aber auch für die BioRegio positiv auswirken. So ist die OECD<br />
zu der E<strong>in</strong>schätzung gekommen, dass sich die Biotechnologie zu dem Wissenschaftszweig mit dem<br />
größten ökonomischen Potenzial entwickeln wird. Derzeit s<strong>in</strong>d die USA bei der kommerziellen Verwertung<br />
von Erkenntnissen der Biotechnologie führend, während Europa <strong>und</strong> auch Deutschland lange<br />
Zeit h<strong>in</strong>ter den Erwartungen zurückgeblieben s<strong>in</strong>d. Hier deutet sich e<strong>in</strong> Aufholprozess an.<br />
Die Wachstumsraten des Umsatzes s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Biotechnologie nach wie vor sehr hoch. Der Weltumsatz<br />
betrug 1991 rd. sechs Milliarden Dollar, 1997 waren es bereit 50 Mrd. Dollar <strong>und</strong> für das Jahr<br />
2000 werden 100 bis sogar 150 Milliarden Dollar erwartet. Der Pharmabereich soll daran e<strong>in</strong>en Umsatzanteil<br />
von ca. 70 Prozent erreichen. Das britische Marktforschungs<strong>in</strong>stitut Frost & Sullivan geht <strong>in</strong><br />
den nächsten Jahren weiterh<strong>in</strong> von e<strong>in</strong>er weltweiten Umsatzsteigerung für die Bio- <strong>und</strong> Gentechnologie<br />
von 20 Prozent aus.<br />
In e<strong>in</strong>em der bedeutendsten Anwendungsgebiete der Biotechnologie, der pharmazeutischen Industrie<br />
<strong>und</strong> damit im weitesten S<strong>in</strong>ne der Mediz<strong>in</strong>, steht die Nutzung der vorhandenen Potenziale erst am<br />
Anfang. Dies hat im Wesentlichen drei Gründe: Viele herkömmliche Medikamente können <strong>in</strong> Zukunft<br />
gentechnisch hergestellt werden, für viele Krankheiten s<strong>in</strong>d noch ke<strong>in</strong>e Arzneimittel verfügbar <strong>und</strong> es<br />
besteht e<strong>in</strong> großer Bedarf an Diagnostika, um Krankheiten bereits <strong>in</strong> ihrem Frühstadium erkennen <strong>und</strong><br />
behandeln zu können.<br />
Die Entwicklung neuer Arzneimittel wird sich durch den E<strong>in</strong>satz gentechnischer Verfahren schneller<br />
<strong>und</strong> kostengünstiger gestalten. Waren schon 1996 etwa 30 Prozent der neu auf den Markt kommenden<br />
Arzneien gentechnischen Ursprungs, so wird erwartet, dass ab dem Jahr 2000 jedes neue Medikament<br />
im Laufe des Entwicklungs- <strong>und</strong> Herstellungsprozesses mit Gentechnik <strong>in</strong> Berührung gekommen se<strong>in</strong><br />
wird. Während das Wachstum für herkömmliche Generika <strong>und</strong> Pharmazeutika momentan auf etwa 4<br />
bis 7 Prozent geschätzt wird, wird für den Absatz von Biopharmazeutika für die nächsten Jahre e<strong>in</strong><br />
starkes Wachstum e<strong>in</strong>zelner Teilmärkte von bis zu 25 Prozent pro Jahr erwartet.<br />
Die Umsatzerwartungen können mit entsprechenden Beschäftigungseffekten e<strong>in</strong>hergehen. Nach<br />
Schätzung der Prognos AG können alle<strong>in</strong> <strong>in</strong> der kommerziellen Biotechnologie <strong>in</strong> Deutschland zwischen<br />
23.000 <strong>und</strong> 40.000 Menschen beschäftigt werden. Dies entspricht e<strong>in</strong>er Verdoppelung gegenüber<br />
1992. Weitere 20.000 Arbeitsplätze werden bei Forschungse<strong>in</strong>richtungen, <strong>in</strong> Hochschulen <strong>und</strong><br />
Verwaltungen im öffentlichen Bereich erwartet. Schließlich gehen die Schätzungen der Prognos AG<br />
dah<strong>in</strong>, dass weitere 40.000 bis 50.000 Personen <strong>in</strong> solchen Feldern Arbeit f<strong>in</strong>den, die durch die Biotechnologie<br />
<strong>in</strong>direkt - durch Zuliefererfunktion <strong>und</strong> Dienstleistungen - profitieren.<br />
In e<strong>in</strong>er Untersuchung im Auftrage der hessischen Landesregierung aus dem Jahre 1998 wurde jedoch<br />
deutlich, dass die Arbeitsplatzeffekte <strong>in</strong> der Bio- <strong>und</strong> Gentechnologie im Vergleich zu den traditionellen<br />
Branchen des produzierenden Gewerbes wie z.B. der Automobil<strong>in</strong>dustrie <strong>und</strong> dem Masch<strong>in</strong>enbau<br />
sehr viel ger<strong>in</strong>ger ausfallen werden. Die Bio- <strong>und</strong> Gentechnologie wird sich nicht zu e<strong>in</strong>er „Job-<br />
Masch<strong>in</strong>e“ entwickeln. Dies zeigt sich auch an den Beschäftigungseffekten der Unternehmensgründungen<br />
<strong>in</strong> den letzten Jahren. Nach Angaben der Bio-Gen-Tec NRW s<strong>in</strong>d im Jahre 1997 <strong>in</strong> der Bio-<br />
Regio Rhe<strong>in</strong>land 15 Unternehmen mit 166 Arbeitsplätzen entstanden, im Jahre 1998 gab es 103 Arbeitsplätze<br />
<strong>in</strong> 2 Gründungen <strong>und</strong> im Jahre 1999 234 Arbeitsplätze bei 15 Gründungen. Zwar wird man<br />
- 149 -
Regionalstudie Rhe<strong>in</strong>land<br />
auch <strong>in</strong> den nächsten Jahren mit weiteren Unternehmensgründungen rechnen können, die Arbeitsplatzeffekte<br />
werden sich jedoch weiterh<strong>in</strong> auf e<strong>in</strong>em niedrigen Niveau bewegen.<br />
Nach e<strong>in</strong>er empirischen Untersuchung des InWIS wurde die BioRegio Rhe<strong>in</strong>land von Experten<br />
durchweg als gut angesehen. Dies bezieht sich <strong>in</strong>sbesondere auf die Qualität der e<strong>in</strong>gesetzten Instrumente<br />
zum Ausbau der Region. Der Erfolg der Region wird auch durch das Gründungsgeschehen <strong>in</strong><br />
der Region belegt: 50 Prozent der landesweiten Neugründungen im Bereich Bio- <strong>und</strong> Gentechnologie<br />
fanden im Raum Köln statt. Als Erfolgsfaktoren werden auch das nachhaltige Interesse von gründungswilligen<br />
Personen <strong>und</strong> die gute Arbeit der Medien benannt, die über Chancen <strong>und</strong> Risiken der<br />
neuen Technologien <strong>in</strong>formieren <strong>und</strong> für e<strong>in</strong>e größere Akzeptanz der Bio- <strong>und</strong> Gentechnologie sorgen.<br />
Für die erfolgreiche Entwicklung der BioRegio <strong>in</strong> der Zukunft s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>ige wichtige Gr<strong>und</strong>voraussetzungen<br />
entscheidend: e<strong>in</strong> ausreichendes wissenschaftliches Potenzial, e<strong>in</strong>e ausreichende Venture Capital-Kultur,<br />
e<strong>in</strong> ausreichendes <strong>und</strong> attraktives Flächenangebot sowie e<strong>in</strong>e ausgeprägte Gründerkultur.<br />
Die Entwicklung der Region kann noch verbessert werden, wenn Reformen <strong>in</strong> folgenden Bereichen<br />
durchgesetzt werden können:<br />
• Förderung der Neugründungen von Unternehmen aus dem Hochschulbereich;<br />
• Verbesserung des Zugangs zur Unternehmens- <strong>und</strong> Gründungsf<strong>in</strong>anzierung;<br />
• Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit durch die politischen Entscheidungsträger, um e<strong>in</strong>e Akzeptanzsteigerung<br />
der Bio- <strong>und</strong> Gentechnologie zu erreichen;<br />
• Verstärkung der Patentbeobachtung seitens der wissenschaftlichen Institute;<br />
• Ausbau der Infrastruktur z.B. durch die zusätzliche Verfügbarkeit von Laborflächen.<br />
Des Weiteren wurden, wie auch schon <strong>in</strong> anderen Regionen, e<strong>in</strong>e Bündelung der Angebotsvielfalt für<br />
Existenzgründer wie auch die Vere<strong>in</strong>fachung der Entscheidungs- <strong>und</strong> Bewilligungsprozesse <strong>und</strong> die<br />
Erhöhung der Transparenz gefordert.<br />
5.1.2. Profil <strong>und</strong> Perspektiven für Ostwestfalen-Lippe: Brückenschläge auf dem Weg zur<br />
vernetzten Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft<br />
Uwe Borchers <strong>und</strong> Brigitte Meier (Zentrum für Innovation <strong>in</strong> der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft Ostwestfalen-Lippe)<br />
Die Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft <strong>in</strong> Ostwestfalen-Lippe steht mit ihren Schwerpunkten der Rehabilitation,<br />
der <strong>in</strong>novativen personenbezogenen Dienstleistungen, der Qualifizierung <strong>und</strong> des Wissenstransfers,<br />
der Angebote <strong>in</strong> Wellness, Freizeit <strong>und</strong> Tourismus sowie der Mediz<strong>in</strong>technik <strong>und</strong> der telematischen<br />
Angebote im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> für e<strong>in</strong>e Region mit beträchtlichem Wirtschafts- <strong>und</strong> Beschäftigungspotenzial.<br />
E<strong>in</strong>e Reihe <strong>in</strong>novativer E<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong> Unternehmen aus dem <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> sowie<br />
aus der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft im weiteren S<strong>in</strong>ne haben damit begonnen, ihre Aktivitäten <strong>und</strong> Projekte<br />
mite<strong>in</strong>ander zu vernetzen. Die Entwicklungsperspektive <strong>und</strong> die zukünftigen Herausforderungen lie-<br />
- 150 -
Regionalstudie Ostwestfalen-Lippe<br />
gen im erfolgreichen Ausbau dieser Brückenschläge h<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>er strategischen Vernetzung der regionalen<br />
Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft.<br />
Das Profil der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft <strong>in</strong> Ostwestfalen-Lippe wird im ersten Abschnitt mit den genannten<br />
Schwerpunkten vorgestellt. Dieses Profil ist der Ausgangspunkt für die zukünftige Entwicklung.<br />
Im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es Entwicklungsszenarios folgt auf der Basis des Profils im zweiten Abschnitt die<br />
Darstellung zukünftiger Optionen <strong>und</strong> Entwicklungspfade <strong>in</strong> sechs Handlungsfeldern. Im anschließenden<br />
Fazit werden potenzielle Entwicklungsrisiken benannt sowie die Herausforderungen zur Realisierung<br />
der Entwicklungschancen für die Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft <strong>in</strong> Ostwestfalen-Lippe gebündelt.<br />
5.1.2.1. Das Profil der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft <strong>in</strong> Ostwestfalen-Lippe<br />
In Ostwestfalen-Lippe ist der Ges<strong>und</strong>heitssektor mit se<strong>in</strong>en Nachbarbranchen e<strong>in</strong>e der zentralen Säulen<br />
der Wirtschaft. Produktion <strong>und</strong> Dienstleistung r<strong>und</strong> um die Ges<strong>und</strong>heit prägen den Standort <strong>in</strong><br />
besonderer Weise. Hier konzentrieren sich therapeutische, rehabilitative, pflegerische <strong>und</strong> präventive<br />
Angebote, die ergänzt werden durch angelagerte Dienstleistungs- <strong>und</strong> Wirtschaftsbranchen wie Gastronomie,<br />
Hotellerie, Sport <strong>und</strong> Wellness sowie mediz<strong>in</strong>technische, pharmazeutische <strong>und</strong> kosmetische<br />
Unternehmen. Entstanden ist e<strong>in</strong> Leistungsprofil, das sich auf die Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Lebensqualität<br />
der K<strong>und</strong>en ausrichtet <strong>und</strong> dabei Ges<strong>und</strong>heitsförderung <strong>und</strong> Rehabilitation betont.<br />
Die Region Ostwestfalen-Lippe verfügt über 45 allgeme<strong>in</strong>e Krankenhäuser, 57 Vorsorge- oder Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
<strong>und</strong> 7 sonstige Krankenhäuser (LDS, Stand 31.12.1998). Mit <strong>in</strong>sgesamt 109<br />
E<strong>in</strong>richtungen der stationären Versorgung stellt die Region damit knapp e<strong>in</strong> Fünftel der 601 E<strong>in</strong>richtungen<br />
<strong>in</strong> NRW. Innerhalb der Region konzentrieren sich die meisten der allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäuser<br />
im Kreis M<strong>in</strong>den (10), <strong>in</strong> der Stadt Bielefeld (8) sowie im Kreis Gütersloh (7).<br />
Betrachtet man die Zahl der vorgehaltenen Betten <strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäusern ergibt sich für die<br />
Region bezogen auf die Wohnbevölkerung e<strong>in</strong> Versorgungsgrad von 6,8 Betten je 1.000 E<strong>in</strong>wohner<br />
gegenüber 7,0 Betten je 1.000 E<strong>in</strong>wohner im Landesdurchschnitt (LDS, Stand 31.12.1998). Die Region<br />
liegt <strong>in</strong>sgesamt etwa im Mittel des landesweiten Versorgungsgrades. Allerd<strong>in</strong>gs streuen die Werte<br />
<strong>in</strong>nerhalb der Region beträchtlich. Deutlich über dem landesdurchschnittlichen Versorgungsgrad liegt<br />
der bevölkerungsschwache Kreis Höxter (10,5 Betten je 1.000 E<strong>in</strong>wohner), die Stadt Bielefeld als<br />
regionales Oberzentrum (9,5 Betten je 1.000 E<strong>in</strong>wohner) sowie der Kreis M<strong>in</strong>den (8,7 Betten je 1.000<br />
E<strong>in</strong>wohner), der auch die meisten Versorgungse<strong>in</strong>richtungen aufweist. Während der Kreis Paderborn<br />
mit 6,7 Betten je 1.000 E<strong>in</strong>wohner etwas unter dem Landesdurchschnitt liegt, ist der Versorgungsgrad<br />
<strong>in</strong> den Kreisen Herford (5,4 Betten je 1.000 E<strong>in</strong>wohner), Gütersloh (4,4 Betten je 1.000 E<strong>in</strong>wohner)<br />
<strong>und</strong> Lippe (4,2 Betten je 1.000 E<strong>in</strong>wohner) deutlich niedriger.<br />
Das besonders ausgeprägte Profil der Region als Standort für Rehabilitationsangebote wird an der<br />
Zahl von 9.674 Betten <strong>in</strong> Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen deutlich. Damit stehen 46,8<br />
Prozent der landesweiten Betten <strong>in</strong> Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong> Ostwestfalen-Lippe<br />
(LDS, Stand 31.12.1998). In der Region konzentrieren sich die Rehabilitationsstandorte <strong>in</strong> den Kreisen<br />
Lippe, M<strong>in</strong>den, Höxter <strong>und</strong> Paderborn mit jeweils 10 <strong>und</strong> mehr Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen.<br />
- 151 -
Regionalstudie Ostwestfalen-Lippe<br />
Der Blick auf die Beschäftigungsquote zeigt für den Kernbereich des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s (ohne Handel,<br />
Handwerk, Freiberufler <strong>und</strong> Selbständige) im Zeitraum von 1980 bis 1995 e<strong>in</strong>e deutliche Zuwachsrate<br />
bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 63 Prozent (vgl. von Bandemer u.a.<br />
1997). Im Landesdurchschnitt NRW betrug die Quote nur 56 Prozent. Waren 1980 5,9 Prozent der<br />
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> tätig, stieg ihr Anteil bis 1996 auf<br />
8,3 Prozent, im Oberzentrum Bielefeld sogar auf 11 Prozent. Der Beschäftigtenanteil liegt damit deutlich<br />
höher als der im NRW-Landes- <strong>und</strong> B<strong>und</strong>esdurchschnitt (alte B<strong>und</strong>esländer) mit je 7,4 bzw.<br />
7,2 Prozent.<br />
Diese Trends haben zur Folge, dass der Dienstleistungssektor der Region <strong>in</strong>sgesamt stark durch die<br />
Beschäftigten im Kernges<strong>und</strong>heitsbereich geprägt ist. Während der Anteil der Beschäftigten im Ges<strong>und</strong>heitssektor<br />
auf Landesebene 12,8 Prozent ausmacht, liegt er <strong>in</strong> OWL bei 16,4 Prozent (ebd.).<br />
Standort für <strong>in</strong>novative Dienstleistungen am Menschen<br />
Die Region ist Standort für Europas größte <strong>und</strong> modernste Diakoniee<strong>in</strong>richtungen: die von Bodelschw<strong>in</strong>ghschen<br />
Anstalten Bethel <strong>und</strong> das Evangelische Johanneswerk mit <strong>in</strong>sgesamt 11.000 Beschäftigten<br />
alle<strong>in</strong> <strong>in</strong> Bielefeld <strong>und</strong> b<strong>und</strong>esweit 17.000 Beschäftigten. In dem weit bekannten multikomplexen<br />
Dienstleistungsunternehmen Bethel werden <strong>in</strong> Kl<strong>in</strong>iken, Werkstätten für Beh<strong>in</strong>derte, Heimen,<br />
Wohngruppen, Beh<strong>in</strong>dertenschulen <strong>und</strong> K<strong>in</strong>dergärten regelmäßig r<strong>und</strong> 10.000 Menschen betreut, die<br />
unter Epilepsieerkrankungen, geistigen Beh<strong>in</strong>derungen, psychischen Erkrankungen sowie sozialen<br />
Problemen leiden. Neben vielen weiteren E<strong>in</strong>richtungen gehören zu den von Bodelschw<strong>in</strong>ghschen<br />
Anstalten Akutkrankenhäuser sowie das <strong>in</strong>ternational renommierte Epilepsie-Zentrum Bethel. In Kooperation<br />
mit der Cleveland Cl<strong>in</strong>ic Fo<strong>und</strong>ation <strong>in</strong> Ohio/USA wurde e<strong>in</strong>e hochspezialisierte Epilepsiechirurgie<br />
aufgebaut. Für die Nachsorge epilepsiekranker Menschen wird b<strong>und</strong>esweit die erste Rehabilitationskl<strong>in</strong>ik<br />
vorgehalten.<br />
Auch das Evangelische Johanneswerk ist e<strong>in</strong> bedeutender Träger moderner sozialer Dienstleistungen.<br />
Es unterhält e<strong>in</strong>e Vielzahl von Kl<strong>in</strong>iken, Alten- <strong>und</strong> Beh<strong>in</strong>dertene<strong>in</strong>richtungen, Diakoniestationen <strong>und</strong><br />
e<strong>in</strong> breites Spektrum sozialer Dienstleistungen für K<strong>in</strong>der, Jugendliche, Ausländer, Suchtkranke oder<br />
verschuldete Familien. Bekannt ist das Johanneswerk für <strong>in</strong>novative Konzepte <strong>in</strong> der Betreuung älterer<br />
Menschen sowie für se<strong>in</strong>e strikt dezentrale <strong>und</strong> ortsnahe Versorgung geistig beh<strong>in</strong>derter Menschen.<br />
Das Herz- <strong>und</strong> Diabeteszentrum NRW ist e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>ternational führende E<strong>in</strong>richtung: Im Zentrum vere<strong>in</strong>en<br />
sich die Merkmale e<strong>in</strong>er großen Arbeitskl<strong>in</strong>ik mit der wissenschaftlichen Kompetenz e<strong>in</strong>er Universitätskl<strong>in</strong>ik.<br />
Vier Kl<strong>in</strong>iken mit modernster Ausstattung <strong>und</strong> kl<strong>in</strong>ischen Methoden nach dem neuesten<br />
Stand s<strong>in</strong>d spezialisiert auf Herz- <strong>und</strong> Kreislauf- sowie Stoffwechselerkrankungen. Vor kurzem<br />
wurde weltweit das erste Kunstherz verpflanzt.<br />
Ostwestfalen-Lippe verfügt über fünf große Heilbäder (darunter drei Staatsbäder), vier Kneipp-<br />
Kurorte <strong>und</strong> zwölf Luftkurorte. So bef<strong>in</strong>den sich im „Heilgarten Ostwestfalen-Lippe“ 21 der landesweit<br />
43 Heilbäder <strong>und</strong> Kurorte. Entsprechend der hohen Konzentration von Kur- <strong>und</strong> Rehabilitations-<br />
- 152 -
Regionalstudie Ostwestfalen-Lippe<br />
e<strong>in</strong>richtungen traf die Mitte der neunziger Jahre wirksam werdende B<strong>und</strong>esgesetzgebung für Kur- <strong>und</strong><br />
Rehabilitationsmaßnahmen die Region <strong>in</strong> besonderem Maße. Die sogenannte „Kurkrise“ führte <strong>in</strong> den<br />
ostwestfälischen, teilweise sehr monostrukturierten Kurorten zu reduzierten Auslastungs- <strong>und</strong> Belegungsquoten.<br />
Folge war u.a. der Abbau von Arbeitsplätzen. Inzwischen ist der Abwärtstrend gestoppt<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Stabilisierung mit deutlichem Aufwärtstrend zu verzeichnen. Der Handlungsdruck hat e<strong>in</strong>e<br />
Vielzahl von Aktivitäten, Projektentwicklungen <strong>und</strong> Innovationen erzeugt. Die Heilbäder setzen dabei<br />
e<strong>in</strong>deutig auf Spezialisierung bei der Behandlung spezifischer Erkrankungen (z.B. <strong>in</strong> den Bereichen<br />
Herz <strong>und</strong> Diabetes, Allergologie, Orthopädie <strong>und</strong> Neurologie) bzw. spezifischer Personengruppen<br />
(z.B. K<strong>in</strong>der <strong>und</strong> Jugendliche, Frauen, Migranten). Dieses gilt sowohl für die Rehabilitation <strong>und</strong> Anschlussheilbehandlung<br />
als auch für präventive, ges<strong>und</strong>heitsfördernde sowie ges<strong>und</strong>heitsbezogene Tourismus-<br />
<strong>und</strong> Wellness-Angebote, die überregional <strong>und</strong> <strong>in</strong>ternational nachgefragt werden.<br />
Standort für Wellness, Freizeit <strong>und</strong> Tourismus<br />
Als „Heilgarten Deutschlands“ bietet sich die Region Ostwestfalen-Lippe als bevorzugtes Reisegebiet<br />
für Erholungs- <strong>und</strong> Kurzurlaube sowie Freizeit- <strong>und</strong> Wellnessaktivitäten an. Ob Radwandern, Golfen,<br />
Beauty-, Wellness- <strong>und</strong> Sportangebote - die Akteure der Freizeit-, Tourismus- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsbranche<br />
haben Initiativen e<strong>in</strong>geleitet, um diese Kernkompetenzen zu verstärken <strong>und</strong> zu modernisieren.<br />
Nach s<strong>in</strong>kenden Übernachtungszahlen <strong>in</strong>folge der Bäderkrise ist der Aufwärtstrend deutlich erkennbar.<br />
Der Fremdenverkehrsstatistik aus dem Jahre 1999 folgend, liegt die Ferienregion Ostwestfalen-<br />
Lippe auf Platz zwei im Land NRW <strong>und</strong> erreicht damit ihre Spitzenzahlen von 1991/92.<br />
Im Wettbewerb um Kurgäste, Ges<strong>und</strong>heitsurlauber <strong>und</strong> Touristen präsentiert sich die Region während<br />
der EXPO 2000 mit dem Landschafts-, Kultur- <strong>und</strong> Erlebnisprojekt Heilgarten 2000, um die Erneuerungsmöglichkeiten<br />
traditioneller Badelandschaften zu dokumentieren. Die herausragende Attraktion<br />
ist die Entstehung e<strong>in</strong>es magischen Wasserlandes - die Aqua Magica - <strong>in</strong> Bad Oeynhausen <strong>und</strong> Löhne.<br />
Standort für Ges<strong>und</strong>heits<strong>in</strong>dustrie<br />
Neben der Ges<strong>und</strong>heits<strong>in</strong>frastruktur s<strong>in</strong>d vor allem mittelständische Unternehmen der Ges<strong>und</strong>heits<strong>in</strong>dustrie<br />
Garanten für die leistungsstarke Wirtschaftsregion. In Ostwestfalen-Lippe f<strong>in</strong>den sich viele<br />
Unternehmen, die mit ihren Produkten <strong>und</strong> Dienstleistungen auf den Ges<strong>und</strong>heitssektor spezialisiert<br />
s<strong>in</strong>d. Das Spektrum reicht von der Herstellung von Krankenhausbetten <strong>und</strong> Rollstühlen über Hörgeräte<br />
<strong>und</strong> Ampullen für den mediz<strong>in</strong>ischen Bedarf bis h<strong>in</strong> zu hochspezialisierten Mediz<strong>in</strong>geräten. Namhafte<br />
Firmen wie Meyra (Rehabilitationstechnik), Stiegelmeyer (Krankenhausbetten <strong>und</strong> -möbel, Ausstattung<br />
von Altenheimen), Brasseller (Dental) <strong>und</strong> Miele (Des<strong>in</strong>fektoren) produzieren im Bereich der<br />
Mediz<strong>in</strong>technik ebenso wie Zulieferer, etwa die Firma Gildemeister mit hochtechnologischen Anlagen<br />
zur Herstellung von Hüftgelenksimplantaten oder die Firma BOGE Kompressoren, deren Produkte <strong>in</strong><br />
fast allen Krankenhäusern vertreten s<strong>in</strong>d.<br />
- 153 -
Regionalstudie Ostwestfalen-Lippe<br />
Standort für Wissenschaft, Forschung <strong>und</strong> Qualifizierung<br />
Die Region arbeitet daran, sich als Zentrum für Qualifizierungs-, Forschungs- <strong>und</strong> Beratungsangebote<br />
für die Ges<strong>und</strong>heitsbranche zu etablieren. Die Universitäten Bielefeld <strong>und</strong> Paderborn sowie die Fachhochschulen<br />
Bielefeld <strong>und</strong> Lippe bieten <strong>in</strong> den Bereichen Ges<strong>und</strong>heitswissenschaften, Pflege, Bio-,<br />
Lebensmittel- <strong>und</strong> Informationstechnologie hervorragende Studien- <strong>und</strong> Forschungsschwerpunkte. In<br />
der Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Fachausbildung sowie der Weiterbildung für Ges<strong>und</strong>heitsberufe garantieren die Diakoniee<strong>in</strong>richtungen<br />
sowie Krankenhausträger der Region e<strong>in</strong> breites Qualifikationsspektrum.<br />
Die <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>är ausgerichtete Fakultät für Ges<strong>und</strong>heitswissenschaften an der Universität Bielefeld<br />
ist b<strong>und</strong>esweit die erste <strong>und</strong> bislang e<strong>in</strong>zige ihrer Art. Als Brücke zwischen bio-mediz<strong>in</strong>ischer <strong>und</strong><br />
kl<strong>in</strong>ischer Forschung sowie sozial- <strong>und</strong> verhaltenswissenschaftlichen Diszipl<strong>in</strong>en qualifizieren die<br />
Ges<strong>und</strong>heitswissenschaften ihre Absolvent/<strong>in</strong>nen zum "Master of Public Health" <strong>und</strong>/oder "Doctor of<br />
Public Health". Seit 1999 wird - ebenso als erstes se<strong>in</strong>er Art an deutschen Hochschulen - das berufsbegleitende<br />
Fernstudium „Angewandte Ges<strong>und</strong>heitswissenschaften“ mit dem Zertifikat "Ges<strong>und</strong>heitsmanager/<strong>in</strong>“<br />
angeboten. Zur Zeit wird e<strong>in</strong>e Telelearn<strong>in</strong>g Plattform für das Fernstudium entwikkelt,<br />
die es erlaubt, das Studium als netzbasiertes <strong>in</strong>teraktives Lernsystem durchzuführen. Für die<br />
Akademisierung der Pflege stehen des Weiteren das Institut für Pflegewissenschaft an der Universität<br />
Bielefeld <strong>und</strong> die Fachhochschule Bielefeld mit dem Studium der Pflegepädagogik.<br />
An der Universität Paderborn haben Wissenschaftler verschiedener Diszipl<strong>in</strong>en mit dem „Forum Ges<strong>und</strong>heit:<br />
Technik - Kommunikation“ e<strong>in</strong> Forschungsnetz gegründet <strong>und</strong> erbr<strong>in</strong>gen wissenschaftliche<br />
Dienstleistungen <strong>in</strong> den Bereichen Ernährungswissenschaften, Sportmediz<strong>in</strong>, Prävention <strong>und</strong> Biomechanik.<br />
Qualifizierungen im Umgang mit Informationstechnologien im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> werden<br />
vom Bildungszentrum für <strong>in</strong>formationsverarbeitende Berufe (b.i.b.) angeboten. Die ausgebildeten<br />
"Staatlich geprüften Informatikassistenten Mediz<strong>in</strong>ökonomie“ arbeiten erfolgreich <strong>in</strong> Krankenhäusern<br />
oder Softwareunternehmen, die sich auf den Computere<strong>in</strong>satz im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> spezialisiert haben.<br />
Standort für telematische Anwendungen im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
Ostwestfalen-Lippe verfügt <strong>in</strong>zwischen über e<strong>in</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>, das e<strong>in</strong>e breite Vielfalt anspruchsvoller<br />
Projekte <strong>in</strong> der Telemediz<strong>in</strong> vorweisen kann. Beispielhaft seien hier die Multimedia-<br />
Projekte CHIN, TENCARE <strong>und</strong> InKontakt genannt.<br />
Das Projekt CHIN (Community Health Integrated Network) wird im Mediz<strong>in</strong>ischen Zentrum für Ges<strong>und</strong>heit<br />
(MZG) Bad Lippspr<strong>in</strong>ge durchgeführt. Das Projekt ist richtungsweisend für die elektronische<br />
Vernetzung von Ärzten, Krankenhäusern <strong>und</strong> Rehabilitationskl<strong>in</strong>iken <strong>und</strong> gilt derzeit als e<strong>in</strong>er der<br />
wichtigsten Versuche <strong>in</strong> Sachen Telemediz<strong>in</strong>. Durch die <strong>in</strong>novative Kommunikationsplattform können<br />
Doppeluntersuchungen vermieden, Patienten ohne e<strong>in</strong>e Unterbrechung der Behandlung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Spezialkl<strong>in</strong>ik<br />
überwiesen werden <strong>und</strong> mehrere Spezialisten gleichzeitig an unterschiedlichen Orten e<strong>in</strong>en<br />
Bef<strong>und</strong> auswerten.<br />
- 154 -
Regionalstudie Ostwestfalen-Lippe<br />
Von der Zielrichtung ähnlich, wenngleich etwas bescheidener, ist das Projekt TENCARE, das – unterstützt<br />
von Mitteln aus der EU – vom Evgl. Johanneswerk geme<strong>in</strong>sam mit der Deutschen Telekom,<br />
dem Bonner Forschungs- <strong>und</strong> Beratungsunternehmen empirica sowie dem Institut Arbeit <strong>und</strong> Technik<br />
durchgeführt wird. Hier geht es darum, die Zusammenarbeit zwischen dem Krankenhaus <strong>und</strong> niedergelassenen<br />
Ärzt/<strong>in</strong>nen zu verbessern. Neben dem elektronischen Austausch von Arztbriefen wird dafür<br />
auf Bildtelephonie gesetzt. Ende Mai 2000 arbeiten 25 niedergelassene Ärzte im Projekt TENCARE<br />
mit.<br />
Zukunftsweisend für den E<strong>in</strong>satz von Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnologien für mehr Lebensqualität<br />
<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit im Alter ist das Entwicklungsprojekt InKontakt - Telekommunikationsservice<br />
für Senioren (TESS). Das Ev. Johanneskrankenhaus <strong>in</strong> Bielefeld bietet e<strong>in</strong> umfangreiches Servicenetz<br />
für die Unterstützung, Betreuung <strong>und</strong> Aktivierung zu Hause lebender älterer Menschen an.<br />
Das Netz umfasst e<strong>in</strong>en Hausnotruf, e<strong>in</strong>en Serviceruf <strong>und</strong> den Teleservice für Senior/<strong>in</strong>nen. Der Teleservice<br />
- TESS - ermöglicht Bielefelder Senioren per Bildtelefon oder Fernseher die Kommunikation<br />
untere<strong>in</strong>ander <strong>und</strong> mit der Fachzentrale des Ev. Johanneswerkes. Von dort aus werden Beratung, Unterhaltung<br />
<strong>und</strong> Programme zu verschiedenen Themen angeboten, Dienstleistungen vermittelt <strong>und</strong> moderierte<br />
Konferenzen mehrerer Teilnehmer/<strong>in</strong>nen organisiert. Das Projekt wurde vom Johanneswerk <strong>in</strong><br />
Kooperation mit der Deutschen Telekom entwickelt <strong>und</strong> erhielt den „Deutschen Seniorenpreis Multimedia“<br />
des B<strong>und</strong>esforschungsm<strong>in</strong>isteriums.<br />
Zukunftsimpulse durch die Ges<strong>und</strong>heitsprojekte der EXPO Initiative OWL<br />
Aufgr<strong>und</strong> der besonderen Kompetenz <strong>in</strong> Mediz<strong>in</strong> <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit arbeitet die Region aktiv an der<br />
Weiterentwicklung ihres Profils als Ges<strong>und</strong>heitsregion. Zentrale Impulse, die die Strukturentwicklung<br />
<strong>in</strong> der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft positiv bee<strong>in</strong>flusst haben, s<strong>in</strong>d im Kontext der ostwestfälischen Initiative<br />
zur EXPO 2000 entstanden. Unter dem EXPO-Motto „Mensch-Natur-Technik“ wurde <strong>in</strong> der Region<br />
e<strong>in</strong> Ideenwettbewerb zur Förderung <strong>in</strong>novativer Projekte <strong>in</strong> den Schwerpunktbereichen Ges<strong>und</strong>heit,<br />
Kultur <strong>und</strong> Neue Technologien organisiert. Zehn von der EXPO-Initiative OstWestfalenLippe ausgewählte<br />
<strong>und</strong> anerkannte Ges<strong>und</strong>heits-Projekte sollen den Kompetenz-Schwerpunkt Ges<strong>und</strong>heit für die<br />
Region profilieren. Das Spektrum der hier vertretenen Innovationen reicht von ganzheitlichen Therapiekonzepten<br />
<strong>in</strong> der ges<strong>und</strong>heitlichen Versorgung über neuartige Impulse für Existenzgründungen <strong>und</strong><br />
ges<strong>und</strong>heitswirtschaftliche Vernetzungen bis h<strong>in</strong> zu generationsübergreifenden Wohn- <strong>und</strong> Lebenskonzepten:<br />
• Mit dem Zentrum für Orthopädie <strong>und</strong> Rheumatologie <strong>in</strong> Bad Oeynhausen wird e<strong>in</strong> ganzheitliches<br />
Konzept der Betreuung von Rheumapatient/<strong>in</strong>nen entwickelt. Explizites Ziel ist es dabei, die Fachrichtungen<br />
Innere Mediz<strong>in</strong> <strong>und</strong> Orthopädie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>ären Behandlungsform zu <strong>in</strong>tegrieren.<br />
• In Lage soll mit dem Homöopathischen Ges<strong>und</strong>heitszentrum e<strong>in</strong>e Homöopathie-E<strong>in</strong>richtung mit<br />
überregionaler Bedeutung zur Entwicklung, Behandlung, Aus- <strong>und</strong> Fortbildung für Patienten, Angehörige,<br />
Fachpersonal <strong>und</strong> Besucher entstehen. Wegweisend für die Zukunft der Mediz<strong>in</strong> ist die<br />
stationäre Behandlung, die als Modell wissenschaftlich evaluiert wird.<br />
- 155 -
Regionalstudie Ostwestfalen-Lippe<br />
• Mit e<strong>in</strong>em b<strong>und</strong>esweit e<strong>in</strong>maligen Projekt setzen die SALUTO GmbH, das Herz- <strong>und</strong> Diabeteszentrum<br />
NRW <strong>in</strong> Bad Oeynhausen <strong>und</strong> das Zentrum für Präventiv- <strong>und</strong> Sportmediz<strong>in</strong> der Universität<br />
Bielefeld auf mehr Eigenverantwortung der Patienten nach Herzoperationen. Das Neue Ostwestfälische<br />
Postoperative Therapiekonzept (NOPT) soll mit maßgeschneiderten Sportprogrammen<br />
<strong>in</strong> der Rehabilitation unmittelbar nach der Operation ansetzen <strong>und</strong> die Lebensqualität nach<br />
schweren E<strong>in</strong>griffen verbessern.<br />
• Bad Lippspr<strong>in</strong>ge profiliert sich als Allergiezentrum mit e<strong>in</strong>em Allergielehrpfad <strong>und</strong> e<strong>in</strong>em Kommunikationspark.<br />
• High-Tech <strong>und</strong> menschliche Wärme verb<strong>in</strong>det die K<strong>in</strong>derkardiologische Kl<strong>in</strong>ik des Herzzentrums<br />
NRW <strong>in</strong> Bad Oeynhausen: Mit neuen Standards bei der Diagnostik, Behandlung <strong>und</strong> Betreuung<br />
soll e<strong>in</strong> großer Teil der Herzkathederuntersuchungen für die kle<strong>in</strong>en Patienten überflüssig werden.<br />
• Mit e<strong>in</strong>em ganzheitlichen Ansatz geht das Darmzentrum <strong>in</strong> Vlotho-Exter neue Wege der Behandlung<br />
proktologischer Erkrankungen. Unterschiedliche therapeutische Ansätze, unterstützende <strong>und</strong><br />
vorsorgende Programme <strong>und</strong> e<strong>in</strong> hotelähnliches Ambiente stehen für e<strong>in</strong> zukunftsfähiges Behandlungsmodell<br />
mit starker K<strong>und</strong>enorientierung.<br />
• Das <strong>in</strong> Bad Salzuflen neu gegründete Interdiszipl<strong>in</strong>äre Zentrum für Frauenges<strong>und</strong>heit (IZFG) ist<br />
spezialisiert auf die mediz<strong>in</strong>ische <strong>und</strong> psychosoziale Versorgung von Frauen <strong>in</strong> den Bereichen Ges<strong>und</strong>heitsförderung,<br />
Prävention <strong>und</strong> Rehabilitation.<br />
• E<strong>in</strong> ehemaliges Kl<strong>in</strong>ikgebäude <strong>in</strong> Gütersloh, das im Zuge der Psychiatriereform frei wurde, wird<br />
für das Projekt Medialog Gütersloh genutzt. Das Konzept sieht die Ansiedlung von Unternehmen<br />
der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft vor, die im Verb<strong>und</strong> mit der Kl<strong>in</strong>ik <strong>und</strong> dem Know-How der Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen<br />
Projekte entwickeln.<br />
• Mit großem Erfolg realisiert der „Vere<strong>in</strong> Anders alt werden“ am Obersee <strong>in</strong> Bielefeld e<strong>in</strong>e generationsübergreifende<br />
Wohngeme<strong>in</strong>schaft. Das anthroposophische Projekt wird im EXPO-Jahr<br />
2000 e<strong>in</strong> „Haus der Stille“ fertig stellen.<br />
• Aus eigenen Mitteln betreiben mehrere große E<strong>in</strong>richtungen der Ges<strong>und</strong>heitsversorgung zusammen<br />
mit Unternehmen der regionalen Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft, die sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Vere<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>er Innovationspartnerschaft<br />
verb<strong>und</strong>en haben, das Zentrum für Innovation <strong>in</strong> der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft<br />
OWL (ZIG). Das Zentrum fungiert als Entwicklungsagentur für die regionale Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft.<br />
Mit den vorgestellten Schwerpunkten <strong>und</strong> Entwicklungsaktivitäten hat sich die Region e<strong>in</strong> Profil erarbeitet,<br />
das gute Voraussetzungen für e<strong>in</strong>e positive Weiterentwicklung der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft <strong>in</strong><br />
Ostwestfalen-Lippe bietet.<br />
5.1.2.2. Zukunftsregion für ges<strong>und</strong>heitswirtschaftliche Vernetzung: Handlungsfelder <strong>und</strong><br />
Entwicklungsperspektiven bis 2010<br />
Das Profil der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft <strong>in</strong> Ostwestfalen-Lippe wird sich <strong>in</strong> den nächsten Jahren auf verschiedenen<br />
Entwicklungspfaden weiterentwickeln. Ausgehend vom derzeitigen Profil, werden nachfolgend<br />
im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es Entwicklungsszenarios mögliche Optionen <strong>in</strong> fünf Handlungsfeldern skizziert:<br />
• Wachstumsimpulse durch Brückenschläge zu Nachbarbranchen;<br />
• Umbau <strong>und</strong> Modernisierung des Ges<strong>und</strong>heitssystems - Integration <strong>und</strong> Spezialisierung;<br />
- 156 -
Regionalstudie Ostwestfalen-Lippe<br />
• Wellness, Freizeit <strong>und</strong> Tourismus;<br />
• Telemediz<strong>in</strong> für mehr Lebensqualität <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit;<br />
• wachsende Dynamik des Consult<strong>in</strong>gmarktes <strong>in</strong> OWL.<br />
Wachstumsimpulse durch Brückenschläge zu Nachbarbranchen<br />
Die Region Ostwestfalen-Lippe kann bis zum Jahr 2010 erheblich davon profitieren, dass die Leistungsanbieter<br />
der Ges<strong>und</strong>heitsversorgung zusammen mit mittelständischen Unternehmen aus den<br />
vor- <strong>und</strong> angelagerten Branchen <strong>in</strong>novative Produkt- <strong>und</strong> Prozess<strong>in</strong>novationen erarbeiten.<br />
Damit bietet sich für die Unternehmen der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft die Möglichkeit, ihre Startposition<br />
auszubauen - e<strong>in</strong>e Chance, die sich vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> gewachsener Vertrauensbeziehungen <strong>in</strong><br />
„Strategischen Kooperations-Partnerschaften für die Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft OWL“ entfaltet. Diese<br />
Partnerschaften zwischen den E<strong>in</strong>richtungen der mediz<strong>in</strong>ischen Versorgung <strong>und</strong> den Unternehmen der<br />
ostwestfälisch-lippischen Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft (pharmazeutische, mediz<strong>in</strong>- <strong>und</strong> gerontotechnische<br />
Industrie, Nahrungsmittelhersteller, Dienstleister aus den Bereichen Sport, Wellness <strong>und</strong> Freizeit, Träger<br />
der Aus- <strong>und</strong> Fortbildung im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> sowie die E<strong>in</strong>richtungen aus Wissenschaft <strong>und</strong><br />
Forschung) führen dazu, dass viele der mittelständischen Unternehmen der Region ihre klassischen<br />
Geschäftsfelder halten <strong>und</strong> darüber h<strong>in</strong>aus im Ges<strong>und</strong>heitssektor neue Optionen ausbauen. Traditionsfirmen<br />
des Masch<strong>in</strong>enbaus entwickeln neue Unternehmensfelder im Bereich der Mediz<strong>in</strong>- <strong>und</strong> Rehabilitationstechnik.<br />
Unternehmen der Kunststoffverarbeitung diversifizieren ihr Produktspektrum <strong>und</strong><br />
erschließen sich Geschäftsfelder durch die Erprobung neuer Materialien <strong>und</strong> Verfahren im Bereich der<br />
Prothetik <strong>und</strong> der Implantateherstellung. Der Fahrzeugbau nutzt se<strong>in</strong>e Kernkompetenzen für die Entwicklung<br />
technischer Lösungen, die die Mobilität älterer <strong>und</strong> beh<strong>in</strong>derter Menschen verbessern. In der<br />
Biotechnologie entstehen neuartige Verfahren zur Qualitätssicherung <strong>in</strong> der Lebensmittelproduktion <strong>in</strong><br />
enger Kooperation mit den Marktführern der ostwestfälisch-lippischen Ernährungs<strong>in</strong>dustrie. Letztere<br />
entwickeln zusammen mit landwirtschaftlichen Erzeugern neue Logistikkonzepte für den Umbau der<br />
Großküchenversorgung mit qualitativ hochwertigen Produkten aus der Region.<br />
Wenn sich Ostwestfalen-Lippe <strong>in</strong> den nächsten Jahren im Wettbewerb mit anderen Ges<strong>und</strong>heitsregionen<br />
als Standort mit fre<strong>und</strong>lichem Investitionsklima profiliert, wird es <strong>in</strong> den Jahren nach 2010 zu<br />
weiteren Ansiedlungen aus den vor- <strong>und</strong> nachgelagerten Wirtschaftsbereichen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s<br />
kommen. Insbesondere kle<strong>in</strong>ere, neu gegründete Firmen werden das positive Dienstleistungsklima der<br />
Region als Markt für ihre Produkt<strong>in</strong>novationen zu nutzen wissen.<br />
Umbau <strong>und</strong> Modernisierung des Ges<strong>und</strong>heitssystems - Integration <strong>und</strong> Spezialisierung<br />
In der Vergangenheit hatten sich die Unternehmen <strong>und</strong> E<strong>in</strong>richtungen der ges<strong>und</strong>heitlichen Versorgung<br />
stark an den traditionellen Strukturen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s orientiert. Mit dem Aufbrechen<br />
dieser korporativen Verkrustungen brauchen die Akteure der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft zukunftsweisende<br />
Antworten.<br />
- 157 -
Regionalstudie Ostwestfalen-Lippe<br />
Was sich <strong>in</strong> den Strukturen des alten <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s noch als schwer realisierbar darstellt, zeichnet<br />
sich als Entwicklungspfad für die nächsten zehn Jahre ab: Der stationären Versorgung gel<strong>in</strong>gt der<br />
Umbau zu Ges<strong>und</strong>heitszentren, die das Schnittstellenmanagement von ambulanten, stationären <strong>und</strong><br />
komplementären Angeboten optimieren. Pilotprojekte tragen dazu bei, den Übergang zu zukunftsweisenden<br />
Modellen der <strong>in</strong>tegrierten Versorgung zu vollziehen. Entlang der Versorgungskette z.B. für<br />
Herzkreislauf- <strong>und</strong> neurologische Erkrankungen werden neue Angebotsformen von der Prävention bis<br />
h<strong>in</strong> zur Nachsorge entwickelt. Wissenschaft <strong>und</strong> Forschung spezialisieren sich auf den Umbau des<br />
Ges<strong>und</strong>heitssystems zu <strong>in</strong>tegrierten Modellen. Dieser Prozess wird qualifiziert <strong>und</strong> beschleunigt durch<br />
die zunehmende regionale Kooperation mit Unternehmen der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft. Pilotprojekten <strong>in</strong><br />
Ostwestfalen-Lippe gel<strong>in</strong>gt auf dieser Basis der Nachweis, dass der Übergang zu neuen Versorgungsmodellen<br />
auch ohne Beschäftigungsverluste vollzogen werden kann. Der Gr<strong>und</strong>ste<strong>in</strong> dafür liegt <strong>in</strong> der<br />
konsequenten Beteiligung aller Akteure der Versorgungskette, der stationären Akutversorgung, der<br />
ambulanten ärztlichen Versorgung, der stationären <strong>und</strong> ambulanten Rehabilitation sowie der Pflege<br />
<strong>und</strong> Betreuung, z.B. <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em frühzeitig geöffneten „Verb<strong>und</strong> mediz<strong>in</strong>ische Versorgung OWL“.<br />
Ferner nutzt die Region ihre Chancen für e<strong>in</strong>e Vorreiterschaft bei der Integration von Schulmediz<strong>in</strong><br />
<strong>und</strong> komplementären/alternativen Heilmethoden. Mit Blick auf K<strong>und</strong>en- <strong>und</strong> Patientenbedürfnisse<br />
nimmt die Region die deutlich e<strong>in</strong>geforderte Vernetzung bzw. Komplementarität von Schulmediz<strong>in</strong><br />
<strong>und</strong> alternativer Mediz<strong>in</strong> ernst <strong>und</strong> baut ihr Angebotsspektrum entsprechend aus. Die bereits bestehenden<br />
Zentren, die ergänzend alternative Heilmethoden e<strong>in</strong>setzen, werden sich erweitern. Vere<strong>in</strong>zelt<br />
gel<strong>in</strong>gt es, <strong>in</strong>nerhalb weniger Jahre die Beschäftigtenzahlen zu verdoppeln - wie das Beispiel des<br />
Darmzentrums <strong>in</strong> Vlotho <strong>in</strong> der Vergangenheit gezeigt hat. Um die Therapieerfolge messbar zu machen,<br />
werden Evaluationsprogramme entwickelt <strong>und</strong> operationalisiert. Zwar wird die F<strong>in</strong>anzierung<br />
weiterh<strong>in</strong> überwiegend durch Privatliquidation erfolgen, doch entscheiden sich die Kassen <strong>in</strong>folge des<br />
großen Behandlungserfolges für Modellprojekte, die e<strong>in</strong>e Mitf<strong>in</strong>anzierung über die Sozialversicherung<br />
erlauben.<br />
Die Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen leben auch <strong>in</strong> Zukunft noch zu e<strong>in</strong>em guten Teil von Zuweisungen<br />
im klassischen Bereich, die Quote der Zuzahler wird aber deutlich zunehmen. Insbesondere für die<br />
Reha-Kl<strong>in</strong>iken werden sich durch Spezialisierung mit gleichzeitig ganzheitlicher Orientierung des<br />
Behandlungsansatzes neue Chancen ergeben, die konsequent <strong>in</strong> verbesserte Dienstleistungen für neue<br />
Zielgruppen umgesetzt werden. So entwickeln sich die großen Heilbäder der Region zu spezialisierten<br />
Zentren für Prävention <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit.<br />
Bad Oeynhausen wird se<strong>in</strong>e bisherige weltweite Führungsrolle im Bereich der Herzchirurgie halten<br />
<strong>und</strong> um weitere Kompetenzen, bspw. <strong>in</strong> der Orthopädie, erweitern. Spezifische Konzepte <strong>und</strong> Angebote<br />
für die Rehabilitation von Migranten werden ausgebaut. Das Staatsbad Salzuflen hat gute Voraussetzungen,<br />
sich als Standort für Frauenges<strong>und</strong>heit zu etablieren. Bad Lippspr<strong>in</strong>ge wird sich als<br />
Spezialist für die Behandlung <strong>und</strong> Prävention von allergologischen Erkrankungen weiterentwickeln.<br />
Bad Me<strong>in</strong>berg könnte b<strong>und</strong>esweit zum führenden Zentrum für T<strong>in</strong>nituserkrankungen avancieren. Bielefeld<br />
bleibt Spitzenanbieter für die Behandlung <strong>und</strong> Rehabilitation psychisch kranker <strong>und</strong> beh<strong>in</strong>derter<br />
Menschen <strong>und</strong> exportiert b<strong>und</strong>esweit <strong>in</strong>tegrierte Konzepte für spezifische Wohn- <strong>und</strong> Rehabilitationsformen.<br />
- 158 -
Wellness, Freizeit <strong>und</strong> Tourismus<br />
Regionalstudie Ostwestfalen-Lippe<br />
In Verknüpfung <strong>und</strong> Erweiterung zur klassischen Rehabilitation entstehen neue Dienstleistungen<br />
durch moderne Wellness-, Freizeit- <strong>und</strong> Tourismusangebote. Dies gel<strong>in</strong>gt durch die strategische Vernetzung<br />
der Aktivitäten von Wellness-Anbietern, dem Teutoburger Wald Vere<strong>in</strong> <strong>und</strong> dem Hotel- <strong>und</strong><br />
Gaststättenverband. In der nordrhe<strong>in</strong>-westfälischen Fremdenverkehrsstatistik strebt die Region den<br />
ersten Platz <strong>in</strong> NRW an.<br />
Die Impulse der regionalen EXPO-Initiative Ostwestfalen-Lippe schaffen Maßstäbe für e<strong>in</strong>en neuen<br />
Typ <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e neue Qualität von Erlebnis-, Freizeit- <strong>und</strong> Tourismusattraktionen <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit<br />
Wellness <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit. Was mit der Umgestaltung der traditionellen Kurparkanlagen zu modernen<br />
Erlebnislandschaften mit künstlerischen <strong>und</strong> bildungsbezogenen Darbietungen <strong>und</strong> Angeboten zu den<br />
Themen Mensch, Natur, Technik, Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Kultur begonnen hat, wird konsequent fortgeführt.<br />
Die jährliche Besucherzahl von Tagesveranstaltungen oder Kurzurlauben sowie ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong><br />
wellnessorientierter Freizeitangebote steigt deutlich an. Das schafft neue Nachfrage, z.B. im Bereich<br />
Ges<strong>und</strong>heitsbildung <strong>und</strong> -förderung: Bad Lippspr<strong>in</strong>ge hat gute Voraussetzungen, den Allergiepfad um<br />
e<strong>in</strong> Bildungs<strong>in</strong>stitut für den Umgang mit Allergieerkrankungen zu ergänzen; <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em anderen Heilbad<br />
wird e<strong>in</strong> Erlebnispark eröffnet, der <strong>in</strong>dividuelle, betriebliche, schulische <strong>und</strong> weitere k<strong>und</strong>engruppenspezifische<br />
Angebote zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung spielerisch <strong>und</strong> kreativ umsetzt.<br />
Die gesamte Region richtet ihr Leistungsprofil dah<strong>in</strong>gehend aus, dass sich nicht nur junge Ges<strong>und</strong>heitsurlauber<br />
angesprochen fühlen, sondern auch die demographisch relevante Seniorengeneration.<br />
Hotels, Fitnesscenter, Sportanlagen, Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitszentren stimmen<br />
ihre Unternehmensstrategien auf diese Zielgruppe ab <strong>und</strong> halten <strong>in</strong>teressante Angebote vor. Auch beh<strong>in</strong>derte<br />
<strong>und</strong> gehandicapte Menschen f<strong>in</strong>den Urlaubs- <strong>und</strong> Wellnessangebote mit mediz<strong>in</strong>ischer <strong>und</strong><br />
pflegerischer r<strong>und</strong>-um-Betreuung.<br />
Telemediz<strong>in</strong> für mehr Lebensqualität <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit<br />
Um die Dienstleistungen der Ges<strong>und</strong>heitsanbieter optimal zu gestalten, verstärkt die Region den E<strong>in</strong>satz<br />
von Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnologien <strong>in</strong> fast allen Versorgungs- <strong>und</strong> Schwerpunktbereichen.<br />
Als Musterregion für telematische Anwendungen im Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Sozialwesen<br />
konzentrieren sich die Angebote <strong>in</strong> Ostwestfalen-Lippe auf die Qualitäts- <strong>und</strong> Effizienzsteigerung der<br />
mediz<strong>in</strong>ischen Versorgung. So f<strong>in</strong>det z.B. die Kommunikation <strong>in</strong> der Akutmediz<strong>in</strong> (ambulant/<br />
stationär) oder <strong>in</strong> der Vernetzung von Akutmediz<strong>in</strong>, Rehabilitation <strong>und</strong> Nachsorge am Wohnort<br />
auf elektronischem Wege statt. Auch die Notfallversorgung bei Herz<strong>in</strong>farkt wird durch direkte Datenübertragung<br />
aus dem Rettungswagen mit dem Herzzentrum verbessert.<br />
Informationstechnik wird darüber h<strong>in</strong>aus zur Aktivierung von <strong>und</strong> Kommunikation mit Patienten ausgebaut.<br />
Nicht nur ältere alle<strong>in</strong>lebende Menschen werden per bildgestützter Kommunikation durch<br />
Professionelle <strong>in</strong> ihrem Alltag unterstützt <strong>und</strong> aktiviert (so geschehen im TESS Projekt des Ev. Johanneswerkes<br />
<strong>und</strong> der Telekom). Auch beh<strong>in</strong>derte <strong>und</strong> psychisch erkrankte Menschen erhalten <strong>in</strong> dezen-<br />
- 159 -
Regionalstudie Ostwestfalen-Lippe<br />
tralen Wohngruppen die Möglichkeit, <strong>in</strong>tensiver zu kommunizieren - untere<strong>in</strong>ander wie auch mit professionellen<br />
Betreuern.<br />
Auf das stetig wachsende Informationsbedürfnis im Krankheitsfall sowie zu Fragen der ges<strong>und</strong>en Lebensführung<br />
<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>erhaltung antworten profilierte Akteure der Region <strong>in</strong>sbesondere an der Universität<br />
Paderborn mit der Entwicklung multimedialer Ges<strong>und</strong>heitsberatung <strong>und</strong> eröffnen damit neue<br />
Kommunikationswege zum Patienten. Das breite fachliche Spezialwissen <strong>in</strong> der Region wird für Patient/<strong>in</strong>nen<br />
per CD-ROM <strong>und</strong> Internet <strong>in</strong>teraktiv aufbereitet (z.B. zur Prävention von Arteriosklerose,<br />
Allergien <strong>und</strong> Erkrankungen des Bewegungsapparates) <strong>und</strong> an verschiedenen Standorten öffentlich<br />
zugänglich gemacht. Um die bereits vorhandenen Modellentwicklungen zu standardisieren <strong>und</strong> weitere<br />
telematische Entwicklungen zu befördern, schließen sich die Hauptakteure <strong>in</strong> der Initiative TOUGH<br />
(Telemediz<strong>in</strong> aus Ostwestfalen-Lippe - Unterstützung für Ges<strong>und</strong>erhaltung <strong>und</strong> Heilung) zusammen.<br />
Durch dieses Kompetenzforum wird der E<strong>in</strong>satz neuer Medien im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> <strong>in</strong>sbesondere mit<br />
Blick auf K<strong>und</strong>en- <strong>und</strong> Patientenbedürfnisse weiterentwickelt.<br />
Wachsende Dynamik des Consult<strong>in</strong>gmarktes <strong>in</strong> OWL<br />
H<strong>in</strong>sichtlich der Beschäftigungseffekte bietet der b<strong>und</strong>esweit anhaltende Trend zur Tertiarisierung<br />
e<strong>in</strong>e solide Basis zur Ausweitung der sek<strong>und</strong>ären Dienstleistungen <strong>in</strong> der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft Ostwestfalen-Lippes.<br />
Neben dem Bereich Qualifizierung wird der Bereich wissensbasierter Dienstleistungen<br />
für die Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft <strong>in</strong> der Region deutlich ausgebaut. Schon heute verfügt die Region<br />
über e<strong>in</strong>en ausgewiesenen Consult<strong>in</strong>gmarkt, der sich auf den Ges<strong>und</strong>heitssektor spezialisiert hat. Ursache<br />
für diese Profilbildung ist die Dichte der Versorgungse<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong> deren Bereitschaft für<br />
Erprobungspartnerschaften sowie die gezielte Ausrichtung der Universitäten <strong>und</strong> Fachhochschulen auf<br />
Management- <strong>und</strong> Organisationsentwicklungskompetenzen für das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>, die e<strong>in</strong>e Vielzahl<br />
von Gründungen hervorgebracht hat. Auf der Gr<strong>und</strong>lage dieser starken Consult<strong>in</strong>g- <strong>und</strong> Qualifizierungslandschaft<br />
entwickelt sich die Region zum Markenzeichen für ges<strong>und</strong>heitsspezifisches Beratungs-<br />
<strong>und</strong> Entwicklungs-Know-how. Sie profitiert deshalb auch <strong>in</strong> besonderem Maße von der durch<br />
die Prognos-AG vorausgesagten ca. e<strong>in</strong>e Million zusätzlicher Arbeitsplätze im Bereich Dienstleistungstätigkeiten,<br />
Forschung <strong>und</strong> Entwicklung, Organisation <strong>und</strong> Management sowie „Beraten, Betreuen,<br />
Lehren Publizieren u.ä.“ (vgl. Dostal/Re<strong>in</strong>berg 1999).<br />
5.1.2.3. Fazit: Regionales Innovationspotenzial <strong>und</strong> Herausforderungen für die Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft<br />
Ostwestfalen-Lippe<br />
Sicherlich werden nicht alle Optionen des Entwicklungsszenarios Realität. Das derzeitige Profil der<br />
Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft <strong>in</strong> Ostwestfalen-Lippe zeigt aber: In der Region existieren starke Wirtschaftsakteure<br />
für den Wachstumsmarkt Ges<strong>und</strong>heit. Die E<strong>in</strong>richtungen der ges<strong>und</strong>heitlichen Versorgung<br />
stehen für <strong>in</strong>novative Lösungsansätze. Die Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft der Region birgt e<strong>in</strong> beträchtliches<br />
Wirtschafts- <strong>und</strong> Beschäftigungspotenzial. E<strong>in</strong> gutes Gründungsklima sorgt für erfolgreiche Existenzgründungen.<br />
Mit e<strong>in</strong>er dynamisch wachsenden Consult<strong>in</strong>gbranche ist e<strong>in</strong> umfassendes Beratungs-<br />
- 160 -
Regionalstudie Ostwestfalen-Lippe<br />
Know-how für den Ges<strong>und</strong>heitsbereich entstanden. Die Bildungs- <strong>und</strong> Forschungs<strong>in</strong>frastruktur gibt<br />
Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung. Transferstellen, Technologiezentren <strong>und</strong> andere <strong>in</strong>termediäre<br />
Institutionen unterstützen <strong>in</strong> modellhaften Projekten die Verknüpfung von Wissenschaft <strong>und</strong><br />
Wirtschaft. Das Zentrum für Innovation <strong>in</strong> der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft OWL, das aus eigenen Mitteln<br />
der beteiligten Unternehmen <strong>und</strong> E<strong>in</strong>richtungen unterhalten wird, ist e<strong>in</strong> zukunftsweisender Ansatz<br />
e<strong>in</strong>er regionalen Entwicklungsagentur für ges<strong>und</strong>heitswirtschaftliche Vernetzung.<br />
Die Standortstärken der Region Ostwestfalen-Lippe <strong>und</strong> das regionale Innovationspotenzial bieten<br />
gute Gr<strong>und</strong>lagen für die Weiterentwicklung der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft. Daraus lassen sich deutlich<br />
positive Beschäftigungseffekte ableiten, die <strong>in</strong>sbesondere dann mit guten Aussichten realisiert werden<br />
können, wenn die folgenden Herausforderungen erfolgreich bewältigt werden:<br />
• Mit zukunftsweisenden Verb<strong>und</strong>lösungen <strong>und</strong> Kooperationsnetzwerken gel<strong>in</strong>gt die Verknüpfung<br />
des Kernsektors der ges<strong>und</strong>heitlichen Versorgung mit den vor- <strong>und</strong> angelagerten Bereichen der<br />
Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft.<br />
• Über Existenzgründungen <strong>und</strong> Neuansiedlungen gel<strong>in</strong>gt es, verstärkt mediz<strong>in</strong>-, geronto- <strong>und</strong> biotechnologische<br />
Kompetenzen sowie unternehmensnahe Dienstleistungen für den Ges<strong>und</strong>heitssektor<br />
<strong>in</strong> die Region zu holen.<br />
• Integrierte Versorgungskonzepte werden <strong>in</strong> verschiedenen Varianten <strong>und</strong> unter E<strong>in</strong>beziehung der<br />
gesamten Versorgungskette erprobt <strong>und</strong> modellhaft umgesetzt.<br />
• Die <strong>in</strong>novativen Verb<strong>und</strong>lösungen, Partnerschaften, Kooperationen <strong>und</strong> Netzwerke werden über<br />
e<strong>in</strong>e regionale Entwicklungsagentur gebündelt <strong>und</strong> verstärkt. Diese Agentur arbeitet „<strong>in</strong> der Region,<br />
für die Region“. Die vorhandenen Ressourcen für die notwendige Vernetzungsarbeit werden<br />
ausgebaut.<br />
• Der Region gel<strong>in</strong>gt es, das vorhandene Standortprofil e<strong>in</strong>heitlich zu verkörpern <strong>und</strong> weniger vielstimmig<br />
zu kommunizieren. Die Vermarktung der Ges<strong>und</strong>heitsregion muss auch <strong>in</strong>ternationale<br />
K<strong>und</strong>engruppen erschließen.<br />
• Der Bedarf an Know-how <strong>und</strong> höherwertigen Qualifikationsprofilen wächst. Die Bildungs- <strong>und</strong><br />
Qualifizierungslandschaft hält entsprechende Angebote vor, so dass die regionale Beschäftigtenstruktur<br />
vor allem durch hochqualifizierte Kräfte geprägt ist.<br />
Ostwestfalen-Lippe könnte sich auf diese Weise die Chance erarbeiten, zukünftig als Modellregion für<br />
regionale Vernetzung <strong>und</strong> Innovationspartnerschaften <strong>in</strong> der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft zu stehen. Ob die<br />
genannten Herausforderungen erfolgreich bewältigt werden, hängt nicht zuletzt davon ab, wie sich die<br />
regionalen Akteure <strong>in</strong> dem Cluster „Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft OWL“ verorten. Für die Unternehmen s<strong>in</strong>d<br />
Eigenbeiträge zur Weiterentwicklung e<strong>in</strong>es regionalen ges<strong>und</strong>heitswirtschaftlichen Clusters nur von<br />
Interesse, wenn die bisher erzeugten Lerneffekte fortgeschrieben werden können. Entsprechend<br />
wächst der Bedarf, die Weiterentwicklung der Erfahrungs- <strong>und</strong> Wissensbasis durch e<strong>in</strong>e regionale<br />
Entwicklungsagentur oder durch kont<strong>in</strong>uierlich <strong>in</strong> der Region für die Region arbeitende Aktivatoren<br />
zu unterstützen, zu moderieren <strong>und</strong> diesen Lernprozess <strong>in</strong> der Form von Handlungswissen anderen<br />
Regionen zu präsentieren <strong>und</strong> zur Verfügung zu stellen.<br />
- 161 -
Regionalstudie Ruhrgebiet<br />
5.1.3. Profil <strong>und</strong> Perspektiven der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft im Ruhrgebiet<br />
Ruth Kampherm <strong>und</strong> Sab<strong>in</strong>e Lange (Kommunalverband Ruhrgebiet)<br />
5.1.3.1. Profil des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s im Ruhrgebiet<br />
Das Ruhrgebiet verfügt über e<strong>in</strong>e gut ausgebaute wohnortnahe Gr<strong>und</strong>versorgung im Ges<strong>und</strong>heitssektor.<br />
So gibt es z.B. <strong>in</strong>sgesamt 22 allgeme<strong>in</strong>e <strong>und</strong> 14 Spezialkrankenhäuser mit mehr als 43.000 Planbetten.<br />
Die Universitätskl<strong>in</strong>iken <strong>in</strong> Essen <strong>und</strong> Bochum (Bergmannsheil) sowie das St. Josef-Hospital<br />
<strong>in</strong> Bochum, aber auch weitere Fachkl<strong>in</strong>ken <strong>in</strong> den anderen Städten s<strong>in</strong>d über die Grenzen der Region<br />
h<strong>in</strong>aus von Bedeutung. H<strong>in</strong>sichtlich der Bettendichte <strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>en Krankenhäusern ist das Ruhrgebiet<br />
mit 8,0 Betten pro 1.000 E<strong>in</strong>wohner/<strong>in</strong>nen (1997) zwar etwas besser als der Landesdurchschnitt<br />
(7,1) ausgestattet, aber schlechter als die Städte Münster (14,3), Bielefeld (9,7) <strong>und</strong> Düsseldorf (9,6).<br />
Die e<strong>in</strong>zelnen Städte des Ruhrgebietes haben durch ihre Lage <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em polyzentrischen Ballungsgebiet<br />
<strong>und</strong> die räumliche Dichte an Krankenhäusern nicht die großen überörtlichen E<strong>in</strong>zugsgebiete wie Münster<br />
<strong>und</strong> Düsseldorf, so dass selbst Bochum mit 8,7 Planbetten je 1.000 E<strong>in</strong>wohner/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> das benachbarte<br />
Essen im Ballungskern mit 9,5 Betten noch h<strong>in</strong>ter dem Wert von Hamm im Ballungsrand<br />
von 11,9 zurückbleiben.<br />
Die Herkunft der Spitzenärzt<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> -ärzte im Ruhrgebiet (FOCUS-Ärzteliste 1997) gibt Auskunft<br />
über die Bedeutung der Kl<strong>in</strong>iken <strong>in</strong> der Region. Die meisten Spitzenärzte f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> Essen <strong>und</strong><br />
Bochum <strong>und</strong> hier <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> den Universitätskl<strong>in</strong>iken Essen <strong>und</strong> Bochum (Bergmannsheil). In<br />
diesen Städten f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> nahezu jeder mediz<strong>in</strong>ischen Fachrichtung Spitzenärzt/<strong>in</strong>nen, während <strong>in</strong><br />
Dortm<strong>und</strong>, Reckl<strong>in</strong>ghausen, Mülheim, Oberhausen, Gelsenkirchen oder Hagen jeweils nur e<strong>in</strong> Spitzenarzt,<br />
<strong>in</strong> Herne zwei <strong>und</strong> <strong>in</strong> Duisburg vier Spitzenärzte tätig s<strong>in</strong>d. Essen <strong>und</strong> Bochum s<strong>in</strong>d somit die<br />
Fachzentren mediz<strong>in</strong>ischer Versorgung im Ruhrgebiet.<br />
Auch <strong>in</strong> der ambulanten Versorgung kann von e<strong>in</strong>er gut ausgebauten Infrastruktur gesprochen werden.<br />
Mit 1,17 niedergelassenen Ärzt<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ärzten pro 1.000 E<strong>in</strong>wohner/<strong>in</strong>nen (1996) nimmt das Ruhrgebiet<br />
<strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen e<strong>in</strong>en mittleren Platz vor Münster/Ostwestfalen <strong>und</strong> dem Sauerland <strong>und</strong><br />
h<strong>in</strong>ter dem Niederrhe<strong>in</strong> <strong>und</strong> dem Rhe<strong>in</strong>land e<strong>in</strong>. Insgesamt beträgt der Anteil der Ärzt<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ärzte<br />
im Ruhrgebiet an den Ärzt<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ärzten <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen 29 %. Mit Anteilswerten zwischen<br />
26 <strong>und</strong> 34 % liegen die Anteile der meisten Fachärztegruppen <strong>in</strong> vergleichbarer Höhe. Die<br />
höchsten Fachärzteanteile <strong>in</strong> NRW verbucht das Ruhrgebiet bei den K<strong>in</strong>der- <strong>und</strong> Jugendpsychiater/<strong>in</strong>nen<br />
mit 42 % <strong>und</strong> den Nuklearmediz<strong>in</strong>er/<strong>in</strong>nen mit 37 %. Deutlich unterdurchschnittlich s<strong>in</strong>d im<br />
Ruhrgebiet die Anteilswerte der Pharmakolog/<strong>in</strong>nen mit 15 %, der Rechtsmediz<strong>in</strong>er/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Lungenärzt/<strong>in</strong>nen<br />
mit jeweils 19 % sowie der Psychiater/<strong>in</strong>nen mit 21 %.<br />
Im Ruhrgebiet s<strong>in</strong>d Ende 1996 <strong>in</strong>sgesamt 14.954 Ärzt<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ärzte tätig, davon 6.290 <strong>in</strong> freier Praxis<br />
<strong>und</strong> 8.072 im Krankenhaus. Der Besatz an Ärzt<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ärzten im Ruhrgebiet entspricht mit 2,8<br />
- 162 -
Regionalstudie Ruhrgebiet<br />
Ärzt<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ärzten pro 1.000 E<strong>in</strong>wohner/<strong>in</strong>nen zwar dem Landesdurchschnitt, für e<strong>in</strong>en Ballungsraum<br />
wären aber aufgr<strong>und</strong> der zentralörtlichen Bedeutung höhere Werte zu erwarten. Mit 1,2 Ärzt<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Ärzten <strong>in</strong> freier Praxis pro 1.000 E<strong>in</strong>wohner/<strong>in</strong>nen ist das Ruhrgebiet sogar schlechter als<br />
NRW <strong>in</strong>sgesamt ausgestattet.<br />
Herausragend ist im Ruhrgebiet lediglich Essen mit dem höchsten Besatz an Ärzt<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ärzten<br />
<strong>in</strong>sgesamt (3,7 Ärzt<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ärzten je 1.000 E<strong>in</strong>wohner/<strong>in</strong>nen), gefolgt von Bochum, Hamm <strong>und</strong><br />
Duisburg (je 3,1). Der Kreis Unna weist dagegen die niedrigste Ärztedichte mit 1,9 Ärzt<strong>in</strong>nen <strong>und</strong><br />
Ärzten auf. Bei der Versorgung mit Ärzt<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ärzten <strong>in</strong> freier Praxis s<strong>in</strong>d die Unterschiede <strong>in</strong>nerhalb<br />
des Ruhrgebietes zu vernachlässigen.<br />
Zwischen 1985 <strong>und</strong> 1996 hat die Zahl der Ärzt<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ärzte sowohl im Ruhrgebiet als auch <strong>in</strong><br />
NRW sehr stark zugenommen, wenn auch im Ruhrgebiet etwas schwächer (+23,6 %) als im Land<br />
<strong>in</strong>sgesamt (+24,7 %). Besonders stark ist dabei die Zahl der Ärzt<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ärzte <strong>in</strong> freier Praxis gestiegen,<br />
im Ruhrgebiet sogar ausgeprägter als <strong>in</strong> NRW <strong>in</strong>sgesamt, aber auch der Anstieg der Zahl der<br />
Ärzt<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ärzte <strong>in</strong> Krankenhäusern liegt im Ruhrgebiet leicht über dem <strong>in</strong> NRW. Rückgänge s<strong>in</strong>d<br />
dagegen bei der Zahl der Ärzt<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ärzte <strong>in</strong> wissenschaftlich-theoretischen Instituten, <strong>in</strong> sonstigen<br />
öffentlich-rechtlichen Behörden <strong>und</strong> Körperschaften, <strong>in</strong> Industrie <strong>und</strong> Privatwirtschaft sowie bei<br />
den sonstigen Arbeitgebern festzustellen.<br />
Forschungs<strong>in</strong>frastruktur des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s im Ruhrgebiet<br />
In Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen wird r<strong>und</strong> e<strong>in</strong> Viertel des b<strong>und</strong>esdeutschen Umsatzes mit Mediz<strong>in</strong>technik<br />
erwirtschaftet. Das Ruhrgebiet nimmt hier e<strong>in</strong>e wichtige Position e<strong>in</strong>, denn es verfügt im Bereich des<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s über e<strong>in</strong>e sehr dichte Forschungs<strong>in</strong>frastruktur. Forschung f<strong>in</strong>det an den fünf Universitäten<br />
<strong>und</strong> acht Fachhochschulen, an den verschiedenen außeruniversitären Forschungs<strong>in</strong>stituten,<br />
<strong>in</strong> den Wissenschafts- <strong>und</strong> Forschungszentren, <strong>in</strong> den Technologiezentren sowie <strong>in</strong> Unternehmen statt.<br />
Das mediz<strong>in</strong>technische Forschungs- <strong>und</strong> Innovationspotenzial der Region ist enorm hoch. Bochum sei<br />
hierfür nur als e<strong>in</strong> Beispiel angeführt: In Bochum tragen <strong>in</strong>sbesondere die mediz<strong>in</strong>ische Fakultät der<br />
Ruhruniversität Bochum <strong>und</strong> ihre Universitätskl<strong>in</strong>iken (darunter die größte Unfallkl<strong>in</strong>ik der Welt<br />
”Bergmannsheil Bochum”), andere akademische Lehrkrankenhäuser sowie die <strong>in</strong>genieurwissenschaftlichen<br />
Fakultäten für Elektrotechnik, Masch<strong>in</strong>enbau <strong>und</strong> zwei Sonderforschungsbereiche auf dem Gebiet<br />
der Mediz<strong>in</strong> zur Profilierung als mediz<strong>in</strong>technischer Standort im mittleren Ruhrgebiet bei. Da die<br />
praxisorientierte Umsetzung von Vorhaben der Forschung <strong>und</strong> Entwicklung gerade für Gründungen<br />
aus der Hochschule heraus e<strong>in</strong>e besondere wirtschaftliche Bedeutung hat, steht <strong>in</strong> dem der Hochschule<br />
benachbarten Technologiezentrum Ruhr (TZR) jungen sowie etablierten kle<strong>in</strong>en <strong>und</strong> mittleren Unternehmen<br />
im Bereich der Mediz<strong>in</strong>technik e<strong>in</strong> umfangreiches Beratungs- <strong>und</strong> Dienstleistungsangebot zur<br />
Verfügung, das von der F<strong>in</strong>anzierungs- <strong>und</strong> Förderungsberatung bei mediz<strong>in</strong>technischen Projekten bis<br />
h<strong>in</strong> zur Kontaktvermittlung zur Universität <strong>und</strong> zu mediz<strong>in</strong>technisch orientierten Unternehmen reicht.<br />
Derzeit s<strong>in</strong>d im TZR 13 mediz<strong>in</strong>technische Unternehmen ansässig, die <strong>in</strong> verschiedensten Bereichen<br />
tätig s<strong>in</strong>d, so z.B. im Vertrieb von Diagnosemethoden, <strong>in</strong> der Entwicklung biomediz<strong>in</strong>ischer Verfahren<br />
<strong>und</strong> Dienstleistungen, <strong>in</strong> der Durchführung molekulargenetischer Diagnostik oder <strong>in</strong> der Entwicklung<br />
- 163 -
Regionalstudie Ruhrgebiet<br />
von Hard- <strong>und</strong> Software im Bereich der Mediz<strong>in</strong>technik. Bochum versteht sich somit als der Standort<br />
für Unternehmensgründungen <strong>und</strong> Innovationskraft <strong>in</strong> der Mediz<strong>in</strong>technik im mittleren Ruhrgebiet.<br />
Neben dem Technologiezentrum Ruhr an der Ruhruniversität Bochum setzen auch der Wissenschaftspark<br />
Gelsenkirchen sowie die Technologiezentren <strong>in</strong> Castrop-Rauxel, Duisburg, Hamm, Essen<br />
<strong>und</strong> Schwerte auf Technik <strong>und</strong> Dienstleistungen im Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Mediz<strong>in</strong>bereich. Die Schwerpunkte<br />
der mediz<strong>in</strong>technischen Unternehmen dieser Zentren sowie die Forschungsschwerpunkte an<br />
den Universitäten, Fachhochschulen <strong>und</strong> Forschungs<strong>in</strong>stituten s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> Spiegelbild der bestehenden<br />
Struktur der Ges<strong>und</strong>heitsversorgung: Das Institut für Gerontologie, e<strong>in</strong> An-Institut der Universität<br />
Dortm<strong>und</strong>, das Institut für Hygiene, Sozial- <strong>und</strong> Umweltmediz<strong>in</strong> der Ruhr-Universität Bochum, das<br />
Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie <strong>in</strong> Dortm<strong>und</strong> oder das Institut für Arbeitsphysiologie<br />
der Universität Dortm<strong>und</strong> s<strong>in</strong>d hierfür Beispiele.<br />
Unternehmensstrukturen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s im Ruhrgebiet<br />
Die Zahl der im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> tätigen Unternehmen im produzierenden Gewerbe wie im Dienstleistungsbereich<br />
ist im Ruhrgebiet sehr hoch. Die Hoppenstedt Firmendatenbank weist für den Bereich<br />
der mittelständischen <strong>und</strong> großen Unternehmen - d.h. für Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen<br />
bzw. mit e<strong>in</strong>em Umsatz von mehr als DM 2 Mio. jährlich <strong>und</strong> Unternehmen ab 150 Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen<br />
bzw. e<strong>in</strong>em jährlichen Umsatz ab DM 20 Mio. - alle<strong>in</strong> unter dem Stichwort<br />
”Mediz<strong>in</strong>technik” im Ruhrgebiet r<strong>und</strong> 100 Unternehmen aus. Unter diesen Unternehmen, die <strong>in</strong> der<br />
Produktion <strong>und</strong> im Dienstleistungssektor tätig s<strong>in</strong>d, f<strong>in</strong>den sich sowohl Unternehmen, die ausschließlich<br />
auf den Bereich der Mediz<strong>in</strong>technik spezialisiert s<strong>in</strong>d als auch Unternehmen, die noch auf anderen<br />
Unternehmensfeldern aktiv s<strong>in</strong>d. Die mediz<strong>in</strong>technischen Mittel- <strong>und</strong> Großunternehmen s<strong>in</strong>d auf nahezu<br />
alle Städte des Ruhrgebietes verteilt, haben ihren räumlichen Scherpunkt allerd<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> den vier<br />
großen Städten der Hellwegzone Duisburg, Essen, Bochum <strong>und</strong> Dortm<strong>und</strong>. Die Palette der im Bereich<br />
Mediz<strong>in</strong>technik angebotenen Produkte <strong>und</strong> Dienstleistungen ist außerordentlich vielfältig: Sie reicht<br />
von der Herstellung <strong>und</strong> dem Vertrieb von Gasen für den mediz<strong>in</strong>ischen Bereich <strong>und</strong> das kl<strong>in</strong>ische<br />
Labor über die Herstellung von allgeme<strong>in</strong>en Instrumenten <strong>und</strong> Geräten zur Untersuchung, Behandlung<br />
<strong>und</strong> Operation des Auges, die Herstellung von Medikamenten-Kühlschränken, Kühlvitr<strong>in</strong>en für Krankenhausküchen,<br />
die Fabrikation <strong>und</strong> den Handel mit textilem Krankenhausbedarf <strong>und</strong> Spezialmöbeln<br />
für Kl<strong>in</strong>iken, die Herstellung von chirurgischen Instrumenten, Apparaten <strong>und</strong> Implantaten, den Export<br />
von Gütern im Bereich Mediz<strong>in</strong>technik bis zum EDV-Service <strong>in</strong> der Krankenhausverwaltung. Die<br />
zahlenmäßige Verteilung der Unternehmen zeigt e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>deutigen Schwerpunkt im produzierenden<br />
Bereich: hier s<strong>in</strong>d etwa zwei Drittel aller Unternehmen tätig, nur e<strong>in</strong> Drittel dagegen im Dienstleistungssektor.<br />
Die Entwicklungs- bzw. Arbeitsplatzschaffungspotenziale der im Bereich der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft<br />
tätigen Unternehmen sche<strong>in</strong>en dabei - wie e<strong>in</strong>zelne Erfolgsstories zeigen – beträchtlich<br />
zu se<strong>in</strong>: Der Arbeitsplatz<strong>in</strong>vestor-Preis wurde 1998 dem im November 1996 <strong>in</strong> Essen gegründeten<br />
Deutschen Dienstleistungszentrum für das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> (DDG) verliehen, das die Zahl se<strong>in</strong>er<br />
Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Mitarbeiter <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Jahres von 120 auf knapp 750 erhöhte.<br />
- 164 -
Regionalstudie Ruhrgebiet<br />
Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung <strong>in</strong> den Ges<strong>und</strong>heitsberufen <strong>und</strong><br />
im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
Die Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erfasst die Erwerbstätigen, die nicht selbständig<br />
<strong>in</strong> eigener Praxis oder Apotheke, beamtet oder ger<strong>in</strong>gfügig beschäftigt s<strong>in</strong>d. Sie erlaubt zum<br />
e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>e Auswertung der Beschäftigungsentwicklung nach Berufsgruppen, zum anderen nach Wirtschaftszweigen.<br />
Um e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> die Beschäftigungsdynamik des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s im Ruhrgebiet<br />
zu gew<strong>in</strong>nen, wird im Folgenden für die qualifizierten Ges<strong>und</strong>heitsdienstberufe e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong><br />
den Wirtschaftszweig Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Veter<strong>in</strong>ärwesen andererseits die Beschäftigungsentwicklung<br />
der letzten Jahre skizziert.<br />
Die Auswertung der Beschäftigtenstatistik auf Ebene der Berufsgruppen zeigt, dass 1997 79 <strong>in</strong>sgesamt<br />
13.545 Ärzt<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ärzte sowie Apotheker/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> 108.695 Personen <strong>in</strong> den übrigen Ges<strong>und</strong>heitsdienstberufen<br />
im Ruhrgebiet sozialversicherungspflichtig beschäftigt s<strong>in</strong>d. Der Anteil der Ges<strong>und</strong>heitsdienstberufe<br />
an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten <strong>in</strong> der Region entspricht<br />
damit 7,8 %.<br />
Die Frauenanteile <strong>in</strong> den akademischen <strong>und</strong> den nichtakademischen Ges<strong>und</strong>heitsberufen 80 fallen dabei<br />
sehr unterschiedlich aus. Während unter den Ärzt/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Apotheker/<strong>in</strong>nen 45 % der sozialversicherungspflichtig<br />
Beschäftigten weiblich s<strong>in</strong>d, beträgt dieser Anteil <strong>in</strong> den übrigen Ges<strong>und</strong>heitsdienstberufen<br />
89 %. Die hohen Frauenanteile haben zur Folge, dass von allen sozialversicherungspflichtig<br />
Beschäftigten <strong>in</strong> NRW nur 2 % der Männer, aber 16 % der Frauen <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen tätig s<strong>in</strong>d.<br />
Tab. 54 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.1997 im Ruhrgebiet<br />
Männer<br />
Gesamtzahl im Ruhrgebiet<br />
Frauen Gesamt<br />
Ärzte <strong>und</strong> Apotheker 7.514 6.031 13.545<br />
Übrige Ges<strong>und</strong>heitsdienstberufe<br />
11.963 96.732 108.695<br />
<strong>in</strong> % von allen Beschäftigten im Ruhrgebiet<br />
Ärzte <strong>und</strong> Apotheker 0,8 0,9 0,9<br />
Übrige Ges<strong>und</strong>heitsdienstberufe<br />
1,3 15,1 6,9<br />
Quelle: LDS; Berechnung <strong>und</strong> Darstellung KVR<br />
E<strong>in</strong> Rückblick auf die Beschäftigungsentwicklung zeigt, dass trotz generellem Beschäftigungsabbau<br />
im Ruhrgebiet, das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> zu den Branchen zählt, <strong>in</strong> denen neue Arbeitsplätze entstanden<br />
s<strong>in</strong>d. So ist <strong>in</strong>sgesamt die Beschäftigtenzahl zwischen 1985 <strong>und</strong> 1997 im Ruhrgebiet um 3,2 % (-<br />
51.331 Personen) zurückgegangen. Demgegenüber ist im gleichen Zeitraum die Zahl der sozialversicherungspflichtig<br />
beschäftigten Ärzt/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Apotheker/<strong>in</strong>nen um 56 % angestiegen, Bei den übrigen<br />
Ges<strong>und</strong>heitsdienstberufen ist bis 1997 e<strong>in</strong>e Zunahme um etwa 35.000 Beschäftigte (47,5 %) fest-<br />
79 Wegen der Untererfassung der Ärzt<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ärzte durch das LDS im Jahr 1998 muss bei der Analyse der<br />
Berufsgruppen auf Daten von 1997 zurückgegriffen werden.<br />
80 Unter die übrigen Ges<strong>und</strong>heitsdienstberufe fallen Heilpraktiker/<strong>in</strong>nen, Masseur/<strong>in</strong>nen, Krankengymnast/<strong>in</strong>nen,<br />
Krankenschwestern, Krankenpfleger, Hebammen, Helfer/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> der Krankenpflege, Diätassistent/<strong>in</strong>nen,<br />
pharmazeutisch-technische Assistent/<strong>in</strong>nen, Sprechst<strong>und</strong>enhelfer/<strong>in</strong>nen sowie Mediz<strong>in</strong>allaborant/<strong>in</strong>nen.<br />
- 165 -
Regionalstudie Ruhrgebiet<br />
zustellen. Die übrigen Ges<strong>und</strong>heitsdienstberufe gehören damit absolut zu den Berufsgruppen mit dem<br />
größten Beschäftigtenzuwachs <strong>und</strong> dem schnellsten Wachstumstempo seit 1985. Dieser rasante Anstieg<br />
der Beschäftigtenzahl ist <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie den weiblichen Beschäftigten zugute gekommen: Von<br />
den zusätzlichen mehr als 35.000 Beschäftigten <strong>in</strong> den übrigen Ges<strong>und</strong>heitsdienstberufen s<strong>in</strong>d über<br />
30.000 Frauen. Die Zahl der Ärzt<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Apotheker<strong>in</strong>nen ist um etwa 3.000 Beschäftigte angestiegen<br />
<strong>und</strong> hat sich damit <strong>in</strong>nerhalb von 12 Jahren nahezu verdoppelt.<br />
Tab. 55 Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
(Ruhrgebiet 1985 bis 1997)<br />
Männer Frauen Gesamt<br />
Gesamtzahl im Ruhrgebiet<br />
Ärzte <strong>und</strong> Apotheker 1.891 2.979 4.870<br />
Übrige Ges<strong>und</strong>heitsdienstberufe<br />
4.630 30.389 35.019<br />
Alle Berufsgruppen -132.630 81.299 -51.331<br />
Gesamtzahl im Ruhrgebiet <strong>in</strong> %<br />
Ärzte <strong>und</strong> Apotheker 33.6 97,6 56,1<br />
Übrige Ges<strong>und</strong>heitsdienstberufe<br />
63,1 45,8 47,5<br />
Alle Berufsgruppen -12,4 14,6 -3,2<br />
Quelle: LDS; Berechnung <strong>und</strong> Darstellung KVR<br />
Die Beschäftigtenstatistik erlaubt neben der Analyse der Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> verschiedenen<br />
Berufszweigen auch Aussagen zur Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung <strong>in</strong><br />
unterschiedlichen Wirtschaftszweigen. Dabei erfolgt e<strong>in</strong>e Zuordnung der Beschäftigten nach der wirtschaftssystematischen<br />
Zuordnung der Institution/ des Unternehmens, bei der die Beschäftigten tätig<br />
s<strong>in</strong>d, unabhängig vom ausgeübten Beruf. Die folgenden Ausführungen beziehen sich somit nicht nur<br />
auf Angehörige der Ges<strong>und</strong>heitsberufe, sondern auf alle Beschäftigten, die <strong>in</strong> den Kernsektoren des<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s, den Krankenhäusern, Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen sowie <strong>in</strong> der<br />
ambulanten Versorgung, tätig s<strong>in</strong>d.<br />
Innerhalb des Wirtschaftszweiges „Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Veter<strong>in</strong>ärwesen“ dom<strong>in</strong>ieren die verschiedenen<br />
Versorgungsbereiche des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s mit e<strong>in</strong>em Anteil von 99,5 %. 1997 arbeiten im Ruhrgebiet<br />
126.960 Beschäftigte im Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Veter<strong>in</strong>ärwesen, das s<strong>in</strong>d r<strong>und</strong> 8,1 % aller Beschäftigten<br />
im Ruhrgebiet. Damit s<strong>in</strong>d im Ruhrgebiet anteilig mehr Personen <strong>in</strong> dieser Branche beschäftigt als<br />
im Landesmittel. Abb. 35 veranschaulicht allerd<strong>in</strong>gs, dass der Anteil der Beschäftigten im Wirtschaftszweig<br />
Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Veter<strong>in</strong>ärwesen zwischen den e<strong>in</strong>zelnen Kreisen <strong>und</strong> kreisfreien Städten<br />
im Ruhrgebiet stark schwankt. So arbeiten <strong>in</strong> Herne <strong>und</strong> Hamm mehr als 10 % aller Beschäftigten<br />
im Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Veter<strong>in</strong>ärwesen, <strong>in</strong> Mülheim dagegen nur 6 %. 83 % der Beschäftigten s<strong>in</strong>d<br />
weiblich, ferner zeichnet sich die Branche durch e<strong>in</strong>en überdurchschnittlichen Anteil an jungen Beschäftigten<br />
<strong>und</strong> an Auszubildenden aus.<br />
- 166 -
Regionalstudie Ruhrgebiet<br />
Abb. 35 Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Veter<strong>in</strong>ärwesen<br />
an allen Beschäftigten <strong>in</strong> den Kreisen <strong>und</strong> kreisfreien Städten des Ruhrgebiets<br />
1997 <strong>in</strong> %<br />
Herne<br />
Hamm<br />
Kreis Reckl<strong>in</strong>ghausen<br />
Oberhausen<br />
Kreis Wesel<br />
Duisburg<br />
Ruhrgebiet<br />
Ennepe-Ruhr-Kreis<br />
Bottrop<br />
Gelsenkirchen<br />
Bochum<br />
Essen<br />
Hagen<br />
Dortm<strong>und</strong><br />
NRW<br />
Kreis Unna<br />
Mülheim<br />
0 2 4 6 8 10 12<br />
Quelle: LDS; Berechnung <strong>und</strong> Darstellung KVR<br />
Zwischen 1985 <strong>und</strong> 1997 ist der Wirtschaftszweig Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Veter<strong>in</strong>ärwesen im Ruhrgebiet<br />
expandiert, die Zahl der Beschäftigten hat sich um fast 40 % erhöht. Die Branche wächst auch bis<br />
1999 relativ kont<strong>in</strong>uierlich <strong>und</strong> konjunkturunabhängig, wenn auch mit ger<strong>in</strong>gerer Dynamik. Damit<br />
vollzieht sich im Ruhrgebiet e<strong>in</strong>e Entwicklung ähnlich dem Landesdurchschnitt.<br />
Insgesamt ist für den Zeitraum zwischen 1985 <strong>und</strong> 1999 <strong>in</strong> den Kernsektoren der ges<strong>und</strong>heitlichen<br />
Versorgung e<strong>in</strong> Beschäftigungszuwachs im Ruhrgebiet um fast 35.000 Personen zu verzeichnen, wobei<br />
<strong>in</strong> den Kreisen das größte relative Wachstum erfolgt ist. So konnte alle<strong>in</strong> der Kreis Reckl<strong>in</strong>ghausen<br />
im Betrachtungszeitraum e<strong>in</strong>en Beschäftigungszuwachs von 4.700 Personen verbuchen. Er hat sich<br />
damit h<strong>in</strong>sichtlich der Bedeutung des Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Veter<strong>in</strong>ärwesens <strong>und</strong> des Wachstumstempos<br />
an e<strong>in</strong>e Spitzenposition im Ruhrgebiet gebracht.<br />
- 167 -
Regionalstudie Ruhrgebiet<br />
Abb. 36 Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Im Ruhrgebiet<br />
im Wirtschaftszweig „Ges<strong>und</strong>heit- <strong>und</strong> Veter<strong>in</strong>ärwesen“ 1985 - 1999<br />
140000<br />
120000<br />
100000<br />
80000<br />
60000<br />
40000<br />
20000<br />
0<br />
19<br />
85<br />
19<br />
86<br />
19<br />
88<br />
19<br />
90<br />
19<br />
92<br />
19<br />
93<br />
Quelle: LDS; Berechnung <strong>und</strong> Darstellung KVR<br />
19<br />
94<br />
19<br />
95<br />
Mithilfe der überarbeiteten Wirtschaftszweigsystematik der B<strong>und</strong>esanstalt für Arbeit lassen sich daneben<br />
für 1999 folgende Strukturmerkmale des Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Veter<strong>in</strong>ärwesens für das Ruhrgebiet<br />
feststellen: Die Mehrheit der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten <strong>in</strong> den Kernsektoren des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s<br />
arbeitet <strong>in</strong> Krankenhäusern (67 %). 18 % der Beschäftigten s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Arztpraxen, 9 %<br />
<strong>in</strong> Zahnarztpraxen <strong>und</strong> 7 % im sonstigen <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> tätig. Dabei unterscheidet sich das Ruhrgebiet<br />
kaum vom Landesdurchschnitt.<br />
Beschäftigung im Ges<strong>und</strong>heitshandwerk<br />
24 % aller nordrhe<strong>in</strong>-westfälischen Handwerksbetriebe bef<strong>in</strong>den sich im Ruhrgebiet. Mit branchenübergreifend<br />
<strong>in</strong>sgesamt 24.770 Betriebe verfügt die Region gegenüber anderen Landesteilen damit<br />
über e<strong>in</strong>e vergleichsweise ger<strong>in</strong>ge Zahl an selbständigen Handwerksunternehmen. Im Bereich des<br />
Ges<strong>und</strong>heitshandwerks f<strong>in</strong>den sich jedoch alle<strong>in</strong> 527 Augenoptikbetriebe mit <strong>in</strong>sgesamt etwas über<br />
3.100 Beschäftigten <strong>und</strong> 473 Zahntechnikunternehmen mit etwas über 6.000 Beschäftigten. Die Anteile<br />
beider Sparten an allen Handwerksunternehmen liegen damit im Ruhrgebiet über dem landesweiten<br />
Durchschnitt. Bezüglich der durchschnittlichen Beschäftigtenzahl pro Betrieb gehören die Augenoptiker/<strong>in</strong>nen<br />
zu den Zweigen mit e<strong>in</strong>er relativ ger<strong>in</strong>gen Zahl an Beschäftigten: 5,9 Beschäftigte je<br />
Betrieb s<strong>in</strong>d im Ruhrgebiet wie auch <strong>in</strong> NRW tätig. Die zahntechnischen Handwerksbetriebe im Ruhrgebiet<br />
s<strong>in</strong>d dagegen mit e<strong>in</strong>er durchschnittlichen Beschäftigtenzahl von 12,8 Personen deutlich größer<br />
als im Land NRW mit 11,6 Personen je Betrieb.<br />
- 168 -<br />
19<br />
96<br />
19<br />
97<br />
19<br />
98<br />
19<br />
99
Ausbildung <strong>in</strong> Betrieben <strong>und</strong> Hochschulen<br />
Regionalstudie Ruhrgebiet<br />
Auch unter bildungspolitischer Perspektive ist das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> im Ruhrgebiet e<strong>in</strong> entscheidender<br />
Faktor. Alle<strong>in</strong> im Ausbildungsjahr 1998/99 haben 2.558 Auszubildende e<strong>in</strong>e Ausbildung <strong>in</strong> den<br />
Berufsgruppen pharmazeutisch-kaufmännische(r) Angestellte(r) (277 Personen), Arzthelfer<strong>in</strong> (1.389<br />
Personen) <strong>und</strong> Zahnarzthelfer<strong>in</strong> (892 Personen) begonnen. Das s<strong>in</strong>d zusammen r<strong>und</strong> 7 % aller Auszubildenden.<br />
Gegenüber 1990/91 ist die Bedeutung der dualen Ausbildung allerd<strong>in</strong>gs <strong>in</strong>sgesamt rückläufig,<br />
am stärksten betroffen s<strong>in</strong>d die Berufsgruppen pharmazeutisch-kaufmännische(r) Angestellte(r)<br />
<strong>und</strong> Arzthelfer<strong>in</strong>. Hier liegt der Abbau der Ausbildungsmöglichkeiten im Ruhrgebiet über dem Landesdurchschnitt.<br />
An den Hochschulen des Ruhrgebietes studieren 4.747 Personen Humanmediz<strong>in</strong>, davon 4.546 allgeme<strong>in</strong>e<br />
Mediz<strong>in</strong> <strong>und</strong> 183 Zahnmediz<strong>in</strong>. Damit f<strong>in</strong>den sich 25 % aller nordrhe<strong>in</strong>westfälischen Student/<strong>in</strong>nen<br />
der Humanmediz<strong>in</strong> im Ruhrgebiet, <strong>und</strong> zwar an den Studienstandorten Bochum (2.385<br />
Studierende), Essen (1.917) <strong>und</strong> Witten/Herdecke (445). Da das Studium der Zahnmediz<strong>in</strong> nur an der<br />
Privatuniversität Witten/ Herdecke möglich ist, f<strong>in</strong>den sich 1998/99 nur 7 % der landesweiten Studienplätze<br />
<strong>in</strong> Zahnmediz<strong>in</strong> im Ruhrgebiet.<br />
5.1.3.2. Perspektiven für das Ruhrgebiet<br />
Von der <strong>in</strong> allen hochentwickelten Industriegesellschaften zu beobachtenden Zunahme der Alterung<br />
der Gesellschaft aufgr<strong>und</strong> steigender Lebenserwartung <strong>und</strong> s<strong>in</strong>kender Geburtenzahlen ist auch das<br />
Ruhrgebiet betroffen. Die Bevölkerungszahlen s<strong>in</strong>d dadurch <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> den Städten rückläufig,<br />
h<strong>in</strong>zu kommen noch die Wanderungen aus den Ballungskernen <strong>in</strong> die Ballungsränder. So verlieren<br />
alle<strong>in</strong> 1998 die kreisfreien Städte im Ruhrgebiet über 9.000 E<strong>in</strong>wohner<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> E<strong>in</strong>wohner durch<br />
niedrige Geburten- <strong>und</strong> hohe Sterbefallzahlen <strong>und</strong> knapp 16.000 wegen Abwanderung. 1997 betrug<br />
der Wanderungsverlust r<strong>und</strong> 10.000 Personen, 1996 r<strong>und</strong> 6.000 Personen. Aber auch die Städte <strong>und</strong><br />
Kreise im Ballungsrand schrumpfen aufgr<strong>und</strong> s<strong>in</strong>kender Geburtenzahlen. Dadurch s<strong>in</strong>d die Anteile der<br />
Älteren an der Gesamtbevölkerung im Ruhrgebiet bereits jetzt vergleichsweise hoch: 1998 s<strong>in</strong>d im<br />
Ruhrgebiet 17,6 % der Bevölkerung 65 Jahre oder älter, <strong>in</strong> NRW nur 16,3 %.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs ist im Ruhrgebiet bis zum Jahr 2010 nicht mit e<strong>in</strong>er weiteren starken Zunahme der Zahl<br />
älterer E<strong>in</strong>wohner<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> E<strong>in</strong>wohner zu rechnen: Zwar wird die Bevölkerungszahl im Ruhrgebiet <strong>in</strong><br />
den nächsten 10 Jahren weiter s<strong>in</strong>ken, wenn nicht durch e<strong>in</strong>e unerwartet große Zuwanderung dieser<br />
Trend umgekehrt wird. Bis 2010 wird die Zahl der E<strong>in</strong>wohner<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> E<strong>in</strong>wohner im Ruhrgebiet um<br />
mehr als 250.000 Personen zurückgehen (-5 %), was fast ausschließlich auf den Bevölkerungsrückgang<br />
<strong>in</strong> den Großstädten zurückzuführen ist. Landesweit beträgt der Bevölkerungsrückgang demgegenüber<br />
nur 0,4 %. Die Zahl der Personen im Alter von 60 <strong>und</strong> mehr Jahren steigt allerd<strong>in</strong>gs im Ruhrgebiet<br />
kaum (+0,6 %), im Land dagegen deutlich (+6,4 %) an.<br />
Die absolute Zahl der Älteren im Ruhrgebiet wird sich somit <strong>in</strong>sgesamt nur ger<strong>in</strong>gfügig erhöhen. Allerd<strong>in</strong>gs<br />
liegt ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung aufgr<strong>und</strong> des ausgeprägten Bevölkerungsrückgangs<br />
auch 2010 deutlich über dem Landesdurchschnitt. Er steigt von 23,8 % <strong>in</strong> 1998 auf 25,2 % <strong>in</strong><br />
2010 <strong>und</strong> liegt damit über dem Landesmittel von 23,9 % <strong>in</strong> 2010.<br />
- 169 -
Regionalstudie Ruhrgebiet<br />
Durch die relative Konstanz der absoluten Zahl Älterer entstehen für das Ruhrgebiet weniger tiefgreifende<br />
neue Anforderungen an das <strong>Arbeitsmarkt</strong>-, Renten- <strong>und</strong> Sozialleistungssystem als <strong>in</strong> anderen<br />
Landesteilen NRWs. Die E<strong>in</strong>kommensverteilung im Ruhrgebiet mit ihren Folgen für das monetäre<br />
Potenzial der Nachfrage nach Ges<strong>und</strong>heitsangeboten konterkariert diese Entwicklung allerd<strong>in</strong>gs möglicherweise:<br />
Da überdurchschnittlich viele Personen im Alter von 60 <strong>und</strong> mehr Jahren über sehr niedrige<br />
<strong>und</strong> unterdurchschnittlich viele Ältere über mittlere Nettoe<strong>in</strong>kommen verfügen, ist davon auszugehen,<br />
dass die Verschiebung der Kosten der Risikoabsicherung auf den E<strong>in</strong>zelnen <strong>und</strong> die Zunahme<br />
privater Vorsorge von e<strong>in</strong>em Großteil der Älteren nicht getragen werden können <strong>und</strong> somit zum<strong>in</strong>dest<br />
das Sozialleistungssystem auch weiterh<strong>in</strong> stark oder möglicherweise verstärkt <strong>in</strong> Anspruch genommen<br />
werden wird. Überdurchschnittlich viele Ältere mit hohen Nettoe<strong>in</strong>kommen h<strong>in</strong>gegen lassen zum<strong>in</strong>dest<br />
für diesen Teil der Bevölkerung e<strong>in</strong>e zunehmende Nachfrage nach Ges<strong>und</strong>heitsprodukten <strong>und</strong><br />
-dienstleistungen, verb<strong>und</strong>en mit der Möglichkeit der privaten F<strong>in</strong>anzierung derselben, vermuten. So<br />
ist im Ruhrgebiet <strong>in</strong> den nächsten 10 Jahren nicht generell mit e<strong>in</strong>er demographisch oder wohlstandsbed<strong>in</strong>gten<br />
Steigerung der Nachfrage der Endverbraucher/<strong>in</strong>nen nach Ges<strong>und</strong>heitsdiensten zu rechnen.<br />
Hieraus leitet sich die Notwendigkeit des Ausbaus kostengünstiger Versorgungs- <strong>und</strong> Dienstleistungsangebote<br />
ab.<br />
Szenario Nr.1<br />
Wenn das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> weiterh<strong>in</strong> nur als Kostenfaktor behandelt wird <strong>und</strong> nicht als wirtschaftliches<br />
Potenzial, dann ist zu erwarten, dass es zu e<strong>in</strong>er weiteren Privatisierung der mit der mediz<strong>in</strong>ischen<br />
Versorgung verb<strong>und</strong>enen Kosten kommen wird mit der Folge, dass Teile der Bevölkerung vom<br />
Ges<strong>und</strong>heitssystem ausgegrenzt werden. Soziale Polarisierungen, denen bislang gezielt entgegen gesteuert<br />
wurde, würden damit erheblich zunehmen. Das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> im Ruhrgebiet stünde dann<br />
im Wesentlichen für die Gr<strong>und</strong>versorgung zur Verfügung, e<strong>in</strong>ige wenige hochspezialisierte Spitzenärzte<br />
kämen ggf. h<strong>in</strong>zu. Der Abbau von Arbeitsplätzen <strong>in</strong> der direkten mediz<strong>in</strong>ischen Versorgung wäre<br />
zwangsläufig die Folge. Mit reduzierten Forschungs- <strong>und</strong> Entwicklungsmitteln würden auch potenziell<br />
marktfähige Produkte <strong>und</strong> Verfahren seltener entwickelt bzw. zur Marktreife gelangen. Damit würden<br />
auch die vor- <strong>und</strong> nachgelagerten Branchen aus den Bereichen der Technik, Werkstoffk<strong>und</strong>e, Gerätebau,<br />
Pharmazeutik, Hard- <strong>und</strong> Softwareentwicklung, Handwerk u.a. schlechtere Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
<strong>und</strong> Absatzmöglichkeiten vorf<strong>in</strong>den. Im Ruhrgebiet würde dies e<strong>in</strong>erseits zu schlechteren Lebensbed<strong>in</strong>gungen<br />
für die Bevölkerung führen, andererseits würde das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> auf das Notwendigste<br />
reduziert, was alle Hoffnungen auf neue Arbeitsplätze oder zum<strong>in</strong>dest auf den Erhalt der Arbeitsplätze<br />
im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> zunichte machen würde.<br />
Szenario Nr. 2<br />
Wenn das Ruhrgebiet Modellregion für Qualitäts- <strong>und</strong> Kostenoptimierung im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> wird<br />
<strong>und</strong> sich e<strong>in</strong>e effektive - aber nicht billige - Behandlung aller kranken Menschen zum Leitziel setzt,<br />
dann würde damit nicht nur die Lebensqualität <strong>in</strong> der Region steigen, sondern auch die Zahl der Ar-<br />
- 170 -
Regionalstudie Ruhrgebiet<br />
beitsplätze <strong>und</strong> die Potenziale für die kommerzielle Erschließung neuer Märkte für die mediz<strong>in</strong>ische<br />
Versorgung. Voraussetzungen hierzu wären:<br />
• Erhöhung der öffentlichen Aufwendungen für Forschung <strong>und</strong> Entwicklung im Bereich Schutz <strong>und</strong><br />
Förderung der menschlichen Ges<strong>und</strong>heit (im EU-Vergleich liegt Deutschland mit se<strong>in</strong>em Anteil an<br />
allen F&E-Mitteln <strong>in</strong> diesem Bereich bei e<strong>in</strong>em Viertel des Anteils von Großbritannien <strong>und</strong> der<br />
Hälfte des Anteils von Italien);<br />
• e<strong>in</strong>e stärkere Kooperation der verschiedenen mediz<strong>in</strong>ischen Fachrichtungen untere<strong>in</strong>ander, mit<br />
benachbarten wissenschaftlichen <strong>und</strong> technischen Fachrichtungen (Biologie, Umweltwissenschaften,<br />
Ingenieurwissenschaften), mit Entwicklern <strong>und</strong> Herstellern mediz<strong>in</strong>ischer Produkte <strong>und</strong> Verfahren,<br />
damit das vorhandene Wissen schneller <strong>und</strong> besser e<strong>in</strong>gesetzt werden kann;<br />
• Wertewandel <strong>in</strong> den Köpfen der im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> wirkenden Akteure, um das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
als Wachstumsmarkt mit Beschäftigungs- <strong>und</strong> Exportmöglichkeiten zu verstehen;<br />
• Wertewandel auch <strong>in</strong> den Köpfen der wirtschaftlichen Akteure aus Unternehmen, Politik <strong>und</strong> Wirtschaftsförderung,<br />
um generell den Fokus stärker auf den Dienstleistungssektor <strong>und</strong> speziell auf das<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> zu lenken, damit im Ruhrgebiet nicht mehr nur die Stabilisierung der Montan<strong>in</strong>dustrie,<br />
sondern verstärkt der Aufbau e<strong>in</strong>er zukunftsfähigen Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft Leitl<strong>in</strong>ie des<br />
Handelns werden kann;<br />
• Ermittlung, Bündelung, zielgerichtete Förderung <strong>und</strong> Vermarktung der besonderen Stärken der<br />
Region im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>.<br />
Für die Entwicklung zu e<strong>in</strong>er Modellregion für Qualitäts- <strong>und</strong> Kostenoptimierung im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
weist das Ruhrgebiet e<strong>in</strong>e Vielzahl guter Ausgangsvoraussetzungen <strong>und</strong> ungenutzter Potenziale<br />
auf, die es gezielt zu fördern gilt:<br />
• Die mediz<strong>in</strong>ische Versorgungslandschaft im Ruhrgebiet ist zwar relativ dicht, die mediz<strong>in</strong>ischen<br />
Spezialisierungen s<strong>in</strong>d allerd<strong>in</strong>gs nicht so vielfältig wie <strong>in</strong> anderen Regionen <strong>und</strong> haben <strong>in</strong>sbesondere<br />
nicht deren lange Tradition. Dies schlägt sich unter anderem <strong>in</strong> dem vergleichsweise schlechteren<br />
Ruf der ärztlichen <strong>und</strong> wissenschaftlichen Tätigkeit im Ruhrgebiet nieder.<br />
• In der Forschungs<strong>in</strong>frastruktur f<strong>in</strong>det die mediz<strong>in</strong>ische Versorgungslandschaft im Ruhrgebiet e<strong>in</strong>e<br />
gute Entsprechung, so dass mediz<strong>in</strong>ische Spezialisierungstendenzen des Ges<strong>und</strong>heitssektors im<br />
Ruhrgebiet durch die Entwicklungen <strong>in</strong> den Bereichen Forschung <strong>und</strong> Technologie unterstützt<br />
werden. Insgesamt verfügt das Ruhrgebiet über e<strong>in</strong>e durchaus beachtliche mediz<strong>in</strong>technische Entwicklungs-<br />
<strong>und</strong> Forschungslandschaft, die – <strong>in</strong>novativ, rege <strong>und</strong> expansionsfreudig – <strong>in</strong>sbesondere<br />
unter dem Gesichtspunkt der Schaffung von Arbeitsplätzen im High-Tech-Bereich von Interesse<br />
ist.<br />
• Kooperationsbeziehungen, wie sie <strong>in</strong> der <strong>in</strong>dustriellen Landschaft bekannt s<strong>in</strong>d, gibt es zwischen<br />
den e<strong>in</strong>zelnen Segmenten der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft, so z.B. zwischen Forschungse<strong>in</strong>richtungen,<br />
Herstellern, Anwendern etc. nicht oder kaum. Die Transparenz über das Leistungsspektrum der<br />
Unternehmen <strong>und</strong> Institutionen lässt bislang zu wünschen übrig, e<strong>in</strong>en <strong>in</strong>tensiven Dialog zwischen<br />
Forschern, Herstellern <strong>und</strong> Anwendern gibt es nicht. Ursache hierfür ist vermutlich, dass der<br />
- 171 -
Regionalstudie Ruhrgebiet<br />
Dienstleistungsbereich im Allgeme<strong>in</strong>en <strong>und</strong> die Branchen Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziales im Besonderen<br />
politisch nicht die Unterstützung <strong>und</strong> Förderung erfahren haben <strong>und</strong> erfahren, wie der produzierende<br />
Bereich. H<strong>in</strong>zu kommt, dass die zweifellos vorhandenen Potenziale sowie die hohe Professionalität<br />
im Ges<strong>und</strong>heitsbereich im Ruhrgebiet – v.a. aber nicht nur <strong>in</strong> den Krankenhäusern der Region<br />
- bislang nicht angemessen vermarktet wurden.<br />
Das Ruhrgebiet bietet mit se<strong>in</strong>er Vielzahl von Krankenhäusern, Praxen, Forschungs- <strong>und</strong> Technologiee<strong>in</strong>richtungen<br />
<strong>und</strong> Unternehmen große Potenziale. E<strong>in</strong> konkretes Profil als Ges<strong>und</strong>heitsregion ist<br />
bislang nur <strong>in</strong> Teilregionen des Ruhrgebietes ansatzweise zu erkennen, da e<strong>in</strong>e zielgerichtete Vernetzung<br />
bislang noch nicht stattgef<strong>und</strong>en hat. Obwohl maßgebliche Entwicklungen im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
staatlich bestimmt s<strong>in</strong>d, erfolgen diese Maßnahmen ohne regionales Leitbild <strong>und</strong> ohne konkretes regionales<br />
Entwicklungsziel. Die Entwicklungen im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> des Ruhrgebietes müssten daher<br />
von e<strong>in</strong>er stärker regional orientierten bzw. geprägten Sichtweise ausgehen <strong>und</strong> - aufbauend auf e<strong>in</strong>er<br />
Gr<strong>und</strong>versorgung vor Ort - teilregionale Spezialisierungen <strong>und</strong> Vernetzungen gezielt fördern.<br />
5.2. Fallstudie: Beschäftigungsentwicklung im niederländischen <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
Anja Hartmann (Ruhr-Universität Bochum) <strong>und</strong> Toon Kerkhoff (Universität Twente)<br />
Um neue Aufschlüsse über Beschäftigungstrends, Gestaltungsalternativen <strong>und</strong> -gefahren zu gew<strong>in</strong>nen,<br />
bietet sich e<strong>in</strong> <strong>in</strong>ternationaler Vergleich an. Die Wahl unseres ausländischen Referenzmodells ist nicht<br />
umsonst auf die Niederlande gefallen: Denn erstens verfügen die Niederlande ebenso wie die B<strong>und</strong>esrepublik<br />
über e<strong>in</strong> hochentwickeltes <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>, welches nicht nur 15,5 Mio. Menschen mit<br />
Ges<strong>und</strong>heitsdiensten versorgt, sondern auch e<strong>in</strong>en wichtigen Wirtschafts- <strong>und</strong> Beschäftigungsfaktor<br />
darstellt. Zweitens stellt das niederländische <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en <strong>in</strong>stitutionellen Strukturen<br />
e<strong>in</strong>e gute Vergleichsbasis für die B<strong>und</strong>esrepublik dar. Denn beiden Ländern ist nicht nur e<strong>in</strong> verhältnismäßig<br />
hohes Wohlfahrtsniveau geme<strong>in</strong>sam; sie verfügen auch - anders als beispielsweise das USamerikanische<br />
oder schwedische Modell - über korporatistisch gestaltete Ges<strong>und</strong>heitssysteme, die<br />
durch Parafiskalität <strong>und</strong> Selbstverwaltung gekennzeichnet s<strong>in</strong>d. Umso eher geraten im Kontext dieser<br />
<strong>in</strong>stitutionellen Geme<strong>in</strong>samkeiten die ‘fe<strong>in</strong>en Unterschiede’ <strong>in</strong> den Blick, die mögliche Differenzen <strong>in</strong><br />
der nationalen Beschäftigungsentwicklung treffender erklären können als dies bei gr<strong>und</strong>legend anders<br />
verfassten Systemen der Fall ist. Und drittens hat sich Holland im Bereich Beschäftigungs- <strong>und</strong> Sozialpolitik<br />
<strong>in</strong> den letzten Jahren den Ruf besonderer Reformfähigkeit erworben. Nicht zuletzt deshalb ist<br />
der deutsche Blick über die Grenze lohnenswert, um möglicherweise neue Anregungen für die hierzulande<br />
anvisierten ges<strong>und</strong>heitspolitischen Reformvorhaben zu gew<strong>in</strong>nen.<br />
Bevor en detail auf die Beschäftigungsentwicklung des niederländischen <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s e<strong>in</strong>gegangen<br />
wird, soll zunächst e<strong>in</strong>e kurze Skizzierung des Ges<strong>und</strong>heitssektors <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en Geme<strong>in</strong>samkeiten<br />
<strong>und</strong> Abgrenzungen zur B<strong>und</strong>esrepublik erfolgen. Den Auftakt bildet die Darstellung des Versiche-<br />
- 172 -
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Niederlande<br />
rungs- <strong>und</strong> Versorgungssektors, ergänzt durch e<strong>in</strong>en kurzen Überblick der <strong>in</strong> den letzten Jahren praktizierten<br />
Reformstrategien.<br />
5.2.1. Versicherungs- <strong>und</strong> Versorgungsstrukturen<br />
Die F<strong>in</strong>anzierung des niederländischen <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s erfolgt ähnlich wie <strong>in</strong> der BRD über drei<br />
Säulen (vgl. Müller 1999, Bos 1999, CPB 1997). 81 Die größte Säule ist das AWBZ (Algemene Wet<br />
Bijzondere Ziektekosten), welches Ende der 60er Jahre <strong>in</strong> Kraft trat - als Antwort auf den englischen<br />
Beveridge-Plan. Das AWBZ wird häufig als deutsches Äquivalent zur Pflegeversicherung bezeichnet,<br />
da es als Volksversicherung konzipiert ist, welches die gesamte Bevölkerung mite<strong>in</strong>schließt. Im Unterschied<br />
zur deutschen Pflegeversicherung ist es jedoch umfassender angelegt. Zu se<strong>in</strong>en Leistungen<br />
gehören langfristige häusliche Pflege, Krankenpflege für ältere Menschen, psychiatrische Behandlung<br />
<strong>und</strong> Pflege für Beh<strong>in</strong>derte - kurz Leistungen, die aufgr<strong>und</strong> ihres hohen Risikos schwer zu versichern<br />
s<strong>in</strong>d. Entsprechend beträgt der Anteil des AWBZ an den Ges<strong>und</strong>heitsausgaben 37%; der Beitrag liegt<br />
bei 10,25% des besteuerbaren E<strong>in</strong>kommens <strong>und</strong> wird über die E<strong>in</strong>kommenssteuer erhoben.<br />
Die zweite Säule bildet das ZFW (Ziekenfondswet), das der deutschen GKV entspricht (es wurde während<br />
der deutschen Besatzungsmacht zwangsimplementiert). Hierunter fallen ‘normale’ Ges<strong>und</strong>heitsleistungen,<br />
z.B. ärztliche Leistungen, Arzneimittel, stationäre Behandlung. Wesentliche Klientel s<strong>in</strong>d<br />
Arbeitnehmer sowie Empfänger von Lohnersatzleistungen. Der Beitrag ist e<strong>in</strong>kommensabhängig <strong>und</strong><br />
lag 1999 bei 7,4% (wobei die Arbeitgeber 5,85% tragen). H<strong>in</strong>zu kommt e<strong>in</strong> nom<strong>in</strong>aler Pauschbetrag<br />
pro Kopf, der je nach Krankenkasse zwischen 296 <strong>und</strong> 356 Gulden pro Jahr schwankt. Verwaltet <strong>und</strong><br />
durchgeführt wird das ZFW durch 49 Krankenkassen (ziekenfondsen). Derzeit s<strong>in</strong>d etwa 63% der niederländischen<br />
Bevölkerung durch das ZFW abgesichert; se<strong>in</strong> Anteil an den Ges<strong>und</strong>heitsausgaben liegt<br />
bei 36%.<br />
Die dritte Säule bilden die Privatversicherungen, die mit 37% weitaus mehr E<strong>in</strong>wohner e<strong>in</strong>schließen<br />
als dies <strong>in</strong> der BRD (<strong>und</strong> auch <strong>in</strong> ganz Europa) der Fall ist. 1999 betrug ihr Anteil an den Ges<strong>und</strong>heitsausgaben<br />
stolze 15%. Dieser hohe Anteil erklärt sich vor allem dadurch, dass e<strong>in</strong> Überschreiten der<br />
E<strong>in</strong>kommensgrenzen das Verbleiben im ZFW verbietet - die Möglichkeit e<strong>in</strong>er freiwilligen Weiterversicherung<br />
bei den ziekenfondsen besteht also nicht. Die daraus resultierende Relevanz des privaten<br />
Sektors hat gleichzeitig auch verstärkte staatliche Regulierung zur Folge. So s<strong>in</strong>d die PKVen seit 1986<br />
verpflichtet, Standardpolicen anzubieten, die an die Konditionen des ZFW angeglichen s<strong>in</strong>d (r<strong>und</strong><br />
14% aller Privatversicherten nutzen diese Möglichkeit). Darüber h<strong>in</strong>aus leisten die Privatversicherungen<br />
auch Transferleistungen an die ziekenfondsen als Ausgleich für den ger<strong>in</strong>geren Anteil an Risikogruppen.<br />
Die angestrebte Konvergenz zwischen ziekenfondsen <strong>und</strong> PKVen hatte außerdem e<strong>in</strong>e Reihe<br />
von Fusionen zur Folge sowie die E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>samen Interessenvertretung.<br />
Auf den ersten Blick verfügen die Niederlande also über e<strong>in</strong>e ähnliche Versicherungsstruktur wie das<br />
b<strong>und</strong>esdeutsche <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>. Allerd<strong>in</strong>gs ist die Mischung zwischen den drei Versicherungsvari-<br />
81 Über die hier angeführten Versicherungen h<strong>in</strong>aus bestehen weitere Säulen, darunter staatliche Zuschüsse<br />
(1999: 5%), private Zuzahlungen (1999: 7%) sowie die Beamten- <strong>und</strong> die betriebliche Absicherung.<br />
- 173 -
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Niederlande<br />
anten wesentlich ausgewogener als <strong>in</strong> Deutschland, wo die GKV mit über 80% der Ges<strong>und</strong>heitsausgaben<br />
die Versicherungslandschaft e<strong>in</strong>deutig dom<strong>in</strong>iert. Die Bedeutung, die das ZFW <strong>und</strong> die Privatversicherung<br />
als Ergänzung zur Volksversicherung AWBZ haben, spiegelt die Differenzen der generellen<br />
wohlfahrtspolitischen Ausrichtung <strong>in</strong> beiden Ländern wider. Im Unterschied zur konservativkorporatistisch<br />
geprägten B<strong>und</strong>esrepublik präsentieren sich die Niederlande nämlich eher als gemischter<br />
Wohlfahrtsstaat, der sich <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Genese nicht nur am deutschen Sicherungssystem á la<br />
Bismarck orientierte, sondern von jeher auch e<strong>in</strong>e starke Aff<strong>in</strong>ität zum englischen Beveridgemodell<br />
aufwies (vgl. Borchert 1998). Diese Mischung zwischen konservativen <strong>und</strong> liberalen Komponenten<br />
kommt im Ges<strong>und</strong>heitssystem <strong>in</strong> der Gleichwertigkeit zwischen AWBZ <strong>und</strong> ZFW zum Ausdruck. Sie<br />
ist auch der Gr<strong>und</strong> dafür, dass den ges<strong>und</strong>heitspolitischen Reformbemühungen etwas Paradoxes anhaftet,<br />
wie weiter unten noch auszuführen se<strong>in</strong> wird - Wettbewerb <strong>und</strong> Marktbewußtse<strong>in</strong> e<strong>in</strong>erseits,<br />
ausgeprägte staatliche Regulierung über Vorschriften <strong>und</strong> Gesetze andererseits.<br />
Auch der Versorgungssektor weist e<strong>in</strong>ige markante Unterschiede zum deutschen Ges<strong>und</strong>heitssystem<br />
auf (vgl. Royal Netherlands Embassy 1998). Geme<strong>in</strong>h<strong>in</strong> unterscheiden die Niederländer zwischen dem<br />
preventive sector, <strong>in</strong> dem Präventionse<strong>in</strong>richtungen (vor allem kommunale Ges<strong>und</strong>heitsdienste) angesiedelt<br />
s<strong>in</strong>d, dem primary sector, der alle ambulanten E<strong>in</strong>richtungen umfasst (hierzu gehören vor allem<br />
Hausärzte, Hebammen, Sozialdienste etc.), <strong>und</strong> dem secondary sector, der alle stationären E<strong>in</strong>richtungen<br />
be<strong>in</strong>haltet (Kl<strong>in</strong>iken <strong>und</strong> Pflegeheime). Der ambulante Sektor ist als E<strong>in</strong>stiegssektor <strong>in</strong> das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
konzipiert, der ggf. den weiteren Durchgang <strong>in</strong> den stationären Sektor vermittelt. Dies<br />
kommt vor allem <strong>in</strong> der exponierten Stellung der niederländischen Hausärzte zum Ausdruck. Als gatekeeper<br />
s<strong>in</strong>d sie nicht nur die (gesetzlich vorgeschriebenen) ersten Ansprechpartner für die Patienten;<br />
sie spielen auch im gesamten Behandlungsverlauf e<strong>in</strong>e zentrale Rolle, <strong>in</strong>sofern sie die Tätigkeiten <strong>und</strong><br />
Informationen der anderen Leistungsanbieter koord<strong>in</strong>ieren <strong>und</strong> bündeln. E<strong>in</strong> weiteres herausstechendes<br />
Merkmal des ambulanten Sektors ist die hohe Dichte an sozialen Diensten im häuslichen Bereich.<br />
Wohl nirgendwo <strong>in</strong> Europa f<strong>in</strong>det sich e<strong>in</strong> derart enges Netz an Kranken- <strong>und</strong> Altenpflege, die <strong>in</strong> den<br />
eigenen vier Wänden praktiziert wird (Home Care).<br />
Im nachgelagerten stationären Sektor gerät im Vergleich zu Deutschland vor allem die Stellung der<br />
Fachärzte <strong>in</strong> den Blick. Diese s<strong>in</strong>d nämlich nicht als niedergelassene Ärzte im ambulanten Sektor tätig,<br />
sondern fast ausnahmslos an den Kl<strong>in</strong>iken angesiedelt. Sie arbeiten hier auf selbständiger Basis <strong>und</strong><br />
vergüten die Kl<strong>in</strong>iken für die Nutzung der Infrastruktur. Die Trennung zwischen ambulant tätigen<br />
Hausärzten <strong>und</strong> stationär tätigen Fachärzten ist übrigens auch der gr<strong>und</strong>legende Parameter für die<br />
praktizierten Vergütungssysteme: Die Vergütung des Hausarztes erfolgt über e<strong>in</strong>e jährliche Kopfpauschale<br />
pro e<strong>in</strong>geschriebenem Patient (1997: 127 Gulden - ab 65 Jahren 146 Gulden), während der<br />
Facharzt nach dem System der E<strong>in</strong>zelleistungsvergütung abrechnet (welches jedoch bei weitem nicht<br />
den Differenzierungsgrad der deutschen Gebührenordnungen erreicht).<br />
Resümiert man die hier dargestellten Besonderheiten, so gelangt man zu dem Schluss, dass das kennzeichnende<br />
Merkmal des niederländischen Versorgungssektors se<strong>in</strong>e - im Vergleich zur B<strong>und</strong>esrepublik<br />
- stärkere Homogenität ist. Die exponierte Stellung des Hausarztes mit se<strong>in</strong>en Koord<strong>in</strong>ierungs<strong>und</strong><br />
Informationsfunktionen sowie die starke Zentralisierung der Fachärzte im stationären Sektor bescheren<br />
dem niederländischen Sektor e<strong>in</strong> größeres Maß an Übersichtlichkeit <strong>und</strong> Transparenz. Wie<br />
- 174 -
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Niederlande<br />
noch zu zeigen se<strong>in</strong> wird, ist dies e<strong>in</strong> entscheidender Vorteil, wenn es um die Konzeption <strong>und</strong> Implementation<br />
von Modernisierungsmaßnahmen geht.<br />
5.2.2. Ges<strong>und</strong>heitspolitische Regulierung <strong>und</strong> Reformstrategien<br />
Der niederländische Wohlfahrtsstaat wird gern als ‘late starter but boomer’ bezeichnet. Denn im Vergleich<br />
zu anderen europäischen Staaten hat sich die niederländische Sozialpolitik auffallend spät entwickelt<br />
<strong>und</strong> erreichte bis zum 2. Weltkrieg auch nicht die Inklusionsfähigkeit des deutschen Nachbarn.<br />
Erst <strong>in</strong> der Nachkriegszeit wurden, <strong>in</strong>spiriert vom englischen Beveridgesystem, e<strong>in</strong>e Reihe umfassender<br />
Volksversicherungen implementiert, <strong>in</strong> deren Folge auch der Aufstieg des Sozialstaates begann.<br />
1980 war es den Holländern dann gelungen, sich an die Spitze der westlichen Wohlfahrtsgesellschaften<br />
zu katapultieren. Zu dieser Zeit waren aber auch die Krisensymptome nicht mehr zu übersehen -<br />
der Anteil von Steuern <strong>und</strong> Sozialausgaben am Volkse<strong>in</strong>kommen betrug r<strong>und</strong> 52%. Ende der 80er<br />
Jahre wurde dann der umfassende Umbau des sozialen Sicherungssystems <strong>in</strong> Angriff genommen - e<strong>in</strong><br />
langer <strong>und</strong> schmerzvoller Prozess, der jedoch unter vere<strong>in</strong>ten politischen <strong>und</strong> gesellschaftlichen Kräften<br />
zu e<strong>in</strong>er Entlastung des Sozialstaates führte (vgl. Visser/Hemerijk 1998).<br />
Auch das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> wurde bereits frühzeitig von der Reformwelle erfasst - wenn auch die<br />
niederländische Reformfreude im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> niemals solche Ausmaße erreichte wie <strong>in</strong><br />
Deutschland. E<strong>in</strong>e Durchsicht durch die niederländische Ges<strong>und</strong>heitspolitik br<strong>in</strong>gt zwei charakteristische<br />
Merkmale zu Tage, nämlich erstens die <strong>in</strong>krementalistische Verfahrensweise <strong>und</strong> zweitens die<br />
eigentümliche Mischung aus Wettbewerb <strong>und</strong> staatlicher Regulierung (Heffen/Kerkhoff 1999,<br />
Veen/Limberger 1996, Schut et al. 1999). 82 Inkrementalistisch ist die niederländische Ges<strong>und</strong>heitspolitik<br />
<strong>in</strong>sofern, als dass alle großen Reformpläne für gescheitert erklärt werden mussten; <strong>in</strong> der Folgezeit<br />
schlichen sich aber viele Elemente durch die H<strong>in</strong>tertür wieder e<strong>in</strong>, die dann <strong>in</strong> modifizierter Form<br />
<strong>und</strong> auch <strong>in</strong> anderen Zusammenhängen step by step implementiert wurden. Unter <strong>in</strong>haltlichen Aspekten<br />
zeichnet sich die niederländische Reformpolitik h<strong>in</strong>gegen durch ihre eigentümliche Mischung aus<br />
Wettbewerb <strong>und</strong> staatlicher Regulierung aus. Dass der Wettbewerbsgedanke immer e<strong>in</strong>e wichtige<br />
Rolle gespielt hat, zeigt folgender Auszug aus dem ges<strong>und</strong>heitspolitischen Geschehen:<br />
82 E<strong>in</strong> gutes Beispiel für diese beiden Merkmale ist der sog. Dekker-Plan, der 1987 veröffentlicht wurde. Um<br />
die steigenden Ges<strong>und</strong>heitsausgaben zu begrenzen, setzte das Modell auf die E<strong>in</strong>führung neuer Wettbewerbselemente.<br />
Geplant war e<strong>in</strong>e sog. Basisabsicherung, die r<strong>und</strong> 85% der Ges<strong>und</strong>heitsleistungen abdecken sollte.<br />
Die verbleibenden 15% sollten über e<strong>in</strong>en freien Versicherungsmarkt organisiert werden, <strong>in</strong> dessen Rahmen<br />
ziekenfondsen <strong>und</strong> Privatversicherungen denselben Status erhalten hätten. Dies hätte nicht nur die Freiheit zur<br />
eigenständigen Vertragsgestaltung mit den Anbietern be<strong>in</strong>haltet, sondern auch die Möglichkeit für die Kassen,<br />
Ges<strong>und</strong>heitsleistungen selbst zu erbr<strong>in</strong>gen. Die Reform konnte aufgr<strong>und</strong> des großen Widerstands von<br />
seiten der Verbände nicht durchgesetzt werden - nichtsdestotrotz wurde der Plan nicht aus den Augen verloren;<br />
se<strong>in</strong>e gr<strong>und</strong>legenden Komponenten ziehen sich bis heute wie e<strong>in</strong> roter Faden durch die niederländische<br />
Ges<strong>und</strong>heitspolitik. Auch die gegenwärtige Politik unter M<strong>in</strong>ister<strong>in</strong> Borst-Eilers unterscheidet sich nicht<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich von Dekker, allerd<strong>in</strong>gs wird die Versorgungsebene nun stärker <strong>in</strong> die ges<strong>und</strong>heitspolitischen<br />
Bemühungen mit e<strong>in</strong>bezogen. Und schließlich ist das Verfahren e<strong>in</strong> anderes: Stand der Dekker-Plan noch<br />
ganz im Zeichen e<strong>in</strong>er politisch von ‘oben’ angeordneten Reform, setzt die jetzige Politik eher auf die Aktivierung<br />
der relevanten Akteure <strong>und</strong> E<strong>in</strong>richtungen vor Ort (vgl. Gr<strong>in</strong>ten 1996).<br />
- 175 -
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Niederlande<br />
• Bis 1992 waren die Krankenkassen regional gegliedert. Im Zuge der Modernisierung der Kassenlandschaft<br />
besteht jetzt die Möglichkeit, die Genehmigung für e<strong>in</strong>e landesweite Tätigkeit zu beantragen.<br />
Um den Wettbewerb zu fördern, wurde außerdem das Verbot für die Krankenversicherungsträger,<br />
eigene Apotheken zu betreiben, aufgehoben. Ebenso dürfen Krankenhausapotheken<br />
Arzneimittel direkt an ambulante Patienten abgeben.<br />
• Die Haushaltsmittel, die sich durch die Versichertenbeiträge ergeben, decken etwa 90% der Kosten.<br />
Fehlbeträge werden durch den Nom<strong>in</strong>albeitrag ausgeglichen, den die Kassen neben den Beiträgen<br />
erheben. Dadurch entsteht e<strong>in</strong> Wettbewerb zwischen den Kassen, d.h. die Wirtschaftlichkeit<br />
der Kasse soll <strong>in</strong> der Höhe dieses Beitrags zum Ausdruck kommen. Des weiteren erhalten die Kassen<br />
zunehmend mehr Freiheiten <strong>in</strong> der Vertragsgestaltung mit den Anbietern, die allerd<strong>in</strong>gs im<br />
Gegensatz zur Gestaltung der Nom<strong>in</strong>albeträge bislang noch sehr zögerlich genutzt werden.<br />
• Zwar wurde den ziekenfondsen 1986 die Möglichkeit genommen, Versicherungen für Personen<br />
anzubieten, die jenseits der E<strong>in</strong>kommensgrenze liegen. Dafür haben sie im Gegensatz zur deutschen<br />
GKV die Möglichkeit, ergänzende Versicherungen für zusätzliche Leistungen (zahnärztliche<br />
Versorgung für Erwachsene, Homöopahtie, Akupunktur etc.) anzubieten. Experten gehen davon<br />
aus, dass gut 90% der Bevölkerung über e<strong>in</strong>e deratige Zusatzversicherung verfügen.<br />
• Analog zum deutschen Pflegegeld besteht seit e<strong>in</strong>igen Jahren die Möglichkeit, die häusliche Pflege<br />
über e<strong>in</strong> sog. persönliches Pflegebudget f<strong>in</strong>anzieren zu lassen.<br />
• Das Risiko der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ist mittlerweile vollständig privatisiert. Die<br />
entsprechende Krankengeldversicherung (ziektewet) wurde 1996 abgeschafft. Seitdem haften die<br />
Unternehmen e<strong>in</strong> volles Jahr für die Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall. Sie können sich gegen<br />
dieses Risiko privat versichern.<br />
• Das jetzige Ges<strong>und</strong>heitsm<strong>in</strong>isterium strebt e<strong>in</strong>e Gliederung des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s an, bei der<br />
Wettbewerbselemente stärker zum Tragen kommen. Langfristig soll das AWBZ <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e umfassende<br />
Basissicherung für schwer versicherbare Risiken transformiert werden (compartment 1), während<br />
ziekenfondsen <strong>und</strong> Privatversicherungen gleichermaßen für die Versicherung von Standardrisiken<br />
zuständig s<strong>in</strong>d (compartment 2). ‘Luxusdienste’ sollen fortan gänzlich privatisiert werden<br />
(compartment 3).<br />
Es wäre jedoch verfehlt, die niederländische Reformgeschichte als e<strong>in</strong>seitige Implementation von<br />
Marktelementen zu charakterisieren. Denn paradoxerweise ist die Reformpolitik ebenso durch harte<br />
staatliche E<strong>in</strong>griffe <strong>in</strong> die Selbstregulierung des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s gekennzeichnet. Die Stärkung des<br />
Marktes wird gewissermaßen beständig durch gesetzliche <strong>und</strong> politische Vorgaben flankiert, um e<strong>in</strong>e<br />
sozialverträgliche Richtung zu garantieren. Dieses Vorgehen, mitunter auch als ‘managed liberalization’<br />
bezeichnet (vgl. Veen/Trommel 1998), ist nicht nur im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> zu beobachten, sondern<br />
vielmehr typisch für das Reformgeschehen <strong>in</strong> fast allen Feldern sozialer Sicherung. H<strong>in</strong>zu kommt,<br />
dass die Niederlande ke<strong>in</strong> föderalistischer Staat s<strong>in</strong>d - daher haben die <strong>in</strong> Den Haag beschlossenen<br />
Steuerungsvorgaben auch häufig e<strong>in</strong>en autoritären <strong>und</strong> zentralistischen Charakter. Der folgende Auszug<br />
verdeutlicht, dass der Umfang der staatlichen Regulierung unter Umständen weit über deutsche<br />
Verhältnisse h<strong>in</strong>ausgeht:<br />
• Die Vergütung wurde lange Zeit zwischen Kassen <strong>und</strong> Anbietern ausgehandelt; die Tarifentwicklung<br />
verlief unkontrolliert, die Anb<strong>in</strong>dung an die Makrokostenplanung war defizitär. 1982 wurde<br />
hierfür eigens e<strong>in</strong>e Behörde e<strong>in</strong>gerichtet - der Zentrale Tarifausschuß für Ges<strong>und</strong>heitsleistungen<br />
- 176 -
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Niederlande<br />
(COTG). Se<strong>in</strong>e Aufgabe ist die Erstellung von Leitl<strong>in</strong>ien, die als Rahmen für Tarifverhandlungen<br />
dienen, sowie die Genehmigung sämtlicher ausgehandelter Tarife für Ges<strong>und</strong>heitsleistungen. Als<br />
Folge kommt es dadurch häufig zu direkten Tarifverhandlungen zwischen fachärztlichen Verbänden<br />
<strong>und</strong> Regierung.<br />
• Die Regierung hat den Anstieg der Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung auf e<strong>in</strong>e maximale<br />
jährliche Wachstumsrate von 2,3% begrenzt. In diesem Rahmen unterliegt auch die Gestaltung<br />
der Krankenversicherungsbeiträge nicht der Entscheidung der Selbstverwaltung, sondern<br />
ist für alle Kassen gesetzlich vorgeschrieben. Das Gleiche gilt für die Beitragssatzanteile von Versicherten<br />
<strong>und</strong> Arbeitgebern. Des weiteren ist die Krankenhausplanung sowie die Planung der Pflegeheime<br />
weitgehend <strong>in</strong> Den Haag zentralisiert.<br />
• Um den Anstieg der Arzneimittel zu bremsen, werden die Festbeträge <strong>und</strong> die Gruppene<strong>in</strong>teilung<br />
von Medikamenten von e<strong>in</strong>er Expertengruppe festgelegt, die unmittelbar dem Ges<strong>und</strong>heitsm<strong>in</strong>isterium<br />
untersteht. 1996 wurde außerdem die Angleichung der <strong>in</strong> den Niederlanden verkauften Arzneimittel<br />
an die Preise der Nachbarstaaten beschlossen, was e<strong>in</strong>e beträchtliche marktweite Preissenkung<br />
zur Folge hatte.<br />
• Der Staat greift via Rechtssprechung <strong>in</strong> die Bereiche Patientenorientierung <strong>und</strong> Qualitätssicherung<br />
e<strong>in</strong>. 1996 tritt das Wet Patienten en Instell<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> Kraft, welches sog. Klientenräte <strong>in</strong> allen mediz<strong>in</strong>ischen<br />
E<strong>in</strong>richtungen vorschreibt, die Mitspracherecht h<strong>in</strong>sichtlich Verpflegung, Sicherheit,<br />
Qualitätskontrolle usw. haben. Im selben Jahr tritt das Wet Kwaliteitszorg <strong>in</strong> Kraft, welches alle<br />
Institutionen zur Qualitätssicherung verpflichtet. Über die Aufsicht Gezondheitszorg (IGZ) wird<br />
diese Sicherung öffentlich evaluiert.<br />
Mit dieser eigentümlichen Mischung aus Liberalisierung <strong>und</strong> Regulierung versucht die niederländische<br />
Ges<strong>und</strong>heitspolitik, dem steigenden Bedarf nach Ges<strong>und</strong>heitsdiensten bei weitmöglicher Kontrolle<br />
der Kostenentwicklung gerecht zu werden. Die Resultate dieser Politik zeigen sich, wenn man<br />
das Geschehen im niederländischen Versorgungssektor beobachtet, der sich im Vergleich zu<br />
Deutschland durch e<strong>in</strong>e ausgeprägte Experimentierfreude auszeichnet - wohlwollend könnte man von<br />
erfolgreicher politischer Aktivierung sprechen. Abschließend sollen daher wichtige Modernisierungsstrategien<br />
skizziert werden, die für die Reformierung der niederländischen Versorgungslandschaft<br />
charakteristisch s<strong>in</strong>d. 83<br />
Als wichtige Prozess<strong>in</strong>novation s<strong>in</strong>d Integrations- <strong>und</strong> Kooperationsstrategien zu verstehen, die auf<br />
e<strong>in</strong>e stärkere Verknüpfung verschiedener Akteure <strong>und</strong> E<strong>in</strong>richtungen abzielen. Sie s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e Reaktion<br />
auf die zunehmende organisatorische Spezialisierung, die mit (teuren) Overhead-Kosten <strong>und</strong> (patientenfe<strong>in</strong>dlichen)<br />
Bürokratisierungstendenzen e<strong>in</strong>hergeht. In den Niederlanden wird dies vor allem unter<br />
dem Stichwort Transmurale Zorg diskutiert, die verschiedene Formen annehmen kann. Darunter fällt<br />
beispielsweise der Austausch von Fachärzten zwischen Kl<strong>in</strong>iken, aber auch die Errichtung sog. hightech-centres,<br />
die sich auf Intensivversorgung spezialisieren. Mittlerweile f<strong>in</strong>den sich auch immer häufiger<br />
sog. buitenpoli´s, kle<strong>in</strong>e dezentrale E<strong>in</strong>richtungen im Schatten großer Kl<strong>in</strong>iken, die sich auf<br />
Nachsorge <strong>und</strong> ambulante Versorgung konzentrieren. Transmurale Zorg f<strong>in</strong>det auch <strong>in</strong> Form vertikaler<br />
83 Die folgenden Abschnitte basieren auf e<strong>in</strong>er Untersuchung über Modernisierungsstrategien im niederländischen<br />
Ges<strong>und</strong>heitssektor (vgl. Hartmann 1999).<br />
- 177 -
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Niederlande<br />
Kooperationen statt. So arbeiten speziell geschulte Schwestern (transfer nurses) aus den Kl<strong>in</strong>iken häufig<br />
mit Home Care-E<strong>in</strong>richtungen zusammen, z.B. bei chronischen Erkrankungen, Diabetes, Rheuma,<br />
Schmerzbehandlungen <strong>und</strong> Brustkrebs. Immer häufiger f<strong>in</strong>den sich auch sog. admission bureaus, <strong>in</strong><br />
denen Hausärzte, Fachärzte <strong>und</strong> Home Care-E<strong>in</strong>richtungen kooperieren, um Verfahren der Diagnose<br />
<strong>und</strong> Behandlung optimal zu organisieren. Und schließlich ist <strong>in</strong> diesem Kontext das Stichwort des case<br />
managers zu erwähnen, das sich <strong>in</strong> den Niederlanden großer Beliebtheit erfreut: Hier geht es darum,<br />
(<strong>in</strong>sbesondere chronisch kranken) Patienten e<strong>in</strong>en Betreuer an die Seite zu stellen, der den Patienten<br />
im Zuge se<strong>in</strong>er Krankheits’laufbahn’ durch die Kette der ambulanten <strong>und</strong> stationären E<strong>in</strong>richtungen<br />
begleitet. Zu den Aufgaben des case managers gehören bürokratische <strong>und</strong> organisatorische Beratung,<br />
‘Alltagshilfe’ <strong>und</strong> die Beobachtung der professionellen Behandlung.<br />
Bei allen transmuralen Versorgungsformen geht es letztendlich darum, die Geschlossenheit <strong>und</strong> Autonomie<br />
e<strong>in</strong>zelner Sektoren zu durchbrechen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e durchgängige Versorgungskette zu etablieren,<br />
z.B. durch verstärkten Informationsaustausch zwischen Hausärzten, Fachärzten <strong>und</strong> Kl<strong>in</strong>iken, aber<br />
auch durch die <strong>in</strong>tensivere Zusammenarbeit zwischen E<strong>in</strong>richtungen des Ges<strong>und</strong>heitssektors <strong>und</strong> anderen<br />
Sektoren, wie Erziehung <strong>und</strong> Soziales, Technologie <strong>und</strong> Forschung. Generell ist das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
der Niederlande als ausgesprochen vernetzungsfreudig zu bezeichnen - dies gilt nicht nur im<br />
Falle von Transmuraler Zorg, sondern auch <strong>in</strong> Bezug auf Forschungs- <strong>und</strong> Entwicklungsprojekte oder<br />
die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen <strong>und</strong> Schulen. Es versteht sich, dass der Hausarzt aufgr<strong>und</strong><br />
se<strong>in</strong>er exponierten Stellung bei Vernetzungsvorhaben als Schlüsselfigur gesehen wird. Entsprechend<br />
wird auch immer wieder über die Ausweitung se<strong>in</strong>er Kompetenzen (z.B. ambulantes Operieren) <strong>und</strong><br />
über e<strong>in</strong>e stärkere Differenzierung se<strong>in</strong>er Vergütung diskutiert.<br />
Auch <strong>in</strong> anderen Feldern erweist sich das niederländische <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> als äußerst <strong>in</strong>novationsfreudig.<br />
So spielt schon seit längerer Zeit die Debatte über Qualitätsmanagement e<strong>in</strong>e wichtige Rolle,<br />
nicht zuletzt aufgr<strong>und</strong> des Wet Kwaliteitszorg, welches alle Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>richtungen zur Qualitätssicherung<br />
verpflichtet. Wie die e<strong>in</strong>zelnen E<strong>in</strong>richtungen dieser Verpflichtung nachkommen, bleibt ihnen<br />
überlassen. Sie können sich an Modellen orientieren, die von Verbänden oder großen Anbieterorganisationen<br />
entwickelt wurden oder eigene Konzepte erstellen, die auf die spezifischen Organisationsanforderungen<br />
zugeschnitten s<strong>in</strong>d. 84 Des weiteren erweist sich der E<strong>in</strong>satz neuer Medien als zunehmend<br />
wichtiges Reform<strong>in</strong>strument. So verfügen mittlerweile nahezu alle Hausärzte über standardisierte<br />
elektronische Krankenakten (EPR’s); an der Digitalisierung des stationären Sektors wird derzeit <strong>in</strong>tensiv<br />
gearbeitet. Gerade am Beispiel der neuen Medien wird deutlich, dass die stärkere Homogenität des<br />
niederländischen <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s e<strong>in</strong> entscheidender Vorteil bei Modernisierungsvorhaben ist. Die<br />
zentrale Stellung des Hausarztes, die Konzentration der Fachärzte an den Kl<strong>in</strong>iken, die e<strong>in</strong>deutigen<br />
Zuständigkeiten <strong>und</strong> Kompetenzen erleichtern nicht nur die Implementation standardisierter Qualitätsverfahren<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong>formationstechnischer Systeme, sondern s<strong>in</strong>d auch von Vorteil, wenn es um die Bildung<br />
von Netzwerken <strong>und</strong> den Aufbau von Kooperationen geht. Neben der günstigen Strukur des<br />
Sektors wirkt sich weiterh<strong>in</strong> vorteilhaft aus, dass die Niederlande (ebenfalls <strong>in</strong>spiriert durch das angel-<br />
84 Besonders populär s<strong>in</strong>d derzeit Total Quality Management <strong>und</strong> ISO 900, aber auch Benchmark<strong>in</strong>g, also der<br />
systematische Vergleich von Ges<strong>und</strong>heitse<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong> ‘Versorgungsketten’ wird immer häufiger praktiziert.<br />
E<strong>in</strong> weiteres wichtiges Element ist die Entwicklung sog. guide-l<strong>in</strong>es <strong>und</strong> Handbücher, die e<strong>in</strong>en Orientierungsrahmen<br />
für optimale diagnostische <strong>und</strong> therapeutische Verfahren bieten.<br />
- 178 -
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Niederlande<br />
sächsische Vorbild) e<strong>in</strong> sehr starkes Engagement im Bereich Public Health aufweisen. Während der<br />
deutsche Sektor e<strong>in</strong>deutig kl<strong>in</strong>isch dom<strong>in</strong>iert ist, hat Ges<strong>und</strong>heit <strong>in</strong> den Niederlanden e<strong>in</strong>e starke soziale<br />
<strong>und</strong> umweltbezogene Komponente. Entsprechend gut ausgebaut ist nicht nur der Bereich der<br />
Pflege, Prävention <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitserziehung; auch das Wissen um Ges<strong>und</strong>heitsmanagement <strong>und</strong><br />
-ökonomie hat systematischeren Charakter als <strong>in</strong> Deutschland.<br />
5.2.3. Beschäftigungsentwicklung im niederländischen <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
Ziel der folgenden Abschnitte ist e<strong>in</strong> umfassender Überblick über die Beschäftigungsentwicklung im<br />
niederländischen <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>. Zunächst wollen wir aufgr<strong>und</strong> der bereits skizzierten Reformmaßnahmen<br />
folgende Fragen zu Gr<strong>und</strong>e legen:<br />
• Wie wirkt sich die Transmuralisierungsstrategie auf die Beschäftigung aus? Denkbar ist, dass sich<br />
durch Transmuralisierung <strong>und</strong> gate-keeper-Pr<strong>in</strong>zip e<strong>in</strong>e Verschiebung der Ges<strong>und</strong>heitsversorgung<br />
<strong>in</strong> den ambulanten Bereich vollzieht. Entsprechend ließe sich e<strong>in</strong> Beschäftigungswachstum bei<br />
ambulanten Institutionen <strong>und</strong> Professionen vermuten, beispielsweise bei Hausärzten, Bezirksschwestern<br />
(district nurses) <strong>und</strong> Hebammen oder bei Health Centres <strong>und</strong> Home-Care-<br />
E<strong>in</strong>richtungen.<br />
• Wie verläuft die Beschäftigungsentwicklung im Bereich Prävention <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitserziehung?<br />
Aufgr<strong>und</strong> der ausgeprägten Public Health-Politik müsste mit e<strong>in</strong>em Beschäftigungswachstum bei<br />
entsprechenden Berufsgruppen <strong>und</strong> E<strong>in</strong>richtungen zu rechnen se<strong>in</strong>, beispielsweise bei kommunalen<br />
Ges<strong>und</strong>heitsämtern, bei Sozialarbeitern, Sprachtherapeuten, aber auch im akademischuniversitären<br />
Umfeld.<br />
• Wie spiegelt sich die demographische Enwicklung <strong>in</strong> den Beschäftigungstendenzen wider? Da der<br />
Baby-Boom <strong>in</strong> Holland ausgeprägter war als <strong>in</strong> Deutschland, verläuft die Alterung der Gesellschaft<br />
bislang zwar relativ moderat, wird jedoch bald rapide ansteigen: Im Jahr 2040 werden die<br />
Niederlande e<strong>in</strong>es der ältesten Länder Europas se<strong>in</strong>; der Anteil der über 65-Jährigen wird dann auf<br />
etwa 23% prognostiziert (Maas et al. 1996). Mit dem Altern der Bevölkerung wandelt sich das<br />
Krankheitsspektrum (Rheuma <strong>und</strong> Arthrose, Diabetes, Grauer Star, Schwerhörigkeit <strong>und</strong> Demenz);<br />
gleichzeitig steigt der Bedarf nach Pflege <strong>und</strong> Versorgungsangeboten. Entsprechend<br />
müsste mit e<strong>in</strong>em Anstieg an Home Care <strong>und</strong> Pflegeheimen, sowie E<strong>in</strong>richtungen für Rehabilitation<br />
<strong>und</strong> psychische Erkrankungen zu rechnen se<strong>in</strong>.<br />
• E<strong>in</strong>e weitere Prognose, die wir an dieser Stelle treffen, ist der Anstieg der Teilzeitarbeit. Denn<br />
erstens ist die niederländische Beschäftigungspolitik durch e<strong>in</strong>e starke Ausweitung der Teilzeitarbeit<br />
gekennzeichnet, <strong>und</strong> zweitens ist gerade der Ges<strong>und</strong>heitssektor e<strong>in</strong> beliebtes Anwendungsfeld<br />
für Teilzeit, da hier überproportional viele Frauen beschäftigt s<strong>in</strong>d. Daher ist davon auszugehen,<br />
dass mögliche Beschäftigungszuwächse vor allem Teilzeitarbeitsplätze betreffen werden.<br />
Nach e<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>leitenden Überblick werden wir die Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> ausgewählten Ges<strong>und</strong>heits<strong>in</strong>stitutionen<br />
näher ausloten, ergänzt um e<strong>in</strong>ige professionsbezogene Darstellungen <strong>und</strong> qua-<br />
- 179 -
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Niederlande<br />
litative Anmerkungen. 85 Wir haben dabei unsere Aufmerksamkeit auf ‘moderne’ <strong>und</strong> unkonventionelle<br />
Institutionen gerichtet, die e<strong>in</strong>erseits <strong>in</strong> engem Zusammenhang mit den gegenwärtig praktizierten ges<strong>und</strong>heitspolitischen<br />
Strategien stehen, andererseits auch die bisher dargestellten Beschäftigungsverläufe<br />
näher konkretisieren.<br />
5.2.3.1. E<strong>in</strong> Überblick: Beschäftigungsentwicklung im Zuge der Kostendämpfung<br />
Dem <strong>in</strong>ternationalen Vergleich ist zu entnehmen, dass die niederländische Reformpolitik zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong><br />
Bezug auf die Ausgabenbegrenzung e<strong>in</strong>e gewisse Wirkung zeigte. So war die Höhe der Ges<strong>und</strong>heitsausgaben<br />
1997 mit 8,5% des BSP unterhalb des EU-Durchschnitts (8,8%) angesiedelt <strong>und</strong> liegt somit<br />
auch unter dem b<strong>und</strong>esdeutschen Anteil von 9,2% (Schneider et al. 1998). Der folgenden Tab. 56 ist<br />
zu entnehmen, dass der Kostenanstieg <strong>in</strong> den meisten Ges<strong>und</strong>heitssektoren Mitte der 90er Jahre gebremst<br />
werden konnte. Ausnahme s<strong>in</strong>d die Ausgaben für Arzneimittel: Die Wachstumsrate von 1980-<br />
94 verdeutlicht, dass deren rapider Anstieg e<strong>in</strong> nach wie vor ungelöstes ges<strong>und</strong>heitspolitisches Problem<br />
darstellt, wenn auch der Verbrauch im <strong>in</strong>ternationalen Vergleich nach wie vor relativ niedrig<br />
ausfällt (1997: 9,6% der Gesamtausgaben versus 10,4% <strong>in</strong> der BRD). Des weiteren weisen die<br />
Wachstumsraten auch den Pflegesektor <strong>und</strong> den Bereich Heil- <strong>und</strong> Hilfsmittel als ‘Boombranchen’<br />
aus, während h<strong>in</strong>gegen der zahnmediz<strong>in</strong>ische <strong>und</strong> der ambulante Sektor <strong>in</strong> den letzten 15 Jahren große<br />
E<strong>in</strong>bußen zu verzeichnen hatten.<br />
Tab. 56 Anteil verschiedener Ges<strong>und</strong>heitsleistungen am BSP <strong>in</strong> den Niederlanden<br />
1980 1985 1990 1991 1921 1993 1994 Wachstum 80-95<br />
Krankenhaus 3,7 3,58 3,53 3,68 3,82 3,82 3,74 0,52%<br />
Ambulanter Sektor 0,89 0,85 0,87 0,87 0,89 0,84 0,81 -2,16%<br />
Zahnarzt 0,42 0,4 0,38 0,39 0,41 0,40 0,39 -3,37%<br />
Arzneimittel 0,62 0,7 0,8 0,82 0,9 0,94 0,95 78,57%<br />
Heil-, Hilfsmittel 0,29 0,32 0,43 0,44 0,47 0,47 0,47 29,03%<br />
Pflege 1,14 1,15 1,13 1,14 1,18 1,2 1,18 13,79%<br />
Insgesamt 7,64 7,53 7,95 8,19 8,56 8,59 8,47 10,9%<br />
Quelle: Schneider et al. 1997<br />
Die folgende Tab. 57 zeigt genauer, wie sich e<strong>in</strong>zelne Versorgungs<strong>in</strong>stitutionen <strong>in</strong> den letzten Jahren<br />
entwickelt haben. Positive durchschnittliche Wachstumsraten weisen die Universitätskl<strong>in</strong>iken, E<strong>in</strong>richtungen<br />
für geistig Beh<strong>in</strong>derte <strong>und</strong> die Pflegeheime/-häuser auf; <strong>in</strong> allen anderen Feldern s<strong>in</strong>d die<br />
Anzahl der Institutionen, die Bettendichte <strong>und</strong> die Pflegetage rückläufig. Besonders stark betroffen ist<br />
85 Erwartungsgemäß wurden wir mit e<strong>in</strong>igen statistischen Schwierigkeiten konfrontiert. Zunächst versuchten<br />
wir, Daten auszuwählen, die e<strong>in</strong>e Vergleichbarkeit zwischen beiden Ges<strong>und</strong>heitssystemen erlauben. Der Versuch,<br />
das niederländische <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> <strong>in</strong> die deutschen Strukturen zu pressen, ergab aber e<strong>in</strong> sehr verfälschtes<br />
Bild. E<strong>in</strong>e weitere Alternative war, die Beschäftigungsentwicklung entlang der ‚offiziellen‘ Gliederung<br />
darzustellen, also anhand der Sektoren Prävention, Kuration <strong>und</strong> Pflege, doch leider folgen die Datenbanken<br />
nicht diesem Aufbau. Ähnliches gilt für die Strukturierung nach <strong>in</strong>tra- <strong>und</strong> extramuraler Versorgung.<br />
E<strong>in</strong> generelles Problem ist natürlich die Verfügbarkeit der Daten. Obwohl das niederländische CBS umfangreiches<br />
Datenmaterial zum <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> präsentiert, ist es doch nicht die ‚perfekte‘ Datenbank, für die<br />
es gerne gehalten wird. Viele Zeitreihen s<strong>in</strong>d lückenhaft, die Abgrenzungen zwischen den Kategorien s<strong>in</strong>d<br />
häufig nicht e<strong>in</strong>heitlich. Dennoch hoffen wir, e<strong>in</strong>e geeignete Auswahl an Statistiken getroffen zu haben, die<br />
zum<strong>in</strong>dest im Rahmen der getroffenen Fragestellungen wichtige Entwicklungstrends aufzeigen kann.<br />
- 180 -
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Niederlande<br />
der extramurale, also der ambulante Bereich. Dies ist e<strong>in</strong> erster Indikator dafür, dass die Betonung des<br />
gate keeper-Pr<strong>in</strong>zips <strong>und</strong> die niederländische Vorliebe für Transmuralisierungsstrategien nicht unbed<strong>in</strong>gt<br />
den Ausbau des ambulanten Sektors nach sich ziehen muss. Dafür lässt sich aus den Daten e<strong>in</strong>e<br />
andere Folge der Transmuralisierung ablesen: In vielen Sektoren schrumpft die Anzahl der E<strong>in</strong>richtungen<br />
stärker als der Bettenabbau, umgekehrt wächst <strong>in</strong> Sektoren mit positivem Wachstum die Bettendichte<br />
schneller als die Anzahl der E<strong>in</strong>richtungen. Was wir hier beobachten, ist e<strong>in</strong>e deutliche Tendenz<br />
zur Fusion, die sich nicht nur auf der Ebene der Versorgungse<strong>in</strong>richtungen, sondern auch bei<br />
Krankenkassen <strong>und</strong> Verbänden beobachten lässt.<br />
Tab. 57 Überblick über die Entwicklung der Versorgungs<strong>in</strong>stitutionen<br />
1985 1990 1994 1995 1996 1997 1998 Avg. yearly growth<br />
Hospitals total<br />
Number of <strong>in</strong>stitutions 207 169 152 148 146 143 143 -2,7<br />
Bed's per thousand <strong>in</strong>habitants 4,7 4,3 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7 -1,8<br />
Nurs<strong>in</strong>g days (x 1000) 19754 17284 16127 15779 15531 15159 14790 -2,1<br />
General hospital<br />
Number of <strong>in</strong>stitutions 155 124 113 110 108 105 107 -2,6<br />
Bed's per thousand <strong>in</strong>habitants 3,9 3,5 3,2 3,1 3 3 3 -1,9<br />
Academic hospital<br />
Number of <strong>in</strong>stitutions 7 9 9 9 9 10 8 1,4<br />
Bed's per thousand <strong>in</strong>habitants 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,9<br />
Categorial hospital / rehabilitation 1<br />
Number of <strong>in</strong>stitutions 45 36 30 29 29 28 28 -3,4<br />
Bed's per thousand <strong>in</strong>habitants 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 -4,5<br />
Mental hospitals 1<br />
Number of <strong>in</strong>stitutions 82 80 85 83 85 80 79 -0,3<br />
Bed's per thousand <strong>in</strong>habitants 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 0<br />
Nurs<strong>in</strong>g days (x 1000) 8439 8503 8513 8343 8348 8104 8029 -0,4<br />
Institutions for mentally handicapped 2<br />
Number of <strong>in</strong>stitutions 121 121 138 139 138 141 147 1,6<br />
Bed's per thousand <strong>in</strong>habitants 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 0,4<br />
Nurs<strong>in</strong>g days (x 1000) 10951 11443 12264 12430 12566 12594 12654 1,1<br />
Nurs<strong>in</strong>g homes/care homes 3<br />
Number of <strong>in</strong>stitutions 328 326 330 329 330 332 336 0,2<br />
Bed's per thousand <strong>in</strong>habitants 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7 0,7<br />
Nurs<strong>in</strong>g days (x 1000) 17608 18347 19464 19841 20234 20340 20473 1,2<br />
Other extramural <strong>in</strong>stitutions 4<br />
Number of <strong>in</strong>stitutions 154 121 88 85 83 83 -11,9<br />
Bed's per thousand <strong>in</strong>habitants 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 -9,6<br />
1 Behandlung kann stationär oder teilstationär erfolgen. Unter die Kategorie Mental Hospitals fällt außerdem die Betreuung von K<strong>in</strong>dern.<br />
2 Inklusive Beh<strong>in</strong>derungen der S<strong>in</strong>nesorgane<br />
3 Nurs<strong>in</strong>g Homes s<strong>in</strong>d Pflegeheime mit umfassender mediz<strong>in</strong>ischer Versorgung. Care Homes s<strong>in</strong>d vergleichbar mit betreutem Wohnen; die<br />
Insassen können bei Bedarf auf Pflegepersonal zurückgreifen.<br />
4 Unter diese Kategorie fallen Praxen, Health Centres, Home Care, Öffentlicher Ges<strong>und</strong>heitsdienst, Thrombosedienst, Blutbanken, Arbeitsges<strong>und</strong>heitsdienst,<br />
Ambulanz.<br />
Quelle: CBS/VWS 1985-1999<br />
Die Frage ist nun, wie die Entwicklung der niederländischen Ges<strong>und</strong>heitsversorgung mit der Beschäftigungsentwicklung<br />
korrespondiert. Zunächst ist das niederländische <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> ebenso wie <strong>in</strong><br />
Deutschland e<strong>in</strong> starker Wirtschafts- <strong>und</strong> Beschäftigungsfaktor. 1999 arbeiteten 13,6% der erwerbstätigen<br />
Bevölkerung im Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Sozialwesen, <strong>und</strong> zwar 3,8% <strong>in</strong> Krankenhäusern, 4,3% <strong>in</strong><br />
Pflege- <strong>und</strong> Altenheimen sowie 5,5% im ambulanten Bereich. Frauen s<strong>in</strong>d mit 77% überproportional<br />
- 181 -
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Niederlande<br />
vertreten, am größten ist ihr Anteil im Pflegesektor (CBS/VWS 1998). Die folgende Tabelle gibt e<strong>in</strong>en<br />
Überblick über die Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> verschiedenen Teilsektoren des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s.<br />
Hier sehen wir, dass die Beschäftigung <strong>in</strong> allen Sektoren des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s ansteigt – trotz Budgetierung,<br />
Bettenabbau <strong>und</strong> Fusionierung. Die Wachstumsraten s<strong>in</strong>d allerd<strong>in</strong>gs äußerst unterschiedlich:<br />
Im stationären Sektor fällt der Anstieg im Zuge der Transmuralisierung erwartungsgemäß relativ<br />
ger<strong>in</strong>g aus. Auffällig ist jedoch auch hier, dass dies nicht durch e<strong>in</strong>en entprechenden Beschäftigungsanstieg<br />
im ambulanten, extramuralen Bereich kompensiert wird. Hohe Wachstumsraten f<strong>in</strong>den wir<br />
h<strong>in</strong>gegen im Bereich Rehabilitation, mental healthcare sowie bei der Versorgung Beh<strong>in</strong>derter. Die<br />
Tabelle zeigt weiterh<strong>in</strong>, dass der Beschäftigungsanstieg wie vermutet im Wesentlichen e<strong>in</strong> Anstieg der<br />
Teilzeitbeschäftigung ist – daran zu sehen, dass der Index der absoluten Beschäftigten stärker wächst<br />
als das Vollzeitäquivalent.<br />
Tab. 58 Absolute Beschäftigungsanzahl (abs.) <strong>und</strong> Vollzeitäquivalent (FTE) im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
1994=100 1995 1996 1997 1998 abs. number 98<br />
abs. FTE abs. FTE abs. FTE abs. FTE<br />
Hospitals 101,4 100,1 103,5 101,5 105,7 103,5 112,0 107,2 207.360<br />
Rehabilitation hospitals 104,2 103,1 112,2 111,2 138,0 136,8 148,7 147,3 7.111<br />
Mental healthcare 103,2 102,3 107,3 105,2 109,6 107,6 114,8 112,7 59.681<br />
Care for the disabled 106,5 104,6 110,5 108,1 111,0 113,1 119,8 119,0 106.070<br />
Care for the elderly 102,3 100,8 104,7 102,4 108,4 105,9 111,9 109,5 200.445<br />
Homecare 103,4 98,8 104,3 99,3 104,5 99,9 107,2 103,3 160.000<br />
Extramural 101,8 101,8 103,5 104,0 104,9 104,8 105,0 105,3 72.106<br />
Total 102,9 101,1 105,1 102,90 107,2 105,5 111,7 109,3 812.733<br />
Quelle: Kwartel et al. 1999<br />
Der erste Überblick lässt sich dah<strong>in</strong>gehend zusammenfassen, dass die geistige Ges<strong>und</strong>heitsversorgung,<br />
die Versorgung beh<strong>in</strong>derter Menschen sowie die Rehabilitation 86 derzeit besonders dynamische Felder<br />
des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s s<strong>in</strong>d. Aufgr<strong>und</strong> der verzögerten Alterung der niederländischen Gesellschaft<br />
s<strong>in</strong>d zwar die Wachstumsraten h<strong>in</strong>sichtlich Altenpflege <strong>und</strong> –versorgung bislang bescheiden, <strong>in</strong> Zukunft<br />
ist hier aber von weiteren Steigerungsraten auszugehen. Des weiteren lassen die Daten darauf<br />
schließen, dass die Kl<strong>in</strong>iken wegen des Rückgangs an Betten <strong>und</strong> E<strong>in</strong>richtungen e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>ges, aber<br />
positives <strong>und</strong> stabiles Beschäftigungswachstum verzeichnen, während der ambulante Sektor trotz anderer<br />
ges<strong>und</strong>heitspolitischer Suggestionen die ger<strong>in</strong>gsten Beschäftigungszuwächse aufweist.<br />
86 Die zunehmende Bedeutung der Rehabilitation ergibt sich nicht nur aus der demographischen Entwicklung<br />
(<strong>in</strong>sbesondere die Nachsorge bei Schlaganfällen spielt hier e<strong>in</strong>e große Rolle), sondern hängt auch eng mit<br />
politischer Regulierung zusammen. Die Reha-Leistungen wurden kürzlich vom ZFW <strong>in</strong> die Volksversicherung<br />
AWBZ verlagert, wodurch nicht nur e<strong>in</strong>e neue F<strong>in</strong>anzierungsquelle erschlossen wurde, sondern auch<br />
e<strong>in</strong>e Verschiebung der Leistungsträger erfolgte: Früher war Reha e<strong>in</strong>e Angelegenheit der Haus- <strong>und</strong> Fachärzte;<br />
jetzt obliegt diese Tätigkeit spezifischen E<strong>in</strong>richtungen, die e<strong>in</strong>e entsprechend starke Expansion aufweisen.<br />
- 182 -
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Niederlande<br />
5.2.3.2. Ambulante <strong>und</strong> kl<strong>in</strong>ische Ges<strong>und</strong>heits<strong>in</strong>stitutionen<br />
Innerhalb der ambulanten Ges<strong>und</strong>heitsversorgung <strong>in</strong>teressiert vor allem die Stellung des gate keepers.<br />
Der folgende Medical Profession Index zeigt, dass die Wachstumsrate der Hausärzte trotz ihrer<br />
Schlüsselfunktion überraschend ger<strong>in</strong>g ist. Die formelle Aufwertung ihrer Position mag zwar e<strong>in</strong>e<br />
Erweiterung ihrer Aufgabenpalette zur Folge haben, führt aber bislang nicht zu e<strong>in</strong>er nennenswerten<br />
Beschäftigungszunahme. Die Fachärzte h<strong>in</strong>gegen weisen e<strong>in</strong>e äußerst stabile Wachstumsrate auf, <strong>und</strong><br />
zwar <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> den Feldern Neurologie, Magen-, Darm- <strong>und</strong> Stoffwechselerkrankungen, Nuklearmediz<strong>in</strong><br />
<strong>und</strong> Rheumatologie (CBS/VWS 1994). Dies ist nicht nur e<strong>in</strong> Indikator dafür, dass jenseits<br />
aller Transmuralisierungsstrategien der Trend zur Spezialisierung ungebrochen ist, sondern spricht<br />
auch für die Dom<strong>in</strong>anz des kl<strong>in</strong>ischen Sektors, <strong>in</strong> dem die Fachärzte angesiedelt s<strong>in</strong>d. Die höchste<br />
Wachstumsrate liegt übrigens bei den Hebammen, die niedergelassen tätig s<strong>in</strong>d. Diese bilden auch die<br />
jüngste Berufsgruppe <strong>in</strong> der mediz<strong>in</strong>ischen Kategorie: 60% s<strong>in</strong>d jünger als 40 Jahre, bei den übrigen<br />
Professionen s<strong>in</strong>d dies nur 18% (Wiegers et al. 1999).<br />
Tab. 59 Entwicklung mediz<strong>in</strong>ischer Ges<strong>und</strong>heitsprofessionen<br />
1990=100, abs. 1971 1976 1980 1985 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 abs. number 98<br />
General practitioners 69,9 77,2 85,6 92,3 101,0 102,3 103,2 104,6 105,7 106,6 108,3 109,5 6.996<br />
Specialists 46,7 59,2 73,2 88,4 108,4 112,2 115,8 119,3 117,6 14.362<br />
Dentists 68,3 87,4 101,3 96,8 97,5 93,4 93,9 94,9 7.069 a<br />
Farmacists 65,6 80,8 100,8 102,6 107,3 110,5 103,8 106,0 109,6 113,6 2.533<br />
Midwives 73,3 85,7 103,6 107,8 111,1 117,8 122,9 125,3 131,4 139,2 1.507<br />
a 1997<br />
Quelle: Geneesk<strong>und</strong>ige hoofd<strong>in</strong>spectie van de volksgezondheid 1988; CBS/VWS 1990; VWS 1999; H<strong>in</strong>gstman/Harmsen<br />
1994<br />
E<strong>in</strong> relativ neues Phänomen der niederländischen Ges<strong>und</strong>heitslandschaft s<strong>in</strong>d die Health Centres, <strong>in</strong><br />
denen verschiedene Felder der ambulanten Versorgung unter e<strong>in</strong>em Dach zusammengefasst werden.<br />
Die folgende Tabelle zeigt, dass die Health Centres bis Mitte der 90er Jahre e<strong>in</strong>en regelrechten Boom<br />
durchliefen – zu dieser Zeit waren sie e<strong>in</strong> favorisiertes Objekt öffentlicher Förderung, da sie geme<strong>in</strong>h<strong>in</strong><br />
als vortreffliches Instrument der Transmuralisierung angesehen wurden. Seitdem die Förderung<br />
zurückgefahren wurde, ist die Rate leicht rückläufig, aber immer noch positiv. Die Tabelle zeigt weiterh<strong>in</strong>,<br />
dass Health Centres e<strong>in</strong> äußerst differenziertes <strong>und</strong> vielseitiges Berufsspektrum vere<strong>in</strong>igen,<br />
wobei die e<strong>in</strong>zelnen Diszipl<strong>in</strong>en jedoch unterschiedliche Entwicklungen durchlaufen: Für Krankenschwestern,<br />
Sozialarbeiter <strong>und</strong> Haushaltshelfer entpuppen sich die Health Centre als ungeeigneter<br />
Arbeitsort (man f<strong>in</strong>det diese Berufsgruppen eher im Bereich Home Care), während die Berufszweige<br />
aus dem Feld soziale/psychologische Beratung sowie aus angrenzenden mediz<strong>in</strong>ischen Bereichen<br />
(‚other staff‘, Apotheker, Hebammen) hier offensichtlich e<strong>in</strong> geeignetes Betätigungsfeld f<strong>in</strong>den.<br />
- 183 -
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Niederlande<br />
Tab. 60 Beschäftigungsentwicklung der Health Centre<br />
1990=100, abs. 1980 1985 1994 1995 1996 1997 1998 abs. number 98<br />
General practitioners (<strong>in</strong>cl. assistents) 50,5 81,9 109,6 109,8 111,9 115,3 114,4 643<br />
District nurses 44,7 77,9 98,0 92,5 91,6 89,4 87,4 487<br />
Social workers 44,9 74,4 99,0 98,1 98,7 98,7 97,1 303<br />
Physical therapists 43,8 78,7 118,1 117,4 119,0 120,1 122,5 529<br />
Midwives 26,4 77,0 151,4 157,4 166,9 175,0 181,8 269<br />
Homehelpers / old people's aids 35,8 78,3 90,6 75,5 76,4 77,4 69,8 74<br />
Assistant nurses 17,5 51,5 150,5 154,4 150,5 159,2 164,1 169<br />
Dentists 43,0 88,6 105,1 112,7 116,5 119,0 121,5 96<br />
Pharmacists 21,0 60,5 124,7 137,0 150,6 151,9 153,1 124<br />
Dieticians 17,0 31,9 214,9 225,5 234,0 244,7 248,9 117<br />
Psychologists 87,5 87,5 225,0 375,0 412,5 512,5 562,5 45<br />
Exercise therapists 460,0 660,0 700,0 760,0 780,0 39<br />
Speech therapists 266,7 305,6 322,2 333,3 372,2 67<br />
Other staff 1<br />
22,4 55,1 291,8 308,2 322,4 383,7 424,5 208<br />
Total 41,2 75,1 118,6 121,0 123,5 126,9 128,0 3210<br />
1 oral hygienists, social councillors, alternative practitioners, school physicians<br />
Quelle: H<strong>in</strong>gstman/Harmsen 1994, CBS/VWS 1994 <strong>und</strong> später<br />
Die Betrachtung der Health Centres lenkt die Aufmerksamkeit auch auf die <strong>in</strong>teressante Entwicklung<br />
der paramediz<strong>in</strong>ischen Berufe, die hier sehr stark vertreten s<strong>in</strong>d. Die Summe der <strong>in</strong> der folgenden Grafik<br />
angeführten Berufe ist seit 1990 um 37% angewachsen, d.h. dass diese Kategorie unter den Ges<strong>und</strong>heitsprofessionen<br />
e<strong>in</strong>e der höchsten Wachstumsraten aufweist. Der Bedarf nach Angeboten, die<br />
die kernmediz<strong>in</strong>ische Versorgung ergänzen, hat <strong>in</strong> den letzten Jahren offensichtlich stetig zugenommen,<br />
obwohl viele dieser Leistungen Eigenbeteiligungen vorsehen oder überhaupt nicht im Katalog<br />
des ZFW oder AWBZ enthalten s<strong>in</strong>d. Zahlenmäßig dom<strong>in</strong>ieren hier die Sprachtherapeuten; die mit<br />
Abstand höchste Wachstumsrate (r<strong>und</strong> 170 Prozentpunkte seit 1990) f<strong>in</strong>det sich jedoch bei der Fußpflege<br />
(Hauptklientel s<strong>in</strong>d Diabetespatienten). Mit großem Abstand folgen die dental hygienist, die vor<br />
allem prophylaktische Aufgaben <strong>in</strong>nehaben (Zahnre<strong>in</strong>igung etc.). Anzumerken ist auch, dass das Profil<br />
der paramediz<strong>in</strong>ischen Berufe überwiegend jung, weiblich <strong>und</strong> teilzeitbeschäftigt ist.<br />
- 184 -
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Niederlande<br />
Abb. 37 Entwicklung der paramediz<strong>in</strong>ischen Berufe<br />
4000<br />
3500<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
1101<br />
1576<br />
occupational<br />
therapist<br />
1915<br />
3017<br />
3226<br />
3880<br />
Quelle: H<strong>in</strong>gstman/Harmsen 1994, VWS 1999<br />
2007<br />
2201 2172<br />
- 185 -<br />
1387<br />
1644 1770<br />
875<br />
1298<br />
1570<br />
1990<br />
1994<br />
1998<br />
228<br />
133<br />
speech therapist dietician excercise therapist dental hygienist podotherapist<br />
Im Gegensatz zum paramediz<strong>in</strong>ischen Personal fällt der Anteil der Hausärzte <strong>in</strong> den Health Centres<br />
überraschend ger<strong>in</strong>g aus. Zwar kann der niederländische Hausarzt nicht generell als E<strong>in</strong>zelkämpfer<br />
bezeichnet werden; die Abb. 38 zeigt jedoch, dass er sich lieber mit se<strong>in</strong>esgleichen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>schaftspraxis<br />
zusammentut, anstatt wie im Health Centre mit anderen Berufsgruppen zu kooperieren.<br />
Abb. 38 Verteilung der Hausärzte über verschiedene Praxisformen (<strong>in</strong> %)<br />
healthcenter<br />
group practise<br />
dual practice<br />
s<strong>in</strong>gle practice<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80<br />
Quelle: H<strong>in</strong>gstman/Harmsen 1994, CBS/VWS 1994 <strong>und</strong> später<br />
Die Kooperationsaktivitäten der Hausärzte s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e Reaktion auf die wachsenden Ansprüche, die ihre<br />
Tätigkeit mit sich br<strong>in</strong>gt. Steigende Patientenzahlen, Wochenend- <strong>und</strong> Nachtarbeit <strong>und</strong> e<strong>in</strong> breites<br />
Klientenspektrum erfordern Organisations- <strong>und</strong> Managementkompetenz, über die e<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>schaftspraxis<br />
eher verfügt als e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelner Hausarzt. In Rotterdam, Nijmegen <strong>und</strong> Maastricht haben<br />
sich Hausärzte aus diesen Gründen mit den Kl<strong>in</strong>iken zusammengeschlossen (Deurzen 2000). Sie organisieren<br />
<strong>in</strong> den dortigen Ambulanzen e<strong>in</strong>en Nachtdienst, an den sich die Patienten wenden können,<br />
1999<br />
1980<br />
355
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Niederlande<br />
während jeweils e<strong>in</strong> Hausarzt für die Hausbesuche abgestellt ist. Die Beteiligung an derartigen Projekten<br />
hat für die Hausärzte den Vorteil, dass die Arbeitswoche kürzer <strong>und</strong> berechenbarer wird; außerdem<br />
können die Fachärzte schnell h<strong>in</strong>zugezogen werden. Die Ambulanzstationen der Kl<strong>in</strong>iken h<strong>in</strong>gegen<br />
werden entlastet, da <strong>in</strong> Spitzenzeiten auf die anwesenden Hausärzte zurückgegriffen werden kann.<br />
Auch im kl<strong>in</strong>ischen Sektor führt die Transmuralisierung zu neuen unkonventionellen Versorgungsformen.<br />
So wurden <strong>in</strong> den Niederlanden bislang vier Zotels (Zorg-Hotels) errichtet, die e<strong>in</strong>e Mischung<br />
aus Kl<strong>in</strong>ik <strong>und</strong> Hotel darstellen (Zeggelt/Zemmel<strong>in</strong>k 1998; Roux/Eussen 1998). Gäste, die nach e<strong>in</strong>em<br />
Krankenhausaufenthalt weiterh<strong>in</strong> Pflege benötigen, können hier bis zu zwei Wochen unterkommen,<br />
vorausgesetzt sie benötigen ke<strong>in</strong>e weitere mediz<strong>in</strong>ische Behandlung, s<strong>in</strong>d ADL-unabhängig (advanced-daily-life)<br />
<strong>und</strong> nehmen die Schwester nicht länger als e<strong>in</strong>e halbe St<strong>und</strong>e täglich <strong>in</strong> Anspruch. Das<br />
Zotel ist also e<strong>in</strong>e Art Zwischenstation zwischen Kl<strong>in</strong>ik <strong>und</strong> eigenem Heim, wobei die Gäste zwar<br />
h<strong>in</strong>sichtlich ihrer Genesung beobachtet, aber nicht mehr behandelt werden. E<strong>in</strong>e Nacht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Zotel<br />
kostet weniger als e<strong>in</strong> Bettentag <strong>in</strong> der Kl<strong>in</strong>ik oder auch e<strong>in</strong> Tag Home Care-Versorgung, daher ist<br />
davon auszugehen, dass diese neue Ges<strong>und</strong>heits<strong>in</strong>stitution demnächst häufiger im niederländischen<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> zu beobachten se<strong>in</strong> wird. Bereits etablierter s<strong>in</strong>d h<strong>in</strong>gegen die Hospices, die Totkranke<br />
<strong>in</strong> ihrer letzten Lebensphase aufsuchen können. Im Gegensatz zu Kl<strong>in</strong>iken <strong>und</strong> Pflegeheimen<br />
besteht hier mehr Spielraum, um die Versorgung <strong>in</strong> der Sterbephase optimal zu gestalten, angefangen<br />
von akuter Schmerztherapie bis zur Unterbr<strong>in</strong>gung der Familienangehörigen. Viele Hospices s<strong>in</strong>d an<br />
Pflegeheime angegliedert oder <strong>in</strong> enger räumlicher Nähe zu Kl<strong>in</strong>iken <strong>und</strong> Pflegeheimen.<br />
5.2.3.3. Ambulante <strong>und</strong> kl<strong>in</strong>ische Pflege<strong>in</strong>stitutionen<br />
Der folgende Care and Nurs<strong>in</strong>g Index gibt e<strong>in</strong>en Überblick über die Verteilung <strong>und</strong> Entwicklung verschiedener<br />
Berufsgruppen im Pflegesektor, der ebenfalls über hohe Wachstumsraten verfügt. Die Daten<br />
zeigen, dass der stationäre Sektor nach wie vor das dom<strong>in</strong>ante Arbeitsfeld für Schwestern <strong>und</strong><br />
Pflegepersonal ist. Dies gilt für allgeme<strong>in</strong>e Kl<strong>in</strong>iken, psychiatrische Krankenhäuser <strong>und</strong> Pflegeheime<br />
sowie für E<strong>in</strong>richtungen zur Versorgung von Beh<strong>in</strong>derten <strong>und</strong> K<strong>in</strong>dern. Bei den Care Homes (betreutes<br />
Wohnen) s<strong>in</strong>d die Krankenschwestern rückläufig, dafür steigt die Anzahl der Pflege- <strong>und</strong> Haushaltshelfer.<br />
Ähnlich sieht es aus im Bereich Home Care: Hier f<strong>in</strong>den sich vor allem vermehrt assistant<br />
nurses, die unter der Aufsicht der Krankenschwestern arbeiten. Die Daten lassen sich dah<strong>in</strong>gehend<br />
<strong>in</strong>terpretieren, dass sich hochqualifzierte Krankenschwestern vor allem im mediz<strong>in</strong>ischen <strong>und</strong> kl<strong>in</strong>ischen<br />
Bereich konzentrieren, während der ambulante Pflegesektor eher e<strong>in</strong> Feld für das ger<strong>in</strong>ger qualifzierte<br />
Pflege- <strong>und</strong> Haushaltspersonal ist.<br />
- 186 -
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Niederlande<br />
Tab. 61 Beschäftigungsentwicklung im Bereich Pflege <strong>und</strong> Versorgung<br />
1990 = 100 1994 1995 1996 1997 abs. number<br />
abs FTE abs FTE abs FTE abs FTE 97<br />
Hospitals 114,9 106,6 118,0 109,3 121,4 112,8 124,3 115,2 72.399<br />
Normal 116,4 108,1 119,6 111,0 123,7 114,5 127,6 118,3 56.329<br />
Academical 114,5 105,8 115,4 107,0 117,7 109,4 120,9 111,1 12.551<br />
Categoral & rehabilitation 97,7 90,0 105,5 94,8 104,6 101,6 94,6 90,8 3.519<br />
Mental hospitals 120,2 114,6 125,3 119,2 131,4 122,9 135,9 129,0 19.480<br />
Institutions for mentally deficients<br />
1<br />
129,6 116,1 137,7 124,2 143,3 128,4 158,3 138,8 35.618<br />
Children's nurs<strong>in</strong>g 2<br />
120,9 109,3 122,6 108,0 127,0 111,9 137,7 114,8 2.116<br />
Nurs<strong>in</strong>g homes 126,5 114,6 131,9 120,6 138,2 127,4 142,7 132,3 55.902<br />
Care homes 107,1 99,2 108,3 97,8 109,1 99,0 112,9 100,9 47.011<br />
Nurses 86,3 82,7 85,0 80,8 85,4 81,1 79,3 78,1 4.086<br />
Assistant nurses 98,8 88,3 102,0 89,6 104,6 91,0 110,7 94,5 10.468<br />
Old people's aids 119,8 107,6 122,6 107,1 125,2 107,6 133,9 111,5 21.245<br />
Old people's helpers 110,5 100,4 110,0 96,4 109,8 93,7 106,5 90,6 5.157<br />
Other 102,1 102,7 99,3 97,5 94,6 91,7 100,3 94,4 6.339<br />
Home care 107,5 91,9 109,4 92,0 113,2 91,8 115,4 91,1 133.555 3<br />
Nurses 115,0 93,6 114,1 91,6 116,0 89,0 118,4 86,5 9.095<br />
Assistant nurses 149,9 116,8 160,2 120,0 178,7 125,4 193,7 131,2 4.076<br />
Maternity welfare workers 107,3 93,7 104,5 89,8 106,2 86,9 111,5 86,4 5.776<br />
Home helpers 105,4 89,1 107,6 89,8 111,4 90,1 113,0 89,4 113.920<br />
Other extramural work<strong>in</strong>g nurses 4<br />
109,9 103,5 100,6 94,0 90,6 82,7 93,5 86,0 3.325<br />
Public health service 100,5 96,8 77,2 70,6 54,9 45,5 57,5 48,0 889<br />
Occupational health service 109,7 96,3 102,0 95,9 95,7 90,8 93,5 88,3 571<br />
Ambulatory mental healthcare 121,6 118,3 128,7 124,7 130,9 126,9 135,3 133,2 1.586<br />
Trombosis services 114,7 91,8 111,6 89,8 112,4 90,5 124,0 100,7 279<br />
Total<br />
1 Includ<strong>in</strong>g sensorily handicapped<br />
113,8 104,1 116,8 106,3 120,5 108,8 124,4 111,6 369.406<br />
2 Includ<strong>in</strong>g nursery´s for toddlers <strong>und</strong>er medical supervision, children´s nurs<strong>in</strong>g homes<br />
3 Includ<strong>in</strong>g staff nurses (1997: 688)<br />
4 Exclud<strong>in</strong>g ambulance services (1997: 1752)<br />
Quelle: LCVV 1998<br />
Dass die Kl<strong>in</strong>iken <strong>in</strong> Bezug auf das Pflegepersonal steigende Wachstumsraten aufweisen, bedeutet<br />
nicht, dass sie unbed<strong>in</strong>gt den attraktiveren Arbeitsplatz bieten. Ganz im Gegenteil ist der stationäre<br />
Sektor durch extremen Personalmangel gekennzeichnet, hervorgerufen durch starke Arbeitsbelastung<br />
<strong>und</strong> ger<strong>in</strong>ge Entlohnung. Da der niederländische <strong>Arbeitsmarkt</strong> im Moment relativ entspannt ist, wandern<br />
viele Kräfte aus dem Ges<strong>und</strong>heitssektor ab. Die Kl<strong>in</strong>iken wiederum versuchen, über Aufrufe <strong>und</strong><br />
öffentliche Anwerbungskampagnen neues Personal zu gew<strong>in</strong>nen - häufig aus dem Ausland. Nicht<br />
selten kommt es aufgr<strong>und</strong> von Personalmangel zur Schließung ganzer Abteilungen. Auch dies ist e<strong>in</strong><br />
deutliches Indiz dafür, dass der stationäre Sektor <strong>in</strong> Holland über Wachstums- <strong>und</strong> Beschäftigungspotenziale<br />
verfügt, die momentan nicht ausgeschöpft werden können: Experten gehen davon aus, dass im<br />
Zuge des demographischen Wandels e<strong>in</strong> Beschäftigungsanstieg von 10% erforderlich wäre (Roodbol/Jaspers<br />
2000). Um die breite Palette der damit e<strong>in</strong>hergehenden Bedarfe zum<strong>in</strong>dest qualitativ abdecken<br />
zu können, wurden <strong>in</strong> den letzten Jahren e<strong>in</strong>e Reihe von Qualifizierungsmaßnahmen e<strong>in</strong>geleitet,<br />
die außerdem den Arbeitskräften e<strong>in</strong>e möglichst starke Mobilität <strong>in</strong> verschiedenen Sektoren des<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s ermöglichen sollen. Die Ausbildung im Bereich Pflege <strong>und</strong> Versorgung kann jetzt<br />
sukzessive durchlaufen werden <strong>und</strong> umfasst folgende Stufen, die jeweils auf e<strong>in</strong>e spezifische Bedarfsgruppe<br />
zugeschnitten s<strong>in</strong>d (De loopen 1998):<br />
- 187 -
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Niederlande<br />
Level 1 Domestic Welfare assistant ohne Ausbildung: Hauswirtschaftliche Dienste<br />
Level 2 Domestic Welfare assistant mit e<strong>in</strong>er zwei-jährigen Ausbildung: Hauswirtschaftliche Dienste, leichte Pflegedienste<br />
Level 3 Assistant nurse mit e<strong>in</strong>er drei-jährigen Ausbildung: Kurzzeitpflege, Mutterschaftsversorgung, Altenpflege, Pflege<br />
Beh<strong>in</strong>derter <strong>und</strong> chronisch Kranker<br />
Level 4 Nurse mit e<strong>in</strong>er vier-jährigen Ausbildung: Kl<strong>in</strong>ische Pflege, Schwangerschaftsversorgung, K<strong>in</strong>derpflege, Versorgung<br />
geistig <strong>und</strong> chronisch Erkrankter<br />
Level 5 (Specialist) Nurse mit e<strong>in</strong>er vier-jährigen Ausbildung: Kl<strong>in</strong>ische Intensivpflege, Schwangerschaftsversorgung,<br />
K<strong>in</strong>derpflege, Versorgung geistig <strong>und</strong> chronisch Erkrankter<br />
Mittlerweile wird auch vermehrt mit e<strong>in</strong>em neuem Schwesterntyp experimentiert, der nurse practitioner,<br />
die Rout<strong>in</strong>eaufgaben des Facharztes übernimmt (Schlooz-Vries et al. 2000; Roodbol/Jaspers<br />
2000). Diese Schwestern haben ihren eigenen Patientenstamm, den sie <strong>in</strong> enger Zusammenarbeit mit<br />
den Assistenzärzten <strong>und</strong> unter Supervision des Facharztes versorgen. Zu ihren Aufgaben gehört die<br />
medikalische Anamnese, Diagnose <strong>und</strong> die Ausführung standardisierter Behandlungspläne. Pflegeaufgaben<br />
vermischen sich also mit mediz<strong>in</strong>ischen Aufgaben, die unter Umständen auch akademischen<br />
Sachverstand erfordern. Aus diesem Gr<strong>und</strong> verlangt dieser Arbeitsplatz das höchste Qualifikationslevel<br />
5. Bislang werden nurse practitioners <strong>in</strong> elf Krankenhäusern e<strong>in</strong>gesetzt, man f<strong>in</strong>det sie zunehmend<br />
auch im ambulanten Bereich bei den Hausärzten.<br />
Als konkrete Versorgungs<strong>in</strong>stitution im Bereich Pflege wollen wir abschließend die Home Care-<br />
Entwicklung betrachten, die <strong>in</strong> der Mitte der 90er Jahre kurzzeitig extrem expandierte <strong>und</strong> seitdem e<strong>in</strong><br />
mehr oder weniger stabiles Wachstum aufweist. Home Care ist <strong>in</strong> den Niederlanden e<strong>in</strong> äußerst weites<br />
Feld, welches nicht nur Kranken- <strong>und</strong> Altenpflege <strong>in</strong> den eigenen vier Wänden e<strong>in</strong>schließt, sondern<br />
auch Familienhilfe im Krankheits- <strong>und</strong> Pflegefall sowie Mutter- <strong>und</strong> Säugl<strong>in</strong>gsbetreuung. Erbracht<br />
wird sie vor allem durch lokale geme<strong>in</strong>nützige Träger (kommerzielle Pflegedienste gibt es bislang<br />
wenig <strong>in</strong> den Niederlanden). Die mediz<strong>in</strong>ische Versorgung wird <strong>in</strong> der Regel durch die district nurses<br />
vorgenommen, wobei die Funktionen mit verschiedenen Qualifizierungsniveaus ausgeweitet werden.<br />
Die Daten zeigen, dass die Zahl der qualifizierten Schwestern rückläufig ist; benötigt werden h<strong>in</strong>gegen<br />
vor allem nurse assistants, die dem qualifizierten mediz<strong>in</strong>ischen Personal zur Hand gehen. Im Bereich<br />
der welfare worker, die für Pflege <strong>und</strong> Hilfe im Haushalt zuständig s<strong>in</strong>d, ist dies genau umgekehrt: Die<br />
Qualifizierungslevel A <strong>und</strong> B, welche sich vor allem auf Haushaltshilfe beziehen, s<strong>in</strong>d rückläufig;<br />
stattdessen f<strong>in</strong>den sich hier verstärkt qualifizierte Kräfte, die auch über Pflegekompetenzen verfügen.<br />
Dies lässt sich dah<strong>in</strong>gehend <strong>in</strong>terpretieren, dass Hilfe im Haushalt nur dann gewünscht ist, wenn auch<br />
bereits Pflegebedarf besteht – vorher reichen ansche<strong>in</strong>end die <strong>in</strong>formellen Netzwerke (Familie, Nachbarn,<br />
Fre<strong>und</strong>e) aus. Des weiteren zeigt sich, dass Home Care offensichtlich e<strong>in</strong> geeignetes Betätigungsfeld<br />
für paramediz<strong>in</strong>ische <strong>und</strong> soziale Berufe ist (<strong>in</strong>sbesondere für Sozialarbeiter <strong>und</strong> Ergotherapeuten).<br />
- 188 -
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Niederlande<br />
Tab. 62 Beschäftigungsentwicklung im Bereich Home Care<br />
FTE per 10.000 <strong>in</strong>habitants 1994 1995 1996 1997 1998 avg. yearly growth abs. number 98<br />
Welfare Workers<br />
Domestic welfare assistant A and B 12,37 11,70 11,70 10,76 10,20 -4,66% 37.907<br />
Welfare workers C and D 5,66 5,74 5,88 6,17 6,22 2,38% 18.659<br />
Specialist welfare workers E 0,57 0,61 0,62 0,62 0,61 1,80% 1.463<br />
Maternity welfare workers 2,81 2,69 2,55 2,50 2,50 -2,90% 5.906<br />
Maternity welfare workers <strong>in</strong> tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g<br />
Nurses<br />
0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 -17,28% 37<br />
District nurses 2,66 2,65 2,55 2,44 2,24 -4,17% 5.906<br />
District nurses not fully qualified 1,62 0,45 0,42 0,46 0,53 -13,52% 2.846<br />
Assistant nurses<br />
Medical and social professions<br />
1,16 1,20 1,26 1,30 3,91% 4.440<br />
Physicians <strong>in</strong>cl. paediatricians 0,17 0,17 0,18 0,18 2,54% 894<br />
Dieticians 0,15 0,15 0,15 0,15 1,09% 425<br />
Occupational therapists 0,01 0,01 18,09% 91<br />
Social workers 0,48 0,56 15,03% 1261<br />
Additional jobs (melkert-jobs) 1<br />
0,31 0,41 31,08% 1105<br />
Other staff carry<strong>in</strong>g out the work<br />
Adm<strong>in</strong>istration<br />
1,08 0,80 0,86 0,59 0,66 -9,68% 2125<br />
Directie / management 0,21 0,17 0,16 0,15 -10,19% 251<br />
Other executive staff 2,00 2,08 2,06 -0,52% 4.259<br />
Staff physicians 0,03 0,03 0,01 0,02 -17,34% 53<br />
Staff nurses 0,33 0,34 0,30 0,33 0,52% 791<br />
Clerical staff 1,71 1,67 1,51 1,63 -1,24% 3.878<br />
Other staff 5,58 1,10 1,34 1,38 1,40 -13,46% 4.038<br />
Total 26,77 31,80 32,01 31,41 31,17 4,20% 96.425<br />
1 Melkert-Jobs s<strong>in</strong>d politisch <strong>in</strong>itiierte Beschäftigungsangebote für Langzeitarbeitslose. Ihr Wachstum ist mit Vorsicht zu <strong>in</strong>terpretieren:<br />
Erstens wird die Rate zweifellos s<strong>in</strong>ken, wenn die Programme beendet werden, zweitens wird auch der Erfolg dieser Maßnahmen im Ges<strong>und</strong>heits-<br />
<strong>und</strong> Pflegebereich kontrovers e<strong>in</strong>geschätzt.<br />
Quelle: CBS/VWS 1996 <strong>und</strong> später<br />
Der gesamte Bereich Pflege <strong>und</strong> Versorgung zeichnet sich des weiteren durch e<strong>in</strong>en hohen Teilzeitanteil<br />
aus. Im Home Care-Sektor beispielsweise lässt der Anstieg der absoluten Beschäftigung auf<br />
recht hohe Wachstumsraten schließen. Da hier jedoch zwei bis drei Beschäftigte auf e<strong>in</strong>e Vollzeitstelle<br />
kommen, fällt das Wachstum im Vollzeitäquivalent erheblich bescheidener aus. Auch <strong>in</strong> den Kl<strong>in</strong>iken<br />
wird mit e<strong>in</strong>em weiteren Ansteig der Teilzeitarbeit zu rechnen se<strong>in</strong>: Kürzlich wurde e<strong>in</strong> Gesetz verabschiedet,<br />
das die Kl<strong>in</strong>iken verpflichtet, nahezu jedem Arbeitszeitwunsch ihrer Beschäftigten zu entsprechen.<br />
Die hohe Teilzeitrate korreliert mit dem hohen Anteil weiblicher Beschäftigung von fast<br />
90% (Ausnahme ist der Bereich ‘mental healthcare’ - hier stellen die Männer zwei Drittel der Beschäftigten)<br />
(Wiegers et al. 1999).<br />
5.2.3.4. Mental healthcare <strong>und</strong> Public Health<br />
Des weiteren lohnt e<strong>in</strong> detaillierter Blick auf den Bereich der geistigen Ges<strong>und</strong>heitsversorgung, der<br />
ebenfalls e<strong>in</strong> stark nachgefragter Sektor des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s ist. Der zunehmende Bedarf nach<br />
psychologischer Betreuung <strong>und</strong> Behandlung ist zweifellos e<strong>in</strong>e Reaktion auf Stress, Unsicherheit <strong>und</strong><br />
Leistungsdruck, also auf die Alltagsanforderungen, die moderne, <strong>in</strong>dividualisierte Gesellschaften mit<br />
sich br<strong>in</strong>gen. Die folgende Tabelle zeigt e<strong>in</strong>e Übersicht über die ambulatory mental healthcare<br />
(AGGZ), die von regionalen verbandlichen Ges<strong>und</strong>heitsdiensten (RIAGGs) oder von örtlichen Dro-<br />
- 189 -
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Niederlande<br />
genberatungen (CADs) erbracht wird. Die AGGZ ist seit 1994 um r<strong>und</strong> 17 Prozentpunkte gewachsen.<br />
Hier s<strong>in</strong>d es <strong>in</strong>sbesondere Psychotherapeuten, sozialpsychiatrische Schwestern <strong>und</strong> das Verwaltungspersonal,<br />
das starke Wachstumsraten aufzuweisen hat. Rückläufig h<strong>in</strong>gegen s<strong>in</strong>d Psychiater, Pädiater,<br />
Psychologen <strong>und</strong> andere akademische Grade. Es spricht vieles dafür, dass diese Berufsgruppen <strong>in</strong> den<br />
psychiatrisch orientierten kl<strong>in</strong>ischen oder universitären Bereich abwandern, der ja bekanntermaßen e<strong>in</strong><br />
starkes Wachstum zu verzeichnen hat. Stark abgenommen haben auch die Sozialarbeiter. Insgesamt<br />
spricht diese Entwicklung für e<strong>in</strong>e zunehmende Spezialisierung im Bereich geistiger Ges<strong>und</strong>heitsversorgung.<br />
Tab. 63 Beschäftigung <strong>in</strong> der ambulanten geistigen Ges<strong>und</strong>heitsversorgung<br />
1990=100, FTE 1981 1988 1991 1992 1993 1994 1997 abs. number 97<br />
Psychiatrists 79,4 98,7 94,2 93,9 96,0 92,6 95,5 526<br />
Paediatricians 114,3 128,6 171,4 128,6 171,4 85,7 20<br />
Other physicians 87,3 95,8 100,0 112,7 112,7 112,7 308<br />
Psychologists 94,6 122,7 107,7 106,1 105,1 103,5 96,4 652<br />
Other university grad. 51,5 94,2 105,2 119,0 112,6 101,8 78,8 360<br />
Psychotherapists 102,8 113,8 112,4 123,1 133,7 973<br />
Social-psychiatric nurses 57,7 93,0 98,2 106,2 111,4 115,5 127,8 1578<br />
Social workers 96,8 103,5 94,4 94,1 93,1 87,2 87,7 1239<br />
Clerical personnel 74,8 93,8 100,5 104,1 106,0 106,7 112,9 2123<br />
Other personnel 65,7 113,0 99,7 109,2 119,3 170,6 197,4 983<br />
Total 70,7 93,5 99,6 104,0 105,7 108,5 116,8 9283 1<br />
1 Includ<strong>in</strong>g prevention councillors (1997=341)<br />
Quelle: CBS/VWS 1982 <strong>und</strong> später<br />
Der steigende Bedarf nach mentaler Versorgung spiegelt sich auch im wachsenden Spektrum an Entspannungs-<br />
<strong>und</strong> Meditationsangeboten wider. ‚Onthaasten <strong>in</strong> het klooster‘ me<strong>in</strong>t zum Beispiel e<strong>in</strong>en<br />
kostengünstigen Wochenendaufenthalt im Kloster, wo <strong>in</strong> Stille <strong>und</strong> Kontemplation über das eigene<br />
Leben reflektiert werden kann (Het carriereblad voor de gezondheitszorg 2000). Besonders beliebt ist<br />
<strong>in</strong> den Niederlanden derzeit auch Tae-Bo (e<strong>in</strong>e Komb<strong>in</strong>ation verschiedener Kampfsportarten), welches<br />
das ohneh<strong>in</strong> schon breite Spektrum an Fitness, Calanetics, Aerobic u.ä. ergänzt. Diese Angebote zielen<br />
gleichermaßen auf körperliches <strong>und</strong> seelisches Wohlbef<strong>in</strong>den ab; sie s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>e Ges<strong>und</strong>heitsversorgung<br />
im eigentlichen S<strong>in</strong>ne, sondern <strong>in</strong>dividuelle Freizeitgestaltung, bei der aber der Faktor Ges<strong>und</strong>heit<br />
e<strong>in</strong>e ausschlaggebende Rolle spielt.<br />
Dass die Beschäftigungsentwicklung im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> eng mit politischen Regulierungsmaßnahmen<br />
verknüpft ist, zeigt sich besonders deutlich am Beispiel Public Health, also im Bereich Ges<strong>und</strong>heits<strong>in</strong>formation<br />
<strong>und</strong> –entwicklung. Zuständig hierfür s<strong>in</strong>d regionale, öffentliche Träger (GGDs), die<br />
<strong>in</strong> Ansätzen mit dem deutschen öffentlichen Ges<strong>und</strong>heitsdienst vergleichbar s<strong>in</strong>d. Zu ihren Aufgaben<br />
zählen Impfungen, Reihenuntersuchungen, Ges<strong>und</strong>heitsberichterstattung sowie sozial-präventive<br />
Maßnahmen bei Jugendlichen (z.B. Sprachtherapie), Arbeitsschutz <strong>und</strong> –ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> ambulante<br />
Notdienste. Seit Beg<strong>in</strong>n der 80er Jahre <strong>in</strong> hohem Maße politisch forciert <strong>und</strong> öffentlich f<strong>in</strong>anziert, stieg<br />
die Beschäftigtenanzahl <strong>in</strong> diesem Sektor von 5369 auf 7149 im Jahr 1994 (CBS/VWS 1994). Seitdem<br />
jedoch die Förderung Mitte der 90er Jahre stark zurückgefahren wurde, zeigt sich e<strong>in</strong> generell rückläufiges<br />
Bild: Die Beschäftigung s<strong>in</strong>kt mit e<strong>in</strong>er jahresdurchschnittlichen Rate von r<strong>und</strong> 5 Prozentpunkten.<br />
Besonders stark betroffen s<strong>in</strong>d Berufsgruppen, die auf der Versorgungsebene tätig s<strong>in</strong>d, z.B.<br />
Krankenschwestern, Sprachtherapeuten, das paramediz<strong>in</strong>ische Personal (Physiotherapeuten u.ä.) sowie<br />
- 190 -
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Niederlande<br />
die Verwaltung. Zu vermuten ist, dass e<strong>in</strong> Großteil dieser Berufsgruppen <strong>in</strong> den Home Care-Sektor<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> die Health Centres abwandern. Dafür weist die Kategorie der akademischen Berufe positive<br />
Wachstumsraten auf. Dies spricht dafür, dass Public Health <strong>in</strong> den Niederlanden e<strong>in</strong> relativ renommiertes<br />
Lehr- <strong>und</strong> Forschungsfeld ist, welches weiterh<strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Bedarf an Arbeitskräften aufweist. Diese<br />
Zuschneidung ist ebenfalls als Spezialisierungs<strong>in</strong>dikator zu <strong>in</strong>terpretieren.<br />
Tab. 64 Beschäftigungsentwicklung im Bereich Public Health<br />
1994=100, FTE 1981 1988 1994 1995 1996 1997 1998 abs. number 98<br />
Physicians 77,8 93,7 100,2 78,2 77,8 46,4 77,4 752<br />
Other university graduates 49,6 79,3 139,1 124,1 128,2 45,5 92,5 246<br />
Nurses 94,4 96,7 98,5 43,1 45,4 39,4 50,5 659<br />
Speech therapists 91,1 85,7 76,0 70,9 59,3 69,4 179<br />
Paramedical, medical auxiliary personnel 94,4 86,3 93,4 76,8 75,9 73,1 78,5 557<br />
Social workers 167,6 130,9 116,2 92,6 85,3 76,5 108,8 74<br />
Clerical personnel 89,6 89,6 101,5 85,3 83,5 62,9 80,2 905<br />
Other personnel 104,8 108,0 132,7 110,5 112,6 62,5 122,0 455<br />
Total 85,4 93,3 102,6 69,0 69,0 49,6 70,9 3993 1<br />
1 Includ<strong>in</strong>g dentists (14), psychologists (32), epidemiologists (58)<br />
Quelle: CBS/VWS 1982 <strong>und</strong> später<br />
5.2.4. Zusammenfassung<br />
Zunächst lässt sich beobachten, dass die Kostendämpfungspolitik <strong>in</strong> den Niederlanden spätestens seit<br />
Mitte der 90er Jahre zu e<strong>in</strong>er Reduzierung der Ausgaben, der Bettendichte, der Anzahl der E<strong>in</strong>richtungen<br />
<strong>und</strong> der Pflegetage führte. Auch auf die Beschäftigungsentwicklung hat sich dies niedergeschlagen.<br />
Zwar wächst die Beschäftigungsanzahl weiterh<strong>in</strong> an, bei e<strong>in</strong>er detaillierten Betrachtung zeigt sich<br />
jedoch, dass die Wachstumsraten ger<strong>in</strong>ger geworden s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> dass e<strong>in</strong> hoher Anteil der Beschäftigungszuwächse<br />
auf Teilzeit zurückzuführen ist. Des Weiteren weisen die Wachstumsraten <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen<br />
Sektoren e<strong>in</strong>e große Spannbreite auf. Außerordentlich hohe Raten f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> den Sektoren<br />
Rehabilitation, mental healthcare <strong>und</strong> bei der Versorgung Beh<strong>in</strong>derter. Auch das Wachstum im Bereich<br />
Pflege für Ältere ist beachtenswert, wenn auch bislang noch nicht so stark wie <strong>in</strong> Deutschland.<br />
Die Expansion dieser Bereiche korrespondiert mit den Bedarfslagen, die sich im Zuge des demographischen<br />
<strong>und</strong> sozialen Wandels ausbilden – <strong>und</strong> trotz aller Kostendämpfung ist die Entwicklung <strong>in</strong><br />
diesen Feldern durchaus politisch gewollt. So wurden <strong>in</strong>sbesondere die <strong>in</strong> diesem Kapitel diskutierten<br />
‚neuen‘ Versorgungsformen zunächst massiv öffentlich gefördert, da sie e<strong>in</strong>e effiziente <strong>und</strong> bedarfsgerechte<br />
Leistungserbr<strong>in</strong>gung versprachen. Die meisten Institutionen (bis auf Public Health) konnten<br />
sich auch nach Reduzierung der Förderung behaupten, wenngleich sich die Wachstumsraten auf e<strong>in</strong>em<br />
niedrigeren Niveau e<strong>in</strong>pendelten. Erstaunlich ist, dass trotz anderer ges<strong>und</strong>heitspolitischer Intentionen<br />
der kl<strong>in</strong>ische Sektor e<strong>in</strong> zwar ger<strong>in</strong>ges, aber sehr stabiles Wachstum aufweist (wobei davon auszugehen<br />
ist, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften zur Zeit nicht gedeckt werden kann), während die<br />
Entwicklung im ambulanten Bereich eher rückläufig ist. In diesem Zusammenhang fällt auch auf, dass<br />
die Entwicklung der Hausärzte als gate keeper relativ unspektakulär verläuft. Sie weisen nicht nur<br />
ger<strong>in</strong>ge Wachstumsraten auf, sondern s<strong>in</strong>d auch weniger präsent als andere Berufsgruppen, wenn es<br />
um <strong>in</strong>novative E<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong> Versorgungsprozesse geht. Zwar laufen die politischen Intentionen<br />
- 191 -
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Niederlande<br />
auf e<strong>in</strong>e Aufwertung der hausärztlichen Tätigkeit h<strong>in</strong>aus, dennoch entsteht der E<strong>in</strong>druck, dass die Innovations’musik‘<br />
eher bei anderen Ges<strong>und</strong>heitsakteuren spielt.<br />
Parallel zur sektoralen Entwicklung durchlaufen e<strong>in</strong>ige Berufsgruppen zur Zeit e<strong>in</strong>e äußerst spannende<br />
Phase. Hierzu gehört vor allem das paramediz<strong>in</strong>ische Personal, Hebammen <strong>und</strong> das Pflegepersonal.<br />
Insbesondere die letzte Kategorie ist auch bevorzugtes politisches Regulierungsobjekt. Kennzeichnend<br />
ist, dass über sukzessive Qualifizierungsstufen e<strong>in</strong>e möglichst hohe Anpassung an verschiedene Ges<strong>und</strong>heits-,<br />
Pflege- <strong>und</strong> Haushaltsbedürfnisse gewährleistet werden soll, die sich im Zuge des demographischen<br />
<strong>und</strong> sozialen Wandels herauskristallisieren. Im stationären Sektor werden vor allem hochqualifizierte<br />
Schwestern benötigt, die auch ärztliche Aufgaben übernehmen können, der ambulante<br />
Sektor h<strong>in</strong>gegen fragt verstärkt ‚multioptionale‘ Kräfte nach, die gleichermaßen Pflege- <strong>und</strong> hauswirtschaftliche<br />
Kompetenzen vere<strong>in</strong>en. Der Aufstieg des paramediz<strong>in</strong>ischen Personals h<strong>in</strong>gegen vollzieht<br />
sich bislang politisch relativ unbemerkt. Hier könnte die These vom Wachstumsmarkt Ges<strong>und</strong>heit<br />
zutreffend se<strong>in</strong>; offensichtlich treffen Ges<strong>und</strong>heitsleistungen, die ergänzend zu den Kernleistungen<br />
angeboten werden, auf e<strong>in</strong>en starken Bedarf <strong>in</strong> der Bevölkerung, der auch zu e<strong>in</strong>em großen Teil privat<br />
f<strong>in</strong>anziert wird. Anzumerken ist noch, dass sich diese Berufsgruppen durch e<strong>in</strong>en hohen Frauenanteil,<br />
durch e<strong>in</strong> verhältnismäßig junges Alter <strong>und</strong> durch e<strong>in</strong>e hohe Teilzeitrate auszeichnen.<br />
Weiterh<strong>in</strong> ist zu beobachten, dass trotz aller Transmuralisierungsstrategien <strong>in</strong> den betrachteten Institutionen<br />
Wanderungsbewegungen sichtbar werden, die auf e<strong>in</strong>e weitergehende Ausdifferenzierung <strong>und</strong><br />
Spezialisierung im niederländischen <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> schließen lassen. In der ambulanten mental<br />
healthcare konstituiert sich derzeit e<strong>in</strong> Berufsprofil, das durch hohe fachliche Qualifikation <strong>und</strong> praktischen<br />
Bezug gekennzeichnet ist (Psychotherapeuten, sozialpsychiatrische Schwestern). Der Public<br />
Health Sektor h<strong>in</strong>gegen akademisiert sich. Versorgungsdienste im eigentlichen S<strong>in</strong>ne f<strong>in</strong>den sich vor<br />
allem <strong>in</strong> den Health Centres (Sprachtherapeuten, paramediz<strong>in</strong>isches Personal) <strong>und</strong> im Home Care-<br />
Sektor (nurse assistants, welfare workers, Sozialarbeiter/<strong>in</strong>nen) - erstere bezogen auf Ges<strong>und</strong>heit,<br />
letztere bezogen auf Pflege, aber beide mit e<strong>in</strong>em hohen Anteil an ausführenden Berufsgruppen mit<br />
starkem Praxisbezug. Die hier angesprochenen Institutionen s<strong>in</strong>d moderne Institutionen, die sich erst<br />
seit den letzten zwanzig Jahren im ambulanten Sektor etabliert haben. Sie haben die typische Phase<br />
der Expansion bereits h<strong>in</strong>ter sich <strong>und</strong> durchlaufen derzeit e<strong>in</strong>e Phase der Konsolidierung, die e<strong>in</strong>erseits<br />
die Wachstumsraten erwartungsgemäß senkt, andererseits aber e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>terne Dyamik erzeugt, die auf<br />
e<strong>in</strong>e Neuzuschneidung von Professionen <strong>und</strong> Aufgaben h<strong>in</strong>ausläuft. Aber auch bei den stationären<br />
Institutionen ist der Trend zur mediz<strong>in</strong>isch-kl<strong>in</strong>ischen Ausrichtung ungebrochen. Diese kont<strong>in</strong>uierliche<br />
Ausdifferenzierung lässt die Strategie der Transmuralisierung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em anderen Licht ersche<strong>in</strong>en.<br />
Transmuralisierung reduziert offensichtlich nicht Spezialisierung, sie ist vielmehr e<strong>in</strong> Instrument, um<br />
die wachsende Komplexität des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s <strong>in</strong> den Griff zu bekommen. Ähnlich müssen auch<br />
andere Prozess<strong>in</strong>novationen – Qualitätsmanagement, E<strong>in</strong>satz neuer Medien – bewertet werden: Sie<br />
machen das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> nicht ‚e<strong>in</strong>facher‘, sondern stellen Mittel <strong>und</strong> Wege zur Verfügung, die<br />
Tätigkeiten auf unterschiedlichen Ebenen <strong>und</strong> Sektoren zu koord<strong>in</strong>ieren.<br />
E<strong>in</strong>e abschließende Bewertung der beobachteten Entwicklungen könnte folgendermaßen lauten: Bei<br />
oberflächlicher Betrachtung sche<strong>in</strong>t sich die Beschäftigungsentwicklung im Zuge der Kostendämpfung<br />
derzeit zu verlangsamen. Erst der detaillierte Blick auf e<strong>in</strong>zelne Sektoren <strong>und</strong> Professionsgruppen<br />
fördert Wandlungsprozesse zu Tage, die nicht nur auf sektorale Expansionen schließen lassen, sondern<br />
- 192 -
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> Niederlande<br />
auch auf e<strong>in</strong>en generellen Trend <strong>in</strong> Richtung Spezialisierung, Funktionsorientierung <strong>und</strong> Effizienzsteigerung.<br />
Die Entwicklung des Ges<strong>und</strong>heitssystems präsentiert sich wie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Stich von Escher:<br />
Fische schwimmen rechts here<strong>in</strong>, Gänse fliegen l<strong>in</strong>ks heraus – die Verwandlung, die sich <strong>in</strong> der Mitte<br />
vollzieht, bleibt für das Auge des Betrachters vage. Entsprechend beobachten wir auch nicht ‚den<br />
Boom‘, sondern e<strong>in</strong>en eher graduellen Wandel des Ges<strong>und</strong>heitssystems, der sich an unterschiedlichen<br />
Fronten unterschiedlich stark vollzieht. Diese Entwicklung ist zu großen Teilen politisch <strong>in</strong>tendiert,<br />
geht aber nicht mit e<strong>in</strong>em großen neuen Reformplan e<strong>in</strong>her. Vielmehr spiegelt sich <strong>in</strong> der Beschäftigungsentwicklung<br />
die Strategie des gegenwärtigen M<strong>in</strong>isteriums wider, auf umwälzende Reformen zu<br />
verzichten <strong>und</strong> statt dessen <strong>in</strong>nerhalb der bestehenden Strukturen die Funktionsfähigkeit des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s<br />
zu verbessern <strong>und</strong> an gesellschaftliche Wandlungsprozesse anzupassen.<br />
- 193 -
5.3. Tabellenanhang<br />
Tabellenanhang<br />
194
Jahr Insgesamt <strong>in</strong> % davon<br />
1980 = Arzthelfer/<strong>in</strong> Zahnarzthelfer/<strong>in</strong> Apothekenhelfer/<strong>in</strong> / seit 1993 phar- Ges<strong>und</strong>heitshandwerk<br />
100<br />
mazeutisch-kaufm. Angestellte/r<br />
zusam- <strong>in</strong> % darunter zusam- <strong>in</strong> % darunter zusam- <strong>in</strong> % darunter zusam- <strong>in</strong> % darunter<br />
men 1980 =<br />
men 1980 =<br />
men 1993 =<br />
men 1980 =<br />
100<br />
100<br />
100<br />
100<br />
weibl. <strong>in</strong> ausl. <strong>in</strong><br />
weibl. <strong>in</strong> ausl. <strong>in</strong><br />
weibl. <strong>in</strong> ausl. <strong>in</strong><br />
weibl. <strong>in</strong> ausl. <strong>in</strong><br />
% von % von<br />
% von % von<br />
% von % von<br />
% von % von<br />
zus. zus.<br />
zus. zus.<br />
zus. zus.<br />
zus. zus.<br />
1980 22.660 100,0 11.051 100,0% 99,9% 3.440 100,0% 100,0% 2.616 100,0% 99,9% 5.553 100,0% 39,7%<br />
1985 27.507 121,4 11.328 102,5% 99,9% 7.377 214,4% 100,0% 2.836 108,4% 100,0% 5.966 107,4% 51,5%<br />
1986 26.961 119,0 11.312 102,4% 99,9% 7.410 215,4% 99,9% 2.548 97,4% 99,9% 5.691 102,5% 50,3%<br />
1987 25.625 113,1 10.455 94,6% 99,9% 7.257 211,0% 100,0% 2.303 88,0% 99,9% 5.610 101,0% 53,0%<br />
1988 27.823 122,8 12.695 114,9% 99,9% 7.459 216,8% 100,0% 2.138 81,7% 100,0% 5.531 99,6% 54,0%<br />
1989 26.134 115,3 11.951 108,1% 99,9% 7.252 210,8% 100,0% 2.013 76,9% 100,0% 4.918 88,6% 58,8%<br />
1990 25.970 114,6 12.406 112,3% 99,9% 7.217 209,8% 100,0% 1.991 76,1% 99,8% 4.356 78,4% 57,3%<br />
1991 27.859 122,9 13.841 125,2% 99,9% 7.436 216,2% 100,0% 2.085 79,7% 99,8% 4.497 81,0% 58,8%<br />
1992 29.915 132,0 14.444 130,7% 99,9% 7.806 226,9% 99,9% 2.328 89,0% 99,4% 5.337 96,1% 59,9%<br />
1993 30.377 134,1 14.822 134,1% 99,9% 16,1% 7.902 229,7% 99,9% 10,7% 1.931 73,8% 99,2% 28,5% 5.722 103,0% 58,4% 11,6%<br />
1994 29.738 131,2 14.135 127,9% 99,9% 16,7% 8.353 242,8% 99,9% 12,2% 1.408 53,8% 98,9% 29,9% 5.842 105,2% 57,5% 11,5%<br />
1995 29.928 132,1 13.888 125,7% 99,8% 15,2% 8.587 249,6% 100,0% 12,2% 1.739 66,5% 99,4% 25,2% 5.714 102,9% 56,0% 11,1%<br />
1996 29.117 128,5 12.885 116,6% 99,8% 15,2% 8.933 259,7% 100,0% 14,1% 1.784 68,2% 99,4% 26,7% 5.515 99,3% 54,6% 10,2%<br />
1997 29.195 128,8 12.542 113,5% 99,7% 15,8% 9.407 273,5% 99,9% 13,0% 1.829 69,9% 99,3% 26,7% 5.417 97,6% 54,9% 8,5%<br />
1998 27.926 123,2 11.668 105,6% 99,7% 14,2% 9.207 267,6% 99,9% 12,3% 1.865 71,3% 99,4% 25,1% 5.186 93,4% 54,7% 7,5%<br />
Quelle: LDS, Berufsbildungsstatistik, Berechnungen FfG<br />
Tab. A 1 Auszubildende an berufsbildenden Schulen, Frauen- <strong>und</strong> Ausländeranteil, 1980 - 1998<br />
Tabellenanhang, Daten zur Ausbildung <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen<br />
- 195 -
Tab. A 2 Auszubildende im Ges<strong>und</strong>heitshandwerk, Frauen- <strong>und</strong> Ausländeranteil, 1980 - 1998<br />
Jahr Insgesamt <strong>in</strong> %, darunter davon<br />
<strong>in</strong> % von<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
sonstige 1)<br />
<strong>in</strong> % von<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
Hörgeräte-akustiker/<strong>in</strong><br />
<strong>in</strong> % von<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
Orthopädiemechaniker/<strong>in</strong><br />
<strong>und</strong> Bandagist/<br />
<strong>in</strong><br />
<strong>in</strong> % von<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
Augenoptiker/<strong>in</strong><br />
<strong>in</strong> % von<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
Zahntechniker/<strong>in</strong><br />
ausländisch<br />
<strong>in</strong><br />
% von<br />
<strong>in</strong>sg.<br />
weiblich<br />
<strong>in</strong> % von<br />
<strong>in</strong>sg.<br />
1980 =<br />
100<br />
Tabellenanhang, Daten zur Ausbildung <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen<br />
1980 5.553 100,0% 39,7% 3.556 64,0% 1.478 26,6% 211 3,8% 68 1,2% 240 4,3%<br />
1985 5.966 107,4% 51,5% 3.718 62,3% 1.627 27,3% 186 3,1% 127 2,1% 308 5,2%<br />
1986 5.691 102,5% 50,3% 3.269 57,4% 1.726 30,3% 189 3,3% 153 2,7% 354 6,2%<br />
1987 5.610 101,0% 53,0% 3.062 54,6% 1.803 32,1% 192 3,4% 212 3,8% 341 6,1%<br />
1988 5.531 99,6% 54,0% 2.934 53,0% 1.900 34,4% 190 3,4% 192 3,5% 315 5,7%<br />
1989 4.918 88,6% 58,8% 2.509 51,0% 1.735 35,3% 199 4,0% 161 3,3% 314 6,4%<br />
1990 4.356 78,4% 57,3% 2.273 52,2% 1.469 33,7% 175 4,0% 149 3,4% 290 6,7%<br />
1991 4.497 81,0% 58,8% 2.526 56,2% 1.387 30,8% 186 4,1% 147 3,3% 251 5,6%<br />
1992 5.337 96,1% 59,9% 3.165 59,3% 1.479 27,7% 272 5,1% 174 3,3% 247 4,6%<br />
1993 5.722 103,0% 58,4% 11,6% 3.474 60,7% 1.505 26,3% 269 4,7% 207 3,6% 267 4,7%<br />
1994 5.842 105,2% 57,5% 11,5% 3.613 61,8% 1.441 24,7% 286 4,9% 226 3,9% 276 4,7%<br />
1995 5.714 102,9% 56,0% 11,1% 3.594 62,9% 1.316 23,0% 321 5,6% 238 4,2% 245 4,3%<br />
1996 5.515 99,3% 54,6% 10,2% 3.328 60,3% 1.228 22,3% 382 6,9% 271 4,9% 306 5,5%<br />
1997 5.417 97,6% 54,9% 8,5% 3.199 59,1% 1.205 22,2% 405 7,5% 284 5,2% 324 6,0%<br />
1998 5.186 93,4% 54,7% 7,5% 2.879 55,5% 1.162 22,4% 436 8,4% 316 6,1% 393 7,6%<br />
1)<br />
Thermometermacher/<strong>in</strong>, Brillenoptikschleifer/<strong>in</strong>, Chirurgiemechaniker/<strong>in</strong> , Pharmakant/<strong>in</strong>, Orthopädieschuhmacher/<strong>in</strong><br />
- 196 -<br />
Quelle: LDS, Berufsbildungsstatistik, Berechnungen FfG
Tab. A 3 Studierende der Studiengänge Humanmediz<strong>in</strong>, Pharmazie <strong>und</strong> Psychologie, Frauen- <strong>und</strong> Ausländeranteile, 1955 - 1998<br />
Psychologiestudent/<strong>in</strong>nen 4)<br />
Pharmaziestudent/<strong>in</strong>nen 3)<br />
Jahr Humanmediz<strong>in</strong>student/<strong>in</strong>nen 1)<br />
darunter<br />
Insgesamt <strong>in</strong> %<br />
1985 =<br />
100<br />
weibl. <strong>in</strong> % von<br />
<strong>in</strong>sg.<br />
darunter davon 2)<br />
<strong>in</strong>sge- <strong>in</strong> % darunter <strong>in</strong>sge- <strong>in</strong> %<br />
samt 1985 =<br />
samt 1985 =<br />
100<br />
100<br />
auslän- <strong>in</strong> % von allgeme<strong>in</strong>e Mediz<strong>in</strong>student/<strong>in</strong>nen Zahnmediz<strong>in</strong>student/<strong>in</strong>nen weibl. <strong>in</strong> % von<br />
disch <strong>in</strong>sg.<br />
<strong>in</strong>sg.<br />
zu- <strong>in</strong> % darunter zu- <strong>in</strong> % darunter<br />
sammen 1985 =<br />
sammen 1985 =<br />
100<br />
100<br />
weibl. <strong>in</strong> % von<br />
weibl. <strong>in</strong> % von<br />
zus.<br />
zus.<br />
Tabellenanhang, Daten zur Ausbildung <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen<br />
1955/56 2.506 2.125 683 32,1% 381 101 26,5% 520 353 67,9% 918 249 27,1%<br />
1960/61 5.609 1.091 19,5% 4.001 1.323 33,1% 517 144 27,9% 723 439 60,7% 400 191 47,8%<br />
1965/66 7.164 1.060 14,8% 6.304 1.735 27,5% 818 185 22,6% 860 457 53,1% 1.081 458 42,4%<br />
1970/71 7.862 756 9,6% 6.693 1.491 22,3% 1.169 164 14,0% 1.045 494 47,3% 2.088 839 40,2%<br />
1975/76 12.183 936 7,7% 10.759 3.068 28,5% 1.424 259 18,2% 1.346 626 46,5% 2.873 1.376 47,9%<br />
1980/81 21.093 1.330 6,3% 17.809 6.288 35,3% 1.954 415 21,2% 1.986 1.095 55,1% 4.229 2.233 52,8%<br />
1985/86 26.650 100,0% 1.590 6,0% 23.581 100,0% 10.184 43,2% 3.069 100,0% 849 27,7% 2.580 100,0% 1.652 64,0% 5.428 100,0% 3.122 57,5%<br />
1986/87 27.075 101,6% 1.625 6,0% 23.933 101,5% 10.409 43,5% 3.142 102,4% 903 28,7% 2.582 100,1% 1.703 66,0% 5.466 100,7% 3.229 59,1%<br />
1987/88 27.361 102,7% 1.671 6,1% 24.157 102,4% 10.689 44,2% 3.204 104,4% 950 29,7% 2.612 101,2% 1.725 66,0% 5.550 102,2% 3.322 59,9%<br />
1988/89 27.356 102,6% 1.728 6,3% 24.105 102,2% 10.882 45,1% 3.251 105,9% 1.032 31,7% 2.600 100,8% 1.733 66,7% 5.518 101,7% 3.358 60,9%<br />
1989/90 26.701 100,2% 1.723 6,5% 23.445 99,4% 10.590 45,2% 3.256 106,1% 1.091 33,5% 2.531 98,1% 1.703 67,3% 5.552 102,3% 3.432 61,8%<br />
1990/91 25.936 97,3% 1.693 6,5% 22.752 96,5% 10.205 44,9% 3.184 103,7% 1.096 34,4% 2.518 97,6% 1.693 67,2% 5.660 104,3% 3.515 62,1%<br />
1991/92 25.045 94,0% 1.660 6,6% 21.937 93,0% 9.854 44,9% 3.108 101,3% 1.140 36,7% 2.514 97,4% 1.722 68,5% 5.798 106,8% 3.668 63,3%<br />
1992/93 23.493 88,2% 1.731 7,4% 20.535 87,1% 9.259 45,1% 2.958 96,4% 1.131 38,2% 2.364 91,6% 1.669 70,6% 5.898 108,7% 3.879 65,8%<br />
1993/94 22.230 83,4% 1.821 8,2% 19.414 82,3% 8.837 45,5% 2.816 91,8% 1.135 40,3% 2.305 89,3% 1.652 71,7% 6.416 118,2% 4.329 67,5%<br />
1994/95 21.275 79,8% 1.970 9,3% 18.540 78,6% 8.554 46,1% 2.735 89,1% 1.159 42,4% 2.325 90,1% 1.699 73,1% 6.912 127,3% 4.680 67,7%<br />
1995/96 20.404 76,6% 2.128 10,4% 17.789 75,4% 8.356 47,0% 2.615 85,2% 1.122 42,9% 2.340 90,7% 1.691 72,3% 7.184 132,4% 4.889 68,1%<br />
1996/97 20.152 75,6% 2.283 11,3% 17.585 74,6% 8.434 48,0% 2.567 83,6% 1.142 44,5% 2.355 91,3% 1.647 69,9% 7.534 138,8% 5.130 68,1%<br />
1997/98 19.708 74,0% 2.252 11,4% 17.052 72,3% 8.271 48,5% 2.656 86,5% 1.224 46,1% 2.564 99,4% 1.793 69,9% 8.598 158,4% 5.866 68,2%<br />
1998/99 20.384 76,5% 2.463 12,1% 17.787 75,4% 8.806 49,5% 2.597 84,6% 1.240 47,7% 2.576 99,8% 1.798 69,8% 8.925 164,4% 6.188 69,3%<br />
1) WS 1960/61, 1965/66 Mediz<strong>in</strong> <strong>und</strong> Pharmazie zusammen für Angaben über die ausl. Studierenden; WS 1955/56 nur dt. Studierende; WS 1970/71 nur dt. bei Angaben über weibliche Studierende<br />
2) ausgenommen WS1975/1976, bis WS 1985/86 nur dt. Studierende<br />
3) WS 1970/71 e<strong>in</strong>schließlich Pharmazeutische Chemie, Pharmakognosie; bis WS 1985/86 nur dt. Studierende<br />
4) WS 1955/56 nur angegeben als Kulturwissenschaft, e<strong>in</strong>schließlich Philosophie, Pädagogik, Geschichte, Kunstwissenschaft, Musikwiss., Zeitungswiss., u.a.; ausgenommen Hochschule WS1975/1976, bis WS 1985/86<br />
nur dt. Studierende<br />
Quelle: LDS, Hochschulstatistik, Berechnungen FfG<br />
- 197 -
Tabellenanhang, Daten zur stationären Versorgung<br />
Tab. A 4 Allgeme<strong>in</strong>e Krankenhäuser - der relative Anteil der Berufsgruppen am Beschäftigungswachstum<br />
zwischen 1991 <strong>und</strong> 1995<br />
Berufsgruppe Relativer Anteil am Beschäftigungswachstum<br />
(<strong>in</strong> Prozent)<br />
Pflegepersonal 81,89<br />
Wirtschafts- <strong>und</strong> Technikbereich<br />
-102,17<br />
Ärzte 36,02<br />
med.tech.Assistenzberufe 39,04<br />
Funktionsdienst 32,78<br />
Verwaltung 16,75<br />
Vorsorge <strong>und</strong> Rehabilitation 11,67<br />
Sonderdienste -15,5<br />
Zahnärzte -0,48<br />
Gesamt 100<br />
Quelle: LDS Krankenhausstatistik, Berechnungen MHH<br />
Tab. A 5 Sonstige Krankenhäuser – der relative Anteil der Berufsgruppen am Beschäftigungswachstum<br />
zwischen 1991 <strong>und</strong> 1998<br />
Berufsgruppe Relativer Anteil am Beschäftigungswachstum<br />
(<strong>in</strong> Prozent)<br />
Pflegepersonal 44,62<br />
Wirtschafts- <strong>und</strong> Technikbereich<br />
28,4<br />
Ärzte -3,11<br />
med.tech.Assistenzberufe 5,72<br />
Funktionsdienst 11,27<br />
Verwaltung 4,58<br />
Vorsorge <strong>und</strong> Rehabilitation 1,99<br />
Sonderdienste 6,53<br />
Zahnärzte -<br />
Gesamt 100<br />
Quelle: LDS Krankenhausstatistik, Berechnungen MHH<br />
- 198 -
Tabellenanhang, Daten zur stationären Versorgung<br />
Tab. A 6 Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen - der relative Anteil der Berufsgruppen<br />
am Beschäftigungswachstum zwischen 1991 <strong>und</strong> 1998<br />
Berufsgruppe Relativer Anteil am Beschäftigungswachstum<br />
(<strong>in</strong> Prozent)<br />
Pflegepersonal 44,84<br />
Wirtschafts- <strong>und</strong> Technikbereich<br />
1,00<br />
Ärzte 6,5<br />
med.tech. Assistenzberufe 3,46<br />
Funktionsdienst 30,2<br />
Verwaltung 5,93<br />
Vorsorge <strong>und</strong> Rehabilitation 11,75<br />
Sonderdienste -3,68<br />
Gesamt 100<br />
Quelle: LDS Krankenhausstatistik, Berechnungen MHH<br />
Tab. A 7 Akutkrankenhäuser - der relative Anteil der Berufsgruppen am Beschäftigungswachstum<br />
zwischen 1965 <strong>und</strong> 1989<br />
Berufsgruppe Relativer Anteil am Beschäftigungswachstum<br />
(<strong>in</strong> Prozent)<br />
Ärzte 17,05<br />
Zahnärzte 0,3<br />
Pflegepersonal 61,86<br />
med.-tech. Assistenten 9,97<br />
Vorsorge <strong>und</strong> Rehabilitation 3,71<br />
Hebammen/Arbeitstherapeuten 1,71<br />
Wirtschaft <strong>und</strong> Verwaltung -<br />
Wirtschafts- <strong>und</strong> Technikbereich -<br />
Verwaltung -<br />
Sonderdienste 5,41<br />
Gesamt 100<br />
Quelle: LDS Krankenhausstatistik, Berechnungen MHH<br />
Tab. A 8 Sonderkrankenhäuser - der relative Anteil der Berufsgruppen am Beschäftigungswachstum<br />
zwischen 1975 <strong>und</strong> 1989<br />
Berufsgruppe Relativer Anteil am Beschäftigungswachstum<br />
(<strong>in</strong> Prozent)<br />
Ärzte 10,05<br />
Zahnärzte 0,02<br />
Pflegepersonal 47,83<br />
Med.-tech. Assistenten 2,36<br />
Vorsorge <strong>und</strong> Rehabilitation 14,59<br />
Hebammen/ Arbeitstherapeuten 7,73<br />
Wirtschafts- <strong>und</strong> Technikbereich 4,35<br />
Verwaltung 9,55<br />
Sonderdienste 3,53<br />
Gesamt 100<br />
Quelle: LDS Krankenhausstatistik, Berechnungen MHH<br />
- 199 -
Tabellenanhang, Daten zur ambulanten Versorgung<br />
Tab. A 9 Ärzte <strong>und</strong> Ärzt<strong>in</strong>nen nach Art der Tätigkeit <strong>und</strong> Frauenanteil, 1955 - 1998<br />
Jahr <strong>in</strong>sgesamt <strong>in</strong> % darunter davon<br />
1955 =<br />
100<br />
weiblich <strong>in</strong> %<br />
von<br />
<strong>in</strong>sg.<br />
<strong>in</strong> freier<br />
Praxis 1)<br />
<strong>in</strong> %<br />
von<br />
<strong>in</strong>sg.<br />
- 200 -<br />
hauptamtl.<br />
Krankenhaustätigkeit<br />
2)<br />
<strong>in</strong> %<br />
von<br />
<strong>in</strong>sg.<br />
sonst.<br />
Arbeitsbereiche<br />
3)<br />
1955 18.671 100,0% 2.593 13,9% 11.519 61,7% 5.700 30,5% 1.452 7,8%<br />
1960 20.959 112,3% 3.152 15,0% 13.214 63,0% 5.847 27,9% 1.898 9,1%<br />
1965 21.943 117,5% 3.476 15,8% 13.125 59,8% 6.653 30,3% 2.165 9,9%<br />
1970 25.865 138,5% 4.591 17,7% 12.943 50,0% 10.541 40,8% 2.381 9,2%<br />
1975 30.867 165,3% 5.792 18,8% 14.164 45,9% 14.353 46,5% 2.350 7,6%<br />
1980 35.114 188,1% 7.401 21,1% 15.074 42,9% 17.608 50,1% 2.432 6,9%<br />
1985 39.832 213,3% 9.347 23,5% 16.568 41,6% 20.814 52,3% 2.450 6,2%<br />
1986 40.492 216,9% 9.661 23,9% 16.950 41,9% 21.309 52,6% 2.233 5,5%<br />
1987 41.532 222,4% 10.147 24,4% 17.230 41,5% 21.902 52,7% 2.400 5,8%<br />
1988 42.206 226,1% 10.468 24,8% 17.578 41,6% 22.451 53,2% 2.177 5,2%<br />
1989 43.998 235,6% 11.262 25,6% 18.219 41,4% 23.583 53,6% 2.196 5,0%<br />
1990 49.984 267,7% 14.372 28,8% 18.454 36,9% 25.960 51,9% 5.570 11,1%<br />
1991 19.104 23.245<br />
1992 49.625 265,8% 12.156 24,5% 19.857 40,0% 23.818 48,0% 5.950 12,0%<br />
1993 51.389 275,2% 12.754 24,8% 21.589 42,0% 24.053 46,8% 5.747 11,2%<br />
1994 52.692 282,2% 14.549 27,6% 22.053 41,9% 24.690 46,9% 5.949 11,3%<br />
1995 54.026 289,4% 14.490 26,8% 22.426 41,5% 25.386 47,0% 6.214 11,5%<br />
1996 54.881 293,9% 14.851 27,1% 22.801 41,5% 25.778 47,0% 6.302 11,5%<br />
1997 56.565 303,0% 23.181 41,0% 25.762 45,5% 7.622 13,5%<br />
1998 57.155 306,1% 23.817 41,7% 25.811 45,2% 7.527 13,2%<br />
1) e<strong>in</strong>schließlich Assistenzärzten bei Ärzten <strong>in</strong> freier Praxis; 1955-1989 Statistik Berufe des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s; 1990 - 1998 Angaben der<br />
Ärztekammern Nordrhe<strong>in</strong> <strong>und</strong> Westfalen-Lippe<br />
2) 1955-1989 Statistik Berufe des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s; 1990 Ärztekammern Nordrhe<strong>in</strong> <strong>und</strong> Westfalen-Lippe; 1991 - 1998 Krankenhausstatistik,<br />
ohne Belegärzt/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> ohne Ärzt/<strong>in</strong>nen im Praktikum<br />
3) e<strong>in</strong>schließlich staatlichen, gewerbeärztlichen Dienst, öffentlichen Ges<strong>und</strong>heitsdienst, Sozialversicherung, Versorgungswesen, Arbeitsverwaltung,<br />
B<strong>und</strong>eswehr, B<strong>und</strong>esgrenzschutz, Polizeidienst, wissenschaftl.-theoretischen Instituten, Industrie u. Privatwirtschaft; 1955 -<br />
1989 Statistik Berufe des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s, Angaben systematisch zu niedrig; 1990 - 1998 Angaben der Ärztekammern Nordrhe<strong>in</strong> <strong>und</strong><br />
Westfalen-Lippe<br />
Quellen: LDS, Berufe des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s, Berechnungen FfG<br />
<strong>in</strong> %<br />
von<br />
<strong>in</strong>sg.
Tabellenanhang, Daten zur ambulanten Versorgung<br />
Tab. A 10 Zahnärzte <strong>und</strong> -ärzt<strong>in</strong>nen nach Art der Tätigkeit <strong>und</strong> Frauenanteil, 1955 – 1998<br />
Jahr Zahnärzte 1)<br />
<strong>in</strong>sgesamt darunter davon<br />
<strong>in</strong> %<br />
1955<br />
= 100<br />
weiblich <strong>in</strong> %<br />
von<br />
<strong>in</strong>sg.<br />
<strong>in</strong> freier<br />
Praxis 2)<br />
<strong>in</strong> %<br />
von<br />
<strong>in</strong>sg.<br />
- 201 -<br />
hauptamtl.<br />
Krankenhaustätigk.<br />
<strong>in</strong> %<br />
von<br />
<strong>in</strong>sg.<br />
sonst.<br />
Arbeitsbereiche<br />
3)<br />
1955 7.090 7.090 100,0<br />
1965 7.574 106,8 1.069 14,1 7.316 96,6 109 1,4 149 2,0<br />
1975 7.625 107,5 1.351 17,7 7.226 94,8 215 2,8 184 2,4<br />
1985 8.692 122,6 1.853 21,3 8.202 94,4 311 3,6 179 2,1<br />
1986 8.926 125,9 1.947 21,8 8.417 94,3 322 3,6 187 2,1<br />
1987 9.277 130,8 2.058 22,2 8.762 94,4 326 3,5 189 2,0<br />
1988 9.328 131,6 2.028 21,7 8.836 94,7 331 3,5 161 1,7<br />
1989<br />
1990<br />
9.475 133,6 2.099 22,2 8.983 94,8 336 3,5 156 1,6<br />
1991 9.307 131,3 2.126 22,8 8.824 94,8 288 3,1 195 2,1<br />
1992 9.719 137,1 2.289 23,6 9.272 95,4 272 2,8 175 1,8<br />
1993 10.003 141,1 2.406 24,1 9.563 95,6 263 2,6 177 1,8<br />
1994 10.507 148,2 2.679 25,5 10.093 96,1 252 2,4 162 1,5<br />
1995 10.484 147,9 2.660 25,4 10.076 96,1 206 2,0 202 1,9<br />
1996 10.586 149,3 2.681 25,3 10.142 95,8 257 2,4 187 1,8<br />
1) 1955 Zahnärzte <strong>und</strong> Dentisten zusammen<br />
2) e<strong>in</strong>schließlich Assistenzärzten bei Ärzten <strong>in</strong> freier Praxis<br />
3) e<strong>in</strong>schließlich staatlichen, gewerbeärztlichen Dienst, öffentlichen Ges<strong>und</strong>heitsdienst, Sozialversicherung, Versorgungswesen, Arbeitsverwaltung,<br />
B<strong>und</strong>eswehr, B<strong>und</strong>esgrenzschutz, Polizeidienst, wissenschaftl.-theoretischen Instituten, Industrie u. Privatwirtschaft; 1955 -<br />
1989 Statistik Berufe des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s, Angaben systematisch zu niedrig; 1990 - 1998 Angaben der Ärztekammern Nordrhe<strong>in</strong> <strong>und</strong><br />
Westfalen-Lippe<br />
Quellen: LDS, Berufe des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s, Berechnungen FfG<br />
<strong>in</strong> %<br />
von<br />
<strong>in</strong>sg.
Tab. A 11 Niedergelassene Ärzte <strong>und</strong> Ärzt<strong>in</strong>nen nach ausgewählten Gebietsbezeichnungen, 1980 - 1998<br />
Jahr Allgeme<strong>in</strong>mediz<strong>in</strong> 1)<br />
E<strong>in</strong>w. je<br />
Facharzt 4)<br />
Tabellenanhang, Daten zur ambulanten Versorgung<br />
Innere Mediz<strong>in</strong> Frauenheilk<strong>und</strong>e K<strong>in</strong>derheilk<strong>und</strong>e<br />
Insgesamt <strong>in</strong> % E<strong>in</strong>wohner <strong>in</strong>sgesamt <strong>in</strong> % E<strong>in</strong>w. je<br />
1980 = je Arzt<br />
1980 = Facharzt<br />
100<br />
100<br />
2)<br />
<strong>in</strong>sgesamt <strong>in</strong> % E<strong>in</strong>w. je<br />
1980 = Facharzt<br />
100<br />
3)<br />
<strong>in</strong>sgesamt <strong>in</strong> %<br />
1980 =<br />
100<br />
1980 6.041 100,0% 2.824 2.807 100,0% 4.996 1.336 100,0% 5.553 835 100,0% 3.634<br />
1985 6.302 104,3% 2.646 3.079 109,7% 4.614 1.573 117,7% 4.776 926 110,9% 2.663<br />
1986 6.418 106,2% 2.598 3.128 111,4% 4.552 1.612 120,7% 4.667 953 114,1% 2.557<br />
1987 6.466 107,0% 2.583 3.165 112,8% 4.506 1.654 123,8% 4.553 970 116,2% 2.516<br />
1988 6.591 109,1% 2.560 3.196 113,9% 4.503 1.697 127,0% 4.457 976 116,9% 2.545<br />
1989 6.721 111,3% 2.545 3.225 114,9% 4.505 1.737 130,0% 4.389 976 116,9% 2.637<br />
1990 6.835 113,1% 2.538 3.275 116,7% 4.480 1.784 133,5% 4.304 1.006 120,5% 2.661<br />
1991 7.004 115,9% 2.500 3.362 119,8% 4.391 1.841 137,8% 4.188 1.044 125,0% 2.631<br />
1992 7.178 118,8% 2.463 3.619 128,9% 4.107 1.904 142,5% 4.068 1.086 130,1% 2.592<br />
1993 7.819 129,4% 2.271 3.679 131,1% 4.050 2.052 153,6% 3.781 1.153 138,1% 2.481<br />
1994 7.933 131,3% 2.246 3.751 133,6% 3.979 2.091 156,5% 3.715 1.172 140,4% 2.466<br />
1995 7.952 131,6% 2.250 3.790 135,0% 3.953 2.126 159,1% 3.664 1.190 142,5% 2.446<br />
1996 8.069 133,6% 2.224 3.823 136,2% 3.929 2.142 160,3% 3.644 1.202 144,0% 2.436<br />
1997 8.129 134,6% 2.211 3.885 138,4% 3.871 2.148 160,8% 3.638 1.215 145,5% 2.416<br />
1998 8.231 136,3% 2.184 3.912 139,4% 3.845 2.175 162,8% 3.592 1.234 147,8% 2.377<br />
1)<br />
e<strong>in</strong>schließl. praktischen Ärzten <strong>und</strong> Ärzten ohne Gebietsbezeichnung<br />
2)<br />
15 Jahre <strong>und</strong> älter<br />
3)<br />
Frauen, 15 Jahre <strong>und</strong> älter<br />
4)<br />
0 bis unter 15 Jahre<br />
Quelle: Ärztekammer Nordrhe<strong>in</strong>, Ärztekammer Westfalen-Lippe, Ärzteregister Nordrhe<strong>in</strong> <strong>und</strong> Westfalen-Lippe, zitiert nach Landes<strong>in</strong>stitut<br />
für den öffentlichen Ges<strong>und</strong>heitsdienst, Ges<strong>und</strong>heits<strong>in</strong>dikator 8.6, Berechnungen FfG<br />
- 202 -
Tabellenanhang, Daten zur ambulanten Versorgung<br />
Tab. A 12 Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Krankengymnast/<strong>in</strong>nen, Masseur/<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> verwandte Berufe, 1991 - 1998<br />
Jahr <strong>in</strong>sgesamt <strong>in</strong> % 1991 = davon<br />
100 im Krankenhaus<br />
<strong>in</strong> % 1991<br />
= 100<br />
<strong>in</strong> % von<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
- 203 -<br />
<strong>in</strong> sonsti- <strong>in</strong> % 1991 <strong>in</strong> % von<br />
genBerei- = 100<br />
chen<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
1991 15.543 6.546 100,0% 42,1% 8.997 100,0% 57,9%<br />
1992 16.698 107,43% 6.868 104,9% 41,1% 9.830 109,3% 58,9%<br />
1993 17.207 110,71% 7.071 108,0% 41,1% 10.136 112,7% 58,9%<br />
1994 18.092 116,40% 7.698 117,6% 42,5% 10.394 115,5% 57,5%<br />
1995 18.974 122,07% 8.422 128,7% 44,4% 10.552 117,3% 55,6%<br />
1996 20.188 129,88% 8.120 124,0% 40,2% 12.068 134,1% 59,8%<br />
1997 19.653 126,44% 8.051 123,0% 41,0% 11.602 129,0% 59,0%<br />
1998 20.583 132,43% 8.112 123,9% 39,4% 12.471 138,6% 60,6%<br />
Quelle: LAA, Beschäftigtenstatistik, 31.6., Krankenhausstatistik, Berechnungen FfG<br />
Tab. A 13 Apotheken, 1955 - 1996<br />
Jahr <strong>in</strong>sgesamt <strong>in</strong> % darunter<br />
1955 =<br />
100<br />
öffentliche<br />
Apotheken<br />
1)<br />
<strong>in</strong> %<br />
1955 =<br />
100<br />
<strong>in</strong> % von<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
öffentliche<br />
Apotheken<br />
pro<br />
100.000 E<br />
Krankenhausapotheken<br />
<strong>in</strong> %<br />
1955 =<br />
100<br />
<strong>in</strong> % von<br />
<strong>in</strong>sgesamt<br />
1955 1.682 100,0% 1.546 100,0% 91,9% 71 100,0% 4,2%<br />
1960 2.536 150,8% 2.394 154,9% 94,4% 80 112,7% 3,2%<br />
1965 2.922 173,7%<br />
1970 3.204 190,5% 3.095 200,2% 96,6% 18,3 109 153,5% 3,4%<br />
1975 3.884 230,9% 3.760 243,2% 96,8% 21,9 124 174,6% 3,2%<br />
1980 4.509 268,1% 4.375 283,0% 97,0% 25,7 134 188,7% 3,0%<br />
1985 4.914 292,2% 4.725 305,6% 96,2% 28,3 189 266,2% 3,8%<br />
1986 4.974 295,7% 4.786 309,6% 96,2% 28,7 188 264,8% 3,8%<br />
1987 4.995 297,0% 4.808 311,0% 96,3% 28,8 187 263,4% 3,7%<br />
1988 5.010 297,9% 4.826 312,2% 96,3% 28,7 184 259,2% 3,7%<br />
1989<br />
1990<br />
5.029 299,0% 4.845 313,4% 96,3% 28,6 184 259,2% 3,7%<br />
1991 5.073 301,6% 4.890 316,3% 96,4% 28,1 183 257,7% 3,6%<br />
1992 5.096 303,0% 4.912 317,7% 96,4% 27,9 184 259,2% 3,6%<br />
1993 5.082 302,1% 4.897 316,8% 96,4% 27,6 185 260,6% 3,6%<br />
1994 5.040 299,6% 4.861 314,4% 96,4% 27,3 179 252,1% 3,6%<br />
1995 5.040 299,6% 4.860 314,4% 96,4% 27,2 180 253,5% 3,6%<br />
1996 5.035 299,3% 4.857 314,2% 96,5% 27,1 178 250,7% 3,5%<br />
1)<br />
Voll- <strong>und</strong> Zweigapotheke, Anzahl der Zweigapotheken liegt unter 30<br />
Quelle: LDS, Beschäftigte im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> <strong>und</strong> Jahresges<strong>und</strong>heitsbericht NRW, Berechnungen FfG
Tab. A 14 Personal der unteren Ges<strong>und</strong>heitsbehörden, 1965 - 1998<br />
davon<br />
<strong>in</strong> %<br />
1985 =<br />
100<br />
Jahr Insgesamt<br />
<strong>in</strong> %<br />
1985 =<br />
100<br />
sonst.<br />
Personal<br />
4)5)<br />
<strong>in</strong> %<br />
1985 =<br />
100<br />
Verwaltungs-,Büroper-sonal<br />
<strong>in</strong> %<br />
1985 =<br />
100<br />
soz.med.Assistenten/<br />
<strong>in</strong>nen<br />
<strong>in</strong> %<br />
1985 =<br />
100<br />
Krankenpflegepersonal<br />
<strong>in</strong> %<br />
1985 =<br />
100<br />
(Zahn-)<br />
arzthelfer/<br />
<strong>in</strong>nen<br />
<strong>in</strong> %<br />
1985 =<br />
100<br />
Ges<strong>und</strong>heitsaufseher/<br />
<strong>in</strong>nen<br />
u.ä. 3)<br />
<strong>in</strong> %<br />
1985 =<br />
100<br />
med.techn.<br />
Personal<br />
<strong>in</strong> %<br />
1985 =<br />
100<br />
Sozialarbeiter/<br />
<strong>in</strong>nen 2)<br />
<strong>in</strong> %<br />
1985 =<br />
100<br />
(Zahn-)<br />
Ärzte/<br />
<strong>in</strong>nen 1)<br />
Tabellenanhang, Daten zu sonstigen Bereichen im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
1965 4.633 690 1.559 282 302 1.528 272<br />
1975 4.358 772 621 273 322 562 92 48 1.668<br />
1985 4.228 100,0% 736 100,0% 536 100,0% 215 100,0% 321 100,0% 595 100,0% 83 100,0% 128 100,0% 1.252 100,0% 362 100,0%<br />
1986 4.318 102,1% 768 104,3% 558 104,1% 216 100,5% 311 96,9% 619 104,0% 86 103,6% 141 110,2% 1.230 98,2% 389 107,5%<br />
1987 4.334 102,5% 785 106,7% 570 106,3% 215 100,0% 312 97,2% 634 106,6% 82 98,8% 143 111,7% 1.218 97,3% 375 103,6%<br />
1988 4.471 105,7% 814 110,6% 580 108,2% 214 99,5% 315 98,1% 648 108,9% 80 96,4% 135 105,5% 1.230 98,2% 455 125,7%<br />
1989 4.481 106,0% 831 112,9% 570 106,3% 227 105,6% 317 98,8% 646 108,6% 91 109,6% 145 113,3% 1.210 96,6% 444 122,7%<br />
1990 4.503 106,5% 861 117,0% 609 113,6% 230 107,0% 317 98,8% 663 111,4% 100 120,5% 143 111,7% 1.271 101,5% 309 85,4%<br />
1991 3.300 878 119,3% 614 114,6% 231 107,4% 282 87,9% 692 116,3% 108 130,1% 142 110,9% 0,0% 353 97,5%<br />
1992 3.281 882 119,8% 640 119,4% 222 103,3% 288 89,7% 717 120,5% 99 119,3% 143 111,7% 0,0% 290 80,1%<br />
1993 3.274 881 119,7% 635 118,5% 217 100,9% 284 88,5% 739 124,2% 95 114,5% 146 114,1% 0,0% 277 76,5%<br />
1994 4.403 104,1% 874 118,8% 648 120,9% 204 94,9% 269 83,8% 729 122,5% 88 106,0% 141 110,2% 1.191 95,1% 259 71,5%<br />
1995 4.233 100,1% 870 118,2% 608 113,4% 173 80,5% 259 80,7% 707 118,8% 77 92,8% 139 108,6% 1.164 93,0% 236 65,2%<br />
1996 4.160 98,4% 866 117,7% 586 109,3% 164 76,3% 264 82,2% 702 118,0% 78 94,0% 136 106,3% 1.135 90,7% 229 63,3%<br />
1)<br />
nur Hauptamtliche<br />
- 204 -<br />
2)<br />
1965 Sozialarbeiter/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitspfleger/<strong>in</strong>nen zusammen angegeben, ab 1975 nur Sozialarbeiter/<strong>in</strong>nen<br />
3)<br />
Ges<strong>und</strong>heitsaufseher/<strong>in</strong>nen, Ges<strong>und</strong>heits<strong>in</strong>genieure/<strong>in</strong>nen, Des<strong>in</strong>fektoren/<strong>in</strong>nen<br />
4)<br />
sonstige ärztliche Hilfskräfte, sonstige im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> tätige Personen, sonstige Personen mit staatlicher Anerkennung, Sonstige<br />
5)<br />
für 1975 <strong>und</strong> 1980 wahrsche<strong>in</strong>lich <strong>in</strong>klusive Verwaltungs- <strong>und</strong> Büropersonal<br />
Quelle: LDS, Berufe des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s, 1994-1996 LÖGD, Berechnungen 1965-1993 FfG
Tabellenanhang, Daten zur sozialen <strong>und</strong> ökonomischen Entwicklung<br />
Tab. A 15 Brutto<strong>in</strong>landsprodukt <strong>in</strong> Deutschland (alte B<strong>und</strong>esländer) <strong>und</strong> <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen (1963-1994)<br />
Jahr<br />
Deutschland Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
BIP <strong>in</strong> Mio.<br />
DM zu Preisen<br />
von 1991<br />
Veränderung<br />
gegenüber Vorjahr<br />
<strong>in</strong> %<br />
Verhältnis zum<br />
Ausgangswert <strong>in</strong><br />
%<br />
1963 1.125.000 0,00 100,00<br />
1964 1.200.000 6,67 106,67<br />
1965 1.265.000 5,42 112,44<br />
1966 1.300.000 2,77 115,56<br />
1967 1.296.000 -0,31 115,20<br />
1968 1.367.000 5,48 121,51<br />
1969 1.469.000 7,46 130,58<br />
- 205 -<br />
BIP <strong>in</strong> NW<br />
<strong>in</strong> Mio. DM<br />
zu Preisen<br />
von 1991<br />
Veränderung<br />
gegenüber Vorjahr<br />
<strong>in</strong> %<br />
Verhältnis zum<br />
Ausgangswert <strong>in</strong><br />
%<br />
1970 1.543.200 100,00 446.889 100,00<br />
1971 1.590.400 3,06 103,06 455.757 1,98 101,98<br />
1972 1.658.000 4,25 107,44 469.290 2,97 105,01<br />
1973 1.737.000 4,76 112,56 493.393 5,14 110,41<br />
1974 1.740.400 0,20 112,78 494.716 0,27 110,70<br />
1975 1.718.600 -1,25 111,37 484.370 -2,09 108,39<br />
1976 1.810.100 5,32 117,30 505.961 4,46 113,22<br />
1977 1.861.600 2,85 120,63 517.412 2,26 115,78<br />
1978 1.917.400 3,00 124,25 530.274 2,49 118,66<br />
1979 1.998.400 4,22 129,50 553.303 4,34 123,81<br />
1980 2.018.000 0,98 130,77 554.901 0,29 124,17<br />
1981 2.020.000 0,10 130,90 552.671 -0,40 123,67<br />
1982 2.001.000 -0,94 129,67 543.513 -1,66 121,62<br />
1983 2.036.200 1,76 131,95 545.576 0,38 122,08<br />
1984 2.093.500 2,81 135,66 554.103 1,56 123,99<br />
1985 2.136.000 2,03 138,41 564.222 1,83 126,26<br />
1986 2.186.100 2,35 141,66 572.997 1,56 128,22<br />
1987 2.218.400 1,48 143,75 576.178 0,56 128,93<br />
1988 2.301.000 3,72 149,11 594.849 3,24 133,11<br />
1989 2.384.400 3,62 154,51 614.847 3,36 137,58<br />
1990 2.520.400 5,70 163,32 644.743 4,86 144,27<br />
1991 2.647.600 5,05 171,57 673.295 4,43 150,66<br />
1992 2.694.300 1,76 174,59 680.029 1,00 152,17<br />
1993 2.639.100 -2,05 171,01 664.196 -2,33 148,63<br />
1994 2.694.000 2,08 174,57 677.183 1,96 151,53<br />
1995 2.718.200 0,90 176,14 684.402 1,07 153,15<br />
1996 2.747.600 1,08 178,05 690.131 0,84 154,43<br />
1997 2.809.500 2,25 182,06 702.524 1,80 157,20<br />
1998 2.889.100 2,83 187,21 717.204 2,09 160,49<br />
Quelle: Statistisches Jahrbuch der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland 1997, Berechnungen FfG
Tabellenanhang, Daten zur sozialen <strong>und</strong> ökonomischen Entwicklung<br />
Tab. A 16 Entwicklung der Bevölkerung <strong>in</strong> Deutschland <strong>und</strong> <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (1950-<br />
1998)<br />
Jahr Deutschland Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
<strong>in</strong>sgesamt Veränderung geg.<br />
Vorjahr <strong>in</strong> %<br />
Verhältnis zum<br />
Ausgangswert <strong>in</strong><br />
%<br />
- 206 -<br />
<strong>in</strong>sgesamt Veränderung geg.<br />
Vorjahr <strong>in</strong> %<br />
Verhältnis zum<br />
Ausgangswert <strong>in</strong><br />
%<br />
1950 13.197.009<br />
1952 69.950.246 100,0 13.489.000 2,2 100,0<br />
1961 73.265.537 4,7 104,7 15.901.678 17,9 117,9<br />
1970 77.711.421 6,1 111,1 17.004.851 6,9 126,1<br />
1971 78.352.818 0,8 112,0 17.137.752 0,8 127,0<br />
1972 78.700.324 0,4 112,5 17.192.897 0,3 127,5<br />
1973 78.955.831 0,3 112,9 17.245.530 0,3 127,8<br />
1974 78.977.987 0,0 112,9 17.217.780 -0,2 127,6<br />
1975 78.680.782 -0,4 112,5 17.129.615 -0,5 127,0<br />
1976 78.321.234 -0,5 112,0 17.073.192 -0,3 126,6<br />
1977 78.164.337 -0,2 111,7 17.030.341 -0,3 126,3<br />
1978 78.081.302 -0,1 111,6 17.006.354 -0,1 126,1<br />
1979 78.105.173 0,0 111,7 17.017.075 0,1 126,2<br />
1980 78.305.433 0,3 111,9 17.058.193 0,2 126,5<br />
1981 78.418.087 0,1 112,1 17.045.993 -0,1 126,4<br />
1982 78.338.456 -0,1 112,0 16.961.183 -0,5 125,7<br />
1983 78.127.501 -0,3 111,7 16.836.519 -0,7 124,8<br />
1984 77.851.698 -0,4 111,3 16.703.875 -0,8 123,8<br />
1985 77.670.519 -0,2 111,0 16.674.051 -0,2 123,6<br />
1986 77.694.471 0,0 111,1 16.676.501 0,0 123,6<br />
1987 77.722.194 0,0 111,1 16.743.956 0,4 124,1<br />
1988 78.116.124 0,5 111,7 16.874.059 0,8 125,1<br />
1989 78.672.207 0,7 112,5 17.103.588 1,4 126,8<br />
1990 79.364.504 0,9 113,5 17.349.651 1,4 128,6<br />
1991 79.984.244 0,8 114,3 17.509.866 0,9 129,8<br />
1992 80.594.371 0,8 115,2 17.679.166 1,0 131,1<br />
1993 81.179.232 0,7 116,1 17.759.300 0,5 131,7<br />
1994 81.421.960 0,3 116,4 17.816.079 0,3 132,1<br />
1995 81.660.965 0,3 116,7 17.893.045 0,4 132,6<br />
1996 81.895.637 0,3 117,1 17.947.715 0,3 133,1<br />
1997 82.051.698 0,2 117,3 17.974.487 0,1 133,3<br />
1998 17.975.516 0,0 133,3<br />
Die Angaben für das B<strong>und</strong>esgebiet beziehen sich auf den Jahresdurchschnitt, die für NRW auf den Stand am Ende des Jahres.<br />
Quelle: Statistisches B<strong>und</strong>esamt, Statistisches Landesamt Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen, Berechnungen FfG
Tabellenanhang, Daten zur sozialen <strong>und</strong> ökonomischen Entwicklung<br />
Tab. A 17 Entwicklung der Altenbevölkerung <strong>in</strong> Deutschland <strong>und</strong> <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
(1950-1998)<br />
Deutschland Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
Jahr 65+ <strong>in</strong>sgesamt<br />
Veränderung<br />
geg.<br />
Vorjahr<br />
Verhältnis<br />
zum Ausgangswert<br />
<strong>in</strong> %<br />
65+ <strong>in</strong>sgesamt<br />
Veränderung<br />
geg.<br />
Vorjahr<br />
- 207 -<br />
Verhältnis<br />
zum Ausgangswert<br />
<strong>in</strong> %<br />
80+ <strong>in</strong>sgesamt<br />
Veränderung<br />
geg.<br />
Vorjahr<br />
Verhältnis<br />
zum Ausgangswert<br />
<strong>in</strong> %<br />
1950 1.164.741 117.035<br />
1952 7.055.486<br />
1961 8.607.193 22,0 100,0 1.591.462 36,6 100,0 211.320 80,6 100,0<br />
1970 10.646.298 23,7 123,7 2.121.477 33,3 133,3 284.022 34,4 134,4<br />
1971 10.899.727 2,4 126,6 2.177.245 2,6 136,8 292.103 2,8 138,2<br />
1972 11.106.579 1,9 129,0 2.230.332 2,4 140,1 299.742 2,6 141,8<br />
1973 11.310.845 1,8 131,4 2.281.387 2,3 143,4 308.280 2,8 145,9<br />
1974 11.511.969 1,8 133,7 2.331.420 2,2 146,5 317.989 3,1 150,5<br />
1975 11.679.068 1,5 135,7 2.367.677 1,6 148,8 326.788 2,8 154,6<br />
1976 11.801.759 1,1 137,1 2.402.116 1,5 150,9 339.502 3,9 160,7<br />
1977 11.952.851 1,3 138,9 2.447.782 1,9 153,8 354.457 4,4 167,7<br />
1978 12.103.577 1,3 140,6 2.458.172 0,4 154,5 371.048 4,7 175,6<br />
1979 12.213.125 0,9 141,9 2.519.297 2,5 158,3 388.757 4,8 184,0<br />
1980 12.216.581 0,0 141,9 2.515.462 -0,2 158,1 409.300 5,3 193,7<br />
1981 12.030.360 -1,5 139,8 2.475.980 -1,6 155,6 430.218 5,1 203,6<br />
1982 11.742.344 -2,4 136,4 2.426.030 -2,0 152,4 452.712 5,2 214,2<br />
1983 11.442.549 -2,6 132,9 2.378.628 -2,0 149,5 473.055 4,5 223,9<br />
1984 11.270.800 -1,5 130,9 2.379.206 0,0 149,5 498.617 5,4 236,0<br />
1985 11.315.796 0,4 131,5 2.418.824 1,7 152,0 521.939 4,7 247,0<br />
1986 11.453.369 1,2 133,1 2.461.321 1,8 154,7 544.166 4,3 257,5<br />
1987 11.589.440 1,2 134,6 2.502.827 1,7 157,3 570.923 4,9 270,2<br />
1988 11.679.617 0,8 135,7 2.533.804 1,2 159,2 597.772 4,7 282,9<br />
1989 11.743.817 0,5 136,4 2.568.860 1,4 161,4 621.365 3,9 294,0<br />
1990 11.872.038 1,1 137,9 2.611.492 1,7 164,1 640.176 3,0 302,9<br />
1991 11.968.733 0,8 139,1 2.651.468 1,5 166,6 655.961 2,5 310,4<br />
1992 12.099.663 1,1 140,6 2.697.010 1,7 169,5 677.674 3,3 320,7<br />
1993 12.271.841 1,4 142,6 2.748.325 1,9 172,7 696.040 2,7 329,4<br />
1994 12.447.708 1,4 144,6 2.797.421 1,8 175,8 712.949 2,4 337,4<br />
1995 12.634.232 1,5 146,8 2.848.065 1,8 179,0 707.664 -0,7 334,9<br />
1996 12.791.062 1,2 148,6 2.878.321 1,1 180,9 683.456 -3,4 323,4<br />
1997 12.915.179 1,0 150,1 2.903.325 0,9 182,4 656.286 -4,0 310,6<br />
1998 2.923.852 0,7 183,7 632.251 -3,7 299,2<br />
Die Angaben für das B<strong>und</strong>esgebiet beziehen sich auf den Jahresdurchschnitt, die für NRW auf den Stand am Ende des Jahres.<br />
Quelle: Statistisches B<strong>und</strong>esamt, Statistisches Landesamt Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen, Berechnungen FfG
Tabellenanhang, Daten zu anderen Beschäftigungsbereichen<br />
Tab. A 18 Beschäftigtenzahlen <strong>und</strong> Tätigkeitsbereiche nach Wirtschaftsclustern (Clusterbildung<br />
IAT)<br />
Baugewerbe Beschäftigte: 541.405<br />
Abbruch-, Spreng- u. Enttrümmerungsgewerbe, Erdbewegungsarbeiten, Landeskulturbau u. Renaturierung v. Gewässer, Test- <strong>und</strong> Suchbohrung,<br />
Hoch- u. Tiefbau ohne ausgepr. Schwerpunkt, Hochbau (ohne Fertigteilbau), Brücken- <strong>und</strong> Tunnelbau, Kabelleitungstiefbau, Dachdeckerei,<br />
Abdichtung gegen Wasser u. Feuchtigkeit, Zimmerei <strong>und</strong> Ingenieurholzbau, Straßenbau, Eisenbahnoberbau, Wasserbau, Brunnenbau,<br />
Schachtbau, Schornste<strong>in</strong>-, Feuerungs-, Industrieofenbau, Gerüstbau, Gebäudetrocknung, sonstiger Tiefbau, Elektro<strong>in</strong>stallation,<br />
Dämmgebung gegen Kälte,Wärme,Schall,Ersch., Klempnerei, Gas- <strong>und</strong> Wasser<strong>in</strong>stallation, Inst. Heizung,Lüftung,Klima,ges. techn. Anlagen,<br />
sonstige Bau<strong>in</strong>stallation, Stukkateurgewerbe, Gipserei u. Verputzerei, Bautischlerei, Parkettlegerei, Fliesen-, Platten- <strong>und</strong> Mosaiklegerei,<br />
Estrichlegerei, sonstige Fußbodenlegerei u. -kleberei, Tapetenkleberei, Raumausstattung (allg.), Maler- <strong>und</strong> Lackiererbetriebe, Glasergewerbe,<br />
Fassadenre<strong>in</strong>igung, Ofen- <strong>und</strong> Herdsetzerei, Ausbaugewerbe, Vermietung Baum., -geräte mit Bedienung, Handelsverm. Rohholz,Holzhalbw.,Holzbauelem.,<br />
Handelsverm. Bauelemente aus m<strong>in</strong>. Stoffen, Handelsverm. v. Anstrichmitteln, Handelsverm. Inst.-bed. F.<br />
Gas, Wasser, Heizung, Großhandel mit elektrotechn. u. Elektro<strong>in</strong>st.-zub., Großhandel mit Tapeten, GH mit Bauelementen aus m<strong>in</strong>erl.<br />
Stoffen, GH mit Anstrichmitteln, GH mit Sanitärkeramik, GH mit Bauelementen aus Metall, GH mit Inst.-bedarf f. Gas, Wasser, Heizung,<br />
GH mit Baumasch<strong>in</strong>en, Architekturbüros, Ingenieurbüros, Büros für Industrie-Design, Büros baufachl. Gutachter, Vermessungsbüros,<br />
Büros f. techn.-wirtschaftl. Beratung, Herstellung von keramischen Erzeugnissen, Ziegelei, Herst. v. Zement, Kalk, Herst. v. Fertigteilen aus<br />
Beton, Herst. v. Erzeugnissen aus Porenbeton, Herst. v. Gipserzeugnissen, Herst. v. Kalksandste<strong>in</strong>, Herst. v. Transportbeton, Mörtel, Faserzementwaren,<br />
Be- <strong>und</strong> Verarbeitung von Naturste<strong>in</strong>, Herst. v. diversen Schleifgeräten für den Bau, Herst. v. diversen Rohren, Rohrstükken,<br />
Herst. v. Werkzeugen für das Baugewerbe, Herst. v. Werkzeugmasch<strong>in</strong>en z. Bearbeiten v. Ste<strong>in</strong>en, Herst. v. Bau- <strong>und</strong> Baustoffmasch<strong>in</strong>en<br />
Automobil Beschäftigte: 250.868<br />
Herstellung v. PKW u. Motoren , Herstellung v. LKW u. Motoren , Herst. Karosserien, Aufbauten u. Anhängern , Herst. Teile, Zubeh. f.<br />
Kraftwagen, -motoren , Handelsvermittlung von Kraftwagen , Großhandel mit Kraftwagen , E<strong>in</strong>zelhandel mit Kraftwagen , Instandh. u.<br />
Reperatur v. Kraftwagen (mit Elektr.) , Lackierung von Kraftwagen , Autowaschanlagen , Handelsverm. von Kraftwagenteilen u. Zubehör ,<br />
Großhandel mit Kraftwagenteilen u. Zubehör , E<strong>in</strong>zelhandel mit Kraftwagenteilen <strong>und</strong> Zubehör , Tankstellen , Personenbeförderung (Taxi,<br />
Om<strong>in</strong>bus etc.) , Umzugsverkehr mit Kraftfahrzeugen , Parkhäuser <strong>und</strong> Parkplätze , Vermietung von Kraftwagen , Kraftfahrschulen<br />
Kultur (LAA-NRW) Beschäftigte: 158.144<br />
Buchverlag (ohne Adressb.verl.) , Musikverlag , Verlag von bespielten Tonträgern , Sonstiges Verlagsgewerbe (außer die <strong>in</strong> IuK) , Druckerei<br />
(ohne Zeitungsdruckerei) , Druckweiterverarbeitung , Satzherstellung <strong>und</strong> Reproduktion , Sonstiges Druckgewerbe (außer die <strong>in</strong> IuK) ,<br />
Vervielfältigung von bespielten Tonträgern , Vervielfältigung von bespielten Bildträgern , Herst. R<strong>und</strong>f.-,TV-,phono-,videotechnischen<br />
Geräten , Handelsverm. R<strong>und</strong>f.-,TV-,phonotechnischen Geräten , Handelsverm. Bücher, Zeitschriften u. so. Druckerz. , Großhandel R<strong>und</strong>f.-<br />
,TV-,phonotechnischen Geräten , E<strong>in</strong>zelh. mit R<strong>und</strong>f.-,TV-,phonotechn. Geräten u. Zubeh. , E<strong>in</strong>zelh. Mit Büchern <strong>und</strong> Fachzeitschriften ,<br />
Rep. von R<strong>und</strong>f.-,TV-,phonotechnischen Geräten , Handelsverm. fe<strong>in</strong>mech., Foto- u. opt. Erzeugnisse , Großhandel mit fe<strong>in</strong>mech., Foto- u.<br />
opt. Erzeugnisse , E<strong>in</strong>zelhandel mit Musik<strong>in</strong>strumenten <strong>und</strong> Musikalien , E<strong>in</strong>zelh. mit Kunstgegenst., Bildern, Briefm, Münzen , Herstellung<br />
von K<strong>in</strong>o- <strong>und</strong> Fernsehfilmen , Herst. von Industrie-, Wirtschafts- <strong>und</strong> Werbefilmen , sonstige Filmherstellung , Filmtechnik , Filmverleih,<br />
Filmvertrieb , Videoprogrammanbieter , Filmtheater , Hörfunk- <strong>und</strong> Fernsehanstalten , Herst. v. Hörfunk <strong>und</strong> Fernsehprogrammen , Theaterensembles<br />
, Balletgruppen, Orchester, Kapellen, Chöre , Selbständige bildende Künstler , Selbständige Restauratoren , Selbständige<br />
Komponisten <strong>und</strong> Musikbearbeiter , Selbständige Schriftsteller , Selbst. Bühnen-,Film-,Hörfunk-,TV-künstler , Theater- <strong>und</strong> Konzertveranstalter<br />
, Opern- <strong>und</strong> Schauspielhaus, Konzerthallen u.a. , Varietes <strong>und</strong> Kle<strong>in</strong>kunstbühnen , Tonstudios , techn. Hilfsdienste f. kultur-. <strong>und</strong><br />
Unterhaltungsleist. , Schauspielergewerbe <strong>und</strong> Vergnügungsparks , Tanzschulen , Erbr<strong>in</strong>gung sonstiger Kultur- u. Unterhaltungsleistungen ,<br />
Bibliotheken <strong>und</strong> Archive , Museen <strong>und</strong> Kunstausstellungen , Denkmalschutz , Botanische <strong>und</strong> zoologische Gärten , Naturparks <strong>und</strong> Tiergehege<br />
, Natur- <strong>und</strong> Landschaftsschutz , Architekturbüros f. Garten- u. Landschaftsgestaltung , Fotografisches Gewerbe , Fotografische<br />
Laboratorien , Schreibbüros , Übersetzungsbüros <strong>und</strong> Dolmetscher , Öffentliche Verwaltung Bildung <strong>und</strong> Kultur , Kunsthochschulen ,<br />
Herst. v. Masch<strong>in</strong>en für das Druckgewerbe , Herst. v. Musik<strong>in</strong>strumenten , Leihbüchere<strong>in</strong> u. Lesezirkeln<br />
Bergbau Beschäftigte: 94.105<br />
Ste<strong>in</strong>kohlenbergbau , Herstellung von Ste<strong>in</strong>kohlenbriketts , Braunkohlenbergbau u. -brikettherstellung , Torfgew<strong>in</strong>nung u. -veredlung ,<br />
Eisenerzbergbau , NE-Metallerzbergbau (ohne Uran u. Thorium) , Gew<strong>in</strong>nung von Naturwerkste<strong>in</strong>en , Gew<strong>in</strong>nung von Naturste<strong>in</strong>en , Gew.<br />
von Kalkste<strong>in</strong>, Dolomitste<strong>in</strong>, Kreide , Gew<strong>in</strong>nung von Gips- <strong>und</strong> Anhydritste<strong>in</strong> , Gew<strong>in</strong>nung von Schiefer , Gew<strong>in</strong>nung von Kies <strong>und</strong> Sand ,<br />
Gew<strong>in</strong>nung von Ton , Kalibergbau , Bergbau a. chem. u. Düngemittelm<strong>in</strong>en , Gew<strong>in</strong>nung von Salz , Gew. v. Ste<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Erden, sonst.<br />
Bergbau , Großhandel mit Erzen , GH mit Eisen, Stahl, Eisen-, Stahlhabzeugen , GH mit NE-Metallen u. NE-Metallhalbzeugen , Herst. v.<br />
Bergwerksmasch<strong>in</strong>en<br />
Ges<strong>und</strong>heit Beschäftigte: 957.000<br />
siehe Studie <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> <strong>und</strong> <strong>Arbeitsmarkt</strong> <strong>in</strong> NRW<br />
Quelle: LAA NRW, Clusterbildung <strong>und</strong> Berechnungen IAT<br />
- 208 -
Tabellenanhang, Daten zu anderen Beschäftigungsbereichen<br />
Tab. A 19 Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten <strong>in</strong><br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen, 1980 - 1998<br />
Jahr soz.-versicherungspflichtig<br />
Beschäftigte<br />
<strong>in</strong> %, 1980 = 100<br />
1980 5.662.000 100%<br />
1985 5.447.823 96,2%<br />
1986 5.537.096 97,8%<br />
1987 5.585.417 98,6%<br />
1988 5.651.808 99,8%<br />
1989 5.789.170 102,2%<br />
1990 6.006.325 106,1%<br />
1991 6.123.363 108,1%<br />
1992 6.092.219 107,6%<br />
1993 5.957.959 105,2%<br />
1994 5.890.765 104,0%<br />
1995 5.859.234 103,5%<br />
1996 5.767.051 101,9%<br />
1997 5.763.196 101,8%<br />
1998 5.794.408 102,3%<br />
Quelle: LDS<br />
Tab. A 20 Frauenerwerbstätigkeit <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (1991-1999)<br />
Jahr Erwerbsquote Frauen im Alter zwischen<br />
15 <strong>und</strong> 64 Jahre<br />
1991 52,0<br />
1992 53,4<br />
1993 53,8<br />
1994 54,0<br />
1995 53,1<br />
1996 53,3<br />
1997 55,0<br />
1998 55,2<br />
1999 57,1<br />
Anmerkung: Daten vor dem Jahr 1991 lagen vom LDS bei Redaktionsschluss nicht vor.<br />
Quelle: LDS<br />
- 209 -
Tabellenanhang, Prognosegr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Modellrechnungen<br />
Tab. A 21 Bedeutung <strong>und</strong> Entwicklung von Selbstzahlungen im <strong>in</strong>ternationalen Vergleich (<strong>in</strong><br />
Prozent der Gesamtausgaben für Ges<strong>und</strong>heit)<br />
1980 1994<br />
B 14,3 17,8<br />
D - 11,7<br />
D (West) 10,2 12,5<br />
D (Ost) - 6,7<br />
DK 10,4 11,4<br />
E 16,3 13,6<br />
F 14,3 17,0<br />
GR 20,5 18,2<br />
I 20,9 22,3<br />
IRL 13,4 15,3<br />
L 21,3 19,2<br />
NL - 7,3<br />
P 26,1 17,3<br />
UK 10,8 15,8<br />
EU 14,1 15,5<br />
A - 14,0<br />
CAN 16,7 12,6<br />
CH 25,1 19,5<br />
J 27,6 17,2<br />
S 10,4 13,6<br />
USA 26,4 17,6<br />
ALL - 16,7<br />
SV* - 15,1<br />
*SV = die Gruppe der acht Sozialversicherungsländer (Belgien, B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland, Frankreich, Japan, Niederlande, Luxemburg,<br />
Österreich, Schweiz)<br />
Quelle: Schneider et al. 1998: 127<br />
Tab. A 22 Anzahl der offenen Planungsbereiche <strong>und</strong> der maximal wiederzubesetzenden Vertragsarztsitze<br />
<strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong> (Stichtag: 1.1.2000)<br />
Allg./Prakt. Ärzte<br />
Augenärzte<br />
Chirurgen<br />
Frauenärzte<br />
HNO-Ärzte<br />
Hautärzte<br />
Anzahl offener<br />
Planungsbereiche<br />
(von 27)<br />
19 9 0 5 6 0 6 4 9 1 3 12 1 10 85<br />
Maximal wiederzubesetzende<br />
Vertragsarztsitze<br />
199 20 0 10 8 0 12 5 23 3 4 37 1 572 1<br />
894<br />
1 Dieser Wert bezieht sich lediglich auf die „Ärztlichen Psychotherapeuten“ <strong>und</strong> nicht auf die „Psychologischen Psychotherapeuten“. Für<br />
letztere gibt es zum Stichtag ke<strong>in</strong>e wiederzuvergebenden Vertragsarztsitze<br />
Quelle: Kassenärztliche Vere<strong>in</strong>igung Nordrhe<strong>in</strong><br />
Internisten<br />
- 210 -<br />
K<strong>in</strong>derärzte<br />
Nervenärzte<br />
Orthopäden<br />
Radiologen<br />
Anästhesisten<br />
Urologen<br />
Psychotherapeuten<br />
Insgesamt
Tabellenanhang, Prognosegr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Modellrechnungen<br />
Tab. A 23 Anzahl der offenen Planungsbereiche <strong>und</strong> maximal wiederzubesetzenden Vertragsarztsitze<br />
<strong>in</strong> Westfalen-Lippe (Stichtag: 2.6.2000)<br />
Allg./Prakt. Ärzte<br />
Augenärzte<br />
Chirurgen<br />
Frauenärzte<br />
HNO-Ärzte<br />
Hautärzte<br />
Anzahl offener<br />
Planungsbereiche<br />
(von 27)<br />
17 4 0 0 2 0 0 1 4 2 0 11 1 23 65<br />
Maximal wiederzubesetzende<br />
Vertragsarztsitze<br />
280 5 0 0 2 0 0 1 8 2 0 33 1 201 1<br />
533<br />
1 Auch hier s<strong>in</strong>d die Arztsitze lediglich an „Ärztlichen Psychotherapeuten“ zu vergeben.<br />
Quelle: Kassenärztliche Vere<strong>in</strong>igung Westfalen-Lippe<br />
Tab. A 24 Kalkulierter Beschäftigungsgew<strong>in</strong>n <strong>in</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen bei Verschiebung<br />
von Pflegetagen<br />
Jahr Verschiebung von<br />
e<strong>in</strong>em Pflegetag pro<br />
Fall allgeme<strong>in</strong>e<br />
Krankenhäuser <strong>in</strong><br />
die Reha<br />
Pflegetage <strong>in</strong> der<br />
Reha<br />
Internisten<br />
Gesamtbeschäftigung<br />
Reha<br />
- 211 -<br />
K<strong>in</strong>derärzte<br />
Nervenärzte<br />
Orthopäden<br />
Radiologen<br />
Quotient:<br />
Pflegetage/<br />
Gesamtbeschäftigung<br />
1<br />
Anästhesisten<br />
Urologen<br />
Psychotherapeuten<br />
Insgesamt<br />
Beschäftigungsgew<strong>in</strong>n<br />
für Vorsorge<strong>und</strong>Rehae<strong>in</strong>richtungen:<br />
Verschobenen Pflegetage<br />
1993 3.338.205 6.130.470 11.345 540 6.200<br />
1997 3.524.173 5.317.006 13.722 387 9.100<br />
1 Der Quotient Pflegetage/Gesamtbeschäftigung gibt an, wie viele Pflegetage durchschnittlich auf e<strong>in</strong>en Beschäftigten kommen. Damit ist<br />
e<strong>in</strong> grober Indikator verfügbar, der angibt, welchen Beschäftigungseffekt Pflegetage haben können. Dieser Quotient ist nicht konstant,<br />
darum wurden die beiden Jahre ausgewählt, <strong>in</strong> denen der Quotient sich am stärksten unterschied, um darstellen zu können, welche unterschiedlichen<br />
Wirkungen dies auf die Beschäftigung hätte.<br />
Quelle: Berechnung <strong>und</strong> Erstellung MHH<br />
Tab. A 25 Kalkulierter Beschäftigungsabfluss durch Patientenwanderung<br />
Erbrachte Pflegetage <strong>in</strong> Rehae<strong>in</strong>richtungen<br />
<strong>in</strong> NRW<br />
Gesamtbeschäftigung <strong>in</strong> Vorsorgeoder<br />
Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen <strong>in</strong><br />
NRW (1997)<br />
Quotient:<br />
Pflegetage/Gesamtbeschäftigung<br />
1993 6.130.470 11.345 540<br />
1997 5.317.000 13.722 387<br />
Durchschnittliche Pflegetage multipliziert mit den Fallzahlen von nicht <strong>in</strong> NRW erbrachten Rehabilitationsleistungen<br />
geteilt durch den Quotienten Pflegetage/Gesamtbeschäftigung:<br />
1993: 33 1 mal 50.458 = 1.665.114; 1.665.114/540 = 3.100 Beschäftigte<br />
1997: 33 mal 50.458 = 1.665.114; 1.665.114/387 = 4.300 Beschäftigte<br />
1 Freilich vernachlässigt die obenstehende Rechnung wichtige Aspekte. So speisen sich z.B. die <strong>in</strong> NRW erbrachten Pflegetage nicht nur<br />
aus Leistungen der GRV; zudem ist der Quotient: Pflegetage/Gesamtbeschäftigung im Zeitverlauf nicht stabil. Aus diesem Gr<strong>und</strong> haben<br />
wir die Jahre 1993 <strong>und</strong> 1997 gewählt, da sich <strong>in</strong> den beiden Jahren die Relation Pflegetage/Gesamtbeschäftigung am stärksten unterscheidet.<br />
Dennoch handelt es sich unter den gegebenen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> bei der gegebenen Datenlage um e<strong>in</strong>e plausible Schätzung.<br />
2 Durchschnittliche Pflegetage pro Patient<br />
Quelle: LDS; VDR, eigene Berechnungen MHH
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Abb. 1 Vergleich der Anteile verschiedener Ausbildungsstätten im Bereich der<br />
Ges<strong>und</strong>heitsausbildungen 1985 <strong>und</strong> 1998 11<br />
Abb. 2 Zuwachsraten <strong>in</strong> ausgewählten Ausbildungsgängen an den Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s<br />
1985 – 1998 (1985 = 100) 13<br />
Abb. 3 Entwicklung der Schülerzahl <strong>in</strong> ausgewählten krankenpflegerischen Ausbildungen an den<br />
Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s 1985 – 1998 (1985= 100) 14<br />
Abb. 4 Auszubildende <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen an berufsbildenden Schulen 1985 - 1998 (1985 =<br />
100) 17<br />
Abb. 5 Entwicklung der Studierendenzahlen <strong>in</strong> akademischen Ges<strong>und</strong>heitsberufen 1985 – 1998<br />
(1985 = 100) 19<br />
Abb. 6 Entwicklung der Beschäftigtenzahlen im stationären Sektor 1991 - 1998 23<br />
Abb. 7 Die Beschäftigungsentwicklung im stationären Sektor 1991 – 1998 (1991=100) 24<br />
Abb. 8 Allgeme<strong>in</strong>e Krankenhäuser - Beschäftigungsentwicklung nach ausgewählten<br />
Berufsgruppen 1991-1998 (1991=100) 26<br />
Abb. 9 Allgeme<strong>in</strong>e Krankenhäuser - Leistungsdaten 1990 bis 1998 (1990=100) 27<br />
Abb. 10 Beschäftigungsentwicklung nach ausgewählten Berufsgruppen <strong>in</strong> sonstigen<br />
Krankenhäusern 1991-1998 (1991=100) 31<br />
Abb. 11 Beschäftigungsentwicklung nach ausgewählten Berufsgruppen <strong>in</strong> Vorsorge- <strong>und</strong><br />
Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen 1991-1998 (1991=100) 33<br />
Abb. 12 Entwicklung der Beschäftigtenzahlen <strong>in</strong> Akut- <strong>und</strong> Sonderkrankenhäusern 1975 - 1989 35<br />
Abb. 13 Die Beschäftigungsentwicklung ausgewählter Berufsgruppen <strong>in</strong> Akutkrankenhäusern 1975-<br />
1989 (1975=100) 36<br />
Abb. 14 Die Beschäftigungsentwicklung ausgewählter Berufsgruppen <strong>in</strong> Sonderkrankenhäusern<br />
1975-1989 (1975=100) 38<br />
Abb. 15 Beschäftigtenzahlen <strong>in</strong> der ambulanten Ges<strong>und</strong>heitsversorgung 1998 42<br />
Abb. 16 Beschäftigungsentwicklung bei Ärzt/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Zahnärzt/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> freier Praxis sowie<br />
sozialversicherungspflichtig beschäftigten Sprechst<strong>und</strong>enhelfer<strong>in</strong>nen 1985 – 1998 (1985 =<br />
100) 46<br />
Abb. 17 Selbständige <strong>und</strong> angestellt Beschäftigte <strong>in</strong> nichtärztlichen mediz<strong>in</strong>ischen Praxen 1998 48<br />
Abb. 18 Pharmazeutisches Personal <strong>in</strong> Apotheken 1985-1998 (1985 = 100) 52<br />
Abb. 19 Beschäftigte <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsämtern (ohne Verwaltungspersonal) 1985 – 1996 (1985 = 100) 70<br />
Abb. 20 Hauptberufliches Lehrpersonal <strong>in</strong> Ausbildungen zu Ges<strong>und</strong>heitsberufen 1998 74<br />
Abb. 21 Entwicklung der Sozialkuren 1975 bis 1997 (westliche B<strong>und</strong>esländer) 87<br />
Abb. 22 <strong>Arbeitsmarkt</strong>bedeutung ausgewählter Wirtschaftsbereiche <strong>in</strong> NRW 1998-1999 98<br />
Abb. 23 Untersuchte E<strong>in</strong>flussfaktoren auf die Beschäftigungsentwicklung im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalens 99<br />
Abb. 24 Die Bevölkerungsprognose des Landesamtes für Datenverarbeitung <strong>und</strong> Statistik des<br />
Landes Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen bis zum Jahr 2015 (1998 = 100) 115<br />
Abb. 25: Szenarien der Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> Arzt- <strong>und</strong> Zahnarztpraxen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong><br />
Westfalen bis 2015 121<br />
Abb. 26 Szenarien der Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> Apotheken <strong>und</strong> ausgewählten nichtärztlichen<br />
Heilhilfsberufe <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong> Westfalen bis 2015 122<br />
- 212 -
Abbildungsverzeichnis<br />
Abb. 27 Beschäftigungsprognose allgeme<strong>in</strong>e Krankenhäuser NRW 1998-2015 124<br />
Abb. 28 Beschäftigungsprognose Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen NRW 1998-2015 129<br />
Abb. 29 Beschäftigungsprognose sonstige Krankenhäuser NRW 1998-2015 130<br />
Abb. 30 Szenarien der Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> der Altenpflege <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen bis<br />
2015 133<br />
Abb. 31 Szenarien der Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> den Zuliefer<strong>in</strong>dustrien <strong>und</strong> Nachbarbranchen<br />
<strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen bis 2015 135<br />
Abb. 32 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Veter<strong>in</strong>ärwesen im<br />
Rhe<strong>in</strong>land 1997 139<br />
Abb. 33 Bio- <strong>und</strong> Gentechnologie im Regierungsbezirk Köln 146<br />
Abb. 34 Das Bio-Gen-Tec-Netzwerk 147<br />
Abb. 35 Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Veter<strong>in</strong>ärwesen<br />
an allen Beschäftigten <strong>in</strong> den Kreisen <strong>und</strong> kreisfreien Städten des Ruhrgebiets 1997 <strong>in</strong> % 167<br />
Abb. 36 Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Im Ruhrgebiet im<br />
Wirtschaftszweig „Ges<strong>und</strong>heit- <strong>und</strong> Veter<strong>in</strong>ärwesen“ 1985 - 1999 168<br />
Abb. 37 Entwicklung der paramediz<strong>in</strong>ischen Berufe 185<br />
Abb. 38 Verteilung der Hausärzte über verschiedene Praxisformen (<strong>in</strong> %) 185<br />
- 213 -
Tabellenverzeichnis<br />
Tabellenverzeichnis<br />
Tab. 1 Gesamtbeschäftigtenzahlen im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen 1998 3<br />
Tab. 2 Schüler/<strong>in</strong>nen, Auszubildende <strong>und</strong> Student/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen, 1955 bis 1998 10<br />
Tab. 3 Schüler/<strong>in</strong>nen an den Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s 1956 – 1998 12<br />
Tab. 4 Auszubildende <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufen im dualen System 1980 - 1998 15<br />
Tab. 5 Anteil weiblicher Auszubildender <strong>in</strong> ausgewählten Ges<strong>und</strong>heitsberufen im dualen System<br />
1980 - 1998 16<br />
Tab. 6 Student/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> traditionellen akademischen Ges<strong>und</strong>heitsberufen 1955 bis 1998 18<br />
Tab. 7 Anteil weiblicher Studierender <strong>in</strong> den akademischen Ges<strong>und</strong>heitsberufen 1955 - 1998 19<br />
Tab. 8 Anzahl der Studierenden <strong>in</strong> den Studienbereichen Pflege, Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong><br />
Sportwissenschaften/-ökonomie <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen 1998 21<br />
Tab. 9 Allgeme<strong>in</strong>e Krankenhäuser - absoluter <strong>und</strong> relativer Anteil der Beschäftigten nach<br />
Berufsgruppen 1991 <strong>und</strong> 1998 25<br />
Tab. 10 Aus dem Krankenhaus entlassene Patient/<strong>in</strong>nen (e<strong>in</strong>schließlich Sterbe- <strong>und</strong> St<strong>und</strong>enfälle)<br />
nach Altersgruppen <strong>und</strong> Geschlecht 1993 - 1996 28<br />
Tab. 11 Entwicklung der Großgerätedichte <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen 1991 bis 1997 29<br />
Tab. 12 Sonstige Krankenhäuser – absoluter <strong>und</strong> relativer Anteil der Beschäftigten nach<br />
Berufsgruppen 1991 <strong>und</strong> 1998 30<br />
Tab. 13 Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen - absoluter <strong>und</strong> relativer Anteil der<br />
Beschäftigten 1991 <strong>und</strong> 1998 32<br />
Tab. 14 Rehabilitanden <strong>in</strong> der Gesetzlichen Rentenversicherung nach Wohnort <strong>und</strong> Ort der<br />
Rehabilitationsleistung im Jahr 1997 34<br />
Tab. 15 Akutkrankenhäuser - absoluter <strong>und</strong> relativer Anteil der Beschäftigten 1965 <strong>und</strong> 1989 36<br />
Tab. 16 Sonderkrankenhäuser - absoluter <strong>und</strong> relativer Anteil der Beschäftigten 1975 <strong>und</strong> 1989 37<br />
Tab. 17 Ärzt/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Zahnärzt/<strong>in</strong>nen/ Kieferorthopäd/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> freier Praxis 1955-1998 44<br />
Tab. 18 Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Sprechst<strong>und</strong>enhelfer/<strong>in</strong>nen, Frauen- <strong>und</strong><br />
Ausländeranteile sowie Beschäftigungsverhältnis, 1980 - 1998 45<br />
Tab. 19 Selbständige <strong>und</strong> angestellt Beschäftigte <strong>in</strong> Praxen von nichtärztlichen Heilhilfsberufen<br />
1996 - 1998 49<br />
Tab. 20 Heilpraktiker/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Hebammen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen 1985 - 1996 50<br />
Tab. 21 Personal <strong>in</strong> Apotheken 1975 - 1998 51<br />
Tab. 22 Kapazitäten <strong>und</strong> Beschäftigte der Wohlfahrtsverbände <strong>in</strong> der Altenhilfe <strong>in</strong> Deutschland<br />
(1970-1996) 57<br />
Tab. 23 Beschäftigte <strong>in</strong> Pflegeheimen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (1997-1998) 58<br />
Tab. 24 Beschäftigte <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>dekrankenpflege <strong>in</strong> Deutschland (altes B<strong>und</strong>esgebiet) <strong>und</strong> <strong>in</strong><br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (1961-1977) 59<br />
Tab. 25 Kapazitäten ambulanter Pflegedienste der Wohlfahrtsverbände <strong>in</strong> Deutschland (1970-1996) 60<br />
Tab. 26 Geme<strong>in</strong>depflegestationen e<strong>in</strong>schließlich E<strong>in</strong>richtungen der Hauskrankenpflege <strong>in</strong><br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (1993-1996) 61<br />
- 214 -
Tabellenverzeichnis<br />
Tab. 27 Beschäftigte <strong>in</strong> Geme<strong>in</strong>depflegestationen e<strong>in</strong>schließlich E<strong>in</strong>richtungen der<br />
Hauskrankenpflege <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (1993-1996) 61<br />
Tab. 28 Beschäftigte <strong>in</strong> ambulanten Pflegediensten nach SGB XI <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (1997-<br />
1998) 62<br />
Tab. 29 Beschäftigte „Altenpfleger<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> –pfleger“ 1 <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (1993-1999) laut<br />
Mikrozensus 63<br />
Tab. 30 Personal des B<strong>und</strong>es, des Landes <strong>und</strong> der Kommunen <strong>in</strong> ausgewählten Bereichen des<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s, 1998 71<br />
Tab. 31 Beschäftigte <strong>in</strong> Krankenversicherungen 1998 73<br />
Tab. 32 Beschäftigte <strong>in</strong> Organisationen der Ärzt/<strong>in</strong>nen, Zahnärzt/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Apotheker/<strong>in</strong>nen 1998 74<br />
Tab. 33 Lehrkräfte an den Schulen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s 1998 75<br />
Tab. 34 Wissenschaftliches <strong>und</strong> künstlerisches Personal an Hochschulen 1998 76<br />
Tab. 35 Pharmazeutische Industrie Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen: Betriebe <strong>und</strong> Beschäftigte 1995 - 1998 77<br />
Tab. 36 Arzneimittelmarkt <strong>in</strong> Deutschland 1998 (zu Endverbraucherpreisen) 78<br />
Tab. 37 Freiverkäufliche Arzneimittel nach Absatzkanälen <strong>in</strong> Deutschland 1998 79<br />
Tab. 38 Beschäftigte <strong>in</strong> der deutschen Biotech-Industrie 1998 80<br />
Tab. 39 Arbeitsstätten <strong>und</strong> Beschäftigte im Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen <strong>und</strong><br />
mediz<strong>in</strong>ischen Hilfsmitteln (Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen; 30.04.1993) 82<br />
Tab. 40 Unternehmen <strong>und</strong> Beschäftigte im Fache<strong>in</strong>zelhandel mit mediz<strong>in</strong>ischen <strong>und</strong> orthopädischen<br />
Produkten Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen 1994 - 1997 82<br />
Tab. 41 Unternehmen <strong>und</strong> Beschäftigte im Ges<strong>und</strong>heitshandwerk Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalens 1995 83<br />
Tab. 42 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Ges<strong>und</strong>heitshandwerk Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
1991 - 1999 83<br />
Tab. 43 Strukturdaten der Fitnesswirtschaft (BRD 1990 bis 1998) 84<br />
Tab. 44 Tourismus <strong>in</strong> nordrhe<strong>in</strong>-westfälischen Kur- <strong>und</strong> Heilbädern 1999 85<br />
Tab. 45 Beschäftigte <strong>in</strong> Beherbergungsbetrieben <strong>in</strong> Kur- <strong>und</strong> Heilbädern <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen 86<br />
Tab. 46 Ausländer-Kurverkehr 1987-1997 (westliche B<strong>und</strong>esländer) 86<br />
Tab. 47 Abgrenzungskriterien zwischen Ges<strong>und</strong>heitsvorsorgetourismus <strong>und</strong><br />
Kur/Rehabilitationstourismus 88<br />
Tab. 48 Gesamtbild: Beschäftigung <strong>in</strong> den Zuliefer<strong>in</strong>dustrien <strong>und</strong> Nachbarbranchen 1998 90<br />
Tab. 49 Akademische <strong>und</strong> nichtakademische Berufe im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> 91<br />
Tab. 50 Frauenanteile <strong>in</strong> ausgewählten Berufsgruppen des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s 92<br />
Tab. 51 Übersicht zur Beschäftigungsentwicklung <strong>und</strong> zu E<strong>in</strong>flussfaktoren - <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen 1985 -1998 102<br />
Tab. 52 Prognose der Beschäftigungsentwicklung <strong>in</strong> der gesamten Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft<br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalens bis 2015 136<br />
Tab. 53 Große Bio- <strong>und</strong> Gentechnologieunternehmen mit 100 <strong>und</strong> mehr Beschäftigten 146<br />
Tab. 54 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.1997 im Ruhrgebiet 165<br />
Tab. 55 Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
(Ruhrgebiet 1985 bis 1997) 166<br />
Tab. 56 Anteil verschiedener Ges<strong>und</strong>heitsleistungen am BSP <strong>in</strong> den Niederlanden 180<br />
Tab. 57 Überblick über die Entwicklung der Versorgungs<strong>in</strong>stitutionen 181<br />
Tab. 58 Absolute Beschäftigungsanzahl (abs.) <strong>und</strong> Vollzeitäquivalent (FTE) im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> 182<br />
Tab. 59 Entwicklung mediz<strong>in</strong>ischer Ges<strong>und</strong>heitsprofessionen 183<br />
- 215 -
Tabellenverzeichnis<br />
Tab. 60 Beschäftigungsentwicklung der Health Centre 184<br />
Tab. 61 Beschäftigungsentwicklung im Bereich Pflege <strong>und</strong> Versorgung 187<br />
Tab. 62 Beschäftigungsentwicklung im Bereich Home Care 189<br />
Tab. 63 Beschäftigung <strong>in</strong> der ambulanten geistigen Ges<strong>und</strong>heitsversorgung 190<br />
Tab. 64 Beschäftigungsentwicklung im Bereich Public Health 191<br />
- 216 -
Tabellenverzeichnis<br />
Tab. A 1 Auszubildende an berufsbildenden Schulen, Frauen- <strong>und</strong> Ausländeranteil, 1980 - 1998 195<br />
Tab. A 2 Auszubildende im Ges<strong>und</strong>heitshandwerk, Frauen- <strong>und</strong> Ausländeranteil, 1980 - 1998 196<br />
Tab. A 3 Studierende der Studiengängen Humanmediz<strong>in</strong>, Pharmazie <strong>und</strong> Psychologie, Frauen- <strong>und</strong><br />
Ausländeranteile, 1955 - 1998 197<br />
Tab. A 4 Allgeme<strong>in</strong>e Krankenhäuser - der relative Anteil der Berufsgruppen am<br />
Beschäftigungswachstum zwischen 1991 <strong>und</strong> 1995 198<br />
Tab. A 5 Sonstige Krankenhäuser – der relative Anteil der Berufsgruppen am<br />
Beschäftigungswachstum zwischen 1991 <strong>und</strong> 1998 198<br />
Tab. A 6 Vorsorge- <strong>und</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen - der relative Anteil der Berufsgruppen am<br />
Beschäftigungswachstum zwischen 1991 <strong>und</strong> 1998 199<br />
Tab. A 7 Akutkrankenhäuser - der relative Anteil der Berufsgruppen am Beschäftigungswachstum<br />
zwischen 1965 <strong>und</strong> 1989 199<br />
Tab. A 8 Sonderkrankenhäuser - der relative Anteil der Berufsgruppen am Beschäftigungswachstum<br />
zwischen 1975 <strong>und</strong> 1989 199<br />
Tab. A 9 Ärzte <strong>und</strong> Ärzt<strong>in</strong>nen nach Art der Tätigkeit <strong>und</strong> Frauenanteil, 1955 - 1998 200<br />
Tab. A 10 Zahnärzte <strong>und</strong> -ärzt<strong>in</strong>nen nach Art der Tätigkeit <strong>und</strong> Frauenanteil, 1955 – 1998 201<br />
Tab. A 11 Niedergelassene Ärzte <strong>und</strong> Ärzt<strong>in</strong>nen nach ausgewählten Gebietsbezeichnungen, 1980 -<br />
1998 202<br />
Tab. A 12 Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Krankengymnast/<strong>in</strong>nen, Masseur/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong><br />
verwandte Berufe, 1991 - 1998 203<br />
Tab. A 13 Apotheken, 1955 - 1996 203<br />
Tab. A 14 Personal der unteren Ges<strong>und</strong>heitsbehörden, 1965 - 1998 204<br />
Tab. A 15 Brutto<strong>in</strong>landsprodukt <strong>in</strong> Deutschland (alte B<strong>und</strong>esländer) <strong>und</strong> <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
(1963-1994) 205<br />
Tab. A 16 Entwicklung der Bevölkerung <strong>in</strong> Deutschland <strong>und</strong> <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (1950-1998) 206<br />
Tab. A 17 Entwicklung der Altenbevölkerung <strong>in</strong> Deutschland <strong>und</strong> <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (1950-<br />
1998) 207<br />
Tab. A 18 Beschäftigtenzahlen <strong>und</strong> Tätigkeitsbereiche nach Wirtschaftsclustern (Clusterbildung IAT) 208<br />
Tab. A 19 Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen, 1980 - 1998 209<br />
Tab. A 20 Frauenerwerbstätigkeit <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (1991-1999) 209<br />
Tab. A 21 Bedeutung <strong>und</strong> Entwicklung von Selbstzahlungen im <strong>in</strong>ternationalen Vergleich (<strong>in</strong> Prozent<br />
der Gesamtausgaben für Ges<strong>und</strong>heit) 210<br />
Tab. A 22 Anzahl der offenen Planungsbereiche <strong>und</strong> der maximal wiederzubesetzenden<br />
Vertragsarztsitze <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong> (Stichtag: 1.1.2000) 210<br />
Tab. A 23 Anzahl der offenen Planungsbereiche <strong>und</strong> maximal wiederzubesetzenden Vertragsarztsitze<br />
<strong>in</strong> Westfalen-Lippe (Stichtag: 2.6.2000) 211<br />
Tab. A 24 Kalkulierter Beschäftigungsgew<strong>in</strong>n <strong>in</strong> Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen bei Verschiebung von<br />
Pflegetagen 211<br />
Tab. A 25 Kalkulierter Beschäftigungsabfluss durch Patientenwanderung 211<br />
- 217 -
5.4. Literaturverzeichnis<br />
Literaturverzeichnis<br />
Abel-Smith, B./ Figueras, J./ Holland, W./ McKee, M./ Mossialos, E. (1995): Choices <strong>in</strong> health policy:<br />
an agenda for the European Union, Aldershot/ Brookfield USA/ S<strong>in</strong>gapore/ Sydney: Dartmouth.<br />
Alber, J. (1982): Vom Armenhaus zum Wohlfahrtsstaat. Analysen zur Entwicklung der Sozialversicherung<br />
<strong>in</strong> Westeuropa, Frankfurt a.M.<br />
Alber, J. (1989): Der Sozialstaat <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland 1950-1983, Frankfurt/ New York.<br />
Alber, J. (1990): Ausmaß <strong>und</strong> Ursachen des Pflegenotstands <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland, <strong>in</strong>:<br />
Staatswissenschaften <strong>und</strong> Staatspraxis, Heft 3, S.335-362.<br />
Alber, J. (1992): Das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland. Entwicklung, Struktur<br />
<strong>und</strong> Funktionsweise, Frankfurt am Ma<strong>in</strong>: Campus.<br />
Alber, J./ Bernadi-Schenkluhn, B. (1992): Westeuropäische Ges<strong>und</strong>heitssysteme im Vergleich: B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, Großbritannien, Frankfurt a.M.: Campus.<br />
Alber, J./ Schölkopf, M. (1999): Seniorenpolitik: Die soziale Lage älterer Menschen <strong>in</strong> Deutschland<br />
<strong>und</strong> Europa, Amsterdam: Fakultas.<br />
Allemeyer, J. (1994): Die Chance zu Reformen: Personalstandards <strong>und</strong> Strukturentwicklungen, <strong>in</strong>:<br />
Altenheim, Heft 7, S.490-499.<br />
Anonym (1998): Grenzüberschreitende Ges<strong>und</strong>heitsversorgung. Aktivitäten <strong>und</strong> Modellprojekte <strong>in</strong> de<br />
Euregios mit Beteiligung der AOK Rhe<strong>in</strong>land - Die Ges<strong>und</strong>heitskasse.<br />
Arthur Andersen Health Care (2000): Krankenhaus 2015. Wege aus dem Paragraphendschungel.<br />
Asmuth M./ Blum K./ Fack-Asmuth W.-G./ Gumbrich G./ Müller U./ Offermanns M. (1999): Begleitforschung<br />
zur B<strong>und</strong>espflegesatzverordnung 1995: Abschlußbericht; Untersuchung im Auftrag<br />
des B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isteriums für Ges<strong>und</strong>heit, Deutsches Krankenhaus<strong>in</strong>stitut: Düsseldorf.<br />
Bäcker, G./ Dieck, M./ Naegele, G./ Tews, H.-P. (1989): Ältere Menschen <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen.<br />
Wissenschaftliches Gutachten zur Lage der älteren Menschen <strong>und</strong> zur Altenpolitik <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
zur Vorbereitung des Zweiten Landesaltenplans (hrsg. vom M<strong>in</strong>isterium für<br />
Arbeit, Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziales des Landes Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen), Düsseldorf.<br />
Badura, B./ Siegrist, J. (1996): Zweiter Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitforschung<br />
Ortsnahe Koord<strong>in</strong>ierung, Bielefeld/ Düsseldorf (verf. Ms.).<br />
Badura, B./ Strodthol P. (1998): Qualitätsförderung, Qualitätsforschung <strong>und</strong> Evaluation im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>,<br />
<strong>in</strong>: Schwartz, F.W./ Badura, B./ Leidl, R./ Raspe, H./ Siegrist J. (Hg.), S.574-584.<br />
Bandelow, N.C. (1998): Ges<strong>und</strong>heitspolitik: Der Staat <strong>in</strong> der Hand e<strong>in</strong>zelner Interessengruppen?<br />
Opladen: Leske & Budrich.<br />
Bandemer, St.v./ Hilbert, J. (1996): Soziale Dienste <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit als Wachstumsbranche - Chancen<br />
<strong>und</strong> Gestaltungsherausforderungen, <strong>in</strong>: Zeitschrift für Sozialreform, 42.Jg., Heft 11/12, S.763-<br />
776.<br />
Bandemer, St.v./ Hilbert, J./ Schulz, E. (1998): Zukunftsbranche Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziales? Szenarien<br />
<strong>und</strong> Ansatzpunkte der Beschäftigungsentwicklung bei ges<strong>und</strong>heitsbezogenen <strong>und</strong> sozialen<br />
Diensten, <strong>in</strong>: Bosch, G. (Hg.): Zukunft der Erwerbsarbeit. Strategien für Arbeit <strong>und</strong> Umwelt,<br />
Frankfurt/ New York, S.412-435.<br />
Bauch, J. (1996): Ges<strong>und</strong>heit als sozialer Code. Von der Vergesellschaftung des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s<br />
zur Medikalisierung der Gesellschaft, We<strong>in</strong>heim/ München.<br />
Beck, U. (1986): Risikogesellschaft: auf dem Weg <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e andere Moderne, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.<br />
- 218 -
Literaturverzeichnis<br />
Behaghel, K. (1994): Kostendämpfung <strong>und</strong> ärztliche Interessenvertretung. E<strong>in</strong> Verbandssystem unter<br />
Streß, Frankfurt a.M./ New York: Campus.<br />
Beske, F./ Hallauer, J.F. (1999): Das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> <strong>in</strong> Deutschland. Struktur - Leistung - Weiterentwicklung,<br />
3. völlig neu bearbeitete <strong>und</strong> erweiterte Auflage, Köln: Deutscher Ärzte-Verlag.<br />
Beyer, L./ Hilbert, J./ Micheel, B. (1998): Le Grand Espoir en F<strong>in</strong> de Siecle, <strong>in</strong>: Cornetz, W. (Hg.):<br />
Chancen durch Dienstleistungen, Ansatzpunkte e<strong>in</strong>er aktiven Gestaltung struktureller Prozesse,<br />
Wiesbaden, S.77-101.<br />
Bio-Gen-Tec-NRW (2000): Geschäftsbericht 1999, Bio- <strong>und</strong> Gentechnologie für Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen, Köln.<br />
Birk, U.-A. u.a. (Hg.) (1994): B<strong>und</strong>essozialhilfegesetz - Lehr- <strong>und</strong> Praxiskommentar, Baden-Baden:<br />
Nomos Verlagsgesellschaft.<br />
Borchert, J. (1998): Ausgetretene Pfade? Zur Statik <strong>und</strong> Dynamik wohlfahrtsstaatlicher Regimes, <strong>in</strong>:<br />
Lessenich, S./ Ostner, I. (Hg.): Welten des Wohlfahrtskapitalismus, Frankfurt a.M./ New York.<br />
Bos, M. (1999): Die Niederlande, <strong>in</strong>: Ausschuß für Krankenversicherungssysteme (Hg.): Sozialschutz<br />
<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitssysteme, Brüssel.<br />
Brechtel, T./ Schnee, M. (1999): Steigende Unzufriedenheit mit Interessenverbänden. Niedergelassene<br />
Allgeme<strong>in</strong>ärzte <strong>und</strong> Internisten kritisieren die Arbeit ihrer Interessenvertretungen, <strong>in</strong>: Deutsches<br />
Ärzteblatt, 96.Jg., Heft 50, A-3233-A-2282.<br />
Bruckenberger, E. (1983): Computertomographie <strong>in</strong> Niedersachsen 1992, <strong>in</strong>: Niedersächsisches Ärzteblatt,<br />
Heft 19, S.659-662.<br />
Bruckenberger, E. (1987): Mediz<strong>in</strong>ische <strong>und</strong> wirtschaftliche Konsequenzen des E<strong>in</strong>satzes der extrakorporalen<br />
Stoßwellen-Lithotripsie <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland, <strong>in</strong>: Hygiene <strong>und</strong> Mediz<strong>in</strong>,<br />
Heft 12, S.285-304.<br />
Bruckenberger, E. (1990): Abstimmung mediz<strong>in</strong>isch-technischer Großgeräte <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland (II), <strong>in</strong>: das Krankenhaus, 81.Jg., Heft 8, S.324-331.<br />
Bruckenberger, E. (1999): Herzbericht 1998 mit Transplantationschirurgie. 11. Bericht des Krankenhausausschusses<br />
der Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft der obersten Landesges<strong>und</strong>heitsbehörden der Länder,<br />
Hannover: Niedersächsisches M<strong>in</strong>isterium für Frauen, Arbeit <strong>und</strong> Soziales.<br />
Bühr<strong>in</strong>g, P. (2000): Psychotherapeuten erhalten eigenständige Kammer, <strong>in</strong>: Deutsches Ärzteblatt,<br />
97.Jg., Heft 4, S.B-122-B-122.<br />
B<strong>und</strong>esfachverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (1999): Der Selbstmedikationsmarkt <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland <strong>in</strong> Zahlen 1998, Bonn.<br />
B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Ges<strong>und</strong>heit (1999): Daten des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s, Ausgabe 1999, Band 122<br />
der Schriftenreihe des B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isteriums für Ges<strong>und</strong>heit, Baden-Baden.<br />
B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Ges<strong>und</strong>heit, IG Bergbau-Chemie-Energie, Verband Forschender Arzneimittelhersteller<br />
e.V. (1998): Innovation fördern, Beschäftigung sichern – Forschende Arzneimittelhersteller<br />
am Pharmastandort Deutschland, e<strong>in</strong>e Bestandsaufnahme, Bonn.<br />
B<strong>und</strong>estags-Drucksache 12/5897 (1993): Erster Altenbericht. Die Lebenssituation älterer Menschen <strong>in</strong><br />
Deutschland.<br />
B<strong>und</strong>estags-Drucksache 13/11460 (1998): Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission, Demographischer<br />
Wandel - Herausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an den E<strong>in</strong>zelnen<br />
<strong>und</strong> die Politik.<br />
B<strong>und</strong>estags-Drucksache 14/1245 (1999): Gesetzentwurf der Fraktionen SPD <strong>und</strong> BÜNDNIS 90/DIE<br />
GRÜNEN. Entwurf e<strong>in</strong>es Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ab dem<br />
Jahr 2000 (GKV-Ges<strong>und</strong>heitsreform 2000). Anonymous<br />
- 219 -
Literaturverzeichnis<br />
B<strong>und</strong>esverband der Arzt-, Zahnarzt- <strong>und</strong> Tierarzthelfer<strong>in</strong>nen e.V. (BdA) (1998): Alarmierende Änderungen<br />
<strong>in</strong> der Beschäftigungsstruktur der Arztpraxen. Pressemitteilung vom 2. Januar 1998,<br />
Eppste<strong>in</strong>.<br />
B<strong>und</strong>esverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (1999): PharmaDaten 99, Frankfurt a.M.<br />
B<strong>und</strong>esverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) (1998): Facts & Figures zum Beratermarkt<br />
1997, Bonn.<br />
Busse, R./ Howorth, C. (1996): Fixed budgets <strong>in</strong> the pharmaceutical sector <strong>in</strong> Germany: Effects on<br />
Costs and Quality, <strong>in</strong>: Schwartz, F.W./ Glennerster, H./ Saltman, R.B. (Hg.), S.109-127.<br />
Busse, R./ Schwartz, F.W. (1997): F<strong>in</strong>anc<strong>in</strong>g reforms <strong>in</strong> the German hospital sector: from full cost<br />
cover pr<strong>in</strong>ciple to prospective case fees, <strong>in</strong>: Medical Care, 35.Jg., Heft 10, S.40-49.<br />
Busse, R./ Schwartz, F.W. (1997): Herausforderung an den B<strong>und</strong>esausschuß der Ärzte <strong>und</strong> Krankenkassen,<br />
<strong>in</strong>: Arbeit <strong>und</strong> Sozialpolitik, 51.Jg., Heft 11/12, S.51-57.<br />
Busse, R./ Wismar M. (1997): Health care reform <strong>in</strong> Germany: the end of cost conta<strong>in</strong>ment? <strong>in</strong>: eurohealth,<br />
3.Jg., Heft 2, S.32-33.<br />
Cachay, K./ Thiel, A. (1999): Ausbildung <strong>in</strong>s Ungewisse? Beschäftigungschancen für Sportwissenschaftler<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Sportwissenschaftler im Ges<strong>und</strong>heitssystem, Aachen.<br />
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek, Maandbericht gezondheidsstatistiek, diverse jaren, diverse<br />
onderwerpen<br />
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek, Onderwijsstatistieken, diverse jaren.<br />
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek, Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS), 1997.<br />
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek, www.cbs.nl.<br />
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek/ VWS M<strong>in</strong>isterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport<br />
(1980-1999): Vademecum gezondheidsstatistiek Nederland, CBS, Voorburg, Heerlen.<br />
CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (1997): Challeng<strong>in</strong>g Neighbours. Reth<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g<br />
German and Dutch Institutions, Den Haag, Kap. 14.<br />
Das Europäische Parlament (1998): Entschließung des Europäischen Parlaments zur Mitteilung der<br />
Kommission <strong>und</strong> den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- <strong>und</strong> Sozialausschuss<br />
<strong>und</strong> den Ausschuss der Regionen über die Entwicklung der Geme<strong>in</strong>schaftspolitik im Bereich<br />
der öffentlichen Ges<strong>und</strong>heit, KOM(98)230-C4-0393/98.<br />
De lopen - <strong>in</strong>formatiemagaz<strong>in</strong>e over het nieuwe opleid<strong>in</strong>gsstelsel voor verplegende en verzorgende<br />
beroepen (1998): Eerste rapport kwalificatiestructuur is uit!!, S.5-8.<br />
Deppe, H.U. (1987): Krankheit ist ohne Politik nicht heilbar, Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag.<br />
Deurzen v., J. (2000): Een huisarts op de eerste hulp, <strong>in</strong>: Metro(tageszeitung des Zuges), 3-2-2000.<br />
Deutsche Krankenhausgesellschaft (1969): Anhaltszahlen für die Besetzung der Krankenhäuser mit<br />
Pflegekräften. Empfehlungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft vom 19. September 1969,<br />
<strong>in</strong>: das Krankenhaus, Heft 10, S.420-421.<br />
Deutscher Bäderverband e.V. (1998): Jahresbericht 1997, Bonn.<br />
Deutscher B<strong>und</strong>estag, Referat Öffentlichkeitsarbeit (1998): Demographischer Wandel: Zweiter Zwischenbericht<br />
der Enquete-Kommission "Demographischer Wandel" - Herausforderungen unserer<br />
älter werdenden Gesellschaft an den E<strong>in</strong>zelnen <strong>und</strong> die Politik, Dt. B<strong>und</strong>estag, Referat Öffentlichkeitsarbeit,<br />
Bonn.<br />
Döhler, M. (1990): Ges<strong>und</strong>heitspolitik nach der "Wende": Policy Netzwerke <strong>und</strong> ordnungspolitischer<br />
Strategiewechsel <strong>in</strong> Großbritannien, den USA <strong>und</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland, Berl<strong>in</strong>:<br />
Edition Sigma.<br />
Döhler, M. (1997): Die Regulierung von Professionsgrenzen. Struktur <strong>und</strong> Entwicklungsdynamik von<br />
Ges<strong>und</strong>heitsberufen im <strong>in</strong>ternationalen Vergleich, Frankfurt/New York: Campus.<br />
- 220 -
Literaturverzeichnis<br />
Döhler, M./ Manow-Borgwardt, P. (1992): Korporatisierung als ges<strong>und</strong>heitspolitische Strategie, <strong>in</strong>:<br />
Staatswissenschaften <strong>und</strong> Staatspraxis, 3.Jg., Heft 1, S.64-106.<br />
Dostal, W./ Re<strong>in</strong>berg, A. (1999): Ungebrochener Trend <strong>in</strong> die Wissensgesellschaft; IAB Kurzbericht<br />
Nr.10; Institut für <strong>Arbeitsmarkt</strong>- <strong>und</strong> Berufsforschung, Nürnberg.<br />
Downs, A. (1967): Inside Bureaucracy, Boston: Little Brown.<br />
Düll<strong>in</strong>gs, J. (1999): Krankenhausplanung <strong>und</strong> Investitionsf<strong>in</strong>anzierung <strong>in</strong> den B<strong>und</strong>esländern – Stand:<br />
April 1999.<br />
Eichener, V./ Schaaf, S./ Schulte, F. (2000): Erfolgsfördernde <strong>und</strong> erfolgshemmende Faktoren der<br />
Biotechnologie-Regionen, InWIS – Forschungsbericht im Auftrag von Hans-Böckler-Stiftung<br />
<strong>und</strong> IGBCE, Bochum.<br />
Eifert, B./ Krämer, K./ Roth, G. (1999): Die Auswirkungen des Gesetzes zur Umsetzung des Pflege-<br />
Versicherungsgesetzes, Landespflegegesetz Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen - PfG NRW - Abschlußbericht<br />
e<strong>in</strong>er Untersuchung im Auftrag des M<strong>in</strong>isteriums für Arbeit, Stadtentwicklung, Kultur <strong>und</strong><br />
Sport des Landes Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen, Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V., Dortm<strong>und</strong>.<br />
Eifert, B./ Krämer, K./ Roth, G./ Rothgang, H. (1999): Die Umsetzung der Pflegeversicherung <strong>in</strong> den<br />
B<strong>und</strong>esländern im Vergleich (Bericht über e<strong>in</strong>e Fachtagung der Forschungsgesellschaft für Gerontologie<br />
e.V., Dortm<strong>und</strong> <strong>und</strong> des Zentrums für Sozialpolitik der Universität Bremen am<br />
10.11. Dezember 1998 <strong>in</strong> Köln), <strong>in</strong>: Nachrichtendienst des Deutschen Vere<strong>in</strong>s für öffentliche<br />
<strong>und</strong> private Fürsorge, Heft 8, S.259-266.<br />
Eifert, B./ Rothgang, H. (1998): Die Pflegegesetze der Länder zwischen planerisch-gestaltender <strong>und</strong><br />
ausführungsorientierter Konzeption, <strong>in</strong>: Schmidt, R./ Braun, H./ Giercke, K. I./ Klie, T./ Kohnert,<br />
M. (Hg.): Neue Steuerungen <strong>in</strong> der Pflege- <strong>und</strong> sozialen Altenarbeit. Beiträge zur sozialen<br />
Gerontologie, Sozialpolitik <strong>und</strong> Versorgungsforschung, Bd. 6., Regensburg: Transfer-Verlag,<br />
S.253-264.<br />
Engels, D./ Friedrich, W. (1996): Die Personalsituation <strong>in</strong> der stationären <strong>und</strong> ambulanten Altenhilfe<br />
im Bereich der alten B<strong>und</strong>esländer (Analyse des Otto-Blume-Institutes für Sozialforschung <strong>und</strong><br />
Gesellschaftspolitik im Auftrag des Kuratoriums Deutsche Altershilfe), <strong>in</strong>: B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium<br />
für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend (Hg.): Personalsituation <strong>in</strong> der Altenpflege <strong>in</strong> der<br />
B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland, Schriftenreihe des B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isteriums für Familie, Senioren,<br />
Frauen <strong>und</strong> Jugend, Stuttgart u.a.: Kohlhammer, S.1-34.<br />
Esp<strong>in</strong>g-Andersen, G. (1990): The three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge.<br />
Fach<strong>in</strong>ger, U./ Rothgang, H. (Hg.) (1995): Die Wirkungen des Pflege-Versicherungsgesetzes, Berl<strong>in</strong>:<br />
Duncker & Humblot.<br />
Flöhl, R. (2000): Psychiatrische Fachkrankenhäuser anachronistisch. Geme<strong>in</strong>denahe Versorgung für<br />
alle Kranken, Frankfurter Allgeme<strong>in</strong>e Zeitung, S.N1-N1.<br />
Fuz<strong>in</strong>ski, A. u.a. (1997): Herausforderung Informationsgesellschaft: Auswirkungen neuer Informations-<br />
<strong>und</strong> Kommunikationstechnologien auf die Beschäftigungssituation von Frauen. E<strong>in</strong>e Studie<br />
herausgegeben vom M<strong>in</strong>isterium für die Gleichstellung von Frau <strong>und</strong> Mann des Landes<br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen, Düsseldorf.<br />
Geneesk<strong>und</strong>ige hoofd<strong>in</strong>spectie van de Volksgezondheid (1988): Staatstoezicht op de volksgezondheid;<br />
Statistiek Geneesk<strong>und</strong>igen per 1-1-1986, M<strong>in</strong>isterie van WVC, Rijswijk.<br />
Gerste, B./ Rehbe<strong>in</strong>, I. (1998): Der Pflegemarkt <strong>in</strong> Deutschland: E<strong>in</strong> statistischer Überblick (Wissenschaftliches<br />
Institut der AOK), Bonn.<br />
Geuter, U. (1999): Die Psychotherapie <strong>und</strong> die Politik. Anmerkungen zum neuen Psychotherapeutengesetz,<br />
<strong>in</strong>: Dr.med.Mabuse, 117.Jg., Heft 24, S.62-66.<br />
Gibbels, M. (1998): Advertenties, acties en imagocampagnes, <strong>in</strong>: ZorgVisie, 28 Jg., Heft 14, S.12-15.<br />
- 221 -
Literaturverzeichnis<br />
Giese, D. (1988): Die Entwicklung des B<strong>und</strong>essozialhilfegesetzes (BSHG) seit 1962, <strong>in</strong>: Münder, J.<br />
(Hg.): Zukunft der Sozialhilfe. Sozialpolitische Perspektiven nach 25 Jahren BSHG, S.9-20.<br />
Golombek, G. (1986): Die Anwendung der neuen DKG-Empfehlung zur Ermittlung des Personalbedarfs<br />
im Pflegedienst, <strong>in</strong>: das Krankenhaus, Heft 9, S.363-367.<br />
Gött<strong>in</strong>g, U./ H<strong>in</strong>richs, K. (1993): Probleme der politischen Kompromißbildung bei der gesetzlichen<br />
Absicherung des Pflegefallrisikos - E<strong>in</strong>e vorläufige Bilanz, <strong>in</strong>: Politische Vierteljahresschrift,<br />
Heft 1, S.47-71.<br />
Gr<strong>in</strong>ten, T.v.d. (1996): Scope for policy: essence, operation and reform of the policy system of Dutch<br />
health care, <strong>in</strong>: Gunn<strong>in</strong>g-Schepers, L.J./ Kronje, G.J./ Spasoff, R.A. (Hg.).<br />
Grönemeyer, D.H.W. (2000): Med. <strong>in</strong> Deutschland: Standort mit Zukunft, Berl<strong>in</strong> u.a.: Spr<strong>in</strong>ger.<br />
Gunn<strong>in</strong>g-Schepers, L.J./ Kronje, G.J./ Spasoff, R.A. (1996): F<strong>und</strong>amental questions about the future of<br />
health care, Den Haag.<br />
Hartmann, A. (1999): Modernisierungs- <strong>und</strong> Wachstumstendenzen im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> - e<strong>in</strong> Vergleich<br />
zwischen niederländischen Regionen <strong>und</strong> dem Ruhrgebiet, <strong>in</strong>: Hilbert, J./ Naegele, G.<br />
(Hg.): Qualifizierte Dienstleistungen, Münster.<br />
Haug, K. (1995): Arbeitsteilung zwischen Ärzten <strong>und</strong> Pflegekräften <strong>in</strong> deutschen <strong>und</strong> englischen<br />
Krankenhäusern. Oder: Warum arbeiten doppelt so viel Krankenschwestern pro Arzt <strong>in</strong> englischen<br />
wie <strong>in</strong> deutschen Krankenhäusern? Konstanz: Hartung-Gorre.<br />
Haug, K./ Rothgang, H. (1994): Das R<strong>in</strong>gen um die Pflegeversicherung - e<strong>in</strong> vorläufiger sozialpolitischer<br />
Rückblick, <strong>in</strong>: Beiträge zum Recht der sozialen Dienste <strong>und</strong> E<strong>in</strong>richtungen, Heft 24, S.1-<br />
30.<br />
Häußermann, H./ Siebel, W. (1995): Dienstleistungsgesellschaften, Frankfurt a.M.<br />
Heclo, H. (1974): Modern Social Politics <strong>in</strong> Brita<strong>in</strong> and Sweden, New Haven, Conn.: Yale Univ.<br />
Press.<br />
Heffen, O.v./ Kerkhoff, T. (1999): Gezondheitszorg: van blauwdrukdenken naar <strong>in</strong>crementeel sleutelen,<br />
<strong>in</strong>: Trommel, W./ Veen, R.v.d (Hg.): De herverdeelde samenlev<strong>in</strong>g. Amsterdam.<br />
Hermans HEGM (1997): Patient's rights <strong>in</strong> the European Union, <strong>in</strong>: European Journal of Public Health<br />
- Supplement, 7.Jg., Heft 3, S.11-17.<br />
Hét carriereblad voor de gezondheidszorg (2000): Onthaasten <strong>in</strong> een klooster, Woche 8, 25-2-2000.<br />
Hiddemann, T. (1999): Bedarfsplanung <strong>und</strong> Zulassungsmöglichkeiten <strong>in</strong> der vertragsärztlichen Versorgung,<br />
<strong>in</strong>: Die Betriebskrankenkasse 87, S. 381-388.<br />
Hilbert, J. (1999): Ges<strong>und</strong>heit als Wirtschaftsbranche – Gestaltungsansätze auf der dezentralen Ebene,<br />
<strong>in</strong>: Zeitschrift für Sozialreform, 45.Jg., Heft 11/12, S.1029-1041.<br />
Hilbert, J. (2000): Vom Kostenfaktor zur Beschäftigungslokomotive – Zur Zukunft der Arbeit <strong>in</strong> der<br />
Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Sozialwirtschaft, Paper P00-509 der Querschnittsgruppe Arbeit <strong>und</strong> Ökologie<br />
beim Präsidenten des Wissenschaftszentrums Berl<strong>in</strong> für Sozialforschung Berl<strong>in</strong>, Berl<strong>in</strong>.<br />
Hilbert, J./ Ittermann, P. (1998): Innovationsbranche Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziales. Kommunale <strong>und</strong> regionale<br />
Ansätze für mehr Wachstum <strong>und</strong> Beschäftigung, Gelsenkirchen.<br />
Hilbert, J./ Nordhause-Janz, J./Rehfeld, D. (1999): Between Regional Network<strong>in</strong>g And Lonesome<br />
Rid<strong>in</strong>g, <strong>in</strong>: Braczyk, H.-J./ Fuchs, G./Wolf, H.-G. (Hg.): Multimedia and regional economic restructur<strong>in</strong>g.<br />
Routledge studies <strong>in</strong> the modern world economy. London, S.131-154.<br />
H<strong>in</strong>gstman, L./ Harmsen, J. (1994): Beroepen <strong>in</strong> de extramurale gezondheidszorg 1994; aanbod van<br />
beroepsbeoefenaren en samenwerk<strong>in</strong>gsverbanden <strong>in</strong> de extramurale gezondheidszorg <strong>in</strong> de periode<br />
1980-1993, Utrecht: Nivel.<br />
Hirnschützer, U. (1988a): Pflegesätze <strong>in</strong> stationären E<strong>in</strong>richtungen der Altenhilfe, Band I: Ergebnisse<br />
der Bestandsaufnahme, 2. unveränderte Auflage. Berl<strong>in</strong>: Deutsches Zentrum für Altersfragen.<br />
- 222 -
Literaturverzeichnis<br />
Hirnschützer, U. (1988b): Pflegesätze <strong>in</strong> stationären E<strong>in</strong>richtungen der Altenhilfe, Band II: Pflegesatzvere<strong>in</strong>barungen<br />
der B<strong>und</strong>esländer, 2. unveränderte Auflage, Berl<strong>in</strong>: Deutsches Zentrum für Altersfragen.<br />
Höft-Dzemski, R. (1987): Bestandsaufnahme der ambulanten sozialpflegerischen Dienste (Alten- <strong>und</strong><br />
Krankenpflege, Haus- <strong>und</strong> Familienpflege) im B<strong>und</strong>esgebiet, Stuttgart: Kohlhammer.<br />
Hübner, M./ Born, A. (1999): Zielgruppe Senioren: Chancen <strong>und</strong> Perspektiven für die Tourismusbranche,<br />
Graue Reihe des Instituts Arbeit <strong>und</strong> Technik, Heft 11, Gelsenkirchen.<br />
Ilich, I. (1976): Limits to medic<strong>in</strong>e, London.<br />
Institut für <strong>Arbeitsmarkt</strong>- <strong>und</strong> Berufsforschung (1999): IAB Kurzbericht Nr. 9.<br />
Institut für Freizeitwirtschaft (1999): Zielgruppen <strong>in</strong> der Freizeit 1995 – 2005, Band 2, München.<br />
Jopen, C. (1990): Personalschlüssel <strong>in</strong> der stationären Altenhilfe, <strong>in</strong>: Altenheim, Heft 11, S.550-554.<br />
Kaiser, G. (Hg.) (1997): Wirtschaftsfaktor Bio- <strong>und</strong> Gentechnologie, E<strong>in</strong>e Untersuchung der Prognos<br />
AG zu den Perspektiven der kommerziellen Bio- <strong>und</strong> Gentechnologie <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen,<br />
Düsseldorf.<br />
Kamberovic, R./ Schwarze, B. (1999): Deutsche Fitness Wirtschaft, Hamburg.<br />
Kassenärztliche B<strong>und</strong>esvere<strong>in</strong>igung (2000): "Reform 2000", Informationen für den Kassenarzt zum<br />
GKV-Ges<strong>und</strong>heitsreformgesetz 2000, Köln.<br />
Kassenzahnärztliche B<strong>und</strong>esvere<strong>in</strong>igung (1999): KZBV Jahrbuch 99. Statistische Basisdaten zur vertragszahnärztlichen<br />
Versorgung, Köln.<br />
Katthagen, B.-D./ Buckup, K. (1999): Hauptsache Ges<strong>und</strong>heit. Welche Zukunft hat die Mediz<strong>in</strong>?<br />
Darmstadt.<br />
Kirchberger, S. (1993): The diffusion of two technologies for renal stone treatments across Europe, <strong>in</strong>:<br />
The K<strong>in</strong>gs F<strong>und</strong> Centre (Hg.): A study of the diffusion of medical technology <strong>in</strong> Europe, London,<br />
S.1-52.<br />
Klanberg, F./ Pr<strong>in</strong>z, A. (1983): Anatomie der Sozialhilfe, <strong>in</strong>: F<strong>in</strong>anzarchiv 1983, S. 281 ff.<br />
Kle<strong>in</strong>, T./ Salaske, I. (1994a): Determ<strong>in</strong>anten des Heime<strong>in</strong>tritts im Alter <strong>und</strong> Chancen se<strong>in</strong>er Vermeidung<br />
- E<strong>in</strong>e Längsschnittuntersuchung für die B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland, <strong>in</strong>: Zeitschrift für<br />
Gerontologie <strong>und</strong> Geriatrie, Heft 7, S.442-455.<br />
Kle<strong>in</strong>, T./ Salaske, I. (1994b): Die Bedeutung sozialer Beziehungen für den Heime<strong>in</strong>tritt im Alter.<br />
Theoretische Überlegungen <strong>und</strong> empirische Bef<strong>und</strong>e, <strong>in</strong>: Zeitschrift für Sozialreform, 40.Jg.,<br />
Heft 10, S.641-661.<br />
Klitzsch, W. (1992): Mehr Betten <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>, <strong>in</strong>: Rhe<strong>in</strong>isches Ärzteblatt, 49.Jg., Heft 9, S.347-356.<br />
Koch, U./Bürger, W. (1996): Ambulante Rehabilitation. Ziele, Voraussetzungen <strong>und</strong> Angebotsstruktur,<br />
Schriftenreihe zum Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Sozialwesen, Bonn.<br />
Kommission der Europäischen Geme<strong>in</strong>schaften (1998): Entwurf - Mitteilung der Kommission an den<br />
Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- <strong>und</strong> Sozialausschuß <strong>und</strong> den Ausschuß der<br />
Regionen über die Entwicklung der Geme<strong>in</strong>schaftspolitik im Bereich der öffentlichen Ges<strong>und</strong>heit.<br />
Krämer, W. (1989): Die Krankheit des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s. Die Fortschrittsfalle der Mediz<strong>in</strong>, Frankfurt<br />
a.M.<br />
Krämer, W. (1996): Die Fortschrittsfalle oder Hippokrates versus Sisyphus, <strong>in</strong>: Frankfurter Allgeme<strong>in</strong>e<br />
Magaz<strong>in</strong>, S.18-23.<br />
Kwartel, A.J.J. u.a. (1999): Brancherapport curatieve somatische zorg 1999; ontwikkel<strong>in</strong>gen, kengetallen,<br />
verdiep<strong>in</strong>gsstudies, Nivel/Nzi, Utrecht.<br />
- 223 -
Literaturverzeichnis<br />
Landesamt für Datenverarbeitung <strong>und</strong> Statistik Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (1999): Statistische Berichte:<br />
Struktur der Unternehmen des Gastgewerbes <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen, Ergebnisse der Erhebung<br />
für das Geschäftsjahr 1997, Düsseldorf.<br />
Landesarbeitsamt Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (1999): Sektoraler Strukturwandel <strong>in</strong> NRW im Spiegel der<br />
Beschäftigtenstatistik, <strong>in</strong>: Informationen zum <strong>Arbeitsmarkt</strong>, Nr.15.<br />
Landes<strong>in</strong>itiative Health Care NRW (1998): Der Health Care Standort NRW im <strong>in</strong>ternationalen Vergleich,<br />
Köln.<br />
Lanz Kaufmann, E. (1999): Wellness-Tourismus. Marktanalyse <strong>und</strong> Qualitätsanforderungen für die<br />
Hotellerie - Schnittstellen zur Ges<strong>und</strong>heitsförderung, Berner Studien zu Freizeit <strong>und</strong> Tourismus<br />
38, Bern.<br />
LCVV: De toekomst van gisteren. www.lcvvv.nl/nieuws/mei98/toekom.html.<br />
Leeuwen-Seelt, E.I.v. (1998): Functiedifferentiatie aantrekkelijk <strong>in</strong>strument voor organisatievernieuw<strong>in</strong>g,<br />
<strong>in</strong>: ZM, Heft 1, S.9-16.<br />
Leidl, R. (1998): Die Ausgaben für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> ihre F<strong>in</strong>anzierung, <strong>in</strong>: Schwartz, F.W./ Badura, B./<br />
Leidl, R./ Raspe, H./ Siegrist, J. (Hg), S.245-258.<br />
Leiser<strong>in</strong>g, L. (1992): Sozialstaat <strong>und</strong> demographischer Wandel. Wechselwirkungen, Generationenverhältnisse,<br />
politisch-<strong>in</strong>stitutionelle Steuerung, Frankfurt a.M./ New-York: Campus.<br />
Lohmann, M. (1997): Ges<strong>und</strong>heitsurlaub, Wellness-Urlaub: Marktsituation <strong>und</strong> Perspektiven, <strong>in</strong>: Psychosozial,<br />
20.Jg., Heft 3, S.33-39.<br />
Maas, P.J.v.d. u.a. (1996): The future of the health and health care of the Dutch, <strong>in</strong>: Gunn<strong>in</strong>g-<br />
Schepers, L.J./ Kronje, G.J./ Spasoff, R.A (Hg.).<br />
McKeown, T. (1976): The role of medic<strong>in</strong>e - dream, mirage or nimesis? Nuffield Prov<strong>in</strong>cial Trust,<br />
London.<br />
Mediz<strong>in</strong>ischer Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen (2000): Modellvorhaben zur Prüfung<br />
der Notwendigkeit der Krankenhausplanung. Zusammenfassender Bericht über die Ergebnisse<br />
<strong>in</strong> den B<strong>und</strong>esländern, Essen.<br />
M<strong>in</strong>isterium für Arbeit, Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziales des Landes Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (1991): Ges<strong>und</strong>heitsreport<br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen 1990, Bielefeld.<br />
M<strong>in</strong>isterium für Arbeit, Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziales des Landes Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (MAGS NW) (Hg.)<br />
(1991): Politik für ältere Menschen, 2. Landesaltenplan für Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen, Schriftenreihe<br />
des MAGS, Düsseldorf: Selbstverlag.<br />
M<strong>in</strong>isterium für Arbeit, Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziales des Landes Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (MAGS NW) (Hg.)<br />
(1995): Ambulante Pflegedienste <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen: Bestandsanalyse <strong>in</strong> typischen Regionen.<br />
Forschungsbericht des Kuratoriums Deutsche Altershilfe – Wilhelm<strong>in</strong>e-Lübke-Stiftung<br />
e.V. <strong>in</strong> Zusammenarbeit mit der ISG Sozialforschung <strong>und</strong> Gesellschaftspolitik GmbH, Düsseldorf:<br />
Selbstverlag.<br />
M<strong>in</strong>isterium für Wirtschaft <strong>und</strong> Mittelstand, Technologie <strong>und</strong> Verkehr des Landes Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen (1999): Health Care aus Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen: Ihr Weg nach Europa, Düsseldorf.<br />
Mohr, F.W. (1989): Die Personalsituation im Krankenpflegedienst <strong>und</strong> <strong>in</strong> den Schulen für Krankenpflegeberufe<br />
<strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen, <strong>in</strong>: das Krankenhaus, 81.Jg., Heft 9, S.475-485.<br />
Müller, J. (1999): Das niederländische Ges<strong>und</strong>heitssystem - Modell für Deutschland? <strong>in</strong>: Arbeit <strong>und</strong><br />
Sozialpolitik, Heft 1/2.<br />
Naegele, G. (1999): Demographie <strong>und</strong> Sozialepidemiologie - Zur These vom demographisch bed<strong>in</strong>gten<br />
Anstieg der Ges<strong>und</strong>heitsausgaben, <strong>in</strong>: Naegele, G./ Igl, G. (Hg.): Perspektiven e<strong>in</strong>er sozialstaatlichen<br />
Umverteilung im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>, München, S.63-85.<br />
Nefiodow, L.A. (1996): Der sechste Kontratieff. Wege zur Produktivität <strong>und</strong> Vollbeschäftigung im<br />
Zeitalter der Information, St. August<strong>in</strong>.<br />
- 224 -
Literaturverzeichnis<br />
Neuhäuser, J. (1996): Sozialhilfe <strong>und</strong> Leistungen an Asylbewerber 1994: Ausgaben <strong>und</strong> E<strong>in</strong>nahmen,<br />
<strong>in</strong>: Wirtschaft <strong>und</strong> Statistik, Heft 10, S.633-641.<br />
Niskanen, W.A. (1971): Bureaucracy and Representative Government, Chicago/ New-York: Ald<strong>in</strong>e.<br />
Niskanen, W.A. (1975): Bureaucrats and Politicians, <strong>in</strong>: Journal of law and economics 18, S.617-643.<br />
Niskanen, W.A. (1991): A Reflection on Bureaucracy and Representative Government, <strong>in</strong>: Blais, A./<br />
Dion, S. (Hg.): The Budget-Maximiz<strong>in</strong>g Bureaucrat. Appraisals and Evidence, Pittsburgh: Univ.<br />
Press.<br />
Perleth, M./ Busse, R. (1999): Stent<strong>in</strong>g versus Ballondilatation bei koronarer Herzkrankheit. Systematische<br />
Übersicht zur mediz<strong>in</strong>ischen Effektiviät, <strong>in</strong>: Perlth, M./ Kochs, G. (Hg.): Stent<strong>in</strong>g versus<br />
Ballondilatation bei koronarer Herzkrankheit. Systematische Übersichten zur mediz<strong>in</strong>ischen Effektivität<br />
<strong>und</strong> zur Kosten-Effektivität, Baden-Baden: Nomos, S.19-246.<br />
Perleth, M./ Mannebach, H./ Busse, R./ Schwartz, F.W. (1999): Cardiac Catheterization <strong>in</strong> Germany -<br />
Diffusion and Utilization from 1984 to 1996, <strong>in</strong>: International Journal of Technology Assessment<br />
<strong>in</strong> Health Care, 15.Jg., Heft 4, S.756-766.<br />
Perschke-Hartmann, C. (1994): Die doppelte Reform - Ges<strong>und</strong>heitspolitik von Blüm zu Seehofer,<br />
Opladen: Leske & Budrich.<br />
Presse- <strong>und</strong> Informationsamt der B<strong>und</strong>esregierung (2000a): Arbeitmarkt entwickelt sich weiter positiv,<br />
<strong>in</strong>: Sozialpolitische Umschau, Heft 6, S.3-7, 13-3-2000.<br />
Presse- <strong>und</strong> Informationsamt der B<strong>und</strong>esregierung (2000b): Wirtschaftliche Lage <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland - Angaben des B<strong>und</strong>esf<strong>in</strong>anzm<strong>in</strong>isteriums, <strong>in</strong>: Sozialpolitische Umschau, Heft<br />
6, S. 16-20, 13-3-2000.<br />
Pr<strong>in</strong>z, A. (1983): Die F<strong>in</strong>anzierung der Sozialhilfe im F<strong>in</strong>anzverb<strong>und</strong> zwischen B<strong>und</strong>, Ländern <strong>und</strong><br />
Geme<strong>in</strong>den, <strong>in</strong>: F<strong>in</strong>anzarchiv Bd. 41 1983, S. 431-451.<br />
Pr<strong>in</strong>z, A. (1995): Die Auswirkungen des Gesetzes über die Pflegeversicherung auf das Angebot von<br />
Pflegeleistungen, <strong>in</strong>: Fach<strong>in</strong>ger/ Rothgang (Hg.), S.27-53.<br />
Rammert, W. (1994): Techniksoziologie, <strong>in</strong>: Kerber, H./ Schmieder, A. (Hg.): Spezielle Soziologie.<br />
Problemfelder, Forschungsbereiche, Anwendungsorientierung, Hamburg: Rohwolt, S.75-98.<br />
Reents, H. (1996): Gerontotechnik – e<strong>in</strong> neuer Markt, <strong>in</strong>: Handbuch der Gerontotechnik: <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äre<br />
Forschung. Praxisbeispiele. Losebl.-Ausg. Landsberg/Lech.<br />
Reichelt, H. (1994): Steuerungswirkungen der Selbstbeteiligung im Arzneimittelmarkt: Analyse der<br />
Auswirkungen bisher praktizierter <strong>und</strong> aktuell diskutierter Selbstbeteiligungsregelungen <strong>in</strong> der<br />
Arzneimittelversorgung im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung, Stuttgart/ Jena/<br />
New York: G. Fischer.<br />
Reichert, M. (1998): Häusliche Pflege <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen, Münster: LIT.<br />
Reister, M. (1998): Entwicklung der Versorgungsstrukturen der Vorsorge- oder Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen<br />
von 1991 bis 1997, <strong>in</strong>: Arnold M./ Paffrath, D. (Hg.): Krankenhausreport '98. Aktuelle<br />
Beiträge, Trends <strong>und</strong> Statistiken. Stuttgart, Jena, Lübeck, Ulm: Gustav Fischer, S.273-288.<br />
Robert-Bosch-Stiftung (Hg.) (1992): Pflege braucht Eliten. Denkschrift der „Kommission der Robert-<br />
Bosch-Stiftung zur Hochschulausbildung für Lehr- <strong>und</strong> Leitungskräfte <strong>in</strong> der Pflege, Beiträge<br />
zur Ges<strong>und</strong>heitsökonomie Bd. 28, Gerl<strong>in</strong>gen: Bleicher.<br />
Rohleder, C./ Krämer, K. (1998): Zum Ausbildungsplatzbedarf <strong>in</strong> ausgewählten pflegerischen Berufen<br />
<strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen. Abschlussbericht e<strong>in</strong>er Untersuchung im Auftrag des M<strong>in</strong>isteriums für<br />
Frauen, Jugend, Familie <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit des Landes Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen, Forschungsgesellschaft<br />
für Gerontologie, Dortm<strong>und</strong>.<br />
Roodbol, P.F./ Jaspers, Fr. C.A. (2000): Nurse practitioner op mastersniveau, <strong>in</strong>: Medisch Contact,<br />
55.Jg., Heft 2, S.51-53.<br />
- 225 -
Literaturverzeichnis<br />
Roth, G. (1998): Veränderungen der <strong>in</strong>stitutionellen F<strong>in</strong>anzverflechtung durch das Pflege-<br />
Versicherungsgesetz <strong>und</strong> Landespflegegesetz Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen. E<strong>in</strong>e erste systematische<br />
Betrachtung, <strong>in</strong>: Sozialer Fortschritt, Heft 2, S. 37-45.<br />
Roth, G. (1999a): Die Institution der kommunalen Sozialverwaltung: Aufgaben, Organisation, Leitgedanken<br />
<strong>und</strong> Mythen von der Weimarer Republik bis Mitte der neunziger Jahre, <strong>in</strong>: Schriften zur<br />
Wirtschafts- <strong>und</strong> Sozialgeschichte Bd. 56, Berl<strong>in</strong>: Duncker & Humblot.<br />
Roth, G. (1999b): Auflösung oder Konsolidierung korporatistischer Strukturen durch die Pflegeversicherung?<br />
<strong>in</strong>: Zeitschrift für Sozialreform, Heft 5, S. 418-446.<br />
Roth, G./ Rothgang, H. (1999a): Die Auswirkungen des Pflege-Versicherungsgesetzes auf die Entwicklung<br />
der Heimentgelte, <strong>in</strong>: Zeitschrift für Ges<strong>und</strong>heitswissenschaften, 7.Jg., Heft 4, S.307-<br />
336.<br />
Roth, G./ Rothgang, H. (1999b): Stop der “Preiswalze”? Führt das Pflege-Versicherungsgesetz zu<br />
e<strong>in</strong>er Angleichung <strong>und</strong> Begrenzung der Heimentgelte? ZeS-Arbeitspapier Nr.9, Bremen: Zentrum<br />
für Sozialpolitik.<br />
Rothgang, H. (1995): Der E<strong>in</strong>fluss der F<strong>in</strong>anzierungssysteme <strong>und</strong> Entscheidungsregeln auf Beschäftigungsstrukturen<br />
<strong>und</strong> -volum<strong>in</strong>a englischer <strong>und</strong> deutscher Krankenhäuser. [Dissertation].<br />
Rothgang, H. (1997): Ziele <strong>und</strong> Wirkungen der Pflegeversicherung. E<strong>in</strong>e ökonomische Analyse,<br />
Frankfurt a.M./ New York.<br />
Roux, A./ Eussen, M. (1998): Het ziekenhuis van morgen kan niet zonder partners, <strong>in</strong>: Zorg Visie,<br />
28.Jg., Heft 7, S.6-9.<br />
Royal Netherlands Embassy: General <strong>in</strong>formation - Overview of Health Care. http://www.netherlandsembassy.org/<strong>in</strong>f-heal.htm.<br />
Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> (1996): <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> <strong>in</strong><br />
Deutschland: Kostenfaktor <strong>und</strong> Zukunftsbranche, Sondergutachten 1996, Band 1: Demographie,<br />
Morbidität, Wirtschaftlichkeitsreserven <strong>und</strong> Beschäftigung, Baden-Baden: Nomos.<br />
Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> (1997): <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> <strong>in</strong><br />
Deutschland, Kostenfaktor <strong>und</strong> Zukunftsbranche, Band 2: Fortschritt <strong>und</strong> Wachstumsmärkte,<br />
F<strong>in</strong>anzierung <strong>und</strong> Vergütung, Sondergutachten 1997 Kurzfassung, Baden-Baden: Nomos.<br />
Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> (1998): <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> <strong>in</strong><br />
Deutschland Kostenfaktor <strong>und</strong> Zukunftsbranche. Band 2: Fortschritt Wachstumsmärkte F<strong>in</strong>anzierung<br />
<strong>und</strong> Vergütung. Sondergutachten 1997, Baden-Baden: Nomos.<br />
Sahner, H./ Rönnau, A. (1991): Freie Heilberufe <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsberufe <strong>in</strong> Deutschland. Schriften des<br />
Forschungs<strong>in</strong>stitutes Freie Berufe, Nr. 6, Lüneburg: FFB.<br />
Saltman, R.B./ Figueras, J. (1997): European Health Care Reform: Analysis of current Strategies, Copenhagen.<br />
Schaeffer, D./ Moers, M./ Rosenbrock, R. (1998): Zur Entwicklung von Pflege <strong>und</strong> Pflegewissenschaften,<br />
<strong>in</strong>: Schwartz, F.W./ Badura, B./ Leidl, R./ Raspe, H./ Siegrist, J. (Hg.), S.216-217.<br />
Schitag Ernst & Young (1998): Aufbruchstimmung 1998. Erster Deutscher Biotechnologie Report.<br />
Schlooz-Vries, M.S. u.a. (2000): Patienten tevereden over nurse practitioner, <strong>in</strong>: Medisch Contact,<br />
55.Jg., Heft 2, S.48-50.<br />
Schmidt, M.G. (1997): Sozialpolitik <strong>in</strong> Deutschland. Historische Entwicklung <strong>und</strong> <strong>in</strong>ternationaler<br />
Vergleich, 2. Aufl., Opladen: Leske & Budrich.<br />
Schmidt, M.G. (1999): Ges<strong>und</strong>heitsausgaben <strong>und</strong> Staatsquote. Bef<strong>und</strong>e des Vergleichs demokratisch<br />
verfaßter Länder, <strong>in</strong>: Häfner, H. (Hg.): Ges<strong>und</strong>heit - unser höchstes Gut? Berl<strong>in</strong>/ Heidelberg/<br />
New York: Spr<strong>in</strong>ger-Verlag, S.287-326.<br />
Schmidt, M.G. (1999a): Warum die Ges<strong>und</strong>heitsausgaben wachsen. Bef<strong>und</strong>e des Vergleichs demokratisch<br />
verfaßter Länder, <strong>in</strong>: Politische Vierteljahresschrift, Heft 2, S.229-245.<br />
- 226 -
Literaturverzeichnis<br />
Schmidt, M.G. (1999b): Immer noch auf dem ‚mittleren Weg‘? Deutschlands Politische Ökonomie am<br />
Ende des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts, ZeS-Arbeitspapier Nr. 7, Zentrum für Sozialpolitik, Universität<br />
Bremen.<br />
Schneekloth, U. u.a. (1996): Hilfe- <strong>und</strong> Pflegebedürftige <strong>in</strong> privaten Haushalten. Endbericht. Bericht<br />
zur Repräsentativerhebung im Forschungsprojekt "Möglichkeiten <strong>und</strong> Grenzen selbständiger<br />
Lebensführung", Schriftenreihe des B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isteriums für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend,<br />
111.Jg., Heft 2., Stuttgart/ Berl<strong>in</strong>/ Köln: Kohlhammer-Verlag.<br />
Schneider, M. u.a. (1998): Ges<strong>und</strong>heitssysteme im <strong>in</strong>ternationalen Vergleich: Übersichten 1997, Laufende<br />
Berichterstattung zu ausländischen Ges<strong>und</strong>heitssystemen, Augsburg.<br />
Schneider, M./ Beckmann, M./ Biene-Dietrich, P./ Gabanyi, M./ Hofmann, U./ Köse, A./ Mill, D./<br />
Späth, B. (1998): Ges<strong>und</strong>heitssysteme im <strong>in</strong>ternationalen Vergleich. Übersichten 1997, Augsburg.<br />
Schnur, P. (1999): Dienstleistungsgesellschaft auf <strong>in</strong>dustriellem Nährboden; IAB Kurzbericht Nr.9;<br />
Institut für <strong>Arbeitsmarkt</strong>- <strong>und</strong> Berufsforschung, Nürnberg.<br />
Schoch, F. (1994): F<strong>in</strong>anzverantwortung beim kommunalen Verwaltungsvollzug b<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> landesrechtlich<br />
veranlaßte Ausgaben, <strong>in</strong>: Zeitschrift für Gesetzgebung, Heft 3, S.246-261.<br />
Schölkopf, M. (1998): Die Altenpflege <strong>und</strong> die Daten: Zur quantitativen Entwicklung der Versorgung<br />
pflegebedürftiger älterer Menschen, <strong>in</strong>: Sozialer Fortschritt, Heft 1, S.1-9.<br />
Schölkopf, M. (1999a): Altenpflegepolitik <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland: Zwischen Bedarfsdekkung<br />
<strong>und</strong> Marg<strong>in</strong>alisierung. E<strong>in</strong>e Analyse der Expansion der Pflegedienste im B<strong>und</strong>esländervergleich,<br />
Dissertation, Universität Konstanz (ersche<strong>in</strong>t bei: Leske & Budrich, Opladen).<br />
Schölkopf, M. (1999b): Altenpflegepolitik an der Peripherie des Sozialstaats? Die Expansion der Pflegedienste<br />
zwischen Verbändewohlfahrt, M<strong>in</strong>isterialbürokratie <strong>und</strong> Parteien, <strong>in</strong>: Politische Vierteljahresschrift,<br />
Heft 2, S. 246-278.<br />
Schreiber, A. (1997): Erkrankungen des Kauorgans, <strong>in</strong>: Schwartz, F.W./Badura, B./Leidl, R./Raspe,<br />
H./Siegrist, J., (Hg.), S.485-492.<br />
Schubert, K. (1991): Politikfeldanalyse, Opladen: Leske & Budrich.<br />
Schulze, G. (1992): Die Erlebnis-Gesellschaft: Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt a.M./ New<br />
York: Campus.<br />
Schulz-Weidner, W./ Felix, F. (1997): Die Konsequenzen der Europäischen Wirtschaftsverfassung für<br />
die Österreichische Sozialversicherung, <strong>in</strong>: Soziale Sicherheit. Fachzeitschrift der Österreichischen<br />
Sozialversicherung, 50.Jg., Heft 12, S.1121-1160.<br />
Schut, F.T. u.a. (1999): Towards a re<strong>in</strong>forced agency role of health <strong>in</strong>surers <strong>in</strong> Belgium and the Netherlands,<br />
<strong>in</strong>: Health Policy, 48.Jg., Heft 1, S.47-67.<br />
Schwartz, F.W./ Badura, B./ Leidl, R./ Raspe, H./ Siegrist J. (1998): Das Public Health Buch: Ges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>, München/ Wien/ Baltimore: Urban <strong>und</strong> Schwarzenberg.<br />
Schwartz, F.W./ Busse, R. (1996): Fixed budgets <strong>in</strong> the ambulatory sector: the German Experience, <strong>in</strong>:<br />
Schwartz, F.W./ Glennerster, H./ Saltman R.B. (Hg.), S.92-108.<br />
Schwartz, F.W./ Busse, R. (1998): Denken <strong>in</strong> Zusammenhängen: Ges<strong>und</strong>heitssystemforschung, <strong>in</strong>:<br />
Schwartz, F.W./ Badura, B./ Leidl, R./ Raspe, H./ Siegrist, J. (Hg.).<br />
Schwartz, F.W./ Glennerster, H./ Saltman, R.B. (1996): Fix<strong>in</strong>g health budgets. Exeperiences from<br />
Europe and North America, Wiley: Chichester.<br />
Schwartz, F.W./ Kickbusch, I./ Wismar, M. (1997): Ziele <strong>und</strong> Strategien der Ges<strong>und</strong>heitspolitik, <strong>in</strong>:<br />
Schwartz, F.W./ Badura, B./ Leidl, R./ Raspe, H./ Siegrist, J. (Hg.), S.172-188.<br />
Schwartz, F.W./ Robra, B.P./ Bengel, J./ Koch, U. (1995): Evaluationsforschung, <strong>in</strong>: Schwartz, F.W.<br />
(Hg.): Ges<strong>und</strong>heitssystemforschung <strong>in</strong> Deutschland: Denkschrift/ Deutsche Forschungsgeme<strong>in</strong>schaft,<br />
We<strong>in</strong>heim: VCH Verlagsgesellschaft, S.51-56.<br />
- 227 -
Literaturverzeichnis<br />
Schwartz, F.W./ Wismar, M. (1998): Wie steuerbar ist das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>, <strong>in</strong>: Meggeneder, O./<br />
Noack, H. (Hg.): Wie steuerbar ist das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>? <strong>in</strong>: Oberösterreichische Gebietskrankenkasse,<br />
L<strong>in</strong>z, S.31-47.<br />
Schwartz, F.W./Badura, B./Leidl, R./Raspe, H./Siegrist, J., (1997): Das Public Health Buch : Ges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>und</strong> <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>. München-Wien-Baltimore: Urban <strong>und</strong> Schwarzenberg.<br />
Sendler, H. (1996): Bestandsaufnahme <strong>und</strong> Perspektiven der EU-Politik im Bereich des <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>s<br />
aus Sicht e<strong>in</strong>es B<strong>und</strong>eslandes, <strong>in</strong>: Gesellschaft für Versicherungswissenschaft <strong>und</strong> -<br />
gestaltung (Hg.): Auswirkungen der Politik der Europäischen Union auf das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong><br />
<strong>und</strong> die Ges<strong>und</strong>heitspolitik <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland - Bestandsaufnahmen <strong>und</strong> Perspektiven,<br />
Bonn, S.51-58.<br />
Shum, C./Humphreys, A./Wheeler, D./Cochrane, M.-A./Skoda, S./Clement, S. (2000): Nurse management<br />
of patients with m<strong>in</strong>or illnesses <strong>in</strong> general practice: multicentred, randomized controlled<br />
trial, <strong>in</strong>: British Medical Journal 320, S.1038-1043.<br />
Sommer, J.H. (1999): Ges<strong>und</strong>heitssysteme zwischen Plan <strong>und</strong> Markt, Stuttgart.<br />
Statistisches B<strong>und</strong>esamt (1998): Ges<strong>und</strong>heitsbericht für Deutschland, Stuttgart: Metzler-Poeschel.<br />
Statistisches B<strong>und</strong>esamt (2000): <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>, Fachserie 12, Reihe 6.1 Gr<strong>und</strong>daten der Krankenhäuser<br />
<strong>und</strong> Vorsorge- oder Rehabilitationse<strong>in</strong>richtungen: 1998. Stuttgart: Metzler-Poeschel.<br />
Ste<strong>in</strong>brück, P. (1999): Ganz oben <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen, <strong>in</strong>: Verlagsbeilage „Ostwestfalen-Lippe“<br />
zur Frankfurter Allgeme<strong>in</strong>en Zeitung v. 20.10.99.<br />
Ste<strong>in</strong>meyer, H.D. (1999): Hat das Territorialitätspr<strong>in</strong>zip <strong>in</strong> der GKV noch Zukunft? <strong>in</strong>: Die Krankenversicherung,<br />
51.Jg., Heft 10, S.288-291.<br />
Tögel, T. (1999): Draft Op<strong>in</strong>ion of Commission 5 for Social Policy, Public Health, Consumer Protection,<br />
Research and Tourism on the Role of the local and regional authorities <strong>in</strong> the reform of<br />
European public health systems. COM 5/021.<br />
Trouwborst, A. (2000): Ge<strong>in</strong>tegreerde zorg, ons aller zorg, <strong>in</strong>: Medisch Contact, 55.Jg., Heft 6, S.214-<br />
216.<br />
van der Mei, A.P. (1999): The Kohll and Decker rul<strong>in</strong>gs: revolution or evolution? <strong>in</strong>: eurohealth, 5.Jg.,<br />
Heft 1, S.14-15.<br />
Veen, E.v.d./ Limberger, H.H.B. (1996): The assurance of appropriate care, <strong>in</strong>: Gunn<strong>in</strong>g-Schepers,<br />
L.J./ Kronje, G.J./ Spasoff, R.A. (Hg.).<br />
Veen, R.v.d./ Trommel, W. (1998): Managed Liberalization of the Dutch Welfare State. A review and<br />
analysis of the reform of the Dutch social security system, 1985-1997. Verv. Ms. University of<br />
Twente.<br />
Venn<strong>in</strong>g, P./ Durie, A./ Roland, M./ Roberts, C./ Leese, B. (2000): Randomized controlled trial compar<strong>in</strong>g<br />
cost effectiveness of general practioners and nurse practioners <strong>in</strong> primary care, <strong>in</strong>: British<br />
Medical Journal 320, S.1048-1053.<br />
Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (1998): VDR Statistik Rehabilitation. Leistungen zur<br />
Rehabilitation <strong>und</strong> sonstige Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung im Jahre 1997, Bd.<br />
127. Frankfurt am Ma<strong>in</strong>.<br />
Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (1999): Statistics 99– Die Arzneimittel<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong><br />
Deutschland, Bonn.<br />
Visser, J./ Hemerijk, A. (1998): E<strong>in</strong> holländisches W<strong>und</strong>er? Reform des Sozialstaates <strong>und</strong> Beschäftigungswachstum<br />
<strong>in</strong> den Niederlanden, Frankfurt a.M./ New York.<br />
von Bandemer, S.v./ Hartmann, A./ Hilbert, J./ Langer, D. (1997): Marktbeobachtung <strong>und</strong> Produktentwicklung:<br />
Entwicklungspotentiale der Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft <strong>in</strong> Bielefeld, Studie im Auftrag<br />
der WEGE mbH, Bielefeld.<br />
- 228 -
Literaturverzeichnis<br />
VWS M<strong>in</strong>isterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1999): Zorgnota 2000; hoofdrapport, Sdu<br />
Uitgeverij, Den Haag.<br />
Wasem, J. (1998): Im Schatten des GSG: Ges<strong>und</strong>heitspolitik <strong>in</strong> der 13. Wahlperiode des Deutschen<br />
B<strong>und</strong>estags - e<strong>in</strong>e (vorläufige) Bilanz, <strong>in</strong>: Arbeit <strong>und</strong> Sozialpolitik, 52.Jg., Heft 7/8, S.18-29.<br />
Wasem, J. (1999): Das <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> <strong>in</strong> Deutschland: E<strong>in</strong>stellungen <strong>und</strong> Erwartungen der Bevölkerung.<br />
Wissenschaftliche Analyse <strong>und</strong> Bewertung e<strong>in</strong>er repräsentativen Bevölkerungsstudie,<br />
Neuss.<br />
Webber, D. (1989): Zur Geschichte der Ges<strong>und</strong>heitsreformen <strong>in</strong> Deutschland - II. Teil: Norbert Blüms<br />
Ges<strong>und</strong>heitsreform <strong>und</strong> die Lobby, <strong>in</strong>: Leviathan, S.262-300.<br />
WEGE (Hg.) (1997): Ges<strong>und</strong>heitswirtschaft <strong>in</strong> der Stadt Bielefeld; Daten - Fakten – Analysen, WEGE<br />
mbH, Bielefeld.<br />
Wessl<strong>in</strong>g, U./ Wirth, S. (1996): Pflege auf dem Weg zur Wissenschaft? <strong>in</strong>: Arnold, M./ Paffrath, D.<br />
(Hg.): Krankenhausreport `96: Aktuelle Beiträge, Trends <strong>und</strong> Statistiken, Stuttgart u.a., S.179-<br />
189.<br />
Wiegers, T. u.a. (1999): Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 1999; hoofdrapport, NI-<br />
VEL/NZi/OSA, Den Haag.<br />
Wiegers, T. u.a. (1999): Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 1999; bijlagen, NIVEL/NZi/OSA,<br />
Den Haag.<br />
Wilensky, Harold (1975): The Welfare State and Equality, Berkley.<br />
Wismar, M. (1996): <strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong> im Übergang zum Postfordismus: Die ges<strong>und</strong>heitspolitische<br />
Regulierung der Fordismuskrise <strong>in</strong> Großbritannien <strong>und</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland, Frankfurt<br />
a.M.: VAS.<br />
Wismar, M. (1998): Europa regiert schon lange heimlich mit, <strong>in</strong>: Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Gesellschaft, 10.Jg.,<br />
Heft 1, S.28-35.<br />
Wismar, M. (2000): Warum Herr Peerboms aus dem Koma erwachte, <strong>in</strong>: Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Gesellschaft,<br />
4.Jg., Heft 3, S.22-24.<br />
Wismar, M./ Busse, R. (1998): Freedom of movement challenges European health care scenery, <strong>in</strong>:<br />
eurohealth, 4.Jg., Heft 2, S.13-15.<br />
Wismar, M./ Busse, R. (1999): Effects of the European S<strong>in</strong>gle Market Integration on the German Public<br />
Health System - Auswirkungen der europäischen B<strong>in</strong>nenmarkt<strong>in</strong>tegration auf das deutsche<br />
<strong>Ges<strong>und</strong>heitswesen</strong>, <strong>in</strong>: Bellach, B.-M./ Ste<strong>in</strong>, H. (Hg.): The new Public Health Policy of the European<br />
Union - Die neue Ges<strong>und</strong>heitspolitik der Europäischen Union, München: Urban <strong>und</strong><br />
Vogel, S.83-99.<br />
Wollmann, H. (1991): Implementationsforschung/ Evaluationsforschung, <strong>in</strong>: Nohlen, D. (Hg.): Wörterbuch<br />
Staat <strong>und</strong> Politik, München/ Zürich: Pieper, S.235-239.<br />
Zeggelt, F./ Zemmel<strong>in</strong>k, M.(1998): Een zotel is een zorgvorm erbij, <strong>in</strong>: Zorgvisie, 28.Jg., Heft 9, S.12-<br />
15.<br />
Zentral<strong>in</strong>stititut für die Kassenärztliche Versorgung (1998): Der Vertragsarzt als Arbeitergeber, Köln.<br />
- 229 -
Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit<br />
der Landesregierung Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen herausgegeben. Sie darf weder von<br />
Parteien noch von Wahlwerber<strong>in</strong>nen <strong>und</strong><br />
-werbern oder Wahlhelfer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> -helfern<br />
während e<strong>in</strong>es Wahlkampfes zum Zwecke der<br />
Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für<br />
Landtags-, B<strong>und</strong>estags- <strong>und</strong> Kommunalwahlen<br />
sowie auch für die Wahl der Mitglieder des<br />
Europäischen Parlaments.<br />
Missbräuchlich ist <strong>in</strong>sbesondere die Verteilung<br />
auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen<br />
der Parteien sowie das E<strong>in</strong>legen,<br />
Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer<br />
Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist<br />
gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke<br />
der Wahlwerbung. E<strong>in</strong>e Verwendung dieser<br />
Druckschrift durch Parteien oder sie unterstützende<br />
Organisationen ausschließlich zur<br />
Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt<br />
hiervon unberührt.<br />
Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg <strong>und</strong><br />
<strong>in</strong> welcher Anzahl diese Schrift der Empfänger<strong>in</strong><br />
oder dem Empfänger zugegangen ist, darf sie<br />
auch ohne zeitlichen Bezug zu e<strong>in</strong>er bevorstehenden<br />
Wahl nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Weise verwendet<br />
werden, die als Parte<strong>in</strong>ahme der Landesregierung<br />
zugunsten e<strong>in</strong>zelner Gruppen verstanden<br />
werden könnte.<br />
Impressum<br />
Herausgeber:<br />
M<strong>in</strong>isterium für Frauen, Jugend,<br />
Familie <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit<br />
des Landes Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen<br />
40190 Düsseldorf<br />
Internet: www.mfjfg.nrw.de<br />
e-mail: <strong>in</strong>fo@mail.mfjfg.nrw.de<br />
Umschlaggestaltung:<br />
Lüdicke+Partner, Meerbusch<br />
Druck:<br />
toennes satz+druck GmbH,<br />
Erkrath<br />
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit<br />
Genehmigung des Herausgebers.<br />
Düsseldorf, Juni 2001