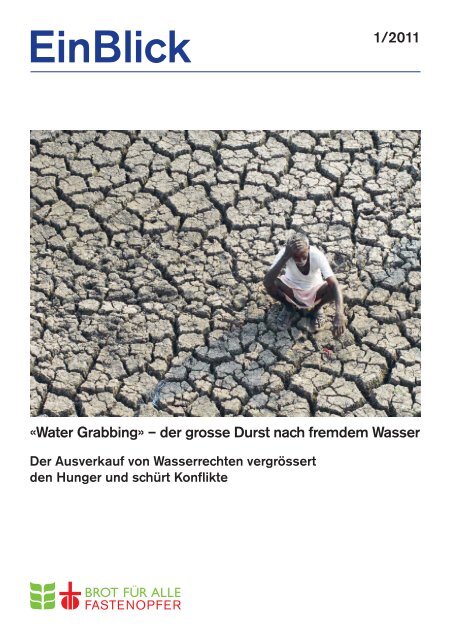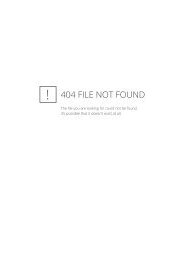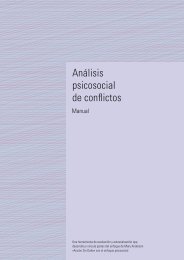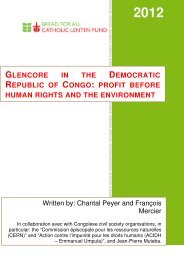Water Grabbing» – der grosse Durst nach fremdem ... - Fastenopfer
Water Grabbing» – der grosse Durst nach fremdem ... - Fastenopfer
Water Grabbing» – der grosse Durst nach fremdem ... - Fastenopfer
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
EinBlick<br />
«<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong> <strong>–</strong> <strong>der</strong> <strong>grosse</strong> <strong>Durst</strong> <strong>nach</strong> <strong>fremdem</strong> Wasser<br />
Der Ausverkauf von Wasserrechten vergrössert<br />
den Hunger und schürt Konflikte<br />
1/2011
Inhaltsverzeichnis<br />
Editorial 3<br />
Einführung ins Thema<br />
«<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong> <strong>–</strong> die versteckte Agenda 4<strong>–</strong>9<br />
«<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong> führt zu Menschenrechtsverletzungen und Konflikten 10<strong>–</strong>12<br />
Eine schwere Hypothek für die betroffenen Län<strong>der</strong> und Bevölkerungen 13<strong>–</strong>15<br />
Fallbeispiele<br />
Sierra Leone: Wasser spielt auch Schlüsselrolle beim<br />
Agrotreibstoffprojekt von Addax Bioenergy 16<strong>–</strong>17<br />
Brasilien: Wasserprojekt für die Agrarindustrie bedroht Existenz<br />
von Kleinbauernfamilien 18<strong>–</strong>19<br />
Madagaskar: «Die Gefahr <strong>der</strong> Land-Deals ist nicht gebannt» 20<strong>–</strong>21<br />
Die internationale Gemeinschaft und die Schweiz<br />
Reichen Empfehlungen und freiwillige Verpflichtungen? 22<strong>–</strong>25<br />
Handlungsmöglichkeiten<br />
Dort ansetzen, wo wir leben und Einfluss haben 26<strong>–</strong>27<br />
Das tun Brot für alle und <strong>Fastenopfer</strong> 28<br />
Das können wir tun 29<br />
Quellenhinweise und Links 30<br />
Impressum 31<br />
Titelbild:<br />
Bauer in einem ausgetrockneten Flussbett bei Hy<strong>der</strong>abad, Indien © Mahesh Kumar / Keystone
Editorial<br />
Im Frühjahr 2010 haben wir einen EinBlick<br />
zum «Land <strong>Grabbing»</strong> publiziert. Private Investoren<br />
und Staaten wie China o<strong>der</strong> die<br />
Golfstaaten sichern sich Millionen von Hektar<br />
Ackerland in Län<strong>der</strong>n des Südens. Gemäss<br />
<strong>der</strong> Universität Kopenhagen wurden bis<br />
2010 allein in Afrika rund 60 Millionen<br />
Hektar veräussert. In Mosambik existieren<br />
beispielsweise Landverträge für über 20 Prozent<br />
<strong>der</strong> landwirtschaftlich nutzbaren Fläche.<br />
Der wohl wichtigste Grund, sich langfristig<br />
Landrechte zu sichern, ist das Wasser.<br />
Nur bewässerbares Land ist für die industrielle<br />
Landwirtschaft brauchbar. Ohne die mit<br />
dem Land verknüpften Wasserrechte sind<br />
Investitionen in Land uninteressant. Hinter<br />
dem «Land <strong>Grabbing»</strong> steht «<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong>,<br />
das «Abgraben von Wasser». So<br />
schwärmt Susan Payne, Managerin des erfolgreichen<br />
African Agricultural Land Fund:<br />
«Wasser wird ein fantastisch knappes Anlagegut<br />
sein.» Die Verfügungsrechte über Wasser<br />
sind das eigentliche Investitions- und<br />
Spekulationsgut.<br />
Weltweit leiden mehr als eine Milliarde Menschen<br />
unter Trinkwassermangel. Die Wasserknappheit<br />
wird durch Klimawandel und<br />
nicht <strong>nach</strong>haltige Wassernutzung verschärft.<br />
Die neuen agroindustriellen Betriebe pumpen<br />
Wasser aus dem Boden und aus Flüssen. Vielerorts<br />
in Afrika mühen sich Frauen mehrere<br />
Stunden pro Tag ab, um Wasser für die Fa-<br />
Miges Baumann, Brot für alle<br />
Leiter Entwicklungspolitik<br />
milie und den Haushalt zu besorgen. Vom<br />
sinkenden Grundwasserspiegel sind sie als<br />
Erste betroffen.<br />
Fehlen<strong>der</strong> Zugang zu Wasser ist Ursache vieler<br />
Konflikte. Was, wenn <strong>der</strong> in Äthiopien<br />
entspringende Nil zu wenig Wasser führt,<br />
weil das Grundwasser für die von ausländischen<br />
Investoren bebauten Flächen in Äthiopien<br />
verwendet wird? Konflikte zwischen<br />
Ägypten, Sudan und Äthiopien sind absehbar.<br />
Für die Herstellung von Nahrungsmitteln,<br />
Rohstoffen und Agrotreibstoffen wird Wasser<br />
benötigt. Um einen Liter Treibstoff aus<br />
Zuckerrohr zu produzieren, braucht es beispielsweise<br />
rund 3500 Liter Wasser. Wir konsumieren<br />
mit allen importieren Produkten<br />
dieses «virtuelle» Wasser. Unser Handeln als<br />
Konsumentinnen und Konsumenten ist daher<br />
gefragt.<br />
«<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong> verletzt elementare Menschenrechte.<br />
Deshalb unterstützen Brot für<br />
alle und <strong>Fastenopfer</strong> Partner im Süden, die<br />
sich gegen den Ausverkauf von Land- und<br />
Wasserrechten zur Wehr setzen. Dieser Ein-<br />
Blick beleuchtet Hintergründe und zeigt<br />
Handlungsansätze bei uns auf. Es geht dabei<br />
nicht nur um einen haushälterischen Umgang<br />
mit einem knappen Gut, es geht auch um<br />
Macht und Armut, um Investitionsregeln<br />
und den Kampf um ein öffentliches Gut, und<br />
nicht zuletzt um Verteilungsgerechtigkeit.<br />
Markus Brun, <strong>Fastenopfer</strong><br />
Leiter Entwicklungspolitische Grundlagen<br />
3
Einführung ins Thema<br />
«<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong> <strong>–</strong> die versteckte Agenda<br />
Miges Baumann, Leiter Ressort Entwicklungspolitik, Brot für alle<br />
Län<strong>der</strong> wie Saudi-Arabien verlagern ihre Nahrungsmittelproduktion ins Ausland,<br />
um eigene Wasserressourcen zu schonen. © Photo Researchers / Keystone<br />
Siebzig Prozent des global verfügbaren<br />
Süsswassers werden für die Produktion<br />
von Nahrungsmitteln und Agrotreibstoffen<br />
verbraucht. Dessen Verknappung macht<br />
es zu einem lukrativen Anlagegut.<br />
Seit einigen Jahren sind Regierungen, Firmen<br />
und Investmentfonds auf <strong>der</strong> Suche <strong>nach</strong><br />
Agrarland in Län<strong>der</strong>n Afrikas, Asiens und<br />
Lateinamerikas. Das Land wird gekauft o<strong>der</strong><br />
über lange Zeit (bis 99 Jahre) gepachtet. Dieser<br />
Hunger <strong>nach</strong> Land wird als «Land <strong>Grabbing»</strong><br />
bezeichnet (siehe EinBlick 1/2010). Die<br />
Land-Deals gehen fast immer auf Kosten von<br />
4<br />
Bauernfamilien, die das Land verlieren, das<br />
ihnen bisher zur Verfügung stand. Folgen dieser<br />
Entwicklung sind unter an<strong>der</strong>em mehr<br />
Armut, Hunger und Migration.<br />
«In Wirklichkeit ist aber das, was als ‹Land<br />
Grabbing› beschrieben wird, ‹<strong>Water</strong> Grabbing›»,<br />
erklärt Karin Smaller vom Internationalen<br />
Institut für Nachhaltige Entwicklung<br />
IISD. 1 Denn Wasser ist <strong>der</strong> wichtigste treibende<br />
Faktor hinter den Hun<strong>der</strong>ten von Landverträgen<br />
über Millionen von Hektaren, die in<br />
den letzten Jahren in Afrika und auf an<strong>der</strong>en<br />
Kontinenten abgeschlossen wurden. «<strong>Water</strong><br />
<strong>Grabbing»</strong> <strong>–</strong> am besten vielleicht mit «Wasser
abgraben» übersetzt <strong>–</strong> ist <strong>der</strong> mit Landverträgen<br />
verbundene Erwerb von Verfügungsrechten<br />
über Grundwasser o<strong>der</strong> Wasser aus Flüssen<br />
und Bächen. Diese Verfügungsrechte sind<br />
oft schon im nationalen Recht mit dem Land<br />
verbunden o<strong>der</strong> sie werden in den Investitionsverträgen<br />
namentlich aufgeführt. «Zahlen<br />
zum ‹<strong>Water</strong> Grabbing› zu erhalten ist schwierig»,<br />
sagt Henk Hobbelink von GRAIN, jener<br />
Organisation, die das Thema «Land <strong>Grabbing»</strong><br />
international auf die Agenda gebracht<br />
hat. Und während «Land <strong>Grabbing»</strong> nun von<br />
vielen Organisationen aufgegriffen wird und<br />
am Weltsozialform 2011 in Dakar das heisse<br />
Thema war, erhält das «<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong> in<br />
<strong>der</strong> Öffentlichkeit praktisch noch keine Aufmerksamkeit.<br />
Wasser als treiben<strong>der</strong> Faktor<br />
von «Land <strong>Grabbing»</strong><br />
Es ist unmöglich, einen genauen Überblick<br />
über alle Land-Deals zu behalten. Das Global<br />
Land Project in Kopenhagen errechnete im<br />
August 2010, dass in 27 afrikanischen Län<strong>der</strong>n<br />
mit 177 Verträgen zwischen 51 und 63<br />
Millionen Hektar Land verpachtet worden<br />
sind. Je zehn Millionen Hektar in den Län<strong>der</strong>n<br />
Mosambik, Demokratische Republik<br />
Kongo und Kongo-Brazzaville sowie mindestens<br />
je drei Millionen Hektar im Sudan, in<br />
Äthiopien und Madagaskar. 2 Gemäss Oxfam<br />
werden zwei Drittel aller Landverträge in<br />
Afrika abgeschlossen. Wasser ist einer <strong>der</strong><br />
wichtigsten langfristigen Faktoren hinter den<br />
boomenden Investitionen in Land. Rund 70<br />
Prozent des global verfügbaren Süsswassers<br />
werden in <strong>der</strong> Landwirtschaft verbraucht. Die<br />
Möglichkeit, Land zu bewässern, ist ausschlaggebend,<br />
wenn es um Investitionen in<br />
Land geht. Die Bewässerung von Flächen<br />
nimmt weltweit schnell zu. Zwischen 1962<br />
und 1998 betrug <strong>der</strong> Zuwachs jährlich 1,6<br />
Prozent, insgesamt 100 Millionen Hektar.<br />
«<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong> verschärft diesen Trend.<br />
Afrika südlich <strong>der</strong> Sahara verwendet nur etwa<br />
zwei Prozent seiner Frischwasser-Ressourcen<br />
für die Bewässerung. Die Region wird deshalb<br />
für Investoren als Gebiet mit einem hohen ungenutzten<br />
Potenzial für die bewässerte Landwirtschaft<br />
angesehen. Im Sudan, wo riesige<br />
Landflächen veräussert wurden, sind die bewässerten<br />
Flächen seit den 1970er-Jahren mit<br />
Investitionen aus den Golfstaaten stark ausgedehnt<br />
worden und betragen nun über zehn<br />
Prozent <strong>der</strong> landwirtschaftlich nutzbaren Fläche.<br />
Darauf wird mehr als die Hälfte <strong>der</strong><br />
Agrargüter des Sudans produziert. Mosambik<br />
hat mit rund 36 Millionen Hektar ein ebenso<br />
<strong>grosse</strong>s Bewässerungspotenzial. Im Jahr 2002<br />
wurden erst drei Prozent <strong>der</strong> Fläche bewässert.<br />
Mosambik ist deshalb zurzeit einer <strong>der</strong><br />
Hauptschauplätze des «Land <strong>Grabbing»</strong>. Bereits<br />
heute ist über ein Fünftel <strong>der</strong> landwirtschaftlich<br />
nutzbaren Fläche an ausländische<br />
Investoren verpachtet.<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
Derzeitige Nutzung<br />
0<br />
Sammeln von Nie<strong>der</strong>schlag/<br />
Oberflächenabfluss<br />
Potenzielle Nutzung<br />
Wassermanagementpotenzial in Afrika<br />
(Flächen in Millionen Hektar).<br />
Bewässerung Bewirtschaftung<br />
von Talgründen<br />
Bewässerungspotenzial Afrikas © FAO AQUASTAT<br />
5
Der Anbau von wasserintensiven Treibstoff-Pflanzen wie Zuckerrohr verstärkt<br />
den Druck auf bewässerbares Land. © Miges Baumann / Brot für alle<br />
Die Golfstaaten hingegen, die zu den Hauptakteuren<br />
des «Land <strong>Grabbing»</strong> zählen, nutzen<br />
über 80 Prozent ihres Frischwassers für<br />
die Landwirtschaft. Saudi-Arabien, das während<br />
vieler Jahre die inländische Weizenproduktion<br />
för<strong>der</strong>te, hat sich entschlossen, diese<br />
bis 2016 aufzugeben. Deshalb gründete <strong>der</strong><br />
Wüstenstaat 2008 einen 3,5 Milliarden US-<br />
Dollar schweren Fonds, dessen Hauptzweck<br />
ausländische Land- und Nahrungsmittel-Investitionen<br />
sind und <strong>der</strong> als ausdrückliches<br />
Ziel nennt, die eigenen Wasserressourcen zu<br />
schonen. Nicht zufällig zählen jene Staaten,<br />
die selbst stark unter Wasserknappheit leiden<br />
und einen hohen Importbedarf an Nahrungs-<br />
und Futtermitteln haben, zu den aktivsten<br />
Landkäufern in Afrika. Dazu gehören China,<br />
Saudi-Arabien und die Golfstaaten, Süd-<br />
korea, Israel und Indien.<br />
6<br />
Wasserverbrauch und -mangel nehmen<br />
stetig zu<br />
Das Wasser, das für die Herstellung eines landwirtschaftlichen<br />
o<strong>der</strong> industriellen Gutes benötigt<br />
wird, wird als «virtuelles Wasser» bezeichnet.<br />
Wenn ein Land ein wasserintensives<br />
Produkt ausführt, exportiert es Wasser in<br />
virtueller Form. «Der Handel mit Nahrungsmitteln<br />
ist nichts an<strong>der</strong>es als ein Handel mit<br />
virtuellem Wasser», erklärte <strong>der</strong> ehemalige<br />
Nestlé-Chef Peter Brabeck. Die Herstellung von<br />
Nahrungsmitteln und Agrotreibstoffen ist sehr<br />
wasserintensiv. Um ein Kilogramm Rindfleisch<br />
herzustellen braucht es beispielsweise rund<br />
15 500 Liter virtuelles Wasser. Und hinter<br />
einem 1,5 dl-Becher Pausenkaffee verbergen<br />
sich etwa 208 Liter Wasser. Produkte hinterlassen<br />
einen Wasser-Fussabdruck.
Der weltweite Wasserverbrauch hat sich in 50<br />
Jahren vervierfacht. Er nimmt etwa doppelt<br />
so schnell zu wie die Bevölkerung. Mehr als<br />
eine Milliarde Menschen lebt in Län<strong>der</strong>n, in<br />
denen Wasser knapp ist. Bis 2050 wird voraussichtlich<br />
ein Viertel <strong>der</strong> Weltbevölkerung<br />
unter chronischem Wassermangel leiden.<br />
Agrotreibstoffe verschärfen Wassermangel<br />
Pflanzen, die für die Herstellung von Agrotreibstoffen<br />
verwendet werden, benötigen<br />
überdurchschnittlich viel Wasser. Das International<br />
<strong>Water</strong> Management Institute IWMI<br />
hat berechnet, dass im weltweiten Durchschnitt<br />
die Biomasse, die für einen Liter<br />
Agrotreibstoff benötigt wird, während ihres<br />
Wachstums zwischen 1000 und 4000 Liter<br />
Wasser verbraucht und verdunstet. In Indien<br />
zum Beispiel braucht es für die Bewässerung<br />
<strong>der</strong> Menge Zuckerrohr, aus <strong>der</strong> ein Liter<br />
Ethanol gewonnen wird, 3500 Liter Wasser.<br />
In vielen Län<strong>der</strong>n beansprucht <strong>der</strong> zunehmende<br />
Anbau von Agrotreibstoff-Pflanzen<br />
die schon knappen Wasserressourcen zusätzlich.<br />
In Indien und China ist die Situation<br />
schon heute gravierend. «Auch ohne eine erhöhte<br />
Produktion von Agrotreibstoffen wird<br />
sich die Wasserknappheit in diesen Län<strong>der</strong>n<br />
noch verschärfen, da steigende Einkommen<br />
und eine wachsende Bevölkerung die Nachfrage<br />
<strong>nach</strong> Nahrungsmitteln hochtreiben»,<br />
prognostiziert Charlotte de Fraiture vom<br />
IWMI. 3<br />
Mehr als ein Viertel des verfügbaren<br />
Wassers virtuell gehandelt<br />
Ungefähr 1340 km 3 Wasser, das heisst über<br />
ein Viertel des weltweit für die Landwirtschaft<br />
verfügbaren Wassers, wird virtuell ge-<br />
handelt. Da <strong>der</strong> Trend für den Handel mit<br />
Nahrungsmitteln und Agrarrohstoffen steil<br />
<strong>nach</strong> oben zeigt, wird <strong>der</strong> gehandelte Wasseranteil<br />
künftig noch massiv zunehmen. Beim<br />
Getreide werden sich bis 2020 die gehandelten<br />
Mengen gegenüber 1993 verdoppeln, bei<br />
Fleisch gar verdreifachen. «Es sind nicht nur<br />
die gesamten Ernten, die zu Gütern werden;<br />
vielmehr sind es Land und Wasser für die<br />
Landwirtschaft selbst, die zunehmend zu<br />
Handelsgütern und <strong>der</strong>en Zugangsrechte globalisiert<br />
werden», stellen Karin Smaller und<br />
Howard Mann vom IISD fest.<br />
1340 km 3 Wasser werden jährlich in Form von<br />
Lebensmitteln und Agrotreibstoffen exportiert. Bei<br />
einem Pegel von 50 cm würde diese Menge 2,68<br />
Millionen km 2 <strong>–</strong> einen <strong>grosse</strong>n Teil Europas <strong>–</strong> bedecken.<br />
Der Wasser-Fussabdruck <strong>der</strong> Schweiz<br />
Der tägliche Pro-Kopf-Wasserverbrauch <strong>der</strong><br />
Schweiz ist mit 6082 Litern ähnlich hoch wie<br />
in den USA. Der Grossteil davon ist in unseren<br />
Lebensmitteln, <strong>der</strong> Kleidung und an<strong>der</strong>en<br />
Produkten des täglichen Bedarfs versteckt.<br />
Laut <strong>der</strong> WWF-Studie «Der Wasser-Fussabdruck<br />
<strong>der</strong> Schweiz» liegt <strong>der</strong> Wasserver-<br />
7
auch <strong>der</strong> Schweiz weit über dem weltweiten<br />
Durchschnitt von 3397 Litern und nahe bei<br />
den führenden 6795 Litern pro Person und<br />
Tag <strong>der</strong> USA. Ein relativ geringer Anteil von<br />
rund 164 Litern wird im Haushalt verbraucht.<br />
Zwei Drittel des in <strong>der</strong> Schweiz konsumierten<br />
Wassers stammen gemäss <strong>der</strong> Studie aus dem<br />
Ausland. Dieses «virtuelle» Wasser steckt<br />
vor allem in wasserintensiven landwirtschaftlichen<br />
und industriellen Produkten. So<br />
werden 86,2 Prozent in Form von importierten<br />
Kulturpflanzen verbraucht, wobei Kaffee<br />
und Kakao einen Spitzenplatz einnehmen.<br />
Aber auch Zucker, Nüsse, Ölsaaten und Weizen<br />
schlagen kräftig zu Buche. In <strong>der</strong> Schweiz<br />
verzehrte tierische Produkte brauchen hingegen<br />
zu etwa drei Vierteln einheimische Wasserressourcen.<br />
Als kritische Produkte bezeichnet die Studie<br />
Baumwolle, Reis, Zucker und Nüsse, da diese<br />
nicht nur viel Wasser benötigen, son<strong>der</strong>n auch<br />
aus Regionen stammen, in denen ihr Anbau<br />
einen erheblichen negativen Einfluss auf<br />
Externer Fussabdruck <strong>der</strong> Schweiz <strong>nach</strong> Regionen © WWF Schweiz<br />
8<br />
Für ein Kilogramm Baumwollstoff werden durchschnittlich<br />
11 000 Liter Wasser aufgewendet.<br />
© Robert Schmid<br />
Mensch und Umwelt hat. Kakao und Kaffee<br />
hinterlassen zwar den grössten externen Wasser-Fussabdruck,<br />
doch werden sie in Län<strong>der</strong>n<br />
wie Ghana, Elfenbeinküste, Ecuador und<br />
Brasilien angepflanzt, in denen es genug Nie<strong>der</strong>schläge<br />
gibt. Problematisch ist <strong>der</strong> hohe<br />
Wasserverbrauch dort, wo bewässert werden<br />
muss. Oft verschmutzen zudem Düngemittel,<br />
Pestizide und Tierexkremente das Wasser. 4
Ultimatives Investitionsgut Wasser<br />
«Wie jede an<strong>der</strong>e Knappheit schafft die Wasserknappheit<br />
Investitionsmöglichkeiten»,<br />
freut sich James McWhinney von Investopedia.<br />
Nicht nur das Geschäft mit dem Flaschenwasser<br />
boomt und bringt Firmen wie<br />
Nestlé o<strong>der</strong> Coca Cola Milliardenumsätze.<br />
Auch in <strong>der</strong> Wasserversorgung positionieren<br />
sich Unternehmen wie Veolia (Vivendi) o<strong>der</strong><br />
Ondeo als Global Players. Von transnationalen<br />
Firmen wie General Electric bis zu Bohrunternehmen<br />
wie Layne Christensen suchen<br />
alle ein Kuchenstück im Wassermarkt zu ergattern.<br />
Nebst Aktienanteilen an typischen<br />
Wasserfirmen gibt es immer mehr Fonds,<br />
Investitionsinstrumente und Hedgefonds,<br />
Schweizer Finanzsektor hat Potenzial erkannt<br />
über die sich gewinnbringend ins Geschäft<br />
mit dem Wasser investieren lässt. Auch<br />
Schweizer Banken und Fonds setzen gezielt<br />
aufs Wasser (siehe Kasten). Mit exklusiven<br />
Zugangsrechten zu Quellen, Flüssen o<strong>der</strong><br />
Grundwasser kann das Wassergeschäft gewinnbringend<br />
abgesichert werden, auch<br />
wenn das Wasser «nur» zur Herstellung von<br />
Nahrungsmitteln und Agrarrohstoffen verwendet<br />
wird. Wie profitabel Investitionen in<br />
Wasser für Landwirtschaftsprojekte sind,<br />
macht Susan Payne, Managerin des African<br />
Agricultural Land Fund deutlich: «Wasser<br />
wird in Zukunft ein phantastisch knappes<br />
Anlagegut sein.» Für wasserbezogene Investitionen<br />
in Afrika stellt sie jährliche Renditen<br />
von 25 Prozent in Aussicht.<br />
Die ersten Anlageprodukte im Wassersektor sind von Schweizer Finanzinstituten herausgegeben<br />
worden. Die Privatbank Pictet in Genf hat bereits 2000 einen Wasserfonds lanciert,<br />
<strong>der</strong> inzwischen gegen drei Milliarden Franken schwer ist und zu den grössten weltweit gehört.<br />
Ein Jahr später hat die in Zürich ansässige Anlagegesellschaft Sustainable Asset Management<br />
einen Wasserfonds aufgelegt. Dieser verwaltet heute 1,3 Milliarden Franken. Nebst diesen<br />
beiden Pionieren bietet eine Reihe von Banken Wasser-Produkte an: 2007 haben die Basler<br />
Privatbank Sarasin und Swisscanto Wasserfonds eingeführt. UBS und Credit Suisse haben<br />
verschiedene Anlageprodukte (Zertifikat, Anleihen mit Kapitalschutz und Index) entwickelt,<br />
die auf Unternehmen im Wassersektor fokussiert sind. Ferner vermarktet die Bank Vontobel<br />
einen Ressourcen-Fonds, <strong>der</strong> unter an<strong>der</strong>em ebenfalls Wasser beinhaltet. Weltweit werden<br />
jährlich 460 Milliarden Franken im Wassersektor umgesetzt, und er soll laut Prognosen in<br />
den nächsten Jahren eine Wachstumsrate von sechs Prozent aufweisen.<br />
9
«<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong> führt zu Menschenrechtsverletzungen<br />
und Konflikten<br />
Nuria Brunner, Fachmitarbeiterin Bereich Recht auf Nahrung, und Andrea Kolb, Gen<strong>der</strong>beauftragte, Brot für alle<br />
Abpumpen von Wasser für landwirtschaftliche Grossprojekte entzieht be<strong>nach</strong>barten Kleinbäuerinnen und Hirten<br />
das Grundwasser und verschärft Konflikte zwischen verschiedenen Landnutzern. © Miges Baumann / Brot für alle<br />
Bei <strong>der</strong> Aushandlung von Landverträgen<br />
und Wasserrechten werden die betroffenen<br />
Bevölkerungen nicht o<strong>der</strong> nur ungenügend<br />
informiert und einbezogen. Doch<br />
geht es dabei um ihre Existenz.<br />
Millionen Menschen im ländlichen Raum<br />
hängen von <strong>der</strong> Landwirtschaft ab. In den<br />
Entwicklungslän<strong>der</strong>n vergrössert sich die<br />
Konkurrenz um bewässerbare Ackerflächen<br />
wegen des Bevölkerungswachstums und <strong>der</strong><br />
Nachfrage aus dem Ausland ständig. Doch ist<br />
<strong>der</strong> Zugang zu Land und Wasser beschränkt<br />
und für Einheimische oft unsicher. Land, das<br />
seit Generationen von Kleinbauernfamilien<br />
10<br />
bewirtschaftet wird, gehört offiziell <strong>der</strong> Regierung<br />
o<strong>der</strong> ist in Kollektivbesitz und wird<br />
von «Dorfchefs» verwaltet. Traditionelle<br />
Landnutzer werden nicht o<strong>der</strong> nur mangelhaft<br />
über bevorstehende Vertragsabschlüsse<br />
informiert. In die entsprechenden Verhandlungen<br />
werden bestenfalls Vertreter lokaler<br />
Eliten einbezogen, die jedoch primär ihre eigenen<br />
Interessen verfolgen.<br />
Ohne Zugang zu kultivierbarem Land und zu<br />
Wasser können sich Menschen, die von<br />
Ackerbau, Nutztierhaltung und Fischfang leben,<br />
nicht ernähren und kein Einkommen<br />
erzielen. Ausserdem verunreinigen die in <strong>der</strong><br />
industriellen Landwirtschaft eingesetzten
Chemikalien Böden und Wasser. Die wenigen<br />
verfügbaren Flächen werden stark übernutzt<br />
und liefern immer kleinere Erträge. Zur Gewinnung<br />
von Ersatzflächen werden Wäl<strong>der</strong> gefällt.<br />
Das treibt die Bodenerosion voran und verknappt<br />
das Wasserangebot weiter.<br />
Zunehmende Konkurrenz um Wasser<br />
und Land<br />
Die Hauptleidtragenden von landwirtschaftlichen<br />
Grossinvestitionen sind Kleinbauernfamilien,<br />
Indigene, Hirtenvölker und traditionelle<br />
lokale Fischer <strong>–</strong> Gemeinschaften, die sukzessive<br />
ihre Lebensgrundlage verloren haben. Vertreibungen<br />
bringen Familien um ihr Obdach und<br />
reissen Gemeinschaften auseinan<strong>der</strong>. Wer protestiert,<br />
sich Vertreibungen wi<strong>der</strong>setzt o<strong>der</strong><br />
Land besetzt, wird möglicherweise strafrechtlich<br />
verfolgt und setzt sich gewalttätigen Übergriffen<br />
durch staatliche o<strong>der</strong> private Sicherheitskräfte<br />
aus. Konflikte zwischen Vertriebenen und<br />
an<strong>der</strong>en Bevölkerungsgruppen in <strong>der</strong> Konkurrenz<br />
um Ackerland, Weideflächen und Wasser<br />
häufen sich. Obwohl die Folgen von Land- und<br />
Wassernahmen noch wenig untersucht sind, ist<br />
anzunehmen, dass bessergestellte Gemeinschaften<br />
auf an<strong>der</strong>e Flächen auszuweichen versuchen.<br />
Zudem rufen die steigende Nachfrage <strong>nach</strong><br />
Land und die dadurch verursachten Bodenpreissteigerungen<br />
lokale, nicht-bäuerliche Käufer wie<br />
Beamte und Politiker/innen auf den Plan. All<br />
dies treibt die Landpreise weiter in die Höhe und<br />
erhöht den Druck auf ärmere Gemeinschaften<br />
ohne gesicherte Landtitel zusätzlich.<br />
Wenn das verfügbare Wasser knapp wird, verschärfen<br />
sich bestehende und entstehen neue<br />
Konflikte. In seinem Bericht «Globale Wasserkrise»<br />
hielt das Uno-Entwicklungsprogramm<br />
UNDP fest: «Wenn sich die innerstaatliche<br />
Wasserkonkurrenz verschärft, werden die Men-<br />
schen mit den schwächsten Rechten zusehen<br />
müssen, wie ihr Wasserzugang durch mäch-<br />
tigere Interessengruppen beschnitten wird.» 5<br />
«<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong> betrifft Frauen an<strong>der</strong>s als<br />
Männer<br />
Wegen ihrer unterschiedlichen Rollen, Rechte<br />
und Aufgaben sind Frauen und Männer vom<br />
Verlust <strong>der</strong> Wasserzugangsrechte auf verschiedene<br />
Weise betroffen. In Afrika stellen Frauen<br />
rund 70 Prozent <strong>der</strong> Nahrungsmittel her. Nebst<br />
<strong>der</strong> Feldarbeit sind sie für die Versorgung, Erziehung<br />
und Pflege <strong>der</strong> Familienmitglie<strong>der</strong> zuständig.<br />
Auch Wasserholen ist in vielen Kulturen<br />
Aufgabe <strong>der</strong> Frauen und Mädchen. Wenn<br />
Wasserquellen privatisiert werden o<strong>der</strong> Brunnen<br />
durch Abpumpen von Grundwasser austrocknen,<br />
müssen sie auf weiter entfernte Wasserstellen<br />
ausweichen, wo sie in Konkurrenz mit<br />
den bisherigen Nutzerinnen stehen und bisweilen<br />
stundenlang anstehen müssen. Das bedeutet<br />
für sie ein höheres Risiko von Übergriffen und<br />
einen grösseren Zeitaufwand, <strong>der</strong> Mädchen unter<br />
Umständen den Schulbesuch und eine unbeschwerte<br />
Kindheit verunmöglicht. Zugang zu<br />
Wasser ist abhängig vom Recht auf Land. Frauen<br />
verfügen nur selten über formale Landtitel<br />
und haben darum keine rechtliche Handhabe<br />
Ein höherer Zeitaufwand für die Wasserbeschaffung<br />
hin<strong>der</strong>t viele Mädchen am Schulbesuch.<br />
© Miges Baumann / Brot für alle<br />
11
gegen die Veräusserung von Land o<strong>der</strong> für Entschädigungsansprüche.<br />
Ohne Landtitel können<br />
Frauen das Land auch nicht als Sicherheit für<br />
Kredite nutzen, um kommerzielle Landwirtschaft<br />
zu betreiben. Vielfach kaufen Investoren<br />
12<br />
Uno-Menschenrechte auf Wasser und natürliche Ressourcen<br />
scheinbar ungenutztes Land auf, doch spielen<br />
solche Flächen insbeson<strong>der</strong>e für Frauen eine<br />
wichtige Rolle für die Beschaffung von Wasser<br />
o<strong>der</strong> das Sammeln von Brennholz, Früchten,<br />
Kräutern o<strong>der</strong> Medizinalpflanzen. 6<br />
Recht auf Zugang zu sicherem, sauberem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen<br />
Resolution 64/292 <strong>der</strong> Uno-Generalversammlung vom Juli 2010 und<br />
Resolution A/HRC/15/L.14 des Uno-Menschenrechtsrats vom September 2010<br />
Recht auf ausreichendes, sicheres, akzeptables, physisch erreichbares<br />
und bezahlbares Wasser<br />
Uno-Rechtskommentar Nr. 15 zum Recht auf Wasser, Uno-Ausschuss für wirtschaftliche,<br />
soziale und kulturelle Menschenrechte, 2002<br />
Recht auf angemessenen Lebensunterhalt, Gesundheit und<br />
Wohlbefinden, einschliesslich Nahrung und Obdach<br />
Art. 25 <strong>der</strong> Allgemeinen Erklärung <strong>der</strong> Menschenrechte und Internationaler Pakt<br />
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Uno-Sozialpakt)<br />
Recht auf Information<br />
Art. 19 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (Uno-Zivilpakt)<br />
Recht indigener Völker auf Schutz ihrer Ressourcen und Einbezug in Entscheidungen,<br />
die ihre Umwelt und Lebensgrundlagen betreffen<br />
Übereinkommen 169 <strong>der</strong> Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)<br />
über eingeborene und in Stämmen lebende Völker<br />
Recht indigener Völker und Menschen auf Schutz ihres Landes,<br />
ihrer Gebiete und Ressourcen<br />
Art. 1 <strong>der</strong> Uno-Erklärung über die Rechte <strong>der</strong> indigenen Völker<br />
Recht aller Völker auf Selbstbestimmung und freie Gestaltung ihrer wirtschaftlichen,<br />
sozialen und kulturellen Entwicklung<br />
Art. 1 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (Uno-Zivilpakt)<br />
und Art. 1 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte<br />
(Uno-Sozialpakt)
Eine schwere Hypothek für die betroffenen<br />
Län<strong>der</strong> und Bevölkerungen<br />
Nuria Brunner, Fachmitarbeiterin Bereich Recht auf Nahrung und Miges Baumann, Leiter Ressort Entwicklungspolitik,<br />
Brot für alle<br />
Die Veräusserung von Land und Wasserressourcen gefährdet die Ernährungssouveränität …<br />
© Martina Schmidt / Brot für alle<br />
Die langfristige Vergabe von Wasser- und<br />
Landrechten führt in eine verstärkte Abhängigkeit<br />
und verhin<strong>der</strong>t eine selbstbestimmte<br />
Entwicklung.<br />
Die meisten Landverträge sind nicht öffentlich<br />
zugänglich. Die wenigen bekannten Verträge<br />
hat das Internationale Institut für<br />
Entwicklung und Umwelt IIED kürzlich analysiert.<br />
Einige davon beinhalten klare und<br />
exklusive Wasser-Verfügungsrechte im Austausch<br />
gegen wenig klare Gegenleistungen<br />
wie vage Versprechen von Arbeitsplätzen<br />
o<strong>der</strong> summarische Pachtzinsen. In einigen<br />
Abkommen wird sogar ausdrücklich auf die<br />
Erhebung von Wassergebühren verzichtet.<br />
Ein vom IIED analysierter Vertrag in Mali<br />
erlaubt dem Investor, während <strong>der</strong> Regenzeit<br />
ohne Einschränkungen so viel Wasser zu nut-<br />
zen wie für das Projekt nötig ist. Bekannte<br />
Verträge aus dem Senegal und Sudan enthalten<br />
ähnliche Rechte. Der Vertrag von Addax<br />
Bioenergy in Sierra Leone sichert dem Unternehmen<br />
exklusive Verfügungsrechte über alle<br />
Wasserressourcen auf dem gepachteten Land<br />
zu, einschliesslich aller Rechte über die Flüsse<br />
und Bäche, die durch dieses Land fliessen (siehe<br />
Seiten 16<strong>–</strong>17).<br />
Beim Aushandeln <strong>der</strong> komplexen Kauf- und<br />
Langzeitpachtverträge sind ausländische Regierungen,<br />
Banken o<strong>der</strong> Hedge Funds mit ihren<br />
gut dotierten, spezialisierten Rechtsabteilungen<br />
gegenüber schwachen Staaten im Vorteil. Aus<br />
vielen Verträgen geht nicht klar hervor, welche<br />
Flächen und Wasservorkommen den Investoren<br />
überlassen werden. Auch werden in den meisten<br />
Fällen die lokalen Wasserbehörden we<strong>der</strong> an<br />
den Vertragsverhandlungen beteiligt noch in<br />
13
den Verträgen erwähnt, was jegliche Planung<br />
des regionalen Wasserverbrauchs verunmöglicht.<br />
Der Mangel an Transparenz beunruhigt<br />
die Betroffenen. In einigen Fällen wurde Land<br />
übertragen, ohne dass entsprechende rechtsgültige<br />
Vereinbarungen bestehen o<strong>der</strong> den verantwortlichen<br />
Regierungsbehörden und betroffenen<br />
Gemeinschaften zugänglich gemacht<br />
worden sind. Dies legt den Verdacht auf Korruption<br />
nahe. 7<br />
Pachtverträge werden meist für Flächen von<br />
über 10 000 Hektar und manchmal sogar bis<br />
zu einer Million Hektar abgeschlossen. Ihre<br />
Laufzeit liegt gewöhnlich zwischen 50 und 99<br />
Jahren. Die Art und Grösse <strong>der</strong> ausländischen<br />
Investitionen in Land und Wasser verschieben<br />
die Verfügungsrechte von nationalen auf ausländische<br />
Akteure. Kommt hinzu, dass in vielen<br />
nationalen Gesetzgebungen Land- und Wasserrechte,<br />
Umweltschutz, Gesundheitsschutz und<br />
Arbeitsrechte nicht o<strong>der</strong> nur ungenügend geregelt<br />
sind, während ausländische Investitionen<br />
klar geschützt und privilegiert werden. Investoren<br />
kaufen o<strong>der</strong> pachten kein Land, ohne Wasserrechte<br />
zu erhalten.<br />
14<br />
Ausländische Investoren besser<br />
geschützt<br />
Zwischenstaatliche o<strong>der</strong> internationale Investitionsabkommen<br />
enthalten oft Meistbegünstigungsklauseln,<br />
<strong>nach</strong> denen Handelsvorteile, die<br />
einem Staat eingeräumt worden sind, im Zuge<br />
<strong>der</strong> Gleichbehandlung allen Staaten gewährt<br />
werden müssen. Zudem sichern sie Investoren<br />
aus den Unterzeichnerstaaten eine Gleichbehandlung<br />
mit einheimischen Unternehmen zu.<br />
So kann <strong>der</strong> Gaststaat von ihnen nicht etwa<br />
for<strong>der</strong>n, dass sie mehr in Umweltschutz, Wassersparmassnahmen<br />
o<strong>der</strong> Arbeitssicherheit investieren<br />
als einheimische Kleinbauern. Ausserdem<br />
gilt gewöhnlich <strong>der</strong> Grundsatz <strong>der</strong><br />
«gerechten und billigen Behandlung». Dieser<br />
sollte Investoren ursprünglich vor Willkür und<br />
Diskriminierung schützen, doch heute wird er<br />
so ausgelegt, dass die «legitimen Erwartungen»<br />
des Investors (beispielsweise auf verfügbare<br />
Wassermengen) erfüllt werden, selbst wenn sich<br />
das Klima än<strong>der</strong>t o<strong>der</strong> mehr Druck auf die verfügbaren<br />
Ressourcen entsteht. Bestehen internationale<br />
o<strong>der</strong> bilaterale Investitionsabkom-<br />
… und verunmöglicht eine <strong>nach</strong>haltige ländliche Entwicklung. © HEKS
men, bleiben die abgeschlossenen Verträge von<br />
späteren nationalen Gesetzesän<strong>der</strong>ungen unberührt.<br />
Wenn <strong>der</strong> Gaststaat zu einem späteren<br />
Zeitpunkt seine Umweltgesetzgebung ausbaut,<br />
Ausfuhrbeschränkungen einführt o<strong>der</strong> eine<br />
Landreform anstrebt, muss sich <strong>der</strong> Investor<br />
nicht daran halten o<strong>der</strong> hat ein Anrecht auf eine<br />
Entschädigung für entgangene Gewinne, die<br />
den Preis für das erworbene Land o<strong>der</strong> allfällige<br />
Steuern um ein Vielfaches übersteigen kann<br />
(siehe Seiten 16<strong>–</strong>17).<br />
Bewusster Verzicht auf Souveränität<br />
Die Mehrheit <strong>der</strong> Ziellän<strong>der</strong> landwirtschaftlicher<br />
Grossinvestitionen ist auf Nahrungsmittel-<br />
Unruhen und Konflikte vorprogrammiert<br />
Importe und oft sogar auf Nahrungsmittelhilfe<br />
angewiesen. Obwohl sie ihre eigene Bevölkerung<br />
nicht zu ernähren vermögen, veräussern sie<br />
ihr bestes Land und ihre Wasserressourcen. Damit<br />
verzichten sie auf ihre Ernährungssouveränität<br />
und auf die Souveränität über das verpachtete<br />
Land. Sie können kaum Einfluss auf die<br />
angebauten Produkte nehmen und <strong>der</strong>en Ausfuhr<br />
auch im Fall von nationalen Ernährungskrisen<br />
nicht verhin<strong>der</strong>n o<strong>der</strong> durch die Erhebung<br />
von Ausfuhrzöllen unattraktiv gestalten.<br />
Sie sind den Preisschwankungen am Weltmarkt<br />
noch stärker ausgeliefert und können die Ernährungssicherheit<br />
ihrer Bevölkerung noch weniger<br />
gewährleisten. Dies liefert Zündstoff für gewaltsame<br />
Proteste, Revolten o<strong>der</strong> gar Bürgerkriege.<br />
In Mali schloss die Regierung 2009 ohne Wissen <strong>der</strong> Bevölkerung einen Pachtvertrag über 50<br />
Jahre mit dem libyschen Staatsfonds Malibya ab, <strong>der</strong> auf 99 Jahre verlängert werden kann.<br />
Dabei geht es um eine Fläche von 100 000 Hektar in <strong>der</strong> Region Segou, wo etwa 75 000<br />
Menschen leben. Malibya plant, jährlich 200 000 Tonnen Reis und 25 000 Tonnen Fleisch<br />
für den Export <strong>nach</strong> Libyen zu produzieren. Der Vertrag berechtigt Malibya zur unbegrenzten<br />
Wasserentnahme aus dem Niger über einen eigens erbauten 40 km langen und 30 m breiten<br />
Kanal. Den einheimischen Kleinbauern bleibt während <strong>der</strong> Trockenzeit nur wenig Wasser für<br />
die Bewässerung ihrer Reisfel<strong>der</strong>. Die Vertreter <strong>der</strong> betroffenen Dörfer wurden erst zum Kanalbau<br />
konsultiert, als bereits erste Häuser nie<strong>der</strong>gerissen worden waren. Bisher kam es zur<br />
Vertreibung von 150 Familien und zur Zerstörung von Grabstätten.<br />
Von Pakistans Fläche von 79,6 Millionen Hektar werden 27 Prozent landwirtschaftlich<br />
genutzt. Vier Fünftel <strong>der</strong> Flächen sind bewässert. Das macht Pakistan zu einem <strong>der</strong> Hauptziele<br />
ausländischer Landwirtschaftsinvestitionen. Im Juni 2009 wurden in <strong>der</strong> Provinz Punjab<br />
324 000 Hektar an die Vereinigten Arabischen Emirate verpachtet. Pakistanische Bauernbewegungen<br />
fürchten, dass dadurch die Einwohner/innen von 25 000 Dörfern vertrieben werden.<br />
Die Regierung bietet Pachtverträge mit einer Laufzeit von 50 Jahren an, die um weitere<br />
40 Jahre verlängerbar sind. Dadurch verunmöglicht sie nicht nur längst fällige und mehrfach<br />
gescheiterte Landreformen, son<strong>der</strong>n verschärft die Armut und die Ernährungsunsicherheit,<br />
von <strong>der</strong> gemäss dem Uno-Welternährungsprogramm die Hälfte <strong>der</strong> Bevölkerung betroffen<br />
ist <strong>–</strong> ein idealer Nährboden für soziale Unruhen.<br />
15
Fallbeispiele<br />
Sierra Leone: Wasser spielt auch<br />
Schlüsselrolle beim Agrotreibstoffprojekt<br />
von Addax Bioenergy<br />
Yvan Maillard Ardenti, Verantwortlicher für Finanzmärkte, Banken und Verschuldung, Brot für alle<br />
Bau des Bewässerungssystems <strong>der</strong> Zuckerrohrplantage © Yvan Maillard Ardenti / Brot für alle<br />
Seit 2010 baut die Schweizer Firma Addax<br />
Bioenergy in Sierra Leone Zuckerrohr für<br />
die Produktion von Agrotreibstoff an. Der<br />
Zugang zu Wasser ist ein wichtiger Bestandteil<br />
des Pachtvertrags. Brot für alle<br />
verfolgt dieses Projekt mit <strong>grosse</strong>r Aufmerksamkeit.<br />
Addax Bioenergy bewirtschaftet am Rokel-<br />
Fluss eine Fläche von 14 000 Hektar in einer<br />
Region, in <strong>der</strong> 13 000 Menschen hauptsächlich<br />
von <strong>der</strong> Landwirtschaft leben. Addax<br />
baut Zuckerrohr an und verarbeitet es vor<br />
16<br />
Ort zu Ethanol. Das Projekt gibt Anlass zu<br />
Besorgnis. Durch die Plantagen und Raffinerien<br />
werden zwar neue Arbeitsplätze geschaffen,<br />
aber zahlreiche Menschen müssen für<br />
den Anbau ihrer Nahrungsmittel neues Land<br />
suchen.<br />
Laut Addax ist die örtliche Bevölkerung über<br />
das Projekt informiert und dazu konsultiert<br />
worden. Doch wurden offensichtlich nicht<br />
alle Betroffenen einbezogen. Insbeson<strong>der</strong>e<br />
war unklar, welche Flächen das Unternehmen<br />
beansprucht. So haben lokale Bauern auf 80
Hektar Maniok angebaut, den die Firma zerstörte,<br />
weil sie das Land für ihr Projekt nutzen<br />
wollte. Das Genfer Unternehmen weist<br />
darauf hin, dass 1960 Hektar für die einheimische<br />
Bevölkerung ausgeschieden worden<br />
seien. Das sei genug für ihre Selbstversorgung.<br />
Zudem würden die Bauern geschult,<br />
damit sie ihre Erträge steigern könnten.<br />
Ungleich lange Spiesse<br />
Der vom Parlament verabschiedete Rahmenvertrag<br />
(Memorandum of Un<strong>der</strong>standing)<br />
zwischen <strong>der</strong> Regierung und Addax enthält<br />
eine so genannte «Change in Law»-Klausel,<br />
welche Addax Entschädigungen für Verluste<br />
in Folge von Gesetzesän<strong>der</strong>ungen zuspricht.<br />
Würde Sierra Leone beispielsweise einen besseren<br />
Arbeitnehmerschutz einführen, käme es<br />
zur absurden Situation, dass Landarbeiter/innen<br />
auf be<strong>nach</strong>barten Grundstücken davon<br />
profitieren könnten, während die Situation<br />
<strong>der</strong> Beschäftigten von Addax sich nicht verän<strong>der</strong>n<br />
würde. Zudem wird das Unternehmen<br />
für 13 Jahre von Gewinnsteuern und an<strong>der</strong>en<br />
Abgaben befreit.<br />
Gemäss dem mit den Paramount Chiefs<br />
(höchsten lokalen Autoritätspersonen) für 50<br />
Jahre abgeschlossenen Pachtvertrag stehen<br />
Addax sämtliche Wasserläufe zur exklusiven<br />
Nutzung zu. Zuckerrohr muss in <strong>der</strong> trockenen<br />
Jahreszeit bewässert werden. Dazu müssen<br />
dem Rokel gewaltige Wassermengen entnommen<br />
werden, wenn er ohnehin wenig<br />
Wasser führt <strong>–</strong> ein Viertel seiner Durchflussmenge.<br />
8 Es ist fraglich, ob <strong>der</strong> Bevölkerung<br />
genug Wasser bleibt. Zudem könnten Boden<br />
und Wasser mit Dünge- und Pflanzenschutzmitteln<br />
verunreinigt werden.<br />
So wird die ansässige Bevölkerung gänzlich<br />
vom guten Willen des Agrotreibstoff-Unter-<br />
nehmens abhängig. Auch an<strong>der</strong>e Bestimmungen<br />
des Pachtvertrags sind bedenklich.<br />
Beispielsweise muss bei Streitigkeiten ein internationales<br />
Schiedsgericht in London angerufen<br />
werden. Arme Bauern können sich eine<br />
Reise <strong>nach</strong> London und britische Anwälte<br />
jedoch sicherlich nicht leisten.<br />
Staat und Betroffenen bleibt wenig<br />
vom Gewinn<br />
Addax versichert, das Projekt bringe zahlreiche<br />
Vorteile für die Bevölkerung. Insbeson<strong>der</strong>e<br />
schaffe es 4000 Arbeitsplätze. Bei <strong>der</strong><br />
Hälfte davon handelt es sich allerdings um<br />
Saisonstellen. Mehrheitlich sind bisher befristete<br />
Arbeitsstellen geschaffen worden <strong>–</strong> ohne<br />
Sozialversicherungsschutz und mit einem Tageslohn<br />
von 2,25 Franken. Dieser Lohn reicht<br />
nicht aus, um eine Familie zu ernähren, was<br />
mit dem Ertrag <strong>der</strong> Fel<strong>der</strong> hingegen möglich<br />
war. Addax orientierte sich bei den Pachtpreisen<br />
an den Empfehlungen <strong>der</strong> Regierung: 7,70<br />
Franken pro Hektar und Jahr. Dies entspricht<br />
dem Preis von ein paar Kilogramm Reis,<br />
deckt aber den Verlust <strong>der</strong> Nahrungsmittel,<br />
die auf einem Hektar wachsen, bei weitem<br />
nicht.<br />
Das Unternehmen und die Entwicklungsbanken<br />
erwarten einen jährlichen Gewinn von 15<br />
Prozent 9 <strong>–</strong> das sind 43 Millionen Franken. Ein<br />
beträchtlicher Betrag im Vergleich zu dem,<br />
was <strong>der</strong> Bevölkerung bleibt: Die 4000 Angestellten<br />
werden pro Jahr Löhne von ungefähr<br />
1,7 Millionen Franken erhalten und die Landbesitzer<br />
eine Pacht von etwa 110 000 Franken.<br />
Weil das Projekt zahlreiche Fragen aufwirft,<br />
haben Brot für alle und seine Partner eine unabhängige<br />
Studie und ein langfristiges Monitoring<br />
durch Fachleute in Auftrag gegeben.<br />
17
Brasilien<br />
Wasserprojekt für die Agrarindustrie bedroht<br />
Existenz von Kleinbauernfamilien<br />
Thomas Bauer, Kleinbauer und Berater <strong>der</strong> vom <strong>Fastenopfer</strong> unterstützten Landpastoralkommission CPT<br />
Der Bau <strong>der</strong> Umleitungskanäle schreitet unaufhaltsam voran. © Lisanne Vant’ Hoff<br />
In den letzten Jahren hat sich die Situation<br />
vieler Bauernfamilien in <strong>der</strong> Halbwüste<br />
des brasilianischen Nordostens zum Guten<br />
verän<strong>der</strong>t. Doch jetzt droht mit <strong>der</strong> Umleitung<br />
des Rio São Francisco zu Gunsten<br />
<strong>der</strong> industriellen Landwirtschaft eine neue<br />
Gefahr.<br />
Während einer neuerlichen längeren Dürreperiode<br />
war augenfällig, dass sich die Lage vieler<br />
Bauernfamilien verbessert hat. Dies ist <strong>der</strong><br />
Stärkung <strong>der</strong> Zivilgesellschaft zu verdanken,<br />
die ihre Rechte gegenüber <strong>der</strong> Regierung geltend<br />
gemacht hat. Die Landpastoralkommission<br />
(CPT) hat einen wichtigen Beitrag dazu<br />
geleistet. Sie ist Teil <strong>der</strong> Articulação no Semi-<br />
18<br />
árido Brasileiro ASA. Dem Netzwerk brasilianischer<br />
Nichtregierungsorganisationen ist es<br />
gelungen, den Bau kostengünstiger Regenwasserzisternen<br />
in einem staatlich unterstützten<br />
Programm zu verankern. Diese einfache<br />
Massnahme ermöglicht es, während <strong>der</strong> Regenzeit<br />
genug Trinkwasser für die darauffolgende<br />
Trockenperiode aufzufangen.<br />
Das grösste Problem ist jedoch nicht die Wasserknappheit,<br />
son<strong>der</strong>n die Konzentration von<br />
Land und Wasser. Laut offiziellen Angaben<br />
besitzen 92 Prozent <strong>der</strong> Bauernfamilien im<br />
halbtrockenen Nordosten nicht genug Land<br />
für ihre Existenzsicherung, obwohl die brasilianische<br />
Verfassung Landreformen vorsieht.<br />
Vor allem unter <strong>der</strong> Präsidentschaft Lulas
sind diese nicht mehr vorangekommen. Auf<br />
<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite verfolgt die Regierung das<br />
Megaprojekt <strong>der</strong> Umleitung des Rio São<br />
Francisco: Zwei 25 m breite und 5 m tiefe<br />
Kanäle mit einer Länge von 400 respektive<br />
220 km sollen einen Teil seines Wassers in<br />
nördlich gelegene, zeitweise ausgetrocknete<br />
Flüsse leiten. Die Gesamtkosten des Projektes<br />
belaufen sich voraussichtlich auf über 7 Milliarden<br />
Reais o<strong>der</strong> 3,92 Milliarden Schweizer<br />
Franken. Die Finanzierung und <strong>der</strong> Unterhalt<br />
dieses aufwendigen Systems lassen die Wasserkosten<br />
in die Höhe schnellen: Die Wassergebühren<br />
werden voraussichtlich versechsfacht.<br />
Doch haben heute schon viele die<br />
grösste Mühe, die Gebühren aufzubringen.<br />
Wer gewinnt, wer verliert?<br />
Gegner des Kanalprojekts kritisieren, dass 70<br />
Prozent des umgeleiteten Wassers <strong>der</strong> exportorientierten<br />
Agrarindustrie zur Verfügung<br />
stehen sollen. Von den restlichen 30 Prozent<br />
sollen 26 Prozent in die Städte Fortaleza, João<br />
Pessoa und Campina Grande fliessen und nur<br />
vier Prozent den wirklich Bedürftigen auf dem<br />
Land zugute kommen. So werden die Interessen<br />
<strong>der</strong> Agro- und Bauindustrie höher gewichtet<br />
als die <strong>der</strong> Bevölkerung. Brasilien kommt<br />
in guter kolonialer Tradition die Rolle des<br />
Rohstoff- und Agrarproduktelieferanten zu.<br />
Die Regierung begründet das Projekt mit <strong>der</strong><br />
Notwendigkeit des Fortschritts und Wachstums<br />
und verspricht, den <strong>Durst</strong> von zwölf<br />
Millionen Menschen zu stillen. Selbst wenn<br />
dem so wäre, liesse sich laut einer Studie <strong>der</strong><br />
nationalen Wasseragentur mit einem wesentlich<br />
geringeren Aufwand von 3,6 Milliarden<br />
Reais eine <strong>nach</strong>haltigere, effizientere, dezentrale<br />
Struktur aufbauen, mit <strong>der</strong> 34 Millionen<br />
Menschen mit Wasser versorgt werden<br />
könnten. Der Wasserbedarf <strong>der</strong> restlichen<br />
zehn Millionen Personen könnte mit einfachen<br />
zusätzlichen Einrichtungen wie Regenwasserzisternen<br />
o<strong>der</strong> unterirdischen Staumauern<br />
gedeckt werden.<br />
Der Umsetzung dieses Megaprojektes sind<br />
viele Proteste von Flussanrainern, sozialen<br />
Bewegungen, Nichtregierungsorganisationen<br />
und ein 23-tägiger Hungerstreik von Bischof<br />
Frei Luís Cappio vorausgegangen. In Gesprächen<br />
mit Betroffenen wird klar, dass sich die<br />
Versprechen <strong>der</strong> Regierung nicht bewahrheiten.<br />
Viele stimmten dem Projekt in <strong>der</strong> Hoffnung<br />
zu, einen Arbeitsplatz o<strong>der</strong> Zugang zu<br />
Wasser zu erhalten. Tatsächlich wurden jedoch<br />
viele <strong>der</strong> Familien enteignet und mit<br />
lächerlichen Summen entschädigt. Die versprochenen<br />
Arbeitsplätze <strong>–</strong> viel weniger als<br />
erwartet <strong>–</strong> stehen nur für kurze Zeit zur Verfügung<br />
und sind grösstenteils mit auswärtigen<br />
Arbeitskräften besetzt worden.<br />
So nimmt die Konzentration von Land und<br />
Wasser dramatisch zu und viele Bauernfamilien<br />
verlieren ihre Lebensgrundlage, obwohl<br />
es mit kostengünstigen Massnahmen durchaus<br />
möglich wäre, künftigen Generationen<br />
eine <strong>nach</strong>haltige, an dieses semiaride Gebiet<br />
angepasste Existenz zu ermöglichen.<br />
«Die verzweifelte Lage im São Francisco-<br />
Tal ist Teil einer globalen Krise. Sie<br />
macht uns bewusst, dass <strong>der</strong> blinde Fortschrittsglaube<br />
zur Unterentwicklung vieler<br />
Völker geführt hat und das Leben <strong>der</strong><br />
ganzen Erde bedroht. Es liegt an uns,<br />
weiter dem Weg des Todes zu folgen o<strong>der</strong><br />
uns für das Leben einzusetzen.»<br />
Bischof und Umweltaktivist Frei Luís Cappio<br />
19
Madagaskar<br />
«Die Gefahr <strong>der</strong> Land-Deals ist<br />
nicht gebannt»<br />
Gion Cabalzar, Ethnologe und Verantwortlicher des <strong>Fastenopfer</strong>-Landesprogramms Madagaskar, über den Pachtvertrag,<br />
<strong>der</strong> die madagassische Regierung zu Fall brachte, und über an<strong>der</strong>e geplante Investitionen:<br />
Pro 18,5 Hektar wäre ein Arbeitsplatz geschaffen worden. Diese Fläche ernährt 22 madagassische Familien.<br />
© Rosemarie Fähndrich / <strong>Fastenopfer</strong><br />
Nach dem Bekanntwerden eines Land-<br />
Deals mit <strong>der</strong> südkoreanischen Daewoo<br />
Logistics kam es in Madagaskar zu massiven<br />
Protesten, die schliesslich zum Sturz<br />
<strong>der</strong> Regierung führten. Warum hatte dieses<br />
Geschäft eine <strong>der</strong>artige Brisanz?<br />
Beim Fall Daewoo kamen Dinge ans Licht,<br />
die sonst wohl verborgen geblieben wären.<br />
Wie das Unternehmen im November 2008<br />
an einer Pressekonferenz in Seoul bekannt<br />
gab, hat es sich einen Pachtvertrag über 1,3<br />
Millionen Hektar <strong>–</strong> einen Drittel des Landwirtschaftslandes<br />
von Madagaskar <strong>–</strong> gesichert.<br />
Davon waren eine Million Hektar in<br />
Trockenzonen für die Produktion von Mais<br />
20<br />
und die restlichen 0,3 Millionen in tropischfeuchten<br />
Gebieten für den Anbau von Ölpalmen<br />
vorgesehen. Dies löste in Madagaskar<br />
und innerhalb <strong>der</strong> madagassischen Diaspora<br />
in Frankreich heftige Proteste aus. Meiner<br />
Ansicht <strong>nach</strong> gibt es dafür vier Gründe:<br />
<strong>–</strong> Es war eine Laufzeit von 99 Jahren vorgesehen,<br />
was sieben Generationen von Madagassen<br />
entspricht.<br />
<strong>–</strong> Die Pacht war angeblich gratis! Madagassen<br />
hätten nur unqualifizierte Jobs bekommen;<br />
für die besseren Stellen waren<br />
Südafrikaner vorgesehen. Es wäre ein einziger<br />
lokaler Arbeitsplatz pro 18,5 Hektar<br />
geschaffen worden. Eine solche Fläche<br />
ernährt sonst 22 Familien.
<strong>–</strong> Die Bodenfrage ist in Madagaskar hochsensibel:<br />
Das Herkunftsdorf (Tanindrazana)<br />
ist Ort <strong>der</strong> Ahnen und Bindeglied zur<br />
Vergangenheit. Es ist an die Gemeinschaft<br />
gebunden, und <strong>der</strong> Ahnenkult ist sozusagen<br />
im Boden verankert. Zudem lässt das<br />
Gesetz den Verkauf von Boden an Auslän<strong>der</strong><br />
kaum zu.<br />
<strong>–</strong> Es gab keine Transparenz. Der Präsident<br />
war angeblich auch nicht informiert. Der<br />
Fall Daewoo hat ohne Zweifel zu seinem<br />
Sturz im März 2009 beigetragen.<br />
Wer hätte vom Vertrag profitiert?<br />
Das Unternehmen und die <strong>–</strong> unbekannten <strong>–</strong><br />
Vermittler des Deals. Die Bauern hätten ihr<br />
Land verloren und wären bestenfalls Arbeiter<br />
auf ihrem eigenen Land geworden.<br />
Sind da<strong>nach</strong> neue Fälle ans Licht<br />
gekommen?<br />
Die französische Organisation CIRAD hat<br />
eine Liste mit über 50 seit 2005 geplanten<br />
Projekten veröffentlicht. Die Vorhaben von<br />
Daewoo und <strong>der</strong> indischen Varun waren die<br />
grössten. Sie sahen die Bewirtschaftung von<br />
drei Millionen Hektar Land vor. Zum Vergleich:<br />
Heute bearbeiten 2,5 Millionen Bauernfamilien<br />
zwei Millionen Hektar! Ein Drittel<br />
aller Projekte ist gestoppt worden. Ein<br />
weiteres Drittel wird zurzeit vorbereitet und<br />
ein Drittel ist bereits lanciert. Insgesamt geht<br />
es dabei jedoch um nur 150 000 Hektar <strong>–</strong><br />
fünf Prozent <strong>der</strong> ursprünglich für ausländische<br />
Investitionen vorgesehenen Fläche. Tatsächlich<br />
bebaut sind heute etwa 23 000<br />
Hektar <strong>–</strong> weniger als ein Prozent. Mehrheitlich<br />
wird Jatropha zur Produktion von Agrotreibstoff<br />
angebaut. Bei den Verträgen, die<br />
sich in <strong>der</strong> Vorbereitungsphase befinden, geht<br />
es um Zuckerrohr, ebenfalls für die Herstellung<br />
von Treibstoff. Reis und Mais als Exportprodukte<br />
sind vorläufig vom Tisch. Was sinnvoll<br />
ist, wenn man bedenkt, dass Madagaskar zehn<br />
Prozent seines Reisbedarfs durch Importe deckt<br />
und 600 000 Einwohner/innen durch das Welternährungsprogramm<br />
versorgt werden.<br />
Sind neue Projekte geplant o<strong>der</strong> ist das<br />
Thema vorerst erledigt?<br />
Die Grossprojekte sind unmittelbar <strong>nach</strong> dem<br />
Sturz <strong>der</strong> Regierung gestoppt worden. Die<br />
verän<strong>der</strong>te Situation im Land hat die betroffenen<br />
Unternehmen <strong>–</strong> aus Südkorea, Indien,<br />
Südafrika, Frankreich, Grossbritannien,<br />
Mauritius und Italien <strong>–</strong> bestimmt ernüchtert.<br />
Dennoch ist die Gefahr nicht gebannt.<br />
Daewoo und Varun gingen ungeschickt vor,<br />
aber sicherlich werden sie o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e neue<br />
Wege finden.<br />
Gibt es Gesetze zum Schutz von Wasserressourcen?<br />
Die seit den 1980er-Jahren von <strong>der</strong> Direktion<br />
für Entwicklung und Zusammenarbeit<br />
DEZA geför<strong>der</strong>ten Nichtregierungsorganisationen<br />
haben 1990 den «Code de l’eau»<br />
mitgeprägt. Wasser ist dem<strong>nach</strong> ein öffentliches<br />
Gut und unverkäuflich. Bei Konflikten<br />
mit an<strong>der</strong>en Bedürfnissen geht die Trinkwasserversorgung<br />
vor. Die Versorgung mit<br />
Trinkwasser ist vor allem im ländlichen Gebiet<br />
prekär. Nur ein Drittel <strong>der</strong> Bevölkerung<br />
hat einen gesicherten Zugang. Die Regierung<br />
ist bemüht, die entsprechenden Millenniumsziele<br />
zu erreichen.<br />
Interview: Nuria Brunner<br />
21
Die internationale Gemeinschaft und die Schweiz<br />
Reichen Empfehlungen und freiwillige<br />
Verpflichtungen?<br />
Nuria Brunner, Fachmitarbeiterin Bereich Recht auf Nahrung, und Miges Baumann,<br />
Leiter Ressort Entwicklungspolitik, Brot für alle<br />
«Land für diejenigen, die es bearbeiten und die Menschen ernähren», for<strong>der</strong>t La Vía Campesina<br />
am Weltsozialforum in Dakar. © Beat Dietschy / Brot für alle<br />
Das Ausmass und die Gefahren von Land-<br />
und Wassernahmen beschäftigen auch internationale<br />
Organisationen. So versuchen<br />
Weltbank und FAO mit freiwilligen Richtlinien,<br />
das «Land <strong>Grabbing»</strong> sozial- und umweltverträglicher<br />
zu gestalten. Viele NGOs<br />
und Bauernorganisationen for<strong>der</strong>n aber:<br />
«Stop Land <strong>Grabbing»</strong>.<br />
Lange Zeit hat die Weltbank Agrarinvestitionen<br />
als Modell für die ländliche Entwicklung<br />
propagiert, von dem sowohl die Investoren<br />
22<br />
als auch die lokale Bevölkerung profitieren.<br />
Wegen <strong>der</strong> aufkommenden Kritik am «Land<br />
<strong>Grabbing»</strong> gab die Weltbank einen Bericht<br />
dazu in Auftrag. Das lange erwartete Dokument<br />
zeichnete dann ein sehr viel kritischeres<br />
Bild. Es nennt zwar Vorteile von landwirtschaftlichen<br />
Grossinvestitionen: einfacher<br />
Zugang zu Kapital, erhöhte Produktivität<br />
durch den Einsatz von technischen Hilfsmitteln,<br />
vereinfachter Zutritt zum Weltmarkt<br />
und die Möglichkeit, die Produktion in globale<br />
Wertschöpfungsketten zu integrieren.
All dies biete ein <strong>grosse</strong>s Potenzial für die<br />
Entwicklung <strong>der</strong> betroffenen Län<strong>der</strong> und ermögliche<br />
die Schaffung von lokalen Arbeitsplätzen<br />
und Einkommen. Doch geht <strong>der</strong> Bericht<br />
auch auf die negativen Konsequenzen<br />
vieler Land-Deals für Kleinbauern ein, beispielsweise<br />
auf die ungenügenden gesetzlichen<br />
Rahmenbedingungen und die Schwäche<br />
<strong>der</strong> Regierungen, die von Investoren ausgenutzt<br />
werden, und den ungenügenden Schutz<br />
einheimischer Gemeinschaften vor Vertrei-<br />
Freiwillige Prinzipien für verantwortungsvolle Agrarinvestitionen<br />
bungen. Er kommt zum Schluss, dass die<br />
Investitionen den Betroffenen we<strong>der</strong> Entschädigungen<br />
o<strong>der</strong> Arbeitsplätze noch Ernährungssicherheit<br />
bringen. Am Ende stehen sie<br />
schlechter da als vor den Landveräusserungen.<br />
Der Bericht appelliert an die Eigenverantwortung<br />
<strong>der</strong> Investoren und Regierungen<br />
(siehe Kasten) und weist auf mögliche Rollen<br />
von Zivilgesellschaft und internationalen Organisationen<br />
bei <strong>der</strong> Stärkung <strong>der</strong> betroffenen<br />
Bevölkerung hin. 10<br />
Im Januar 2010 hat die Weltbank zusammen mit <strong>der</strong> Welternährungsorganisation FAO<br />
und weiteren Organisationen sieben Prinzipien ausgearbeitet, die die schädlichen Wirkungen<br />
<strong>grosse</strong>r Agrarinvestitionen beschränken sollen:<br />
<strong>–</strong> Achtung bestehen<strong>der</strong> Rechte<br />
<strong>–</strong> Sicherung <strong>der</strong> Ernährung <strong>der</strong> örtlichen Bevölkerung<br />
<strong>–</strong> Transparenz, gute Regierungsführung und ein unterstützendes Umfeld<br />
<strong>–</strong> Einbezug <strong>der</strong> lokalen Bevölkerung<br />
<strong>–</strong> verantwortungsvolle Investitionen<br />
<strong>–</strong> soziale Nachhaltigkeit<br />
<strong>–</strong> ökologische Nachhaltigkeit 11<br />
Die freiwilligen Richtlinien <strong>der</strong> Weltbank sind umstritten. Sogar Regierungen sehen ein,<br />
dass sie zu wenig weit gehen. Deshalb hat die Organisation für Ernährung und Landwirtschaft<br />
FAO beschlossen, an den freiwilligen Prinzipien für verantwortungsvolle Agrarinvestitionen<br />
von Privaten weiter zu arbeiten.<br />
La Vía Campesina, FIAN, Land Research Action Network und GRAIN lancierten darauf<br />
den Appell «Stop land grabbing now!». Sie halten fest, dass freiwillige Verhaltensregeln<br />
Menschenrechtsverletzungen Vorschub leisten können, weil sie keinerlei Bezug zu menschenrechtlichen<br />
Verpflichtungen und vorhandenen Menschenrechtsinstrumenten herstellen<br />
und die Illusion nähren, ein sozial- und umweltverträgliches «Land <strong>Grabbing»</strong> sei<br />
möglich. Der Appell weist auch darauf hin, dass die Prinzipien <strong>der</strong> Internationalen Konferenz<br />
für Agrarreform und ländliche Entwicklung ICARRD 2006 und die Empfehlungen<br />
des Weltagrarrates IAASTD zum Potenzial und zur Notwendigkeit ökologischer Landwirtschaft<br />
völlig ignoriert werden. Viele Nichtregierungsorganisationen, darunter auch Brot<br />
für alle, haben diesen Appell mitunterzeichnet. 12<br />
23
GRAIN und La Vía Campesina protestieren vor <strong>der</strong> FAO gegen den Landraub. Foto: GRAIN<br />
Vorschlag <strong>der</strong> FAO zur Erarbeitung<br />
freiwilliger Richtlinien<br />
Eine zweite Richtlinie für Staaten soll die<br />
Ausgestaltung und Sicherung von Nutzungsrechten<br />
an Land und an<strong>der</strong>en natürlichen<br />
Ressourcen sowie soziale, ökologische und<br />
wirtschaftliche Aspekte von Landverträgen<br />
abdecken. Sie soll Regierungen dabei helfen,<br />
verantwortungsbewusste Landpolitiken umzusetzen,<br />
die sich am Ziel einer <strong>nach</strong>haltigen<br />
Armutsbekämpfung orientieren. Dieser Verhaltenskodex<br />
könnte <strong>nach</strong> Auffassung von<br />
FIAN International die Rechte <strong>der</strong> ländlichen<br />
Bevölkerung auf Nahrung, Landzugang<br />
und die Nutzung an<strong>der</strong>er Ressourcen besser<br />
stärken und schützen als die «Freiwilligen<br />
Prinzipien für verantwortungsvolle Agrarinvestitionen».<br />
24<br />
«<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong> untergräbt Entwicklungsanstrengungen<br />
Wasser spielt eine Schlüsselrolle in <strong>der</strong><br />
Schweizer Entwicklungszusammenarbeit.<br />
Seit über 30 Jahren unterstützt die Direktion<br />
für Entwicklung und Zusammenarbeit<br />
DEZA Projekte zur Verbesserung <strong>der</strong> Trinkwasserversorgung,<br />
<strong>der</strong> Siedlungshygiene und<br />
des Wasser- und Abwassermanagements. Die<br />
Strategie <strong>der</strong> Sektion Wasser Initiativen weist<br />
auf die Notwendigkeit einer globalen Perspektive<br />
für die Abwendung einer globalen<br />
Wasserkrise hin und stellt den Ansatz des<br />
Integrierten Wasserressourcen-Managements<br />
vor. Für die Sicherung des Zugangs zu Wasser<br />
und den Schutz <strong>der</strong> Rechte lokaler Bevölkerungen<br />
setzt sie auf klare gesetzliche Re-<br />
gelungen und Mechanismen und funktionie-
ende Institutionen. Im Strategiepapier <strong>der</strong><br />
DEZA wird zwar erwähnt, dass 70 Prozent<br />
des weltweiten Süsswassers für die Landwirtschaft<br />
eingesetzt werden und dass die Produktion<br />
von Agrotreibstoffen diesen Verbrauch<br />
weiter ansteigen lässt. Auch wird <strong>der</strong> Import<br />
von «virtuellem Wasser» in Form von landwirtschaftlichen<br />
Produkten angesprochen.<br />
Doch thematisieren we<strong>der</strong> die Sektion Wasser<br />
Initiativen noch an<strong>der</strong>e Abteilungen <strong>der</strong> DEZA<br />
das «<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong> im Zusammenhang mit<br />
landwirtschaftlichen Grossinvestitionen.<br />
Verschiedene Entwicklungsorganisationen<br />
verbessern mit ihren Projekten die Trinkwasserversorgung<br />
in Dörfern. «<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong><br />
unterläuft diese Bemühungen und könnte «reine»<br />
Wasserversorgungs- und Brunnenbau-<br />
Projekte scheitern lassen. Deshalb ist neben<br />
<strong>der</strong> Entwicklungszusammenarbeit auch entwicklungspolitisches<br />
Handeln unumgänglich.<br />
Brot für alle und <strong>Fastenopfer</strong> engagieren sich<br />
in beiden Bereichen.<br />
«<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong> senkt den Grundwasserspiegel und gefährdet den Erfolg von<br />
Wasserprojekten zugunsten <strong>der</strong> Bevölkerung. © Miges Baumann / Brot für alle<br />
25
Handlungsmöglichkeiten<br />
Dort ansetzen, wo wir leben und<br />
Einfluss haben<br />
Nuria Brunner, Fachmitarbeiterin Bereich Recht auf Nahrung, Brot für alle<br />
Übergabe <strong>der</strong> Petition «Keine Agrotreibstoffe, die zu Hunger und Zerstörung führen» © Michael Würtenberg<br />
Die Schweiz darf die Ernährungssouveränität<br />
und den Zugang zu Ressourcen an<strong>der</strong>er<br />
Län<strong>der</strong> nicht gefährden. Unser Land<br />
hat eine langjährige humanitäre Tradition<br />
und ein <strong>grosse</strong>s Wissen in <strong>der</strong> Wasserversorgung<br />
und -aufbereitung.<br />
In zahlreichen Projekten hat die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit<br />
in vielen Län<strong>der</strong>n<br />
des Südens Trinkwasserversorgungen und sanitäre<br />
Einrichtungen gebaut. «Es kann nicht sein,<br />
dass wir uns in <strong>der</strong> Entwicklungspolitik dem<br />
Menschenrecht auf Wasser verpflichten und<br />
gleichzeitig diese Bemühungen durch unsere<br />
Wirtschafts- und Handelspolitik zunichte machen»,<br />
sagt Maike Gorsboth vom Ökumenischen<br />
Wassernetzwerk. Die Schweiz könnte<br />
zum Beispiel dem Vorbild an<strong>der</strong>er Län<strong>der</strong> folgen<br />
und das Recht auf Wasser in <strong>der</strong> Bundes-<br />
26<br />
verfassung verankern, meint sie. Auch weist sie<br />
darauf hin, dass die Schweiz bisher das Fakultativprotokoll<br />
zum Uno-Pakt für wirtschaftliche,<br />
soziale und kulturelle Rechte nicht ratifiziert<br />
hat. Dieses sieht ein Beschwerdeverfahren<br />
für Individuen und Gruppen vor, <strong>der</strong>en wirtschaftliche,<br />
soziale und kulturelle Rechte verletzt<br />
worden sind.<br />
In ihrer im Februar 2011 lancierten Petition<br />
«Unternehmen müssen Menschenrechte achten!»<br />
for<strong>der</strong>n Brot für alle und <strong>Fastenopfer</strong> den<br />
Schweizer Bundesrat zu einer kohärenten Aussen-<br />
und Wirtschaftspolitik auf, welche auch<br />
die Unternehmen in die Pflicht nimmt, die<br />
Menschenrechte zu respektieren.<br />
Hinsichtlich in <strong>der</strong> Schweiz beheimateter Unternehmen,<br />
die Agrarinvestitionen tätigen und in<br />
Entwicklungslän<strong>der</strong>n Land erwerben, sollte diese<br />
Politik Folgendes sicherstellen:
<strong>–</strong> Mehr rechtliche Verantwortlichkeit:<br />
Die Sorgfaltspflicht von Unternehmensleitungen<br />
muss gesetzlich verankert werden.<br />
Transnationale Konzerne müssen dazu<br />
verpflichtet werden, Massnahmen zur Verhin<strong>der</strong>ung<br />
von Menschenrechtsverletzungen<br />
durch ihre Unternehmen o<strong>der</strong> Tochterfirmen<br />
zu ergreifen.<br />
Wasser als Menschenrecht und öffentliches Gut:<br />
Die brasilianisch-schweizerische ökumenische Wassererklärung<br />
<strong>–</strong> Mehr Transparenz bei Finanzflüssen:<br />
Transnational tätige Unternehmen müssen<br />
ihre Finanzflüsse pro Land öffentlich machen<br />
und dabei angeben, wie viel Geld sie<br />
an die Regierungen <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> bezahlen,<br />
in denen sie tätig sind.<br />
Im April 2005 unterzeichneten die Bischofskonferenzen Brasiliens und <strong>der</strong> Schweiz sowie<br />
<strong>der</strong> Ökumenische Rat <strong>der</strong> Kirchen Brasiliens (CONIC) und <strong>der</strong> Schweizerische Evangelische<br />
Kirchenbund (SEK), <strong>der</strong> Brot für alle gegründet hat, als nationale Vertretungen <strong>der</strong> protestantischen<br />
Kirchen die «Ökumenische Erklärung zum Wasser als Menschenrecht und<br />
öffentliches Gut». 13 Dieser kurze Text wird seither in <strong>der</strong> Ökumene als gutes Beispiel für<br />
die Nord-Süd-Zusammenarbeit gewürdigt. Die Erklärung unterstützt die weltweiten Bemühungen<br />
um die Anerkennung des Menschenrechts auf Wasser, die mit <strong>der</strong> Resolution<br />
<strong>der</strong> Generalversammlung <strong>der</strong> Vereinten Nationen vom 28. Juli 2010 einen deutlichen Erfolg<br />
verzeichnen konnten. Die Erklärung wendet sich mit dem Begriff des «öffentlichen Guts»<br />
auch gegen die Tendenz zur Privatisierung von Wasser: «Der Staat muss die Verpflichtung<br />
übernehmen, allen Bewohnern Zugang zu Trinkwasser zu sichern.» Dazu gehört auch die<br />
Verpflichtung zur friedlichen Beilegung von Konflikten um die Nutzung von Wasserressourcen.<br />
Wie jedes Dokument von grundsätzlichem Charakter kann die ökumenische Erklärung <strong>–</strong><br />
um beim Bild des Wassers zu bleiben <strong>–</strong> ein halb volles o<strong>der</strong> ein halb leeres Glas sein. Einerseits<br />
bedeutet sie einen wesentlichen Schritt zu einer Verpflichtung <strong>der</strong> Kirchen auf den<br />
Einsatz für das Wasser. Die Vollversammlung des Ökumenischen Rates <strong>der</strong> Kirchen (ÖRK)<br />
in Porto Alegre 2006 sowie die Gründungsversammlung <strong>der</strong> Weltgemeinschaft Reformierter<br />
Kirchen (WGRK) in Grand Rapids 2010 haben die ökumenische Wassererklärung in<br />
diesem Sinne aufgegriffen und unterstützt. An<strong>der</strong>erseits kann ein solches Dokument zu<br />
einer reinen Absichtserklärung verkommen, wenn nicht weitere Schritte zur Umsetzung<br />
folgen. Es ist daher nötig, die Wassererklärung immer wie<strong>der</strong> in unseren Kirchen und<br />
Werken bekannt zu machen, auch in ganz Europa und Lateinamerika, weltweit das Ökumenische<br />
Wassernetzwerk (EWN) zu stärken, auf die öffentliche Meinung einzuwirken<br />
und <strong>–</strong> mindestens dort, wo <strong>der</strong> Problemdruck gross ist, wie etwa in Osteuropa <strong>–</strong> Regierungen<br />
und Parlamente für den Schutz des Wassers als öffentliches Gut in Verfassung und<br />
Gesetzgebung zu gewinnen.<br />
Otto Schäfer, Beauftragter für Theologie und Ethik des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds (SEK)<br />
27
Das tun Brot für alle und <strong>Fastenopfer</strong><br />
Brot für alle und <strong>Fastenopfer</strong> arbeiten zum<br />
Thema Land- und Wassernahmen und unterstützen<br />
Partner im Süden, die sich dagegen<br />
zur Wehr setzen und stattdessen die lokale<br />
<strong>nach</strong>haltige Bewirtschaftung des Bodens för<strong>der</strong>n.<br />
Brot für alle und GRAIN haben vereinbart,<br />
zusammen mit betroffenen Bauern- und<br />
Nichtregierungsorganisationen in Westafrika<br />
einen Erfahrungsaustausch über Aktionen<br />
gegen das «Land <strong>Grabbing»</strong> durchzuführen.<br />
Brot für alle und <strong>Fastenopfer</strong> unterstützen<br />
Nichtregierungs- und Basisorganisationen,<br />
welche die <strong>nach</strong>haltige Landwirtschaft und<br />
biologische Vielfalt för<strong>der</strong>n. In verschiedenen<br />
Län<strong>der</strong>n arbeiten sie zudem entwicklungspolitisch<br />
mit nationalen Gruppen und Bauernorganisationen<br />
zusammen, um das Recht<br />
auf Nahrung zu stärken.<br />
Brot für alle und <strong>Fastenopfer</strong> engagieren sich<br />
entwicklungspolitisch auch in <strong>der</strong> Schweiz. In<br />
einer <strong>grosse</strong>n Koalition von Schweizer Nichtregierungsorganisationen<br />
haben sie die Problematik<br />
<strong>der</strong> Agrotreibstoffe aus Nahrungsmitteln<br />
in die Medien gebracht. Die Arbeit<br />
trägt Früchte: Die nationalrätliche Kommission<br />
für Umwelt und Energie (UREK) hat die<br />
Zulassungskriterien für den Import von<br />
Agrotreibstoffen deutlich verschärft. Künftig<br />
sollen Agrotreibstoffe, die zu Hunger und<br />
Umweltzerstörung führen, nicht mehr importiert<br />
und Eigentumsrechte von indigenen Völkern<br />
und Kleinbauerngemeinschaften nicht<br />
mehr verletzt werden dürfen. Zur Unterstützung<br />
<strong>der</strong> Position <strong>der</strong> UREK reichte die Plattform<br />
Agrotreibstoffe im Februar 2011 die<br />
Petition «Keine Agrotreibstoffe, die zu Hunger<br />
und Zerstörung führen» ein. Die von<br />
66 901 Personen unterzeichnete Petition for-<br />
28<br />
© Paul Jeffrey / EAA<br />
<strong>der</strong>t Zulassungskriterien, die sozial und<br />
ökologisch problematische Agrotreibstoffe<br />
generell ausschliessen. Die Kriterien sollen<br />
insbeson<strong>der</strong>e die Ernährungssicherung in den<br />
Herkunftslän<strong>der</strong>n sowie indirekte Verdrängungseffekte<br />
einbeziehen.<br />
Mitwirkung in internationalen Arbeitsgruppen<br />
Auch auf europäischer Ebene sind wir politisch<br />
aktiv: Brot für alle engagiert sich unter<br />
an<strong>der</strong>em im Verbund protestantischer Hilfswerke<br />
APRODEV. <strong>Fastenopfer</strong> arbeitet im<br />
internationalen Verbund von CIDSE zusammen.<br />
Ziel ist es, entwicklungsrelevante Entscheidungen<br />
und Politiken <strong>der</strong> EU und <strong>der</strong><br />
Uno zu beeinflussen. Brot für alle ist ebenfalls<br />
in <strong>der</strong> globalen Ecumenical Advocacy Alliance<br />
EAA engagiert.
Das können wir tun<br />
Durch den Konsum saisonaler und regionaler Produkte werden weniger ausländische<br />
Wasserressourcen beansprucht. © Patrik Kummer / Brot für alle<br />
Die Bibel lehrt uns, die Schöpfung zu bewahren<br />
und ihre Früchte und Schätze gerecht zu<br />
teilen. Wir alle können einen Beitrag zum<br />
schonenden Umgang mit Wasser und zur<br />
Eindämmung von Wassernahmen im Süden<br />
leisten. Sei es durch die Än<strong>der</strong>ung unserer<br />
Konsumgewohnheiten, unser politisches Engagement<br />
o<strong>der</strong> die Unterstützung von konkreten<br />
Projekten:<br />
<strong>–</strong> Den eigenen Wasserfussabdruck berechnen:<br />
www.waterfootprint.org.<br />
<strong>–</strong> Saisonale und regionale Produkte kaufen,<br />
um energiebewusst zu konsumieren und<br />
weniger ausländische Wasserressourcen zu<br />
beanspruchen.<br />
<strong>–</strong> Den Fleischkonsum einschränken und<br />
Fleisch von einheimischen Tieren bevorzugen,<br />
die nicht mit wasserintensivem Kraftfutter<br />
wie Weizen, Mais o<strong>der</strong> Soja gefüttert<br />
wurden.<br />
<strong>–</strong> Produkte aus Fairem Handel kaufen und<br />
damit faire Handelsstrukturen begüns-<br />
tigen.<br />
<strong>–</strong> Den eigenen Energie- und Treibstoffverbrauch<br />
reduzieren, um <strong>der</strong> Klimaerwärmung<br />
entgegenzuwirken und <strong>der</strong> Herstellung<br />
von Agrotreibstoffen keinen Vorschub<br />
zu leisten.<br />
<strong>–</strong> Bekannte überzeugen, bewusster und verantwortungsvoller<br />
zu konsumieren und<br />
einzukaufen.<br />
<strong>–</strong> Finanzinvestitionen hinterfragen und<br />
Transparenz for<strong>der</strong>n: «Wo wird mein Geld<br />
investiert?».<br />
<strong>–</strong> Die Schweizer Regierung auffor<strong>der</strong>n,<br />
Massnahmen zu ergreifen, damit bilaterale<br />
Investitionsabkommen nicht zum «<strong>Water</strong><br />
<strong>Grabbing»</strong> beitragen.<br />
<strong>–</strong> Das entwicklungspolitische Engagement<br />
und Projekte von Brot für alle und <strong>Fastenopfer</strong><br />
und damit Partner im Süden gegen<br />
Land- und Wassernahmen unterstützen.<br />
<strong>–</strong> Uns gemeinsam mit an<strong>der</strong>en Organisationen<br />
<strong>der</strong> Zivilgesellschaft für die Einhaltung<br />
<strong>der</strong> Menschenrechte <strong>der</strong> von «<strong>Water</strong><br />
<strong>Grabbing»</strong> betroffenen Menschen und<br />
Gemeinschaften einsetzen.<br />
29
Quellenhinweise und Links<br />
Quellenhinweise<br />
1 Carin Smaller and Howard Man, A Thirst for Distant<br />
Lands: Foreign investment in agricultural<br />
land and water. International Institute for Sustainable<br />
Development, Mai 2009.<br />
2 Land grab in Africa. Emerging land system drivers<br />
in a teleconnected world. The Global Land Project<br />
International Project Office, GLP Report No. 1,<br />
2010.<br />
3 Charlotte de Fraiture, Biofuel Crops Could Drain<br />
Developing World Dry. International <strong>Water</strong> Management<br />
Institute Research, in Biofuels News,<br />
11. Mai 2007.<br />
4 Der Wasser-Fussabdruck <strong>der</strong> Schweiz. Woher<br />
stammt das Wasser, das in unseren Landwirtschaftsprodukten<br />
steckt? WWF Schweiz, Februar<br />
2010.<br />
5 Beyond scarcity: Power, poverty and the global<br />
water crisis. Human Development Report 2006.<br />
UNDP, 2006.<br />
6 Julia Behrman, Ruth Meinzen-Dick, Agnes<br />
Quisumbing, The Gen<strong>der</strong> Implications of Large<br />
Scale-Land Deals. International Food Policy<br />
Research Institute, 2011.<br />
7 Carin Smaller and Howard Man, A Thirst for Distant<br />
Lands: Foreign investment in agricultural<br />
land and water. International Institute for Sustainable<br />
Development, Mai 2009.<br />
8 Dies hat <strong>der</strong> Wasserrechtsspezialist Jean-Benoit<br />
Charrin von <strong>Water</strong>Lex aufgrund <strong>der</strong> Umwelt-,<br />
Sozial- und Gesundheisverträglichkeitsstudie <strong>der</strong><br />
Afrikanischen Entwicklungsbank und des Scoping-Berichts<br />
<strong>der</strong> südafrikanischen Beratungsfirma<br />
Coastal & Environmental Services berechnet.<br />
9 Jean-Claued Péclet, Addax Bioenergy investit 200<br />
millions de dollars en Sierra Leone. Le Temps,<br />
13. Februar 2010.<br />
10 Rising Global Interest in Farmland. Can It Yield<br />
Sustainable and Equitable Benefits? The World<br />
Bank, 7. September 2010.<br />
11 Principles for Responsible Agricultural Investment<br />
that Respects Rights, Livelihoods and Resources.FAO,<br />
IFAD, UNCTAD, World Bank<br />
Group, 25. Januar 2010.<br />
12 Stop land grabbing now! 22. April 2010.<br />
http://farmlandgrab.org/12200<br />
13 Ökumenische Erklärung zum Wasser als Menschenrecht<br />
und öffentliches Gut. Schweizerischer<br />
Evangelischer Kirchenbund, Ökumenischer Rat<br />
Christlicher Kirchen Brasiliens, Katholische Bischofskonferenz<br />
Brasiliens, Schweizer Bischofskonferenz,<br />
2005.<br />
30<br />
Links<br />
Wasser, Recht auf Wasser<br />
www.iwmi.org<br />
www.righttowater.info<br />
www.waterlex.org<br />
http://water.oikoumene.org<br />
Land Grabbing<br />
www.grain.org<br />
http://farmlandgrab.org<br />
www.viacampesina.org<br />
www.brotfueralle.ch/land<br />
www.alliancesud.ch/de/dokumentation/e-dossiers/<br />
land-grabbing<br />
http://land-grabbing.de<br />
Gen<strong>der</strong> und Zugang zu Land und Wasser<br />
www.fao.org/gen<strong>der</strong>/landrights<br />
www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e00.htm<br />
www.weltagrarbericht.de/themen-desweltagrarberichtes/geschlechterrollen<br />
www.gen<strong>der</strong>andwater.org<br />
www.wedo.org<br />
Recht auf Nahrung<br />
www.brotfueralle.ch/nahrung<br />
www.rechtaufnahrung.ch<br />
www.cetim.ch<br />
www.e-alliance.ch/en/s/food<br />
www.fao.org/righttofood<br />
www.fian.org<br />
www2.ohchr.org/english/issues/food<br />
www.righttofood.org<br />
www.rtfn-watch.org<br />
www.srfood.org<br />
Landwirtschaft, <strong>nach</strong>haltige Entwicklung<br />
www.future-agricultures.org<br />
www.globallandproject.org<br />
www.ifpri.org<br />
www.iisd.org<br />
Nachhaltige Landwirtschaft Schweiz<br />
www.bio-suisse.ch<br />
www.fibl.org<br />
www.uniterre.ch
Impressum<br />
Herausgeber: Brot für alle / <strong>Fastenopfer</strong>, Bern / Luzern, Mai 2011<br />
Redaktion: Jacqueline Hefti Widmer<br />
Autor/innen: Thomas Bauer, Miges Baumann, Nuria Brunner, Andrea Kolb,<br />
Yvan Maillard Ardenti, Otto Schäfer<br />
Lektorat: Annemarie Friedli<br />
Gestaltung, Druck: Cavelti AG, Druck und Media, Gossau<br />
Auflage: 8000 (deutsch), 2900 (französisch)<br />
Bestellungen: Brot für alle, Monbijoustrasse 29, Postfach 5621, 3001 Bern<br />
Telefon 031 380 65 65, Fax 031 380 65 63, materialstelle@bfa-ppp.ch<br />
Preis: CHF 5.<strong>–</strong><br />
<strong>Fastenopfer</strong>, Alpenquai 4, Postfach 2856, 6002 Luzern<br />
Telefon 041 227 59 59, Fax 041 227 59 10, mail@fastenopfer.ch
«<strong>Water</strong> <strong>Grabbing»</strong> ist noch kein gängiger Begriff. Doch ist die Sicherung von Wasserrechten<br />
<strong>der</strong> treibende Faktor hinter dem Phänomen des «Land <strong>Grabbing»</strong>. Die Gier <strong>nach</strong> Wasser treibt<br />
Investoren und Nationen an, sich riesige Flächen Ackerland und die dazu gehörigen Wasserressourcen<br />
im Süden zu sichern. Während sich internationale Organisationen fragen, wie <strong>der</strong><br />
Hunger <strong>nach</strong> Land sozial- und umweltverträglich gestaltet werden kann, for<strong>der</strong>n betroffene<br />
Bauernorganisationen: «Stopp!»<br />
Dieser EinBlick beleuchtet die Hintergründe des ungezügelten Zugriffs auf Wasser im Zusammenhang<br />
mit dem Erwerb von Land in Afrika und an<strong>der</strong>swo. Er zeigt, was wir tun können<br />
und was die Politik tun sollte.<br />
Brot für alle ist <strong>der</strong> Entwicklungsdienst <strong>der</strong> Evangelischen Kirchen <strong>der</strong> Schweiz. Er unterstützt<br />
rund 400 Projekte in Asien, Lateinamerika und Afrika, die Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Entwicklungspolitisch<br />
engagiert sich Brot für alle für ein faires internationales Weltwirtschaftssystem,<br />
für das Recht auf Nahrung, für Gerechtigkeit im Klimawandel, für soziale und ökologische<br />
Unternehmensverantwortung und für faire und transparente Finanzbeziehungen.<br />
Brot für alle, Monbijoustrasse 29, Postfach 5621, 3001 Bern<br />
Telefon 031 380 65 65, Fax 031 380 65 64<br />
www.brotfueralle.ch, bfa@bfa-ppp.ch<br />
<strong>Fastenopfer</strong> ist das Hilfswerk <strong>der</strong> Katholikinnen und Katholiken in <strong>der</strong> Schweiz. Die 400<br />
Projekte in 16 Län<strong>der</strong>n weltweit bauen auf die Stärkung lokaler Gemeinschaften, in denen<br />
sich Menschen zusammenschliessen und Lösungen für bessere Lebensbedingungen suchen.<br />
<strong>Fastenopfer</strong> engagiert sich auf nationaler und internationaler Ebene für bessere entwicklungspolitische<br />
Rahmenbedingungen und mehr Gerechtigkeit.<br />
<strong>Fastenopfer</strong>, Alpenquai 4, Postfach 2856, 6002 Luzern<br />
Telefon 041 227 59 59, Fax 041 227 59 10<br />
www.fastenopfer.ch, mail@fastenopfer.ch