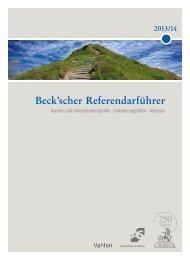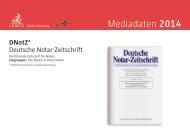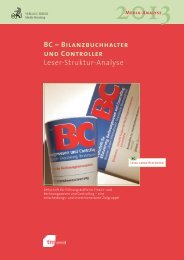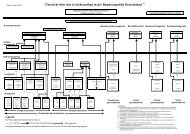Arbeiten in der Schweiz am Beispiel der Bauwirtschaft
Arbeiten in der Schweiz am Beispiel der Bauwirtschaft
Arbeiten in der Schweiz am Beispiel der Bauwirtschaft
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Neue Zeitschrift für<br />
Arbeitsrecht<br />
Zweiwochenschrift für die betriebliche Praxis<br />
NZA Onl<strong>in</strong>e Aufsatz 3/2009<br />
19. August 2009 · 26. Jahrgang · Seite 1–7<br />
In Zus<strong>am</strong>menarbeit mit <strong>der</strong> Neuen Juristischen Wochenschrift herausgegeben von:<br />
Prof. Dr. Jobst-Hubertus Bauer, Rechtsanwalt, Stuttgart – Prof. Dr. Johannes Peter Francken, Präsident des LAG Baden-Württemberg<br />
a. D., Freiburg – Edith Gräfl, Vorsitzende Richter<strong>in</strong> <strong>am</strong> BAG, Erfurt – Dr. Thomas Klebe, Justitiar <strong>der</strong> IG Metall, Frankfurt a. M. –<br />
Wolfgang Koberski, Vorstand bei den Sozialkassen des Baugewerbes, Wiesbaden – Prof. Dr. Eckhard Kreßel, Leiter Personal- und<br />
Arbeitspolitik <strong>der</strong> Daimler AG, Stuttgart – Prof. Dr. Klaus Neef, Rechtsanwalt, Hannover – Prof. Dr. Ulrich Preis, Universität zu Köln –<br />
Prof. Dr. Re<strong>in</strong>hard Richardi, Universität Regensburg – Prof. Dr. Ra<strong>in</strong>er Schlegel, Abteilungsleiter im Bundesm<strong>in</strong>isterium für Arbeit und<br />
Soziales, Berl<strong>in</strong> – Ingrid Schmidt, Präsident<strong>in</strong> des BAG, Erfurt – Prof. Dr. Klaus Schmidt, Präsident des LAG Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz a. D.,<br />
Heidelberg – Prof. Dr. Achim Schun<strong>der</strong>, Rechtsanwalt, Frankfurt a. M. – Prof. Dr. Ulrike Wendel<strong>in</strong>g-Schrö<strong>der</strong>, Universität Hannover –<br />
Prof. Dr. Hellmut Wißmann, Präsident des BAG a. D., Erfurt<br />
Schriftleitung: Prof. Dr. Klaus Schmidt, Prof. Dr. Achim Schun<strong>der</strong> und Dr. Jochen Wallisch<br />
Beethovenstr. 7b, 60325 Frankfurt a. M.<br />
Onl<strong>in</strong>e-Aufsatz<br />
Rechtsanwalt Eric Zimmermann, Freiburg im Breisgau*<br />
<strong>Arbeiten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> <strong>am</strong> <strong>Beispiel</strong> <strong>der</strong> <strong>Bauwirtschaft</strong><br />
<strong>Arbeiten</strong> im Ausland bedeutet immer auch <strong>Arbeiten</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
fremden Rechtsordnung. Der nachfolgende Artikel stellt die<br />
Rechtslage dar, die e<strong>in</strong> ausländischer Unternehmer beachten<br />
muss, <strong>der</strong> se<strong>in</strong>e Arbeitnehmer <strong>in</strong> die <strong>Schweiz</strong> entsendet. Wer<br />
sich nicht im Vorfeld mit dem schweizerischen Entsen<strong>der</strong>echt<br />
beschäftigt, muss d<strong>am</strong>it rechnen, dass ihm bei e<strong>in</strong>er Kontrolle<br />
Verstöße gegen die schweizerischen Arbeits- und Lohnbed<strong>in</strong>gungen<br />
nachgewiesen werden. Diese können zu hohen<br />
Strafen und sogar zu e<strong>in</strong>em Arbeitsverbot führen.<br />
I. E<strong>in</strong>führung<br />
Die EU und ihre 27 Mitgliedstaaten s<strong>in</strong>d die mit Abstand<br />
wichtigsten Partner <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> 1 . Deutschland nimmt dabei<br />
e<strong>in</strong>e Son<strong>der</strong>stellung e<strong>in</strong>. Denn Deutschland ist für die <strong>Schweiz</strong><br />
<strong>der</strong> Wirtschaftspartner Nummer 1, und <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong>er Exportmarkt<br />
ist e<strong>in</strong>er <strong>der</strong> zehn wichtigsten für die deutsche<br />
Wirtschaft 2 . Der Importanteil aus Deutschland lag <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Schweiz</strong> im Jahr 2008 bei 34,6% 3 . Neben <strong>der</strong> Grenznähe<br />
bestehen kulturelle, historische und politische Verwandtschaften.<br />
Zudem gibt es <strong>in</strong> weiten Teilen <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> auch<br />
ke<strong>in</strong>e Sprachbarriere für deutsche Unternehmer. Angesichts<br />
<strong>der</strong> engen Verflechtung verfolgt die <strong>Schweiz</strong> gegenüber <strong>der</strong><br />
EU e<strong>in</strong>e Interessenpolitik auf bilateralem Weg 4 . Als großes<br />
Hemmnis hat sich aber <strong>in</strong> <strong>der</strong> Vergangenheit trotz dieser<br />
Interessenpolitik die Nichtzugehörigkeit <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
Europäischen Union herausgestellt. Das Verhältnis zwischen<br />
<strong>der</strong> EG und <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> wird dabei zunächst durch e<strong>in</strong> Freihandelsabkommen<br />
aus dem Jahr 1972 geregelt 5 . E<strong>in</strong> Beitrittsgesuch<br />
<strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> <strong>in</strong> die EG ruht, da es von dem <strong>Schweiz</strong>erischen<br />
Bundesrat sistiert wurde 6 . Im Januar 1993 erklärte <strong>der</strong><br />
<strong>Schweiz</strong>erische Bundesrat, dass die <strong>Schweiz</strong> bis auf Weiteres<br />
auf die Eröffnung <strong>der</strong> Beitrittsverhandlungen verzichtet und<br />
ihre Beziehungen zur Geme<strong>in</strong>schaft auf bilateralem Weg weiter<br />
zu entwickeln wünscht 7 . Inzwischen ist <strong>am</strong> 1. 6. 2002 e<strong>in</strong><br />
Paket mit sieben sektoralen Abkommen <strong>in</strong> Kraft getreten 8 .<br />
Die Abkommen haben das Ziel, die wirtschaftlichen Nachteile<br />
des Nichtbeitritts <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> zum europäischen Wirtschaftsraum<br />
auszugleichen 9 . Zu den sieben Sektoren zählt<br />
auch <strong>der</strong> Personenverkehr, <strong>der</strong> <strong>in</strong> dem Freizügigkeitsabkommen<br />
(FZA) geregelt wird.<br />
Das Freizügigkeitsabkommen ist e<strong>in</strong> völkerrechtlicher Vertrag<br />
zwischen <strong>der</strong> EG sowie ihren Mitgliedsstaaten auf <strong>der</strong><br />
e<strong>in</strong>en Seite und <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite: wegen <strong>der</strong><br />
gleichzeitigen Beteiligung <strong>der</strong> EG und ihrer Mitgliedsstaaten<br />
auf <strong>der</strong> europäischen Seite handelt es sich um e<strong>in</strong> so genanntes<br />
gemischtes Abkommen 10 . Die Vertragsparteien verpflich-<br />
* Der Autor ist Rechtsanwalt beim Berufsför<strong>der</strong>ungswerk <strong>der</strong> Südbadischen<br />
<strong>Bauwirtschaft</strong>, Freiburg im Breisgau.<br />
1 EDA/EVD, Die Bilateralen Abkommen <strong>Schweiz</strong> – Europäische Union,<br />
S. 5.<br />
2 Bopp, CH-D Wirtschaft 2009, 2.<br />
3 Bopp, CH-D Wirtschaft 2009, 2.<br />
4 EDA/EVD, Die Bilateralen Abkommen <strong>Schweiz</strong> – Europäische Union,<br />
S. 5.<br />
5 Bourgeois, <strong>in</strong>:von <strong>der</strong> Groeben/Schwarze, Komm. zum EU-/EG-Vertrag,<br />
6. Aufl. (2003), Art. 133 Rdnr. 153.<br />
6 Weigell, IStR 2006, 190 (191) m. w. Ausführungen.<br />
7 EDA/EVD, Die Bilateralen Abkommen <strong>Schweiz</strong> – Europäische Union,<br />
S. 5.<br />
8 Bourgeois, <strong>in</strong>: von <strong>der</strong> Groeben/Schwarze (o. Fußn. 5), Art. 133<br />
Rdnr. 153.<br />
9 Fehrenbacher, NVwZ 2002, 1344.<br />
10 Fehrenbacher, NVwZ 2002, 1344.
2 NZA Onl<strong>in</strong>e Aufsatz 3/2009 Zimmermann, <strong>Arbeiten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> <strong>am</strong> <strong>Beispiel</strong> <strong>der</strong> <strong>Bauwirtschaft</strong><br />
ten sich im Freizügigkeitsabkommen unter an<strong>der</strong>em dazu, die<br />
Arbeitsmärkte schrittweise zu öffnen.<br />
Nach Art. 8 lit. a FZA haben die Vertragsparteien <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e<br />
die Gleichbehandlung zu gewährleisten. D<strong>am</strong>it ist unter<br />
an<strong>der</strong>em auch die Dienstleistungsfreiheit geme<strong>in</strong>t, so dass die<br />
Dienstleistungserbr<strong>in</strong>ger das Recht haben, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em an<strong>der</strong>en<br />
Vertragsstaat Dienstleistungen zu erbr<strong>in</strong>gen, <strong>der</strong>en tatsächliche<br />
Dauer 90 Tage pro Kalen<strong>der</strong>jahr nicht überschreitet 11 .<br />
Um Erwerbstätige <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> vor dem Risiko von Sozialund<br />
Lohndump<strong>in</strong>g, welches mit <strong>der</strong> E<strong>in</strong>führung des freien<br />
Personalverkehrs zwischen <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> und <strong>der</strong> Europäischen<br />
Union e<strong>in</strong>treten konnte, zu schützen, wurden <strong>am</strong> 1. 6.<br />
2004 so genannte „flankierende Maßnahmen“ <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Schweiz</strong> e<strong>in</strong>geführt 12 . Unter flankierenden Maßnahmen versteht<br />
man zum Teil gesetzliche, zum Teil <strong>in</strong>stitutionelle Vornahmen,<br />
die dazu dienen, die E<strong>in</strong>haltung <strong>der</strong> schweizerischen<br />
Arbeits- und Lohnbed<strong>in</strong>gungen abzusichern, so dass ke<strong>in</strong><br />
Lohn- und Sozialdump<strong>in</strong>g entstehen kann. Die <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong><br />
geltenden Lohn- und Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen müssen demnach<br />
von allen Erwerbstätigen und Arbeitgebern e<strong>in</strong>gehalten werden<br />
13 .<br />
Wer <strong>in</strong> die <strong>Schweiz</strong> legal Arbeitnehmer entsenden will, muss<br />
diese flankierenden Maßnahmen kennen und e<strong>in</strong>halten.<br />
Dreh- und Angelpunkt <strong>der</strong> flankierenden Maßnahmen s<strong>in</strong>d<br />
die Regelungen des Entsendegesetzes (EntsG) und <strong>der</strong> Entsendeverordnung<br />
(EntsV). Zu beachten ist, dass sich die flankierenden<br />
Maßnahmen stets an dem Freizügigkeitsabkommen<br />
und mittelbar an <strong>der</strong> Rechtsprechung des EuGH messen<br />
lassen müssen. Die Vertragsparteien haben sich im Freizügigkeitsabkommen<br />
gerade verpflichtet, ke<strong>in</strong>e neuen Beschränkungen<br />
für Staatsangehörige <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Vertragsparteien<br />
e<strong>in</strong>zuführen (Art. 13 FZA). Flankierende Maßnahmen dürfen<br />
daher nicht zu e<strong>in</strong>er Abschottung und Benachteiligung ausländischer<br />
Betriebe führen.<br />
Die EuGH-Rechtsprechung wirkt durch Art. 16 FZA auf das<br />
Abkommen durch. Gemäß Art. 16 II FZA ist die e<strong>in</strong>schlägige<br />
Rechtsprechung des EuGH vor dem Zeitpunkt <strong>der</strong> Unterzeichnung<br />
zu berücksichtigen, also bis zum 21. 6. 1999. Über<br />
die Rechtsprechung nach dem Zeitpunkt <strong>der</strong> Unterzeichnung<br />
des Abkommens muss die <strong>Schweiz</strong> unterrichtet werden. Da<br />
aber gem. Art. 16 I FZA die Vertragsparteien gleiche Rechte<br />
und Pflichten herstellen wollen, wird es bei e<strong>in</strong>er Fernwirkung<br />
<strong>der</strong> EuGH-Rechtsprechung auch bei den Entscheidungen<br />
nach dem 21. 6. 1999 bleiben, die die Themengebiete <strong>der</strong><br />
Abkommen betreffen.<br />
II. Aufenthaltsrecht<br />
Gemäß Art. 5 I FZA i. V. mit Art. 17 FZA Anhang I wird<br />
e<strong>in</strong>em Dienstleistungsbr<strong>in</strong>ger das Recht e<strong>in</strong>geräumt, Dienstleistungen<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> bis zu 90 Arbeitstage lang ohne<br />
Beschränkung zu erbr<strong>in</strong>gen. Hierfür benötigt <strong>der</strong> ausländische<br />
Unternehmer ke<strong>in</strong>e Aufenthaltserlaubnis (Art. 20 I<br />
FZA Anhang I), son<strong>der</strong>n muss alle<strong>in</strong> die entsandten Personen<br />
anmelden. Diese Regelung weicht vom Grundsatz des Art. 11<br />
AuG ab, wonach Auslän<strong>der</strong>, die <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> e<strong>in</strong>e Erwerbstätigkeit<br />
ausüben wollen, unabhängig von <strong>der</strong> Aufenthaltsdauer<br />
e<strong>in</strong>e Bewilligung benötigen. Bewilligungspflichtig s<strong>in</strong>d<br />
somit sämtliche Dienstleistungserbr<strong>in</strong>gungen, die länger als<br />
90 Arbeitstage o<strong>der</strong> drei Monate im Kalen<strong>der</strong>jahr dauern,<br />
denn Dienstleistungen über 90 Arbeitstage fallen nicht <strong>in</strong> den<br />
Geltungsbereich des Freizügigkeitsabkommens 14 .<br />
Die E<strong>in</strong>führung <strong>der</strong> E<strong>in</strong>reise durch bloße Meldung hat die<br />
<strong>Schweiz</strong> für ausländische Unternehmer deutlich attraktiver<br />
gemacht. Das Meldeverfahren kann kostenlos und schnell im<br />
Internet auf <strong>der</strong> Seite des Bundes<strong>am</strong>tes für Migration vorgenommen<br />
werden 15 . Der Arbeitsaufnahme <strong>in</strong> die <strong>Schweiz</strong><br />
geht also alle<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Meldung voraus. Vor Beg<strong>in</strong>n des Arbeitse<strong>in</strong>satzes<br />
muss <strong>der</strong> Arbeitgeber gem. Art. 6 I EntsG die entsandten<br />
Personen, die ausgeübte Tätigkeit sowie den Arbeitsort<br />
anmelden. Nach Art. 6 III EntsG darf die Arbeit frühestens<br />
acht Tage, nachdem <strong>der</strong> E<strong>in</strong>satz gemeldet wurde, aufgenommen<br />
werden. Art. 6 I EntsV regelt, dass das<br />
Meldeverfahren und auch die dort aufgeführte Acht-Tagefrist<br />
für alle <strong>Arbeiten</strong> obligatorisch ist, die länger als acht Tage<br />
pro Kalen<strong>der</strong>jahr dauern. Bei mehreren E<strong>in</strong>sätzen im Kalen<strong>der</strong>jahr<br />
s<strong>in</strong>d die Tage zus<strong>am</strong>menzuzählen 16 . <strong>Arbeiten</strong>, die<br />
weniger als acht Tage dauern, bedürfen daher nicht e<strong>in</strong>er<br />
solchen Meldung.<br />
Bei bestimmten Tätigkeiten, unter an<strong>der</strong>em im Bauhauptund<br />
Baunebengewerbe, hat allerd<strong>in</strong>gs die Meldung immer<br />
unabhängig von <strong>der</strong> Dauer <strong>der</strong> <strong>Arbeiten</strong> zu erfolgen. Die<br />
Acht-Tagefrist ist daher selbst bei e<strong>in</strong>em Arbeitstag <strong>in</strong> diesen<br />
Branchen e<strong>in</strong>zuhalten. In <strong>der</strong> Praxis entpuppte sich diese<br />
Acht-Tagefrist als Handelshemmnis. Unternehmer beklagen<br />
immer wie<strong>der</strong>, dass sie kurzfristige <strong>Arbeiten</strong> nicht durchführen<br />
könnten und daher gegenüber ihren schweizerischen Mitbewerbern<br />
benachteiligt wären. Die <strong>Schweiz</strong> entgegnet, dass<br />
sie mit <strong>der</strong> Regelung <strong>in</strong> Art. 6 III EntsV e<strong>in</strong>en ausreichenden<br />
Dispens formuliert habe. Dort heißt es, dass <strong>in</strong> Notfällen, wie<br />
Reparaturen, Unfällen, Naturkatastrophen o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en<br />
nicht vorhersehbaren Ereignissen, die Arbeit ausnahmsweise<br />
auch vor Ablauf <strong>der</strong> achttägigen Frist beg<strong>in</strong>nen kann, frühestens<br />
jedoch <strong>am</strong> Tag <strong>der</strong> Meldung. Die Geltendmachung e<strong>in</strong>es<br />
Notfalls wird von den kantonalen Behörden unter kumulativer<br />
Erfüllung, <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e folgen<strong>der</strong> Bed<strong>in</strong>gungen anerkannt:<br />
<strong>der</strong> Arbeitse<strong>in</strong>satz dient <strong>der</strong> Behebung e<strong>in</strong>es unvorhersehbaren<br />
e<strong>in</strong>getretenen Schadens und hat zum Ziel, weiteren<br />
Schaden zu verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n 17 . Außerdem muss <strong>der</strong> Arbeitse<strong>in</strong>satz<br />
unverzüglich erfolgen, das heißt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel<br />
spätestens drei Kalen<strong>der</strong>tage nach E<strong>in</strong>tritt des Schadens 18 .<br />
Gleichwohl bleibt es bei e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>direkten Benachteiligung, da<br />
<strong>der</strong> Dispens gerade nur beson<strong>der</strong>e und ungewöhnliche Ausnahmen<br />
regelt. In e<strong>in</strong>er gleichen, diskrim<strong>in</strong>ierungsfreien Regelung<br />
müsste e<strong>in</strong> ausländischer Betrieb genauso schnell se<strong>in</strong>e<br />
Arbeit <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> verrichten können wie e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>heimischer<br />
Unternehmer. Der Dispens wäre somit gar nicht<br />
notwendig. Zielsetzung des Abkommens ist gerade die E<strong>in</strong>räumung<br />
<strong>der</strong> gleichen Beschäftigungs- und Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen<br />
19 . In dieser Regelung kann man daher e<strong>in</strong>en Verstoß<br />
gegen Art. 2 FZA erkennen. Nach Art. 2 FZA dürfen Auslän<strong>der</strong><br />
nicht auf Grund ihrer Staatsangehörigkeit diskrim<strong>in</strong>iert<br />
werden. E<strong>in</strong>e solche Diskrim<strong>in</strong>ierung liegt aber auf<br />
Grund <strong>der</strong> grundsätzlich zw<strong>in</strong>genden langen Meldefrist für<br />
Auslän<strong>der</strong> vor. Es bleibt abzuwarten, ob sich <strong>der</strong> gem.<br />
Art. 14 I FZA zuständige „Gemischte Ausschuss“, <strong>der</strong> für die<br />
Verwaltung und ordnungsgemäße Anwendung des Freizügig-<br />
11 Kahil-Wolff/Mosters, EuZW 2001, 5 (8).<br />
12 Seco, Kommentar Flankierende Massnahmen zur Personenfreizügigkeit,<br />
1. Aufl. (2008), Vorb., S. 7.<br />
13 EDA/EVD, Die Bilateralen Abkommen <strong>Schweiz</strong> – Europäische Union,<br />
S. 23.<br />
14 Seco (o. Fußn. 12), Art. 6 EntsG, S. 25.<br />
15 www.bfm.adm<strong>in</strong>.ch; dort unter: Themen/Freier Personenverkehr/Meldeverfahren.<br />
16 Seco (o. Fußn. 12), Art. 6 EntsG, S. 28.<br />
17 Seco, Ergänzungen und Präzisierungen <strong>der</strong> VEP-Weisungen (April<br />
2009), S. 3.<br />
18 Seco, Ergänzungen und Präzisierungen <strong>der</strong> VEP-Weisungen (April<br />
2009), S. 3.<br />
19 EuGH, Urt. v. 22. 12. 2008 – C-13/08, BeckRS 2009, 70001 – St<strong>am</strong>m<br />
und Hauser.
Zimmermann, <strong>Arbeiten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> <strong>am</strong> <strong>Beispiel</strong> <strong>der</strong> <strong>Bauwirtschaft</strong> NZA Onl<strong>in</strong>e Aufsatz 3/2009 3<br />
keitsabkommens zuständig ist, dieser Angelegenheit annimmt.<br />
III. Arbeitsrecht<br />
Um Lohn- und Sozialdump<strong>in</strong>g zu verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n, wurde mit dem<br />
Entsendegesetz e<strong>in</strong> Gesetz verabschiedet, das <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e<br />
die m<strong>in</strong>imalen Arbeits- und Lohnbed<strong>in</strong>gungen für aus dem<br />
Ausland <strong>in</strong> die <strong>Schweiz</strong> entsandte Arbeitnehmer regelt. E<strong>in</strong>zuhalten<br />
s<strong>in</strong>d für ausländische Arbeitgeber gem. Art. 2 I<br />
EntsG die m<strong>in</strong>imale Entlohnung, die Arbeits- und Ruhezeit,<br />
M<strong>in</strong>destdauer <strong>der</strong> Ferien, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz<br />
<strong>am</strong> Arbeitsplatz, Schutz von Schwangeren, Wöchner<strong>in</strong>nen,<br />
K<strong>in</strong><strong>der</strong>n und Jugendlichen sowie die Nichtdiskrim<strong>in</strong>ierung.<br />
Ausländische Arbeitgeber <strong>der</strong> entsandten Arbeiter<br />
müssen dabei m<strong>in</strong>destens die Arbeits- und Lohnbed<strong>in</strong>gungen<br />
garantieren, die <strong>in</strong> Bundesgesetzen, Verordnungen des Bundesrates,<br />
allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlich erklärten Ges<strong>am</strong>tarbeitsverträgen<br />
und Normalarbeitsverträgen vorgeschrieben s<strong>in</strong>d.<br />
Diese Regelung deckt sich mit <strong>der</strong> Rechtsprechung des<br />
EuGH, die zu den Grundfreiheiten auf das Verhältnis zwischen<br />
<strong>der</strong> EU und <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> übertragen wird 20 . Der<br />
EuGH 21 hat auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er aktuellen Entscheidung nochmals<br />
hervorgehoben, dass es unter bestimmten Umständen gestattet<br />
ist, Tarifverträge auf alle Personen, also auch auf entsandte<br />
Arbeitnehmer, zu erstrecken. Die zw<strong>in</strong>gende Anwendung<br />
<strong>der</strong> Arbeits- und Lohnbed<strong>in</strong>gungen auf entsandte Arbeitnehmer<br />
verstößt daher vom Pr<strong>in</strong>zip her nicht gegen das Freizügigkeitsabkommen.<br />
1. Allgeme<strong>in</strong>es<br />
Gemäß Art. 2 I EntsG müssen die Arbeitgeber den entsandten<br />
Arbeitnehmern m<strong>in</strong>destens die Arbeits- und Lohnbed<strong>in</strong>gungen<br />
garantieren, die <strong>in</strong> Bundesgesetzen, Verordnungen<br />
des Bundesrates, allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlich erklärten Ges<strong>am</strong>tarbeitsverträgen<br />
und Normalarbeitsverträgen i. S. des<br />
Art. 360 a OR <strong>in</strong> bestimmten Bereichen vorgeschrieben s<strong>in</strong>d.<br />
Durch den Ges<strong>am</strong>tarbeitsvertrag stellen Arbeitgeber o<strong>der</strong> <strong>der</strong>en<br />
Verbände und Arbeitnehmerverbände gem. Art. 356 I<br />
OR geme<strong>in</strong>s<strong>am</strong>e Bestimmungen über Abschluss, Inhalt und<br />
Beendigung <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen Arbeitsverhältnisse <strong>der</strong> beteiligten<br />
Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf. Wenn ke<strong>in</strong> Ges<strong>am</strong>tarbeitsvertrag<br />
vorliegt, kann unter bestimmten Bed<strong>in</strong>gungen<br />
e<strong>in</strong> so genannter Normalarbeitsvertrag gem. Art. 360 a OR<br />
erlassen werden, <strong>der</strong> nach Regionen und gegebenenfalls Orten<br />
differenzierte M<strong>in</strong>destlöhne vorsieht.<br />
In vielen Branchen wurden Ges<strong>am</strong>tarbeitsverträge (GAV) geschlossen<br />
22 , die deutschen Tarifverträgen vergleichbar s<strong>in</strong>d.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs f<strong>in</strong>den die Ges<strong>am</strong>tarbeitsverträge nur dann für<br />
ausländische Betriebe Anwendung, wenn sie allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlich<br />
erklärt werden. Durch die Allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlicherklärung<br />
gilt <strong>der</strong> GAV bzw. die allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlich erklärten<br />
Passagen e<strong>in</strong>es GAVs für alle Betriebe und nach Art. 2 I<br />
EntsG auch für die ausländischen Unternehmen. Die Allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlicherklärung<br />
wird auf Antrag aller betroffenen<br />
Tarifvertragsparteien durch e<strong>in</strong>e zuständige Behörde ausgestellt.<br />
Der Allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlicherklärung geht e<strong>in</strong>e umfangreiche<br />
Prüfung voraus, die im Bundesgesetz über die Allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlicherklärung<br />
von Ges<strong>am</strong>tarbeitsverträgen<br />
geregelt ist.<br />
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hat im Internet<br />
alle allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlich erklärten Ges<strong>am</strong>tarbeitsverträge abrufbar<br />
aufgeführt 23 .<br />
Häufig kommt es dabei vor, dass nicht sämtliche Normen des<br />
Ges<strong>am</strong>tarbeitsvertrags allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlich erklärt wurden,<br />
son<strong>der</strong>n nur e<strong>in</strong>zelne Artikel. Der GAV für das Schre<strong>in</strong>ergewerbe<br />
beg<strong>in</strong>nt daher erst mit Art. 5, da die Art. 1 bis 4<br />
gerade nicht allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlich erklärt wurden. Beim GAV<br />
für das Bauhauptgewerbe, <strong>der</strong> aus historischen Gründen Landesmantelvertrag<br />
(LMV) genannt wird, s<strong>in</strong>d die allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlich<br />
erklärten Regelungen optisch fett gedruckt. So<br />
kommt es dort vor, dass z. B. <strong>in</strong> Art. 52 LMV über die Lohnzuschläge<br />
die Absätze 1 und 3 fett gedruckt s<strong>in</strong>d, mith<strong>in</strong> als<br />
allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlich auch für Auslän<strong>der</strong> gelten, Absatz 2<br />
aber nicht und somit ke<strong>in</strong>e Anwendung für Auslän<strong>der</strong> f<strong>in</strong>det.<br />
Ausländische Betriebe müssen also nur dann e<strong>in</strong>en Ges<strong>am</strong>tarbeitsvertrag<br />
e<strong>in</strong>halten, wenn dieser allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlich<br />
erklärt ist und auch dann nur die speziell allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlich<br />
erklärten Normen.<br />
H<strong>in</strong>zu tritt, dass es regionale Unterschiede geben kann, die<br />
stets zu berücksichtigen s<strong>in</strong>d. Für das Gipsergewerbe im Kanton<br />
Basel-Land z. B. gibt es e<strong>in</strong>en eigenen GAV, <strong>der</strong> von dem<br />
GAV für das Gipsergewerbe <strong>in</strong> Basel-Stadt abweicht. Der<br />
ausländische Unternehmer schuldet dort natürlich auch unterschiedliche<br />
M<strong>in</strong>destlöhne. Es ist daher unablässig für e<strong>in</strong>en<br />
Unternehmer vorab zu prüfen, <strong>in</strong> welchem Kanton das Bauvorhaben<br />
stattf<strong>in</strong>det, sodass er untersuchen kann, welchen<br />
M<strong>in</strong>destlohn er se<strong>in</strong>en Mitarbeitern <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> schuldet<br />
und welche Normen Anwendung f<strong>in</strong>den.<br />
Beim Abruf e<strong>in</strong>es Tarifvertrags ist zu beachten, dass jedem<br />
allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlich erklärten Tarifvertrag noch <strong>der</strong> Allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlichkeitsbeschluss<br />
vorsteht. Dieser Beschluss<br />
ist deshalb für Arbeitgeber <strong>in</strong>teressant, da <strong>in</strong> ihm meist die<br />
sachliche und örtliche Zuständigkeit des Tarifvertrags geregelt<br />
wird. In Art. 2 I AVE-Beschluss des LMV f<strong>in</strong>det man<br />
die Kantone aufgeführt, <strong>in</strong> denen <strong>der</strong> LMV Anwendung f<strong>in</strong>det.<br />
In Art. 2 IV AVE-Beschluss des LMV ist festgehalten,<br />
dass <strong>der</strong> LMV z. B. auf Poliere o<strong>der</strong> das kaufmännische Personal<br />
ke<strong>in</strong>e Anwendung f<strong>in</strong>det. Bei mehreren konkurrierenden<br />
Ges<strong>am</strong>tarbeitsverträgen soll das Pr<strong>in</strong>zip <strong>der</strong> Tarife<strong>in</strong>heit<br />
Anwendung f<strong>in</strong>den, so dass e<strong>in</strong> GAV alle Mitarbeiter e<strong>in</strong>es<br />
Betriebs erfasst 24 .<br />
2. M<strong>in</strong>destlohn<br />
In <strong>der</strong> Praxis als wichtigste, aber sicherlich auch schwierigste<br />
Verpflichtung hat sich die Zahlung des schweizerischen M<strong>in</strong>destlohns<br />
herausgestellt. Die M<strong>in</strong>destvorschriften für die Entlohnung<br />
und für die Ferien gelten gem. Art. 4 EntsG nicht für<br />
<strong>Arbeiten</strong> von ger<strong>in</strong>gem Umfang. Ebenfalls nicht umfasst s<strong>in</strong>d<br />
Montagearbeiten o<strong>der</strong> <strong>der</strong> erstmalige E<strong>in</strong>bau, wenn die <strong>Arbeiten</strong><br />
weniger als acht Tage dauern und Bestandteil e<strong>in</strong>es<br />
Warenlieferungsvertrags bilden. <strong>Arbeiten</strong> ger<strong>in</strong>gen Umfangs<br />
s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Art. 3 EntsV def<strong>in</strong>iert: Dies s<strong>in</strong>d <strong>Arbeiten</strong>, die pro<br />
Kalen<strong>der</strong>jahr maximal 15 Arbeitstage dauern.<br />
Ausgenommen von diesem Dispens s<strong>in</strong>d aber das Bauhauptund<br />
das Baunebengewerbe sowie das Hotel- und Gastgewerbe.<br />
Für diese Branchen s<strong>in</strong>d somit alle Bestimmungen des<br />
Entsendegesetzes anzuwenden (Ausnahme von <strong>der</strong> Ausnahme)<br />
25 . In Art. 5 EntsV s<strong>in</strong>d die Tätigkeiten aufgeführt, die<br />
darunter fallen. Dazu zählen unter an<strong>der</strong>em Aushubarbeiten,<br />
20 Weigell, IStR 2006, 190 (193).<br />
21 EuGH (19. 6. 2008), NZA 2008, 865 (868) – Kommission/Luxemburg.<br />
22 615 GAV für rund 1,7 Mio. Arbeitnehmer (ca. 40%); s. swiss<strong>in</strong>fo.ch<br />
vom 27. 3. 2009.<br />
23 www.seco.adm<strong>in</strong>.ch dort: Arbeit/Arbeitsrecht/Ges<strong>am</strong>tarbeitsverträge<br />
Bund<br />
24 Emmel, NZZ v. 6. 9. 2006, Dossiers.<br />
25 Seco (o. Fußn. 12), Art. 4 EntsG, S. 21.
4 NZA Onl<strong>in</strong>e Aufsatz 3/2009 Zimmermann, <strong>Arbeiten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> <strong>am</strong> <strong>Beispiel</strong> <strong>der</strong> <strong>Bauwirtschaft</strong><br />
Erdarbeiten, aber auch Renovierungen, Reparaturen o<strong>der</strong><br />
Wartungen. Betriebe des Metallgewerbes, des Schre<strong>in</strong>ergewerbes<br />
sowie des Marmor- und Granitgewerbes, die nicht<br />
ganz o<strong>der</strong> teilweise <strong>Arbeiten</strong> auf Baustellen bzw. an Gebäuden<br />
o<strong>der</strong> <strong>der</strong>en Umgebung ausführen, fallen nicht unter das<br />
Baunebengewerbe 26 .<br />
Der M<strong>in</strong>destlohn variiert von Branche zu Branche und zum<br />
Teil von Kanton zu Kanton 27 . E<strong>in</strong> Vorarbeiter des Bauhauptgewerbes<br />
<strong>in</strong> Basel-Land erhält 35,35 CHF/h, im Tess<strong>in</strong> aber<br />
nur 32,45 CHF/h. In an<strong>der</strong>en Gewerken wird noch nach<br />
Erfahrungsjahren o<strong>der</strong> Lebensalter unterschieden.<br />
Wichtig ist, dass <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> gem. Art. 1 lit. a EntsV <strong>der</strong><br />
M<strong>in</strong>destlohn entsprechend <strong>der</strong> erworbenen Qualifikation gezahlt<br />
wird. Das heißt, dass e<strong>in</strong> Vorarbeiter, <strong>der</strong> auf <strong>der</strong> Baustelle<br />
ausschließlich Hilfstätigkeiten als Helfer ausführt, trotzdem<br />
den Vorarbeiterlohn bekommt. Die Bezahlung erfolgt<br />
folglich qualifikationsbezogen und nicht tätigkeitsbezogen.<br />
Zu beachten ist außerdem, dass die <strong>in</strong> den allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlich<br />
erklärten GAV enthaltenen M<strong>in</strong>destlöhne jeweils Bruttolöhne<br />
(vor Abzug <strong>der</strong> Arbeitnehmerbeiträge <strong>der</strong> Sozialversicherungen)<br />
s<strong>in</strong>d 28 .<br />
In <strong>der</strong> Regel s<strong>in</strong>d die schweizerischen M<strong>in</strong>destlöhne höher als<br />
z. B. die deutschen Löhne. Da auch die ausländischen Betriebe<br />
den schweizerischen M<strong>in</strong>destlohn zu zahlen haben, werden<br />
Lohnvergleiche zwischen dem gefor<strong>der</strong>ten M<strong>in</strong>destlohn<br />
(Soll) und dem tatsächlich bezahlten Lohn (Ist) geführt. Deutsche<br />
Arbeitgeber zahlen für die <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> geleisteten<br />
Stunden meist e<strong>in</strong>e Lohndifferenz, die auf <strong>der</strong> Lohnabrechnung<br />
als „Auslandszulage“ o<strong>der</strong> „<strong>Schweiz</strong>zuschlag“ geführt<br />
wird, um den verlangten M<strong>in</strong>destlohn e<strong>in</strong>zuhalten. Werden<br />
also 15 Euro/h gezahlt, s<strong>in</strong>d aber 17 Euro/h als M<strong>in</strong>destlohn<br />
geschuldet, werden 2 Euro/h als Zulage gezahlt. Beim Lohnvergleich<br />
ist dann <strong>der</strong> M<strong>in</strong>destlohn e<strong>in</strong>gehalten.<br />
Problematisch beim Lohnvergleich s<strong>in</strong>d die unterschiedlichen<br />
Beiträge <strong>in</strong> die Sozialversicherung. Insbeson<strong>der</strong>e deutsche<br />
und österreichische Arbeitgeber führen beim Lohnvergleich<br />
an, dass ihre Beitragszahlungen <strong>in</strong> die Sozialversicherung als<br />
Lohnzuschlag berücksichtigt und zusätzlich auf den Lohn<br />
angerechnet werden müssten.<br />
Das Seco hatte <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Weisung vom 20. 2. 2007 die unterschiedlichen<br />
Beiträge <strong>in</strong> die Krankenversicherung als Lohnbestandteil<br />
akzeptiert 29 . In <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> besteht ke<strong>in</strong>e gesetzliche<br />
Verpflichtung des Arbeitgebers, sich an den Beiträgen für<br />
die Krankenversicherung des Arbeitnehmers zu beteiligen.<br />
Da <strong>in</strong> Deutschland e<strong>in</strong>e solidarische F<strong>in</strong>anzierung besteht,<br />
nahm das Seco die Arbeitgeberzahlungen als <strong>in</strong>direkte Lohnzahlung<br />
an. Pauschal wurde e<strong>in</strong> Wert von 7,4% als Lohnzuschlag<br />
angenommen. Bei e<strong>in</strong>er Zahlung von 10 Euro/h<br />
wurde dies wie e<strong>in</strong>e Zahlung von 10,74 Euro/h gewertet.<br />
Diese Regelung wurde von vielen schweizerischen Institutionen<br />
kritisiert. Zudem weigerten sich bestimmte Kontrollorgane<br />
die Weisung umzusetzen, da das Seco nicht weisungsbefugt<br />
sei. Mit Weisung vom 11. 11. 2008 nahm das Seco<br />
se<strong>in</strong>e frühere Weisung zurück und stellte nun fest, dass die<br />
Krankenversicherungsbeiträge nicht weiter zu berücksichtigen<br />
s<strong>in</strong>d 30 . Somit werden die unterschiedlichen Sozialversicherungsbeiträge<br />
bei e<strong>in</strong>em Lohnvergleich nicht weiter mit<br />
e<strong>in</strong>fließen.<br />
Die Rücknahme <strong>der</strong> Weisung ist rechtlich nicht haltbar: Arbeitgeberzahlungen<br />
<strong>in</strong> die Sozialversicherung kommen auch<br />
dem Arbeitnehmer zugute. Es ist nicht e<strong>in</strong>zusehen, warum<br />
diese Zahlungen nicht auch als <strong>in</strong>direkte Lohnzahlung bei<br />
e<strong>in</strong>em Lohnvergleich berücksichtigt werden. Vielmehr ist die<br />
bloße Betrachtung des Lohns gegenüber Unternehmen aus<br />
Staaten mit hohen Sozialversicherungsbeiträgen diskrim<strong>in</strong>ierend.<br />
Der tatsächliche Lohnaufwand des Arbeitgebers ist um<br />
e<strong>in</strong> Vielfaches höher als <strong>der</strong> Bruttolohn. <strong>Schweiz</strong>erische Arbeitgeber<br />
mit hohen Löhnen und niedrigeren Sozialversicherungsbeiträgen<br />
werden dadurch bevorzugt. Die Krankenversicherungskosten,<br />
die <strong>der</strong> deutsche Arbeitgeber zur Hälfte<br />
trägt, muss <strong>der</strong> schweizerische Arbeitnehmer vollständig<br />
selbst begleichen. Somit s<strong>in</strong>d die Zahlungen <strong>in</strong> die Krankenversicherungen<br />
wie Lohnzahlungen anzusehen. Zielführend<br />
wären hier bilaterale Verträge zwischen Deutschland und <strong>der</strong><br />
<strong>Schweiz</strong>, bei denen beide Staaten den jeweiligen M<strong>in</strong>destlohn<br />
des an<strong>der</strong>en Staates pauschal als ausreichend akzeptierten, so<br />
dass e<strong>in</strong> Lohnvergleich gar nicht vorgenommen werden muss.<br />
Der jetzt vorgenommene Weg bevorzugt e<strong>in</strong>seitig die e<strong>in</strong>heimischen<br />
Arbeitgeber und wird den unterschiedlichen Sozialversicherungssystemen<br />
nicht gerecht. Durchgesetzt hat sich<br />
weitgehend, dass bestimmte Zahlungen, wie vermögenswirks<strong>am</strong>e<br />
Leistungen, Mehraufwandsw<strong>in</strong>tergeld o<strong>der</strong> Spesenzahlungen<br />
auch auf den Lohn als Zuschlag berücksichtigt und<br />
angerechnet werden.<br />
3. 13. Monatsgehalt<br />
Obligatorisch ist <strong>in</strong> den Ges<strong>am</strong>tarbeitsverträgen die Zahlung<br />
e<strong>in</strong>es vollständigen 13. Monatsgehalts. Auch diese Regelungen<br />
s<strong>in</strong>d meist allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlich erklärt und werden gem.<br />
Art. 1 lit. e EntsV von ausländischen Betrieben geschuldet. Es<br />
reicht folglich nicht aus, alle<strong>in</strong> den schweizerischen M<strong>in</strong>destlohn<br />
zu zahlen. Häufige Verfehlungen stellen deshalb die<br />
Nichtbeachtung des 13. Monatsgehalts dar. Das 13. Monatsgehalt<br />
muss dabei lediglich anteilig („pro rata“) bezahlt werden.<br />
Dies beträgt 8,33% (z. B. Art. 31 III GAV Holzbau)<br />
bzw. 8,3% (z.B. Art. 50 II LMV). Mittlerweile werden Urlaubs-<br />
und Weihnachtsgeld als Gegenstück zum 13. Monatsgehalt<br />
anerkannt und entsprechend angerechnet 31 .<br />
4. Ferienlohn und Feiertagsentschädigung<br />
Gemäß Art. 329 a I OR hat <strong>der</strong> Arbeitgeber dem Arbeitnehmer<br />
für jedes Dienstjahr wenigstens vier Wochen, dem Arbeitnehmer<br />
bis zum vollendeten 20. Altersjahr wenigstens<br />
fünf Wochen Ferien zu gewähren. Üblich s<strong>in</strong>d 25 Arbeitstage<br />
(z. B. Art. 34 I LMV). Die Feiertage s<strong>in</strong>d kantonal unterschiedlich<br />
geregelt. Die Ges<strong>am</strong>tarbeitsverträge haben häufig<br />
eigene Regelungen bezüglich <strong>der</strong> Feriendauer. Im Allgeme<strong>in</strong>en<br />
bekommen deutsche Arbeitnehmer mehr Urlaub und<br />
haben mehr Feiertage. Dies macht sich bei <strong>der</strong> Berechnung<br />
und dem Vergleich des Ferien- und Feiertagslohns bemerkbar.<br />
Für die Berechnung und den Vergleich des Ferienlohns und<br />
<strong>der</strong> Feiertagsentschädigung, die gem. Art. 1 lit. d und lit. f<br />
EntsV zu zahlen s<strong>in</strong>d, hat das Seco e<strong>in</strong>e Tabelle herausgegeben<br />
32 . Für jeden Ferien- o<strong>der</strong> Feiertag gibt es e<strong>in</strong>e entsprechende<br />
Prozentangabe, die vom Arbeitgeber zu begleichen<br />
ist.<br />
5. Arbeits- und Ruhezeit<br />
Generelles zur Arbeitszeit ist im Bundesgesetz über die Arbeit<br />
<strong>in</strong> Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz, ArG) ge-<br />
26 Seco (o. Fußn. 12), Art. 4 EntsG, S. 21 (Fußn. 11).<br />
27 Seit Juni 2009 gibt es e<strong>in</strong>en Lohnrechner auf www.entsendung.ch (dort<br />
unter: Lohn und Arbeit).<br />
28 Seco (o. Fußn. 12), Art. 1 EntsG, S. 15.<br />
29 Seco, Weisung v. 20. 2. 2007, S. 4 f.<br />
30 Seco, Weisung v. 11. 11. 2008, S. 9.<br />
31 Seco, Weisung v. 11. 11. 2008, S. 8 f.<br />
32 Seco, Weisung v. 11. 11. 2008, S. 6 f.
Zimmermann, <strong>Arbeiten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> <strong>am</strong> <strong>Beispiel</strong> <strong>der</strong> <strong>Bauwirtschaft</strong> NZA Onl<strong>in</strong>e Aufsatz 3/2009 5<br />
regelt. Gemäß Art. 9 I lit. a ArG beträgt die wöchentliche<br />
Höchstarbeitszeit 45 Stunden für Arbeitnehmer <strong>in</strong> <strong>in</strong>dustriellen<br />
Betrieben sowie für Büropersonal, technische und an<strong>der</strong>e<br />
Angestellte mit E<strong>in</strong>schluss des Verkaufspersonals <strong>in</strong> Großbetrieben<br />
des Detailhandels; 50 Stunden beträgt die Höchstarbeitszeit<br />
für übrige Arbeitnehmer. Ebenfalls im Arbeitsgesetz<br />
s<strong>in</strong>d Ausführungen zu Überstunden aufgeführt. Viele<br />
Ges<strong>am</strong>tarbeitsverträge haben allerd<strong>in</strong>gs eigene Regelungen<br />
zur Arbeitszeit. Im Bauhauptgewerbe beträgt z. B. die<br />
Höchstarbeitszeit 45 Stunden <strong>in</strong> <strong>der</strong> Woche (Art. 25 II lit. b<br />
LMV). Die Arbeit ist durch Pausen zu unterbrechen. Bei e<strong>in</strong>er<br />
täglichen Arbeitszeit von mehr als sieben Stunden beträgt die<br />
M<strong>in</strong>destdauer <strong>der</strong> Pause e<strong>in</strong>e halbe Stunde, bei e<strong>in</strong>er täglichen<br />
Arbeitszeit von mehr als neun Stunden e<strong>in</strong>e Stunde (Art. 15 I<br />
ArG). Die Pausen gelten dann als Arbeitszeit, wenn die Arbeitnehmer<br />
ihren Arbeitsplatz nicht verlassen dürfen (Art. 15<br />
II ArG). Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel<br />
die Pausen nicht mit dem schweizerischen M<strong>in</strong>destlohn zu<br />
vergüten s<strong>in</strong>d.<br />
6. Überstundenzuschläge, Nachtzuschläge<br />
Gemäß Art. 10 I ArbG gilt die Arbeit von 6 Uhr bis 20 Uhr<br />
als Tagesarbeit, die Arbeit von 20 Uhr bis 23 Uhr als Abendarbeit.<br />
Nachtarbeit und Sonntagsarbeit s<strong>in</strong>d grundsätzlich<br />
untersagt. Zu beachten ist, dass bei <strong>der</strong> Abendarbeit und bei<br />
<strong>der</strong> ausnahmsweise von <strong>der</strong> Behörde genehmigten Nachto<strong>der</strong><br />
Sonntagsarbeit e<strong>in</strong> entsprechen<strong>der</strong> Zuschlag zu bezahlen<br />
ist, <strong>der</strong> sich wie<strong>der</strong>um meist aus den Ges<strong>am</strong>tarbeitsverträgen<br />
ergibt. Für Überstunden ist im Bauhauptgewerbe gem.<br />
Art. 53 II LMV e<strong>in</strong> Zuschlag von 25%, bei Sonntagsarbeit<br />
sogar von 50% (Art. 56 LMV) zu zahlen. Es sei aber nochmals<br />
darauf h<strong>in</strong>gewiesen, dass Sonntagsarbeit grundsätzlich<br />
untersagt ist und Ausnahmen vom Verbot e<strong>in</strong>er Bewilligung<br />
bedürfen.<br />
7. Reisezeit<br />
Als e<strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Praxis großes Problem hat sich die Behandlung<br />
<strong>der</strong> Reisezeit herausgestellt. In Art. 13 I V1ArG ist festgehalten,<br />
dass <strong>der</strong> Weg zu und von <strong>der</strong> Arbeit nicht als Arbeitszeit<br />
gilt. Etwas an<strong>der</strong>es soll nur dann gelten, wenn die Arbeit<br />
außerhalb des Arbeitsortes zu leisten ist, an dem <strong>der</strong> Arbeitnehmer<br />
normalerweise se<strong>in</strong>e Arbeit verrichtet. In diesem Fall<br />
läge nach Art. 13 II V1ArG e<strong>in</strong>e vergütungspflichtige Reisezeit<br />
vor. Arbeitsort ist normalerweise <strong>der</strong> St<strong>am</strong>mbetrieb, <strong>der</strong><br />
Anstellungsort o<strong>der</strong> im Baugewerbe etwa <strong>der</strong> Werkhof 33 . Die<br />
vorliegende Bestimmung regelt aber alle<strong>in</strong> den Fall jenes Arbeitnehmers,<br />
<strong>der</strong> grundsätzlich e<strong>in</strong>en festen Arbeitsort hat<br />
und an<strong>der</strong>e E<strong>in</strong>satzorte aufsuchen muss 34 . Dies ist aber gerade<br />
<strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Bauwirtschaft</strong> problematisch, da die Arbeitnehmer<br />
von Baustelle zu Baustelle ziehen. Der Werk- o<strong>der</strong> Bauhof ist<br />
dort nicht <strong>der</strong> feste Arbeitsort, son<strong>der</strong>n die Baustelle. Nach<br />
<strong>der</strong> Auslegung dieser Regelung ist die Reisezeit <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Bauwirtschaft</strong><br />
nicht zu vergüten, sofern die Mitarbeiter nicht<br />
regelmäßig auf dem Bauhof arbeiten.<br />
Im LMV f<strong>in</strong>det sich aber für die Reisezeit e<strong>in</strong>e speziellere<br />
Regelung. Nach Art. 54 II LMV ist die Reiszeit dann mit dem<br />
Grundlohn zu vergüten, wenn die tägliche Reisezeit 30 M<strong>in</strong>uten<br />
übersteigt. Diese Regelung ist aber nicht allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlich<br />
erklärt, gilt also gerade nicht für ausländische Bauunternehmer.<br />
E<strong>in</strong>e schweizerische Kontrollstelle hat die<br />
Norm analog anwenden und dies d<strong>am</strong>it rechtfertigen wollen,<br />
dass ansonsten die e<strong>in</strong>heimischen schweizerischen Unternehmer<br />
schlechter stünden. In Konsequenz wurde dann die vollständige<br />
Reisezeit mit Verlassen des Bauhofs <strong>in</strong> Deutschland<br />
als vergütungspflichtige Zeit angesehen. Diese Ansicht fand<br />
aber auch <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> wenig Unterstützung. Zum e<strong>in</strong>en<br />
wi<strong>der</strong>spricht e<strong>in</strong>e Analogie <strong>der</strong> Regelung <strong>der</strong> Allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlichkeit.<br />
Könnte man durch e<strong>in</strong>e Analogie die nicht allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlich<br />
erklärten Regelungen praktisch h<strong>in</strong>terrücks<br />
doch allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlich machen, bedürfte es des<br />
komplizierten Allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlichkeitserklärungsverfahrens<br />
nicht weiter. Zum an<strong>der</strong>en kann das schweizerische<br />
Recht nicht auf deutschem Boden Anwendung f<strong>in</strong>den. Die<br />
schweizerischen Tarifverträge gelten bereits örtlich nicht <strong>in</strong><br />
Deutschland, so dass <strong>der</strong> schweizerische M<strong>in</strong>destlohn nicht<br />
schon <strong>in</strong> Deutschland geschuldet wird.<br />
Das Seco dürfte dieser Diskussion nun mit se<strong>in</strong>er Weisung<br />
vom 11. 11. 2008 e<strong>in</strong> Ende bereitet haben. Dort stellte das<br />
Seco fest, dass e<strong>in</strong> Lohnvergleich erst mit Grenzübertritt möglich<br />
ist, folglich <strong>der</strong> E<strong>in</strong>satz erst mit dem Grenzübergang<br />
beg<strong>in</strong>nt 35 . Die befremdliche Ansicht, dass <strong>der</strong> schweizerische<br />
M<strong>in</strong>destlohn bereits mit Verlassen des deutschen Bauhofs zu<br />
zahlen wäre, ist somit obsolet. Weiterh<strong>in</strong> ungeklärt ist freilich<br />
die Analogiefähigkeit nicht allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlich erklärter<br />
Regelungen.<br />
8. Auslösung<br />
E<strong>in</strong> ebenfalls wichtiger Bestandteil <strong>in</strong> den schweizerischen<br />
Tarifverträgen ist die Auslösung. Mittagessen o<strong>der</strong> Übernachtungskosten<br />
müssen vom Arbeitgeber bezahlt werden<br />
o<strong>der</strong> aber Unterkunft und Verpflegung gestellt werden. Werden<br />
Unterkunft o<strong>der</strong> Verpflegung vom Unternehmer gestellt,<br />
so sollte dieser alle Rechnungen, Belege und Quittungen sorgs<strong>am</strong><br />
aufbewahren, da er dies <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Kontrollverfahren<br />
gegebenenfalls nachzuweisen hat.<br />
9. Tagesrapporte<br />
Die Führung von Tagesrapporten ist <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> Pflicht.<br />
Auch <strong>in</strong> Deutschland besteht gem. § 2 II a AEntG z. B. für die<br />
<strong>Bauwirtschaft</strong> e<strong>in</strong>e Verpflichtung den Beg<strong>in</strong>n, das Ende und<br />
die Dauer <strong>der</strong> täglichen Arbeitszeit aufzuzeichnen. Während<br />
<strong>in</strong> Deutschland diese Vorschrift <strong>in</strong> <strong>der</strong> Praxis häufig nicht<br />
angewandt wird, auch weil es an entsprechenden Rechtsfolgen<br />
fehlt, werden <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> die Tagesrapporte bei Kontrollen<br />
regelmäßig verlangt und überprüft. Dabei rekurriert<br />
diese For<strong>der</strong>ung auf Art. 73 I ArgV1 i. V. mit Art. 46 ArG.<br />
Umstritten ist hier wie ausführlich diese Tagesrapporte zu<br />
führen s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong>zelne Kontrollstellen verlangen den Beg<strong>in</strong>n<br />
und das Ende <strong>der</strong> Arbeitszeit, sowie e<strong>in</strong>e genaue zeitliche<br />
Angabe, wann die Pausen lagen (Bsp.: 8-12 Uhr, 12-13 Uhr<br />
Pause, 13-17 Uhr). In Art. 73 I lit. c ArgV1 heißt es, dass aus<br />
den Unterlagen die geleistete tägliche und wöchentliche Arbeitszeit<br />
hervorgehen muss. Dieser Anfor<strong>der</strong>ung kommt me<strong>in</strong>es<br />
Erachtens aber schon <strong>der</strong> Unternehmer nach, wenn er auf<br />
den Tagesrapport als Zeitangabe „8 Stunden“ notiert, also<br />
nicht <strong>in</strong>dividuell den Anfang und das Ende. Gänzlich abzulehnen<br />
ist die For<strong>der</strong>ung, dass die Tagesrapporte unterschrieben<br />
se<strong>in</strong> müssen. E<strong>in</strong> solches Erfor<strong>der</strong>nis ist gesetzlich<br />
nicht geschuldet und – sofern e<strong>in</strong> GAV es nicht explizit verlangt<br />
– nicht notwendig.<br />
IV. Vollzug<br />
Die E<strong>in</strong>haltung des Entsen<strong>der</strong>echts wird <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> auf<br />
zwei Schultern getragen: Zum e<strong>in</strong>en gibt es die staatlichen<br />
kantonalen Arbeitsämter und zum an<strong>der</strong>en gibt es paritätische<br />
Kommissionen. Die paritätischen Kommissionen s<strong>in</strong>d<br />
E<strong>in</strong>richtungen <strong>der</strong> Tarifparteien und haben die Aufgabe die<br />
33 Seco, Wegleitung zur Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz, 4. Aufl. (2009),<br />
Art. 13 V 1 ArG, S. 113-1.<br />
34 Seco (o. Fußn. 33), S. 113-2.<br />
35 Seco, Weisung v. 11. 11. 2008, S. 3.
6 NZA Onl<strong>in</strong>e Aufsatz 3/2009 Zimmermann, <strong>Arbeiten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> <strong>am</strong> <strong>Beispiel</strong> <strong>der</strong> <strong>Bauwirtschaft</strong><br />
E<strong>in</strong>haltung <strong>der</strong> Ges<strong>am</strong>tarbeitsverträge zu überwachen. Im<br />
Bauhauptgewerbe s<strong>in</strong>d die lokalen paritätischen Kommissionen<br />
als Vere<strong>in</strong> gesellschaftsrechtlich organisiert (Art. 76 I<br />
LMV). Es handelt sich also um privatrechtliche Kontrollstellen.<br />
Der schweizerische Gesetzgeber hat aber diesen privatrechtlichen<br />
Kontrollstellen e<strong>in</strong>e sehr weit reichende Kontrollbefugnis<br />
e<strong>in</strong>geräumt. In Art. 7 I lit. a EntsG heißt es, dass die<br />
E<strong>in</strong>haltung <strong>der</strong> Anfor<strong>der</strong>ungen des Entsendegesetzes bezüglich<br />
<strong>der</strong> Bestimmungen e<strong>in</strong>es allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlich erklärten<br />
GAV den paritätischen Kommissionen e<strong>in</strong>geräumt wird. Wie<br />
weitreichend diese Regelung geht, lässt sich an Art. 7 II<br />
EntsG feststellen: Danach muss <strong>der</strong> Arbeitgeber den paritätischen<br />
Kommissionen auf Verlangen alle Dokumente zustellen,<br />
welche die E<strong>in</strong>haltung <strong>der</strong> Arbeits- und Lohnbed<strong>in</strong>gungen<br />
<strong>der</strong> entsandten Arbeitnehmer belegen.<br />
Freilich wenden die paritätischen Kommissionen <strong>in</strong> ganz unterschiedlicher<br />
Weise diese Bestimmung an. Während es bei<br />
e<strong>in</strong>igen Kontrollstellen ausreicht, die Tagesrapporte sowie die<br />
Lohn- und Gehaltsabrechnungen e<strong>in</strong>zureichen, verlangen an<strong>der</strong>e<br />
Kontrollstellen die Vorlage sämtlicher Arbeitsverträge<br />
und Qualifikationszeugnisse <strong>der</strong> Arbeitnehmer sowie <strong>der</strong><br />
Werkverträge. Insbeson<strong>der</strong>e diese weite Ausnutzung <strong>der</strong> Vorlagepflicht<br />
macht deutschen Bauunternehmern zu schaffen.<br />
Zum e<strong>in</strong>en bestehen bei vielen Betriebe ke<strong>in</strong>e schriftlichen<br />
Arbeitsverträge, die vorgelegt werden können, zum an<strong>der</strong>en<br />
gibt ke<strong>in</strong> deutscher Unternehmer gerne Firmen<strong>in</strong>terna an e<strong>in</strong>e<br />
paritätische Kommission, die von dem schweizerischen Arbeitgeberverband<br />
und den schweizerischen Gewerkschaften<br />
besetzt werden. Die Angst, sich gegenüber den e<strong>in</strong>heimischen<br />
Wettbewerbern quasi gläsern darzustellen, treibt viele Unternehmer<br />
um. Hier wäre e<strong>in</strong>e Regelung, die verhältnismäßig<br />
und datenschutzrechtlich unangreifbar wäre, immer noch<br />
wünschenswert. Freilich hat sich <strong>der</strong> schweizerische Gesetzgeber<br />
selbst <strong>in</strong> die Bredouille gebracht, <strong>in</strong> dem er ausgerechnet<br />
die Tarifparteien für die Kontrolle auf den Baustellen<br />
e<strong>in</strong>setzt. E<strong>in</strong>e unabhängige Institution wäre hier sicherlich<br />
angebrachter.<br />
Als solche unabhängige Institution bestehen die kantonalen<br />
Arbeitsämter, die wie<strong>der</strong>um Schwarzarbeits<strong>in</strong>spektoren beschäftigen.<br />
Gemäß Art. 16 c EntsV haben auch diese Inspektoren<br />
die Möglichkeit zur Kontrolle <strong>der</strong> Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen<br />
und zur Kontrolle <strong>der</strong> Lohnbücher. Nach Art. 7 a I EntsG ist<br />
die Aufgabe <strong>der</strong> Inspektoren eigentlich auf Bestimmungen<br />
e<strong>in</strong>es Normalarbeitsvertrags beschränkt, also gerade auf die<br />
Branchen, bei denen es ke<strong>in</strong>en Ges<strong>am</strong>tarbeitsvertrag gibt.<br />
Die paritätischen Kommissionen haben jeden Verstoß gegen<br />
das Entsendegesetz gem. Art. 9 I EntsG <strong>der</strong> zuständigen kantonalen<br />
Behörde zu melden, so dass diese Verstöße gegen das<br />
Entsen<strong>der</strong>echt prüfen und ahnden. Ausländische Arbeitgeber<br />
haben zu beachten, dass sie jährlich von den Kontrollstellen<br />
zur Zahlung von Kontroll- und Vollzugskosten herangezogen<br />
werden, sofern dies e<strong>in</strong> Ges<strong>am</strong>tarbeitsvertrag regelt (Art. 8 a<br />
EntsV).<br />
V. Sanktionierung<br />
In Branchen mit allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlich erklärten Ges<strong>am</strong>tarbeitsverträgen<br />
s<strong>in</strong>d die e<strong>in</strong>gesetzten paritätischen Kommissionen<br />
zuständig detaillierte Kontrollen <strong>der</strong> Lohn- und Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen<br />
durchzuführen; die Sanktionskompetenz<br />
gemäß des Entsendegesetzes bleibt aber ausschließlich bei<br />
den Kantonen 36 .<br />
Statt e<strong>in</strong>er staatlichen Geldbuße kann die paritätische Kommission<br />
allerd<strong>in</strong>gs Konventionalstrafen aussprechen, sofern<br />
dies <strong>der</strong> Ges<strong>am</strong>tarbeitsvertrag vorsieht (Art. 2 II quarter<br />
EntsG). Freilich haben die meisten Tarifparteien <strong>in</strong> ihren<br />
Ges<strong>am</strong>tarbeitsverträgen davon Gebrauch gemacht – alle<strong>in</strong><br />
schon um den hohen Personalaufwand <strong>der</strong> paritätischen<br />
Kommissionen f<strong>in</strong>anzieren zu können. Im Bauhauptgewerbe<br />
ist die paritätische Kommission z. B. gem. Art. 79 II LMV<br />
berechtigt e<strong>in</strong>e Verwarnung auszusprechen, e<strong>in</strong>e Konventionalstrafe<br />
bis zu 50 000 CHF zu verhängen (<strong>in</strong> Fällen vorenthaltener<br />
geldwerter Ansprüche darf die Konventionalstrafe<br />
bis zur Höhe <strong>der</strong> geschuldeten Leistung gehen) und die<br />
Neben- und Verfahrenskosten <strong>der</strong> fehlbaren Partei auferlegen.<br />
In <strong>der</strong> Praxis ist e<strong>in</strong> recht zurückhalten<strong>der</strong> Gebrauch <strong>der</strong><br />
Verwarnungen festzustellen; die Verhängung von Konventionalstrafen<br />
zuzüglich <strong>der</strong> Auferlegung <strong>der</strong> Verfahrenskosten<br />
ist die Regel.<br />
Neben <strong>der</strong> Verhängung e<strong>in</strong>er Konventionalstrafe und <strong>der</strong><br />
Verfahrenskosten durch die paritätische Kommission wird<br />
bei e<strong>in</strong>em Verstoß zusätzlich e<strong>in</strong>e Geldbuße als Sanktion<br />
durch den Kanton verhängt. Bei ger<strong>in</strong>gfügigen Verstößen<br />
kann die kantonale Behörde e<strong>in</strong>e Verwaltungsbuße bis zu<br />
5 000 CHF aussprechen. Bei Verstößen, die nicht mehr als<br />
ger<strong>in</strong>gfügig angesehen werden, kann die Behörde e<strong>in</strong> Berufsverbot<br />
zwischen e<strong>in</strong>em und fünf Jahren auferlegen (Art. 9<br />
EntsG). Zudem ist die Sanktion <strong>der</strong> Bundesbehörde zu melden,<br />
die e<strong>in</strong>e öffentlich e<strong>in</strong>sehbare Liste <strong>der</strong> sanktionierten<br />
Betriebe führt 37 . Dieser „Internetpranger“ wurde seit se<strong>in</strong>er<br />
Freizeichnung heftig kritisiert. Neben datenschutzrechtlichen<br />
und rechtsstaatlichen Bedenken wurde <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die Verhältnismäßigkeit<br />
beklagt, da e<strong>in</strong> solcher E<strong>in</strong>trag reputationsschädigende<br />
Auswirkungen hat. Die <strong>Schweiz</strong> k<strong>am</strong> diesen Bedenken<br />
nun <strong>in</strong>soweit entgegen, als dass sie nur noch schwere<br />
Verstöße, also Verstöße, die zu e<strong>in</strong>em Berufsverbot führten,<br />
dort auflistet. E<strong>in</strong> generelles Unbehagen gegen e<strong>in</strong>e solche<br />
öffentliche Bloßstellung kann aber auch dieses Entgegenkommen<br />
nicht beseitigen.<br />
Es ist nach dem <strong>Schweiz</strong>er Entsen<strong>der</strong>echt möglich, dass e<strong>in</strong>er<br />
Firma wegen Verletzung des Ges<strong>am</strong>tarbeitsvertrags durch die<br />
paritätische Kommission e<strong>in</strong>e Konventionalstrafe auferlegt<br />
wird und gleichzeitig z. B. wegen Meldeverstößen aber auch<br />
e<strong>in</strong>e Geldbuße verhängt wird wegen Verletzung <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlich<br />
erklärten M<strong>in</strong>destlöhne 38 . In <strong>der</strong> Praxis<br />
kommt es sogar zu Verfahren, bei denen <strong>der</strong>selbe Verstoß<br />
gegen den M<strong>in</strong>destlohn sowohl von <strong>der</strong> paritätischen Kommission<br />
(mit e<strong>in</strong>er Konventionalstrafe), als auch von <strong>der</strong> kantonalen<br />
Behörde (mit e<strong>in</strong>er Geldbuße) geahndet wird.<br />
Das Seco erkennt hier<strong>in</strong> ke<strong>in</strong>en Verstoß von dem Rechtsgrundsatz<br />
„ne bis <strong>in</strong> idem“, da zwei unterschiedliche Organe<br />
auf Grund von unterschiedlichen Vorschriften vorgehen 39 .<br />
Bei <strong>der</strong> Konventionalstrafe handle es sich um e<strong>in</strong> privatrechtliches<br />
Instrument, das auf privatrechtlichem Wege durchzusetzen<br />
ist; dass die Möglichkeit <strong>der</strong> Verhängung e<strong>in</strong>er Konventionalstrafe<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em öffentlich-rechtlichen Erlass erwähnt<br />
wird, würde nichts an dem privatrechtlichen Charakter än<strong>der</strong>n<br />
40 .<br />
Das Verbot von „ne bis <strong>in</strong> idem“ knüpft an das Vorliegen<br />
<strong>der</strong>selben Straftat an und ist z. B. auch <strong>in</strong> Art. 50 <strong>der</strong> Charta<br />
<strong>der</strong> Grundrechte <strong>der</strong> EU geregelt. E<strong>in</strong>e Doppelbestrafung läge<br />
dann vor, wenn es sich kumulativ um e<strong>in</strong>en identischen Sachverhalt,<br />
also dieselbe strafbare Handlung im S<strong>in</strong>ne des <strong>der</strong><br />
Anklage zu Grunde liegenden konkreten Lebenssachverhalts,<br />
36 Seco (o. Fußn. 12), Art. 9 EntsG, S. 42.<br />
37 www.seco.adm<strong>in</strong>.ch dort: Arbeit/Flankierende Maßnahmen/Entsendung<br />
– Rechtskräftige Sanktionen.<br />
38 Seco (o. Fußn. 12), Art. 9 EntsG, S. 43.<br />
39 Seco (o. Fußn. 12), Art. 9 EntsG, S. 43.<br />
40 Seco (o. Fußn. 12), Art. 9 EntsG, S. 44.
Zimmermann, <strong>Arbeiten</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> <strong>am</strong> <strong>Beispiel</strong> <strong>der</strong> <strong>Bauwirtschaft</strong> NZA Onl<strong>in</strong>e Aufsatz 3/2009 7<br />
e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>zigen Täter, denselben Rechtsverstoß und d<strong>am</strong>it<br />
dasselbe geschützte Rechtsgut handelt 41 . Die Sperrwirkung<br />
tritt dann für künftige Strafverfahren e<strong>in</strong>, die auf Grund<br />
<strong>der</strong>selben Vorschrift o<strong>der</strong> auf Grund unterschiedlicher, materiell<br />
jedoch m<strong>in</strong>destens teilweise identischer Vorschriften e<strong>in</strong>geleitet<br />
werden 42 . Nicht nur <strong>der</strong> Begriff des Strafverfahrens,<br />
son<strong>der</strong>n auch die „Strafe“ ist <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em weiten S<strong>in</strong>n zu verstehen,<br />
so dass auch Ordnungswidrigkeiten und an<strong>der</strong>e Verwaltungsmaßnahmen<br />
mit strafähnlichem Charakter erfasst<br />
s<strong>in</strong>d 43 .<br />
Wenn aber die kantonale Behörde e<strong>in</strong>en Verstoß gegen den<br />
M<strong>in</strong>destlohn mit e<strong>in</strong>er Geldbuße bestraft, ist es nicht e<strong>in</strong>zusehen,<br />
dass <strong>der</strong>selbe Verstoß nochmals von <strong>der</strong> paritätischen<br />
Kommission als Konventionalstrafe geahndet werden kann.<br />
Es liegt <strong>der</strong> identische Sachverhalt und <strong>der</strong> identische Rechtsverstoß<br />
vor, so dass e<strong>in</strong>e Sperrwirkung e<strong>in</strong>treten muss. Letztlich<br />
hat die Konventionalstrafe auch ke<strong>in</strong>en privatrechtlichen<br />
Charakter, son<strong>der</strong>n e<strong>in</strong>en Strafcharakter. Entsprechend ist<br />
<strong>der</strong> Art. 79 LMV auch mit dem Wort „Sanktionen“ bezeichnet,<br />
so dass e<strong>in</strong> Verstoß des „ne bis <strong>in</strong> idem“-Grundsatzes<br />
vorliegt. E<strong>in</strong>e Überarbeitung <strong>der</strong> Sanktionierungen ersche<strong>in</strong>t<br />
daher dr<strong>in</strong>gend geboten.<br />
VI. Ergebnis<br />
Die bilateralen Verträge haben die wirtschaftlichen Beziehungen<br />
zwischen <strong>der</strong> EU und <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> erheblich vere<strong>in</strong>facht<br />
und dadurch auch verbessert. Nie zuvor war es für ausländische,<br />
zumal deutsche Betriebe so e<strong>in</strong>fach <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong><br />
Dienstleistungen anzubieten. Allerd<strong>in</strong>gs s<strong>in</strong>d die praktischen<br />
Ausführungen noch verbesserungswürdig. Insbeson<strong>der</strong>e das<br />
Sanktionswesen bedarf e<strong>in</strong>er umfassenden Überarbeitung.<br />
Zudem machen sich immer wie<strong>der</strong> Zeichen e<strong>in</strong>es Protektionismusses<br />
breit. Schon wurde im Kanton Basel-Land als<br />
Pilotprojekt e<strong>in</strong>e Kaution von 20 000 CHF für Betriebe des<br />
Ausbaugewerbes e<strong>in</strong>geführt, an <strong>der</strong> sich die paritätischen<br />
Kommissionen im Fall e<strong>in</strong>es Verstoßes und <strong>der</strong> Verhängung<br />
e<strong>in</strong>er Konventionalstrafe unter bestimmten Umständen bedienen<br />
dürfen. Solche Än<strong>der</strong>ungen stehen mit dem Freizügigkeitsabkommen<br />
nicht im E<strong>in</strong>klang. Dort wurde <strong>in</strong> Art. 13<br />
FZA e<strong>in</strong> „Stand still“ vere<strong>in</strong>bart, so dass sich die Vertragsparteien<br />
verpflichten, ke<strong>in</strong>e neuen Beschränkungen für die<br />
Staatsangehörigen <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Vertragspartei e<strong>in</strong>zuführen.<br />
Jede neue Beschränkung verstößt aber nicht nur gegen das<br />
Freizügigkeitsabkommen, son<strong>der</strong>n verh<strong>in</strong><strong>der</strong>t e<strong>in</strong>en funktionierenden<br />
Wettbewerb. Statt sich abzuschotten, sollten die<br />
bestehenden Probleme konstruktiv und im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es liberalen<br />
und offenen Wettbewerbs gelöst werden. Denn von e<strong>in</strong>em<br />
Dienstleistungswettbewerb profitieren <strong>am</strong> Ende alle. &<br />
41 Blanke, <strong>in</strong>: Callies/Ruffert, VerfassungsR <strong>der</strong> EU, 3. Aufl. (2007),<br />
Art. 50 GRCh Rdnr. 4.<br />
42 Blanke,<strong>in</strong>:Callies/Ruffert (o. Fußn. 41), Art. 50 GRCh Rdnr. 4.<br />
43 Blanke,<strong>in</strong>:Callies/Ruffert (o. Fußn. 41), Art. 50 GRCh Rdnr. 4.