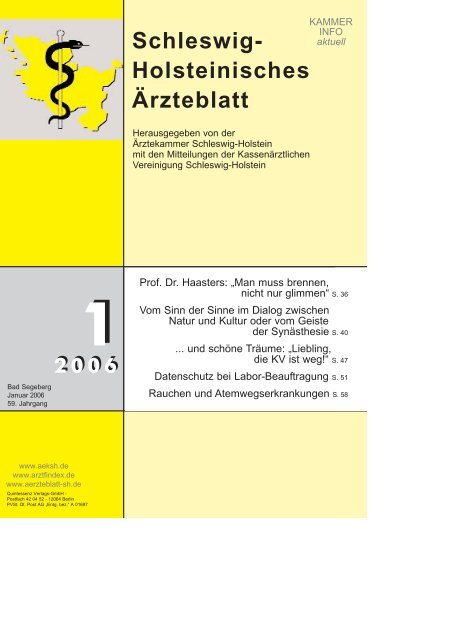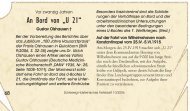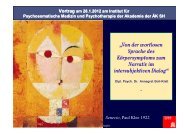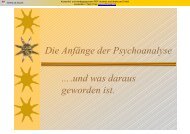Holsteinisches Ärzteblatt - Ärztekammer Schleswig-Holstein
Holsteinisches Ärzteblatt - Ärztekammer Schleswig-Holstein
Holsteinisches Ärzteblatt - Ärztekammer Schleswig-Holstein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bad Segeberg<br />
Januar 2006<br />
59. Jahrgang<br />
www.aeksh.de<br />
www.arztfindex.de<br />
www.aerzteblatt-sh.de<br />
1<br />
2006<br />
Quintessenz Verlags-GmbH -<br />
Postfach 42 04 52 - 12064 Berlin<br />
PVSt. Dt. Post AG „Entg. bez.“ A 01697<br />
<strong>Schleswig</strong>-<br />
<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong><br />
<strong>Ärzteblatt</strong><br />
Herausgegeben von der<br />
<strong>Ärztekammer</strong> <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
mit den Mitteilungen der Kassenärztlichen<br />
Vereinigung <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
KAMMER<br />
INFO<br />
aktuell<br />
Prof. Dr. Haasters: „Man muss brennen,<br />
nicht nur glimmen“ S. 36<br />
Vom Sinn der Sinne im Dialog zwischen<br />
Natur und Kultur oder vom Geiste<br />
der Synästhesie S. 40<br />
... und schöne Träume: „Liebling,<br />
die KV ist weg!“ S. 47<br />
Datenschutz bei Labor-Beauftragung S. 51<br />
Rauchen und Atemwegserkrankungen S. 58
Akademie<br />
2<br />
Neues aus der Akademie ...<br />
Im Jahr 2006 bietet die<br />
Akademie eine Reihe von<br />
neuen Weiterbildungskursen<br />
und Fortbildungsveranstaltungen<br />
an, die nachstehend kurz vorgestellt<br />
werden. Nähere Informationen finden<br />
sich im Programmheft oder im Internet.<br />
Fallseminar Palliativmedizin<br />
Das dreiteilige Fallseminar Palliativmedizin<br />
nach dem Curriculum von Bundesärztekammer<br />
und Deutscher Gesellschaft für Palliativmedizin<br />
richtet sich an Ärztinnen und Ärzte, die den<br />
Basiskurs Palliativmedizin bereits absolviert haben<br />
und weitere Bausteine zum Erwerb der Zusatzbezeichnung<br />
erwerben wollen.<br />
In den jeweils 40-stündigen, interdisziplinär angelegten<br />
Modulen geht es um die Umsetzung<br />
palliativmedizinischen Wissens in der täglichen<br />
Praxis, insbesondere um praktische Entscheidungen<br />
im medizinischen und psychosozialen<br />
Bereich.<br />
Qualitätsmanagement in der Arztpraxis<br />
Mehr Praxisorientierung geht nicht - am Ende<br />
der neuen Kursreihe „Qualitätsmanagement in<br />
der Arztpraxis“ werden die Teilnehmer(innen)<br />
ihr eigenes praxisinternes QM-System einschließlich<br />
individuellem QM-Handbuch fertig<br />
gestellt haben. Damit wären dann nicht nur die<br />
eigenen Praxisabläufe optimiert, sondern gleichzeitig<br />
auch die gesetzlichen Vorgaben erfüllt.<br />
Das Angebot in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen<br />
Vereinigung <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
richtet sich zunächst an die Absolventen der<br />
dort durchgeführten so genannten QEP-Kurse.<br />
Diesem Personenkreis wird das erste Modul der<br />
insgesamt vierteiligen Kursreihe angerechnet.<br />
Idealerweise werden die Kurse vom Praxisteam<br />
(Arzt mit seiner Helferin) besucht.<br />
In der zweiten Jahreshälfte 2006 wird die komplette<br />
Kursreihe allen Interessierten offen stehen.<br />
Naturheilverfahren<br />
Der Weiterbildungskurs Naturheilverfahren<br />
(160 Stunden) wurde neu konzipiert. Grundlage<br />
ist jetzt das erstmals von der Bundesärztekammer<br />
herausgegebene Curriculum. Neu ist auch<br />
die Zusammenarbeit mit den Segeberger Klini-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
ken. Dadurch können wieder alle Veranstaltungen<br />
in Bad Segeberg stattfinden.<br />
Des Weiteren ist auch das Angebot von Fallseminaren<br />
(insgesamt 80 Stunden) geplant. Nach<br />
der neuen Weiterbildungsordnung kann dadurch<br />
das für die Zusatzbezeichnung nachzuweisende<br />
dreimonatige Praktikum ersetzt werden.<br />
Qualitätsbeauftragter Hämotherapie<br />
Die kürzlich novellierte „Hämotherapie-Richtlinie“<br />
der Bundesärztekammer fordert als Qualifikation<br />
für Qualitätsbeauftragte in der Hämotherapie<br />
erstmals explizit die Erfüllung der Voraussetzungen<br />
für die Zusatzbezeichnung Ärztliches<br />
Qualitätsmanagement oder alternativ eine<br />
spezielle theoretische Fortbildung.<br />
Diese 40-stündige Qualifizierungsmaßnahme<br />
hat zum Ziel, die Kursabsolventen zu befähigen,<br />
den Aufbau und die Weiterentwicklung eines<br />
Qualitätsmanagement-Systems in der Hämotherapie<br />
als benannte Qualitätsbeauftragte zu<br />
begleiten.<br />
Fortbildungsreihe für Hausärzte<br />
In Vorbereitung ist eine Fortbildungsreihe, die<br />
insbesondere die hausärztlich tätigen Ärztinnen<br />
und Ärzte ansprechen soll. Geplant sind u. a.<br />
pharmakologische, infektiologische und allgemeinmedizinische<br />
Themen.<br />
In der ersten Veranstaltung am 22. März 2006<br />
geht es um: „Thromboembolische Erkrankungen<br />
- Prophylaxe und Therapie“.<br />
Thromboembolien gehören zu den häufigsten<br />
Todesursachen: 35 Prozent der Bundesbürger<br />
versterben am Herzinfarkt, zwölf Prozent am<br />
Schlaganfall und ein bis zwei Prozent an Lungenarterienembolien.<br />
Fundierte Kenntnisse zur<br />
Pathogenese, Prophylaxe und Therapie von arteriellen<br />
und venösen Thrombosen sind daher<br />
dringend erforderlich, damit die ärztlichen Maßnahmen<br />
rechtzeitig und erfolgreich zum Einsatz<br />
kommen können.<br />
Akademie für med. Fort- und Weiterbildung<br />
der <strong>Ärztekammer</strong> <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
Esmarchstr. 4-6, 23795 Bad Segeberg<br />
Tel. 04551/803-166, Fax 803-194<br />
Internet www.aeksh.de/akademie<br />
E-Mail akademie@aeksh.org
Seite 3<br />
Liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
das neue Jahr hat begonnen. Niemand kann sagen, was das Jahr 2006 an Überraschungen für uns bereithält. In<br />
einem aber muss man kein Prophet sein, um zu erahnen, was passiert. Es wird ein Jahr massenhafter Proteste<br />
werden. Die großen Koalitionen in Land und Bund sind zu Sparmaßnahmen, auch zulasten sozialer Einschnitte,<br />
gezwungen. In jeder Stunde des neuen Jahres werden 200 000 Euro auf den gigantischen Schuldenberg von<br />
21 Milliarden Euro des Landes <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> hinzukommen. Oder übertragen auf den Bund: Wenn wir<br />
heute begännen, die Verbindlichkeiten der Bundesrepublik Deutschland mit einer Milliarde Euro im Monat zu<br />
tilgen, wären wir erst in 117 Jahren schuldenfrei.<br />
Vor diesem Hintergrund mit der Absicherung steigender Gesundheitskosten durch Steuermittel rechnen zu<br />
wollen, wäre reichlich naiv. Im Gegenteil: Ab 2007 wird ein durchaus zielgerichteter Zuschuss für das Gesundheitswesen<br />
aus der Tabaksteuer wegfallen.<br />
Andererseits wird das Dogma der Beitragssatzstabilität zur gesetzlichen Krankenversicherung aus vordergründig<br />
wirtschaftspolitischen Gründen nicht angetastet werden. Auch die Abkoppelung von den Lohnkosten wäre,<br />
zumindest für die von der Gesamtvergütung abhängigen Ärztinnen und Ärzte, keine Lösung des Problems,<br />
da sich durch die vermehrte Belastung der Versicherten der Run auf preisgünstigere Kassenvarianten verstärken<br />
und damit die Kopfpauschale weiter absinken dürfte. Also insgesamt keine rosigen Aussichten für eine<br />
spontane Entlastung der angespannten Situation in der ambulanten und stationären Versorgung durch die<br />
Gesundheitspolitik.<br />
Umso wichtiger ist es, die Bevölkerung auf die Ungereimtheiten politischer Aussagen hinzuweisen. Mittlerweile<br />
gehört es immerhin zum guten Ton - selbst im Koalitionsvertrag - auf die Effizienz und Leistungsfähigkeit<br />
des deutschen Gesundheitswesens hinzuweisen. Dieses herausragende Prädikat im internationalen Vergleich<br />
kommt aber nicht dadurch zustande, obwohl, sondern weil wir relativ viel an Geldmitteln dafür einsetzen.<br />
Dies sähe aber bereits dann anders aus, wenn ärztliche Leistung so bezahlt würde, wie es nach betriebswirtschaftlichen<br />
Gesichtspunkten erforderlich und angemessen wäre.<br />
Die Finanzierung des Gesundheitswesens in der Bundesrepublik Deutschland erfolgt derzeit zu 60 Prozent aus<br />
Mitteln der gesetzlichen Krankenversicherung (bei 90 Prozent Versicherten in diesem Versicherungszweig), zu<br />
14 Prozent aus Mitteln der privaten Krankenversicherung und zu 26 Prozent aus nicht finanzierten aber<br />
gleichwohl erbrachten Leistungen.<br />
Oder anders ausgedrückt: In den letzten 25 Jahren ist der Ärzteschaft lediglich ein Honorarzuwachs von 13,6<br />
Prozent zugebilligt worden. Praxiskosten sind um ein Vielfaches, die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist von<br />
1991 bis 2003 um 42 Prozent und die Grundlohnsumme um 27 Prozent gestiegen.<br />
Wenn also die freien Verbände zum 18. Januar zu einer Demonstration vor dem Bundesministerium für Gesundheit<br />
in Berlin aufrufen, und nach Kündigung des BAT durch den Marburger Bund voraussichtlich ab Februar<br />
kommunale Krankenhäuser bestreikt werden, geht es nicht etwa um turnusmäßige Gehaltssteigerungen<br />
wie bei üblichen Tarifkonflikten, sondern in erster Linie um die Erfüllung längst überfälliger Forderungen. Es<br />
ist eben kein Privileg, regelhaft durchschnittlich ein Viertel seiner erbrachten Leistung nicht bezahlt zu bekommen.<br />
In der wirtschaftlich schwierigen Lage für große Teile der Bevölkerung muss man dies betonen, um<br />
der unvermeidlichen Reaktion verantwortlicher Politiker vorzubeugen, die versuchen werden, dies emotional<br />
gezielt einzusetzen.<br />
Wenn das Bekenntnis zur Gesundheit als dem höchsten aller Güter in unserer Gesellschaft tatsächlich nicht<br />
nur ein Lippenbekenntnis sein sollte, kann man auf die logische Schlussfolgerung mündiger Wähler hoffen:<br />
Ein nachweisbar und anerkanntermaßen gutes Gesundheitssystem ist es wert, erhalten zu werden! Kostensteigerungen<br />
sind weniger System bedingt als vielmehr dem exponentiell ansteigenden medizinischen Fortschritt<br />
geschuldet. Dies erschließt sich mit einem Seitenblick auf staatliche und ökonomisierte Systeme mit vergleichbarem<br />
medizinischen Leistungsstandard unschwer dem, der es sehen will.<br />
Mit freundlich-kollegialen Grüßen<br />
Ihre<br />
Dr. med. Franz-Joseph Bartmann Dr. med. Cordelia Andreßen<br />
Präsident Hauptgeschäftsführerin<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
Seite 3<br />
3
4<br />
Wir leben immer länger. Ein heute in Deutschland geborener Junge hat eine Lebenserwartung von<br />
76 Jahren, ein Mädchen sogar von 81,5 Jahren. Neue Medikamente und Therapien sowie Diagnoseund<br />
Operationsverfahren verbessern stetig die Überlebens- und Heilungschancen. Doch das hat seinen<br />
Preis. So kostet ein 90-jähriger Mann in Westdeutschland die gesetzlichen Krankenkassen<br />
durchschnittlich 5 371 Euro im Jahr, eine ebenso alte Frau 4 903 Euro (Westdeutschland). Die Jüngeren<br />
sind gesünder und daher für die Krankenkassen günstiger. Für einen 30-jährigen Mann in Ostdeutschland<br />
geben die gesetzlichen Krankenkassen „nur“ 714 Euro im Jahr aus, für eine Frau im gebärfähigen<br />
Alter (30 Jahre, Ostdeutschland) 1 445 Euro.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006
Mitteilungen der Akademie 2<br />
Seite 3<br />
Nachrichten in Kürze 6<br />
Leserbriefe 14<br />
Fortbildung<br />
Veranstaltungskalender 17<br />
Personalia<br />
Geburtstage/Verstorbene 20<br />
Chefarztwechsel im Neurologischen Zentrum<br />
der Segeberger Kliniken Gruppe 21<br />
Bad Segeberg<br />
Praxisübergabe sicher und vorteilhaft gestalten 23<br />
27 US-Dollar pro Kopf und Jahr 24<br />
Nicht klein reden! 25<br />
Mal ganz anders<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
26<br />
Viszeraler Schmerz, ein Chamäleon?<br />
Unterschiedliche Wahrnehmung des Gesund-<br />
28<br />
heitswesens 29<br />
Kriegskasse gut gefüllt 32<br />
Krankenkassen dürfen sich freuen 33<br />
Niedrigschwellige Angebote<br />
� Prof. Haasters: „Man muss brennen, nicht nur<br />
34<br />
glimmen“ 36<br />
Erworbene Fortbildungszertifikate<br />
Kammer-Info aktuell<br />
39<br />
� Vom Sinn der Sinne im Dialog zwischen Natur<br />
und Kultur oder vom Geist der Synästhesie 40<br />
<strong>Schleswig</strong>-<br />
<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong><br />
<strong>Ärzteblatt</strong><br />
Herausgegeben von der <strong>Ärztekammer</strong> <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
Mit den Mitteilungen der Kassenärztlichen Vereinigung <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
� ... und schöne Träume: „Liebling, die KV ist weg!“ 47<br />
Weitere Kreisausschüsse bestätigt 49<br />
Ausschüsse neu besetzt<br />
� Was muss der Arzt aus Datenschutzsicht bei<br />
50<br />
der Labor-Beauftragung beachten? 51<br />
„Neumünsteraner Erklärung“ 54<br />
Neue Richtlinien Hämotherapie<br />
Gemeinsam für Deutschland. Mit Mut und<br />
55<br />
Menschlichkeit 57<br />
Rezensionen 22, 31, 62, 72<br />
Medizin und Wissenschaft<br />
� Rauchen und chronisch-obstruktive Atemwegserkrankungen<br />
58<br />
Impfschutz bei Aufnahme in den Kindergarten<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> 2004 63<br />
Unsere Nachbarn<br />
Sterbehilfe bei Früh- und Neugeborenen? 67<br />
Suizid im Alter<br />
Kassenärztliche Vereinigung<br />
69<br />
Zur Vertragspraxis Zugelassene. Diese Beschlüsse<br />
sind noch nicht rechtskräftig, sodass<br />
hiergegen noch Widerspruch eingelegt bzw.<br />
Klage erhoben werden kann 73<br />
Rechtskräftig zur Vertragspraxis Zugelassene 79<br />
Zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Überweisungspraxis<br />
Ermächtigte. Diese Beschlüsse<br />
sind noch nicht rechtskräftig, sodass hiergegen<br />
noch Widerspruch eingelegt bzw. Klage erhoben<br />
werden kann 79<br />
Öff. Ausschreibung von Vertragspraxen 86<br />
Berufung von Vertragsärzten(innen) bzw. Psychotherapeuten(innen)<br />
als ehrenamtliche Richter(innen)<br />
der Sozialgerichtsbarkeit 87<br />
Telefonverzeichnis/Impressum 94<br />
Inhalt<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 5
Nachrichten in Kürze<br />
6<br />
Nachrichten in Kürze<br />
DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg<br />
Dr. Albrecht Harland verabschiedet,<br />
Dr. Roland Preuss Nachfolger<br />
Hans-Martin Kuhlmann, Geschäftsführer des DRK-Krankenhauses<br />
Mölln-Ratzeburg, Dr. Roland Preuss und Dr. Albrecht<br />
Harland (v. l. n. r.) (Foto: Krankenhaus)<br />
In einer kleinen Feierstunde wurde Dr. Albrecht<br />
Harland (62) als Chefarzt der Inneren Abteilung des<br />
DRK-Krankenhauses Mölln-Ratzeburg im Kreise ehemaliger<br />
Mitarbeiter und niedergelassener Ärzte gebührend<br />
verabschiedet. „Wir haben Ihnen viel zu verdanken“,<br />
hob Geschäftsführer Hans-Martin Kuhlmann<br />
in seiner Rede hervor, „vor allem für Ihr außerordentliches<br />
Engagement weit über die Grenzen der Stadt<br />
Mölln hinaus. Dafür möchte ich Ihnen auch im Namen<br />
der Gesellschafter Dank und Anerkennung aussprechen.<br />
Und ich würde mich freuen, wenn wir weiterhin<br />
auf Ihre Ratschläge zählen dürfen.“<br />
Am 1. Januar 1979 trat Dr. Harland ins Städtische<br />
Krankenhaus in Mölln als Oberarzt der Inneren Abteilung<br />
ein, fungierte dort seit dem 1. Januar 1980 -<br />
gemeinsam mit Dr. Jens-Christian Schacht - als leitender<br />
Arzt. Nach der Fusion mit dem DRK-Krankenhaus<br />
in Ratzeburg im April 2000 wurde Dr. Harland<br />
im Juni 2002 zum Chefarzt der Inneren Abteilung des<br />
DRK-Krankenhauses Mölln-Ratzeburg berufen. Seine<br />
medizinischen Schwerpunkte waren die sonographische<br />
Gefäßdiagnostik, für die er über den Kreis hinaus<br />
Anerkennung erwarb und als Gastroenterologe die<br />
Endoskopie. So etablierte er schon 1992 die Video-<br />
ERCP-Technik in Mölln und 1999 die einzige Endosonographie<br />
im Kreis Herzogtum Lauenburg.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
In einer sehr persönlichen Ansprache ließ Dr. Roland<br />
Preuss (46), der am 1. Oktober zum neuen Chefarzt<br />
der Inneren Abteilung berufen wurde, die zehn Jahre<br />
der intensiven Zusammenarbeit Revue passieren.<br />
Preuss: „Ich habe immer Ihre Leidenschaft und Ihr<br />
Engagement für Ihr Krankenhaus und Ihre Patienten<br />
bewundert. Sie waren ein Kämpfer und sind es immer<br />
noch. Es war Ihr Verdienst, dass Mölln medizinisch<br />
immer auf dem neuesten Stand war. Und für Ihre<br />
Fähigkeit, im Nebel des sonographischen Bildes das<br />
Krankhafte zu erkennen, sind sie berühmt.“<br />
Eine der wichtigsten Aufgaben von Dr. Preuss wird<br />
vorerst auch darin liegen, dass der Umzug der stationären<br />
Klinik von Mölln nach Ratzeburg reibungslos<br />
vonstatten geht. Preuss: „Wir stehen vor schweren<br />
Aufgaben. Aber ich glaube, dass wir ein sehr gutes<br />
Team haben und deshalb unsere Zukunft positiv<br />
gestalten werden.“ (Dirk Andresen, Hans-Martin<br />
Kuhlmann, DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg)<br />
Damp Holding AG<br />
Wechsel im Vorstandstandsvorsitz<br />
Zum 31. Dezember 2005 legt der langjährige Vorstandsvorsitzende<br />
Dr. Carl Hermann Schleifer (63)<br />
sein Mandat nieder und wechselt in den Aufsichtsrat<br />
des Unternehmens. Sein Nachfolger ab 1. Januar<br />
2006 wird Dr. Claus-<br />
Michael Dill (51). Neben<br />
Torben Freund (40) wird<br />
ab dem 1. März 2006 außerdem<br />
der Vorstand um<br />
Horst A. Jeschke (54) als<br />
drittes Mitglied erweitert.<br />
Jeschke übernimmt die<br />
Aufgabe Klinikmanagement<br />
und bringt darin seine<br />
umfangreichen operativen<br />
Erfahrungen in der<br />
Dr. Carl Hermann Schleifer<br />
(Foto: Damp)<br />
Führung von Krankenhäusern<br />
ein.<br />
Dr. Dill war in den Jahren 1999 bis 2005 als Vorstandsvorsitzender<br />
für die AXA Konzern AG sowie<br />
die deutschen Lebens- und Sachversicherer der AXA<br />
Gruppe verantwortlich. Horst A. Jeschke kommt von<br />
der SANA Unternehmensgruppe und war dort seit<br />
1987 Generalbevollmächtigter für die Region Süd.<br />
Dr. Schleifer führte die Unternehmensgruppe Damp<br />
als Vorsitzender seit Oktober 1997 und zeichnet für<br />
Entwicklung und Umsetzung des in den letzten Jahren<br />
erfolgreich verwirklichten Expansionsprogramms<br />
verantwortlich. Er wurde dabei seit dem Jahre 2003
durch Torben Freund als Vorstand Finanzen, Immobilien<br />
und Services unterstützt. Der Vorsitzende des<br />
Aufsichtsrates und Hauptaktionär Dr. Walter<br />
Wübben dankte Dr. Schleifer für seine großen Leistungen<br />
in den zurückliegenden Jahren.<br />
Zur Unternehmensgruppe Damp gehören in den Bundesländern<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern<br />
sieben Akutkliniken mit ca.<br />
2 100 Betten, vier Rehabilitationskliniken mit ca. 1 500<br />
Betten sowie touristische Einrichtungen mit ca. 2 500<br />
Betten. Durch 6 400 Mitarbeiter wird ein Umsatz von<br />
ca. 355 Millionen Euro erwirtschaftet. Mit dem jüngsten<br />
Erwerb des Klinikums Wismar steigt die Zahl der<br />
Mitarbeiter auf ca. 7 200 und der Umsatz auf ca. 410<br />
Millionen Euro. Rund 73 Prozent dieses Umsatzes<br />
entfallen auf den Akut-, 21 Prozent auf den Rehabilitationsbereich.<br />
(Damp)<br />
Neue Ergebnisse aus Kiel<br />
Wie wehrt sich das Gehirn gegen Parkinson?<br />
Eine multizentrische Forschungsinitiative der Neurologischen<br />
Universitätskliniken in Kiel, Lübeck und<br />
Hamburg-Eppendorf, die in einer aktuellen Ausgabe<br />
der Forschungszeitschrift „Brain“ veröffentlicht wurde,<br />
hat neue Ergebnisse erbracht, wie es das Gehirn<br />
schafft, sich gegen das Auftreten eines Parkinsonsyndroms<br />
zu wehren. Mithilfe eines modernen Schnittbildverfahrens,<br />
der so genannten funktionellen Magnetresonanztomographie,<br />
erfassten die Forscher die<br />
Gehirnaktivierung bei bestimmten Fingerbewegungen.<br />
Dabei verglichen sie gesunde Probanden mit<br />
denjenigen, die eine Mutation in einem bestimmten<br />
Gen, dem Parkin-Gen, aufwiesen. Diese Personen haben<br />
ein erhöhtes genetisches Risiko, im Laufe ihres<br />
Lebens an Parkinson zu erkranken. Die Ergebnisse<br />
dieser Untersuchungen zeigten, dass bestimmte Fingerbewegungen<br />
von beiden Gruppen gleich gut ausgeführt<br />
werden konnten. Allerdings konnten die Forscher<br />
bei den Risiko-Probanden eine Überaktivierung<br />
im motorischen System des Gehirns feststellen. Diese<br />
Überaktivierung belegt eine vermehrte „Anstrengung“<br />
einzelner Komponenten des motorischen Systems,<br />
um die zugrunde liegende noch verborgene<br />
Funktionsstörung zu überwinden. Hiermit wird nach<br />
Aussage der Forscher eindrucksvoll die Fähigkeit des<br />
Gehirns, solche Funktionsstörungen zu kompensieren,<br />
unterstrichen. Ein besseres Verständnis dieser<br />
Kompensationsmechanismen ist daher eine wichtige<br />
Grundlage für vorbeugende Therapieansätze, die<br />
darauf abzielen, den Ausbruch der Parkinsonschen<br />
Erkrankung zu verzögern. Die Parkinsonsche<br />
Erkrankung entsteht durch einen allmählich fortschreitenden<br />
Untergang von Nervenzellen im Mittel-<br />
hirn, die den Botenstoff<br />
Dopamin produzieren. Das<br />
Absterben dieser Nervenzellen<br />
beeinträchtigt die<br />
Informationsverarbeitung<br />
bei der Steuerung<br />
von Bewegungen. Schreitet<br />
der Untergang dieser<br />
dopaminhaltigen Nervenzellen<br />
fort, kann die<br />
Funktionsstörung nicht mehr<br />
kompensiert werden. Die Patienten entwickeln ein<br />
Parkinsonsyndrom mit einer deutlichen Bewegungsverlangsamung,<br />
Steifigkeit oder Zittern. Das Gehirn<br />
besitzt jedoch ein beträchtliches Potenzial, diese<br />
Funktionsstörung und so den Ausbruch der Erkrankung<br />
zu verhindern. So dauert es mehrere Jahre, bis es<br />
zu einem fassbaren Funktionsverlust kommt. Erst<br />
wenn 70-80 Prozent der dopaminergen Nervenendigungen<br />
in den Basalganglien abgestorben sind, entwickelt<br />
sich ein Parkinsonsyndrom. Wie es das<br />
menschliche Gehirn schafft, trotz des Nervenzelluntergangs<br />
über Jahre eine normale Funktion aufrecht<br />
zu erhalten, ist bislang noch völlig unklar. (Dr.<br />
Anja Aldenhoff-Zöllner)<br />
Dr. Theodor Windhorst neuer Präsident der<br />
<strong>Ärztekammer</strong> Westfalen-Lippe<br />
Dr. Theodor Windhorst (Foto:<br />
<strong>Ärztekammer</strong> Westfalen-Lippe)<br />
Dr. Theodor Windhorst<br />
aus Bielefeld, Chefarzt<br />
an den Städtischen Kliniken<br />
Bielefeld-Mitte, ist<br />
Ende November 2005<br />
zum neuen Präsidenten<br />
der <strong>Ärztekammer</strong> Westfalen-Lippe<br />
gewählt worden.<br />
Der 55-jährige Chirurg<br />
tritt damit die<br />
Nachfolge des langjährigen<br />
Kammerpräsidenten<br />
Prof. Dr. Ingo Flenker<br />
an, der sich nach zwölf<br />
Jahren an der Spitze der<br />
ärztlichen Selbstverwaltung im Landesteil nicht mehr<br />
zur Wahl stellte. Dr. Windhorst setzte sich mit 67<br />
Stimmen gegen den zweiten Bewerber Dr. Rüdiger<br />
Fritz aus Dortmund durch, der 46 Stimmen erhielt.<br />
Der neue Kammerpräsident bringt langjährige berufspolitische<br />
Erfahrung mit: Er gehörte dem Vorstand<br />
der <strong>Ärztekammer</strong> Westfalen-Lippe bereits seit 1993<br />
an und war u. a. von 2001 bis 2004 außerordentliches<br />
Mitglied im Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.<br />
(<strong>Ärztekammer</strong> Westfalen-Lippe)<br />
Nachrichten in Kürze<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 7
Nachrichten in Kürze<br />
8<br />
Teilnehmer der Podiumsdiskussion (v. l. n. r.): Dr. Jürgen Cellarius, Marianne Schauer, Prof. Dr. Heiner Raspe,<br />
Dr. Sandra Dunkelberg, Dr. Andreas Christoph Arlt, Wilfried Egelkraut (Foto: hk)<br />
Medizinische Rehabilitation hat Nachholbedarf<br />
Die medizinische Rehabilitation in Deutschland muss<br />
sich stärker um ihr „Outcome“ und damit speziell<br />
auch um die Wiedereingliederung des Patienten in<br />
das Arbeitsleben kümmern. Dabei sollte die Rentenversicherung<br />
unverzüglich vorangehen und sich an<br />
Konzepten aus Skandinavien und den Niederlanden<br />
orientieren. Diese Botschaft ging aus von dem bundesweiten<br />
Symposium „Berufliche Orientierung der<br />
medizinischen Rehabilitation in den nordeuropäischen<br />
Ländern und in Deutschland“ Ende November<br />
in Lübeck. Formuliert wurde sie am deutlichsten von<br />
Prof. Heiner Raspe, Institut für Sozialmedizin des<br />
UK S-H, Campus Lübeck. Weitere Veranstalter waren<br />
der Verein zur Förderung der Rehabilitationsforschung<br />
in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> und die Deutsche Rentenversicherung<br />
Nord (DRV; ehem. Landesversicherungsanstalt<br />
[LVA] Hamburg, LVA Mecklenburg-Vorpommern,<br />
LVA <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>).<br />
Zum Hintergrund: Trotz eines hierzulande weit ausgebauten<br />
Systems der medizinischen Reha sind die<br />
Wirkungen auf die berufliche Wiedereingliederung<br />
von chronisch kranken Patienten mit langer Arbeitsunfähigkeit<br />
„enttäuschend“, so etwa für die Veranstalter<br />
die Dres. Ruth Deck und Nathalie Glaser-<br />
Möller. Zu den Erfolg versprechenden Interventionen<br />
gehörten nach ausländischem Vorbild (nunmehr<br />
auch hier z. T. erprobt) der frühe Zugang zur Reha,<br />
eine bessere Verzahnung mit dem Gesundheitsmanagement<br />
im Betrieb und andere den Arbeitgeber stärker<br />
fordernde Wege.<br />
Die zuständigen Experten können aus ihren jeweiligen<br />
Positionen hierzu beitragen, wie die Teilnehmer<br />
der abschließenden Podiumsdiskussion übereinstimmend<br />
sagten: Dr. Sandra Dunkelberg (am Lehrstuhl<br />
Hausarztmedizin des Universitäts-Krankenhauses Eppendorf<br />
(UKE), Marianne Schauer (Betriebsärztin der<br />
Hansestadt Lübeck), Dr. Jürgen Cellarius (Ärztlicher<br />
Dezernent der DRV Nord, Lübeck), Dr. Andreas<br />
Christoph Arlt (Ärztlicher Direktor der Rheumaklinik<br />
Bad Bramstedt), Prof. Heiner Raspe, Wilfried<br />
Egelkraut (Dezernent für Reha-Planung, DRV in Lübeck)<br />
und Moderator Dr. Buschmann-Steinhage<br />
(DRV, Berlin).<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
Als Beispiel für die Einzelreferate sei das von Prof. Dr.<br />
Christoph Schmeling-Kludas (Chefarzt der Klinik für<br />
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der<br />
Segeberger Kliniken GmbH, Bad Segeberg) genannt.<br />
Er verwies insbesondere auf eine Pilotstudie mit 129<br />
Patienten, die die Klinik zusammen mit dem UKE<br />
durchführe. Nach ersten Ergebnissen sei die Akzeptanz<br />
in der Gruppe mit berufsbezogenen Maßnahmen<br />
deutlich besser als in der Kontrollgruppe mit rein<br />
medizinischer Rehabilitation. (hk)<br />
Alzheimer Gesellschaft <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> e. V.<br />
koordiniert und unterstützt Hilfen<br />
Wird die Alzheimer<br />
oder eine andere Demenzerkrankungfestgestellt,<br />
sind Angehörige<br />
meist ratlos, wie<br />
sie mit der Diagnose<br />
umgehen und an wen sie sich wenden können. Mit<br />
Beratungsstellen, Angehörigen- und Betreuungsgruppen<br />
oder häuslichen Helferkreisen sind vielerorts Hilfen<br />
für Menschen, die ihre Angehörigen Zuhause betreuen<br />
möchten, vorhanden. Wahrgenommen und<br />
akzeptiert werden sie aber meist erst, wenn die<br />
Krankheit schon weit vorangeschritten ist. Ungefähr<br />
die Hälfte der pflegenden Angehörigen erkrankt selbst<br />
unter der enormen Beanspruchung, der sie täglich<br />
ausgesetzt sind.<br />
Um Betroffenen und Angehörigen die nächstgelegenen<br />
Hilfen zu vermitteln hat zum 1. November 2005<br />
die Landesagentur der Alzheimer Gesellschaft <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
e. V. ihre Arbeit aufgenommen. Für die<br />
nächsten drei Jahre erhält die Landesagentur vom<br />
Land und den Pflegekassen Fördermittel. In Zusammenarbeit<br />
mit den regionalen Anbietern sollen die<br />
Hilfen für Menschen mit Demenz (vorrangig im Rahmen<br />
des § 45 SGB XI) und deren Angehörigen im<br />
Lande aufgespürt, begleitet, gefördert und ausgebaut<br />
werden.<br />
Auf der im Aufbau befindlichen Homepage der Alzheimer<br />
Gesellschaft <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> e. V.<br />
(www.alzheimer-sh.de) und auch in einer Broschüre
sollen Adressen und Kontakte der Entlastungsangebote<br />
im Lande aufgeführt werden.<br />
Swen Staack (Diplom Sozialpädagoge) und Cornelia<br />
Voigt (Diplom Pädagogin und examinierte Altenpflegerin)<br />
leiten die Agentur. Zu erreichen sind sie in der<br />
Ohechaussee 100, 22848 Norderstedt, Tel. 040/<br />
30857987. (Alzheimer Gesellschaft <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
e. V.)<br />
Notdienststruktur der Vertragsärzte in der<br />
Diskussion<br />
Mit dem Regelungsbedarf des organisierten<br />
Notdienstes hat sich<br />
die Abgeordnetenversammlung<br />
der Kassenärztlichen<br />
Vereinigung <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
(KVSH) auf<br />
ihrer November-Sitzung befasst.<br />
Wie der Stellvertretende<br />
KV-Vorsitzende<br />
Ralf W. Büchner vortrug, geht es um eine Qualitätsverbesserung<br />
für Patienten und Ärzte und um die Förderung<br />
kooperativer Strukturen vor allem durch zentrale<br />
Anlaufpraxen mit einheitlicher Rufnummer.<br />
Nach Erfahrungen mit Anlaufpraxen in Rendsburg,<br />
Kiel, Flensburg, Lübeck, Brunsbüttel und Wedel ist<br />
an weitere Anlaufpraxen gedacht. Die Rede war von<br />
Elmshorn, <strong>Schleswig</strong>, Kappeln, Heide, Nordfriesland,<br />
Lauenburg. Erwartet werden Effizienzgewinne unter<br />
anderem durch eine Reduktion von Einsatzfahrten.<br />
Die Anlaufpraxen sollten idealerweise an Krankenhäuser<br />
angebunden und eng mit dem fahrenden<br />
Dienst abgestimmt sein. Das Einzugsgebiet soll bis<br />
etwa 25 km im Durchmesser betragen. In der Notfallambulanz<br />
könnten werktags von 19 bis 22 Uhr Vertragsärzte,<br />
sonst Klinikärzte Dienst tun.<br />
Vorangegangen war im Mai eine Befragung der Notdienst<br />
leistenden Vertragsärzte. Es gibt derzeit 139<br />
Notdienstringe und 15 Kreisstellen. Unter den Reaktionen<br />
fand sich auch Kritik, so von vielen Ahrensburger<br />
Ärzten, die sich gegen eine einheitliche Regelung<br />
des Notdienstes aussprachen: Für eine flächendeckende<br />
Versorgung mit Anlaufpraxen seien die regionalen<br />
Verhältnisse zu unterschiedlich. Nach einer<br />
Beratung mit KV-Vertretern vor Ort sei jedoch nach<br />
Angaben der KV Konsens erzielt worden über das<br />
weitere Vorgehen wie oben beschrieben. Die Herren<br />
Büchner und Becker hatten sich bei zahlreichen Ortsterminen<br />
über die Probleme der einzelnen Notdienstringe<br />
und Regionen aus erster Hand informiert, das<br />
KV-Konzept erläutert und diskutiert. (hk)<br />
Buchtipps<br />
Ein schönes Geschenk<br />
für naturwissenschaftlich<br />
und philosophisch interessierte<br />
Ärzte oder medizinisch<br />
Interessierte ist<br />
der jüngste Jahresband<br />
„Materie in Raum und<br />
Zeit“ - Verhandlungen<br />
der Gesellschaft Deutscher<br />
Naturforscher<br />
und Ärzte (GDNÄ)<br />
2005, Hirzel Verlag<br />
Stuttgart/Leipzig, 512<br />
Seiten, ISBN 3-7776-1257, 32 Euro. Die<br />
GDNÄ hat 1822 zum ersten Mal (in Leipzig) getagt<br />
und ist damit eine der ältesten wissenschaftlichen Gesellschaften<br />
der Welt. Über 20 herausragende Wissenschaftler<br />
berichten in dem Band anschaulich über<br />
neue Forschungsergebnisse aus vielen Bereichen der<br />
Naturwissenschaften. In der Medizin geht es u. a. um<br />
Genomforschung, Prionforschung, Organtransplantation,<br />
Schmerz, neurologische Rehabilitation, bildgebende<br />
Diagnostik.<br />
Der aktuelle Diskurs über<br />
Zukunfts- und Gegenwartsfragen<br />
des Krankenhauses<br />
findet sich im jüngsten<br />
Krankenhaus-Report<br />
2005 mit dem Schwerpunkt:<br />
Wege zu Integration.<br />
Darunter ist auch ein<br />
Beitrag über Integrative<br />
Versorgungsplanung von<br />
Prof. Dr. rer. pol. Hans-<br />
Heinrich Rüschmann,<br />
Dr. Andrea Roth und<br />
Christian Krauss. Schattauer<br />
Verlag, Stuttgart 2006, 424<br />
Seiten mit CD, ISBN 3-7942408-X, 49,90 Euro. (hk)<br />
„Lübeck kämpft für seine Uni“<br />
Im Institut für Medizin- und Wissenschaftsgeschichte<br />
in der Lübecker Innenstadt veranstaltete die Universität<br />
zu Lübeck am 16./17. Dezember einen 24-Stunden-Vorlesungsmarathon,<br />
um für ihre Eigenständigkeit<br />
und gegen Fusionspläne zu demonstrieren. Unerwartet<br />
viele Lübecker und Auswärtige nutzten die<br />
Gelegenheit, an einem Ort in kurzer Zeit viele populär<br />
gehaltene Einblicke vor allem in die medizinische<br />
Wissenschaft zu erhalten. Einige Beispiele: Rektor<br />
Nachrichten in Kürze<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 9
Nachrichten in Kürze<br />
10<br />
Prof. Dominiak über das tödliche Risiko Bluthochdruck,<br />
Prof. Schmucker über moderne Anästhesie,<br />
PD Dr. Nicole Rotter über Tissue Engineering und<br />
Stammzellen im HNO-Bereich, Studiendekan Prof.<br />
Westermann zum Studieren in Lübeck („einer der<br />
besten Medizin-Studiengänge in Deutschland“),<br />
Prof. Jelkmann über Doping im Sport, Prof. Seyfarth<br />
über moderne Labordiagnostik („Was verrät mein<br />
Blut?“), Prof. Schwinger über das menschliche Genom,<br />
Prof. Diedrich über pränatale Medizin, Prof.<br />
Laqua über die Kunstlinse.<br />
Aber auch prominente<br />
Mitstreiter waren mit von<br />
der Partie, so Ministerpräsident<br />
a. D. Björn Engholm<br />
als Vorsitzender des Beirats<br />
(„größter Vorteil die Überschaubarkeit“),<br />
Propst Ralf<br />
Meister oder Dr. phil.<br />
Wisskirchen von der Kulturstiftung<br />
der Stadt zusammen<br />
mit Prof. von<br />
Ministerpräsident a. D.<br />
Björn Engholm (Foto: hk)<br />
Engelhardt („Wissenschaft<br />
und Literatur im Dialog“),<br />
dem Hausherrn des Veranstaltungsgebäudes.<br />
Am Ende stand der Eindruck,<br />
dass eigentlich alle<br />
geistig interessierten Lübecker<br />
und Lübeck-Kenner<br />
eine leistungsfähige, selbstständige<br />
Universität für un-<br />
Prof. Dr. phil Dietrich von<br />
Engelhardt (Foto: Privat)<br />
ersetzlich halten. Demgegenüber scheint die Politik<br />
prinzipiell an ihrem Plan festzuhalten, bis Mai 2006<br />
die Fusionsentscheidung in den Entwurf eines neuen<br />
Hochschulgesetzes einzuarbeiten, wie Staatssekretär<br />
de Jager am 5. Dezember bei den Krümmeler Alfred-<br />
Nobel-Tagen gegenüber dem <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>ischen<br />
<strong>Ärzteblatt</strong> bekräftigte. Aber Zeit zum Nachdenken<br />
über Argumente gibt es wohl noch. (hk)<br />
Im neuen Krankenhausplan über 1 000 Betten<br />
gestrichen<br />
Am 8. Dezember hat sich nach Information der Krankenhausgesellschaft<br />
(KGSH) in Kiel das Gesundheitsministerium<br />
mit Krankenhausträgern und<br />
Krankenkassen über<br />
die Grundzüge einer<br />
Fortschreibung des<br />
Krankenhausplans<br />
des Landes verständigt.<br />
Dazu gehört eine Reduktion<br />
der Planbettenzahl von bisher gut<br />
15 800 um rund 1 100 Betten. Für KGSH-<br />
Geschäftsführer Bernd Krämer ist der Abbau von<br />
sieben Prozent Folge kürzerer Liegezeiten: „Es werden<br />
nur Kapazitäten gestrichen, die in den letzten Jahren<br />
nicht mehr ausgelastet wurden.“ Für einzelne Kliniken<br />
sei dies jedoch nicht unkritisch. Viele dächten<br />
über Kooperationen und Verbundlösungen nach. Die<br />
KGSH befürworte solche Prozesse, wie sie in <strong>Schleswig</strong><br />
oder Flensburg zu beobachten seien.<br />
Gegen den Trend werde bedarfsgemäß die Zahl der<br />
psychiatrischen Planbetten zunehmen. Drei neue<br />
neurologische Abteilungen (in Flensburg, Heide, Bad<br />
Segeberg) sollen auch zu einer qualitativ besseren<br />
Versorgung beitragen. Über den Handlungsbedarf in<br />
der Geriatrie soll Anfang 2006 noch verhandelt werden.<br />
(hk)<br />
KGSH - Wechsel im Vorstand<br />
Der Mitgliederausschuss der Krankenhausgesellschaft<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> e. V. (KGSH) hat am 6. Dezember<br />
2005 Dr. Philipp Lubinus als stellvertretenden<br />
Vorsitzenden in den KGSH-Vorstand gewählt. Dr.<br />
Lubinus, zugleich Vorsitzender des Verbandes der Privatkliniken<br />
in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> e. V. (VPKSH)<br />
und Geschäftsführer der Lubinus Clinicum GmbH &<br />
Co. KG, tritt damit die Nachfolge von Dr. Jürgen<br />
Mau an, der nach 15-jähriger Zugehörigkeit zu diesem<br />
Gremium sein Amt niedergelegt hat. (KGSH)<br />
Herzzentrum im Krankenhaus Reinbek<br />
fertig gestellt<br />
Am 9. Dezember weihte<br />
das Adolf-Stift Krankenhaus<br />
Reinbek sein nunmehr<br />
fertig gestelltes kardiologisches<br />
Zentrum ein.<br />
Nach der Eröffnung des<br />
Herzkatheter-Labors 2004<br />
in Kooperation mit Prof.<br />
Kuck (Allgemeines Krankenhaus<br />
St. Georg, Ham-<br />
burg) konnten nun die<br />
Umbau- und Einrichtungsarbeiten<br />
an der gesamten<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
PD Dr. Herbert Nägele<br />
(Foto: hk)
11<br />
kardiologischen Funktionseinheit abgeschlossen werden,<br />
das heißt Herzschrittmacher- und Defibrillatoren-OP,<br />
Schrittmacher-Ambulanz, Echokardiographie,<br />
EKG, Lungenfunktionsmessung u. a.<br />
Der Leitende Arzt, PD Dr. Herbert Nägele, und der<br />
Chefarzt der gesamten Inneren Abteilung,<br />
Prof. Dr. Stefan Jäckle, wiesen darauf hin, Abb. 2<br />
dass Reinbek die höchsten Patientenzahlen<br />
in der Rhythmologie habe mit Ausnahme<br />
der Uni-Kliniken. Speziell für die Kinderkardiologie<br />
gibt es ab 1. Januar eine Kooperation<br />
mit einem niedergelassenen Spezialisten.<br />
(hk)<br />
Neues Hautarztverfahren diskutiert<br />
Meeting auf Sylt<br />
Abb. 1<br />
Abb. 1: Dr. Appl diskutiert in der Expertenrunde den neuen erweiterten Hautarztbericht.<br />
Abb. 2: Das Tagungsbüro des 6. BG-Meeting verlor nie den Überblick.<br />
(Fotos: Florian Grotelüschen/Asklepios-Nordseeklinik)<br />
80 Hautärzte, Arbeitsmediziner und Mitarbeiter der<br />
Berufsgenossenschaften diskutierten über das neue<br />
erweiterte Hautarztverfahren, die Folgemeldungen<br />
und den integrierten Hautschutz.<br />
Im Herbst vorigen Jahres fand in der Asklepios Nordseeklinik<br />
in Westerland auf Sylt das 6. BG-Meeting<br />
für Hauterkrankungen und Allergien statt. Eingeladen<br />
hatte der Berufsverband der Deutschen Dermatologen.<br />
Die inhaltlichen Schwerpunkte betrafen das<br />
neue Hautarztverfahren, primäre, sekundäre und tertiäre<br />
Prävention und in diesem Zusammenhang<br />
Schwerpunkte wie Hautschutzsalben und Hautschutzhandschuhe.<br />
Von den 80 Teilnehmern war etwa ein Drittel aus den<br />
Berufsgenossenschaften als Sachbearbeiter, Arbeitsmediziner,<br />
Hautschutztrainer und technischer Aufsichtsdienst<br />
angereist. So konnten in der interdisziplinären<br />
Diskussion einerseits die Stufen im Verwal-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
tungsverfahren bei Meldung durch Hautärzte (Hautarztbericht)<br />
aus unterschiedlichen Berufsgenossenschaften<br />
transparent gemacht werden und Schnittstellenprobleme<br />
sowie Vor- und Nachteile für die<br />
Versicherten kompetent diskutiert werden.<br />
Beiträge über die<br />
Bedeutung der gewerblichenHauterkrankungen<br />
von<br />
Dr. K. C. Appl<br />
(Berlin) sowie über<br />
den neuen Hautarztbericht<br />
waren<br />
ebenso vertreten<br />
wie berufspolitische<br />
Themen (EBM<br />
2000plus; referiert<br />
durch Dr. Strömer<br />
aus Mönchengladbach) und ein<br />
intensives praktisches „Stations-<br />
Training“ zu den Themen Handhygiene,<br />
Handschuhe und Hautpflege<br />
sowie -schutz bildeten die<br />
thematischen Höhepunkte.<br />
Abgerundet wurde die Veranstaltung<br />
durch zwei Expertenrunden<br />
zur praktischen Durchführung und<br />
Gestaltung des neuen Hautarztberichtes<br />
(Trainer Dr. Appl/Berlin)<br />
und zur Einführung des Qualitätsmanagements<br />
in die Praxis (Trainer<br />
Dr. Buhles/Sylt). (Dr. Norbert<br />
Buhles, Dr. Stephanie Denzer-Fürst)<br />
MDK <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> und MDK Hamburg<br />
fusionieren<br />
Im Dezember hat das <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>ische Sozialministerium<br />
die Fusion der Medizinischen Dienste der<br />
Krankenversicherung (MDK) in beiden Bundesländern<br />
genehmigt. Der MDK Mecklenburg-Vorpommern<br />
konnte sich zu einer Beteiligung nicht entschließen.<br />
Ziel der von den Kassen betriebenen Zusammenlegung<br />
sind Einsparungen beim Verwaltungspersonal<br />
(allein in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> etwa 50 von insgesamt<br />
200 Stellen), ein Hauptsitz in Hamburg und rationelle<br />
Strukturen mit moderner Informationstechnologie,<br />
sodass erhebliche Kostenersparungen erwartet werden.<br />
Für die Ärzteschaft ist bedeutsam, dass Aussichten<br />
auf zügigere Bearbeitung und verbesserte kollegiale<br />
Kontakte bestehen, wie der Geschäftsführer des MDK<br />
Nachrichten in Kürze<br />
11
Nachrichten in Kürze<br />
12<br />
in Lübeck und designierte Geschäftsführer des fusionierten<br />
MDK, Peter Zimmermann, auf Anfrage zu<br />
verstehen gab. Ärztlicher Leiter des MDK wird bzw.<br />
bleibt Dr. Björn Buxell (ebenfalls bisher MDK<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>). Einzelheiten stehen erst nach<br />
der konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrates<br />
am 20. Januar fest. (hk)<br />
Prof. Dr. Jörg Haasters verabschiedet<br />
21 Jahre Engagement für die Gesundheit der<br />
Patienten<br />
Prof. Dr. Jörg Haasters, der als Ärztlicher Direktor der<br />
Ostseeklinik Damp zum 31. Dezember 2005 ausgeschieden<br />
ist, wurde im Kreis von 140 Orthopäden<br />
und Sportmedizinern verabschiedet. Im Rahmen eines<br />
orthopädisch-sportmedizinischen<br />
Symposiums ehrte Dr. Carl Hermann<br />
Schleifer (Vorstandsvorsitzender der<br />
Damp Holding AG) den langjährigen<br />
Ärztlichen Direktor und anerkannten<br />
Orthopäden. Insgesamt 21 Jahre hat er<br />
als Ärztlicher Direktor die Weiterentwicklung<br />
der Ostseeklinik Damp vorangetrieben.<br />
In seiner Laudatio stellt Dr. Schleifer weiter<br />
fest: „Prof. Haasters hat der Ostseeklinik<br />
Damp Impulse zur Weiterentwicklung<br />
gegeben und das Repertoire der operativen<br />
und konservativen Behandlungsmöglichkeiten<br />
ausgedehnt.“<br />
Neben seiner klinischen Tätigkeit in der<br />
Klinik engagiert sich der Orthopädie und Sportmediziner<br />
schon seit Jahren im Vorstand des <strong>Schleswig</strong>-<br />
<strong>Holstein</strong>ischen Sportärztebundes, seit 1996 ist er<br />
zweiter Vorsitzender. Dahinter steckt sein ausgesprochenes<br />
Ziel, einen hohen Ausbildungsstand von<br />
Sportmedizinern sicherzustellen. Darüber hinaus lehrt<br />
er seit 1994 in der Universität Flensburg im Fachgebiet<br />
Sportmedizin. Dieses Engagement führte 1998<br />
zur Professur. Siehe dazu auch das Interview auf Seite<br />
36 (Die Red.). (Damp)<br />
Bundesweit erstes DMP Diabetes I:<br />
„Zusammenarbeit mit Ärzten hervorragend“<br />
Das Bundesversicherungsamt hat das von den<br />
schleswig-holsteinischen Krankenkassen gemeinsam<br />
mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) des Landes<br />
erarbeitete Disease-Management-Programm für<br />
Typ 1-Diabetiker genehmigt. Damit sei dieses Programm<br />
zum ersten Mal für ein Bundesland akkreditiert<br />
worden, teilten die AOK <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
und die KVSH gemeinsam mit. Nun sei die medizini-<br />
sche Versorgungskette für Diabetiker geschlossen,<br />
denn für Typ 2-Diabetiker gab es schon seit 2003 ein<br />
genehmigtes Programm (für etwa 40 000 Patienten).<br />
Als erste nehmen jetzt die bereits eingeschriebenen<br />
850 Typ 1-Patienten am neuen Programm teil. Ein<br />
ungewöhnliches Lob sei noch erwähnt: Den Rang Eins<br />
unter den Bundesländern führte der stellvertretende<br />
Vorstandsvorsitzende der AOK <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>,<br />
Dr. Dieter Paffrath, nicht zuletzt darauf zurück, „dass<br />
die Zusammenarbeit mit der KVSH und den beteiligten<br />
Ärzten wirklich hervorragend und konstruktiv<br />
war!“ (hk)<br />
Neue Akademie<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
Für die Metropolregion Hamburg gibt es als partielle<br />
Nachfolgerin der Evangelischen Akademie Nordelbi-<br />
Geschäftsführer Wolfram Scharenberg, Vorstandschef Pastor Baumbach<br />
Stiftung Alsterdorf, Hauptpastor Räder St. Michaelis, Propst PD Dr. theol.<br />
Johann Hinrich Claussen (v. l. n. r.) (Foto: hk)<br />
en (Bad Segeberg und Hamburg) die Evangelische<br />
Akademie Hamburg e. V. Gründungsmitglieder sind<br />
die Stiftung Alsterdorf (große evangelisch geprägte<br />
Behinderteneinrichtung mit Krankenhaus und weiteren<br />
medizinischen Einrichtungen), die fünf Hamburger<br />
Hauptkirchen und die Bildungsstätte „Haus<br />
am Schüberg“ (Kreis Stormarn). Die neue Akademie<br />
hat weder eigenes Haus noch Personal, sondern stützt<br />
sich als Netzwerk auf die Einrichtungen und bisherigen<br />
Angebote der Mitglieder. Statt der damaligen<br />
Vielzahl sollen weniger, aber anspruchsvolle Themen<br />
des gesellschaftlichen Diskurses dominieren, darunter<br />
auch aus Gesundheitswesen und Medizinethik. Beispiel:<br />
Das Norddeutsche Forum Gesundheitspolitik<br />
lebt wieder auf mit einem Streitgespräch zwischen<br />
Medizin, Theologie und Politik über Sterbehilfe am<br />
22. März, 20 Uhr, Gemeindezentrum der Hauptkirche<br />
St. Nikolai. Näheres zum vorliegenden Programm des<br />
1. Halbjahres 2006 unter www.eahh.de. Für das übrige<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> plant die Nordelbische Kirche<br />
dem Vernehmen nach ein ähnliches Netzwerk. (hk)
Integrierte Versorgung<br />
Nach anfänglicher Skepsis scheint bei mehr und mehr<br />
Gesundheitsdienstleistern, zumal Krankenhäusern,<br />
die Vorstellung Platz zu greifen, die vom Gesetzgeber<br />
ausgedachte „Integrierte Versorgung“ sei zwar nicht<br />
ideal, man sei aber gut beraten, das Beste daraus zu<br />
machen und durch Vertragsschließungen im Gesundheitsmarkt<br />
Positionen zu besetzen und „mitzumischen“,<br />
ehe andere einem zuvorkommen. So oder ähnlich<br />
war es zu hören beim 1. Hamburger Symposium<br />
für Integrierte Versorgung am 30. November 2005 im<br />
Congress Center Hamburg. Das Albertinen-Diakoniewerk<br />
mit mehreren Kliniken im Norden Hamburgs<br />
(und Verbindungen nach <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>)<br />
hatte die Initiative ergriffen und so eine Informationsplattform<br />
über Stand und Möglichkeiten der Kooperationspartnerschaften<br />
und Versorgungsmodelle geschaffen.<br />
An die 400 Teilnehmer waren da, darunter<br />
eine Reihe aus <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, z. B. aus Norderstedt,<br />
Bad Segeberg, Rickling, Bad Bramstedt, Itzehoe,<br />
Damp, Malente u. a. Dazu kamen Vertreter von<br />
bereits etablierten Netzen, wie vom Norddeutschen<br />
Herz-Netz (mit Albertinen-Gruppe, Marien-Krankenhaus,<br />
Barmer Ersatzkasse), dabei auch das Universitätsklinikum<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> Kiel und Lübeck,<br />
die Ostseeklinik Schönberg-Holm, die Kompass-Klinik<br />
Kiel und Gesundheitsnetz Region Wedel.<br />
Wenn es gelingen sollte, das bisher oft fehlende kooperative<br />
Miteinander im Gesundheitswesen mit dem<br />
Vehikel Integrationsverträge inhaltlich zu verbessern,<br />
wäre der Optimismus der Veranstalter am Ende<br />
gerechtfertigt. Am 1. Dezember 2006 soll das Nachfolgesymposium<br />
stattfinden (www.integrierte-versorgung-hamburg.de).<br />
(hk)<br />
Praxisjubiläum<br />
Am 1. Januar 2006 feierte Gabriele Röpnack zehnjähriges<br />
Dienstjubiläum als Praxismanagerin in der<br />
Praxis für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Ahrensburg,<br />
Dr. Dr. med. dent. Volker-Alexander von<br />
Zitzewitz und Dr. med. dent. Matei Apostolescu,<br />
Große Str. 19, 22926 Ahrensburg. Das Praxisteam<br />
gratuliert! (SH)<br />
Katastrophenmedizin:<br />
Erfolgreiche Übung um<br />
KKW Krümmel<br />
Auch die medizinische Seite<br />
habe gut geklappt, sagte<br />
der Leiter der Katastrophenabwehr<br />
in Hamburg,<br />
Innenstaatsrat Dr. Stefan<br />
Schulz, nach einer Länder übergreifenden Katastrophenschutz-Übung<br />
am 26. November um das Kernkraftwerk<br />
(Geesthacht-) Krümmel herum. Insgesamt<br />
800 Katastrophenschützer aus <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>,<br />
Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern<br />
übten die Bewältigung eines erheblichen Störfalls<br />
mit Austritt von Radioaktivität. Unter anderem<br />
durchliefen 50 Personen exemplarisch 13 Stationen<br />
in der Notfallstation in Hamburg-Wandsbek mit Dekontamination,<br />
erster medizinischer Untersuchung<br />
und Entscheidung über weitere Strahlenschutzmaßnahmen<br />
wie die Verabreichung von Jodtabletten.<br />
Daten aus Messungen und Probenanalysen wurden<br />
an das Sozialministerium in Kiel geleitet. Mitarbeiter<br />
erstellten eine Übersicht über die Lage, und eine radiologische<br />
Fachberatungseinheit übermittelte dann<br />
die Handlungsempfehlungen an die Katastrophenschutzbehörden<br />
der vier Bundesländer. (hk)<br />
„Schulmedizin“<br />
Beim Kolloquium „Wer heilt, hat recht ... Woran und<br />
wie misst sich der Erfolg in der Medizin?“ der Akademie<br />
Loccum zusammen mit dem Zentrum für Gesundheitsethik,<br />
Hannover, referierte am 7. November<br />
2005 Prof. Dr. Albrecht Encke, Präsident der Arbeitsgemeinschaft<br />
der wissenschaftlichen medizinischen<br />
Fachgesellschaften (AWMF) u. a. zum Thema<br />
„Schulmedizin“, ein Zitat:<br />
„Den Begriff Schulmedizin möchte ich streng vermeiden.<br />
Es handelt sich um eine wissenschaftlich begründete<br />
Medizin, die durch die Wortwahl ‘Schulmedizin’<br />
verunglimpft und zu einer Alternative von z. T.<br />
äußerst zweifelhaften Methoden herabgestuft werden<br />
soll.“ Richtig sei vielmehr, dass die so genannte Alternativmedizin,<br />
besonders in ihrer ganzheitlichen Ausrichtung,<br />
eine Ergänzung - keine Alternative - darstelle.<br />
Der Begriff Schulmedizin sei 1875 von einem<br />
Anhänger der Homöopathie geprägt worden. (hk)<br />
Kammermitarbeiter<br />
Nadine Liebau und Kerstin<br />
Essler-Müller haben nach langjähriger<br />
Tätigkeit die <strong>Ärztekammer</strong><br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
verlassen. Nadine Liebau war<br />
im Sachbereich Präsident und<br />
Vorstand tätig. Sie hat in diesem<br />
Jahr eine neue Stelle beim<br />
Vorstand der Kassenärztlichen<br />
Vereinigung angetreten. Ihre<br />
Aufgaben in der <strong>Ärztekammer</strong><br />
Nadine Liebau<br />
(Foto: rat)<br />
Nachrichten in Kürze<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 13
Nachrichten in Kürze<br />
14<br />
hat Patricia Hradetzky<br />
übernommen. Kerstin<br />
Essler-Müller war zuständig<br />
für die Ethikkommission.<br />
Sie hat einen neuen<br />
Arbeitgeber in ihrem<br />
Wohnort Hamburg ge-<br />
funden. Die Sachbearbeitung<br />
der Ethikkommission<br />
übernimmt Grit<br />
Morawski. (ro)<br />
�<br />
Leserbrief von Dr. Gottfried Köppl zum Thema<br />
Fortbildung/Barcode-Versand<br />
Ich bin überzeugt, dass der Gesetzgeber (wie viele Ärzte<br />
sitzen eigentlich im Bundestag?<br />
- Nach unserer Kenntnis<br />
sechs, Red.) beurteilen kann, wie<br />
viele Fortbildungspunkte ich brauche,<br />
um ein guter Arzt zu sein.<br />
Gut genug jedenfalls, um auch<br />
meinen Nebenjob als Kassierer<br />
der Krankenkassen ausführen zu<br />
können. Dass die Politik mit solchen<br />
und ähnlichen Maßnahmen<br />
die „Ärzteschwemme“ im Land -<br />
Kerstin Essler-Müller (li.), Grit Morawski<br />
(Foto: wi)<br />
�Leserbriefe<br />
Dr. Köppl<br />
(Foto: Privat)<br />
wie jetzt schon absehbar erfolgreich - bekämpft, daran<br />
haben wir uns schon gewöhnt. Aber dass auch unsere<br />
eigenen Standesvertreter daran mitwirken, ist<br />
doch bemerkenswert.<br />
Erst unterzieht man uns einem flächendeckenden Demenz-Screening,<br />
indem man uns fünfstellige Abrechnungsziffern<br />
auswendig lernen lässt. Bei so viel Innovationsfreude<br />
der Kassenärztlichen Vereinigung (die Kollegen,<br />
die den Sinn dieses „Fortschritts“ schon verstanden<br />
haben, bitte ich um briefliche Nachhilfe) darf<br />
auch die Kammer nicht zurückstehen, sie schickt uns<br />
selbstklebende Barcode-Etiketten. Meiner Verwunderung<br />
suchte ich mit der beigefügten Begründung abzuhelfen:<br />
Ich verstand vor allem, dass man bei der<br />
Kammer keine Lust hat, meine Fortbildungspunkte<br />
nachzuzählen. Dafür habe ich volles Verständnis! Mein<br />
Vorschlag zur Güte: Ich zähle meine Punkte selbst (Demenz-Test<br />
bestanden - siehe oben!) und füge eine eidesstattliche<br />
Erklärung bei, dass ich die Fortbildungsbescheinigungen<br />
alle ehrlich erworben habe, schließlich<br />
habe ich schon bei der Approbation nachgewiesen,<br />
dass ich kein gewohnheitsmäßiger Fälscher und Betrüger<br />
bin.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
Ich gehöre schon zu den Älteren, Drohungen<br />
mit dem Entzug der Zulassung beeindrucken<br />
mich nur noch mäßig. Außerdem habe ich<br />
meine Fortbildungspunkte schon ziemlich zusammen,<br />
und den Rest werde ich mir bevorzugt<br />
dort holen wo der Scanner noch nicht<br />
zum Instrumentarium der ärztlichen Fortbildung<br />
gehört. Die schöne neue Zukunft, wenn<br />
dann irgendwann allen Ärzten im Land ein Chip<br />
zur leichteren elektronischen Erfassung eingepflanzt<br />
wird, werde ich als Aktiver wohl nicht<br />
mehr erleben. Dann wird wohl in Bad Segeberg anstelle<br />
der ganzen schönen <strong>Ärztekammer</strong> eine einsame<br />
Supermarkt-Kassiererin sitzen, die die telemetrisch<br />
erfassten Daten in den dann perfektionierten EIV einscannt.<br />
Im Interesse der jüngeren Kollegen mein Appell: Schaffen<br />
Sie die EFN wieder ab und stampfen Sie die Barcodes<br />
ein! Mit den gesparten Kosten für Software,<br />
Druck und Versand kann vielleicht ein „Ein-Euro-Jobber“<br />
Arbeit bekommen, der die Fortbildungsbescheinigungen<br />
nachzählt, bündelt und abheftet. Vielleicht ist<br />
es ein arbeitsloser Philosoph, der nebenher eine Abhandlung<br />
„Über Stil und Würde“ verfasst.<br />
Ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen meine<br />
Empfindungen teilen.<br />
Dr. Gottfried Köppl, Große Str. 77, 24937 Flensburg<br />
�<br />
Leserbrief von Dr. Frank Moosig zum Artikel<br />
„Fallstudie Homöopathie Sero-negativ Arthritis“,<br />
SHÄ 11/2005, S. 64 ff.<br />
Der Bericht über die erfolgreiche homöopathische Behandlung<br />
eines Patienten, der möglicherweise an einer<br />
rheumatischen Erkrankung litt (der dürftigen Beschreibung<br />
nach aber wohl kaum an einer rheumatoiden Arthritis),<br />
versucht den Eindruck zu erwecken, die Homöopathie<br />
sei eine erwiesenermaßen effektive Therapie<br />
der rheumatoiden Arthritis. Unter den Suchbegriffen<br />
„homoeopathy“ (sowie Abwandlungen davon) und<br />
„rheumatoid arthritis“ finden sich nur sehr wenige Einträge<br />
in „PubMed“, darunter nur drei randomisierte<br />
und kontrollierte Studien 1,2,3<br />
. Zwei davon kommen zu<br />
dem Ergebnis, dass die homöopathische Behandlung<br />
nicht wirksamer ist als Placebo. Eine dieser Arbeiten,<br />
die jüngste und methodisch beste, stammt bemerkenswerterweise<br />
aus dem Royal London Homoeopathic<br />
Hospital. Eine dritte, ältere und methodisch<br />
schlechtere Studie kommt zu einem positiven Ergebnis<br />
zugunsten der Homöopathie.<br />
Die von Dr. Rieberer zitierte Studie von Linde und Mitarbeitern<br />
in Lancet 4<br />
belegt keineswegs die Wirksamkeit<br />
der Homöopathie, sie kommt lediglich zu dem Er-
gebnis, dass die Annahme, Homöopathie beruhe ausschließlich<br />
auf dem Placeboeffekt, nicht nachgewiesen<br />
werden kann. Das entscheidende Zitat aus der Interpretation<br />
möchte ich gern wiedergeben: „However, we<br />
found insufficient evidence from these studies that homeopathy<br />
is clearly efficacious for any single clinical<br />
condition”. Dies also ist eine der „zahlreichen Arbeiten“<br />
die ein „gutes Ansprechen“ von Erkrankungen aus dem<br />
„rheumatischen Formenkreis“ auf die homöopathische<br />
Behandlung belegen! Eine neuere Veröffentlichung in<br />
Lancet kommt hingegen zu dem Schluss, dass die Effekte<br />
der Homöopathie Placeboeffekte sind 5<br />
.<br />
Um hier, wie Homöopathen es ja auch häufig tun, aus<br />
eigener Erfahrung mit Behandlung rheumatischer Erkrankungen<br />
zu argumentieren: Ich habe, anders als<br />
Dr. Rieberer, nicht den Eindruck, dass die Homöopathie<br />
häufig die letzte Anlaufstelle nach Versagen der<br />
wissenschaftlichen Medizin ist. Vielmehr scheuen viele<br />
Patienten die empfohlene frühzeitige Behandlung der<br />
rheumatoiden Arthritis mit Methotrexat oder anderen<br />
DMARDs aus Angst vor Nebenwirkungen. Homöopathische<br />
Therapieversuche stehen daher häufig am Anfang<br />
des Krankheitsverlaufes und oft sogar vor der<br />
exakten Klassifikation der Erkrankung. Vor einem Verzicht<br />
auf eine frühzeitige DMARD-Behandlung ist aber<br />
dringend zu warnen, da gerade in der frühen Phase der<br />
Erkrankung die meisten Gelenkschäden eintreten. Der<br />
verbreiteten Auffassung, dass man zunächst „milde“<br />
behandeln könne und erst bei Therapieversagen „stärkere“<br />
Medikamente einsetzen sollte, ist daher vehement<br />
zu widersprechen.<br />
Literatur beim Verfasser oder im Internet unter<br />
www.aerzteblatt-sh.de<br />
Dr. Frank Moosig, Friedenskamp 4, 24119 Kronshagen<br />
�<br />
Leserbrief von Dr. Jochen Rohwer zum Artikel<br />
„Fallstudie Homöopathie - Sero-negative Arthritis“,<br />
SHÄ 11/2005, S. 64 ff.<br />
Die Autorin G. Rieberer beschreibt ihre Anamnese und<br />
Behandlung eines Patienten mit der Diagnose „seronegative<br />
Arthritis“.<br />
Das ihr am auffälligsten erscheinende Symptom für eine<br />
homöopathische Arzneimittelwahl ist der Umstand,<br />
dass der Patient hauptsächlich von der Familie und Arbeit<br />
gesprochen habe, seine Ängste sich auf die Versorgung<br />
der Familie und seine Funktionstüchtigkeit bezögen;<br />
sie verordnete ihm daher Kalium carbonicum C 12<br />
täglich. Etwa sechs Wochen später erkennt die Kollegin<br />
ihren Fehler: „... keine Veränderung ... noch nicht<br />
einmal eine Verbesserung des Wohlbefindens oder des<br />
Schlafes ... auch keine homöopathische Erstreaktion<br />
i. S. einer Akzentuierung der Beschwerden ...“ und<br />
verordnet ein anderes Mittel.<br />
Ich bin der Kollegin dankbar für diese sehr anzuerkennende<br />
Offenheit: Beschreibt sie hier doch ein heute leider<br />
vielfach zu sehendes grundsätzliches Missverständnis<br />
von Homöopathie, unter dem sowohl Patienten<br />
als auch ihre oft frustrierten gutwilligen Behandler(innen)<br />
zu leiden haben. Auch ich zähle mich dazu,<br />
der ich ehemals in meiner Ausbildung der spekulativen<br />
„Psycho-Homöopathie“ aufgesessen bin.<br />
Leider beschreibt die Kollegin nicht, welche Fehler sie<br />
gemacht hat, könnte doch daraus gelernt werden!<br />
So möchte ich es hier nachholen: Es wurden zwei<br />
grundsätzliche Regeln der bewährten Homöopathie<br />
Hahnemanns missachtet:<br />
1. In der Homöopathie wird nicht nach Krankheitsnamen<br />
verordnet, wie in der konventionellen Medizin,<br />
sondern nach den individuellen und auffälligen Symptomen<br />
in einem Krankheitsfall. Die „moderne Homöopathie“<br />
grenzt sich deutlich ab von der Homöopathie<br />
Hahnemanns: Sie individualisiert nicht, sondern<br />
sie fasst wieder zusammen zu Gruppen, zu<br />
Diagnosen, nur heißen diese nicht, wie in der so genannten<br />
Schulmedizin zum Beispiel „sero-negative<br />
Arthritis“, sondern „Betonung der Familie“,<br />
„Pflichtbewusstsein“. - Dass einem Mann seine Arbeit<br />
viel bedeutet, dass er sich verantwortlich fühlt<br />
für die Ernährung seiner Familie, sind sehr fragwürdige<br />
„Symptome“, jedenfalls keinesfalls individuelle,<br />
denn Millionen von Männern mit oder ohne sero-negative<br />
Arthritis haben dieses fragwürdige „Symptom“.<br />
2. In der Homöopathie wird nicht verordnet, weil ein<br />
bestimmtes Medikament so und so wirken müsste,<br />
sondern weil seine charakteristischen Wirkungen<br />
auf den menschlichen Organismus aus akribischen<br />
Arzneimittelprüfungen bekannt sind. Hahnemann<br />
war sehr enttäuscht von damaliger Medizin, die<br />
über die Zusammensetzung der Körpersäfte, aus<br />
Signaturenlehre und Reagenzglas bekannte Arzneiwirkungen<br />
spekulierte - sein oberstes Ziel war Heilungsgewissheit!<br />
Er wollte wissen, wie ein menschlicher<br />
Organismus auf Arzneien der damals bekannten<br />
Materia medica reagiert. Beobachtungen<br />
bei Arzneimittelprüfungen, Reaktionen auf eine Arznei<br />
am gesunden Menschen führten zu langen Symptomenreihen,<br />
zu einer „Reinen Materia medica“;<br />
die Bestätigung solcher Symptome und deren klinische<br />
Bestätigungen zeigen Charakteristika einer<br />
Arznei. Das (fragwürdige) Symptom „Familienverbundenheit“<br />
taucht weder in Hahnemanns Prüfungen,<br />
noch in der Fachliteratur der letzten 150 Jahre<br />
auf, ebenso wenig wie „Pflichtbewusstsein“. Diese<br />
„Symptome“ wurden ohne verlässliche Grundla-<br />
Nachrichten in Kürze<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 15
Nachrichten in Kürze<br />
16<br />
ge vor wenigen Jahren in das Schrifttum „moderner<br />
Homöopathie“ übernommen und die Mär verbreitete<br />
sich rasant.<br />
Zu den für die Arzneiwahl verwertbaren Zeichen und<br />
Symptomen dagegen gehört z. B., dass dieser an<br />
Schmerzen leidende Patient „nur Minuten still sitzen<br />
kann“, seine Schmerzen ihn gar im Behandlungszimmer<br />
umhertreiben, wie die Kollegin beschreibt, Beschwerden<br />
also, unter der nur ein Teil von Patienten<br />
mit rheumatischen Erkrankungen leidet und die in der<br />
homöopathischen Materia medica gut zu finden sind.<br />
Weitere Symptome, die uns die Autorin außer dem<br />
wiederum fragwürdigen „Symptom“ „Leistungsbedürfnis“<br />
leider nicht im Einzelnen benennt, führten sie<br />
schließlich bei einer Überprüfung ihrer Anamnese zum<br />
Arzneimittel Ferrum, einer anscheinend recht guten<br />
Wahl - schon nach zwei Wochen sei es dem Patienten<br />
besser gegangen, nach zwei Monaten habe das CRP<br />
im Normbereich gelegen, es wird ein Beobachtungszeitraum<br />
von weiteren 13 Monaten „ohne Bedarf einer<br />
weiteren konventionellen Behandlung ... bei ‘gutem<br />
Wohlbefinden’“ angeführt. Ob die Frühberentung des<br />
erst ca. 48-jährigen Patienten aus betrieblichen oder<br />
gesundheitlichen Gründen erfolgte, wird leider nicht<br />
klar.<br />
Dr. Jochen Rohwer, Schwartauer Allee 10, 23554 Lübeck<br />
�<br />
Leserbrief zum Artikel „Fallstudie Homöopathie:<br />
Sero-negative Arthritis“, SHÄ 11/2005,<br />
S. 64 ff.<br />
Die Fallbeschreibung der Kollegin Rieberer und die daraus<br />
gezogenen Schlussfolgerungen können aus internistisch-rheumatologischer<br />
Sicht nicht unwidersprochen<br />
bleiben:<br />
�� In der Kasuistik beschreibt die Kollegin einen 46jährigen<br />
Mann mit therapieresistenten muskuloskelettalen<br />
Schmerzen seit März 2002, der sie<br />
Oktober 2002 erstmals aufsuchte. Die Arbeitshypothese<br />
einer sero-negativen Arthritis erscheint<br />
uns nicht nachvollziehbar. Die Kollegin selbst beschreibt,<br />
dass der Patient keine sichtbar entzündlichen<br />
Gelenkveränderungen hatte. Eine Arthritis<br />
ohne Arthritis gibt es jedoch nicht. Der langsam abflauende<br />
Charakter der Beschwerden erinnert vielmehr<br />
an eine Polymyalgia rheumatica.<br />
�� Des Weiteren lesen wir, dass „... Erkrankungen aus<br />
dem rheumatischen Formenkreis in der Regel sehr<br />
gut auf eine homöopathische Behandlung ansprechen“.<br />
Eine Arbeit aus dem British Medical Journal<br />
(BMJ) 1991 und dem Lancet 1997 sollen diese<br />
Aussage belegen. Liest man diese Arbeiten jedoch,<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
wird man vom Gegenteil überzeugt. So lautet die<br />
Schlussfolgerung im BMJ 1991 Feb 9; 302<br />
(6772):316-23. „The evidence of clinical trials is positive<br />
but not sufficient to draw definitive conclusions.“<br />
Im Lancet 1997, September 20; 350<br />
(9081):834-43 lesen wir „... we found insufficient<br />
evidence from these studies that homeopathy is<br />
clearly efficacious ...“ Noch genauer drückt es die<br />
Zeitschrift Rheumatology (Oxford) 2001 September;<br />
40(9):1052-5 aus. In einer randomisierten<br />
kontrollierten Studie an 112 Patienten über sechs<br />
Monate findet sich kein Effekt der Homöopathie.<br />
Dr. Georgi<br />
(Foto: Privat)<br />
In der deutschsprachigen Literatur<br />
wurden homöopathische Studien<br />
in der DMW 1999, März<br />
2005; 124(9):261-266 kritisch<br />
gewürdigt. Die Kollegen Strubelt<br />
und Claussen zeigten in einer Metaanalyse<br />
von 65 Studien einen<br />
fehlenden Effekt der Homöopathie.<br />
Nicht zuletzt sei auf die Untersuchungen<br />
der Cochrane-<br />
Library 2005 über Homöopathie<br />
bei chronischem Asthma und Demenz verwiesen. Für<br />
die Wirksamkeit der Homöopathie auch bei diesen Erkrankungen<br />
findet sich keine Evidenz.<br />
Zusammenfassend stellen wir Folgendes fest:<br />
1. Der beschriebene Patient litt wahrscheinlich an einer<br />
Polymyalgia rheumatica mit dem üblichen abflauenden<br />
Schmerzcharakter und nicht an einer sero-negativen<br />
Arthritis.<br />
2. Entzündlich-rheumatische Systemerkrankungen<br />
(aber auch chronisches Asthma und Demenz) sprechen<br />
nicht auf eine homöopathische Behandlung<br />
an. Viel gefährlicher als der Einsatz der nutzlosen<br />
Homöopathie ist hierbei der Verlust an wertvoller<br />
Zeit bis zum Einsetzen einer wirksamen Behandlung<br />
unserer Rheumatiker. Bekanntermaßen treten die<br />
Hauptschäden der Erkrankung in den ersten Krankheitsmonaten<br />
bis Jahren auf. Wir alle sehen täglich<br />
die katastrophalen Gelenkzerstörungen bei Patienten<br />
mit zu spätem Beginn einer wissenschaftlich<br />
fundierten wirksamen Therapie. Bei Patienten<br />
mit Polymyalgia rheumatica besteht bei der häufig<br />
assoziierten Riesenzellarteriitis zudem das Risiko einer<br />
Erblindung.<br />
Dr. Joachim Georgi, Seute-Deern-Ring 20, 24351 Damp,<br />
sowie Prof. Dr. Angela Gause, Dr. Pontus Harten,<br />
Dr. Kerstin Jepsen-Schiemann, Dr. Helge Körber,<br />
Dr. Harald Markus, Dr. Susanne Nolof, Dr. Ulrich Schwab,<br />
Dr. Jochen Walter
Redaktionsschluss für die Annahme von Veranstaltungen für Ausgabe 2/2006<br />
ist der 20.01.2006<br />
Bad Malente-Gremsmühlen<br />
01.02.2006, 19:00-21:00 Uhr<br />
Differenzialdiagnose und moderne Therapieoptionen<br />
der Epilepsie<br />
Veranstalter, Veranstaltungsort, Auskunft und<br />
Anmeldung: August-Bier-Klinik, Dr. Günther<br />
Busch, Diekseepromenade 9-11, 23714 Bad Malente-<br />
Gremsmühlen, Tel. 04523/405-0, Fax 04523/405-100,<br />
E-Mail info@august-bier-klinik.de,<br />
Internet www.august-bier-klinik.de<br />
11.02.2006, 14:45 Uhr<br />
Indikationen für Musiktherapie<br />
Veranstaltungsort: Curtius-Klinik, Neue Kampstr. 2,<br />
23714 Bad Malente-Gremsmühlen<br />
Veranstalter, Auskunft und Anmeldung: Norddeutsche<br />
Gesellschaft für angewandte Tiefenpsychologie,<br />
Tel. 04381/409796 oder 04381/6533,<br />
Fax 04381/6501, E-Mail wadelssen@t-online.de,<br />
Internet www.ngat.de<br />
Bargfeld-Stegen<br />
01.02.2006, 17:30 Uhr<br />
Dinner-Teaching 2006: Neue therapeutische Möglichkeiten<br />
in der Depressionstherapie<br />
22.03.2006, 17:30 Uhr<br />
Metabolische Aspekte in der Langzeitbehandlung<br />
schizophrener Patienten<br />
Veranstalter, Veranstaltungsort, Auskunft und<br />
Anmeldung: Heinrich-Sengelmann-Krankenhaus,<br />
Kayhuder Str. 65, 23863 Bargfeld-Stegen, Abt. Psychiatrie,<br />
Dr. Hans-Joachim Funke, Tel. 04535/505312,<br />
Fax 04535/505367, E-Mail h.funke@alsterdorf.de<br />
Berlin<br />
20<br />
23.-25.02.2006<br />
Funktionelle und praktische Neuroanatomie für<br />
Neurologen, Neurochirurgen, Neuroradiologen<br />
und Psychiater<br />
Veranstalter, Veranstaltungsort, Auskunft und<br />
Anmeldung: Charité, Universitätsmedizin Berlin,<br />
Centrum für Anatomie, Prof. Dr. Rüdiger W. Veh,<br />
Philippstr. 12, 10115 Berlin, Tel. 030/450528062,<br />
Fax 030/450528912, E-Mail ruediger.veh@charite.de,<br />
Internet www.charite.de/anatomie<br />
Gebühr: 522 Euro<br />
Borstel<br />
26.01.2006, 18:00 Uhr<br />
Schlafbezogene Atmungsstörung und kardiovaskuläre<br />
Erkrankungen<br />
Veranstaltungsort: Krankenhaus Großhansdorf<br />
02.02.2006, 15:00 Uhr<br />
Wann sind Antibiotika bei der akuten Exazerbation<br />
der COPD indiziert?<br />
Veranstaltungsort: Seminarraum, 1. Stock, Medizinische<br />
Klinik<br />
09.02.2006, 15:00 Uhr<br />
Infektiöse Hepatitiden<br />
Veranstaltungsort: Seminarraum, 1. Stock, Medizinische<br />
Klinik<br />
14.02.2006, 16:30 Uhr<br />
Immunpathologie der Tuberkulose<br />
Veranstaltungsort: Reflektorium, Zentrumsseminar<br />
Veranstalter und Auskunft: Forschungszentrum<br />
Borstel, Medizinische Klinik, PD Dr. Christoph Lange,<br />
Parkallee 35, 23845 Borstel, Tel. 04537/188-332,<br />
Fax 04537/188-313, E-Mail clange@fs-borstel.de<br />
Damp<br />
27.-28.01.2006<br />
27.-28.05.2006<br />
23<br />
12.-13.08.2006<br />
23<br />
25.-26.11.2006<br />
23<br />
Curriculum Rehabilitationsrichtlinie<br />
Veranstaltungsort: Akademie Damp, 24349 Damp,<br />
Tel. 04352/808308, Fax 04352/808312,<br />
E-Mail lehrinstitut@damp.de<br />
Auskunft und Anmeldung: Doris Lemke, Arbeitsgemeinschaft<br />
Physikalische Medizin und Rehabilitation,<br />
Meckauerweg 5, 30629 Hannover,<br />
Tel. 0511/5859205, Fax 0511/5859206,<br />
E-Mail lemke.doris@mh-hannover.de<br />
Gebühr: 195 Euro<br />
Eutin<br />
Kurs III: 19.-22.01.2006<br />
Kurs IV: 09.-12.02.2006<br />
Kurs II: 09.-12.03.2006 40<br />
Naturheilverfahren in 4 Kursen<br />
Veranstaltungsort: Herzogliches Palais, Markt 9, Eutin<br />
Veranstalter, Auskunft und Anmeldung: Hufeland-Zentrum<br />
Eutin, Königstraßenpassage 2,<br />
Tel. 04521/8305810, Fax 04521/8305811,<br />
E-Mail hufeland-zentrum@t-online.de<br />
Gebühr: je Kurs 360 Euro<br />
Großhansdorf<br />
23<br />
40<br />
40<br />
28.01.2006, 9:00-13:00 Uhr<br />
2. Großhansdorfer Beatmungskolloqium<br />
Veranstalter, Veranstaltungsort: Krankenhaus<br />
Großhansdorf, Wöhrendamm 80, 22927 Großhansdorf<br />
Auskunft und Anmeldung: Dr. Bernd Schucher,<br />
Tel. 04102/601-0 oder Sekretariat Prof. Magnussen<br />
Tel. 04102/601-151, Fax 04102/601-373<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 17<br />
4<br />
Fortbildung
Fortbildung<br />
18<br />
Hamburg<br />
28.01.2006<br />
8. Jahrestagung der Norddeutschen Vereinigung<br />
für Schlafmedizin e. V. (NVSM)<br />
Veranstalter: NVSM, Internet www.nvsm.de<br />
Veranstaltungsort: Maritim Hotel Reichshof, Hamburg<br />
Anmeldung: Nord Service Projects Brigitte Breetzke<br />
Kongressdienst, Krögerskoppel 1, 24558 Henstedt-<br />
Ulzburg, Tel. 04193/757677, Fax 04193/757688,<br />
E-Mail nsp-breetzke@web.de<br />
Gebühr: 30 Euro<br />
13.02.2006, 17:00-19:00 Uhr<br />
Arbeitsmedizinische Falldemonstration und Fallbesprechung<br />
„Atemwegsirritantien BK 4302“<br />
Veranstalter, Veranstaltungsort, Auskunft: Univ.-<br />
Klinikum Hamburg-Eppendorf, Ordinariat und Zentralinstitut<br />
für Arbeitsmedizin, Seewartenstr. 10,<br />
20459 Hamburg, Sekretariat Prof. Dr. X. Baur,<br />
Tel. 040/428894-501, Fax 040/428894-514,<br />
E-Mail xaver.baur@bgw.hamburg.de, Internet<br />
www.uke.uni-hamburg.de/institute/arbeitsmedizin<br />
14.02.2006, 17:30-19:00 Uhr 2<br />
Die neuropsychologische Untersuchung aus ärztlich-gutachterlicher<br />
Sicht<br />
Veranstaltungsort: Fortbildungsakademie der <strong>Ärztekammer</strong><br />
Hamburg, Lerchenfeld 14 (Hammoniabad)<br />
Veranstalter und Auskunft: Arbeitskreis sozialmedizinisch<br />
interessierter Ärzte e. V. (ASIA), Friedrich-<br />
Ebert-Damm 245, 22159 Hamburg,<br />
Tel. 040/5300-2804, Fax 040/5300-2093,<br />
E-Mail info@sozialmediziner.de,<br />
Internet www.sozialmediziner.de<br />
17.02.2006, 9:00 Uhr<br />
Mikroskopieren in Therapie und Praxis<br />
Veranstaltungsort: Bernhard-Nocht-Institut Hamburg<br />
18.02.2006, 9:00-17:30 Uhr<br />
Tag der Reisegesundheit<br />
Veranstaltungsort: Katholische Akademie, Herrengraben<br />
4, 20459 Hamburg<br />
Veranstalter, Auskunft und Anmeldung: Bernhard-<br />
Nocht-Institut, Reisemedizinisches Zentrum, Bernh.-<br />
Nocht-Str. 74, 20359 Hamburg, Tel. 040/42818805,<br />
Fax 040/42818340, E-Mail rmz@gesundes-reisen.de<br />
18.02.2006, 8:30-17:15 Uhr<br />
Multi-slice CT, digitale Mammographie/Mammadiagnostik<br />
Veranstalter: Norddeutsche Röntgengesellschaft<br />
e. V. und Röntgengesellschaft von Niedersachsen,<br />
Bremen und Sachsen-Anhalt e. V.<br />
Veranstaltungsort, Auskunft und Anmeldung:<br />
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, „Erikahaus“,<br />
PD Dr. Jörn Lorenzen, Martinistr. 52, 20246<br />
Hamburg, Tel. 040/42803-3015, Fax 040/42803-<br />
4759, E-Mail lorenzen@uke.uni-hamburg.de<br />
3<br />
9<br />
7<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
Kiel<br />
01.02.2006, 15:30 s. t.<br />
Infektiologische und immunologische Aspekte von<br />
Varizellen<br />
Veranstalter: Kinderklinik der Universität Kiel<br />
Veranstaltungsort: Hörsaal der Universitäts-Kinderklinik,<br />
Schwanenweg 20, 24105 Kiel<br />
Auskunft: Frau Sindt, UK S-H, Campus Kiel, Klinik<br />
für Allgemeine Pädiatrie, Tel. 0431/597-1704, Fax<br />
0431/597-1831, Internet www.uni-kiel.de/pediatrics,<br />
E-Mail f.sindt@pediatrics.uni-kiel.de<br />
15.02.2006, 18:00-21:00 Uhr<br />
Interdisziplinäre Behandlung von gynäkologischen<br />
Unterbauchtumoren<br />
Veranstaltungsort: Hörsaal der Frauenklinik des<br />
UK S-H, Campus Kiel, Michaelisstr. 16, 24105 Kiel<br />
22.02.2006, 18:00-21:00 Uhr<br />
Symposium Psychoonkologie<br />
Veranstaltungsort: Hörsaal der Chirurgie, UK S-H,<br />
Campus Kiel<br />
Veranstalter: Tumorzentrum, UK S-H, Campus Kiel<br />
Auskunft: Tumorzentrum des UK S-H, Campus<br />
Kiel, Frau Wendt, Tel. 0431/597-2913, Dr. Buschbeck,<br />
Tel. 0431/597-3022<br />
15.02.2006, 18:00 Uhr<br />
Akute Herzinsuffizienz<br />
Veranstaltungsort: Hörsaal, Chirurgie, UK S-H,<br />
Campus Kiel<br />
Veranstalter und Auskunft: Sekretariat Prof. Dr. J.<br />
Scholz, Klinik f. Anästhesiologie u. Operative Intensivmedizin,<br />
UK S-H, Campus Kiel, Schwanenweg 21,<br />
24105 Kiel, Tel. 0431/597-2991, Fax 0431/597-3002,<br />
E-Mail kontakt@anaesthesie.uni-kiel.de<br />
15.02.2006, 18:00 Uhr<br />
Kopfschmerz update 2005/06: Was gibt es neues<br />
in der Diagnostik und Therapie?<br />
Veranstaltungsort: Konferenzraum, Klinik für Neurologie<br />
Auskunft und Anmeldung: Dr. Thorsten Bartsch,<br />
Klinik für Neurologie der CAU Kiel, Neurozentrum,<br />
Schittenhelmstr. 10, 24105 Kiel, Tel. 0431/597-8721,<br />
Fax 0431/597-8502,<br />
E-Mail t.bartsch@neurologie.uni-kiel.de,<br />
Internet www.uni-kiel.de/neurologie<br />
25<br />
03.-04.03.2006, je 9:00-18:00 Uhr<br />
TEE in der Anästhesiologie, Teil I<br />
17.-18.03.2006, je 9:00-18:00 Uhr<br />
TEE in der Anästhesiologie, Teil II<br />
Veranstaltungsort: Klinik für Anästhesiologie und<br />
Operative Intensivmedizin, Seminarraum, UK S-H,<br />
Campus Kiel, Schwanenweg 21, 24105 Kiel<br />
25<br />
Auskunft und Anmeldung: Frau Carstens, Sekretariat<br />
Prof. Dr. J. Scholz, Klinik für Anästhesiologie
und Operative Intensivmedizin, UK S-H, Campus<br />
Kiel, Schwanenweg 21, 24105 Kiel,<br />
Tel. 0431/597-2965, Fax 0431/597-3002,<br />
E-Mail kontakt@anaesthesie.uni-kiel.de,<br />
Internet www.uni-kiel.de/anaesthesie<br />
Gebühr: 495 Euro<br />
Lübeck<br />
25.01.2006, 16:00 Uhr c. t.<br />
Akne und Hidradenitis suppurativa - neues zu Pathogenese<br />
und Therapie<br />
01.02.2006, 16:00 Uhr c. t.<br />
Neues aus der pädiatrischen Dermatologie<br />
08.02.2006, 16:00 Uhr c. t.<br />
Das DEJAVU-System und seine Nutzung in der<br />
Hautklinik<br />
Veranstaltungsort: Bibliothek d. Kl. f. Dermatologie<br />
und Venerologie, Campus Lübeck, Haus 10, 1. Stock<br />
Veranstalter, Auskunft und Anmeldung: Klinik für<br />
Dermatologie und Venerologie, UK S-H, Campus<br />
Lübeck, Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck,<br />
Tel. 0451/500-2513, Fax 0451/500-2981<br />
26.01.2006, 19:00-21:30 Uhr<br />
Aktuelle Diagnostik und Therapie von Ösophaguskarzinomen<br />
Veranstalter: Sana Klinken Lübeck GmbH, Krankenhaus<br />
Süd<br />
Veranstaltungsort: Hörsaal des Krankenhauses Süd<br />
Auskunft und Anmeldung: Prof. Dr. Christian<br />
Blöchle, Sana Kliniken Lübeck GmbH, Krankenhaus<br />
Süd, Kronsforder Allee 71-73, 23560 Lübeck,<br />
Tel. 0451/585-1301, Fax 0451/585-1309,<br />
E-Mail c.bloechle@sana-luebeck.de<br />
08.02.2006, 16:15 Uhr<br />
Kortikale Repräsentation von höheren motorischen<br />
Funktionen beim Menschen<br />
Veranstaltungsort: Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie,<br />
Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie,<br />
UK S-H, Campus Lübeck, Seminarraum Haus 6,<br />
Seiteneingang, 2. Stock<br />
Veranstalter, Auskunft und Anmeldung: Klinik für<br />
Psychiatrie und Psychotherapie, Poliklinik für Kinder-<br />
und Jugendpsychiatrie, UK S-H, Campus Lübeck,<br />
Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck, Tel. 0451/500-<br />
2922, Fax 0451/500-6198, E-Mail backhaus.j@gmx.de,<br />
Internet www.psychiatry.uni-luebeck.de<br />
13.02.2006, 16:00 Uhr c. t.<br />
Schiller als Arzt und Patient<br />
Veranstalter: Klinik für Anästhesiologie, UK S-H,<br />
3<br />
2<br />
Campus Lübeck, Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck<br />
Veranstaltungsort: Hörsaal Zentralklinikum Z3<br />
Auskunft: Frau Richter, Tel. 0451/500-4057<br />
15.02.2006, 17:00-19:00 Uhr<br />
Hämangiome im Kindesalter<br />
Veranstalter: Klinik f. Kinderchirurgie, Klinik f. Dermatologie<br />
u. Venerologie, Klinik f. Kinder- u. Jugendmedizin,<br />
UK S-H, Campus Lübeck, sowie niedergelassene<br />
Kinder- u. Jugendärzte Lübeck u. Umgebung<br />
Veranstaltungsort: Seminarraum 1 und 2 der Klinik<br />
für Kinder- und Jugendmedizin UK S-H, Campus Lübeck,<br />
Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck<br />
Auskunft: I. Dickau, Sekr. Prof. Dr. E. Herting,<br />
Tel. 0451/500-2546, Fax 0451/500-6222,<br />
E-Mail dickau@paedia.ukl.mu-luebeck.de<br />
Neustadt<br />
15.02.2006, 19:00 Uhr s. t.<br />
Aktuelle Therapieaspekte der rheumatoiden<br />
Arthritis<br />
Veranstalter: Ärzteverein Ostholstein<br />
Veranstaltungsort: Marienhof, Rosengarten 50,<br />
23730 Neustadt i. H.<br />
Auskunft und Anmeldung: Klinikum Neustadt, Klinik<br />
für Innere Medizin, Frau Spieckermann, Am Kiebitzberg<br />
10, 23730 Neustadt i. H., Tel. 04561/54-1071,<br />
Fax 04561/54-1192<br />
Westerland/Sylt<br />
16.-19.03.2006<br />
Ausbildung zum Asthmatrainer(in) 2006<br />
Veranstalter, Veranstaltungsort, Auskunft und<br />
Anmeldung: Fachklinik Sylt, Steinmannstr. 52-54,<br />
25980 Westerland/Sylt, Tel. 04651/852-1760,<br />
Fax 04651/852-1758, E-Mail fks.aerzte@t-online.de<br />
Gebühr: 420 Euro<br />
26.04.-30.04.2006<br />
Ausbildung zum/zur Neurodermitis-Psoriasis-Trainer(in)<br />
für Erwachsene<br />
Veranstaltungsort: Asklepios-Nordseeklinik, Klinik<br />
für Dermatologie und Allergologie, Westerland/Sylt<br />
Veranstalter, Auskunft und Anmeldung: Insel-<br />
Akademie, Organisationsberatung, Kathrin Wilke,<br />
Bismarckstr. 12, 25980 Westerland, Tel. 04651/835-<br />
6070, Fax -6074, E-Mail info@insel-akademie.de,<br />
Internet www.insel-akademie.de<br />
Gebühr: 968,60 Euro<br />
Fortbildungsveranstaltungen, die nach Redaktionsschluss gemeldet werden, finden Sie<br />
im Internet unter www.aerzteblatt-sh.de (Rubrik Fortbildungen)<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 19<br />
3<br />
40<br />
Fortbildung
Personalia<br />
20<br />
Wir gedenken der Toten<br />
Dr. Ingemarie Fröhner, Glückstadt,<br />
geboren am 02.04.1921,<br />
verstarb am 16.10.2005.<br />
Dr. Heinz Brandenburg, Quickborn,<br />
geboren am 16.12.1912,<br />
verstarb am 28.10.2005.<br />
Dr. Gerhard Keil, Schenefeld,<br />
geboren am 16.02.1913,<br />
verstarb am 08.11.2005.<br />
Prof. Dr. Horst Gieseler, Wassersleben,<br />
geboren am 08.02.1930,<br />
verstarb am 13.11.2005.<br />
Dr. Wolfgang Hinke, Flensburg,<br />
geboren am 02.04.1919,<br />
verstarb am 17.11.2005.<br />
Geburtstage<br />
Veröffentlicht sind nur die Namen der Jubilare,<br />
die mit der Publikation einverstanden sind.<br />
Uwe Voelker, Kiel,<br />
feiert am 01.02. seinen 70. Geburtstag.<br />
Dr. Heinz Wittmer, Flensburg,<br />
feiert am 04.02. seinen 85. Geburtstag.<br />
Dr. Friedrich-Otto Drenckhahn, Neumünster,<br />
feiert am 05.02. seinen 85. Geburtstag.<br />
Dr. Volker Kern, Rendsburg,<br />
feiert am 06.02. seinen 70. Geburtstag.<br />
Dr. Udo Plaaß, Eckernförde,<br />
feiert am 06.02. seinen 70. Geburtstag.<br />
Dr. Irene Moeller, Ratzeburg,<br />
feiert am 07.02. ihren 90. Geburtstag.<br />
Dr. Fausi Al-Ruhbeyi, Flintbek,<br />
feiert am 08.02. seinen 70. Geburtstag.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
Dr. Reinhard Bender, Eutin,<br />
geboren am 29.10.1940,<br />
verstarb am 20.11.2005.<br />
Dr. Karl Caye, Mölln,<br />
geboren am 12.04.1910,<br />
verstarb am 21.11.2005.<br />
Dr. Torsten Zeidler, Hohenwestedt,<br />
geboren am 24.09.1949,<br />
verstarb am 23.11.2005.<br />
Dr. Klaus-Jürgen Buhr, Hitzhusen,<br />
geboren am 02.08.1919,<br />
verstarb am 27.11.2005.<br />
Klaus Totzke, Flensburg,<br />
geboren am 27.04.1951,<br />
verstarb am 27.11.2005.<br />
Dr. Henner Gehrig, Neumünster,<br />
feiert am 09.02. seinen 75. Geburtstag.<br />
Boris Einfalt, Reinbek,<br />
feiert am 10.02. seinen 70. Geburtstag.<br />
Dr. Hans Kroll, Kappeln,<br />
feiert am 15.02. seinen 70. Geburtstag.<br />
Dr. Elke Hannemann, Kiel,<br />
feiert am 16.02. ihren 70. Geburtstag.<br />
Dr. Friedrich Doerth, Bad Oldesloe,<br />
feiert am 18.02. seinen 95. Geburtstag.<br />
Dr. Margarethe Schulze-Weisser, Wedel,<br />
feiert am 26.02. ihren 80. Geburtstag.<br />
Dr. Siegfried Jakubowski, Heiligenhafen,<br />
feiert am 27.02. seinen 75. Geburtstag.<br />
Dr. Gisela Eulenberger, Ratzeburg,<br />
feiert am 28.02. ihren 75. Geburtstag.
Chefarztwechsel im<br />
Neurologischen Zentrum der<br />
Segeberger Kliniken Gruppe<br />
Jörg Seifert<br />
Am 30.11.2005 beendete der langjährige Chefarzt<br />
des Neurologischen Zentrums der Segeberger<br />
Kliniken Gruppe, Dr. Michael Kutzner, mit<br />
65 Jahren seinen aktiven beruflichen Lebensweg.<br />
Im Rahmen eines Symposiums unter seiner Leitung<br />
nahm Dr. Kutzner noch einmal die Gelegenheit<br />
wahr, einem interessierten Fachpublikum<br />
ein aktuelles Thema aus der neurologischen<br />
Rehabilitation anzubieten und sich von<br />
vielen Kollegen aus der langjährigen Zusammenarbeit<br />
zu verabschieden.<br />
Mit einem anschließenden festlichen Empfang<br />
verabschiedete die Geschäftsführerin der Segeberger<br />
Kliniken Gruppe, Marlies Borchert, Dr.<br />
Kutzner in den Ruhestand und dankte ihm für<br />
die elf Jahre seiner engagierten und loyalen Tätigkeit<br />
im Unternehmen.<br />
Das ab 01.10.1994 in Betrieb genommene Neurologische<br />
Zentrum trägt in sehr bemerkenswerter<br />
Weise die Handschrift von Dr. Kutzner.<br />
Ab 01.04.1994 im Unternehmen war er bereits<br />
in Planung und Ausbau dieses 270 Bettenhauses,<br />
von denen 24 Planbetten mit sechs Beatmungsplätzen<br />
als Frührehabilitationsstation<br />
ausgelegt sind,<br />
einbezogen. Mit dem Ausbau<br />
speziell dieser Station leistete<br />
er Pionierarbeit in <strong>Schleswig</strong>-<br />
<strong>Holstein</strong>, denn es war die erste<br />
Einrichtung in diesem Bundesland,<br />
die für Schädel-Hirnverletzte<br />
vorgehalten wurde.<br />
Für die Fachrichtung Neurologie<br />
und Psychiatrie hatte sich<br />
der 1940 in Breslau geborene<br />
Sohn eines Landarztes früh<br />
entschieden.<br />
Dr. Kutzner studierte in Bonn,<br />
Göttingen und Wien und wurde<br />
Facharzt für Neurologie,<br />
Prof. Dr. José M. Valdueza<br />
(Fotos: Segeberger Kliniken GmbH)<br />
Psychiatrie<br />
und Geriatrie.Zusätzlich<br />
erwarb<br />
er die weitereQualifikation<br />
für<br />
Physikalische<br />
und<br />
RehabilitativeMedizin.<br />
In herausgehobenenVerwendungen<br />
war Dr. Michael Kutzner<br />
Dr. Kutzner von 1977 bis 1992 als Leitender<br />
Oberarzt an der Neurologischen Universitätsklinik<br />
Bergmannsheil in Bochum und von 1992 bis<br />
1994 als Ärztlicher Direktor der Neurologischen<br />
Fach- und Rehabilitationsklinik in Gailingen tätig.<br />
Von 1994 bis 2005 war er als Chefarzt des Neurologischen<br />
Zentrums der Segeberger Kliniken<br />
Gruppe in Bad Segeberg eingesetzt.<br />
Als erster Chefarzt dieser neu errichteten Fachklinik<br />
hat er großen Anteil an der schnellen und<br />
anerkannten Etablierung am Markt.<br />
Ein Haus, das alle Phasen rehabilitationsfähiger<br />
Erkrankungen und Verletzungen auf dem Gebiet<br />
Neurologie und Neurotraumatologie behandelt<br />
und von Grund auf nach<br />
aktuellem Stand durchgeplant,<br />
organisiert und mit einem umfassenden<br />
Versorgungskonzept<br />
ausgestattet ist.<br />
Mit diesem umfassenden Konzept,<br />
seinen umfassenden diagnostischen<br />
Möglichkeiten u. a.<br />
in Klinikverbund der Segeberger<br />
Kliniken Gruppe gehört das<br />
Neurologische Zentrum mit<br />
320 Mitarbeitern zu einer der<br />
größten Kliniken ihrer Art in<br />
Deutschland.<br />
Neben seiner klinischen Arbeit<br />
engagierte sich Dr. Kutzner<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 21<br />
Personalia
Personalia<br />
22<br />
über viele Jahre intensiv in zahlreichen Fachgesellschaften,<br />
war Mitglied mehrerer Kommissionen<br />
der Deutschen Gesellschaft für Neurologische<br />
Rehabilitation (Vorstandsmitglied bis<br />
2004). Darüber hinaus gehörte er Expertenkommissionen<br />
der Berufsgenossenschaften und von<br />
Versicherungsträgern an.<br />
Bundesweit war er in der Stiftung Deutsche<br />
Schlaganfall-Hilfe aktiv, deren Regionalbeauftragter<br />
er in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> war. Die Beratung<br />
und Unterstützung vieler Selbsthilfeorganisationen,<br />
regional und überregional, waren<br />
ihm ein wichtiges Anliegen. Dies galt im Besonderen<br />
für den Bundesverband Schädel-Hirnverletzte<br />
in Not e. V., die Deutsche Multiple Sklerose<br />
Gesellschaft sowie seine Tätigkeit im wissenschaftlichen<br />
Beirat des Guillain-Barré-Syndroms<br />
(GBS).<br />
In Fachtagungen und öffentlich wirksamen Veranstaltungen,<br />
wie Telefon- oder Internet-Aktionen,<br />
war er intensiv um Bewusstseinsbildung<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
und Aufklärung über neurologische Erkrankungen,<br />
ihre Warnsignale und Behandlungsmöglichkeiten<br />
bemüht.<br />
Dr. Kutzner übergibt eine Fachklinik auf hohem<br />
rehabilitationsmedizinischem Niveau an seinen<br />
Nachfolger Prof. Dr. José M. Valdueza.<br />
Prof. Valdueza war u. a. im Universitätskrankenhaus<br />
Hamburg-Eppendorf sowie als Assistenz-<br />
und Oberarzt an der Neurologischen Klinik<br />
der Charité, Humboldt-Universität Berlin,<br />
tätig, von wo er bereits am 01.02.2004 in das<br />
Neurologische Zentrum der Segeberger Kliniken<br />
Gruppe als Chefarzt der Frühreha-Station<br />
wechselte und nun die medizinische Gesamtverantwortung<br />
im Neurologischen Centrum für die<br />
neurologische Akut- und Rehabilitationsmedizin<br />
übernahm.<br />
Jörg Seifert, Verwaltungsleiter, Segeberger Kliniken<br />
Gruppe, Neurologisches Zentrum, Hamdorfer Weg 3,<br />
23795 Bad Segeberg<br />
BUECHER + BUECHER + BUECHER + BUECHER + BUECHER<br />
Praxis der interventionellen Koronartherapie<br />
Bibliographische Angaben: Ralph Tölg, Gert Richardt (Hrsg.), unter Mitarbeit von V. Geist, E. Giannitsis,<br />
F. Hartmann, A. Khattab, T. Kurz, S. Lehrke und H. Steen, UNI-MED Verlag AG, Bremen, 1. Auflage, 141<br />
Seiten, 44,80 Euro, ISBN 3-89599-660-2<br />
Kurze Inhaltsangabe: In elf Kapiteln werden die verschiedenen Aspekte der interventionellen<br />
Koronartherapie sorgfältig dargelegt, großzügig durch zahlreiche Tabellen<br />
sowie aussagekräftige Abbildungen und Grafiken unterstützt. Originalliteratur<br />
wird jeweils am Ende eines Kapitels aufgeführt. Stärke des Buches ist die anschauliche<br />
Schilderung des konkreten technischen Vorgehens in verschiedenen Situationen<br />
des Koronarkranken.<br />
Kritische Bewertung: Der interventionelle Kardiologe ist meist Protagonist seines<br />
Spezialgebietes: Trotz kritischer Würdigung der verschiedenen Dilatations- und<br />
Eröffnungstechniken kranker Koronargefäße wird wiederholt das interventionelle<br />
Vorgehen auch dann befürwortet, wenn Evidenz hierfür nicht vorliegt. Die klare<br />
Indikation zur Alternative, zur Koronarchirurgie wird nur ausnahmsweise angesprochen<br />
- obgleich gerade hier die Langzeitergebnisse überzeugen. Die Literaturbelege<br />
sind zum Teil knapp, werden im Text nicht aufgeführt (nur summarisch am<br />
Kapitelende) und sind nicht aktuell (bis 2002).<br />
Sonstiges: Dennoch: Das vorliegende Buch ist derzeit wohl das ausführlichste<br />
Werk im deutschsprachigen Raum, das alle verfügbaren methodischen Konzepte der interventionellen<br />
Kardiologie detailliert aufzeigt und damit die enorme Entwicklung der letzten 15 Jahre zusammenfasst.<br />
Empfehlung: Aus diesem Grunde wird jeder Kardiologe, jeder kardiologisch interessierte Internist und nicht<br />
zuletzt der Kardiochirurg - und sei es zur eigenen Standortbestimmung - dieses Buch mit großem Gewinn zur<br />
Hand nehmen. Es sei ihm empfohlen!<br />
Rezensent: Prof. Dr. Klaus-Peter Bethge, Friedrich-Ebert-Krankenhaus, Friesenstr. 11, 24534 Neumünster
Akademie der <strong>Ärztekammer</strong><br />
Praxisübergabe sicher und<br />
vorteilhaft gestalten<br />
Horst Kreussler<br />
Dramatische Szene am Mittwochnachmittag<br />
beim Zulassungsausschuss in der Segeberger Bismarckallee:<br />
Praxisinhaber Dr. A., 67, ist außer<br />
sich, als ihm mitgeteilt wird, sein Wunschkandidat<br />
Dr. B. für die Praxisübernahme habe einen<br />
Monat weniger ärztliche Erfahrung als der ihm<br />
unbekannte Bewerber C. und könne daher<br />
nicht zum Zuge kommen.<br />
Wer als übergabe- oder übernahmewilliger Kollege<br />
diesen oder ähnliche Fallstricke vermeiden<br />
will, kann das Notwendige erfahren im fünfstündigen<br />
Seminar „Praxisübergabe/Praxisübernahme“<br />
der Kursreihe Arzt und Recht, veranstaltet<br />
von der Akademie für medizinische Fortund<br />
Weiterbildung in Bad Segeberg mit den Referenten<br />
Rechtsanwalt Dr. jur. Klaus C. Kossen<br />
und Steuerberater Jörg G. Eick.<br />
Mitte November fand eines von etwa drei derartigen<br />
Seminaren pro Jahr im neuen Akademiegebäude<br />
statt. Im ersten, juristischen Teil von<br />
Dr. jur. Kossen hörten 22 meist jüngere, praxiskaufwillige<br />
(Klinik-)Ärztinnen und -Ärzte neben<br />
vielen Details aus Vertragsarztrecht, Berufsrecht,<br />
Kaufrecht, Arbeits- und Mietrecht die<br />
zentrale Botschaft: Rechtzeitige Vorbereitung<br />
(Vorlauf etwa zwei Jahre), Kontakt zur Zulassungsabteilung<br />
der Kassenärztlichen Vereinigung<br />
(KV), Beratung und Vertragsgestaltung<br />
durch einen erfahrenen Anwalt ratsam. Beispiel<br />
für eine vorteilhafte Vertragsgestaltung: Bei<br />
Veräußerung einer Praxis im Rahmen einer Praxisgemeinschaft<br />
kann eine vorübergehende<br />
(mindestens ein Jahr dauernde) Umwandlung in<br />
eine Gemeinschaftspraxis (evtl. auch überörtliche)<br />
sinnvoll sein, um die Zulassung für einen<br />
Wunschkandidaten zu bekommen. Grundsätzlich<br />
sind bei Übernahme einer Einzelpraxis in<br />
einem gesperrten Bezirk eine Reihe von strengen<br />
Voraussetzungen des § 103 SGB V zu beachten,<br />
die aber in bestimmten Fällen unterschiedlich<br />
gewichtet werden:<br />
„Bei der Auswahl der Bewerber sind die berufliche<br />
Eignung, das Approbationsalter und die<br />
Dauer der ärztlichen Tätigkeit zu berücksichtigen,<br />
ferner, ob der Bewerber der Ehegatte, ein<br />
Kind, ein angestellter Arzt des bisherigen Vertragsarztes<br />
oder ein Vertragsarzt ist, mit dem die<br />
bisherige Praxis gemeinschaftlich ausgeübt wurde.“<br />
(Abs. 4 Satz 4)<br />
Die Anwaltskosten<br />
können sich beide<br />
Seiten teilen - und,<br />
so meint der Berichterstatter,<br />
einige hundert<br />
Euro sind angesichts<br />
der nicht einfachen<br />
Materie und<br />
möglicher Rechtsfehler<br />
meist sehr gut<br />
angelegtes Geld.<br />
Wer dagegen alleine<br />
und mit einem der<br />
Dr. jur. Klaus C. Kossen<br />
(Foto: Privat)<br />
zugesandten veralteten Vertragsmuster arbeitet<br />
und den Übergabevertrag nicht „wasserdicht“<br />
macht, muss damit rechnen, dass abgelehnte<br />
Mitbewerber den Rechtsweg vor den Sozialgerichten<br />
beschreiten und jahrelange Unsicherheit<br />
herrscht, bis die ganze Sache eventuell mit<br />
großem Aufwand rückabgewickelt werden muss.<br />
Beispielhaft einige Details: Bei der Suche nach<br />
einer Praxis sollte der Interessent berücksichtigen,<br />
dass Praxisbörsen von privaten Finanzdienstleistern<br />
im eigenen Interesse Kredite oder<br />
Versicherungen ankoppeln wollen. Makler haben<br />
aus Provisionsgründen ein Interesse an<br />
möglichst hohen Kaufpreisen.<br />
Bei der Unterlagenbeschaffung geht es bei den<br />
Angaben über das Praxispersonal auch um möglicherweise<br />
seit längerem nicht anwesende, in<br />
Elternzeit befindliche Mitarbeiter. Bei den Angaben<br />
zur Leistungsstruktur der Praxis sind die<br />
besonderen Abrechnungsgenehmigungen nicht<br />
zu vergessen. Zu den Dauerschuldverhältnissen<br />
gehören auch der Apotheker-Belieferungsvertrag<br />
oder Leasingverträge. Auch über evtl. Wirtschaftlichkeitsprüfungsverfahren,Widerspruchsoder<br />
Gerichtsverfahren muss informiert werden.<br />
Bad Segeberg<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 23
Bad Segeberg<br />
24<br />
Bei den erforderlichen Genehmigungen ist auch<br />
an die Ehegatten-Einwilligung nach § 1365<br />
BGB zu denken, wenn die Praxis das wesentliche<br />
Vermögen darstellt. Besonders wichtig ist<br />
auch die schriftliche Einwilligung des Vermieters<br />
zur Übertragung der Praxisräume auf einen<br />
Nachfolger, sonst können im Falle des Scheiterns<br />
hohe Schadenersatzforderungen auf den<br />
Praxisveräußerer zukommen.<br />
Im Kaufvertrag wird mitunter übersehen, alle<br />
Ansprüche des (nach § 613 a BGB übergehenden)<br />
Personals festzustellen, wie zum Beispiel<br />
noch ausstehenden Urlaub. Ein Wettbewerbsverbot<br />
für den Praxisveräußerer sollte nicht fehlen,<br />
d. h. ein Verbot auch privatärztlicher Tätigkeit,<br />
außer Gutachten- oder Notdiensttätigkeit,<br />
in einem bestimmten Umkreis (z. B. 15 km) für<br />
eine bestimmte Zeit, z. B. zwei Jahre.<br />
Nach dem neuen Kaufrecht hat der Verkäufer<br />
dem Käufer die Sache (Praxis) frei von Sachund<br />
Rechtsmängeln zu verschaffen. Es empfiehlt<br />
sich also, so Dr. Kossen, eine genaue Inventarliste<br />
der zu übergebenden Gegenstände<br />
(nicht aufgeführte verbleiben logischerweise<br />
beim Veräußerer oder bei anderen, etwa Leasinggebern)<br />
und ein genaues Übergabeprotokoll<br />
mit Angabe der Funktionsfähigkeit aller Geräte<br />
in allen Räumen - sogar Lampen.<br />
Den wichtigen Abschnitt Kaufpreisermittlung<br />
hatte Steuerberater Eick bereits innerhalb des<br />
juristischen Teils beigesteuert, als er die verschiedenen<br />
Praxis-Bewertungsmethoden vorstellte.<br />
Alle seien nicht verbindlich definiert<br />
und könnten nur Anhaltswerte liefern, so - in<br />
der Reihenfolge regelhaft steigender Werte - die<br />
<strong>Ärztekammer</strong>methode (ein Drittel des um ein<br />
Oberarztgehalt bereinigten Jahresumsatzes), die<br />
Quartalsmethode (entsprechend nach Quartalen),<br />
die Gewinnmethode oder die in der ge-<br />
Bericht aus Burkina Faso<br />
27 US-Dollar pro Kopf und Jahr<br />
Im Abgeordnetensaal der Kassenärztlichen Vereinigung<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> (KVSH) steht normalerweise<br />
die ärztliche Berufspolitik im Mittel-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
werblichen Wirtschaft verbreitete, aber riskante<br />
Ertragswertmethode.<br />
Im zweiten, steuerlichen Teil des Seminars ging<br />
Eick ein auf Niederlassungsplanung, Finanzierungsmodelle,<br />
Versicherungen und Steuerstrategien.<br />
Ein wissenswertes Beispiel: Die Steuervergünstigungen<br />
beim Praxisverkauf (z. B. Freibetrag,<br />
„halber Steuersatz“) fallen weg, wenn<br />
nach der Praxisaufgabe keine geringfügige Tätigkeit<br />
mehr ausgeübt wird. Hätten Sie’s gewusst?<br />
Seminar<br />
Praxisübergabe/Praxisübernahme<br />
der Akademie für medizinische Fort- und Weiterbildung<br />
der <strong>Ärztekammer</strong> <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
Gebühr: 51 Euro<br />
Information: www.aeksh.de/akademie<br />
Referenten: Dr. jur. Klaus C. Kossen, Rechtsanwalt<br />
und Fachanwalt für Arbeits- u. Versicherungsrecht,<br />
Bad Segeberg, und Vorsitzender<br />
von Schlichtungskommission II/Schiedsgericht<br />
bei der <strong>Ärztekammer</strong> <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>.<br />
Steuerberater Dipl.-Phys. Jörg G. Eick, zusammen<br />
mit seinem Vater Georg Eick, Partner der<br />
Delta Steuerberatung, Bad Segeberg, hervorgegangen<br />
aus der Steuerabteilung (mit Niederlassungsberatung,<br />
betriebswirtschaftlicher Beratung,<br />
Finanz- und Lohnbuchhaltung, Vermögensberatung)<br />
der Privatärztlichen Verrechnungsstelle,<br />
Bad Segeberg, die 1985 aufgrund<br />
gesetzlicher Änderungen ausgegliedert werden<br />
musste.<br />
Mitglied im bundesweiten Arbeitskreis für<br />
Steuerfragen der Heilberufe, www.meditaxa.de.<br />
Dr. jur. Horst Kreussler, An der Karlshöhe 1, 21465<br />
Wentorf<br />
punkt. Am zweiten Dezember rückte sie kurz in<br />
den Hintergrund, als Dr. Yissou Dao über die<br />
gesundheitlichen Rahmenbedingungen in<br />
seinem Heimatland Burkina Faso berichtete.<br />
Burkina Faso, übersetzt das „Land der aufrechten<br />
Menschen“, ist das drittärmste Land der Erde.<br />
Der Staat gibt pro Kopf 27 US-Dollar im
Jahr für das Gesundheitswesen aus. Chirurg<br />
Dao, der in Berlin zum Facharzt für Gynäkologie<br />
ausgebildet wird, ist einer von wenigen Ärzten<br />
in ganz Burkina Faso. Jeder der 134 Fachärzte<br />
versorgt rein rechnerisch 93 251 Einwohner.<br />
Zum Vergleich: In <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> beträgt<br />
das Verhältnis eins zu rund 1 300. Die<br />
Klinikärzte sind dabei noch gar nicht eingerechnet.<br />
Die 180 Allgemeinärzte in Burkina Faso<br />
versorgen durchschnittlich 69 420 Einwohner,<br />
bei uns sind es 1 400.<br />
Doch es fehlt nicht nur an Ärzten, sondern auch<br />
an Geld, Material und Einrichtungen. Zwei<br />
Unikliniken, zwölf Regionalkrankenhäuser und<br />
38 Gesundheitszentren leisten die Versorgung<br />
für die 12,5 Millionen Einwohner. Darunter gibt<br />
es noch Zentren, in denen ohne ausgebildete<br />
Mediziner die Versorgung auf unterster Stufe<br />
geschieht. Wie die Kranken und Verletzten<br />
dorthin kommen, ist ihr Problem. Wer es nicht<br />
zu Fuß schafft, muss sich mit Eselskarre oder<br />
Mofa behelfen, wenn solche Fahrzeuge zur Verfügung<br />
stehen. Wer einen Krankenwagen benötigt,<br />
muss Benzin- und Nutzungsentgelt zahlen,<br />
was bei einem Pro-Kopf-Einkommen von durchschnittlich<br />
300 US-Dollar meistens nicht ohne<br />
Verschuldung möglich ist. Fällt ein Klinikaufenthalt<br />
an, ist die gesamte Familie gefordert.<br />
„Einer ist für die Betreuung des Kranken notwendig,<br />
ein weiterer für Kochen, Waschen und<br />
andere Unterstützung“, verdeutlichte Dao.<br />
Die Ärzte verfügen in aller Regel kaum über<br />
Material, vorhanden sind meist nur veraltete<br />
Instrumente. Selbst Abteilungen an der Uniklinik<br />
müssen ohne Sonographiegerät auskommen.<br />
Medizinische Versorgungszentren<br />
Nicht klein reden!<br />
Medizinische Versorgungszentren (MVZ) bieten<br />
Ärzten vielfältige Möglichkeiten, etwa zur Anstellung<br />
im ambulanten Bereich. Noch aber<br />
werden die Möglichkeiten nicht annähernd ausgeschöpft,<br />
meint Rechtsanwalt a. D. Jürgen<br />
Steinbrink. Auf einer Informationsveranstal-<br />
Spendenkonto:<br />
Sahel e. V. Sparkasse Plön, BLZ 21051580,<br />
Konto 5785; Info www.sahel.de<br />
Dao wirbt deshalb während<br />
seiner Ausbildung in<br />
Deutschland gemeinsam<br />
mit Jürgen Steinbrink für<br />
Unterstützung für das Gesundheitssystem<br />
in Burkina<br />
Faso. Der Rechtsanwalt<br />
a. D. - vielen Medizinern<br />
in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
noch aus rechtlichen Dr. Yissou Dao (Foto: di)<br />
useinandersetzungen<br />
mit der KVSH bekannt - ist seit vier Jahren Honorarkonsul<br />
von Burkina Faso für Hamburg und<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>. Aus seinen Aufenthalten<br />
vor Ort kennt Steinbrink nicht nur das Gesundheitssystem:<br />
„Es ist ein Land mit beeindruckenden<br />
Menschen“, berichtete Steinbrink in Bad<br />
Segeberg. 60 verschiedene Ethnien mit unterschiedlichen<br />
Sprachen und Religionen leben in<br />
dem Land friedlich miteinander. Die Armut ist<br />
das Kernproblem von Burkina Faso. Die Hälfte<br />
der Einwohner lebt unterhalb der Armutsgrenze,<br />
besonders betroffen sind Familien mit vielen<br />
Kindern. Fast jeder zweite Einwohner ist jünger<br />
als 15 Jahre, 65 Jahre oder älter sind nicht einmal<br />
drei Prozent. 17 Prozent der Menschen gelten<br />
als unterernährt, 87 Prozent Analphabeten.<br />
Steinbrink wirbt zusammen mit Dao für den gemeinnützigen<br />
Verein Sahel e. V. Steinbrink<br />
versichert als Vorstandsmitglied in diesem Verein,<br />
dass die Unterstützung auch vollständig ankommt<br />
und nicht in intransparenten Verwaltungsstrukturen<br />
versickert. (di)<br />
tung der Kassenärztlichen Vereinigung <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
(KVSH) am 2. Dezember in Bad<br />
Segeberg appellierte er an die Ärzte, die Potenziale<br />
der MVZ nicht „klein zu reden“.<br />
„In der gemeinsamen Selbstverwaltung ist das<br />
MVZ noch nicht vollständig angekommen“,<br />
sagte Steinbrink im Abgeordnetensaal der<br />
KVSH. Als Beispiel nannte er die im neuen Einheitlichen<br />
Bewertungsmaßstab (EBM) enthaltenen<br />
Aufschläge zur Punktzahl des Ordinations-<br />
Bad Segeberg<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 25
Bad Segeberg<br />
26<br />
komplexes (15 je<br />
ken: Ein MVZ mit integrativen Versorgungs-<br />
Fachgebiet, insgestrukturen<br />
sei der „Idealpartner der Krankensamt<br />
zwischen 60<br />
kassen in der integrierten Versorgung“.<br />
und 105 Punkten).<br />
„Das wird dem<br />
MVZ nicht gerecht“,<br />
sagte<br />
Steinbrink.<br />
Ein MVZ wird nach seiner Ansicht aber keinen<br />
Erfolg haben, wenn es nur aus Gründen des<br />
Marketing und der Marktbesetzung ins Leben<br />
gerufen wird. Die Verbesserung der Versorgungsqualität<br />
ist aus seiner Sicht stets Bedin-<br />
Verwundert ist<br />
gung für den Erfolg eines MVZ.<br />
Steinbrink auch,<br />
dass die gemeinsame<br />
Ekkehard Becker (Fotos: di)<br />
Selbstverwaltung<br />
weitere vom Gesetzgeber eingeräumte Förderungsmöglichkeiten<br />
nicht ausreichend nutzt,<br />
um die MVZ attraktiver zu machen. Zum Beispiel<br />
den § 85 a Abs. 6, wonach etwa für das<br />
ambulante Operieren oder für Disease-Management-Programme<br />
(DMP) besondere Vergütungsvereinbarungen<br />
für die Versorgung in<br />
MVZ getroffen werden können. Nach Beobachtung<br />
Steinbrinks wird dies in der Praxis kaum<br />
genutzt.<br />
Jürgen Steinbrink<br />
Steinbrink, dessen<br />
Meinung schon bei<br />
zahlreichen früheren<br />
gerichtlichen<br />
Auseinandersetzungen<br />
von der der<br />
KVSH abwich, liegt<br />
auch in Sachen<br />
MVZ nicht voll auf<br />
einer Linie mit der<br />
Körperschaft.<br />
KVSH-Abteilungsleiter<br />
Ekkehard<br />
Steinbrink riet Ärzten, die noch länger als zehn Becker warnte die niedergelassenen Ärzte vor<br />
Jahre praktizieren wollen, sich dringend mit übereilten Entscheidungen bei der Gründung<br />
dem Thema MVZ auseinander zu setzen. Er pro- eines MVZ. Die Besserstellung im Honorarverphezeite,<br />
dass Krankenhäuser künftig verstärkt teilungsmaßstab (HVM) und im EBM oder die<br />
auf MVZ setzen und damit massiv die bestehen- vermeintlich schnelleren Konkurrenten sind<br />
de Versorgungslandschaft zu Lasten der Ver- nach seiner Meinung keine Gründe, sich vortragsärzte<br />
verändern werden. Auch erste Klinischnell für ein MVZ zu entscheiden. Allerdings<br />
ken in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> haben bereits MVZ spricht - bei entsprechenden Rahmenbedingun-<br />
gegründet. Steinbrinks Warnung an die Adresse gen - auch aus Sicht Beckers einiges für MVZ.<br />
der niedergelassenen Ärzte: „Ihre Stellung be- Er räumte beispielsweise betriebswirtschaftliche<br />
haupten sie nur, wenn Sie die Chancen eines Vorteile und die Möglichkeit, ein professionelles<br />
MVZ nutzen.“ Dies könne sich positiv in den Management oder gemeinsame Vermarktung zu<br />
Verhandlungen mit den Krankenkassen auswir- betreiben, als Vorteile ein. (di)<br />
Weihnachtsfeier eines Praxisteams<br />
Mal ganz anders<br />
Dr. Carmen-Regina und Dr. Bernhard Bambas<br />
haben am 22. Dezember mit ihren Praxisangestellten<br />
ihre Weihnachtsfeier abgehalten - wie<br />
viele andere Praxen auch. Die Bad Segeberger<br />
Augenärzte haben ihre Feier aber mit Sport und<br />
Bewegung verbunden. Der 22. Dezember war<br />
für sie und die Mitarbeiter ein Fitnesstag.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
„Ich finde das gut“, befand Mitarbeiterin Silke<br />
Krause schon vor dem schweißtreibenden Fitnesstag.<br />
Im Bekanntenkreis der Angestellten<br />
sorgte die ungewöhnliche Weihnachtsfeier der<br />
Segeberger Praxis zwar für Erstaunen, die Mitarbeiter<br />
aber standen hinter den Plänen ihrer<br />
Chefs. Statt eines deftigen Essens erwartete sie<br />
an diesem Tag zunächst ein Kurs in Nordic<br />
Walking unter professioneller Anleitung. Anschließend<br />
ging es in ein exklusives Fitness-Studio,<br />
wo sich jeder nach persönlichen Vorlieben
verausgaben konnte: Schwimmen,<br />
Kraft- oder Ausdauertraining standen<br />
zur Auswahl, aber auch Entspannung<br />
war angesagt. Hinterher wurde<br />
dann zwar doch noch gemeinsam gegessen,<br />
„aber gesund“, wie Bernhard<br />
Bambas betonte.<br />
Er hat sich u. a. von der Aktion eines<br />
Flensburger Praxisteams inspirieren<br />
lassen, das gemeinsam das Training<br />
für das Deutsche Sportabzeichen absolviert<br />
und damit gute Erfahrungen<br />
gesammelt hatte. Dieses Vorhaben<br />
steht für die Segeberger Praxis im<br />
kommenden Jahr auf dem Plan.<br />
Bambas hofft, mit solchen Aktionen die gesamte<br />
Mannschaft für mehr Sport und Bewegung<br />
begeistern zu können. Die Praxisinhaber selbst<br />
sind die besten Vorbilder. Dr. Carmen-Regina<br />
Bambas macht Crossläufe und fährt Fahrrad, ihr<br />
Mann ist seit 15 Jahren erfolgreicher Triathlet,<br />
Marathonläufer und häufig auf Ausdauerwettkämpfen<br />
präsent. Die Praxisangestellten müssen<br />
zwar nicht befürchten, dass der Augenarzt von<br />
ihnen ähnliche Höchstleistungen erwartet.<br />
Aber er hofft, dass sich manche von ihnen zu<br />
mehr Bewegung anspornen lassen. Mit einer an-<br />
�<br />
Das Praxisteam von Dr. Carmen-Regina Bambas (links) und Dr.<br />
Bernhard Bambas: Zur Weihnachtsfeier gab es für die Segeberger Praxis<br />
einen Fitnesstag (Foto: di)<br />
deren gesunden Idee haben die Augenärzte bereits<br />
Erfolg gehabt. Sie stellen ihren Mitarbeitern<br />
regelmäßig eine Obstkiste für Zwischenmahlzeiten<br />
in der Praxis zur Verfügung. Die vitaminreiche<br />
Kost kommt bei den Angestellten<br />
gut an und ersetzt immer häufiger die beliebten<br />
Süßigkeiten. „Seitdem wird bei uns deutlich weniger<br />
Schokolade gefuttert“, hat Bambas beobachtet.<br />
Er kann sich auch ein regelmäßiges gemeinsames<br />
Training der Mitarbeiter ohne<br />
Zwang vorstellen. Ganz uneigennützig ist der<br />
Plan nicht - jede Praxis profitiert schließlich von<br />
gesunden sportlichen Mitarbeitern. (di)<br />
Suchfunktion im Internet<br />
Auf der Homepage des <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>ischen<br />
<strong>Ärzteblatt</strong>es<br />
www.aerzteblatt-sh.de<br />
können Sie jetzt eine Suchfunktion nutzen. Mit<br />
einem einzugebenden Suchbegriff ist es möglich,<br />
Artikel, Rezensionen u. a. in den <strong>Schleswig</strong>-<br />
<strong>Holstein</strong>ischen Ärzteblättern von Heft 1/2000 bis<br />
heute zu finden.<br />
Schauen Sie doch mal rein ...<br />
Bad Segeberg<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 27
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
28<br />
11. <strong>Schleswig</strong>er Schmerztagung<br />
Viszeraler Schmerz, ein<br />
Chamäleon?<br />
Harald Lucius<br />
Zum 11. Mal trafen sich im Kasino der Fachklinik<br />
<strong>Schleswig</strong> am 5. November 2005 Mediziner,<br />
Psychologen, Physiotherapeuten, Patienten und<br />
andere Interessierte, um sich über aktuelle Fragen<br />
zur Diagnostik und Therapie chronischer<br />
Schmerzkrankheiten zu informieren.<br />
Der Schmerz der inneren Organe - viszeral genannt<br />
- stellt Mediziner, andere Interessierte<br />
und Patienten immer wieder vor große Herausforderungen,<br />
wie die Vorträge der sechs kompetenten<br />
Referenten(innen) unter der bewährten<br />
Moderation von Dr. Andreas Gremmelt, Chefarzt<br />
der Abteilung für Anästhesie des Martin-<br />
Luther-Krankenhauses, Dr. Harald Lucius,<br />
Oberarzt und Leiter der Schmerzambulanz der<br />
Fachklinik <strong>Schleswig</strong>, und erstmals PD Dr.<br />
Matthias Köhler, Leiter des Dialysezentrums der<br />
Reha-Klinik Damp, im Verlauf des Vormittags<br />
erkennen ließen.<br />
Angesichts der Komplexität und vor allem der<br />
unterschiedlichen „Zuordnung“ viszeraler Leibschmerzen<br />
zu einzelnen Fachdisziplinen, die oft<br />
eher nebeneinander her als miteinander arbeiten,<br />
besteht ein ständiger Bedarf an neuen wissenschaftlichen<br />
Erkenntnissen, um die richtigen<br />
Diagnosen stellen und entsprechende Therapieverfahren<br />
einleiten zu<br />
können.<br />
Die Grundlagenforschung<br />
steht<br />
dabei immer<br />
wieder im<br />
Zentrum,<br />
denn wir haben,<br />
das<br />
zeigte schon<br />
der erste<br />
Vortrag von<br />
Prof. Dr.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
Wilfrid Jänig, Institut für Physiologie der Christian-<br />
Albrechts-Universität Kiel, noch lange nicht<br />
verstanden, was da so passiert im Bauch unserer<br />
Patienten. So wurde erneut deutlich, dass der<br />
viszerale Schmerz eben keine so exakte segmentale<br />
Zuordnung erlaubt wie der so genannte somatische<br />
Nociceptorschmerz.<br />
Wie schwierig die Therapie sich zeigen kann,<br />
weil auch die diagnostischen Wege oft recht<br />
verschlungen sind, wurde dann in den folgenden<br />
Referaten schnell deutlich. Dr. Winfried<br />
Häuser, Oberarzt, Internist und Psychosomatiker<br />
aus Saarbrücken, stellte klar, dass eine exakte<br />
organbezogene Diagnose unerlässlich ist, aber<br />
die frühzeitige Einbindung von psychologischen,<br />
besonders psychiatrischen Differenzialdiagnosen<br />
helfen kann, eine Chronifizierung zu verhindern.<br />
In diese Richtung argumentierte auch PD<br />
Dr. Michael Strumpf, Chefarzt der Anästhesie<br />
am Rot-Kreuz-Krankenhaus Bremen und ein<br />
echter Opiatexperte, der darauf hinwies, dass<br />
gerade bei unklaren Beschwerden Opioide eben<br />
durchaus nicht Mittel der Wahl sind.<br />
Nach einer kurzen Pause stellte PD Dr. Hodjat<br />
Shekarriz, Chefarzt der chirurgischen Abteilung<br />
am Martin-Luther-Krankenhaus <strong>Schleswig</strong>, die<br />
invasiven Optionen der Chirurgie vor. Vor<br />
allem auf endoskopischem Gebiet haben sich<br />
Wege zur Schmerztherapie ergeben, allerdings<br />
unterstrich der Referent auch, dass es vielfach<br />
Schmerz als Folge chirurgischen Verhaltens gibt<br />
und machte damit deutlich, dass invasive Verfahren<br />
nicht in erster Linie zur Schmerztherapie<br />
chronischer<br />
Bauchschmerzen<br />
geeignet<br />
sind.<br />
Interessante<br />
Aspekte aus<br />
gynäkologischer<br />
Sicht<br />
bot der Vortrag<br />
von Dr.<br />
Friederike<br />
PD Dr. Hodjat Shekarriz, Dr. Harald Lucius, PD Dr. Susanne Krege, Dr. Friederike<br />
Siedentopf, Prof. Dr. Wilfrid Jänig, Dr. Andreas Gremmelt, Dr. Arndt Michael<br />
Oschinsky, PD Dr. Matthias Köhler (v. l. n. r.) (Foto: I. Asmussen)<br />
Siedentopf,<br />
Oberärztin<br />
der gynäko-
logischen Klinik des DRK Klinikums Westend<br />
in Berlin, die nicht nur auf die psychosomatisch<br />
bedeutsamen Aspekte chronischer Beckenschmerzen<br />
bei Frauen besonders hinwies und<br />
ebenfalls herausstellte, dass operative Techniken<br />
nicht primär zu bevorzugen sind, sondern<br />
auch eine Leitlinie zur Therapie chronischer<br />
Unterbauchschmerzen vorstellte, die Eingang in<br />
die interdisziplinäre Diskussion finden sollte.<br />
Den Abschluss der Veranstaltung machte ein<br />
Referat aus dem urologischen Fachgebiet, in<br />
dem PD Dr. Susanne Krege, Oberärztin der urologischen<br />
Uni-Klinik in Essen, die vor allem<br />
über die interstitielle Cystitis berichtete und<br />
hierzu eine relativ neue diagnostische Leitlinie<br />
der amerikanischen Urologen präsentierte, in<br />
ihrem Vortrag aber - wie auch die Vorrednerin -<br />
im Bereich der minimal invasiven Chirurgie<br />
doch therapeutische Chancen bei rechtzeitiger<br />
Diagnosestellung sah.<br />
In der Abschlussdiskussion, die fast alle Referenten<br />
nochmals vereinte, wurde deutlich, dass<br />
die Diagnostik und Behandlung von viszeralen<br />
Schmerzen trotz neuer Erkenntnisse in vielerlei<br />
Hinsicht immer noch oft einzelnen Fachgebieten<br />
vorbehalten bleibt. Interdisziplinäre Leitlinien<br />
fehlen nach wie vor und auch im Bereich der<br />
Grundlagenforschung besteht ein erheblicher<br />
Klärungsbedarf. Wie Prof. Jänig treffend formu-<br />
Ärzte-Patienten<br />
Unterschiedliche Wahrnehmung<br />
des Gesundheitswesens<br />
Dirk Schnack<br />
Ärzte und Patienten nehmen das Gesundheitswesen<br />
oft ganz verschieden wahr. Was Ärzte als<br />
unproblematisch empfinden, stört vielleicht die<br />
Patienten. In anderen Fragen sind Patienten dagegen<br />
viel unkomplizierter, als Ärzte glauben.<br />
Eine Umfrage der Deutschen Gesellschaft der<br />
Ärzte für Qualitätsmanagement (DGÄQ) unter<br />
800 Patienten und Ärzten zeigt, dass die Wahrnehmungen<br />
manchmal weit auseinander liegen.<br />
lierte, müssen wir - weg vom scheinbar kausal<br />
assoziativen Denken - die Ursachen und Zusammenhänge<br />
„im Zentralnervensystem“ suchen.<br />
Das bedeutet in vielerlei Hinsicht eine Abkehr<br />
vom gewohnten Denken und Handeln. Er zeigte<br />
sich aber, ebenso wie die übrigen Teilnehmer,<br />
optimistisch, im Jahrhundert des Gehirns zu<br />
neuem Wissen zu gelangen, das den Patienten<br />
zugute kommen soll.<br />
Die Schmerztagung der Fachklinik <strong>Schleswig</strong><br />
und des Martin-Luther-Krankenhauses ist inzwischen<br />
zur größten regelmäßigen wissenschaftlichen<br />
Fortbildungsveranstaltung zum Thema<br />
„Schmerz“ in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> herangereift.<br />
Dies dokumentierte sich auch in der erneut erfreulich<br />
hohen Zahl von 78 Teilnehmern(innen),<br />
die das wissenschaftliche Programm mit<br />
einem lebhaften Diskussionsforum ausklingen<br />
ließen. In seinem Schlusswort wies Dr. Lucius<br />
darauf hin, dass die Schmerzkongresse in der<br />
Schleistadt selbstverständlich auch in den<br />
nächsten Jahren thematisch spannend und interessant<br />
besetzt werden sollen. Im Jahr 2006 ist<br />
der „Schmerz im Alter“ vorgesehen, für 2007 ist<br />
ein längst fälliges Symposium über „Kinderschmerztherapie“<br />
in der Planung.<br />
Dr. Harald Lucius, Fachklinik <strong>Schleswig</strong>, Am Damm 1,<br />
24837 <strong>Schleswig</strong><br />
Dr. Gregor Viethen,<br />
Vorstandsmitglied<br />
in der DGÄQ, sieht<br />
15 Jahre nach Einführung<br />
des Qualitätsmanagements<br />
die Umfrage zum<br />
richtigen Zeitpunkt.<br />
Der Mediziner von<br />
der Molfseer<br />
Schlossakademie,<br />
die berufsbegleitende<br />
Ausbildung<br />
für Fachkräfte im<br />
Dr. Gregor Viethen (Foto: di)<br />
Gesundheitswesen anbietet, wollte wissen, wie<br />
gut die Patienten sich heute tatsächlich versorgt<br />
fühlen.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 29
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
30<br />
Die Antworten sind zum Teil überraschend. So<br />
neigen offensichtlich viele Ärzte dazu, die Bedeutung<br />
von Zertifikaten zu überschätzen. Von<br />
ihnen glauben mehr als 60 Prozent, damit den<br />
Patienten Sicherheit vermitteln zu können. Die<br />
Umfrageergebnisse aber zeigen, dass dies eine<br />
Fehleinschätzung ist - die Mehrzahl der Patienten<br />
verneint die Frage. Nur 30 Prozent gibt an,<br />
dass Zertifikate ihnen Sicherheit in Bezug auf<br />
die geleistete Qualität in der Praxis vermittelt.<br />
Anderes Beispiel: Die Frage nach Gesprächszeit<br />
und Zuwendung in den Praxen. Mehr als die<br />
Hälfte der befragten Ärzte glaubt, dass medizinische<br />
Fachkräfte vor zehn Jahren mehr Wert auf<br />
Gespräche als auf die apparative Ausstattung<br />
gelegt haben. Dieser Meinung sind aber nur<br />
knapp über 20 Prozent der Patienten - nach ihrer<br />
Auffassung sind die Gespräche auch vor<br />
zehn Jahren schon zu kurz gekommen.<br />
Ein hohes Vertrauen der Patienten belegen die<br />
Antworten nach ungefragten Mehrleistungen.<br />
Die Patienten sind mit großer Mehrheit sicher,<br />
dass ihr Arzt keine Leistungen erbringt, auf die<br />
der Patient eigentlich verzichten könnte. Die<br />
Ärzte selbst sind sich da gar nicht so sicher:<br />
Über 20 Prozent glauben, dass solche nicht notwendigen<br />
Leistungen erbracht werden. Die absolute<br />
Ablehnung dieses Gedankens ist bei ihnen<br />
nur halb so groß wie bei den Patienten.<br />
Weitere Ergebnisse der Umfrage:<br />
�� Verordnungen: Über 40 Prozent der Ärzte<br />
räumen ein, dass sie ihren Patienten nicht alle<br />
für die Behandlung angebrachten Medikamente<br />
oder Heil- und Hilfsmittel anbieten<br />
können. Nur knapp über zehn Prozent der<br />
Patienten teilt diese Auffassung. Mehr als 60<br />
Prozent der Patienten können sich nicht vorstellen,<br />
dass ihr Arzt ihnen aus Kostengründen<br />
Medikamente verweigern würde.<br />
�� Freie Arztwahl: Für die Patienten ein Tabuthema<br />
- auch wenn sie damit sparen könnten,<br />
wären über 80 Prozent nicht bereit, auf<br />
die freie Arztwahl zu verzichten. Ärzte schätzen<br />
das anders ein. Zumindest ein Teil der<br />
Patienten wäre nach ihrer Meinung durch finanzielle<br />
Anreize zum Verzicht der freien<br />
Arztwahl bereit.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
�� Frequenz der Arztbesuche: Patienten gehen<br />
heute häufiger zum Arzt, meinen über 40<br />
Prozent der Ärzte. Die Patienten sehen das<br />
völlig anders. Nur ein geringer Prozentsatz<br />
stimmt dieser Aussage zu.<br />
�� Berücksichtigung der Patientenmeinung:<br />
Ärzte geben an, dass sie dies fast immer tun.<br />
Patienten sind skeptischer, sie haben zumindest<br />
zum Teil das Gefühl, dass dies nicht geschieht.<br />
�� Alternative Heilmethoden: Die Therapeuten<br />
berichten, dass Patienten heute deutlich<br />
mehr alternativmedizinische Angebote wahrnehmen<br />
als noch vor zehn Jahren. Patienten<br />
stimmen hier deutlich seltener zu.<br />
�� State of the art: Hier liegen Ärzte und Patienten<br />
fast gleich in ihrer Einschätzung: Rund<br />
80 Prozent der Ärzte schätzt sich auf dem aktuellen<br />
Stand der Wissenschaft ein. 65 Prozent<br />
der Patienten glauben dies auch von<br />
ihrem Arzt. Viele Patienten räumten ein,<br />
dies nicht einschätzen zu können. Nur ein<br />
Prozent glaubt, dass ihr Arzt nicht auf dem<br />
aktuellen Stand ist.<br />
�� Vertrauensverhältnis: Auch hier eine fast<br />
gleiche Einschätzung. Fast 90 Prozent der Patienten<br />
vertrauen ihrem Arzt. Etwas über 90<br />
Prozent der Ärzte sind sich dieses Vertrauens<br />
sicher.<br />
�� Finanzbereitschaft: Knapp über 70 Prozent<br />
der Patienten lehnen es rundweg ab, für eine<br />
optimale Versorgung bis zu einem Viertel ihres<br />
Gehalts auszugeben. Ärzte unterschätzen<br />
diese Ablehnung zwar leicht, sind aber mehrheitlich<br />
skeptisch, was die Ausgabebereitschaft<br />
der Patienten in dieser Größenordnung<br />
angeht.<br />
Bei der Einschätzung der künftigen Versorgung<br />
gehen die Einschätzungen von Ärzten und Patienten<br />
wieder deutlich auseinander. 80 Prozent<br />
der Ärzte sind sicher, dass sich die Qualität der<br />
medizinischen Versorgung in Deutschland<br />
künftig insgesamt verschlechtern wird. Bei den<br />
Patienten glauben dies nur knapp über 40 Prozent.<br />
Die Versorgung beim Arzt selbst wiederum<br />
wird nach deren eigener Einschätzung in zehn<br />
Jahren eher besser werden. Die Patienten sind
hier skeptischer: Nur jeder fünfte glaubt an diese<br />
Verbesserung. Unser derzeitiges Gesundheitssystem<br />
halten viele aber für eines der besten der<br />
Welt. Patienten glauben dies zu fast 30 Prozent,<br />
bei den Therapeuten rund 23 Prozent. Deutlich<br />
wird auch, dass die große Masse der befragten<br />
Ärzte trotz mancher Probleme im Beruf diesen<br />
nicht tauschen würde: Fast 90 Prozent trägt sich<br />
nicht mit dem Gedanken, beruflich etwas ganz<br />
anderes zu machen.<br />
Für Viethen lassen die Ergebnisse folgendes Resümee<br />
zu:<br />
1. Qualitätsanstrengungen bei Ärzten werden<br />
deutlich wahrgenommen.<br />
2. Die Qualität des Gesundheitswesens wird<br />
von Patienten als „noch gut“ perzepiert.<br />
3. Besonders hoch ist das Vertrauen in den niedergelassenen<br />
Arzt und sein Können.<br />
4. Die freie Arztwahl bleibt das höchste Gut.<br />
5. Ärzte haben mehr Sorgen um die Zukunft als<br />
ihre Patienten.<br />
Dirk Schnack, Postfach 12 04, 24589 Nortorf<br />
BUECHER + BUECHER + BUECHER + BUECHER + BUECHER<br />
Facharztprüfung Viszeralchirurgie<br />
Bibliographische Angaben: Peter M. Markus, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 2005, 184 Seiten, 1 039<br />
Fragen, 60 Abbildungen, 59,95 Euro, ISBN 3-13-140841-3<br />
Das vorliegende Buch „Facharztprüfung Viszeralchirurgie“ soll den Kandidaten, die<br />
sich der Prüfung zum Viszeralchirurgen unterziehen möchten, ermöglichen sich speziell<br />
auf die Prüfungssituation vorzubereiten. Über 1 000 Fragen aus den verschiedenen<br />
Bereichen des komplexen Gebietes Viszeralchirurgie sind in einen allgemeinen Teil<br />
und organspezifischen Teil aufgegliedert. Die Themen entsprechen vollständig den<br />
Anforderungen und Inhalten der Weiterbildungsordnung. Der Herausgeber hat zu<br />
den jeweiligen Themenkomplexen namhafte Vertreter aus dem deutschsprachigen<br />
Raum gewinnen können, sodass der aktuelle fachspezifische Wissensstand hervorragend<br />
abgebildet wird.<br />
Die Fragen sind insgesamt klinikbezogen und prüfungsrelevant formuliert, knapp<br />
und präzise beantwortet und durch einen zusätzlichen kurzen Informationsteil erläutert.<br />
Diese Aufteilung vermittelt dem Leser einen schnellen Überblick über<br />
seinen Wissensstand und lässt unmittelbar Lücken oder noch Nachzubesserndes<br />
aufdecken. Die eingefügten Röntgenbilder illustrieren die gestellten Fragen sehr<br />
anschaulich und simulieren prüfungsrelevante Situationen, in denen der Kandidat<br />
ein Röntgenbild zur Interpretation erhält.<br />
Insgesamt besticht das Buch durch seinen systematischen und detaillierten Aufbau. Die Fragen<br />
sind durchweg klinikrelevant und somit prüfungsgerecht. Wie auch vom Herausgeber geplant, ersetzt das<br />
vorliegende Buch nicht das Studium eines Lehrbuches. Diesen Anspruch kann und soll das „Fragenbuch“<br />
auch nicht erfüllen.<br />
Es stellt vielmehr eine hervorragende Ergänzung zum allgemeinen Studium der Viszeralchirurgie dar, um das<br />
Gelernte abzufragen und um eigene Lücken und noch nicht ausreichend erarbeitete Bereiche auszubessern.<br />
Besonders herauszuheben ist, dass die inhaltliche Zielsetzung nicht auf eine oft langweilige Systematik begrenzt<br />
ist, sondern sich anhand des klinischen Fallbeispieles orientiert und den Leser packt, die interessant<br />
und häufig spannend gestellten Fragen zu beantworten.<br />
Zusammenfassend kann man sagen, dass mit dem vorliegenden Buch eine geglückte Fragensammlung entstanden<br />
ist, die eine perfekte Ergänzung zur Lehrmittelvermittlung der Viszeralchirurgie darstellt.<br />
Wer diese weit über 1 000 Fragen mit Verständnis beantworten kann, der besteht auch berechtigt die Prüfung<br />
zum Viszeralchirurgen.<br />
Zudem sei angemerkt, dass dieses Buch auch für Prüfer im Teilgebiet Viszeralchirurgie hilfreich sein kann. Es<br />
könnte so vermieden werden, dass allzu Spezielles oder gar Forschungsbereiche Gegenstand einer Viszeralchirurgen-Prüfung<br />
werden.<br />
Rezensent: Prof. Dr. Peter Dohrmann, Klinik für Allgemeine Chirurgie und Thoraxchirurgie des UK S-H,<br />
Campus Kiel, Arnold-Heller-Str. 7, 24105 Kiel<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 31
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
32<br />
Damp Holding<br />
Kriegskasse gut gefüllt<br />
Die Damp Holding AG hat weitere Kliniken zur<br />
Übernahme im Visier. Rund 25 Standorte in<br />
Norddeutschland kommen in den nächsten Jahren<br />
in Betracht, sobald die öffentlichen Träger<br />
die Privatisierungsprozesse starten. Jüngster Zukauf<br />
ist das Krankenhaus in Wismar.<br />
„Unsere Kriegskasse ist gut gefüllt“ - Damps<br />
Vorstände Dr. jur. Carl Hermann Schleifer und<br />
Torben Freund machten beim Pressegespräch<br />
am 24. November in Kiel gar nicht erst den<br />
Versuch, ihren Expansionsdrang zu verheimlichen.<br />
Die Marschrichtung des Unternehmens<br />
ist klar: In den kommenden Jahren soll die<br />
Gruppe weitere Kliniken in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>,<br />
Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern hinzugewinnen.<br />
Mittelfristig angestrebte Umsatzgröße:<br />
zwischen 700 und 750 Millionen Euro.<br />
Die Übernahmekandidaten sollen möglichst gut<br />
aufgestellt sein im psychiatrischen und im kardiovaskulären<br />
Bereich, die von Damp als besonders<br />
wachstumsstark eingestuft werden. Die Übernahme<br />
einer Uniklinik-Abteilung ist für Damp<br />
nach Angaben Schleifers derzeit kein Thema.<br />
Im Vergleich zu kommunalen Trägern sieht der<br />
Vorstandschef sein und andere private Klinikunternehmen<br />
klar im Wettbewerbsvorteil: Kreativeres<br />
Marketing, Größenvorteile beim Einkauf,<br />
Kostenersparnisse durch Standardisierungen<br />
etwa der Zimmerausstattung, Optimierung<br />
der Arbeitsabläufe und ein „motivierendes Vergütungssystem“<br />
sprechen nach seiner Ansicht<br />
dafür, dass die privaten Betreiber auch in den<br />
kommenden Jahren ihren Marktanteil auf<br />
Kosten der kommunalen Träger ausweiten<br />
werden.<br />
Jüngster Zukauf der Gruppe ist das Krankenhaus<br />
in Wismar, dessen Übernahme beim Pressegespräch<br />
publik gemacht wurde. Das Haus<br />
verfügt über 450 Betten, beschäftigt 900 Mitarbeiter<br />
und erwirtschaftet einen Umsatz von 54<br />
Millionen Euro im Jahr. Wismar ist das achte<br />
Akutkrankenhaus der Kette, neben verschiedenen<br />
stationären und ambulanten Reha-Einrichtungen.<br />
Bei den öffentlichen Trägern hat sich<br />
Damp nach Einschätzung<br />
Schleifers inzwischen<br />
als Interessent<br />
für Akutkliniken etabliert.<br />
„Wir wurden anfangs<br />
skeptisch beobachtet,<br />
ob wir das auch<br />
können“, sagte<br />
Schleifer - schließlich<br />
hatte die Gruppe ihren<br />
Schwerpunkt lange<br />
Zeit im Rehabereich.<br />
Torben Freund<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
Dr. jur. Carl Hermann<br />
Schleifer (Fotos: di)<br />
Mit der erfolgreichen<br />
Übernahme des Stralsunder<br />
Krankenhauses<br />
sieht Schleifer diese<br />
Bedenken widerlegt.<br />
Das Haus konnte unter<br />
der privaten Führung<br />
sein Wirtschaftsergebnis<br />
deutlich verbessern<br />
und hat die<br />
Mitarbeiterzahl nicht<br />
verringern müssen.<br />
Weitere Themen aus Damp:<br />
Erfolgreiches Jahr 2005: Der Gesamtumsatz<br />
der Gruppe liegt 2005 bei rund 357 Millionen<br />
Euro, der Gewinn bei rund 30 Millionen Euro.<br />
Die wichtigsten Geschäftsfelder: Die Akutkliniken<br />
erwirtschafteten 246 Millionen Euro, der<br />
Rehabereich 86 Millionen Euro, die Touristik<br />
rund 20 Millionen Euro.<br />
Beschäftigung: Damp ist inzwischen der drittgrößte<br />
private Arbeitgeber in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>,<br />
wo allein 4 416 Menschen beschäftigt<br />
sind. Insgesamt steigt mit Wismar die Zahl der<br />
Holding-Mitarbeiter auf fast 7 300 an. 375 Auszubildende<br />
gibt es in der Gruppe. Bei den Übernahmen<br />
ist angestrebt, die Mitarbeiterzahl nicht<br />
zu verringern. Allerdings kann es zwischen den<br />
Gruppen zu Veränderungen kommen - so wurden<br />
etwa in Stralsund zusätzliche Ärzte eingestellt,<br />
die Stellen wurden in anderen Bereichen<br />
eingespart.<br />
Auslandsgeschäft: Das „Damp Sundhedscenter<br />
Tondern“ hat sich im dänischen Markt nach<br />
zwei Jahren etabliert. Es gehört mit 1 504 Pati-
enten im Bereich der Endoprothetik zu den<br />
zehn größten Versorgern im Segment der Hüftund<br />
Kniegelenkersatz-Operationen. Der Umsatz<br />
betrug 3,1 Millionen Euro. Einfach ist es nicht,<br />
als privater ausländischer Konzern im Nachbarland<br />
Fuß zu fassen - es dürfen nur Patienten behandelt<br />
werden, die schon acht Wochen auf der<br />
Warteliste stehen. Tondern gilt als Testlauf. Bei<br />
Ökonomische Effekte von QuaMaDi<br />
Krankenkassen dürfen sich<br />
freuen<br />
Dass das Modellprojekt QuaMaDi (Qualitätsgesicherte<br />
Mamma-Diagnostik) hilft, Tumore in<br />
einem frühen Stadium zu erkennen,<br />
ist in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
bereits bekannt. Das Lübecker<br />
Institut für Krebsepidemiologie<br />
hat nun die ökonomischen<br />
Effekte untersucht - und<br />
kommt zu Ergebnissen, die die<br />
Krankenkassen im Norden<br />
freuen dürften.<br />
Dr. Alexander Katalinic<br />
„Zwar ist<br />
die Teilnahme<br />
der<br />
Frauen am<br />
Projekt für<br />
die Kassen<br />
zunächst<br />
teurer,<br />
Dr. Johann Brunkhorst<br />
langfristig<br />
werden jedoch<br />
Therapiekosten in erheblichem Umfang<br />
eingespart“, sagte Dr. Alexander Katalinic bei<br />
der Präsentation der Ergebnisse am 5. Dezember<br />
in der Kieler Landesvertretung der Techniker<br />
Krankenkasse (TK). Der Leiter des Lübecker<br />
Instituts hat die Einspareffekte mit zwei Modellen<br />
geprüft. Die Ergebnisse waren nahezu identisch:<br />
Den Ausgaben von 43 Euro pro Patientin<br />
steht ein Einspareffekt von 23 Euro pro Patientin<br />
gegenüber. Diesen Effekt kann Katalinic mit-<br />
mittelfristigem Erfolg ist eine Expansion in<br />
Skandinavien angedacht.<br />
Investitionen: Am <strong>Schleswig</strong>er Standort sollen<br />
in den kommenden Jahren inklusive öffentlicher<br />
Mittel rund 100 Millionen Euro investiert<br />
werden. Die Endo-Klinik in Hamburg erhält einen<br />
Neubau auf dem Klinikstandort, Gesamtvolumen:<br />
81 Millionen Euro. (di)<br />
telfristignachvollziehen.<br />
Langfristig<br />
rechnet er<br />
sogar mit<br />
höheren<br />
Prof. Dr. Ingrid Schreer (Fotos: di)<br />
Einspareffekten, die sich aber<br />
noch nicht mit Zahlen belegen<br />
lassen.<br />
Bei der mittelfristigen Betrachtung<br />
führt das Erkennen der<br />
Tumore im früheren Stadium<br />
u. a. zu niedrigeren Krankenhaus-Verweildauern,<br />
zu geringeren Medikamentenkosten,<br />
zu einer Vermeidung plastisch rekonstruktiver<br />
Eingriffe und zur Vermeidung von<br />
Rezidiven und Progressen. Pro Behandlungsfall<br />
beträgt die Kostenreduktion rund 2 450 Euro.<br />
„Die Mehrkosten für QuaMaDi werden durch<br />
weniger invasive und günstigere Therapie nahezu<br />
ausgeglichen“, bilanzierte Katalinic.<br />
Neben der ökonomischen Seite unterstrich<br />
Prof. Dr. Ingrid Schreer vom Mamma-Zentrum<br />
der Kieler Uniklinik die mit der Früherkennung<br />
einhergehende höhere Lebensqualität der Patientinnen:<br />
„Die Lebensqualität wird entscheidend<br />
bestimmt durch das Stadium, in dem ein<br />
Tumor entdeckt wird.“ Rund 70 000 Frauen aus<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> haben bisher in rund<br />
100 000 Untersuchungen von dem 2001 gestarteten<br />
Projekt profitiert. Im Sommer 2005 wurde<br />
es auf ganz <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> ausgedehnt. Die<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 33
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
34<br />
gesetzlichen Krankenkassen belastet das Modell<br />
mit rund vier Millionen Euro im Jahr. <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>s<br />
TK-Leiter Dr. Johann Brunkhorst<br />
ist sicher, dass dieses Geld sinnvoll eingesetzt<br />
wird: „Das ist eine Investition in die Gesundheit<br />
der Frauen.“ Nach den in Kiel präsentierten Ergebnissen<br />
sind rund 68 Prozent der durch Qua-<br />
MaDi entdeckten Tumore noch in einem frühen<br />
Stadium mit entsprechend guter Heilungschance.<br />
In den Regionen <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>s,<br />
wo QuaMaDi im Untersuchungszeitraum 2002<br />
und 2003 noch nicht etabliert war, betrug der<br />
Anteil der entdeckten Tumore im frühen Stadium<br />
nur rund 47 Prozent.<br />
Diese Ergebnisse haben auch andere Bundesländer<br />
inzwischen hellhörig gemacht. Trotz Di-<br />
Pflegediakonie Husum-Bredstedt<br />
Niedrigschwellige Angebote<br />
Angehörige zu pflegen ist ein Fulltimejob. Wer<br />
24 Stunden am Tag Ehepartner oder Eltern<br />
pflegt, ist froh über jede Auszeit. Niedrigschwellige<br />
Angebote wie die der Pflegediakonie Husum-Bredstedt<br />
bieten solche Auszeiten. 20 Ehrenamtler<br />
übernehmen die Betreuung für einen<br />
Nachmittag.<br />
Für einen Augenblick wirken die beiden Frauen<br />
etwas verloren. Zwischen Aufräumen und Abholen<br />
haben sich die beiden älteren Damen vertraut<br />
nebeneinander gesetzt, so wie in den vergangenen<br />
drei Stunden. Als sie sich nach ihrem<br />
zu Hause fragen, werden ihre Blicke ratlos.<br />
Ihr Gedächtnis spielt nicht mehr mit. Fragen<br />
nach Wohnort, Nachname oder Alter können<br />
sie häufig genug beantworten, manchmal aber<br />
auch nicht. Die Demenz ist bei ihnen noch<br />
nicht so weit fortgeschritten wie bei der dritten<br />
Teilnehmerin in dieser Donnerstagnachmittag<br />
Runde in der Pflegediakonie in Hattstedt bei<br />
Husum. Sie hat immer mal wieder den Vornamen<br />
ihres 82-jährigen Ehemanns gerufen, der<br />
sie allein zu Hause pflegt. Den Dienstagnachmittag<br />
hat er frei, dank des Angebots der Diakonie.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
sease-Management-Programm und Screening<br />
interessieren sich auch die TK in Sachsen und<br />
in Rheinland-Pfalz für das Modell „Made in<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>“. „Es laufen viel versprechende<br />
Gespräche“, sagte Brunkhorst zu den bis<br />
Redaktionsschluss noch nicht beendeten Verhandlungen<br />
über einen Export in die anderen<br />
Länder. In <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> ist die Akzeptanz<br />
nach einigen Anlaufschwierigkeiten in den Anfangsjahren<br />
inzwischen sehr groß. Im niedergelassenen<br />
Bereich hat sich QuaMaDi längst<br />
durchgesetzt. Mehr als 90 Prozent der niedergelassenen<br />
Gynäkologen unterstützen das Modell<br />
mit standardisierter Doppelbefundung durch<br />
zwei Radiologen und die Abklärungsdiagnostik<br />
im Mammazentrum. (di)<br />
600 pflegebedürftige Menschen werden allein in<br />
der Husumer Umgebung allein von den Angehörigen<br />
betreut. Für sie gibt es seit Mai 2004 das<br />
Angebot, ehrenamtliche Betreuung in Anspruch<br />
zu nehmen. Ein Anruf bei der Koordinatorin<br />
Ruthild Schiller genügt. Die examinierte Altenpflegerin<br />
kommt dann vorbei zu einem Gespräch<br />
mit dem zu Pflegenden und dem Angehörigen<br />
und sucht sich dann eine Betreuungsperson aus<br />
ihrem Pool von Ehrenamtlern heraus. Bei der<br />
Gruppenbetreuung in den Räumen der Diakonie<br />
in Hattstedt und Langenhorn legt sie Wert<br />
auf eine 1 : 1-Betreuung. Jede Ehrenamtlerin -<br />
nur ein Mann hat bislang den 24-stündigen<br />
Ausbildungskurs absolviert - ist sorgfältig ausgesucht<br />
und kennt die Besucherin durch die regelmäßige<br />
Betreuung.<br />
Dennoch ist bei der Begrüßung wenig davon zu<br />
spüren, dass die Treffen jede Woche stattfinden.<br />
Die Erinnerung an das letzte Beisammensein<br />
ist schon wieder ausgelöscht. Betreuerin<br />
Sylvia Peetz bittet alle in einen Kreis und<br />
stimmt ein Lied an, das alle noch aus ihrer Kinderzeit<br />
kennen. Schwieriger wird es, als nach<br />
den Namen und Wohnorten gefragt wird. Die<br />
Grenze der Belastbarkeit ist für das Gedächtnis<br />
schnell erreicht. Die Betreuerinnen lassen sich<br />
davon nicht entmutigen. Die Hausfrau Heike<br />
Johannsen, die Angestellte Eike Grygas und die
Eike Grygas (o. links), Sylvia Peetz (o. rechts) und<br />
Heike Johannsen (u. rechts) betreuen ehrenamtlich<br />
Menschen, um deren Angehörigen eine kurze Auszeit zu<br />
ermöglichen (Fotos: di)<br />
Selbstständige Sylvia Peetz hätten viele Gründe,<br />
diesen Nachmittag woanders zu verbringen:<br />
mit der Familie, bei der Arbeit oder entspannt<br />
für sich allein. Seit Mai 2004 aber<br />
kommen sie regelmäßig in die Diakonie, um<br />
mit ihren Schützlingen zusammen zu sein<br />
und deren Angehörigen eine Auszeit zu gönnen.<br />
„Ich empfinde das nicht als anstrengend“,<br />
sagt Sylvia Peetz. Sie lerne aus diesen Nachmittagen,<br />
sagt sie, „dass der Augenblick zählt.“<br />
Zusammen mit 21 anderen Interessierten hat<br />
sich Sylvia Peetz im Frühjahr 2004 auf einen<br />
Artikel in der Lokalpresse gemeldet, in dem<br />
über das von der Diakonie geplante Entlastungsangebot<br />
für pflegende Angehörige berichtet<br />
wurde. „Wir waren hoch erfreut über die Resonanz“,<br />
berichtet Kursleiterin Ruthild Schiller.<br />
In zwölf Doppelstunden wurden Kenntnisse<br />
über die Krankheitsbilder Demenz und Alzheimer<br />
gepaukt, Kommunikationsformen mit Verwirrten<br />
geübt, Beschäftigungsideen vermittelt<br />
und die oft kräftezehrende Situation von pflegenden<br />
Angehörigen geschildert. „Man sollte<br />
nie über die Angehörigen urteilen“, sagt Sylvia<br />
Peetz. Denn was die im Alltag leisteten, sei für<br />
die meisten Außenstehenden nicht ersichtlich.<br />
Zur körperlichen Belastung und zur Erkenntnis,<br />
dass der Partner an Demenz<br />
erkrankt ist, gesellt sich oft auch noch<br />
Enttäuschung. „Viele hatten noch ganz<br />
viel vor. Und plötzlich ist der Ehemann<br />
oder die Frau erkrankt und die ganzen<br />
Pläne lassen sich nicht mehr verwirklichen“,<br />
berichtet Sylvia Peetz. Nach kurzem<br />
Nachdenken sagt sie: „Eigentlich<br />
nehmen die Angehörigen jeden Tag ein Stück<br />
Abschied von ihrem Partner.“<br />
Die 46-Jährige betreut an einem zweiten Nachmittag<br />
in der Woche demente Menschen auch<br />
einzeln in deren vier Wänden, hat selbst vier<br />
Kinder im Alter von elf bis 25 Jahren, einen<br />
Mann und einen florierenden Handel auf Wochen-<br />
und Weihnachtsmärkten. Daraus den<br />
Schluss zu ziehen, keine Zeit für die ehrenamtliche<br />
Tätigkeit zu haben, kommt ihr nicht in den<br />
Sinn - im Gegenteil: „Ich habe in meinem Leben<br />
so viel Gutes erfahren, das will ich irgendwie<br />
weitergeben.“<br />
Trotzdem ist sie weit davon entfernt, von anderen<br />
das gleiche Engagement zu fordern wie von<br />
sich selbst. „Jeder sollte seine eigenen Maßstäbe<br />
setzen. Für mich ist es wichtiger, hier zu helfen,<br />
als zu Hause die Fenster zu putzen.“ (di)<br />
Rat & Hilfe für Patienten(innen):<br />
Patienten-Ombudsmann/-frau <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> e. V.<br />
Telefon 01805/235383<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 35
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
36<br />
Interview mit Prof. Dr. Jörg Haasters,<br />
Ostseeklinik Damp<br />
„Man muss brennen, nicht<br />
nur glimmen“<br />
Nach über 20 Jahren ärztlicher Tätigkeit<br />
als Chefarzt der 1. orthopädischen<br />
Abteilung und ärztlicher Direktor der<br />
Ostseeklinik Damp trat Prof. Dr. Jörg<br />
Haasters Ende des Jahres 2005 in den<br />
Ruhestand. Im Gespräch mit dem<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>ischen <strong>Ärzteblatt</strong> zog<br />
er Bilanz und gab einen Ausblick auf<br />
die Zukunft.<br />
SHÄ:<br />
Herr Prof. Haasters, nach einer so langen chefärztlichen<br />
Tätigkeit dürfte die Zahl der behandelten<br />
Patienten und vielleicht auch die der<br />
weitergebildeten Ärzte ganz erheblich sein?<br />
PROF. ROF.<br />
HAASTERS<br />
HAASTERS:<br />
Ja, in unserer Klinik werden jährlich 8 000 bis<br />
9 000 Patienten behandelt, davon allein in meiner<br />
Abteilung rund 2 000. Wenn man das hochrechnen<br />
würde ...<br />
Wir haben als Fachklinik für den Haltungs- und<br />
Bewegungsapparat (einschließlich Innere Medizin/Rheumatologie,<br />
Neurologie und Neurochirurgie<br />
der Wirbelsäule) ein großes Einzugsgebiet,<br />
ganz <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> - aber es kommen<br />
auch Patienten von weiter her, etwa aus Niedersachsen<br />
oder Mecklenburg-Vorpommern.<br />
Genau kann ich Ihnen die Zahl der bei mir in<br />
der Abteilung weitergebildeten Ärzte nennen:<br />
56. Hinzu kamen noch einige Doktoranden.<br />
Durch meinen eigenen Werdegang an den Universitäten<br />
Freiburg, Berlin, Köln und Essen<br />
(Prof. Dr. K. F. Schlegel) habe ich immer großen<br />
Wert auf Aus- und Weiterbildung des<br />
Nachwuchses gelegt. Mancher junge Arzt ist<br />
vielleicht auch nach Damp gekommen, weil ich<br />
die volle Weiterbildungsbefugnis nicht nur für<br />
die Orthopädie habe, sondern auch für die Physikalische<br />
Therapie und die Sportmedizin.<br />
SHÄ:<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
Wie hat sich in Ihrer Zeit die orthopädische<br />
Versorgung qualitativ verändert?<br />
PROF. ROF.<br />
HAASTERS<br />
HAASTERS:<br />
Für uns - und damit<br />
meine ich<br />
auch meinen leitenden<br />
Oberarzt<br />
und Nachfolger<br />
Dr. Oehme - war<br />
immer wichtig, einen<br />
hohen Standard<br />
zu haben.<br />
Unsere qualitative<br />
Weiterentwicklung<br />
basiert auf einerSpezialisierung<br />
im Bereich<br />
der Gelenk- und Prof. Haasters (Foto: hk)<br />
Wirbelsäulenchirurgie. Wie am medizinischen<br />
Spektrum der Ostseeklinik Damp zu erkennen<br />
ist, haben wir uns seit einigen Jahren weiter subspezialisiert,<br />
wie es in der Abteilungsstruktur<br />
der Ostseeklinik deutlich wird. Ich selbst habe<br />
mich in der ersten orthopädischen Abteilung<br />
auf die Endoprothetik der großen Gelenke Hüfte<br />
und Knie konzentriert, meine Kollegen entsprechend<br />
auf andere Bereiche. Qualität hat ja<br />
mit der Häufigkeit bestimmter Operationen zu<br />
tun: rund 1 250 Hüft- und 1 000 Knie-Endoprothesenoperationen<br />
im letzten Jahr sprechen für<br />
sich.<br />
Wir haben schon sehr früh minimal-invasive<br />
Zugänge gewählt ebenso wie Kurzschaftprothesen.<br />
Beim Prothesenmaterial habe ich durch<br />
meine Arbeit in der Materialforschung an der<br />
Universität Essen stets auf solide Implantate geachtet<br />
(Titan oder seit neuester Zeit auch Tantal).<br />
Wir verwenden mit der Zweymüller-Prothese<br />
diejenige mit den weltweit längsten Standzeiten.<br />
Speziell beim Knie hat sich eine Art Baukastensystem<br />
bewährt: Ich verwende eine variable<br />
Prothese, die es erlaubt, sogar intra operationem<br />
nach individuellen Gegebenheiten etwa<br />
von der Schlitten- auf die achsgeführte Prothese<br />
umzusteigen.
SHÄ:<br />
Zwischenfrage: Die Industrie hat in den vergangenen<br />
Jahren so viele hochgelobte Neuerungen<br />
auf den Markt geworfen?<br />
PROF. ROF.<br />
HAASTERS<br />
HAASTERS:<br />
Wir haben bewusst nicht jede kurzlebige oder<br />
wiederholte Mode wie die Kappen-Hüftprothese<br />
mitgemacht. Das gilt auch für die Op-Roboter,<br />
die von manchen Krankenhausverwaltungen<br />
trotz des hohen Preises aus Marketing-Gründen<br />
favorisiert wurden. Wir haben aber gesehen,<br />
dass Roboter große Wunden schaffen und dem<br />
Operateur zu wenig Eingriffsmöglichkeiten lassen.<br />
Navigationssysteme haben wir durchaus getestet,<br />
allerdings sind sie nicht besser als ein gut<br />
trainierter Operateur, und es besteht die Gefahr,<br />
dass man gezwungen ist, im System zu bleiben,<br />
wenn einmal eine falsche Eingabe gemacht<br />
wurde.<br />
SHÄ:<br />
Ist eine Qualitätsveränderung vielleicht auch<br />
ablesbar bei ihrer langjährigen Prüfungstätigkeit<br />
in der <strong>Ärztekammer</strong> (Facharzt-Prüfungen)?<br />
PROF. ROF.<br />
HAASTERS<br />
HAASTERS:<br />
Heute liegt der Schwerpunkt auf der operativen<br />
Versorgung, aber auch die klassische Orthopädie<br />
wird noch geprüft. Dabei ist klar, dass sich<br />
das Bild der Orthopädie stark gewandelt hat,<br />
von der früheren „Wuchslenkung“ bis hin zur<br />
Endoprothetik. Das hängt auch damit zusammen,<br />
dass das Anspruchsdenken stärker geworden<br />
ist: Erst nach der Pensionierung beginnt für<br />
manche die sportliche Laufbahn mit Tennis,<br />
Golf oder Skilaufen. Die früher üblichen konservativen<br />
Behandlungen nach Hüftdysplasie,<br />
Skoliose, Polio, Rachitis sind kaum noch erforderlich,<br />
auch durch entsprechende Früherkennungen<br />
pädiatrischer oder pränataler Art. Sicher<br />
geht da manche Erfahrung verloren.<br />
SHÄ:<br />
In Ihren Veröffentlichungen haben Sie sich immer<br />
wieder auch mit der Sportmedizin befasst.<br />
Gehe ich recht in der Annahme, dass sich die<br />
Sportmedizin heute viel stärker (und erfolgreicher)<br />
als früher mit dem Breitensport befasst?<br />
PROF. ROF.<br />
HAASTERS<br />
HAASTERS:<br />
Ja, früher stand meist der Hochleistungssport im<br />
Vordergrund. Das war sicher auch attraktiv für<br />
eine Klinik, wie sich bei meinem Vorgänger<br />
Prof. Schoberth zeigte, der ja Mannschaftsarzt<br />
der deutschen Fußballnationalmannschaft war.<br />
Auch heute kümmern wir uns natürlich auch<br />
um Spitzensportler, wie z. B. die Handballer von<br />
der SG Flensburg-Handewitt. Schwerpunktmäßig<br />
versorgen wir heute jedoch die Masse der<br />
Freizeitsportler. Dazu wollen wir möglichst viele<br />
Ärzte an die Sportmedizin heranführen. Leider<br />
ist „Sportmedizin“ nur eine Zusatzbezeichnung.<br />
Ein Beispiel für aktuelle sportmedizinische Erkenntnisse<br />
findet sich beim Schoberth-Preis<br />
2005. Hier konnte der Preisträger belegen, dass<br />
viele Tennisspieler zu einseitig trainieren und<br />
später besonders Schulter- und Rückenbeschwerden<br />
bekommen, wenn sie nicht adäquat vorbeugen.<br />
Ein anderes Beispiel sind die Springreiter<br />
im Lande, die viel für ihre Pferde, aber zu wenig<br />
für sich tun. Wir laden diese Breitensportler<br />
nach Damp ein und zeigen ihnen, dass ein ausgleichendes<br />
Bewegungsprogramm effektiv ist<br />
und Spaß macht.<br />
SHÄ:<br />
Kann die Sportmedizin, die Orthopädie mehr<br />
auf dem Gebiet der medizinischen Prävention<br />
tun?<br />
PROF. ROF.<br />
HAASTERS<br />
HAASTERS:<br />
Wir tun schon jetzt viel. Ich selber habe schon<br />
in der Ausbildung an der Universität Köln<br />
(Schwerpunkt Biomechanik) mit der Sporthochschule<br />
Köln zusammengearbeitet. Die große<br />
Bedeutung von Dehnübungen, wie wir damals<br />
sagten (heute „Stretching“), war mir daher<br />
früh bewusst. Wir Menschen haben ja meist<br />
stärkere Beuge- als Streckmuskeln, Agonisten<br />
und Antagonisten sind nicht gleichgewichtig.<br />
Die verkürzten Strecker müssen wieder auf ein<br />
Normalmaß gebracht werden, um Verletzungen<br />
vorzubeugen. Wie das fast spielerisch geht, beweisen<br />
ja Balletttänzerinnen oder die Mädchen<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 37
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
38<br />
von der rhythmischen Sportgymnastik beim<br />
vorbereitenden Training.<br />
In Damp zeigen wir unseren Gästen, wie zum<br />
Beispiel durch Nordic Walking und durch gesunde<br />
Ernährung Prävention betrieben werden<br />
kann. Allerdings wissen wir heute auch, dass es<br />
Menschen gibt, denen aus genetischen Gründen<br />
Sport nicht so viel bringt wie anderen. Aber<br />
auch wer eine Endoprothese hat, bleibt vom<br />
Sport nicht ausgeschlossen. Er kann seine gewohnte<br />
Sportart etwas angepasst weiter betreiben,<br />
auch Golf, Tennis oder sanftes Skilaufen -<br />
aber in eine neue Sportart wie Wasserski sollte<br />
sich der Knie-Endoprothesenträger nicht unbedingt<br />
stürzen.<br />
SHÄ:<br />
Wenn die Orthopädie zunehmend „operativer“<br />
zu werden scheint, ist dann für Sie die Zusammenführung<br />
mit der Unfallchirurgie vorbehaltlos<br />
zu begrüßen?<br />
PROF. ROF.<br />
HAASTERS<br />
HAASTERS:<br />
Obwohl ich von der klassischen Orthopädie geprägt<br />
bin und den „sensus orthopaedicus“ immer<br />
hoch gehalten habe, habe ich doch sehen<br />
müssen, dass uns die Traumatologie weglief: Wir<br />
hatten kaum noch frische Verletzungen, fast<br />
nur Verschleißschäden. Auch heute beschränken<br />
wir uns auf die rekonstruktive Chirurgie<br />
und übernehmen keine Multitraumata aus<br />
schweren Unfällen. Zu Lehrzwecken haben wir<br />
aber einen Verbund mit der Kieler Klinik für<br />
Unfallchirurgie (Prof. Dr. Seekamp) des UK S-H<br />
und tauschen Assistenten für ein Jahr aus. Im<br />
Übrigen ist die Trennung von Orthopädie und<br />
Unfallchirurgie eine deutsche Besonderheit, die<br />
im Ausland so nicht besteht.<br />
SHÄ:<br />
Wäre aber durch ein Zurückgehen der konservativen<br />
Orthopädie nicht auch die hierzulande<br />
traditionell starke Physikalische Medizin und<br />
die Rehabilitative Medizin betroffen?<br />
PROF. ROF.<br />
HAASTERS<br />
HAASTERS:<br />
Ich glaube nicht, denn auch die Unfallchirurgen<br />
haben gelernt, dass die postoperativen Ergebnis-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
se besser werden durch eine gute Rehabilitation,<br />
wie wir sie in Damp integriert haben. Sie werden<br />
lernen müssen, sich mit konservativen orthopädischen<br />
Maßnahmen auseinander zu setzen<br />
und erkennen, dass eine Reihe von Erkrankungen<br />
wie der Bandscheibenvorfall kausal Verschleißleiden<br />
sind, die zunächst konservativ an-<br />
zugehen sind. Insgesamt bin ich davon überzeugt,<br />
dass die Fusion für beide Fächer und ganz bestimmt<br />
für die Patienten gut ist.<br />
SHÄ:<br />
Für Patienten ist auch die Zukunftsfrage wichtig,<br />
ob und wie eine menschliche Medizin bewahrt<br />
werden kann.<br />
PROF. ROF.<br />
HAASTERS<br />
HAASTERS:<br />
Ich denke, das muss erreicht werden. Wir Ärzte<br />
dürfen uns nicht nur dem Diktat der Ökonomie<br />
unterwerfen, auch wenn wir anerkennen, dass<br />
es nicht mehr nach dem früheren Motto „Es ist<br />
alles da“ gehen kann. Auch wir müssen mit unseren<br />
Ressourcen gut umgehen, müssen auch<br />
ökonomisch denken lernen, aber wir dürfen den<br />
Patienten nicht finanziellen Aspekten unterordnen<br />
und müssen uns auch gegenüber der Verwaltung<br />
behaupten. Das gilt etwa bei kurzfristig<br />
orientierten Vorbehalten gegen „teure“ Maßnahmen:<br />
Ich habe bei den Implantaten immer<br />
auf Qualität geachtet und damit langfristig teure<br />
Folgeoperationen vermieden. Meine Forderung<br />
lautet daher: Auch in ökonomisch schwierigeren<br />
Zeiten darf die Qualität nicht leiden.<br />
SHÄ:<br />
Verstehen Sie Menschlichkeit in der Medizin<br />
auch intern als Maxime im Verhältnis zu den<br />
jungen Ärzten und den übrigen Mitarbeitern in<br />
der Klinik?<br />
PROF. ROF.<br />
HAASTERS<br />
HAASTERS:<br />
Ja, ich sehe auch in der Familie (ein Sohn beginnt<br />
die chirurgische Ausbildung in München)<br />
die große zeitliche und physisch-psychische Belastung<br />
der Assistenten. Generell haben Mitarbeiter<br />
aller Kliniken einen gewissen Druck. Zum<br />
Beispiel kommen Patienten zur Vorbereitung
nur einen Tag vor der Operation zu uns. Weiterhin<br />
verlangt der Gesetzgeber bei der Operation<br />
den Facharztstandard, und unsere Kaufleute<br />
dringen auf kurze Operationszeiten. Junge Mediziner<br />
brauchen aber länger, und wir wollen<br />
unseren Nachwuchs heranbilden. Bei der Arbeitszeit<br />
können wir zum Glück in Damp mehr<br />
steuern als anderswo, weil wir fast nur Wahleingriffe<br />
haben. Wir versuchen somit, unseren Mitarbeitern<br />
möglichst optimale Arbeitsbedingungen<br />
zu gewährleisten.<br />
SHÄ:<br />
Schlussfrage: Was werden Sie nach dem 31. Dezember<br />
tun, bleiben Sie dem Fach verbunden?<br />
Dr. Uve Barmwater, Bad Bramstedt,<br />
Praktischer Arzt<br />
Oliver Brinker, Kronshagen, Arzt<br />
Dr. Peter Grieffenhagen, Preetz,<br />
Facharzt für Haut- u. Geschlechtskrankheiten<br />
Dr. Catrin Halves, Flensburg,<br />
Fachärztin für Allgemeinmedizin<br />
Torsten Hesemeyer, Mölln,<br />
Facharzt für Allgemeinmedizin<br />
Dr. Jörn Heiser, Flensburg,<br />
Facharzt für Augenheilkunde<br />
Dr. Jan H. Höcker, Schellhorn, Arzt<br />
Petra Karde, Kiel,<br />
Fachärztin für Allgemeinmedizin<br />
Dr. Andreas Kosak, Bordesholm,<br />
Facharzt für Allgemeinmedizin<br />
Dr. Jürgen Kuhnert, Eutin,<br />
Facharzt für Allgemeinmedizin<br />
Kai Lausen, Kiel, Facharzt für Anästhesiologie<br />
Karl Lentz, Lohe-Förden,<br />
Facharzt für Allgemeinmedizin<br />
Dr. Thomas Lewko, Kiel,<br />
Facharzt für Orthopädie<br />
PROF. ROF.<br />
HAASTERS<br />
HAASTERS:<br />
Ja, ich möchte mich unserer Akademie Damp in<br />
der Supervision stärker widmen, aber auch weiter<br />
die Flensburger Pädagogikstudenten im Fach<br />
Sportmedizin unterrichten, ich bin zu Vorträgen<br />
bereit und zur weiteren Gremienarbeit in der<br />
<strong>Ärztekammer</strong>. Mein Fazit: Meine ärztliche Tätigkeit<br />
hat mir viel Freude gemacht, ich habe<br />
dafür gelebt und ich möchte der Medizin verbunden<br />
bleiben.<br />
SHÄ:<br />
Herr Prof. Haasters, vielen Dank für das Gespräch<br />
und alles Gute für die Zukunft! (hk)<br />
Das Fortbildungszertifikat haben u. a. erhalten:<br />
Heike Lixenfeld, Hamburg,<br />
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie<br />
Dr. Peter Neb, Ahrensburg,<br />
Facharzt für Radiologie<br />
Dr. Gerd Petersen, Eutin,<br />
Facharzt für Allgemeinmedizin<br />
Dr. Manuela Rothe, Henstedt-Ulzburg, Ärztin<br />
Dr. Annette Scheuer, Lübeck,<br />
Fachärztin für Haut- u. Geschlechtskrankheiten<br />
Dr. Renate Schleker, Eutin,<br />
Fachärztin für Allgemeinmedizin<br />
Alexander Scholz, Kiel,<br />
Facharzt für Orthopädie<br />
Dr. Bernd-Otfried Schulz, Lübeck,<br />
Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe<br />
Axel Vossen, Kiel,<br />
Facharzt für Physikalische und<br />
Rehabilitative Medizin<br />
Dr. Angela Weinowski, St. Michaelisdonn, Ärztin<br />
Dr. Monika Wiemer, Lübeck,<br />
Fachärztin für Innere Medizin<br />
Horst Wietelmann, Lübeck,<br />
Facharzt für Innere Medizin<br />
Fortsetzung folgt ...<br />
Fragen zu Ihrem Fortbildungszertifikat<br />
beantworten Ihnen gern Dr. Elisabeth Breindl, Tel. 04551/803-143,<br />
oder Juliane Hohenberg, Tel. 04551/803-218.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 39
Kammer-Info<br />
40<br />
Vom Sinn der Sinne im<br />
Dialog zwischen Natur und<br />
Kultur oder vom Geist der<br />
Synästhesie*<br />
Dietrich von Engelhardt**<br />
I. Einstimmung<br />
Das Thema „Sinn der Sinne“ stellt im Prinzip<br />
drei Fragen: Was ist der spezifische Charakter<br />
der physischen Sinne, worin liegt die Verbindung<br />
der physischen Sinne mit Sinn oder mit<br />
Psyche, Gesellschaft und Kultur und wie steht<br />
es schließlich mit der Beziehung der physischen<br />
Sinne untereinander und zugleich mit den<br />
transphysischen oder geistig-kulturellen Bereichen.<br />
Synästhesie in dieser Hinsicht lenkt darüber<br />
hinaus den Blick auf spezifische Zusammenhänge<br />
der Sinne mit den einzelnen Altersphasen,<br />
den beiden Geschlechtern, mit sozialkulturellen<br />
Voraussetzungen wie ebenfalls mit Norm und<br />
Abweichung oder Gesundheit und Krankheit.<br />
Neben der Phänomenologie und Pathophänomenologie<br />
der Sinne, ihrer realen Erscheinung<br />
und kulturellen Deutung in den Künsten und<br />
der Literatur, der Philosophie und Theologie<br />
verdienen auch die Formen der Prägung und<br />
Veränderung der Sinne als ihre Kultivierung,<br />
Erziehung und Therapie besondere Beachtung.<br />
Sinne spielen in den Behandlungsformen der<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
Medizin, in der pädagogischen Einwirkung oder<br />
ganzheitlichen Bildung sowie im Leben und der<br />
Kommunikation der Menschen eine wichtige<br />
Rolle.<br />
Unübersehbar ist die Flut an Veröffentlichungen<br />
über die einzelnen Sinne. Verschiedentlich<br />
wurden auch Studien den Sinnen in umfassender<br />
Perspektive, wenngleich mit jeweils unterschiedlicher<br />
Akzentuierung, gewidmet; ein klassischer<br />
Beitrag wurde von Erwin Straus mit der<br />
Schrift „Vom Sinn der Sinne“ im Jahre 1936<br />
(2. Aufl. 1956) vorgelegt, nahezu zeitgleich erschien<br />
1934 von Albert Wesselski die Abhandlung<br />
„Der Sinn der Sinne“.<br />
II. Sinne in physischer Hinsicht<br />
Die Sinne in physischer Hinsicht richten den<br />
Blick auf Anatomie, Physiologie und stets auch<br />
Pathologie. Sinne besitzen eine unterschiedliche<br />
Bedeutung in der Phylogenese und Ontogenese<br />
und stehen für jeweils spezifische Beziehungen<br />
des Menschen zu seiner Umwelt.<br />
Die beiden Fernsinne Sehen und Hören haben<br />
im Unterschied zu den Nahsinnen Fühlen, Riechen<br />
und Schmecken im besonderen Maße die<br />
Aufmerksamkeit der naturwissenschaftlich-medizinischen<br />
Forschung gewonnen. Sehen und<br />
Hören sind im Übrigen auch konstitutiv für alle<br />
Künste: Bilder und Skulpturen werden betrachtet,<br />
Musik wird gehört, Literatur wird ebenfalls<br />
mit den Augen oder den Ohren aufgenommen,<br />
nicht aber gerochen, geschmeckt oder gefühlt.<br />
Nach den jeweiligen Möglichkeiten der Künste<br />
werden aber auch die Nahsinne in Kunst und<br />
Literatur dargestellt.<br />
Von allen Wissenschaften wurden in der Vergangenheit<br />
Untersuchungen über die der verschiedenen<br />
Sinne veröffentlicht und werden<br />
auch weiterhin publiziert. Descartes entwickelte<br />
im 17. Jahrhundert eine physiologische Theorie<br />
der Schmerzempfindung. Der Physiologe<br />
Johannes Müller formulierte in der Schrift<br />
„Über die phantastischen Gesichtserscheinungen“<br />
aus dem Jahre 1826 das so genannte „Gesetz<br />
der spezifischen Sinnesenergie“, nach dem<br />
jeder Sinn unabhängig von der Art des Reizes<br />
* Das Bild zeigt das Gemälde „Allegorie der fünf Sinne“ von Hermann van Aldewereld (1629-1669). Die Veröffentlichung<br />
erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Staatlichen Museums der Kunst in Schwerin.
nach der für ihn charakteristischen Energie reagiert;<br />
das Auge, auf welche Weise auch stimuliert,<br />
wird immer mit dem Eindruck von Lichterscheinungen<br />
den Reiz beantworten.<br />
Die physischen Sinne fanden in der Philosophie<br />
seit der Antike Beachtung. Von Aristoteles wurden<br />
die Sinne in die Gliederung der oberen und<br />
unteren Sinne gebracht, die allerdings im Blick<br />
auf Lebenserhalt, Wissenserwerb und Erkenntnisgewinn<br />
abgewandelt werden kann. Jeder Sinn<br />
ist nach Aristoteles<br />
einerseits autonom,<br />
andererseits gibt es<br />
allen Sinnen gemeinsameGegenstände<br />
(= koine<br />
aisthesis). Entsprechende Analysen und Einteilungen<br />
brachen auch in der Folgezeit nicht ab.<br />
Hegel legte eine philosophische Begründung der<br />
Anzahl der Sinne vor, begründete seinerseits die<br />
Unterscheidung in Fern- und Nahsinne, erläuterte<br />
die Zuordnung der Sinne zu bestimmten<br />
Regionen des menschlichen Körpers und regte<br />
vor allem zur Entwicklung oder Vertiefung einer,<br />
wie er es nennt, „psychischen Physiologie“<br />
an. In diesem Zusammenhang wies der Philosoph<br />
auf die unterschiedliche Verknüpfung von<br />
Affekt und Körperorgan hin, wie zum Beispiel<br />
auf die Platzierung des Mutes im Herzen, des<br />
Denkens im Gehirn usw. „Die Eingeweide und<br />
Organe werden in der Physiologie als Momente<br />
nur des animalischen Organismus betrachtet,<br />
aber sie bilden zugleich ein System der Verleiblichung<br />
des Geistigen, und erhalten hierdurch<br />
noch eine ganz andere Deutung.“ (Die Philosophie<br />
des Geistes, 1817).<br />
Die physischen Sinne besitzen aber nicht nur eine<br />
empirisch-wissenschaftliche oder philosophische<br />
und theologische, sondern ebenso eine anthropologische<br />
Bedeutung, insofern sich aus ihnen<br />
eine jeweils spezifische Beziehung des Menschen<br />
zum Raum, zur Zeit, zum Körper, zum<br />
Mitmenschen wie auch zum Selbst- und Weltbild<br />
ergibt.<br />
III. Sinne in Verbindung mit Sinn<br />
Die verschiedenen Sinne haben jeweils einen<br />
spezifischen sozialkulturellen Sinn, der bereits<br />
mit ihrer Anthropologie thematisiert ist. In vie-<br />
len Redewendungen wird diese Sinnebene der<br />
Sinne thematisiert. Reich ist die Welt der Literatur<br />
und Künste mit entsprechenden Darstellungen<br />
und Deutungen.<br />
Die Haut schließt den Körper ab und gibt ihn<br />
zugleich der Umwelt preis, sie verbindet und<br />
trennt, sie ist Gefühlssinn und Instrument der<br />
Seele. Der Mund ist das Organ des Geschmacks,<br />
der Nahrungsaufnahme und ebenso der geistigen<br />
Entäußerung oder sprachlichen Mitteilung.<br />
** Prof. Dr. phil. Dietrich v. Engelhardt hielt den<br />
hier wiedergegebenen Vortrag im Rahmen des Studiums<br />
Generale der Universität, Themenreihe „Vom Sinn der Sinne“,<br />
am 23. Oktober 2003. Prof. v. Engelhardt leitete das<br />
Lübecker Studium Generale von 1988 bis 2004.<br />
Der Geruch als dritter<br />
Nahsinn ist von be-<br />
sonderer Zartheit<br />
und Sensibilität.<br />
Auge und Ohr sind<br />
die beiden Fernsinne.<br />
Das Auge ist ebenso geistig wie intensiv oder<br />
auch aggressiv im Unterschied zur Passivität des<br />
Ohrs, das seinerseits zum Medium der Zuwendung,<br />
Gleichgültigkeit oder Ablehnung werden<br />
kann; zuhören, überhören und weghören bezeichnen<br />
diese Reaktionsmöglichkeiten. Mit<br />
dem Blick löst sich der Mensch am stärksten<br />
von seinem Körper, überwindet die räumliche<br />
Distanz, stellt eine Verbindung mit unterschiedlicher<br />
Signalwirkung zu anderen Menschen her;<br />
im Blick spricht Geist zu Geist, Seele zu Seele.<br />
Der Tastsinn verbindet sich mit der Hand, in<br />
weiterer Hinsicht aber mit der Haut als dem<br />
größten Organ des menschlichen Körpers. Zentral<br />
ist in diesem Bereich der Schmerz, dessen<br />
Sinnebene in sieben Dimensionen manifest<br />
wird: Empfindung, Ausdruck, Bewertung, Verhalten,<br />
Behandlung, soziale Reaktion, kultureller<br />
Kontext.<br />
Redewendungen über die Haut belegen die vielfältigen<br />
Verbindungen dieses Sinnes mit Sinn:<br />
er ist nur noch Haut und Knochen; mir ist nicht<br />
wohl in meiner Haut; ich möchte nicht in seiner<br />
Haut stecken; nicht aus seiner Haut herauskönnen;<br />
seine Haut zu Markte tragen; etwas geht<br />
unter die Haut; aus fremder Leute Haut ist gut<br />
Riemen schneiden; eine dicke Haut haben etc.<br />
Mit dem Altern des Menschen altert auch die<br />
Haut. Eindrucksvolle Beispiele aus der Malerei<br />
bieten Bilder von Ghirlandaio, Hans Baldung<br />
gen. Grien, Rembrandt. Schriftstellern stehen<br />
den Malern aber nicht nach. Honoré de Balzac<br />
Kammer-Info<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 41
Kammer-Info<br />
42<br />
verleiht im Roman „Die Frau von 30 Jahren“<br />
(1842) der Altersveränderung einen positiven<br />
Sinn, der unserer Zeit fremd geworden ist: „Das<br />
Gesicht einer jungen Frau hat die Ruhe, die<br />
Glätte, die Frische der Oberfläche eines Sees.<br />
Das Gesicht einer Frau beginnt erst mit dreißig<br />
Jahren ausdrucksvoll zu werden. Bis zu diesem<br />
Alter findet der Maler in ihrem Gesicht nur<br />
Milch und Blut,<br />
ein Lächeln und<br />
einen Ausdruck,<br />
das denselben<br />
Gedanken immer<br />
wiederholt, den<br />
Gedanken an Jugend<br />
und Liebe,<br />
einen immer<br />
gleichartigen und<br />
nicht tiefgehenden<br />
Gedanken;<br />
im Alter aber hat<br />
alles bei der Frau<br />
gesprochen, die<br />
Leidenschaften<br />
haben sich in ihr<br />
Gesicht eingegraben;<br />
sie ist Ge-<br />
liebte, Gattin, Mutter gewesen; die größte Freude,<br />
der heftigste Schmerz haben schließlich ihre<br />
Züge verzerrt und zerquält, haben sich dort in<br />
tausend Runzeln eingeschrieben, die alle sprechen;<br />
dann wird der Kopf einer Frau erhaben<br />
durch die Schrecknisse, die sie erduldet, schön<br />
durch die Schwermut, herrlich durch die Ruhe;<br />
wenn man jenes seltsame Gleichnis weiter anwenden<br />
will: ein ausgetrockneter See lässt dann<br />
noch die Spuren der wilden Wasser sehen, die<br />
ihn gebildet haben.“<br />
Hauterkrankungen können in Kunst und Literatur<br />
auch ethisch bewertet oder in einen religiösen<br />
Kontext gebracht werden. Mit der Therapie<br />
der Dermatologie und Plastischen Chirurgie<br />
verbinden sich stets ökonomische, ethische<br />
und sozialkulturelle Fragen. Was ist medizinisch<br />
gerechtfertigt, was ist psychologisch indizierte<br />
Ästhetik, was übertriebene Kosmetik? Die Lepraerkrankung<br />
im Versepos „Der arme Heinrich“<br />
(1195) von Hartmann von Aue steht für eine<br />
gefleckte Seele; mit dem Verzicht auf das Opfer<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
eines jungen Mädchens, das zu seiner Rettung<br />
ihr Leben hergeben will, gewinnt der Ritter seine<br />
reine Haut zurück. Hiobs Prüfung im Alten<br />
Testament vollzieht sich besonders an der<br />
Hauterkrankung. „Meine Haut ist schwarz geworden<br />
und löst sich ab von mir, und meine<br />
Beine sind verdorrt vor hitzigem Fieber. Mein<br />
Harfenspiel ist zur Klage geworden und mein<br />
Flötenspiel zum<br />
Trauerlied.“<br />
(Hiob 30, 21 f.)<br />
Vielfältig sind naturgemäß<br />
auch<br />
die Zusammenhänge<br />
des Geschmack-<br />
und<br />
Geruchssinnes<br />
mit der psychischgeistigenSinnebene.<br />
Reich ist<br />
ebenfalls hier die<br />
Geschichte an<br />
Beschreibungen<br />
und Interpretationen,<br />
an Redewendungen<br />
und<br />
künstlerischen Darstellungen und Deutungen:<br />
Liebe geht durch den Magen; es gibt Kummerspeck;<br />
man kann jemanden zum Fressen gern<br />
haben; über Geschmack soll sich nicht streiten<br />
lassen; man kann Personen nicht riechen etc.<br />
Abb. 1: Gérard de Lairesse, Allegorie der fünf Sinne, 1668, Öl auf Leinwand,<br />
Glasgow, Art Gallery<br />
Beim Essen und Trinken wird im Verlauf der<br />
Geschichte immer wieder Maß gefordert. In der<br />
Antike gab es die Warnung, dass Gastmähler<br />
(= convivia) zu Beerdigungen (= funeralia)<br />
werden könnten. Die Äbtissin, Ärztin und Naturforscherin<br />
Hildegard von Bingen befürchtete<br />
dagegen im Mittelalter vom Verzicht auf Trinken<br />
eine „Schwerfälligkeit (gravitas) an Leib<br />
und Geist.“ Paracelsus brachte mit der Mahnung:<br />
„Drum esse und trinke ein jeglicher so,<br />
dass er am Jüngsten Tage seine Völlerei zu verantworten<br />
wisse“, das Physische in eine Verbindung<br />
zur Metaphysik. Bei Shakespeare warnte<br />
Cäsar vor den leibfeindlichen Intellektuellen:<br />
„Lasst wohlbeleibte Männer um mich sein, mit<br />
glatten Köpfen und die nachts gut schlafen. Der<br />
Cassius dort hat einen hohlen Blick; er denkt zu
Abb. 2: Jan Saenredam, Die fünf Sinne, zwischen 1593-1606, Kupferstich nach Hendrick Goltzius San Francisco, Achenbach<br />
Foundation for Graphic Arts<br />
viel: Die Leute sind gefährlich“ (Julius Caesar,<br />
Akt 1, Szene 2). In der Physiologie des Geschmacks<br />
(1826) von Brillat-Savarin heißt es:<br />
„Die Gastronomie beherrscht das ganze Leben,<br />
denn die Tränen des Neugeborenen verlangen<br />
die Brust seiner Amme und der Sterbende<br />
schlürft noch hoffnungsvoll den letzten Trank,<br />
den er, ach! nicht mehr verdauen soll.“ Für den<br />
Philosophen Feuerbach gilt: „Der Mensch ist,<br />
was er isst.“ Fontane machte im „Stechlin“ (1899)<br />
auf einen wesentlichen Unterschied beim Geflügel<br />
aufmerksam: „Es gibt nichts Diesseitigeres als<br />
Brust und es gibt nichts Jenseitigeres als Flügel.“<br />
Der in den Wissenschaften weniger beachtete Geruchssinn<br />
ist für das Zusammenleben der Menschen<br />
seinerseits besonders wichtig oder wirkungsvoll.<br />
Selbst nach dem Tode kann dem Geruch<br />
ein besonderer Sinn zugeschrieben werden,<br />
wofür der russische Schriftsteller Dostojewskij<br />
im Roman „Die Brüder Karamasow“ (1879/80)<br />
mit der vorzeitigen Verwesung des Heiligen<br />
Sossima ein Beispiel gegeben hat. Ein Spektrum<br />
unterschiedlicher Gefühle und Gedanken löst<br />
bei allen Menschen - auch bei den Mönchen -<br />
der bereits nach wenigen Stunden auftretende<br />
Verwesungsgeruch des verstorbenen Sossima<br />
aus. Niemand wollte diesen Geruch wahrhaben,<br />
das Gegenteil hatten die Menschen erwartet<br />
oder erhofft, hatten in der Vergangenheit doch<br />
bereits mehrfach Mönche wie lebendig mit<br />
leuchtendem Antlitz im Grab gelegen, ja war<br />
von ihrem Leichnam sogar ein Wohlgeruch ausgegangen.<br />
Der Verwesungsgeruch verbindet<br />
sich mit sittlichem Verfall und Verunsicherung<br />
im Glauben, lenkt den Blick auf das Verhältnis<br />
von Immanenz und Transzendenz.<br />
Auch bei Shakespeare steht die vorzeitige Verwesung<br />
für moralische Dekadenz - „wie wir<br />
denn heutzutage viele lustsieche Leichen ha-<br />
ben, die kaum bis zum Hinlegen halten“ (Hamlet,<br />
um 1600). Verwesung ist das Wesen des Lebens;<br />
mit allen Sinnen - auf der physischen wie<br />
spirituellen Ebene - wird dieser Endprozess am<br />
Leichnam wahrgenommen, mit den Augen und<br />
vor allem aber der Nase, dem feinsten und intimsten<br />
Sinnesorgan des Menschen. Der aufgeklärte<br />
Humanist Settembrini verwirft mit seinem<br />
Plädoyer für Feuerbestattung in Thomas<br />
Manns „Der Zauberberg“ (1924) diese religiöse<br />
Perspektive der Erdbestattung.<br />
Sehen und Hören - die beiden Fernsinne - sind<br />
ihrerseits auf vielfältige Weise mit Sinn verbunden<br />
und haben in den Naturwissenschaften und<br />
Medizin intensive Beachtung gefunden. Die<br />
Fülle entsprechender Redewendungen und<br />
Sprichwörter lässt sich nicht wiedergeben: Man<br />
verschafft sich Gehör und kann einem Menschen<br />
hörig werden; verlangt wird Gehorsam;<br />
wer allerdings nicht hören will, muss fühlen;<br />
man sieht über den eigenen Tellerrand, kann<br />
seine Felle davon schwimmen sehen und auch<br />
der Gefahr ins Auge sehen; der Wald wird vor<br />
lauter Bäumen nicht gesehen; man sieht auf jemanden<br />
herunter, kann aber nicht in sein Herz<br />
sehen und nach dem Wechsel von Worten endlich<br />
Taten sehen wollen etc.<br />
Neben der Bezogenheit der Sinne zu den Lebensphasen<br />
und dem Geschlecht kommt ihrer Verbindung<br />
mit Norm und Abweichung bis hin zur<br />
Gesundheit und Krankheit auch in der Verbindung<br />
der physischen Sinne mit Sinn eine wesentliche<br />
Bedeutung zu. Zentral sind in dieser Beziehung<br />
ohne Zweifel Essstörungen wie Anorexie<br />
und Bulimie, aber auch Sinnesstörungen von<br />
Geisteskranken, die sich als Halluzinationen auf<br />
alle Sinne beziehen können. Zu den Menschen<br />
der Geschichte, die kein Geschmacksvermögen<br />
besaßen oder nach der Geburt verloren haben,<br />
Kammer-Info<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 43
Kammer-Info<br />
44<br />
Abb. 3: Hans Makart, Die fünf Sinne, 1872-79, Öl auf Leinwand, Wien, Österreichische Galerie Belvedere<br />
zählt Lorenzo il Magnifico in der Renaissance.<br />
Absonderliche Essgelüste von schwangeren<br />
Frauen sind aus der Realität und auch Literatur<br />
bekannt. Die Gräfin Renée de l’Estorade in<br />
Balzacs „Memoiren zweier Jungvermählter“<br />
(1841/42) erfreut sich in ihrer Schwangerschaft<br />
an schlechten, fast fauligen Orangen: „Ihr bläulicher<br />
oder grünlicher Schimmel schimmert für<br />
meine Augen wie Diamanten: Ich erblicke darin<br />
Blumen, ich bin mir ihres Kadavergeruchs nicht<br />
bewusst und finde ihren Saft aufreizend; er ist<br />
von einer weinigen Wärme, ein köstlicher Geschmack.“<br />
Naturgemäß stellt sich bei den Normabweichungen<br />
und krankhaften Veränderungen der<br />
Sinne stets die Frage nach therapeutischen<br />
Möglichkeiten sowohl in physischer wie in psy-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
chischer Hinsicht. Sinnesstörungen können<br />
auch über Sinne behandelt und gemildert werden.<br />
Unangenehme Hörgeräusche (Tinnitus)<br />
können mit Rauschgeräten (Noiser) im Ohr<br />
verringert werden. Die gezielte Vermeidung von<br />
Lärmsituationen kann allerdings auch zu wachsender<br />
Empfindlichkeit des Ohrs führen. Physische<br />
Therapie kann im Übrigen durch Psychotherapie<br />
unterstützt werden; das gilt ebenfalls<br />
für Halluzinationen von Geisteskranken, die<br />
sich nicht nur medikamentös, sondern daneben<br />
auch psychisch behandeln lassen. Die Antike<br />
vertrat bereits die Auffassung, einen Schmerz<br />
durch einen anderen Schmerz zu bekämpfen.<br />
Die Plastische Chirurgie hat in den letzten Jahren<br />
zunehmend Beachtung gewonnen, nicht<br />
nur bei Frauen, sondern ebenfalls bei Männern.
Ein besonders markantes und ethisch umstrittenes<br />
Beispiel ist das Angebot des englischen Chirurgen<br />
Peter Butler, bei nahezu totalen Gesichtsverbrennungen<br />
eine vollkommene Gesichtstransplantation<br />
vorzunehmen.<br />
Alle kunsttherapeutischen Richtungen greifen<br />
das Medium der Sinne zur Therapie von Sinnesstörungen<br />
auf. Entsprechend der Logik von<br />
Kunst und Literatur stehen allerdings die Sinne<br />
Sehen und Hören im Vordergrund der therapeutischen<br />
Interventionen; verschiedentlich<br />
wird aber auch der Tastsinn in der Mal- und<br />
Werktherapie eingesetzt. Für die Tanztherapie<br />
ist ohnehin das Zusammenspiel mehrerer Sinne<br />
konstitutiv.<br />
IV. Verbindung der Sinne untereinander<br />
und mit Sinn<br />
Die physischen Sinne des Menschen stehen<br />
nicht für sich, sondern sind auf vielfältige Weise<br />
miteinander verbunden und dies auch immer<br />
wieder zugleich mit der seelisch-geistigen oder<br />
sozialkulturellen Sinnebene. Der Maler Herman<br />
van Aldewereld hat in der „Allegorie der Sinne“<br />
(1651) alle Sinne bildlich wiedergegeben und<br />
zugleich die Fern- und Nahsinne voneinander<br />
auf der linken und rechten Bildhälfte getrennt.<br />
Zahlreiche Maler haben die einzelnen Sinne für<br />
sich dargestellt.<br />
Nach Goethe besitzen die Farben eine sinnlichsittliche<br />
Bedeutung, die auch von der Kunst genutzt<br />
wird: „Aus der sinnlichen und sittlichen<br />
Wirkung der Farben, sowohl einzeln als in Zusammenstellung,<br />
wie wir sie bisher vorgetragen<br />
haben, wird nun für den Künstler die ästhetische<br />
Wirkung abgeleitet“ (Farbenlehre, 1810).<br />
Die Geruchsorgel ist die Erfindung des hypersensiblen<br />
Des Esseintes in dem Roman „Gegen<br />
den Strich“ (1884) von Joris-Karl Huysmans.<br />
„Schon seit Jahren war er in der Wissenschaft<br />
der ‚feinen Nase’ geübt; er war der Meinung,<br />
dass der Geruch die gleichen Genüsse verschaffen<br />
könne wie das Gehör und das Gesicht, indem<br />
jeder Sinn durch natürliche Begabung und<br />
sorgsame Übung empfindlich genug wäre, neue<br />
Eindrücke aufzunehmen, sie zu verzehnfachen,<br />
zu koordinieren und die Gesamtheit daraus zu<br />
bilden, die ein Werk ausmacht.“<br />
Das Tasten wird mehrfach in eine Verbindung<br />
mit anderen Sinnen und zugleich auch mit dem<br />
Sinn von Seele und Geist gebracht. Das Neue<br />
Testament thematisiert die Berührung als Vergewisserung<br />
wie ebenfalls als Verbot. Die übliche<br />
Hierarchisierung der Sinne wird aufgehoben;<br />
die niedrigen Sinne werden zugleich zu den<br />
höchsten Sinnen. Den Jünger Thomas fordert<br />
Jesus auf, ihn zu berühren, um an seine Existenz<br />
glauben zu können. „Danach spricht er zu Thomas:<br />
Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände<br />
und reiche deine Hand her und lege sie in<br />
meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern<br />
gläubig!“ (Joh. 20, 27). Umgekehrt wird Maria<br />
Magdalena von Jesus mit dem berühmten Wort<br />
„noli me tangere“ von jedem körperlichen Kontakt<br />
mit ihm abgehalten. „Spricht Jesus zu ihr:<br />
Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht<br />
aufgefahren zum Vater“ (Joh. 20, 17). Das<br />
Abendmahl stellt alle Sinne - wenn auch im<br />
Zentrum Essen und Trinken - in die Perspektive<br />
der religiösen Transzendenz. Hölderlin greift in<br />
seinem Gedicht Brot und Wein (1800/01) diese<br />
Dimension in der doppelten Beziehung zum<br />
christlichen Glauben wie zur antiken Götterwelt<br />
auf. „Brot ist der Erde Frucht, doch ist’s<br />
vom Lichte gesegnet, und vom donnernden<br />
Gott kommt die Freude des Weins.“<br />
Die physischen Sinne stehen in ihrer Verbindung<br />
zum geistigen Sinn auch unter dem Gesetz<br />
der Rückkopplung. Wenn der Sinn von Liedern<br />
und Arien bekannt ist, verändert sich auch die<br />
unmittelbare Wirkung der Töne; der Trauergesang<br />
des Inkakönigs Montezuma über seine bevorstehende<br />
Hinrichtung in Carl Heinrich<br />
Grauns gleichnamiger Oper von 1775 gewinnt<br />
seine bewegende Tiefe erst durch das Wissen<br />
um den Inhalt. „Doch bringt mein Los auch<br />
Tod mir, so will ich fest und mutig ihm in das<br />
Auge sehn. Größe und Glanz der Menschen<br />
gleichen den flücht’gen Schatten, ein Hauch<br />
kann sie verwehn.“<br />
Sinne können sich gegenseitig steigern, aber<br />
auch stören. Von den Sinnen kann auch die Reflexion<br />
zum Erliegen kommen oder in den Worten<br />
der Philosophin Edith Landmann: „Je mehr<br />
wir uns den Sinnen hingeben, desto mehr schwindet<br />
das Bewusstsein von Realität, wir sind wie in<br />
Kammer-Info<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 45
Kammer-Info<br />
46<br />
einem Traum befangen“ (Metaphysik der Erkenntnis,<br />
1928). Musik kann unter die Haut gehen.<br />
Die Hörintensität kann durch Verschließen<br />
der Augen gesteigert werden. Das Lesen der<br />
Partiturnoten kann aber auch einzelne Instrumente<br />
klarer hervortreten lassen oder überhaupt<br />
erst zur Geltung bringen. Die Verbindung<br />
von Gehen und Denken wurde unterschiedlich<br />
beurteilt. Während der Philosoph Kant diese<br />
Verbindung im „Streit der Fakultäten“ (1798)<br />
für möglich hielt, schloss der Schriftsteller<br />
Thomas Bernhard in seinem Essai „Gehen“<br />
(1971) diese Möglichkeit kategorisch aus und ließ<br />
nur Denkbewegungen und Gedankengänge zu.<br />
Auf Ablehnung können ungewohnte Kombinationen<br />
der Sinne stoßen: Ein blaues Schweinesteak<br />
oder ein Glas des eigenen Speichels wird<br />
bei den meisten Menschen Unbehagen oder<br />
Widerwillen auslösen.<br />
Vor allem kann das Essen mit allen Sinnen in<br />
einen Zusammenhang gebracht werden, wofür<br />
das alte Konzept der Diätetik mit seinen sieben<br />
Dimensionen (= sex res non naturales): Licht<br />
und Luft, Bewegung und Ruhe, Schlafen und<br />
Wachen, Ausscheidungen und Gefühle in Verbindung<br />
mit Essen und Trinken steht. Das synästhetische<br />
Essen folgt ebenfalls dieser differenzierten<br />
Ganzheitlichkeit; alle Sinne sollen<br />
sinnhaft in einen Zusammenhang mit Essen und<br />
Trinken gebracht werden. Bilder, Musik, Kleidung,<br />
Besteck, Geschirr und die Gesprächsthemen<br />
werden auf die einzelnen Gänge des Essens<br />
abgestimmt.<br />
Sinne und Organe des Körpers sind dem Menschen<br />
nicht nur gegeben, sie müssen trainiert<br />
und entwickelt, sie können aber auch vernachlässigt<br />
werden und verkümmern. In ihrer kulturellen<br />
Bedeutung oder Wichtigkeit für das Leben<br />
weichen die Sinne voneinander ab. Die<br />
Funktionen der Sinne und Organe können sich<br />
mit den sozialen Aufgaben und geistigen Aktivitäten<br />
des Menschen in einem ausgewogenen<br />
und sinnvollen Zusammenhang befinden, ebenso<br />
möglich sind aber auch einseitige Betonungen<br />
und Konflikte. Körperkultur und Lebenskunst<br />
haben ihre Harmonie zum Ziel, die jedoch<br />
keineswegs immer erreicht wird.<br />
Abb. 4: Ferdinand Khnopff, Schumanns Werken zuhörend,<br />
1883, Öl auf Leinwand, Brüssel, Musées Royaux des Beaux-<br />
Arts<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
V. Perspektiven<br />
Synästhesie auf der physischen Ebene wie zugleich<br />
in Verbindung mit Sinn ist ein vielfältiges<br />
und faszinierendes Thema der Wissenschaften,<br />
Künste und des Lebens, stellt die Schnittstelle<br />
von Natur und Kultur dar, zeigt sich in Gesundheit<br />
und Krankheit.<br />
Im vorliegenden Beitrag wurde das Spektrum<br />
der physischen Sinne für sich wie in ihrer Verbindung<br />
mit Sinn, der selbst wiederum in eine<br />
Vielfalt von Dimensionen zu untergliedern ist,<br />
knapp behandelt. Aufgegriffen wurden Beschreibungen<br />
und Analysen der Wissenschaft<br />
wie Darstellungen und Deutungen der Künste<br />
und Literatur, hingewiesen wurde auch auf Beispiele<br />
aus der Realität.<br />
Die Sinne stehen in Verbindung, sie können<br />
aber auch zu Trennungen führen, was insbesondere<br />
mit Störungen und Krankheiten zusammenhängen<br />
kann. Bildung, Erziehung und Therapie<br />
sind gefragt. Substanzielle Grundlage ist<br />
der Dialog von Kultur und Natur für die Sinne<br />
oder ihre Synästhesie.<br />
Literatur beim Verfasser oder im Internet unter<br />
www.aerzteblatt-sh.de.<br />
Mit freundlicher Nachdruckgenehmigung des Focus<br />
MUL, Heft 2/2004<br />
Prof. Dr. phil. Dietrich von Engelhardt, Institut für<br />
Medizin- und Wissenschaftsgeschichte der Universität<br />
zu Lübeck, Königstr. 42, 23552 Lübeck
... und schöne Träume:<br />
„Liebling, die KV ist weg!“<br />
Wolfgang-Axel Dryden<br />
Neben mir schrillt der allmorgendliche Quälgeist<br />
auf dem Nachttisch. Mit einer tastenden<br />
Handbewegung stelle ich den Wecker ab. Einmal<br />
noch umdrehen! Da bemerke ich, dass das<br />
Bett neben mir leer ist. Die beste Ehefrau von<br />
allen, natürlich die von Herrn Kishon ausgenommen,<br />
ist fort! Im Wohnzimmer finde ich sie.<br />
Ziemlich unausgeschlafen schaut sie mir entgegen<br />
und berichtet mir von einem Wahnsinnstraum,<br />
der so realistisch gewesen sei, dass sie irgendwann<br />
schweißgebadet daraus aufgewacht<br />
sei. Sie habe erst einmal ihre Gedanken ordnen<br />
müssen. „Stell dir vor, ich habe geträumt, es gebe<br />
die Kassenärztliche Vereinigung (KV) nicht<br />
mehr.“<br />
„Kann ich mir eigentlich nicht gut vorstellen“,<br />
erwiderte ich. „Aber wenn man die ärztliche<br />
Presse sieht, ist das ja wohl der Wunschtraum<br />
fast jedes dritten Arztes. Die empfinden das sicherlich<br />
als nicht so schlimm. Was ist dir denn<br />
in dem Traum geschehen?“ Damit war ein<br />
Damm gebrochen: Die beste Ehefrau von allen,<br />
als mitarbeitende Arztfrau sonst eigentlich<br />
durch nichts mehr zu erschüttern, erzählte:<br />
„Schon als ich in die Praxis kam, hat mir eine<br />
unserer Helferinnen von einem Anruf von<br />
der AOK berichtet. Die hätten angekündigt,<br />
dass der Medizinische Dienst der<br />
Krankenkassen (MDK) morgen<br />
kommt, um das Qualitätshandbuch<br />
der Praxis,<br />
die Genehmigungen zur<br />
Sonographie und auch<br />
die Gerätebücher<br />
zu überprüfen.<br />
Man wolle zwar<br />
nicht stören, aber<br />
müsse natürlich<br />
im Sinne der<br />
Versicherten der<br />
AOK die Qualitätssicherung<br />
ernst nehmen. (Foto: BilderBox)<br />
Schließlich könne man nur mit Ärzten Verträge<br />
aufrecht erhalten, die ihre Qualität auch jederzeit<br />
belegen könnten.<br />
Schreiben für die Knappschaft<br />
Noch bevor der erste Patient für das Sprechzimmer<br />
vorbereitet war, war dann die Bundesknappschaft<br />
in der Leitung. Die teilten mit, dass sich<br />
die Abrechnungsbestimmungen für ihre Versicherten<br />
geändert haben. Wir hätten also jetzt<br />
auf dem Formblatt 35 der Bundesknappschaft<br />
alle Knappschaftspatienten aufzulisten, getrennt<br />
nach Mitgliedern, Familienversicherten und<br />
Rentnern, darunter nach Geschlecht, kurativem<br />
oder präventivem Beratungsanlass. Dann<br />
müssten wir auch die Arbeitsunfähigkeitszeiten<br />
bei den Mitgliedern aufführen. Dann noch darstellen,<br />
wer wann und warum in welches Krankenhaus<br />
eingewiesen wurde. Natürlich mit besonderer<br />
Begründung dann, wenn die Patienten<br />
nicht in das Knappschaftskrankenhaus, sondern<br />
in andere Klinken eingewiesen wurden.<br />
Wohin mit dem Bayer?<br />
Dann kam ein Notfall in die Praxis, Verdacht<br />
auf Herzinfarkt. Da hatte ich das Problem, dass<br />
der Mann aus Bayern auf Besuch nach Westfalen<br />
gekommen und irgendwo im Süden bei einer<br />
kleinen lokalen Betriebskrankenkasse (BKK)<br />
versichert war, mit der wir keinen Vertrag haben.<br />
Also musste ich erst einmal aus dem Internet<br />
die Liste der BKKen heraussuchen. Dabei<br />
habe ich festgestellt, dass es die<br />
Kasse unter dem Namen, der<br />
auf der Versichertenkarte<br />
stand, gar nicht mehr gab.<br />
So habe ich erst einmal<br />
beim BKK-Bundesverband<br />
angerufen.<br />
Die waren zwar<br />
sehr freundlich,<br />
aber man hat<br />
mich mindestens<br />
durch fünf<br />
Abteilungen<br />
verbunden, bis<br />
mir jemand<br />
mitteilte, dass ich einen<br />
Ersatzkrankenschein anle-<br />
Kammer-Info<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 47
Kammer-Info<br />
48<br />
gen dürfe. Den könnten wir dann über die BKK<br />
Hoesch abrechnen, mit denen haben wir ja einen<br />
Vertrag. Wenn aber ein Krankentransport<br />
oder gar eine stationäre Behandlung erforderlich<br />
würde, sollten wir das Formular erst einmal<br />
nach München faxen, um von dort die Berechtigung<br />
zum Ausstellen eines Krankentransportscheines<br />
zu erhalten. Zudem sei zu berücksichtigen,<br />
dass die bayerischen BKKen ausschließlich<br />
Behandlungsverträge mit katholischen Krankenhäusern<br />
hätten. Dieser Vertrag sei auch in<br />
Westfalen Lippe für eine Krankenhausbehandlung<br />
gültig. Außerdem müssten wir beachten,<br />
dass wir nur die Leistungspositionen einsetzen<br />
dürften, die die bayerischen BKKen mit dem<br />
dortigen Hausärzteverband vereinbart haben.<br />
Kenne ich nicht, habe ich gesagt - na, da sollten<br />
wir halt in Regensburg bei der Außenstelle des<br />
bayerischen Hausärzteverbandes anrufen. Die<br />
würden uns sicherlich gerne einen Auszug der<br />
Gebührenordnung geben.<br />
Der Rest des Vormittages ist dann ziemlich unspektakulär<br />
verlaufen. Die Helferinnen haben<br />
an die Karteikarten der Patienten Broschüren<br />
mit Auszügen aus den möglichen Leistungsangeboten<br />
der jeweiligen Krankenkassen geheftet,<br />
damit niemand aus Versehen bei einer Kasse eine<br />
falsche Position<br />
ansetzt.<br />
Wir haben<br />
noch richtig<br />
Glück gehabt,<br />
denn das TechnikerteamunseresSoftwarewartungshauses<br />
kam erst gegen<br />
Mittag, um<br />
die neuen Regelwerke<br />
der DAK und der BEK gesondert einzuspielen.<br />
Ich war froh, dass die Techniker erst<br />
so spät kamen. Wir müssten ja alle Arbeitsplätze<br />
der Anlage für zwei Stunden abmelden.“<br />
Endlich: 100 Prozent Generika!<br />
„Und was habe ich in deinem Traum gemacht?“,<br />
fragte ich die beste Ehefrau von allen. Obwohl<br />
ich schon nicht mehr ganz so sicher war, ob ich<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
in dieser Traumpraxis auch noch hätte auftauchen<br />
wollen. Doch, natürlich, meine Gattin<br />
träumt auch von mir:<br />
„Du? Während ich mich in der Praxis durchgeschlagen<br />
habe, bist du gemütlich zur DAK gefahren,<br />
um mit denen deinen Vertrag zu verlängern.<br />
Sie hatten ja auf einer Absenkung der Vergütungspauschalen<br />
bestanden. Wir könnten erst<br />
dann wieder höhere Pauschalen bekommen,<br />
wenn wir unseren Anteil an Generika in der<br />
Medikamentenverordnung endlich auf 100 Prozent<br />
erhöhten. Außerdem sollten wir für berufstätige<br />
DAK-Versicherte Sprechzeiten zwischen<br />
6 und 7 Uhr morgens und 20 und 22 Uhr abends<br />
anbieten. Und in der Zeit von 22 bis 24 Uhr eine<br />
Anlaufpraxis am Krankenhaus besetzen, damit<br />
unnötige stationäre Aufnahmen vermieden<br />
werden können. Wenn wir durch eine Bescheinigung<br />
des Apothekers, des Krankenhauses und<br />
des Gesundheitsamtes die Umsetzung dieser<br />
Auflagen belegen könnten, würde der MDK im<br />
Auftrag der DAK eine Praxisbegehung durchführen.<br />
Und dann würde auch der Prozentsatz<br />
festgelegt für die Erhöhung unserer Pauschale.“<br />
„Auch kein wirklich schönes Programm für den<br />
Vormittag“, schoss es mir durch den Kopf. „Aber<br />
dann war hoffentlich endlich Ruhe, oder?“<br />
Ein Notfall - in sechs Wochen<br />
„Ach was, das ging genauso weiter. Wir hatten<br />
ziemliche Schwierigkeiten, einen Patienten bei<br />
einem Gastroenterologen für eine notfallmäßige<br />
Gastroskopie unterzubringen. Der bei uns am<br />
Ort hatte keinen Vertrag mehr mit der AOK,<br />
Vertrag gekündigt! Der Kollege im Nachbarort<br />
arbeitet nur mit der Bundesknappschaft. Erst in<br />
Dortmund habe ich einen Gastroenterologen<br />
gefunden, der einen aktuellen AOK-Vertrag<br />
hat. Da habe ich für den Patienten dann einen<br />
notfallmäßigen Termin in sechs Wochen bekommen.<br />
Tja, hat der Kollege gesagt, ‘die AOK<br />
vergibt ihre Verträge nur noch regional an<br />
Schwerpunktpraxen. Und ich habe die einzige<br />
zwischen Münster, Essen, Soest und Lüdenscheid<br />
für die AOK. Also in sechs Wochen -<br />
vorher ist nichts drin.'“
„Na, da warst du sicher froh, als du endlich wieder<br />
zuhause warst“, stupste ich die beste Ehefrau<br />
von allen an und lächelte aufmunternd. Doch<br />
sie schüttelte nur den Kopf.<br />
„Klar war ich froh. Aber nur ganz kurz. Denn<br />
zuhause habe ich mich an den Computer gesetzt,<br />
um über Internet-Banking unser Konto<br />
anzusehen. Was habe ich mich erschrocken, so<br />
heftig waren wir ins Soll gefallen! Die haben uns<br />
die Netzbeiträge, die verschiedenen Verbandsbeiträge,<br />
die Gebühren für die letzten Praxisbegehungen<br />
durch MDK, Gesundheitsamt und<br />
Bezirksregierung abgebucht. Außerdem müssten<br />
wir ja die Gehälter für die Helferinnen auszahlen.<br />
Wäre ja alles nicht so schlimm gewesen,<br />
wenn die Bundesknappschaft nicht die Abschlagszahlungen<br />
für die letzten drei Monate<br />
storniert hätte. Aber da haben wir nun mal die<br />
meisten Patienten. Warum? Na, per E-Mail haben<br />
die mitgeteilt, dass wir unserer Verpflichtung<br />
zur jährlichen Zertifizierung unserer Praxis<br />
nicht nachgekommen seien. Und um etwaige<br />
Ansprüche gegen uns durchsetzen zu können,<br />
hätten sie eben die Honorarzahlungen des letzten<br />
Vierteljahres zurückgehalten.<br />
Daraufhin habe ich natürlich sofort die Hotline<br />
angerufen. Ich war doch sicher, dass wir dieses<br />
verdammte Zertifikat eingereicht haben. Ir-<br />
Weitere Kreisausschüsse<br />
bestätigt<br />
In der Kammerversammlung am 30.11.2005<br />
wurden weitere Kreisausschüsse bestätigt.<br />
Kreis Herzogtum Lauenburg<br />
Dr. Reinhard Drehsen/Mölln (Vorsitzender)<br />
Dr. Julius Brunn/Ratzeburg (Stellvertreter)<br />
Dr. Wulf Allmeling/Wentorf<br />
Dr. Ernst-Ulrich Mösinger/Mustin<br />
Dr. Roland Preuss/Mölln<br />
Dr. Andreas Schmid/Ratzeburg<br />
(Fortbildungsbeauftragter)<br />
Dr. Thomas Völkel/Geesthacht<br />
Rendsburg-Eckernförde:<br />
Dr. Werner Kröger/Rendsburg (Vorsitz)<br />
Dr. Rüdiger Marquardt/Eckernförde (1. Stellvertreter)<br />
gendwann rückte die Mitarbeiterin damit heraus,<br />
dass wir das falsche Zertifikat abgegeben<br />
hätten. Unseres stamme von der Soziozert. Die<br />
sei aber nur von den Ersatzkassen anerkannt.<br />
Die Bundesknappschaft akzeptiert seit drei Wochen<br />
nur noch die Zertifikate der Firma Püttozert.<br />
Damit hätten wir unsere vertraglichen<br />
Verpflichtungen nicht eingehalten und auch<br />
keine Honoraransprüche mehr. Das müssten<br />
wir doch wissen.“<br />
„Na klar, wie konnten wir das nur vergessen?“,<br />
murmelte ich staunend. „Und dann?“<br />
„Dann habe ich der Zertifikatsfrau gesagt, was<br />
ich von solchen traumhaften Verpflichtungen<br />
halte. Und das hat mich so sehr geärgert, dass<br />
ich endlich aufgewacht bin und nicht mehr<br />
wusste, was nun Traum war und was Realität.<br />
Ich bin ins Arbeitszimmer gegangen. Auf dem<br />
Tisch lagen noch ein paar KV-Formulare, frisch<br />
ausgefüllt. Die gibt es also doch noch! Da wusste<br />
ich, dass alles zwar ganz realistisch, aber doch<br />
nur ein böser Traum war.“<br />
Mit freundlicher Nachdruckgenehmigung des Westfälischen<br />
<strong>Ärzteblatt</strong>es 11/2005<br />
Dr. Wolfgang-Axel Dryden, 2. Vorsitzender der Kassenärztlichen<br />
Vereinigung Westfalen-Lippe, Robert-<br />
Schimrigh-Str. 4-6, 44141 Dortmund<br />
Dr. Joachim Georgi/Damp (2. Stellvertreter)<br />
Dr. Friedrich-Arno Fickelscherer/Elsdorf-Westermühlen<br />
(Fortbildungsbeauftragter)<br />
Carl-Gerhard Culemeyer/Ascheffel<br />
Dr. Arthur Friedrich/Fockbek<br />
Dr. Jörg Hoffmann/Fockbek<br />
Dr. Peter Idel/Hamdorf<br />
Dr. Reinhard Kamphues/Schacht-Audorf<br />
Gloria-Linda Lawrenz/Alt Duvenstedt<br />
Dr. Karin Oltmann/Kiel<br />
Andreas Stanisak/Schacht-Audorf<br />
Dr. Helmut Scholz/Rendsburg<br />
Dr. Helmut-Hartwig Schröder/Rendsburg<br />
Dr. Dr. Hans-Michael Steen/Eckernförde<br />
Lübeck:<br />
Dr. Hauke J. Nielsen/Buchholz (Vorsitz)<br />
Dr. Frank Niebuhr/Lübeck (Stellvertreter)<br />
Kammer-Info<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 49
Kammer-Info<br />
50<br />
Prof. Dr. Thomas Wagner/Lübeck<br />
(Fortbildungsbeauftragter)<br />
Dr. rer. nat. Andreas Bobrowski/Lübeck<br />
Dr. Inge Derad/Lübeck<br />
Dr. Christoph Dodt/Groß Grönau<br />
Dr. Doris Hartwig-Bade/Lübeck<br />
Detlev Hinselmann/Lübeck - Gesundheitsamt<br />
Dr. Barbara Kraus/Lübeck<br />
Dr. Lutz Lerche/Lübeck<br />
Dr. Hannelore Machnik/Berkenthin<br />
Dr. Wolf-Dieter Schreiner/Lübeck<br />
Dr. Beate Sedemund-Adib/Ahrensbök<br />
Ausschüsse neu besetzt<br />
Folgende Ausschüsse der <strong>Ärztekammer</strong> <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
sind für die Wahlperiode 2005 bis<br />
2009 durch die Kammerversammlung neu besetzt<br />
worden:<br />
Ausschuss Allgemeinmedizin<br />
Dr. Wilken Boie/Handewitt<br />
Petra Imme/Kiel<br />
Dr. Michael Lauterbach/Kiel<br />
Dr. Thomas Maurer/Leck<br />
Dr. Frank Niebuhr/Lübeck<br />
Ausschuss Ambulante Versorgung<br />
Dr. Heike Lehmann/Elmshorn<br />
Dr. Dolores de Mattia/Schönwalde<br />
Dr. Sabine Menke/Niebüll<br />
Dr. Wolf-Dieter Schreiner/Lübeck<br />
Dr. Angela Stahl/Norderstedt<br />
Ausschuss Ärztinnen<br />
Dr. Inge Derad/Lübeck<br />
Barbara Homann/Tangstedt<br />
Maria Koch-Dörfler/Kiel<br />
Dr. Barbara Kraus/Lübeck<br />
Dr. Karl-Werner Ratschko/Bad Segeberg<br />
Finanzausschuss<br />
Bertram Bartel/Kronshagen<br />
Dr. Reinhard Drehsen/Mölln<br />
Dr. Doris Hartwig-Bade/Lübeck<br />
Dr. Hans-Herbert Köhler/Norderstedt<br />
Dr. Karl-Werner Ratschko/Bad Segeberg<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
Prof. Dr. Jens Träder/Lübeck<br />
Dr. Peter-Christian Wentrup/Lübeck<br />
Pinneberg:<br />
Dr. M. Steffen/Elmshorn (Vorsitz)<br />
Dr. Christine Schüler/Schenefeld<br />
(Fortbildungsbeauftragte)<br />
Dr. Jörn Cramer/Schenefeld<br />
Dr. Horst Hilpert/Uetersen<br />
Dr. Ute Freifrau von Hahn/Wedel<br />
Dr. Michael Renner/Elmshorn<br />
Hans-Joachim Schwarz/Barmstedt<br />
Dr. Heiko Stock/Pinneberg<br />
Fortbildungsausschuss<br />
Dr. Thomas Birker/Heide<br />
Dr. Wilken Boie/Handewitt<br />
Dr. Reinhard Möller/Kiel<br />
Dr. Beate Sedemund-Adib/Ahrensbök-Dakendorf<br />
Prof. Dr. Jörg Steinmann/Altenholz<br />
Ausschuss Medizinische Fachberufe/<br />
Seminarausschuss<br />
Dr. Julius Brunn/Ratzeburg<br />
Dr. Henrik Herrmann/Linden<br />
Dr. Sigrid Leszke/Preetz<br />
Dr. Karl-Werner Ratschko/Bad Segeberg<br />
Regina Timm/Wedel<br />
Hochschulausschuss<br />
Prof. Dr. Christoph Dodt/Groß Grönau<br />
Prof. Dr. Peter Dohrmann/Kiel<br />
Dr. Carsten Hilbert/Kiel<br />
Dr. Barbara Kraus/Lübeck<br />
Dr. Hauke J. Nielsen/Buchholz<br />
Dr. Jürgen Schultze/Kiel<br />
Prof. Dr. Jörg Steinmann/Altenholz<br />
Krankenhausausschuss<br />
Axel Chélard/Groß-Buchwald<br />
Dr. Petra Hell/Seester<br />
Dr. Norbert Jaeger/Kiel<br />
Thomas Koch/Flensburg<br />
Dr. Dolores de Mattia/Schönwalde<br />
Weiterbildungsausschuss<br />
Dr. Arthur Friedrich/Fockbek<br />
Dr. Henrik Herrmann/Linden<br />
Dr. Norbert Jaeger/Kiel<br />
(Dav)
Dr. Heike Lehmann/Elmshorn<br />
Dr. Dolores de Mattia/Schönwalde<br />
Schlichtungskommission I<br />
Friedrich W. Cochanski/Bad Segeberg<br />
Dr. Heinz-Jürgen Noftz/Neustadt<br />
Dr. Manfred Steffen/Elmshorn<br />
Vertreter:<br />
Dr. jur. Klaus C. Kossen/Bad Segeberg<br />
Dr. Henning Baur/Flensburg<br />
Dr. Roland Preuss/Mölln<br />
Schlichtungskommission II<br />
Dr. jur. Klaus C. Kossen/Bad Segeberg<br />
Dr. Heiko Stock/Pinneberg<br />
Dorothea Vagt/Schönberg<br />
Was muss der Arzt aus<br />
Datenschutzsicht bei der<br />
Labor-Beauftragung beachten?<br />
Lukas Gundermann<br />
Wird ein externer Laborarzt eingeschaltet, so<br />
kann die damit in der Regel verbundene Übermittlung<br />
von Patientendaten (wie Name, Anschrift<br />
und KV-Nummer) nicht ohne weiteres<br />
darauf gestützt werden, dass es sich um einen<br />
nachbehandelnden Arzt handelt. Nur wenn die<br />
Patienten in angemessener Weise über die Einschaltung<br />
einer bestimmten laborärztlichen Praxis<br />
informiert werden, ist die Übermittlung von<br />
Patientendaten zusammen mit den Proben zulässig.<br />
1. Einführung<br />
Bei Datenschutzaufsichtsbehörden gehen immer<br />
wieder Nachfragen von Patienten ein, die<br />
von einem ihnen unbekannten Laborarzt eine<br />
Rechnung zugesandt bekamen. Sie wollen wissen,<br />
ob die Beauftragung ohne ihre ausdrückliche<br />
Zustimmung zulässig war. Von ärztlicher<br />
Seite wird die rechtliche Brisanz der Weitergabe<br />
von Patientendaten an den externen Laborarzt<br />
nicht immer erkannt. Der vorliegende Beitrag<br />
erläutert die rechtlichen Hintergründe für die<br />
Vertreter:<br />
Friedrich W. Cochanski/Bad Segeberg<br />
Elke Burghard/Neumünster<br />
Bernd-Axel Lipphardt/Lensahn<br />
Strukturausschuss<br />
Ekkehard Becker/Bad Segeberg (KV)<br />
Ludger Buitmann/Kiel (VdAK/AEV)<br />
Thomas Haeger/Kiel (AOK)<br />
Thomas Koch/Flensburg<br />
Dr. Hans-Herbert Köhler/Kuddewörde<br />
Bernd Krämer/Kiel<br />
(Krankenhausgesellschaft e. V.)<br />
Dr. Dr. rer. nat. Heinz-Eberhard Schlaak/<strong>Schleswig</strong><br />
Dr. Christian Sellschopp/Kiel<br />
Matthias Seusing/Kiel<br />
(Dav)<br />
Übermittlung von<br />
Patientendaten<br />
bei einer Labor-<br />
Beauftragung.<br />
2. Patientengeheimnis<br />
Die ärztliche Schweigepflicht,<br />
heute auch<br />
als Patientengeheimnis<br />
bezeichnet, verpflichtet den<br />
Arzt zur Verschwiegenheit<br />
über die ihm in seiner Eigenschaft als Arzt anvertrauten<br />
oder bekannt gewordenen Informationen.<br />
Diese Rechtspflicht ist im ärztlichen<br />
Standesrecht niedergelegt (§ 9 Berufsordnung<br />
der <strong>Ärztekammer</strong> <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, entsprechende<br />
Regelungen finden sich in den Berufsordnungen<br />
der anderen Bundesländer); darüber<br />
hinaus enthält das Strafgesetzbuch in § 203 eine<br />
Strafandrohung für die Verletzung der Schweigepflicht.<br />
Auch das Datenschutzrecht stellt die<br />
Patientendaten unter einen besonderen Schutz;<br />
es handelt es sich dabei um sensitive, besonders<br />
schutzwürdige Daten (§ 3 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz<br />
- BDSG, § 11 Abs. 3 Landesdatenschutzgesetz<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> LDSG SH). Eine<br />
Weitergabe der patientenbezogenen Informationen<br />
an Dritte ist daher nur erlaubt, wenn<br />
eine gesetzliche Vorschrift dies erlaubt oder<br />
Kammer-Info<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 51
Kammer-Info<br />
52<br />
wenn die Einwilligung des betroffenen Patienten<br />
vorliegt (Schweigepflichtentbindungserklärung).<br />
Die ärztliche Schweigepflicht geht bekanntlich<br />
zurück auf den Eid des Hippokrates und ist damit<br />
eine der ältesten Regeln zur beruflichen<br />
Verschwiegenheit. Die Wahrung der Verschwiegenheit<br />
ist unverzichtbare Voraussetzung<br />
für eine vertrauensvolle Beziehung zwischen<br />
Arzt und Patient und damit oft eine Grundbedingung<br />
für eine erfolgreiche Behandlung.<br />
3. Geltung der Schweigepflicht zwischen<br />
Ärzten<br />
Die Schweigepflicht besteht im Grundsatz gleichermaßen<br />
bei der kollegialen Zusammenarbeit<br />
unter Ärzten. Auch im Verhältnis von Arzt zu<br />
Arzt gilt, dass Patientendaten nur dann offenbart<br />
werden dürfen, wenn eine gesetzliche Vorschrift<br />
dies erlaubt oder eine Einwilligung des<br />
Patienten vorliegt.<br />
Eine gesetzliche Regelung, die die Weitergabe<br />
von Patientendaten von Arzt zu Arzt legitimieren<br />
kann, findet sich in § 9 Abs. 4 der Berufsordnung.<br />
Danach sind Ärzte untereinander von<br />
der Schweigepflicht insoweit befreit, als sie<br />
gleichzeitig oder nacheinander denselben Patienten<br />
untersuchen oder behandeln und das Einverständnis<br />
des Patienten vorliegt oder anzunehmen<br />
ist.<br />
§ 9 Abs. 4 der Berufsordnung zielt auf Konstellationen<br />
ab, in denen der Patient Kenntnis davon<br />
bekommt, dass sich ein weiterer Arzt mit<br />
seiner Erkrankung befassen soll. Dies ist z. B. bei<br />
einer Überweisung vom Hausarzt an den Facharzt<br />
der Fall. Die Überweisung wird regelmäßig<br />
mit dem Patienten besprochen, oftmals ist er<br />
der Bote, der dem Facharzt die Überweisung<br />
und den Arztbrief übergibt. Dadurch erkennt<br />
der Patient ohne weiteres die Einschaltung eines<br />
weiteren Arztes und dokumentiert mit seinem<br />
Erscheinen beim Facharzt, dass er einwilligt<br />
oder jedenfalls nichts dagegen hat, dass dieser<br />
die patientenbezogenen Informationen (wie<br />
sie z. B. in einem Arztbrief enthalten sind) erhebt.<br />
Damit liegt im Sinne von § 9 Abs. 4 der<br />
Berufsordnung das Einverständnis des Patienten<br />
vor bzw. es ergibt sich aus dem Verhalten des<br />
Patienten, dass eine Einwilligung im Sinne des<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
§ 9 Abs. 4 der Berufsordnung angenommen<br />
werden kann (konkludente Einwilligung). Entscheidend<br />
ist, dass in diesen Fällen der Patient<br />
Kenntnis von der Weitergabe seiner Daten hat.<br />
Damit wird zum einen der wichtige datenschutzrechtliche<br />
Grundsatz der Transparenz beachtet,<br />
wonach der Betroffene Kenntnis davon<br />
haben muss, wer welche Daten zu welchem<br />
Zweck verarbeitet. Zum anderen kann das Einverständnis<br />
des Patienten im Sinne des § 9 Abs.<br />
4 der Berufsordnung nur dann angenommen<br />
werden, wenn ihm die vorgesehene Weitergabe<br />
der Daten bekannt ist.<br />
4. Besonderheiten der Einschaltung eines<br />
externen Laborarztes<br />
Bei der Einschaltung eines Laborarztes liegt der<br />
Fall zunächst anders. Hier hat der Patient mit<br />
dem Laborarzt i. d. R. keinen persönlichen Kontakt;<br />
es fehlt ihm an der Möglichkeit, durch sein<br />
Verhalten zu steuern, ob der Laborarzt seine<br />
Daten erhält oder nicht. Damit ist ein Rückgriff<br />
auf § 9 Abs. 4 der Berufsordnung hier nicht ohne<br />
weiteres möglich. Nur dann, wenn der Patient<br />
ausdrücklich auf die vorgesehene Einschaltung<br />
des Laborarztes hingewiesen wird, kommt<br />
die Anwendung der Vorschrift in Betracht.<br />
Weiß der Patient, welches Labor beauftragt<br />
werden soll, und wendet er nichts dagegen ein,<br />
so kann der Umstand, dass er die Abnahme der<br />
zu untersuchenden Probe zulässt, als schlüssiges<br />
Handeln angesehen werden, mit dem der Patient<br />
seine Zustimmung auch zur Übermittlung<br />
seiner Daten an den Laborarzt erteilt. Nur wenn<br />
auf bestmögliche Weise sicherstellt wird, dass<br />
der Patient Kenntnis von der vorgesehenen<br />
Übermittlung bekommt, kann demnach sein<br />
Einverständnis nach § 9 Abs. 4 der Berufsordnung<br />
angenommen werden. Insoweit handelt es<br />
sich um eine konkludente Einwilligung, für deren<br />
Wirksamkeit die präzise Information des Patienten<br />
erforderlich ist.<br />
Mit der Information an den Patienten darüber,<br />
an welches Labor seine Proben und seine Daten<br />
weitergegeben werden, wird auch die in den Datenschutzgesetzen<br />
normierte Pflicht zur Information<br />
erfüllt. Die Betroffenen sind darüber zu<br />
informieren, wenn ihre Daten ohne ihre Kenntnis<br />
an dritte Stellen weitergegeben werden (§ 33<br />
BDSG, § 26 LDSG). Diese Informationspflicht
wird mit einer entsprechenden Mitteilung des<br />
Arztes, der den Laborarzt beauftragt, erfüllt.<br />
5. In welcher Weise hat die Information<br />
über die Beauftragung eines externen Laborarztes<br />
zu erfolgen?<br />
Die Mittel zur Information der Patienten sollten<br />
so ausgewählt werden, dass ein durchschnittlich<br />
verständiger Patient nach vernünftigem Ermes-<br />
sen praktisch nicht<br />
umhin kann, von<br />
der Beauftragung eines<br />
bestimmten Labors<br />
und der damit<br />
verbundenen Weitergabe<br />
der Patientendaten<br />
Kenntnis<br />
zu nehmen.<br />
Dazu wird folgender<br />
Informationsmix<br />
empfohlen; d. h. die<br />
nachfolgenden<br />
Maßnahmen gelten<br />
kumulativ:<br />
1. Wird in der Praxis<br />
ein Aufnahmebogen<br />
für neue Patienten<br />
verwendet, so sollte<br />
schon auf diesem<br />
Bogen ein entsprechender<br />
Hinweis<br />
enthalten sein. Folgender<br />
Text könnte<br />
verwendet werden:<br />
Bei der Untersuchung<br />
von Proben<br />
(Blut, Gewebe etc.)<br />
arbeitet unsere Praxis mit der laborärztlichen<br />
Praxis XYZ, Adresse, zusammen. Dieses Labor<br />
rechnet die erbrachten Laborleistungen unmittelbar<br />
mit Ihrer Krankenkasse ab bzw. stellt Sie Ihnen<br />
in Rechnung. Daher muss dem Laborarzt<br />
außer den Proben auch Ihre Anschrift und gegebenenfalls<br />
Ihre Krankenversicherungsnummer<br />
übermittelt werden.<br />
2. Es sollte ein entsprechender Aushang oder<br />
Aufsteller gut sichtbar in der Praxis platziert<br />
werden. Er sollte sich deutlich von sonstiger all-<br />
Anmerkung der <strong>Ärztekammer</strong><br />
fälliger Werbung abheben. Ein geeigneter Ort<br />
wäre ein Empfangstresen. Der oben angeführte<br />
Wortlaut kann auch für diesen Aushang oder<br />
Aufsteller verwendet werden.<br />
3. Bei der Abnahme der Proben sollen der Arzt<br />
bzw. die Hilfskräfte darauf hinweisen, welches<br />
externe Labor eingeschaltet wird und dass dieses<br />
zum Zwecke der eigenen Abrechnung neben<br />
dem Probenmaterial auch die Adressdaten des<br />
Patienten erhält.<br />
„Den Ausführungen des Unabhängigen Landeszentrums<br />
für Datenschutz ist grundsätzlich zuzustimmen.<br />
Abweichend ist lediglich zu Ziffer 4 festzustellen, dass es<br />
nach Auffassung der <strong>Ärztekammer</strong> einer gesonderten Einwilligung<br />
des Patienten in die Weitergabe an einen Laborarzt<br />
nicht bedarf. Dies folgt nach unserer Auffassung aus<br />
§ 9 Abs. 4 der Berufsordnung, wonach dann, wenn mehrere<br />
Ärzte gleichzeitig oder nacheinander denselben Patienten<br />
untersuchen oder behandeln sie untereinander von der<br />
Schweigepflicht insoweit befreit sind, dass das Einverständnis<br />
des Patienten anzunehmen ist. Dem Patienten<br />
dürfte es in dieser Situation im Wesentlichen darauf<br />
ankommen, dass die entnommene Probe fachgerecht<br />
untersucht wird. Dabei unterstellt er, nach Auffassung der<br />
<strong>Ärztekammer</strong>, dass dann, wenn dies der Arzt nicht selber<br />
macht, dieser einen geeigneten Laborarzt auswählen wird.<br />
Auf die Person des Laborarztes wird es daher aus Sicht des<br />
Patienten nicht ankommen. In diesem Sinne hat auch der<br />
Bundesgerichtshof (BGH) in einem ähnlich gelagerten Fall<br />
- Entnahme einer Gewebeprobe - entschieden. Er nimmt in<br />
diesem Zusammenhang an, dass der Patient mit seinem<br />
Einverständnis sich Gewebeproben zum Zwecke der Untersuchung<br />
durch einen Spezialisten entnehmen zu lassen<br />
stillschweigend den Arzt bevollmächtigt und ihm die Auswahl<br />
des Spezialisten überlassen hat. Gerade bei der histologischen<br />
Untersuchung hat nach Auffassung des BGH der<br />
Patient kein besonderes Interesse daran, den die Untersuchung<br />
durchführenden Arzt selbst auszuwählen“.<br />
Selbstverständlich<br />
ist eine entsprechende<br />
Aufklärung in die<br />
jeweilige Behandlungssituationeinzupassen.<br />
So kann sie<br />
unangemessen erscheien,<br />
wenn es bei<br />
der Probenentnahme<br />
um die Abklärung<br />
einer schweren Erkrankung<br />
geht. Insoweit<br />
ist ärztliches Ermessen<br />
gegeben.<br />
4. Unterhält die<br />
Arztpraxis eine eigene<br />
Homepage, bietet<br />
es sich an, auch dort<br />
über die Zusammenarbeit<br />
mit einer bestimmten<br />
externen<br />
Laborpraxis zu unterrichten<br />
und auf<br />
die dabei stattfindendeDatenübermittlunghinzuweisen.<br />
6. Besonderheiten bei der Einschaltung<br />
mehrerer externer Labore<br />
Insbesondere in Krankenhäusern und großen<br />
Arztpraxen kann es vorkommen, dass nicht nur<br />
ein einziges externes Labor beauftragt wird, sondern<br />
eine größere Zahl von Laborärzten nach<br />
unterschiedlichen Kriterien in Anspruch genommen<br />
wird. In solchen Fällen kann auf den<br />
oben angesprochenen schriftlichen Informationsträgern<br />
naheliegenderweise nicht konkreti-<br />
Kammer-Info<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 53
Kammer-Info<br />
54<br />
siert werden, welches Labor gerade im Falle eines<br />
bestimmten Patienten eingeschaltet wird;<br />
möglicherweise wird dies auch der Arzt nicht<br />
genau sagen können, wenn er den Patienten<br />
über die Einsendung seiner Probe und Übermittlung<br />
seiner Daten an eine andere Stelle informiert.<br />
In solchen Fällen muss der Patient in<br />
der oben dargelegten Weise schriftlich auf die<br />
Gemeinsamer Protest psychologischer<br />
und ärztlicher Psychotherapeuten gegen<br />
Rahmenbedingungen der Patientenversorgung*<br />
„Neumünsteraner Erklärung“<br />
Psychologische und ärztliche Psychotherapeuten<br />
protestieren gemeinsam gegen den für Kassenärzte<br />
und Kassenpsychotherapeuten in<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> gültigen Honorarverteilungsmaßstab.<br />
Dieser Honorarverteilungsmaßstab<br />
soll angeblich die Gleichbehandlung der<br />
Psychotherapeuten und aller Ärzte gewährleisten.<br />
Tatsächlich bewirkt der Honorarverteilungsmaßstab,<br />
dass es den psychologischen und<br />
ärztlichen Psychotherapeuten praktisch nicht<br />
mehr möglich ist für die psychotherapeutische<br />
Krisenintervention von Patienten Behandlungskapazitäten<br />
vorzuhalten, da die größten<br />
Teile ihres Leistungsspektrums nicht mehr bezahlt<br />
und eine Vollexistenzsicherung nur bei<br />
Konzentration auf die von den Krankenkassen<br />
genehmigten Psychotherapien erreicht werden<br />
kann.<br />
So werden ganz wesentliche Bereiche der Patientenversorgung<br />
nicht vergütet. Betroffen ist<br />
vor allem die Akutversorgung und die psychotherapeutische<br />
Diagnostik.<br />
Angesichts der allgemein festgestellten zunehmenden<br />
Bedeutung der psychischen Erkrankungen,<br />
nicht nur für die Krankheitsfehltage,<br />
werden damit weitere Kostensteigerungen im<br />
Gesundheitswesen, zum Beispiel durch häufiger<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
möglichen Empfänger hingewiesen werden. Zusätzlich<br />
muss ihm auf Nachfrage mitgeteilt werden<br />
können, welches externe Labor seine Daten<br />
tatsächlich erhalten hat.<br />
Lukas Gundermann, Unabhängiges Landeszentrum<br />
für Datenschutz <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, Holstenstr. 98,<br />
24103 Kiel<br />
erforderliche Klinikeinweisungen, Zunahme des<br />
„Doctor-Hopping“ vieler psychosomatisch<br />
kranker Patienten und Verlängerung von Arbeitsunfähigkeitszeiten<br />
ausgelöst.<br />
Die Krankenkassen werden kurz- oder spätestens<br />
mittelfristig ein Interesse daran haben,<br />
Leistungserbringer heranzuziehen, die niederschwellig<br />
Kriseninterventionen durchführen<br />
und so Klinikeinweisungen, Suizide und Suizidversuche<br />
vermeiden und helfen, dass aus psychischen<br />
Gründen arbeitsunfähige Krankengeldbezieher<br />
schnell eine psychotherapeutische<br />
Behandlung erfahren.<br />
So wird eine erneute Übernahme kassenmedizinischer<br />
Leistungen durch nicht kassenzugelassene<br />
und nicht dem gesicherten Qualitätsstandard<br />
des Psychotherapeutengesetzes genügenden<br />
Psychologen/Pädagogen/Sozialpädagogen<br />
zu Lasten der für die kassenmedizinische Versorgung<br />
zur Verfügung stehenden Gesamtvergütung<br />
provoziert.<br />
Sollten die bestehenden Regelungen der Honorarverteilung<br />
nicht geändert werden, so wird<br />
dies zum Nachteil für alle Kassenärzte und Kassenpsychotherapeuten<br />
sein.<br />
Die beschlossenen Regelungen des Honorarverteilungsmaßstabes<br />
sind „pseudogerecht“, sie<br />
schreiben die jahrelange bestehende benachteiligende<br />
Behandlung der Psychotherapeuten<br />
und damit auch der psychisch kranken Menschen<br />
im kassenmedizinischen System fort.<br />
Gerhard Leinz, Wilhelm-Stabe-Str. 4, 24582 Wattenbek<br />
* Beschlossen von der Mitgliederversammlung des Psychotherapeutischen Netzes Neumünster (PNN) e. V. am 8. November<br />
2005
Neue Richtlinien Hämotherapie<br />
Cornelia Ubert<br />
Die Richtlinien zur Gewinnung von Blut und<br />
Blutbestandteilen und zur Anwendung von<br />
Blutprodukten (Hämotherapie) sind im Juni des<br />
Jahres vom Vorstand der Bundesärztekammer<br />
verabschiedet worden. Mit der Bekanntmachung<br />
im Bundesanzeiger am 05.11.2005 sind<br />
die Richtlinien in Kraft getreten. Diese Richtlinien<br />
gelten für alle Ärzte, die mit<br />
� dem Gewinnen, Herstellen, Lagern, Abgeben<br />
oder In-Verkehr-Bringen von Blut, Blutbestandteilen<br />
oder Blutprodukten,<br />
� der Durchführung von blutgruppenserologischen<br />
und weiteren immunhämatologischen<br />
Untersuchungen sowie<br />
� der Anwendung von Blutprodukten und der<br />
entsprechenden Nachsorge befasst sind.<br />
Einrichtungen der Krankenversorgung im stationären<br />
und ambulanten Bereich, die Blutprodukte<br />
anwenden, sind nach § 15 des Transfusionsgesetzes<br />
gesetzlich zur Einrichtung eines Systems<br />
der Qualitätssicherung verpflichtet. Hieraus ergibt<br />
sich die Pflicht dieser Einrichtung zur Benennung<br />
eines Qualitätsbeauftragten, zur Bestellung<br />
eines Transfusionsverantwortlichen und eines<br />
Transfusionsbeauftragten für jede Abteilung.<br />
Der Umfang der Überwachung des QS-Systems<br />
ist hierbei abhängig von der Art und der Anzahl<br />
der in der Einrichtung angewendeten Präparate.<br />
In Einrichtungen, die Blutkomponenten und/<br />
oder Plasmaderivate für die Behandlung von<br />
Hämotasestörungen anwenden, muss ein Qualitätsbeauftragter<br />
benannt werden. Dieser muss<br />
eine mindestens 3-jährige ärztliche Tätigkeit<br />
nachweisen können und die Zusatzbezeichnung<br />
„Ärztliches Qualitätsmanagement“ besitzen<br />
oder eine 40-stündige anerkannte Fortbildung<br />
„Qualitätsbeauftragter Hämotherapie“ nachweisen<br />
können. Neu ist, dass diese Qualifikation<br />
gegenüber der <strong>Ärztekammer</strong> nachzuweisen ist.<br />
Der Qualitätsbeauftragte darf nicht gleichzeitig<br />
Transfusionsverantwortlicher oder Transfusionsbeauftragter<br />
der Einrichtung sein. Zu den<br />
Aufgaben des Qualitätsbeauftragten, die im<br />
Einzelnen einem Merkblatt entnommen werden<br />
können, gehört auch die jährliche Erstattung eines<br />
Berichtes über die Ergebnisse seiner Überprüfung<br />
an die zuständige <strong>Ärztekammer</strong> und<br />
den Träger der Einrichtung.<br />
In Einrichtungen, die ausschließlich Fibrinkleber<br />
und/oder Plasmaderivate anwenden, die<br />
nicht zur Behandlung von Hämotasestörungen<br />
eingesetzt werden, ist eine Überwachung des<br />
Qualitätssicherungssystems der Einrichtung<br />
nicht erforderlich.<br />
Einrichtungen, die jährlich weniger als 50 Erythrozytenkonzentrate<br />
transfundieren, können<br />
auf die Benennung eines Qualitätsbeauftragten<br />
verzichten, wenn die Anwendung von Erythrozytenkonzentraten<br />
ausschließlich durch den<br />
ärztlichen Leiter der Einrichtung erfolgt, nur ein<br />
Patient zum gleichen Zeitpunkt transfundiert<br />
wird und andere Blutkomponenten oder Plasmaderivate<br />
zur Behandlung von Hämotasestörungen<br />
nicht angewendet werden. Der Ärztliche<br />
Leiter einer solchen Einrichtung hat jährlich<br />
bis zum 1. März der zuständigen <strong>Ärztekammer</strong><br />
eine von ihm selbst unterzeichnete Arbeitsanweisung<br />
zur Transfusion, mit der Selbstverpflichtung,<br />
diese als Standard zu beachten sowie<br />
einen Nachweis über die Meldung des Verbrauches<br />
von Blutprodukten nach § 21 Transfusionsgesetz<br />
zu übersenden. Ebenfalls muss er der<br />
<strong>Ärztekammer</strong> einen Nachweis über seine Qualifikationen<br />
übermitteln. Der Leiter einer solchen<br />
Einrichtung muss Facharzt für Transfusionsmedizin<br />
sein, die Zusatzbezeichnung Transfusionswesen<br />
besitzen oder eine anerkannte 16-stündige<br />
Fortbildung und eine 2-wöchige Hospitation<br />
in einer zur Weiterbildung für Transfusionsmedizin<br />
zugelassenen Einrichtung nachweisen.<br />
Ein entsprechender Kurs ist von der Akademie<br />
für medizinische Fort- und Weiterbildung der<br />
<strong>Ärztekammer</strong> <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> geplant (siehe<br />
Seite 56 unten).<br />
Für jede Einrichtung der Krankenversorgung,<br />
die Blutprodukte anwendet, ist ein Transfusionsverantwortlicher<br />
zu bestellen, der für die<br />
transfusionsmedizinischen Aufgaben verantwortlich<br />
und mit den dafür erforderlichen Kompetenzen<br />
ausgestattet ist. Der Transfusionsverantwortliche<br />
muss eine der folgenden Qualifikationen<br />
besitzen:<br />
Kammer-Info<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 55
Kammer-Info<br />
56<br />
� Facharzt für Transfusionsmedizin;<br />
� Facharzt mit Zusatzbezeichnung<br />
Bluttransfusionswesen;<br />
� Facharzt mit von einer <strong>Ärztekammer</strong><br />
anerkannten 16stündigen<br />
Fortbildung und<br />
zweiwöchiger Hospitation<br />
in einer zur Weiterbildung<br />
für Transfusionsmedizin zugelassenen<br />
Einrichtung.<br />
� Werden in einer Einrichtung<br />
nur Plasmaderivate<br />
angewendet, ist eine von einer<br />
<strong>Ärztekammer</strong> aner-<br />
Verantwortlicher<br />
(Gesamtspektrum)<br />
Beauftragter<br />
(Gesamtspektrum)<br />
Beauftragter/Verantwortlicher<br />
(nur Plasmaderivate)<br />
Verantwortlicher/Beauftragter<br />
(Immunglobuline zur passiven<br />
Immunisierung)<br />
Verantwortlicher (nur Erythrozytenkonzentrate<br />
max. 50/Jahr)<br />
kannte 8-stündige Fortbildung ausreichend,<br />
eine Hospitation kann entfallen.<br />
� Werden in einer Einrichtung nur Immunglobuline<br />
zur passiven Immunisierung angewendet,<br />
ist eine Approbation als Arzt mit entsprechenden<br />
Kenntnissen und Erfahrungen<br />
ausreichend.<br />
Die Tätigkeit des Transfusionsverantwortlichen<br />
kann auch durch Heranziehung eines externen<br />
Sachverstandes gewährleistet werden.<br />
In Einrichtungen mit nur einem Arzt ist dieser<br />
zugleich behandelnder, transfusionsverantwortlicher<br />
und transfusionsbeauftragter Arzt. Es gelten<br />
die Qualifikationsvoraussetzungen für<br />
Transfusionsverantwortliche.<br />
Für jede Behandlungseinheit ist ein Arzt als<br />
Transfusionsbeauftragter zu bestellen. Er muss<br />
eine der folgenden Qualifikationen besitzen:<br />
� Facharzt für Transfusionsmedizin;<br />
� Facharzt mit Zusatzbezeichnung Bluttransfusionswesen;<br />
� Facharzt mit von einer <strong>Ärztekammer</strong> anerkannten<br />
16-stündigen Fortbildung.<br />
� Werden in einer Einrichtung nur Plasmaderivate<br />
angewendet, ist eine von einer <strong>Ärztekammer</strong><br />
anerkannte 8-stündige Fortbildung<br />
ausreichend.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
Richtlinien 2000 Richtlinien 2005<br />
Facharzt (transf. FG)* Facharzt *<br />
+ Kurs (16 h) + Kurs (16 h)<br />
+ Hospitation (4 Wo) + Hospitation (2 Wo)<br />
Facharzt *<br />
+ Kurs (16 h)<br />
Facharzt *<br />
+ Kurs (16 h)<br />
Kurs (8 h)* Kurs (8 h)<br />
Approbation als Arzt<br />
Facharzt<br />
+ Kurs (16 h)<br />
*Alternativ für Facharzt für Transfusionsmedizin der Facharzt mit Zusatzbezeichnung<br />
Bluttransfusionswesen. Die Tätigkeit des Transfusionsverantwortlichen kann auch<br />
durch Heranziehung eines externen Sachverstandes gewährleistet werden.<br />
� Werden in einer Einrichtung nur Immunglobuline<br />
zur passiven Immunisierung angewendet,<br />
ist eine Approbation als Arzt mit entsprechenden<br />
Kenntnissen und Erfahrungen<br />
ausreichend.<br />
Übergangsvorschriften:<br />
Die Funktion des Transfusionsbeauftragten bzw.<br />
des Transfusionsverantwortlichen darf weiterhin<br />
ausüben, wer zum 07.07.1998 eine entsprechende<br />
Tätigkeit auf der Grundlage der Richtlinien<br />
von 1996 ausübte oder wer auf der Grundlage<br />
der Übergangsvorschriften der bisherigen Richtlinien<br />
eine entsprechende Funktion ausübte.<br />
Wer zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser<br />
Richtlinien als Qualitätsbeauftragter tätig ist,<br />
darf diese Tätigkeit weiter ausüben unter der<br />
Bedingung, dass die erforderliche Qualifikation<br />
innerhalb von zwei Jahren nach In-Kraft-Treten<br />
dieser Richtlinien nachgewiesen wird.<br />
Den vollständigen Text der Richtlinien Hämotherapie<br />
finden Sie im Internet unter www.baek.de/<br />
30/Richtlinien/Richtidx/index.html. Weitere<br />
Auskünfte erteilt Ihnen gern Cornelia Ubert,<br />
Tel. 04551/803-165.<br />
Cornelia Ubert, Ärztin in der Geschäftsführung, <strong>Ärztekammer</strong><br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, Bismarckallee 8-12,<br />
23795 Bad Segeberg<br />
Qualitätsbeauftragter Hämotherapie 40-Stunden-Kurs<br />
12.-16.06.2006, täglich von 9:00-17:00 Uhr<br />
Veranstaltungsort: Bad Segeberg<br />
Fortbildungspunkte: 40<br />
Gebühr: 750 Euro<br />
Anmeldung: Akademie für med. Fort- u. Weiterbildung,<br />
Esmarchstr. 4-6, 23795 Bad Segeberg, Wilfried Druba,<br />
Tel. 04551/803-179, Fax 04551/803-194, E-Mail<br />
akademie@aeksh.org, Internet www.aeksh.de/akademie
Gemeinsam für Deutschland. Mit Mut und Menschlichkeit.<br />
Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD (Auszug)<br />
Der Koalitionsvertrag ist in der Druckfassung mit 224<br />
Seiten erschienen und über die Parteizentralen gratis<br />
zu erhalten, z. B. unter alain.luecker@cdu.de oder im<br />
Internet nachlesbar unter www.aerzteblatt.de/plus4705.<br />
Ärztliche Versorgung<br />
Nicht nur in den ländlichen Gebieten der neuen<br />
Länder ist absehbar, dass es infolge des Ärztemangels<br />
zu Versorgungsengpässen in der ambulanten Versorgung<br />
kommen kann. Daher müssen schnellstmöglich<br />
Hindernisse beseitigt werden, die einer flächendeckenden<br />
Versorgung entgegenstehen. Geeignete<br />
Maßnahmen zur Liberalisierung der vertragsärztlichen<br />
Tätigkeit sind unter anderem die Verbesserung<br />
der Anstellungsmöglichkeiten bei und von Vertragsärzten,<br />
die Flexibilisierung der Bedarfsplanung auf<br />
Landesebene oder die gleichzeitige Ermöglichung einer<br />
Tätigkeit in der ambulanten und der stationären<br />
Versorgung.<br />
Wir werden das ärztliche Vergütungssystem fortentwickeln<br />
und vereinfachen, um eine qualitativ hochwertige<br />
Versorgung aller Versicherten in der GKV<br />
auch in Zukunft zu gewährleisten. Ziel muss es sein,<br />
ein Vergütungssystem zu schaffen, das Transparenz<br />
schafft und in dem die heutige Systematik verstärkt<br />
durch Pauschalvergütungen kombiniert mit Einzelvergütungsmöglichkeiten<br />
für spezielle Leistungen ersetzt<br />
wird. Die komplexen Regelungen zur Einführung<br />
eines neuen Vergütungssystems müssen unter<br />
Berücksichtigung von Morbiditätskriterien vereinfacht<br />
und in einem professionellen Verfahren erarbeitet<br />
werden. Für ambulante Leistungen in Krankenhäusern<br />
und bei niedergelassenen Ärzten sollten vergleichbare<br />
Vergütungen geschaffen werden.<br />
Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Kassenärztlichen<br />
Vereinigungen werden neuen Bedingungen<br />
angepasst.<br />
Es wird geprüft, inwieweit nichtärztliche Heilberufe<br />
stärker in Versorgungskonzepte einbezogen werden<br />
können.<br />
Es wird eine Behandlungspflicht zu bestimmten Gebührensätzen<br />
für privat versicherte Personengruppen,<br />
wie zum Beispiel Beihilfeberechtigte und Standardtarifversicherte,<br />
sowohl bei wahlärztlichen Leistungen<br />
in Krankenhäusern als auch bei ambulanten Leistungen<br />
niedergelassener Ärzte geschaffen. Die dafür vorgesehenen<br />
abgesenkten Gebührensätze werden in der<br />
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) und für Zahnärzte<br />
(GOZ) verbindlich verankert.<br />
Krankenhausversorgung<br />
Spätestens 2008 ist der ordnungspolitische Rahmen<br />
für die Krankenhausversorgung nach dem Ende der<br />
Konvergenzphase festzulegen. Um Fehlentwicklungen<br />
zu vermeiden, soll geprüft werden, ob die Kalkulationsmethode<br />
der DRGs den Pflegeaufwand und die<br />
Kosten der Weiterbildung angemessen abbildet. Für<br />
die belegärztliche Vergütung soll im DRG-System eine<br />
Regelung gefunden werden.<br />
Das GKV-Modernisierungsgesetz hat flexible Vertragsmöglichkeiten<br />
geschaffen, um die strikte Trennung<br />
von ambulanter und stationärer Versorgung zu<br />
überwinden. In der Praxis haben sich solche Verträge<br />
jedoch nicht durchgesetzt. Daher ist zu überprüfen,<br />
inwieweit Hindernisse für solche Vertragsgestaltungen<br />
beseitigt werden können.<br />
Besondere Versorgungsformen<br />
In der Integrierten Versorgung soll die Anschubfinanzierung<br />
über das Jahr 2006 hinaus bis zum 1. Januar<br />
2008 verlängert werden. Ziel der Integrierten<br />
Versorgung muss es sein, Fach- oder Sektorengrenzen<br />
zu überwinden, Versorgungsqualität zu erhöhen,<br />
Transparenz bei Angebot und Wirkung herzustellen<br />
sowie bevölkerungsbezogene Flächendeckung zu erreichen.<br />
Um den Verwaltungsaufwand bei Disease-Management-Programmen<br />
(DMP) zu reduzieren und Multimorbidität<br />
zu berücksichtigen, ist die Schaffung eines<br />
einheitlichen Rahmens für alle Programme erforderlich.<br />
Dabei soll die Möglichkeit geprüft werden, alle<br />
gesetzlichen Krankenkassen zur Durchführung der<br />
DMP nach einem einheitlichen Qualitätsstandard zu<br />
verpflichten und somit auf Einzelzertifizierung zu verzichten.<br />
Die Verknüpfung mit dem Risikostrukturausgleich<br />
ist mit der Entscheidung über einen weiterentwickelten<br />
Ausgleich neu zu gestalten.<br />
Speziell im letzten Lebensabschnitt ist die gesundheitliche<br />
und pflegerische Versorgung in Deutschland<br />
zu verbessern. Viele Menschen wünschen sich,<br />
auch bei schweren Erkrankungen bis zuletzt zu Hause<br />
versorgt zu werden. Unsere heutigen Angebote tragen<br />
diesen Bedürfnissen nur unzureichend Rechnung.<br />
Daher müssen im Leistungs-, Vertrags- und Finanzierungsrecht<br />
der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung<br />
Regelungen zur besseren palliativmedizinischen<br />
Versorgung verankert werden.<br />
Um dem demographischen Wandel Rechnung zu tragen,<br />
müssen Versorgungsstrukturen und -prozesse<br />
entsprechend den Bedürfnissen älterer Menschen angepasst<br />
werden (Reha vor Pflege, ambulant vor stationär).<br />
Den alters- und geschlechtsspezifischen Besonderheiten<br />
muss die Gesundheitsversorgung stärker<br />
Rechnung tragen.<br />
Kammer-Info<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 57
Medizin und Wissenschaft<br />
58<br />
Rauchen<br />
und<br />
chronischobstruktive<br />
Atemwegserkrankungen<br />
Klaus-Dieter Kolenda<br />
Durch das Rauchen werden bevorzugt die Lungen<br />
vor zahlreichen anderen Organen geschädigt<br />
1 . Im Bereich der Atemwege spielt sich nahezu<br />
die Hälfte aller durch das Rauchen bedingten<br />
Gesundheitsschäden ab. Ein großer Teil dieser<br />
Gesundheitsschäden endet tödlich. Dies gilt<br />
insbesondere für die Lungencarzinome, aber<br />
auch für die chronisch-obstruktive Lungenkrankheit<br />
mit oder ohne Emphysem (COPD),<br />
der wichtigsten Form der chronisch-obstruktiven<br />
Atemwegserkrankungen 2 . Dazu gehört außerdem<br />
als zweite große Volkskrankheit im Bereich<br />
der Atemwege das Asthma bronchiale.<br />
Obwohl COPD und Asthma aus pathogenetischer<br />
Hinsicht zwei grundsätzlich verschiedene<br />
Krankheitsbilder sind und vor allem aus therapeutischen<br />
Gründen unterschieden werden<br />
müssen, gibt es auch viele Gemeinsamkeiten. So<br />
gibt es in der klinischen Praxis nicht selten Patienten,<br />
die nicht eindeutig einer COPD oder einem<br />
Asthma zugeordnet werden können, bei<br />
denen ein Mischbild besteht und beide Diagnosen<br />
gestellt werden müssen. Das gilt insbesondere<br />
für rauchende Asthmatiker. Im Folgenden<br />
soll anhand der neueren Literatur dargestellt<br />
werden, welche Bedeutung das Rauchen für Pathogenese<br />
und Verlauf der beiden chronischobstruktiven<br />
Atemwegserkrankungen hat.<br />
Rauchen und COPD<br />
Die COPD ist mit Abstand die wichtigste chronische<br />
Krankheit der Atemwege, an der ca. fünf<br />
Millionen Bundesbürger leiden 2,3,4,5,6 . Weltweit<br />
steht die COPD derzeit an der 4. Stelle der Todesursachen.<br />
Sie ist die einzige Volkskrankheit,<br />
deren Inzidenz weiter zunimmt, sodass sie wahrscheinlich<br />
im Jahre 2020 weltweit an der 3.<br />
Stelle der Todesursachenstatistik nach der koronaren<br />
Herzkrankheit (KHK) und den cere-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
brovaskulären Erkrankungen stehen wird2,3,4 .<br />
Die Zahl der Todesfälle durch COPD wird in<br />
Deutschland auf ca. 20 000-30 000/Jahr geschätzt2,6<br />
.<br />
Die COPD ist eine allmählich fortschreitende<br />
chronisch-entzündliche Atemwegserkrankung,<br />
die in ca. 90 Prozent der Fälle durch das Rauchen<br />
verursacht ist. Bei Rauchern ist die Sterblichkeit<br />
an COPD um das 14-fache erhöht. Daneben<br />
geht die Erkrankung bei etwa 10 Prozent<br />
der Fälle auf andere verursachende Faktoren<br />
zurück, zu denen Asbest, Kadmium, Kohle-,<br />
Gold- und Getreidestaub sowie möglicherweise<br />
auch Kobalt, Baumwollstaub, Holz- und Papierstaub<br />
und bestimmte Metalle (Mangan, Quecksilber,<br />
Nickel, Zink, Platin, Chrom, Beryllium,<br />
Aluminium usw.) gehören2 . Die volkswirtschaftlichen<br />
Belastungen durch die COPD sind enorm.<br />
Die Gesamtkosten werden in Deutschland auf<br />
ca. sechs bis acht Milliarden Euro/Jahr geschätzt,<br />
eingeschlossen sind dabei ca. 24 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage<br />
und ca. zwei Millionen<br />
Krankenhaustage/Jahr aufgrund einer COPD3 .<br />
Langjähriges Zigarettenrauchen (z. B. 20 Zigaretten<br />
pro Tag über 20 Jahre entsprechend 20<br />
packyears) führt in der Regel ab der 4.-5. Lebensdekade<br />
zu produktivem Husten, der eine<br />
beginnende oder fortgeschrittene COPD anzeigt3<br />
. Damit einhergehend kommt es zum Verlust<br />
der Zilien und einer Zunahme der Schleimdrüsen<br />
in den Hauptbronchien, zu Entzündungen,<br />
Epithelveränderungen, Fibrose und einem<br />
Sekretstau in den peripheren Atemwegen und<br />
einer Hypertrophie der Bronchialmuskulatur<br />
mit entsprechenden Gefäßveränderungen. Eine<br />
weitere wichtige Veränderung bildet sich im Bereich<br />
der peripheren Atemwege aus. Hier kommt<br />
es zu einer Destruktion der Alveolen und einem<br />
Verlust der Flexibilität der Atemwege, des elastischen<br />
Rückstoßes und der Gasaustauschoberfläche.<br />
Dafür ist vor allem ein chronischer Entzündungsprozess<br />
verantwortlich, der durch aktivierte<br />
Makrophagen und neutrophile Granulozyten<br />
gekennzeichnet ist und mit einer Freisetzung<br />
verschiedener Mediatoren einhergeht, zu<br />
denen auch Proteasen gehören. Die Folge ist ein<br />
Ungleichgewicht von Proteasen und Anti-Proteasen.<br />
Letztere sind Schutzfaktoren, deren<br />
Konzentration im Lungengewebe genetisch fest-
gelegt ist. Der bekannteste dieser Schutzfaktoren<br />
ist das Alpha-1-Antitrypsin. Bei einem homozygoten<br />
Mangel kommt es bei Patienten sehr<br />
frühzeitig zu einem ausgeprägten Emphysem.<br />
Diese Zusammenhänge erklären, warum nicht<br />
alle Raucher, d. h. ca. 40 Prozent der erwachsenen<br />
Männer und ca. 30 Prozent der erwachsenen<br />
Frauen in<br />
Deutschland, an einer<br />
COPD erkranken, sondern<br />
nur ein Teil von ihnen, etwa<br />
15 Prozent3,5,7 .<br />
Mithilfe der Lungenfunktionsdiagnostik<br />
lassen sich diese<br />
Zusammenhänge veranschaulichen.<br />
Das forcierte exspiratorische<br />
Volumen in einer<br />
Sekunde (FEV1) als Ausdruck<br />
der Lungenfunktion<br />
fällt im Verlauf des normalen<br />
Altersprozesses bei Nie-Rauchern<br />
um etwa 30 ml/Jahr ab.<br />
Der Abfall ist bei Rauchern unabhängig<br />
von der Entwicklung<br />
einer COPD etwa doppelt so<br />
hoch. Bei 10-20 Prozent der<br />
Raucher, der so genannten „anfälligen<br />
Raucher“, ist dieser Verlust jedoch auf<br />
über das Fünffache gesteigert (150-200 ml/Jahr)<br />
und es entwickelt sich eine COPD3,5,8 . In der<br />
Abbildung 1 sind diese Zusammenhänge graphisch<br />
dargestellt. Die Beendigung des Rau-<br />
(Fotos: BilderBox)<br />
Abb. 1: FEV 1-Verläufe männlicher Raucher in Abhängigkeit von den<br />
Rauchgewohnheiten und der persönlichen Disposition. * Arbeitsabläufe<br />
etc. (aus 3)<br />
chens führt in jedem Lebensalter zu einer Abflachung<br />
der Beschleunigung des FEV 1-Abfalls<br />
und einer verbesserten Lebenserwartung im<br />
Vergleich zu Weiter-Rauchern sowie zu einer<br />
Minderung der Symptome der COPD 3 . Rauchen<br />
der Mutter in der Schwangerschaft gilt<br />
heute als ein COPD-Risikofaktor<br />
für das Kind, jugendliche<br />
Raucher erreichen<br />
nicht die normale<br />
Lungenfunktion. Passivrauchen<br />
im erwachsenen<br />
Alter ist ein wahrscheinlicher,<br />
aber bislang<br />
nicht sicher nachgewiesener<br />
Risikofaktor<br />
für eine COPD.<br />
Rauchen und Asthma<br />
bronchiale<br />
Das Asthma bronchiale<br />
ist die zweite große<br />
chronische Volkskrankheit<br />
der Atemwege,<br />
von der ca.<br />
acht Millionen Bundesbürger<br />
betroffen<br />
sind 2,9 . An den Folgen eines Asthma bronchiale<br />
sterben in Deutschland nach vorsichtiger Schätzung<br />
pro Jahr bis zu 1 000 Personen, von denen<br />
viele Fälle bei konsequenter Behandlung vermeidbar<br />
wären 2 . Die volkswirtschaftliche Bedeutung<br />
des Asthma bronchiale ist<br />
ebenfalls groß. Die Gesamtkosten werden<br />
in Deutschland auf 2,6 Milliarden<br />
Euro/Jahr geschätzt 2 . Krankheitskosten<br />
für Kinder und Erwachsene mit<br />
mittelschwerem allergischem Asthma<br />
bronchiale errechneten sich auf 2 200-<br />
2 700 Euro/Patient und Jahr, bei<br />
schweren Formen resultierten 7900-<br />
9 300 Euro/Patient und Jahr 9 . Die<br />
Kosten für die vielfach schwereren<br />
Krankheitsverläufe nicht allergischer<br />
Asthmaformen dürften noch wesentlich<br />
höher anzusetzen sein.<br />
Asthma bronchiale ist eine chronischentzündliche<br />
Atemwegserkrankung<br />
auf dem Boden einer bronchialen<br />
Medizin und Wissenschaft<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 59
Medizin und Wissenschaft<br />
60<br />
Überempfindlichkeit (Hyperreagibilität), die<br />
häufig mit einer allergischen Diathese einhergeht.<br />
Die genetische Prädisposition ist ein gesicherter<br />
Risikofaktor für die Entstehung von<br />
Asthma und Allergie. Ihr Anteil an der Krankheitsentstehung<br />
wird auf bis zu 75 Prozent geschätzt<br />
9 . Neben dem allergischen Asthma unterscheidet<br />
man das so genannte intrinsische Asthma,<br />
das wahrscheinlich durch Virusinfekte im<br />
Kindes- oder Erwachsenenalter ausgelöst wird 2 .<br />
Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Rauchen<br />
und Asthma bronchiale? Trotz verschiedener<br />
Studien zu diesem Thema ist eine gesicherte<br />
ursächliche Beziehung bisher nicht nachzuweisen<br />
1 . Aber es gibt deutliche Hinweise dafür, dass<br />
das Asthma bronchiale im klinischen Verlauf<br />
durch Zigarettenrauchen ungünstig beeinflusst<br />
wird 10 . Zunächst fördert das Rauchen das Auftreten<br />
von Infekten im Bereich der Lunge und<br />
der Bronchien, ein Faktor, der sich sicher ungünstig<br />
auf den Verlauf eines Asthma bronchiale<br />
auswirkt 11 . Zum Zweiten können auch Patienten<br />
mit einem Asthma bronchiale zusätzlich<br />
durch das Rauchen eine COPD ausbilden, die<br />
zu einer Parenchymzerstörung mit Ausbildung<br />
eines Emphysems führt, sodass ein Mischbild<br />
von Asthma und COPD entsteht 12 . In der Praxis<br />
werden solche Fälle relativ häufig beobachtet.<br />
Zum Dritten kann das Rauchen bei Asthmatikern<br />
die Hyperreagibilität der Bronchien<br />
verstärken und dadurch den Verlauf eines<br />
Asthmas ungünstig beeinflussen 13,14 .<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
Beim Jahreskongress der European Respiratory<br />
Society (ERS) 2004 in Glasgow wurde ebenfalls<br />
berichtet, dass das Rauchen für Patienten mit<br />
Asthma bronchiale ein deutlicher Risikofaktor<br />
ist15 . Bei einer Nachuntersuchung von Patienten<br />
mit schwerstem Asthma zeigte sich, dass die<br />
Mortalität bei rauchenden Asthmatikern mit 28<br />
Prozent deutlich über der bei Nichtrauchern mit<br />
zehn Prozent lag. Als Erklärung wurde angenommen,<br />
dass das Rauchen neben den medizinischen<br />
Auswirkungen als Prädiktor für eine<br />
mangelnde Fähigkeit, sich selbst und die Krankheit<br />
ausreichend kontrollieren zu können, gelten<br />
müsse. Außerdem sei die Therapie bei rauchenden<br />
Asthmatikern schwieriger. Theophyllin<br />
werde doppelt so schnell ausgeschieden und<br />
viele Raucher zeigten eine „Cortisonresistenz“.<br />
Kürzlich wurde berichtet, dass aktives Zigarettenrauchen<br />
auch die Wirksamkeit von inhaliertem<br />
topischen Corticosteroiden bei mildem<br />
Asthma verschlechtert16 . Weiterhin wurde auf<br />
dem Kongress in Glasgow berichtet, dass trotz<br />
dieser Zusammenhänge 25 Prozent der Asthmatiker<br />
in Schottland Raucher seien, etwa gleichviel<br />
wie in der Allgemeinbevölkerung. Zahlen über<br />
die Raucherquote bei Asthmatikern in Deutschland<br />
sind in der Literatur leider nicht zu finden.<br />
Der Prozentsatz wird bei erwachsenen Asthmatikern<br />
auf etwa 30 Prozent geschätzt und soll bei<br />
Jugendlichen noch höher liegen17 .<br />
Da der moderne Mensch etwa 90 Prozent seiner<br />
Zeit in Innenräumen verbringt, wurde die Be-<br />
Abb. 2: Passivrauchen und kindliches Asthma bronchiale. Dargestellt sind der Schweregrad des Asthmas, das Ausmaß<br />
der herabgesetzten Lungenfunktion und die gesteigerte Reaktivität der Bronchien auf Histamin (nach 19; aus 1)
deutung von Innenraum-Schadstoffen für die<br />
Asthmaentstehung untersucht. Der quantitativ<br />
bedeutsamste Faktor ist neben der Allergenexposition<br />
die Passivrauchbelastung 9 . Diese ist<br />
quantitativ und qualitativ von besonderer Bedeutung<br />
nicht nur für die Verschlimmerung,<br />
sondern auch für die Auslösung asthmatischer<br />
Erkrankungen. Dies gilt sowohl im Kindesalter<br />
als auch für Erwachsene 18 . Abbildung 2 zeigt,<br />
dass der Schweregrad des Asthmas, das Ausmaß<br />
der verminderten Lungenfunktion sowie die gesteigerte<br />
Reaktivität der Bronchien auf Histamin<br />
in einer Studie an 94 Kindern im Alter von<br />
7-17 Jahren mit einer Asthmaanamnese abhängig<br />
davon war, ob die Mutter Raucherin oder<br />
Nichtraucherin gewesen ist 19 . Damit gehört die<br />
Passivrauchexposition zu den prinzipiell am einfachsten<br />
zugänglichen und vollständig vermeidbaren<br />
Risikofaktoren für die Entstehung und<br />
Verschlimmerung eines Asthma bronchiale.<br />
Zusammenfassung und Schlussfolgerungen<br />
Die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung<br />
(COPD) ist nach dem Lungenkrebs und kardiovaskulären<br />
Krankheiten die wichtigste durch<br />
das Rauchen bedingte Krankheit, der ca. 20 000-<br />
30 000 Menschen/Jahr in Deutschland zum Opfer<br />
fallen. Beim Asthma bronchiale von Erwachsenen<br />
und Kindern verschlechtert das Rauchen<br />
und auch das Passivrauchen den Krankheitsverlauf.<br />
Viele Patienten mit Asthma bronchiale<br />
Edmund-Christiani-Seminar<br />
Edmund-Christiani-Seminar<br />
Ärztek <strong>Ärztekammer</strong><br />
ammer <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
www.aeksh<br />
www.aeksh.de<br />
.de<br />
Akademie Akademie für für medizinische medizinische Fort- Fort- und und Weiterbildung<br />
Weiterbildung<br />
sind Raucher. Deshalb gehört das Angebot einer<br />
konsequenten Raucherentwöhnung für beide<br />
Patientengruppen zum Programm einer Rehabilitationsklinik.<br />
In der Ostseeklinik Schönberg-Holm wird Patienten<br />
mit COPD oder Asthma bronchiale ein<br />
von unseren Psychologen durchgeführter verhaltensmedizinisch-orientierterRaucherentwöhnungskurs<br />
angeboten20,21 . Vonseiten unserer<br />
Ärzte und anderer Mitarbeiter werden die rauchenden<br />
Patienten mit COPD und Asthma<br />
bronchiale zur Teilnahme aufgefordert und motiviert.<br />
Den Patienten, die bei uns das Rauchen<br />
aufgeben wollen, wird vonseiten der Ärzte zusätzlich<br />
eine Nikotinersatztherapie angeboten,<br />
bei der wir uns auf die Erfahrungen des Erfurter<br />
Raucherberatungszentrums stützen22 . Ein wichtiges<br />
Problem bei der Nachsorge von Patienten,<br />
die bei uns eine Nikotinersatztherapie begonnen<br />
haben, ist die sachgerechte weitere Betreuung<br />
durch die Hausärzte. Aus diesem Grunde wird<br />
die Landesarbeitsgemeinschaft Herz und Kreislauf<br />
in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> e. V. 23 in Zusammenarbeit<br />
mit der vor kurzem gegründeten bundesweiten<br />
Ärzte-Initiative Raucherhilfe (AIR) 24<br />
demnächst Kurse für Ärzte zum Erwerb von<br />
Kenntnissen zur Raucherentwöhnung anbieten.<br />
Literatur beim Verfasser oder im Internet unter<br />
www.aerzteblatt-sh.de<br />
Prof. Dr. Klaus-Dieter Kolenda, Ostseeklinik Schönberg-Holm,<br />
An den Salzwiesen 1, 24217 Schönberg<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> <strong>Ärzteblatt</strong><br />
ArztF ArztFindex<br />
index<br />
Vertrauensstelle ertrauensstelle des des Krebsregisters Krebsregisters <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
Medizin und Wissenschaft<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 61
Medizin und Wissenschaft<br />
62<br />
BUECHER + BUECHER + BUECHER + BUECHER + BUECHER<br />
Dermatosen aus drei Kontinenten<br />
Bibliographische Angaben: Bildatlas der vergleichenden Dermatologie, Wilfried Schmeller,<br />
Christoph Bendick, Peter Stingl, Schattauer Verlag 2005, Stuttgart - New York, 240 Seiten,<br />
328 Abbildungen, Preis 129 Euro, ISBN 3-7945-2339-3<br />
Es gibt Bücher, die nur zustande kommen, wenn zur richtigen Zeit<br />
die richtigen Autoren zusammentreffen. Ein Werk wie das hier zu<br />
besprechende ist selten in unserer publizistischen Landschaft.<br />
Lehrbücher enthalten zwar einzelne Bilder von Dermatosen auf<br />
dunkler Haut, Dermatologen mit Tropenerfahrung publizieren<br />
kleinere Werke mit Bildern aus ihrem Einsatzgebiet. Eine Übersicht<br />
über die Vielfalt von Dermatosen auf Haut verschiedener<br />
Pigmentierung bekommt der Leser aus der deutschsprachigen<br />
Literatur nicht.<br />
Die Autoren von „Dermatosen aus drei Kontinenten“ haben<br />
jahrelang in Afrika und Asien dermatologisch gearbeitet und<br />
viel Erfahrung und Bildmaterial zusammengetragen. Auf dieser<br />
Grundlage ist ein Bildatlas entstanden, der synoptisch 100 dermatologische<br />
Krankheitsbilder jeweils bei „weißen“, „gelben“<br />
und „schwarzen“ Patienten darstellt. Diese Synopsis macht das<br />
Buch so bemerkenswert. Die Zusammenschau entspricht den<br />
Anforderungen hiesiger täglicher Arbeit: Unter unseren Patienten finden sich - regional verschieden<br />
- etliche mit dunkler Haut, aber aus den verschiedensten Ländern stammend. Bei Untersuchung<br />
dieser Menschen erleben wir die Schwierigkeit, Befunde auf farbiger Haut richtig zu lesen<br />
und zu deuten, und hierzu brauchen wir Hilfe. Dem Untertitel des Bandes entsprechend stehen<br />
Bilder im Vordergrund, Angaben zur Ätiologie, Pathogenese und zur Therapie sind sehr knapp gehalten.<br />
Sicher zeigen manche der Abbildungen Maximalbefunde, die wir in Mitteleuropa (fast) nicht<br />
mehr antreffen, sondern unter armer Bevölkerung in Ländern mit unzureichender medizinischer<br />
Versorgung. Auffällig ist der hohe Anteil HIV-assoziierter Befunde. Nützlich sind die immer wieder<br />
eingestreuten Bemerkungen zu lokalen Vorstellungen von „Gesundheit“ und „Krankheit“, zu<br />
welchen Folgen traditionelle Heilmethoden oder unkritischer Gebrauch moderner Medikamente<br />
(v. a. Antibiotika und topische Kortikoide) führen können. Dies macht es leichter, ausländischen<br />
Patienten unsere Form der Medizin akzeptabel zu gestalten, auch eigene Misserfolge - aufgrund<br />
scheinbar fehlenden Verständnisses der Patienten für unsere Therapie - zu verstehen.<br />
Etwas problematisch für den Leser ist die alphabetische Sortierung der Fälle nach Diagnosen. Auf<br />
diese Weise finden sich beispielsweise Hauttumoren wie Melanom und Basalzellkarzinom an weit<br />
auseinander liegenden Seiten. Man muss eine Vorstellung der Diagnose haben um danach suchen<br />
zu können. Das kann für Nicht-Dermatologen schwierig sein.<br />
In Zeiten, in denen die Medizin sich immer feiner spezialisiert, verliert man bei Untersuchung der<br />
Details leicht den Blick auf das Ganze. Dieses Buch hilft, die Übersicht zu wahren. Es ist nützlich<br />
für unsere tägliche Arbeit mit dunkelhäutigen Patienten, deren Zahl zunimmt. Es ist unverzichtbar<br />
für alle, die sich auf medizinische Arbeit in Asien oder Afrika vorbereiten.<br />
Rezensent: PD Dr. Dr. Jürgen Kreusch, Bei der Wasserkunst 15, 23564 Lübeck<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006
Impfschutz bei Aufnahme in<br />
den Kindergarten<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> 2004<br />
Auswertung der anonymen ärztlichen<br />
Bescheinigungen nach KitaVO<br />
Hans-Martin Bader, Sabine Rasche<br />
Über die Einführung der „Ärztlichen Bescheinigung“<br />
seit dem Jahre 2000, ihre Bedeutung (Information<br />
der Kindertagesstätten) und die Auswertung<br />
des Impfstatus bei Aufnahme von Kindern<br />
in Kindertagesstätten wurde zuletzt in Heft<br />
12/2004 des <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>ischen <strong>Ärzteblatt</strong>es<br />
berichtet. Die Kriterien haben sich nicht<br />
geändert (s. Tabelle 1).<br />
Der Impfschutz gegen neun Infektionskrankheiten<br />
(DTP, Polio, Masern, Mumps, Röteln, Hib,<br />
Impfstatus<br />
Diphterie mindestens 3 mal<br />
Tetanus mindestens 3 mal<br />
Keuchhusten mindestens 4 mal<br />
Kinderlähmung mindestens 3 mal<br />
Masern: anzugeben 1 mal oder 2 mal<br />
Mumps: anzugeben 1 mal oder 2 mal<br />
Röteln: anzugeben 1 mal oder 2 mal<br />
Hib mindestens 3 mal<br />
Hepatitis B mindestens 3 mal<br />
Tab. 1: Markierung des Impfstatus vor Aufnahme in eine<br />
Kindertagesstätte (Kindergarten) „vollständig geimpft“<br />
2004 2003 2002 2001 2000<br />
Hep B) wird nach vorgelegtem Impfpass oder<br />
nach ärztlichen Unterlagen in einfacher Form<br />
(Markierung des Haus- oder Kinderarztes in<br />
„vollständig“ oder „unvollständig/nicht geimpft“<br />
gemäß der STIKO-Impfempfehlung [Ständige<br />
Impfkommission]) festgehalten.<br />
Die Einsenderate der einzelnen Kreise ...<br />
... ist sehr unterschiedlich, sie hat sich in einigen<br />
Kreisen und kreisfreien Städten deutlich<br />
verbessert (die niedrigste lag mit 60,1 Prozent in<br />
einem Landkreis). Als Anhalt konnte dieses<br />
Mal die Anzahl der Schulanfängeruntersuchungen<br />
des gleichen Jahres 2004 aus dem landesweiten<br />
Gesundheitsbericht1 verwendet werden<br />
(n = 29 476). In 2004 besuchten 93,5 Prozent<br />
der Schulanfänger vorher einen Kindergarten.<br />
Tatsächlich gingen bei diesem Maßstab 92,3<br />
Prozent der erwarteten Einsendungen ein (einschließlich<br />
der verspäteten). Im Durchschnitt<br />
konnten von diesen 88,6 Prozent der Bögen der<br />
Vorschulkinder zur Auswertung verwendet werden.<br />
241 Kinder der Gesamtauswertung waren<br />
bereits schulpflichtig (Kinderhort). Die Einrichtungen<br />
der dänischen Minderheit sind in den<br />
jeweiligen Kreisen mit enthalten.<br />
Gesamtauswertung: Einen Überblick über alle<br />
eingegangenen „ärztlichen Bescheinigungen“<br />
zeigt Tabelle 2: Auswertbar n = 22 850, Alter 3<br />
Mo. bis 13 J. 2 Mo., im gewichteten Mittel 3 J. 6<br />
Mo.<br />
Kindergarten (1 bis 5 Jahre)<br />
Die Ergebnisse der Altersgruppe 1 bis 5 Jahre (n<br />
= 20 147) stehen im Mittelpunkt des Interesses<br />
dieser Erhebung. Der Altersdurchschnitt<br />
(gewichteter Mittelwert)<br />
lag bei 3 J. 5 Mo. (in<br />
den Vorjahren bei 3 J. 7 Mo).<br />
Die geringen Unterschiede der<br />
Impfschutzraten (Tab. 3) beim<br />
Vergleich dieser Kindergarten-<br />
Gruppe mit der Gesamtgruppe<br />
„Kindertageseinrichtung“ (Aufnahme<br />
4 Mo. bis 15 J. 4 Mo.)<br />
haben sich - wie schon im Vorjahr<br />
erkennbar - fast völlig ausgeglichen:<br />
Die nachwachsenden<br />
jüngeren Kindergartenkinder<br />
sind nunmehr bereits in die-<br />
Anzahl Anzahl Anzahl<br />
Eingesandt 25 591 25 796 21 887 25 298 19 571<br />
Davon nicht auswertbar 1 107 955 857 1 326 127<br />
verspäteter Eingang 1 634 2 931 536 3 070 1 812<br />
Gesamtauswertung 2004<br />
(3 Mo. bis 13 J. 2 Mo.)<br />
22 850 21 910 20 494 20 902 17 632<br />
Davon jünger als 13 Monate 87 48 53 39 111<br />
Älter als 60 Monate 2 613 2 708 2 922 2 894 2 240<br />
Kindergarten (1 bis 5 Jahre)<br />
(= 13 Mo. bis 60 Mo.)<br />
20 147 19 114 17 491 17 953 15 281<br />
Rundungsdifferenz 3 40 28 16<br />
Tab. 2: Allgemeine Angaben zu den Einsendungen (Stand: 14. Nov. 2005)<br />
Medizin und Wissenschaft<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 63
Medizin und Wissenschaft<br />
64<br />
2004 2000 2004 2000<br />
1 bis 5<br />
Jahre<br />
Kita -<br />
gesamt<br />
Diphterie 97,3 96 97,2 95,8<br />
Tetanus 97,8 96,3 97,7 96,1<br />
Polio 96,5 93,5 96,2 93,3<br />
Pertussis 93,4 89,7 92,9 89<br />
Hib 94,3 89,2 93,7 88,5<br />
Hepatitis B 89,2 75 88,6 73,2<br />
mindestens 1 x Masern 92,4 88,2 92,2 92,2<br />
2 x Masern 69,8 14,4 69,5 15,4<br />
mindestens 1 x Mumps 92,2 87,9 91,9 91,9<br />
2 x Mumps 69,7 14,3 69,3 15,3<br />
mindestens 1 x Röteln 91,9 85,4 91,5 91,5<br />
2 x Röteln 69,5 14,1 69,1 14,8<br />
mindestens 1 x MMR 91,6 84,8 91,2 91,2<br />
2 x MMR 69,5 14 69,1 14,8<br />
Tab. 3: Impfschutz Aufnahme Kindergarten 1 bis 5 Jahre<br />
(n = 20 147) und Kindertagesstätten gesamt in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
2004 (n = 22 850) im Vergleich zum Jahr 2000<br />
sem Alter im selben Maße geschützt wie sonst<br />
der Anteil der älteren in der Gesamtgruppe.<br />
Impfschutz gegen Masern<br />
Die Rate für die Erst-Impfung (Abb. 1 und 2)<br />
liegt landesweit in diesem Alter bei 92,4 Prozent<br />
(Vorjahr 91,6 Prozent). Auch die Impfraten gegen<br />
Mumps und Röteln sind in der Einzeldar-<br />
Abb. 1: Masern-Impfung Kindergarten (Aufnahme) <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> 2000-2004<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
stellung fast gleich hoch (Tab. 3) (feste<br />
MMR-Kombination). Die Impfrate gegen<br />
Röteln liegt nur noch um 0,6 Prozent niedriger<br />
gegenüber MM (3,3 Prozent im Jahr<br />
2000).<br />
Die Zweitimpfung (Abb. 1 und 3) gegen die<br />
Kombination MMR wurde erst vier Jahre<br />
zuvor von der STIKO auf den früheren<br />
Zeitpunkt des 2. Lebensjahrs vorgezogen<br />
(STIKO-Empfehlung Jan. 2000). Für die<br />
Zweit-Impfung bei Aufnahme in den Kindergarten<br />
gegen Masern allein ist die Rate<br />
jetzt 69,8 Prozent (im Vorjahr 60,8 Prozent)<br />
(somit erneut eine deutliche Zunahme um<br />
neun Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr<br />
und fast fünf Mal höher seit der Einführung<br />
der „Ärztlichen Bescheinigung“ im<br />
Jahr 2000). Nach einer Teilauswertung des<br />
Jahres 2005 (n = 7 980) zeichnet sich derzeitig<br />
mit 72,4 Prozent ein geringer Anstieg<br />
ab (Stand 5. Nov. 2005).<br />
Am deutlichsten zeigen sich bei der Durchführung<br />
dieser Wiederholungsimpfung die<br />
Unterschiede im Bereich der niedergelassenen<br />
Ärzteschaft: In den Landkreisen und kreisfreien<br />
Städten findet sich bei Aufnahme in die<br />
Kindertagesstätte eine regionale Spannweite für<br />
die zweite Masern-Impfung von 63,2 Prozent bis<br />
79,4 Prozent (vor fünf Jahren 5 Prozent bis 38<br />
Prozent)!<br />
Die Erhebungen der schulärztlichen<br />
Dienste in<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> zeigen:<br />
9- bis 11-Jährige (4. Schulklassen,<br />
vorgelegte Impfpässe<br />
n = 1 292) haben in<br />
2004 bei der Zweitimpfung<br />
eine Rate von 85 Prozent<br />
erreicht, 14-Jährige 83 Prozent<br />
(8. Schulklassen,<br />
n = 5 234) 2 . Noch ist es<br />
nicht gelungen, diese Raten<br />
bereits durch die frühere<br />
Intervention bei Eintritt<br />
in den Kindergarten nachzuweisen.<br />
Denn es gilt, so<br />
früh wie möglich bei der<br />
Zweitimpfung gegen Ma-
Dipht.<br />
%<br />
Tet.<br />
%<br />
Polio<br />
%<br />
Pert.<br />
%<br />
Hib<br />
%<br />
FL 98,7 98,9 97,7 94,5 94,8<br />
HL 97,5 97,8 95,6 96,3 95,6<br />
KI 95,7 96,3 95,2 89,2 92,3<br />
NMS 98,1 98,1 97,5 94,9 96<br />
HEI 97,9 97,9 97,2 94,4 95,2<br />
IZ 97 97,5 96,3 94,6 94,1<br />
NF 98,4 98,6 97,6 95,3 95,5<br />
OD 96,6 97,6 95,3 92,3 92,8<br />
OH 96,1 96,4 95,9 93,3 93,2<br />
PI 96,4 97,6 95,7 91,6 92,8<br />
PLÖ 96 97 94,8 91 92,4<br />
RD 97,7 98,2 96,9 94,9 94,8<br />
RZ 97,31 97,6 96,4 94 94,2<br />
SE 98,3 98,5 97,2 93,5 95,4<br />
SL 98,2 98,5 97,5 94,8 96,1<br />
<strong>Schleswig</strong>-<br />
<strong>Holstein</strong><br />
gesamt<br />
97,3 97,8 96,5 93,4 94,3<br />
Tab. 4: Impfschutz bei Aufnahme Kindergarten (1 bis 5<br />
Jahre) <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> 2004 regional<br />
Abb. 2: Mind. 1 x Masern-Impfung Kindergarten (Aufnahme)<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> 2004<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
sern eine Schutzrate von mindestens 80 Prozent<br />
zu erreichen (bei der Erstimpfung nunmehr von<br />
95 Prozent) - und das bereits am Ende des 2.<br />
Lebensjahres.<br />
Impfschutz gegen Hepatitis B (Abb. 4 und 5)<br />
Bei Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung<br />
sind landesweit 89,2 Prozent erreicht (im Jahr<br />
2000: 75 Prozent). In einem Kreis impfen die<br />
Niedergelassenen unverändert sehr zurückhaltend,<br />
wenngleich auch hier die Schutzrate stieg<br />
(Spannweite landesweit 67,5 Prozent bis 93,4<br />
Prozent). Aus der Teilauswertung des Jahres<br />
2005 lässt sich zurzeit mit 88 Prozent kein weiterer<br />
Anstieg der Schutzrate gegen Hep B ableiten<br />
(Stand 5. Nov. 2005).<br />
Impfschutz gegen Diphtherie, Tetanus, Polio,<br />
Pertussis und Hib, (Tab. 3 und 4)<br />
Die Darstellung der fünf Impfungen soll in Tab.<br />
4 zeigen, dass in den meisten Gebieten die 92<br />
Prozent-Marge überschritten ist (die landesweiten<br />
Raten s. Tab. 3). Lediglich zwei Landkreise<br />
Abb. 3: 2 x Masern-Impfung Kindergarten (Aufnahme)<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> 2004<br />
Medizin und Wissenschaft<br />
65
Medizin und Wissenschaft<br />
66<br />
Abb. 4: Hep B-Impfung Kindergarten (Aufnahme) <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> 2000-2004<br />
zeigen bei der Pertussis-Impfung eine Rate von<br />
91,0 bzw. 91,6 Prozent.<br />
Zusammenfassung über den fünften Jahrgang<br />
Die Impfempfehlungen der STIKO vom Juli<br />
2002 haben auf diesen Kindergartenjahrgang im<br />
Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs der Impfschutzraten<br />
um neun Prozent-Punkte bei der<br />
zweiten MMR-Impfung (Kombination 69,5 Prozent)<br />
und von 3,3 Prozent-Punkten bei der Hep<br />
B-Impfung gebracht (89,2 Prozent). Mit Ausnahme<br />
der 2. MMR- und der Hep B-Impfung ist<br />
im Landesdurchschnitt die 93 Prozent-Marke<br />
überschritten (93,4 Prozent Impfung gegen Pertussis<br />
bis 97,8 Prozent gegen Tetanus). Das ist<br />
wie bisher Ausdruck der Aktivität ausschließlich<br />
der niedergelassenen Ärzteschaft (meist<br />
Kinderärzte). Der öffentliche Gesundheitsdienst<br />
(ÖGD) in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> kommt aktiv erst<br />
ab der Schuleintrittsuntersuchung ins Spiel. Der<br />
Rücklauf der anonymen Belege aller Vorschulkinder,<br />
die ausgewertet werden konnten, betrug<br />
83,8 Prozent der erwarteten Eingänge zum Aus-<br />
wertestichtag 6. Juni 2005. Die<br />
Anzahl der auswertbaren Beläge<br />
bei Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung<br />
ist weiter<br />
angestiegen (jetzt n = 22 850).<br />
Danksagung an das Gesundheitsministerium<br />
MSGV/Kiel, Firma<br />
Chiron Behring Vaccines/Marburg,<br />
Marita Harder/KJÄD im Gesundheitsamt<br />
Flensburg und Holger<br />
Harder/Jarplund-Weding.<br />
Literatur bei der Verfasserin oder<br />
im Internet www.aerzteblattsh.de.<br />
Dr. Sabine Rasche, Gesundheitsamt,<br />
Norderstr. 58-60, 24939<br />
Flensburg<br />
Abb. 5: Hepatitis B-Impfung Kindergarten (Aufnahme)<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> 2004<br />
Sämtliche Ausgaben des<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>ischen <strong>Ärzteblatt</strong>es<br />
finden Sie im Internet unter<br />
www.aerzteblatt-sh.de<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006
Sterbehilfe bei Früh- und<br />
Neugeborenen?<br />
Werner Loosen<br />
Wird in Deutschland, wie in den letzten Jahren<br />
immer häufiger, über aktive und passive Sterbehilfe<br />
diskutiert, folgt meist der Hinweis auf die<br />
Niederlande, mal eher böswillig kommentierend,<br />
mal sachlich informierend. Darum ging es<br />
unter anderem auch bei einem Ethikseminar im<br />
Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf<br />
(UKE); das Thema: „Aktive Sterbehilfe bei<br />
schwerkranken Neu- und Frühgeborenen ohne<br />
Hoffnung auf Heilung?“<br />
Schlechte Erfahrungen<br />
Um bei unseren<br />
Nachbarn in den<br />
Niederlanden zu<br />
bleiben: Dort<br />
gibt es, so Prof.<br />
Dr. Winfried<br />
Kahlke vom<br />
UKE, schon seit<br />
1969 den Hinweis,<br />
der Arzt<br />
habe das menschliche<br />
Leben nur<br />
Prof. Dr. Winfried Kahlke (Fotos: wl) dann zu verlängern,<br />
wenn dies sinnvoll sei. 30 Jahre später<br />
wird die aktive und passive Sterbehilfe von der<br />
niederländischen Bevölkerung als normales medizinisches<br />
Handeln betrachtet. Bei uns, so der<br />
Wissenschaftler, sei man eher zurückhaltend,<br />
vielleicht wegen der schlechten Erfahrungen in<br />
der Nazidiktatur, als der Begriff Euthanasie nur<br />
dazu gedient habe, allgemeines Töten zu rechtfertigen,<br />
damit ein Alltagsgeschäft zu bemänteln;<br />
vielleicht aber gebe es bei uns auch (seit<br />
damals?) eine große Scheu vor diesem Thema.<br />
Dies müsse gesagt und darauf hingewiesen werden,<br />
erklärte Kahlke, dass in der Nazizeit Ärzte<br />
Aufgaben übernommen hätten, die den gesamten<br />
Berufsstand in Misskredit gebracht hätten.<br />
„Und wie stehen die Ärzte heute zur Euthanasie?<br />
Anscheinend sind sie eindeutig anderer<br />
Auffassung als ihre niederländischen Kollegen,<br />
die eine Lösung gefunden zu haben glauben.“<br />
Damit klar wird,<br />
worüber wir<br />
sprechen: Aktive<br />
Sterbehilfe ist<br />
die Verkürzung<br />
eines verlöschenden<br />
Lebens<br />
durch aktive<br />
Einflussnahme<br />
auf den Krankheits-<br />
und Sterbeprozess.<br />
Dr. Axel von der Wense<br />
Gibt es vertretbare<br />
Gründe für eine so verstandene Euthanasie?<br />
Was könnte dazu gehören? Etwa sozioökonomische<br />
Interessen? Oder: keine Überlebenschance<br />
ohne intensivmedizinische Hilfe? Oder:<br />
das Leiden eines todgeweihten oder schwerstgeschädigten<br />
Kindes zu beenden? „Soll so etwas<br />
Ärzten gestattet sein?“, fragte Winfried Kahlke.<br />
Müsse dann nicht ärztliches Handeln grundsätzlich<br />
verändert werden? Solle er sich entscheiden<br />
zwischen unterschiedlichen ethischen Haltungen?<br />
Kahlke erinnerte an das Prinzip der Nützlichkeit,<br />
wonach alles ethisch geboten sei, was<br />
für das Glück aller Betroffenen wichtig sei, er zitierte<br />
aber auch: „Jeder Mensch hat, wie du, einen<br />
unverzichtbaren Wert - handle danach.“<br />
Von daher dürfe seiner Ansicht nach aktives<br />
Töten niemals zum ärztlichen Beruf gehören.<br />
Schwieriges Thema<br />
Nach Erfahrung von Dr. Axel von der Wense,<br />
leitender Arzt der Abteilung für Neonatologie<br />
und pädiatrische Intensivmedizin am Kinderkrankenhaus<br />
Altona, „haben wir es mit einem<br />
schwierigen Thema zu tun, und: Wir werden<br />
auch heute nicht zu einer Lösung kommen“. Er,<br />
andererseits, habe ständig mit dieser Thematik<br />
zu tun. Hierzu ein Satz von Hippokrates: „Das<br />
Leben ist kurz, die Kunst (damals gehörte auch<br />
die Medizin dazu) ist lang, die Gelegenheit flüchtig,<br />
der Erfolg trügerisch, das Urteil schwierig.“<br />
Die rechtlichen Grundlagen sind eindeutig: Jeder<br />
hat nach unserem Grundgesetz das Recht<br />
auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Alle<br />
Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand<br />
darf benachteiligt werden - dies ist nach den<br />
Worten von der Wenses ein Aufruf zum Schutz<br />
Unsere Nachbarn<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 67
Unsere Nachbarn<br />
68<br />
menschlichen Lebens. „Kann und muss andererseits<br />
das Grundrecht auf Leben im Zeitalter<br />
der Intensivmedizin relativiert werden?“ Axel<br />
von der Wense bezog sich auf die Grundsätze<br />
der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung<br />
von 2004. Danach ist es Aufgabe des<br />
Arztes, Gesundheit zu schützen und wieder herzustellen,<br />
aber nicht unter allen Umständen;<br />
manchmal trete die palliativ-medizinische Versorgung<br />
in den Vordergrund: „Bei Neugeborenen<br />
mit schwerer Fehlbildung oder schwerer<br />
Stoffwechselstörung kann nach hinreichender<br />
Diagnostik und im Einvernehmen mit den Eltern<br />
eine lebenserhaltende Maßnahme unterlassen<br />
werden - so steht es in den erwähnten<br />
Grundsätzen.“ Dagegen könne man die so genannte<br />
Einbecker Empfehlung von 1992 halten,<br />
in der es heiße: „Der Umstand, dass dem Neugeborenen<br />
ein Leben mit Behinderungen bevorsteht,<br />
rechtfertigt es nicht, lebenserhaltende<br />
Maßnahmen zu unterlassen oder abzubrechen.“<br />
Dennoch, so von der Wense, gebe es Fälle, in<br />
denen der Arzt nicht alle Behandlungsmöglichkeiten<br />
ausschöpfen müsse, etwa bei einem Frühgeborenen<br />
vor der 22. Schwangerschaftswoche.<br />
Es sei allgemeiner Konsens, dass so ein Kind<br />
nicht lebensfähig sei, es gehe also um Sterbebegleitung.<br />
Solches Vorgehen sei allerdings<br />
ethisch wenig fundiert, entsprechende Richtlinien<br />
müssten dringend überarbeitet werden. Bei<br />
den Grundsätzen der Bundesärztekammer gehe<br />
es darum, Leben nicht auf Dauer zu erhalten,<br />
wenn der Tod in Kürze zu erwarten sei, wenn es<br />
Einvernehmen mit den Eltern gebe oder auch<br />
bei schweren Stoffwechselstörungen.<br />
Unterschiedliche Ansichten<br />
Kann man also von einer Sterbehilfe bei Neuund<br />
Frühgeborenen sprechen? Nach Erfahrung<br />
des Arztes gibt es einen impliziten Konsens, dass<br />
eine maximale Intensivtherapie in aussichtsloser<br />
Situation nicht angemessen sei. Der Dissens im<br />
europäischen Kontext entstehe häufig über Begriffsstreitigkeiten.<br />
Nehmen wir den Begriff Euthanasie.<br />
Unter passiver Euthanasie versteht<br />
man den Verzicht von Maßnahmen oder das<br />
Abbrechen begonnener Maßnahmen: aktive<br />
Euthanasie ist demgegenüber die Anwendung<br />
von Maßnahmen mit dem Ziel der Lebensverkürzung.<br />
Schließlich gibt es noch die indirekte<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
aktive Euthanasie, das Inkaufnehmen einer Lebensverkürzung<br />
durch Medikamente, die zur<br />
Leidensverminderung eingesetzt werden, aber<br />
nicht explizit zur Tötung des Patienten. Axel<br />
von der Wense berichtete über eine Studie in<br />
mehreren europäischen Ländern, die bei einem<br />
Rücklauf von mehr als 80 Prozent der befragten<br />
Ärzte ganz unterschiedliche Ergebnisse gebracht<br />
habe auf Fragen wie, was denn zu tun sei bei einer<br />
Spontangeburt in der vollendeten 24. Schwangerschaftswoche<br />
und einem geschätzten Gewicht<br />
von 560 Gramm oder bei einem Kind, das beatmet<br />
werden muss nach der Geburt, das Krampfanfälle<br />
und eine einseitige Hirnblutung hat.<br />
In den Niederlanden sind 22 Neugeborene in<br />
den Jahren 1998 bis 2004 mit schwerer Spina bifida<br />
aktiv getötet worden. Die Bewertungen waren<br />
unterschiedlich, von großem Leiden über<br />
schlechte Prognose und zu erwartender Hospitalisierung<br />
bis zu der Einschätzung, je länger ein<br />
solcher Patient leben werde, desto größer sei das<br />
zu erwartende Leiden. In keinem dieser Fälle<br />
gab es eine strafrechtliche Verfolgung. Alle Fälle<br />
waren der Staatsanwaltschaft als nicht natürliche<br />
Tode gemeldet worden. Die niederländischen<br />
Kategorien für eine solche Maßnahme:<br />
keine Lebenschance, sehr schlechte Prognose,<br />
untragbares Leid mit sehr schlechter Lebensqualität.<br />
Und in Altona?<br />
Im Kinderkrankenhaus Altona wird nach dem<br />
Züricher Modell vorgegangen, das an der dortigen<br />
Kinderklinik entwickelt worden ist mit dem<br />
ethischen Ziel: Jedes Kind soll eine faire Chance<br />
haben. Es gibt demnach eine ständige Diskussion<br />
mit den Eltern, mit behandelnden Pflegenden,<br />
Ärzten und Experten, es geht um eine Güterabwägung,<br />
die immer im Konsens enden<br />
muss. Zu den Gesprächsinhalten gehören eine<br />
ethische Fragestellung, medizinische Sachverhalte,<br />
der Lebenskontext des Kindes, die Güterabwägung,<br />
ob Chancen auf Überleben mit und<br />
ohne Therapie bestehen, die Prognose von<br />
Komplikationen, die Behandlungsdauer sowie<br />
die Lebenschancen („Leidensintensität versus<br />
Lebensqualität - das ist schwierig!“).<br />
Gibt es Konsens über die Sinnlosigkeit einer Intensivtherapie,<br />
wird sie beendet (etwa Beat-
mung oder Kreislaufunterstützung; hinzukommen<br />
konsequente Analogsedierung und Zuwendung<br />
durch Ärzte, Eltern und Pflege: „Alle Betroffenen<br />
akzeptieren die Lebensverkürzung<br />
durch die genannten Maßnahmen - aber dies ist<br />
keine aktive Tötung!“ In seinen Thesen zu einem<br />
solchen Vorgehen sagte von der Wense, es<br />
entspreche dem Konzept der passiven Euthanasie,<br />
in Einzelfällen der indirekten aktiven Eu-<br />
Suizid im Alter<br />
Ärzte und Psychologen sorgen sich um den<br />
Themenkomplex Alter und Suizidalität. Ist der<br />
Anteil älterer Menschen, die sich das Leben<br />
nehmen, generell gewachsen?<br />
Nein, sagt Diplom-Psychologe<br />
Georg Fiedler,<br />
stellvertretender<br />
Leiter des in<br />
Deutschland<br />
einzigartigen<br />
Therapie-Zentrums<br />
für Suizidgefährdete<br />
(TZS) * .<br />
Nur: „Der Anteil<br />
älterer Men-<br />
Dipl.-Psych. Georg Fiedler schen an unserer<br />
Bevölkerung ist<br />
größer geworden in den letzten Jahren und Jahrzehnten,<br />
daher steigt auch der Anteil Älterer an<br />
der Gesamtzahl der Suizide in Deutschland.“ Im<br />
Jahr 2003 starben in der Bundesrepublik 11 150<br />
Menschen durch Suizid (8 179 Männer und<br />
2 971 Frauen). In <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> waren es<br />
im selben Zeitraum 455 Fälle. Der Arzt Dr.<br />
Reinhard Lindner vom TZS fügt hinzu, die<br />
Problematik Suizid im Alter sei „sehr stark ein<br />
demographisches Problem - wir stoßen in der<br />
allgemeinen Debatte um die Demographie auch<br />
auf mehr Aufmerksamkeit für die Suizide älterer<br />
Menschen“.<br />
Nach den Worten von Georg Lindner ist das<br />
Problem Suizidalität im Alter seit langem be-<br />
thanasie. „Und dies vor dem ethischen Hintergrund,<br />
dass der ‚messbare’ Unterschied zur aktiven<br />
Euthanasie überaus gering ist.“ Er liege eher<br />
in der Grundüberzeugung. Sichere, übergeordnete<br />
Kriterien seien hier nicht möglich.<br />
Und, auch das ein Ergebnis dieses Seminars, die<br />
Interpretationsmöglichkeiten sind zahlreich.<br />
Werner Loosen, Faassweg 8, 20249 Hamburg<br />
kannt; so liege beispielsweise die Zahl suizidaler<br />
alter Männer um das Zehnfache höher als bei<br />
Zwanzigjährigen: „Wir kümmern uns im TZS<br />
seit rund vier Jahren verstärkt um diese Altersgruppe,<br />
nachdem die Werner-Otto-Stiftung<br />
Geld für die entsprechende Forschung bewilligt<br />
hat.“ Eine der dahinter steckenden Fragen: Warum<br />
nehmen suizidale Ältere soziale und ärztliche<br />
Angebote in so geringem Umfang wahr?<br />
Um das herauszufinden,<br />
hat das<br />
TZS mehrere<br />
Anzeigen in der<br />
Tagespresse geschaltet<br />
- wer<br />
sich angesprochen<br />
fühlte, sollte<br />
sich melden<br />
und sich bereit<br />
erklären, an einem<br />
Interview<br />
teilzunehmen; Dr. Reinhard Lindner (Fotos: wl)<br />
man unterstütze<br />
damit ein Forschungsvorhaben: Das taten die<br />
Teilnehmer gern und bereitwillig - ohne sich<br />
aber, bis auf wenige Ausnahmen, auf ein therapeutisches<br />
Gespräch einzulassen. Ein wichtiges<br />
Ergebnis dieser Untersuchung - die Auswertung<br />
ist noch nicht abgeschlossen -: Ältere können<br />
durchaus in ärztlicher Behandlung sein, dennoch<br />
fällt es ihnen schwer, mit dem Arzt (oder<br />
mit der Schwester oder dem Pfleger im Heim)<br />
über Suizidalität zu sprechen: „Dieses Faktum<br />
haben wir sozusagen entdeckt“, sagt Reinhard<br />
Lindner. Warum das so ist? Der Arzt nennt<br />
Scham, eine solche Thematik anzusprechen,<br />
* Therapie-Zentrum für Suizidgefährdete am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Martinistraße 52, 20246<br />
Hamburg, Tel. 040/428034112, Fax 040/428034949, E-Mail tzs@uke.uni-hamburg.de, Internet www.suicidology.de<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 69<br />
Unsere Nachbarn
Unsere Nachbarn<br />
70<br />
aber auch die Angst, mit einem<br />
derartigen Gespräch vielleicht die<br />
Beziehung zum Arzt zu gefährden.<br />
„Außerdem ist da auch die<br />
Angst vor einer Einweisung in eine<br />
psychiatrische Einrichtung.“<br />
Weitere der bisher vorliegenden<br />
Untersuchungsergebnisse: Der<br />
Umgang mit suizidalen Älteren<br />
gestaltet sich häufig schwierig, da<br />
sie sehr aggressiv sein können.<br />
Sie stoßen - sei es nun aufgrund<br />
von Ärger oder Vorurteilen - ihre<br />
Gesprächspartner oft vor den Kopf. „Dahinter“,<br />
so Reinhard Lindner, „steckt auch der Gedanke,<br />
ihnen könne ja doch nicht geholfen werden,<br />
auch wegen des Altersunterschieds zwischen<br />
Patient und Arzt und/oder Therapeut.“<br />
Mit dem Arzt sprechen<br />
Da stellt sich gleich die Frage, ob und wie es<br />
denn möglich sei, den vielleicht suizidalen älteren<br />
Menschen doch zu bewegen, mit seinem<br />
Dr. Dipl.-Psych. Astrid Altenhöfer<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
Arzt zu sprechen. Dr. Dipl.-Psych.<br />
Astrid Altenhöfer vom TZS sagt,<br />
zunächst sei es wichtig, dem Patienten<br />
die Angst zu nehmen, er<br />
könne mit einem solchen Gespräch<br />
die Beziehung zum Arzt<br />
belasten. „Uns geht es generell in<br />
solchen Gesprächen auch und<br />
vor allem darum, ganz allgemein<br />
den Kontakt zu helfenden Menschen<br />
zu ermöglichen, den Patienten<br />
zum Sprechen zu motivieren,<br />
ihm dabei auch die Angst<br />
vor einer therapeutischen Mühle zu nehmen.“<br />
Es sei nötig, solche Gespräche immer wieder<br />
und in aller Öffentlichkeit zu führen - „gerade<br />
die Älteren kommen ja sonst nicht“. Wir wollen<br />
es schaffen, erklärt Astrid Altenhöfer, „die<br />
ganze Problematik mehr publik zu machen“.<br />
„Es kommt aber auch darauf an“, stellt Reinhard<br />
Lindner fest, „dass es gelingt, den Arzt dazu zu<br />
motivieren, Patienten anzusprechen, wenn sie<br />
ein solches Problem vermuten. Dabei müssen<br />
Kasten 1<br />
Zum Thema Depression und Suizidalität im Alter schreibt Dr. Claus Wächtler, Leitender Arzt im Zentrum<br />
für Ältere im Klinikum Nord, unter anderem:<br />
Knapp 24 Prozent der über 65-Jährigen sind eindeutig psychisch krank. Depressionen stellen dabei die<br />
häufigste psychische Störung im Alter dar. Unter den Menschen, die sich das Leben nehmen, sind ältere<br />
Menschen überprozentual häufig.<br />
Typisch für Depressionen im Alter ist:<br />
Sie sind häufig:<br />
Dr. Claus Wächtler<br />
9 bis 10 Prozent der über 65-Jährigen leiden an einer „bedeutsamen“ Depression. Bei den in Alten- und Pflegeheimen Lebenden<br />
sind schätzungsweise 40 bis 45 Prozent betroffen.<br />
Sie sind gefährlich:<br />
Depressionen gehen gehäuft mit Verlust der Lebensfreude, Einschränkungen bei der Alltagsbewältigung und in der sozialen<br />
Kontaktfähigkeit, Einweisung ins Heim, vermehrtem Arzneimittelverbrauch, erhöhter Anfälligkeit für körperliche<br />
Erkrankungen und vermehrter Sterblichkeit einher - hierzu tragen sowohl körperliche Erkrankungen als auch eine erhöhte<br />
Suizidgefährdung bei. Depressive Menschen neigen besonders dazu, sich das Leben zu nehmen.<br />
Die wichtigsten Maßnahmen gegen Suizidalität wie Erkennen, Beziehung anbieten und Therapie einleiten unterbleiben<br />
bei Älteren häufig.<br />
Bei der Therapie von Depression und Suizidalität im Alter ist zu berücksichtigen, dass häufig ein Wechselspiel aus körperlichen,<br />
psychischen und sozialen Störungen vorliegt. Dieser Tatsache lässt sich nur mit einem berufs- und methodikübergreifenden<br />
Therapieansatz begegnen. Primär benötigt der depressive Ältere ein Gespräch, das mit Interesse und Geduld<br />
geführt wird, das auf spezielle belastende Probleme eingeht und das weitere therapeutische Maßnahmen bahnt. Die<br />
Therapie mit Psychopharmaka ist bei mittelschwerer und schwerer Depression und bei Suizidalität geboten. Im Zentrum<br />
der Pharmakotherapie einer depressiv-suizidalen Verstimmung steht die Behandlung mit einem geeigneten Antidepressivum.<br />
Unter Umständen ist eine Kombination mit Benzodiazepin, Neuroleptikum oder Lithium erforderlich. Alle Maßnahmen<br />
sollten möglichst in Wohnortnähe des älteren Menschen erfolgen. Immer ist das soziale Netz zu berücksichtigen<br />
und einzubeziehen. Der Hausarzt ist der „Casemanager“ („Lotse“).<br />
Zukünftig sollten der Hausarzt, aber auch alle anderen Berufsgruppen, die mit depressiven und suizidalen Älteren in Kontakt<br />
kommen, ihre psychosozialen therapeutischen Fähigkeiten verbessern und enger miteinander kooperieren. Auch<br />
sollten präventive Strategien weiterentwickelt und wissenschaftlich untersucht werden. Hinweise auf suizidpräventive<br />
Wirksamkeit ergeben sich vor allem bei aktiv aufsuchenden Versorgungsprogrammen.
sie wissen: Ältere Menschen können sich nur in<br />
seltenen Fällen vorstellen, dass ein Gespräch<br />
hilfreich sein kann!“ Reinhard Lindner fügt hinzu,<br />
dass Ärzte hier schnell an Grenzen stoßen;<br />
dazu gehöre die häufig mangelnde Zeit für derartige<br />
Gespräche. Zudem wies er gegenüber dem<br />
<strong>Ärzteblatt</strong> darauf hin, dass gerade niedergelassene<br />
Ärzte zwar meist viele Patienten haben, dass<br />
aber darunter nur wenige seien, die suizidal seien:<br />
„Und diese wenigen gilt es zu entdecken,<br />
was zugegebenermaßen schwer sein kann.“<br />
Zu den Symptomen gehören Depressivität (siehe<br />
dazu Kasten 1), Niedergeschlagenheit, aber<br />
auch Äußerungen, die auf Lebensunlust schließen<br />
lassen. Auch der bevorstehende Umzug ins<br />
Heim und der Verlust des Partners können suizidale<br />
Gedanken auslösen. Hinzu kommt oft die<br />
Einschränkung körperlicher Fähigkeiten: „Wenn<br />
es dem Arzt gelingt, eine solche Einschränkung<br />
sowie den möglichen Verlust seelischer Fähigkeiten<br />
zu erleben und dies dann anzusprechen,<br />
wirkt das gleichsam als Türöffner für weitere<br />
Gespräche.“ Reinhard Lindner erwähnt, dass<br />
gerade Hausärzte inzwischen mehr Gespräche<br />
abrechnen dürfen, mehrere Sitzungen im Quartal,<br />
bis hin zu 15 Minuten. „Ob das nicht aber<br />
zu kurz ist, muss sich herausstellen.“ Ganz allgemein<br />
sei es schwierig, von der symptomatischen<br />
Ebene zum Erleben zu kommen und so ein Fenster<br />
zu öffnen.<br />
Astrid Altenhöfer betont die Ängste auf beiden<br />
Seiten: „Was soll ich als Psychologin oder als<br />
Arzt dem Patienten anbieten? Wie gehe ich mit<br />
meiner Verantwortung um? Soll ich für diesen<br />
Patienten künftig rund um die Uhr erreichbar<br />
sein? Wir Therapeuten müssen aber auch wissen,<br />
dass solche Grenzen zu einer Verbesserung<br />
der Kommunikation führen können.“<br />
Tipps für den Hausarzt<br />
Auf die Frage, wie viele suizidale ältere Menschen<br />
in einer Praxis auftauchen, sagt Georg<br />
Fiedler, die dazu befragten Ärzte schätzten dies<br />
zwischen einem und 15 - „wenn solche Patienten<br />
überhaupt erkannt werden“. Dabei seien gerade<br />
die Hausärzte mit ihrer oft umfassenden<br />
Kenntnis von Krankheits- und Familiengeschichten<br />
gute und bewährte Gesprächspartner.<br />
Es sei aber wohl schwierig, „den diagnostischen<br />
Schritt zu wagen von gelegentlich geäußerter<br />
Lebensunlust zu tatsächlicher Suizidalität“.<br />
Hier einige Tipps für den Umgang mit möglicherweise<br />
suizidalen Patienten. Reinhard Lindner<br />
nennt an erster Stelle: „Der Arzt sollte daran<br />
denken - er muss sozusagen die Vorstellung haben,<br />
dass hinter somatischen Beschwerden eine<br />
andere Erlebniswelt stecken kann, etwa die der<br />
Verzweiflung.“ Inkontinenz kann bei Älteren<br />
durchaus ein Scham besetztes Phänomen sein.<br />
Der Rückgang des eigenen Zurechtkommens im<br />
Leben gehört ebenso dazu wie Schmerzen, aber<br />
auch Beziehungsprobleme: „Wir haben es ja<br />
nicht nur mit den völlig vereinsamten alkoholabhängigen<br />
Männern zu tun!“ So etwas und<br />
mehr kann der Arzt erfragen, und manche tun<br />
dies. Wenn einige dies tun - ist es dann nicht<br />
mehr Ärzten möglich? Reinhard Lindner betont,<br />
gleichsam als Anreiz für seine ärztlichen<br />
Kollegen, dass ältere Menschen durchaus dankbar<br />
sind für solche Gespräche, auch für die sich<br />
vielleicht anschließende psychotherapeutische<br />
Behandlung. Sie fühlten sich in und mit dem<br />
suizidalen Zustand nicht wohl, und wer sie da<br />
hinausführe, gelte schon als etwas ganz Besonderes.<br />
Georg Fiedler regt an, die häufiger werdenden<br />
Gespräche und Fragen zu den Themen<br />
Sterbehilfe und Patientenverfügungen zum Anlass<br />
für weiterführende Gespräche zu nehmen.<br />
„Ganz allgemein stellen wir fest, dass sich dank<br />
der Aufmerksamkeit der Hausärzte eine Menge<br />
bewegen und bewirken lässt - wenn ich nur an<br />
das Erkennen der Depressivität gerade bei Frauen<br />
denke. Das bringt eine ganze Menge und<br />
verhindert unter Umständen die weitere Entwicklung<br />
in Richtung Suizidalität.“ Astrid<br />
Altenhöfer ergänzt: „Ich sehe es als eine vornehme<br />
Aufgabe, Menschen zu helfen, die das<br />
Gefühl haben, alles verloren zu haben - das<br />
kann der Hausarzt im Blick haben, etwa auch<br />
den möglichen oder tatsächlichen Verlust an<br />
Attraktivität, über den Frauen oft klagen - die<br />
schaffen sich dann, gleichsam als Ersatz, ein<br />
Tier an, das diesen Verlust nicht sieht.“<br />
Kontakte zwischen TZS und <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
gibt es übrigens - etwa zur Einrichtung „Lichtblick“<br />
in Flensburg; am 13. Juni 2006 findet in<br />
Unsere Nachbarn<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 71
Unsere Nachbarn<br />
72<br />
Kasten 2<br />
Aus dem Hamburger Suizidbericht:<br />
Eine entscheidende Rolle bei der Prävention der Suizide alter Menschen können die Hausärztinnen und Hausärzte spielen.<br />
Da alte Menschen oft an chronischen Krankheiten leiden, haben sie häufiger als andere Bevölkerungsgruppen Kontakt<br />
zu Ärztinnen und Ärzten. Depressive Entwicklungen lassen sich in den meisten Fällen durch einfache Fragen erkennen.<br />
Suizidgedanken werden im Gespräch oftmals geäußert, wenn ein Vertrauensverhältnis zwischen Ärztin/Arzt und<br />
Patientin/Patient besteht. Hinzu kommt, dass die häufigsten Gründe für den Suizid alter Menschen, körperliche und psychische<br />
Krankheiten oder Schmerzen, durch medizinische Behandlung teils geheilt, teils erträglich gestaltet werden können.<br />
Die wichtigsten Handlungsempfehlungen auf einen Blick:<br />
� Präventive Ansätze in Lebenswelten (Schule, Einrichtungen der Seniorenarbeit, Betrieben, Erwachsenenbildungseinrichtungen)<br />
stärken.<br />
� Alte Menschen zu einer wichtigen Zielgruppe in der Suizidverhütung machen.<br />
� Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sensibilisieren und qualifizieren.<br />
� Psychiater(innen) sowie Psychotherapeuten(innen) in ambulanter und stationärer Behandlung stärker einbeziehen.<br />
� Hilfsangebote bekannter machen.<br />
� Medien bei ihrer Berichterstattung über Suizide und Suizidversuche unterstützen.<br />
� Die Unterstützung von Angehörigen verbessern.<br />
� Die Kenntnisse der Öffentlichkeit durch Aufklärung über psychische Leiden und Früherkennung erhöhen.<br />
Niebüll eine entsprechende Weiterbildung statt.<br />
Georg Fiedler und seine Kolleginnen und Kollegen<br />
sind im Auftrag unterschiedlicher Träger<br />
häufig in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> unterwegs.<br />
Reinhard Lindner erwähnt den jüngsten Ham-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
burger Suizidbericht (siehe Kasten 2) mit - erstmals<br />
in einem Bundesland - einem gesonderten<br />
Kapitel, das sich mit älteren Menschen befasst:<br />
„So etwas müsste doch in <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
ebenfalls möglich sein.“ (wl)<br />
BUECHER + BUECHER + BUECHER + BUECHER + BUECHER<br />
Sanitätsrat Dr. August Steffen (1825-1910)<br />
Nestor und Spiritus rector der Kinderheilkunde in Deutschland und Mitteleuropa<br />
Bibliographische Angaben: Hermann Manzke, Ludwig Verlag, Kiel 2005, 236 Seiten, 19,90 Euro,<br />
ISBN 3-937719-27-X<br />
Vielen Kielern ist Prof. Hermann Manzke kein Unbekannter. Von 1962 bis 1986 wirkte er an der<br />
Kieler Universitätskinderklinik, zuletzt als leitender Oberarzt, bevor er Chefarzt und Ärztlicher<br />
Direktor des Kinderkrankenhauses Seehospiz auf Norderney wurde. Der Autor legt mit dem vorliegenden<br />
Buch eine Biographie August Steffens vor, der 1851 in Stettin eine der ersten Kinderkliniken<br />
schuf. Im 19. Jahrhundert der aufblühenden naturwissenschaftlichen und experimentellen<br />
Medizin lautete eine Hauptfrage: Wie kann ich mich als Spezialist in einer eigenen, aber noch<br />
nicht anerkannten Disziplin frei entfalten? So entstand in dieser Zeit die Pädiatrie als eigenes<br />
Fach, nachdem sie sich von der Inneren Medizin gelöst hatte. Steffen gründete 1883 die „Gesellschaft<br />
für Kinderheilkunde“, leitete am Stettiner Kinderspital Ferienkurse über Pädiatrie und förderte<br />
durch eigene Publikationen die Entwicklung der Kinderheilkunde. Heute sehen wir die Notwendigkeit<br />
der weiteren Spezialisierung unter Erhaltung einer Allgemeinen Pädiatrie und Allgemeinen<br />
Inneren Medizin, weil sonst Fragmentierung und Atomisierung drohen. Hermann Manzke<br />
bietet mit seiner Biographie gleichzeitig eine interessante Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts<br />
und eine liebevolle Schilderung der ehemals deutschen Stadt Stettin. Als Leserinnen und Leser<br />
stellt sich der Rezensent Kinderärzte, Allgemeinärzte mit Neigung zur Pädiatrie und andere Ärzte<br />
mit medizinhistorischen und allgemeingeschichtlichen Interessen vor.<br />
Rezensent: Prof. Dr. Karlheinz Engelhardt, Jaegerallee 7, 24159 Kiel
Folgende Ärzte wurden zur Vertragspraxis<br />
zugelassen. Diese Beschlüsse sind<br />
noch nicht rechtskräftig, sodass hiergegen<br />
noch Widerspruch eingelegt bzw.<br />
Klage erhoben werden kann:<br />
Kreis Dithmarschen<br />
Herr Prof. Dr. med. Hans-Ulrich Gutsche, Facharzt<br />
für Innere Medizin, Schwerpunkt Nephrologie, sowie<br />
die Fachärzte für Innere Medizin und Fachärzte für<br />
Innere Medizin, Schwerpunkt Nephrologie, Herren<br />
Dr. med. Jens Masselmann und Dr. med. Thomas<br />
Mehrens, Heide, haben gemäß § 32 b Ärzte-ZV i. V.<br />
m. den Angestellte-Ärzte-Richtlinien die Genehmigung<br />
zur Beschäftigung von Frau Dr. med. Claudia<br />
Matthiesen als angestellte Ärztin in einer Ganztagstätigkeit<br />
in ihrer Praxis erhalten.<br />
Herr Prof. Dr. med. Hans-Ulrich Gutsche, niedergelassener<br />
Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt<br />
Nephrologie, in Heide, zusätzlich als Facharzt für Innere<br />
Medizin.<br />
Herr Dr. med. Christian Lüer, niedergelassener Facharzt<br />
für Innere Medizin, Schwerpunkt Kardiologie, in<br />
Heide, zusätzlich als Facharzt für Innere Medizin.<br />
Stadt Flensburg<br />
Herr Wolfgang Gregersen und Frau Dr. med.<br />
Christine Stegmann haben mit Wirkung vom<br />
01.01.2006 die Genehmigung zur Führung einer Gemeinschaftspraxis<br />
als hausärztlich tätige Fachärzte für<br />
Innere Medizin in Flensburg erhalten.<br />
Herr Dr. med. Stephan Hoffmann seit dem<br />
01.01.2006 als praktischer Arzt für 24939 Flensburg,<br />
Toosbüystraße 4.<br />
Kreis Herzogtum Lauenburg<br />
Herr Seyed Reza Touhidi gemäß § 101 Abs. 1 Nr. 4<br />
sowie Abs. 3 Satz 1 SGB V (Job-Sharing) in Verbindung<br />
mit den Nrn. 23 a bis g Bedarfsplanungs-Richtlinien-Ärzte<br />
als Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde<br />
für 23909 Ratzeburg, Domhof 10.<br />
Herr Seyed Reza Touhidi und Herr Dr. med. Jürgen<br />
Reinhold haben mit Wirkung vom 01.01.2006 die<br />
Genehmigung zur Führung einer Gemeinschaftspraxis<br />
als Fachärzte für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in<br />
Ratzeburg erhalten.<br />
Der LADR GmbH Labormedizinisches Versorgungszentrum<br />
in Geesthacht hat ab 01.04.2006 die<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
Genehmigung zur Beschäftigung von Herrn Dr. med.<br />
Wolfgang Hell als angestellten Facharzt für Mikrobiologie<br />
und Infektionsepidemiologie in einer Ganztagstätigkeit<br />
erhalten.<br />
Herr Dr. med. Thomas Völkel, Facharzt für Allgemeinmedizin<br />
und Facharzt für Innere Medizin mit<br />
ausschließlich hausärztlicher Tätigkeit, und Frau Dr.<br />
med. Astrid Gerdes, Fachärztin für Innere Medizin<br />
mit ausschließlich hausärztlicher Tätigkeit, haben mit<br />
Wirkung vom 01.01.2006 die Genehmigung zur Führung<br />
einer Gemeinschaftspraxis in Geesthacht erhalten.<br />
Herr Dr. med. Sven Fastenrath ab 01.04.2006 Facharzt<br />
für Innere Medizin mit ausschließlich hausärztlicher<br />
Tätigkeit für 21502 Geesthacht, Am Runden<br />
Berge 3 a.<br />
Stadt Kiel<br />
Frau Dr. med. Lydia Fischer seit dem 02.01.2006 als<br />
Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe für<br />
24103 Kiel, Markt 11.<br />
Herr Dr. med. Tino Speidel als Facharzt für Allgemeinmedizin<br />
für 24109 Kiel, Kurt-Schumacher-Platz<br />
10.<br />
Herr Dr. med. Tino Speidel und Herr Dr. med. Lutz-<br />
Henrik Ruhnke haben mit Wirkung vom 01.01.2006<br />
die Genehmigung zur Führung einer Gemeinschaftspraxis<br />
als Fachärzte für Allgemeinmedizin in Kiel erhalten.<br />
Herr Dr. med. Gunter Behrend, Facharzt für Allgemeinmedizin,<br />
hat seine Vertragspraxis von 24116<br />
Kiel, Eckernförder Straße 69, nach 24159 Kiel, Jaegerallee<br />
14, verlegt.<br />
Frau Dr. med. Claudia Brockmann-Kuhn als Fachärztin<br />
für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie für 24148<br />
Kiel, Schönberger Straße 11.<br />
Frau Dr. med. Claudia Brockmann-Kuhn und Herr<br />
Dr. med. Dietmar Kuhn haben mit Wirkung vom<br />
01.01.2006 die Genehmigung zur Führung einer Gemeinschaftspraxis<br />
als Fachärzte für Mund-, Kiefer-,<br />
Gesichtschirurgie in Kiel erhalten.<br />
Herr Dr. med. Harald Wilms, Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde<br />
in Kiel, hat seine Vertragspraxis<br />
nach 24113 Kiel, Hamburger Chaussee 77, verlegt.<br />
Frau Dr. med. Katja Dirksen, gemäß § 101 Abs. 1<br />
Nr. 4 sowie Absatz 3 Satz 1 SGB V (Job-Sharing) in<br />
Verbindung mit den Nummern 23 a bis g Bedarfsplanungsrichtlinien-Ärzte<br />
als Fachärztin für Innere Medizin<br />
mit ausschließlich hausärztlicher Tätigkeit für<br />
24149 Kiel, Georgstraße 6.<br />
Mitteilungen der Kassenärztlichen Vereinigung<br />
73
Mitteilungen der Kassenärztlichen Vereinigung<br />
74<br />
Frau Dr. med. Katja Dirksen, Fachärztin für Innere<br />
Medizin mit ausschließlich hausärztlicher Tätigkeit,<br />
Herr Dr. med. Rainer Birke, Facharzt für Innere Medizin<br />
mit ausschließlich hausärztlicher Tätigkeit, Frau<br />
Johanna Maria C. Priesack-Bocken, praktische Ärztin,<br />
und Frau Dr. med. Gisela Samtleben, praktische<br />
Ärztin, haben mit Wirkung vom 01.01.2006 die Genehmigung<br />
zur Führung einer Gemeinschaftspraxis in<br />
Kiel erhalten.<br />
Herr Dr. med. Dr. med. dent. Wolfgang Neugebauer,<br />
Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie in 24960<br />
Glücksburg, Im Ruhetaler Weg 2, und Herr Dr. med.<br />
Stefan Erbersdobler, Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie<br />
in 24103 Kiel, Wall 55, haben mit<br />
Wirkung vom 01.01.2006 die Genehmigung zum<br />
Führen einer ortsübergreifenden Gemeinschaftspraxis<br />
erhalten. Die Postanschrift lautet: Wall 55, 24103<br />
Kiel.<br />
Frau Dr. med. Nicola Weisner und Herr Dr. med.<br />
Karl-Michael Dietz haben mit Wirkung vom<br />
01.01.2006 die Genehmigung zur Führung einer Gemeinschaftspraxis<br />
als Fachärzte für Frauenheilkunde<br />
und Geburtshilfe in Kiel erhalten.<br />
Herr Dr. med. Jan Pieter Jamaer, Facharzt für Orthopädie<br />
und Facharzt für Orthopädie, Schwerpunkt<br />
Rheumatologie, hat die Genehmigung zur Verlegung<br />
seiner Vertragspraxis nach 24106 Kiel, Steenbeeker<br />
Weg 25-33, erhalten.<br />
Herr Dr. med. Kay Baade, Herr Dr. med. Markus<br />
Hruby, Herr Dr. med. Jörg Diesch und Herr Dr.<br />
med. Jan Pieter Jamaer, Fachärzte für Orthopädie,<br />
haben mit Wirkung vom 01.01.2006 die Genehmigung<br />
zur Führung einer Gemeinschaftspraxis in Kiel<br />
erhalten.<br />
Das seit dem 01.01.2004 zugelassene Medizinische<br />
Versorgungszentrum Lubinus GmbH in Kiel hat eine<br />
Änderung des Gründerkreises bekannt gegeben.<br />
Der Zulassungsausschuss hat der Aufnahme von<br />
Herrn Dr. med. Jan Pieter Jamaer in den Gründerkreis<br />
zugestimmt. Ferner hat der Zulassungsausschuss<br />
zur Kenntnis genommen, dass Herr Dr. Jamaer seit<br />
dem 01.01.2006 vertragsärztliche Leistungen für das<br />
Medizinische Versorgunszentrum Lubinus GmbH erbringt.<br />
Dem Medizinischen Versorgungszentrum Lubinus<br />
GmbH wurde gemäß § 103 Abs. 4 a SGB V die Genehmigung<br />
zur Beschäftigung von Herrn Dr. med.<br />
Rainer Scheuermann als Facharzt für Chirurgie und<br />
Facharzt für Chirurgie, Schwerpunkt Unfallchirurgie,<br />
in einer 25 %-Tätigkeit mit Wirkung vom 01.01.2006<br />
genehmigt.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
Herr Dr. med. Christoph Heider, niedergelassener<br />
Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt Kardiologie,<br />
zusätzlich als Facharzt für Innere Medizin.<br />
Herr Dr. med. Wolfgang Kroll, niedergelassener<br />
Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt Kardiologie,<br />
in Kiel, zusätzlich als Facharzt für Innere Medizin.<br />
Herr Priv.-Doz. Dr. med./Univ. Asuncion Horst<br />
Grimm, niedergelassener Facharzt für Innere Medizin,<br />
Schwerpunkt Gastroenterologie, in Kiel, zusätzlich<br />
als Facharzt für Innere Medizin.<br />
Herr Dr. med. Tilmann David-Walek, niedergelassener<br />
Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt Nephrologie,<br />
zusätzlich als Facharzt für Innere Medizin.<br />
Herr Dr. med. Humann Bolouri, niedergelassener<br />
Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt Hämatologie<br />
und Internistische Onkologie, in Kiel, zusätzlich<br />
als Facharzt für Innere Medizin.<br />
Herrn Dr. med. Bodo Engel, Herrn Andreas Rinck,<br />
Herrn Dr. med. Hans-Albrecht Schele, Frau Dr.<br />
med. Brigitte Hollenbach, Frau Susanne Beckenbach,<br />
Frau Dr. med. Hanna Keppler, Herrn Dr. med. Philip<br />
Horstmann, Frau Dr. med. Ursula Prange, Fachärzte<br />
für Anästhesiologie in 24148 Kiel, Schönberger Straße<br />
11, Herrn Kai Lausen, Facharzt für Anästhesiologie<br />
in 24226 Heikendorf, Teichtor 23, Herrn Dr.<br />
med. Wolfgang Schwarz, Facharzt für Anästhesiologie<br />
in 23568 Lübeck, Bergiusweg 1, Frau Dr. med.<br />
Sabine Onnasch, Fachärztin für Anästhesiologie in<br />
24159 Kiel, Seekante 2, Herrn Dr. med. Karim<br />
Zeribi, Facharzt für Allgemeinmedizin, in 24148 Kiel,<br />
Schönberger Straße 11, sowie Frau Dr. med. Gunda<br />
Comberg-Büll, Fachärztin für Anästhesiologie in<br />
24105 Kiel, Dielsweg 8, wurde das Führen einer fachübergreifenden<br />
überörtlichen Gemeinschaftspraxis<br />
mit Wirkung vom 01.01.2006 genehmigt. Die Postanschrift<br />
lautet: Schönberger Straße 11, 24148 Kiel.<br />
Stadt Lübeck<br />
Frau Dr. med. Frauke Harms, Fachärztin für Innere<br />
Medizin (hausärztlicher Versorgungsbereich), in<br />
23568 Lübeck, Roeckstraße 16, hat die Genehmigung<br />
zur Verlegung ihrer Vertragspraxis nach 23568<br />
Lübeck, Heiligen-Geist-Kamp 1 c, ab 01.01.2007, erhalten.<br />
Herr Dr. med. Dirk Nazarenus, Facharzt für Innere<br />
Medizin (hausärztlicher Versorgungsbereich), in<br />
23568 Lübeck, Roeckstraße 16, hat die Genehmigung<br />
zur Verlegung seiner Vertragspraxis nach 23568<br />
Lübeck, Heiligen-Geist-Kamp 1 c, ab 01.01.2007 erhalten.
Herr Dr. med. Armin Echelmeyer als Facharzt für<br />
Neurochirurgie für 23554 Lübeck, Werner-Kock-<br />
Straße 4.<br />
Herr Dr. med. Roland Kranz als Facharzt für Neurochirurgie<br />
für 23554 Lübeck, Werner-Kock-Straße 4.<br />
Die Fachärzte für Neurochirurgie, Herren Dr. med.<br />
Armin Echelmeyer und Dr. med. Roland Kranz haben<br />
mit Wirkung vom 01.01.2006 die Genehmigung<br />
zur Führung einer Gemeinschaftspraxis in Lübeck erhalten.<br />
Herr Stefan Bialluch als Facharzt für Innere Medizin<br />
(hausärztlicher Versorgungsbereich) für Lübeck.<br />
Herr Georg Hinz, prakt. Arzt, verlegt ab 29.03.2006<br />
seine Vertragspraxis von 23566 Lübeck, Brandenbaumer<br />
Landstraße 255, nach 23558 Lübeck, Moislinger<br />
Allee 93.<br />
Herr Honorarprof. Dr. med. Jens-Martin Träder und<br />
Frau Dr. med. Bettina Fallenbacher haben mit Wirkung<br />
vom 01.01.2006 die Genehmigung zur Führung<br />
einer Gemeinschaftspraxis als Fachärzte für Allgemeinmedizin<br />
in Lübeck erhalten.<br />
Frau Dr. med. Irina Robrahn-Nitschke seit dem<br />
01.01.2006 als Fachärztin für Strahlentherapie für<br />
23558 Lübeck, Nebenhofstraße 7.<br />
Herr Dr. med. Ulf Richter, Bad Segeberg, und Frau<br />
Dr. med. Annette Richter, Lübeck, Fachärzte für<br />
Anästhesiologie, haben mit Wirkung vom 01.01.2006<br />
die Genehmigung zur Führung einer überörtlichen<br />
Gemeinschaftspraxis erhalten.<br />
Herr Dr. med. Thomas Herboth, Herr Dr. med. Matthias<br />
Clausen, Lübeck, und Herr Dr. med. Christoph van<br />
Aken, Herr Kai Honnicke, Bad Schwartau, Fachärzte<br />
für Augenheilkunde, haben mit Wirkung vom<br />
01.01.2006 die Genehmigung zur Führung einer überörtlichen<br />
Gemeinschaftspraxis erhalten. Die Postanschrift<br />
lautet: 23554 Lübeck, Fackenburger Allee 22-24.<br />
Herr Jens Schäper gemäß § 101 Abs. 1 Nr. 4 sowie<br />
Abs. 3 Satz 1 SGB V (Job-Sharing) in Verbindung<br />
mit den Nrn. 23 a bis g Bedarfsplanungs-Richtlinien-<br />
Ärzte als Facharzt für Anästhesiologie für 23554 Lübeck,<br />
Lindenplatz 1.<br />
Herr Jens Schäper und Frau Dr. med. Teresa Linares<br />
haben mit Wirkung vom 01.01.2006 die Genehmigung<br />
zur Führung einer Gemeinschaftspraxis als<br />
Fachärzte für Anästhesiologie in Lübeck erhalten.<br />
Frau Dr. med. Ute Görgen-Pauly als Fachärztin für<br />
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie<br />
für 23552 Lübeck, St.-Annen-Straße 1 a.<br />
Frau Dr. med. Ute Görgen-Pauly, Frau Dr. med.<br />
Antje Schüren, Frau Dr. med. Gabriele Ziemens und<br />
Herr Dr. med. Martin Neuhauss haben mit Wirkung<br />
vom 01.01.2006 die Genehmigung zur Führung einer<br />
Gemeinschaftspraxis als Fachärztinnen für Kinderund<br />
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie bzw. als<br />
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Lübeck<br />
erhalten.<br />
Frau Dorothea Wulfmeier-von der Lühe und Herr<br />
Dr. med. Peter Renner, An der Obertrave 8, 23552<br />
Lübeck, und Herr Dr. med. Stefan Sabel, Rathausmarkt<br />
2 b, 23617 Stockelsdorf, haben mit Wirkung<br />
vom 01.01.2006 die Genehmigung zur Führung einer<br />
ortsübergreifenden Gemeinschaftspraxis als Fachärzte<br />
für Urologie erhalten. Die Postanschrift lautet: Dissauer<br />
Straße 62, 23617 Stockelsdorf.<br />
Herr Dr. med. Rainer Schulte als Facharzt für Strahlentherapie<br />
für 23558 Lübeck, Nebenhofstraße 7.<br />
Herr Dr. med. Bernd Brandenburg, Frau Dr. (Univ.-<br />
Zagreb) Ursula Steidle-Katic, Herr Dr. med. Rainer<br />
Schulte, Frau Dr. med. Irina Robrahn-Nitschke,<br />
Fachärzte für Strahlentherapie, Frau Christine<br />
Ollrogge und Frau Dr. med. Susanne Heise, Fachärzte<br />
für Diagnostische Radiologie, haben mit Wirkung<br />
vom 01.01.2006 die Genehmigung zur Führung einer<br />
Berufsausübungsgemeinschaft in Form einer Partnerschaft<br />
erhalten. Die Partnerschaft trägt den Namen<br />
„Radiologische Strahlentherapeutische Partnerschaft<br />
Lübeck Dr. Brandenburg“.<br />
Frau Dr. med. Gabriela Winkens als Fachärztin für<br />
Radiologische Diagnostik für 23552 Lübeck, Mengstraße<br />
66-70.<br />
Herr Dr. med. Helmut Vorbringer, Facharzt für Radiologie,<br />
Herr Dr. med. Martin Beese, Facharzt für<br />
Nuklearmedizin, Herr Dr. med. Dragan Brodniak,<br />
Herr Prof. Dr. med. Heinz Jörg Freitag, Frau Dr.<br />
med. Esther Lange, Fachärzte für Diagnostische Radiologie,<br />
Herr Dr. med. Karsten Rieck, Facharzt für<br />
Radiologie und Facharzt für Nuklearmedizin, und<br />
Frau Dr. med. Gabriela Winkens, Fachärztin für Radiologische<br />
Diagnostik, haben mit Wirkung vom<br />
01.01.2006 die Genehmigung zur Führung einer Gemeinschaftspraxis<br />
in Lübeck erhalten.<br />
Herr Dr. med. Dirk Uthgenannt, niedergelassener<br />
Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt Hämatologie<br />
und Internistische Onkologie, in Lübeck, zusätzlich<br />
als Facharzt für Innere Medizin.<br />
Herr Prof. Dr. med. habil. Peter Maria Rob, niedergelassener<br />
Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt<br />
Nephrologie, in Lübeck, zusätzlich als Facharzt für<br />
Innere Medizin.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 75<br />
Mitteilungen der Kassenärztlichen Vereinigung
Mitteilungen der Kassenärztlichen Vereinigung<br />
76<br />
Herrn Dr. med. Bodo Engel, Herrn Andreas Rinck,<br />
Herrn Dr. med. Hans-Albrecht Schele, Frau Dr.<br />
med. Brigitte Hollenbach, Frau Susanne Beckenbach,<br />
Frau Dr. med. Hanna Keppler, Herrn Dr. med. Philip<br />
Horstmann, Frau Dr. med. Ursula Prange, Fachärzte<br />
für Anästhesiologie in 24148 Kiel, Schönberger Straße<br />
11, Herrn Kai Lausen, Facharzt für Anästhesiologie<br />
in 24226 Heikendorf, Teichtor 23, Herrn Dr.<br />
med. Wolfgang Schwarz, Facharzt für Anästhesiologie<br />
in 23568 Lübeck, Bergiusweg 1, Frau Dr. med.<br />
Sabine Onnasch, Fachärztin für Anästhesiologie in<br />
24159 Kiel, Seekante 2, Herrn Dr. med. Karim<br />
Zeribi, Facharzt für Allgemeinmedizin, in 24148 Kiel,<br />
Schönberger Straße 11, sowie Frau Dr. med. Gunda<br />
Comberg-Büll, Fachärztin für Anästhesiologie in<br />
24105 Kiel, Dielsweg 8, wird das Führen einer fachübergreifenden<br />
überörtlichen Gemeinschaftspraxis<br />
mit Wirkung vom 01.01.2006 genehmigt. Die Postanschrift<br />
lautet: Schönberger Straße 11, 24148 Kiel.<br />
Stadt Neumünster<br />
Herr Dr. med. Christian Meewes seit dem 01.01.2006<br />
als Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten<br />
für 24534 Neumünster, Kuhberg 43-45.<br />
Herr Dr. med. Christian Meewes und Herr Dr. med.<br />
Gerhard Büttner, Fachärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten,<br />
haben mit Wirkung vom<br />
01.01.2006 die Genehmigung zur Führung einer Gemeinschaftspraxis<br />
in Neumünster erhalten.<br />
Kreis Nordfriesland<br />
Frau Katrin Breckling, Fachärztin für Innere Medizin<br />
mit hausärztlichem Versorgungsbereich, und Frau Dr.<br />
med. Angelika Sauter, Fachärztin für Allgemeinmedizin,<br />
haben die Genehmigung zur Führung einer Gemeinschaftspraxis<br />
in Bredstedt ab 01.04.2006 erhalten.<br />
Kreis Ostholstein<br />
Herr Armin Pallokat ab 01.02.2006 als Facharzt für<br />
Frauenheilkunde und Geburtshilfe für 23714 Bad<br />
Malente, Bahnhofstr. 37-39.<br />
Herr Dr. med. Knut Müller-Marienburg, Facharzt<br />
für Urologie in Heiligenhafen, hat die Genehmigung<br />
zur Verlegung seiner Vertragspraxis nach 23758 Oldenburg,<br />
Mühlenkamp 5, ab 01.01.2007 erhalten.<br />
Frau Dr. med. Lucia Kühner seit dem 01.01.2006 als<br />
Fachärztin für Allgemeinmedizin für 23743 Grömitz,<br />
Markt 4.<br />
Herr Kai Honnicke, Facharzt für Augenheilkunde,<br />
hat die Genehmigung zur Verlegung seiner Vertragspraxis<br />
von 23611 Bad Schwartau, Auguststraße 2 a,<br />
nach 23611 Bad Schwartau, Lübecker Straße 24, erhalten.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
Herr Dr. med. Thomas Herboth, Herr Dr. med.<br />
Matthias Clausen, Lübeck, und Herr Dr. med.<br />
Christoph van Aken, Herr Kai Honnicke, Bad<br />
Schwartau, Fachärzte für Augenheilkunde, haben<br />
mit Wirkung vom 01.01.2006 die Genehmigung zur<br />
Führung einer überörtlichen Gemeinschaftspraxis erhalten.<br />
Die Postanschrift lautet: 23554 Lübeck, Fackenburger<br />
Allee 22-24.<br />
Herr Dr. med. Peter Schroeder als Facharzt für Kinderund<br />
Jugendmedizin für 23701 Eutin, Schloßstraße 3.<br />
Herr Dr. med. Peter Schroeder und Herr Dr. med.<br />
Wolf-Dieter Schiecke haben mit Wirkung vom<br />
01.01.2006 die Genehmigung zur Führung einer Gemeinschaftspraxis<br />
als Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin<br />
in Eutin erhalten.<br />
Herr Peter Falk als Facharzt für Innere Medizin mit<br />
ausschließlich hausärztlicher Tätigkeit für 23758 Oldenburg,<br />
Schulstraße 22.<br />
Frau Maria Zofia Lutyi, prakt. Ärztin, Herr Dr. med.<br />
Lutz Stöve, Facharzt für Allgemeinmedizin, und Herr<br />
Peter Falk, Facharzt für Innere Medizin mit ausschließlich<br />
hausärztlicher Tätigkeit, haben mit Wirkung<br />
vom 01.01.2006 die Genehmigung zur Führung<br />
einer Gemeinschaftspraxis in Oldenburg erhalten.<br />
Herr Dr. med. Christian Kellner als Facharzt für<br />
Neurochirurgie für 23611 Bad Schwartau, Anton-<br />
Baumann-Straße 1.<br />
Herr Dr. med. Christian Kellner und Herr Dr. med.<br />
Frieder Cortbus haben mit Wirkung vom 01.01.2006<br />
die Genehmigung zur Führung einer Gemeinschaftspraxis<br />
als Fachärzte für Neurochirurgie in Bad<br />
Schwartau erhalten.<br />
Herr Dr. med. Henning Baucks, niedergelassener<br />
Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt Pneumologie/Pulmologie,<br />
in Eutin, zusätzlich als Facharzt für<br />
Innere Medizin.<br />
Kreis Pinneberg<br />
Frau Dr. med. Ingrid Langhans, Fachärztin für Hautund<br />
Geschlechtskrankheiten in Uetersen, hat gemäß<br />
§ 32 b Ärzte-ZV i. V. m. den Angestellte-Ärzte-<br />
Richtlinien die Genehmigung zur Beschäftigung von<br />
Herrn Dr. med. Tim Graefe als angestellten Arzt in<br />
einer Ganztagstätigkeit in ihrer Praxis erhalten.<br />
Frau Dr. med. Bettina Stölken seit dem 01.01.2006<br />
als Fachärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde für<br />
25337 Elmshorn, Hermann-Ehlers-Weg 4.<br />
Frau Dr. med. Kristin Woywod, Fachärztin für Allgemeinmedizin,<br />
hat ihre Vertragspraxis von 25421 Pinneberg,<br />
Hasenkehre 11, nach 25336 Elmshorn, Hogenkamp<br />
16, verlegt.
Frau Ute Brömmer, hausärztlich tätige Fachärztin für<br />
Innere Medizin, hat ihre Vertragspraxis von 25335<br />
Elmshorn, Königstraße 12-14, nach 25336 Elmshorn,<br />
Hogenkamp 16, verlegt.<br />
Frau Dr. med. Mirja Lange gemäß § 101 Abs. 1 Nr. 4<br />
sowie Abs. 3 Satz 1 SGB V (Job-Sharing) in Verbindung<br />
mit den Nrn. 23 a bis g Bedarfsplanungs-Richtlinien-Ärzte<br />
als Fachärztin für Allgemeinmedizin für<br />
25336 Elmshorn, Hogenkamp 16.<br />
Frau Dr. med. Mirja Lange, Herr Frank Ubl, Herr<br />
Dr. med. Thomas Fronzek, Frau Dr. med. Dörte<br />
Erdmann, Herr Hauke Wolters, Frau Dr. med.<br />
Kristin Woywod und Frau Ute Brömmer, haben mit<br />
Wirkung vom 01.01.2006 die Genehmigung zur Führung<br />
einer Gemeinschaftspraxis als Hausärzte in<br />
Elmshorn erhalten.<br />
Frau Dr. med. Heike Hahn-Ullrich als Fachärztin für<br />
Nuklearmedizin für 25421 Pinneberg, Fahltskamp 74.<br />
Herr Dr. med. Christian Franke als Facharzt für<br />
Nuklearmedizin für 25421 Pinneberg, Fahltskamp 74.<br />
Frau Dr. med. Heike Hahn-Ullrich, Herr Dr. med.<br />
Christian Franke, Fachärzte für Nuklearmedizin,<br />
Herr Dr. med. Hassan Sepehr, Herr Dr. med.<br />
Thomas Fassbender, Frau Dr. med. Ulrike Ahrens,<br />
Fachärzte für Radiologie, Frau Dr. med. Dagmar<br />
Linde-Stoltenberg, Frau Renata Kazmierczak, Herr<br />
Dr. med. Meinolf Marx, Fachärzte für Strahlentherapie,<br />
Herr Dr. med. Timo M. Gomille und Herr Dr.<br />
med. Maik Jürgensen, Fachärzte für Diagnostische<br />
Radiologie, haben mit Wirkung vom 01.01.2006 die<br />
Genehmigung zur Führung einer Gemeinschaftspraxis<br />
in Pinneberg erhalten.<br />
Frau Dr. med. Bettina Stölken und Herr Dr. med.<br />
Uwe Sonnemann haben mit Wirkung vom<br />
01.01.2006 die Genehmigung zur Führung einer Gemeinschaftspraxis<br />
als Fachärzte für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde<br />
in Elmshorn erhalten.<br />
Kreis Plön<br />
Frau Anja Walczak ab 01.02.2006 als Fachärztin für<br />
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie<br />
für 24211 Preetz, Langebrückstr. 9.<br />
Herr Dr. med. Michael Klockemann und Frau Dr.<br />
med. Birgit Pabst, Preetzer Chaussee 77, 24147<br />
Klausdorf, und Herr Dr. med. Matthias Claußen,<br />
Wiesenweg 15 c, 24242 Felde, haben die Genehmigung<br />
zur Führung einer ortsübergreifenden Berufsausübungsgemeinschaft<br />
als Fachärzte für Anästhesiologie<br />
in Form einer Partnerschaft mit Wirkung vom<br />
01.01.2006 erhalten. Die Postanschrift lautet: Preetzer<br />
Chaussee 77, 24147 Klausdorf.<br />
Herrn Dr. med. Bodo Engel, Herrn Andreas Rinck,<br />
Herrn Dr. med. Hans-Albrecht Schele, Frau Dr.<br />
med. Brigitte Hollenbach, Frau Susanne Beckenbach,<br />
Frau Dr. med. Hanna Keppler, Herrn Dr. med. Philip<br />
Horstmann, Frau Dr. med. Ursula Prange, Fachärzte<br />
für Anästhesiologie in 24148 Kiel, Schönberger Straße<br />
11, Herrn Kai Lausen, Facharzt für Anästhesiologie<br />
in 24226 Heikendorf, Teichtor 23, Herrn Dr.<br />
med. Wolfgang Schwarz, Facharzt für Anästhesiologie<br />
in 23568 Lübeck, Bergiusweg 1, Frau Dr. med.<br />
Sabine Onnasch, Fachärztin für Anästhesiologie in<br />
24159 Kiel, Seekante 2, Herrn Dr. med. Karim<br />
Zeribi, Facharzt für Allgemeinmedizin, in 24148 Kiel,<br />
Schönberger Straße 11, sowie Frau Dr. med. Gunda<br />
Comberg-Büll, Fachärztin für Anästhesiologie in<br />
24105 Kiel, Dielsweg 8, wird das Führen einer fachübergreifenden<br />
überörtlichen Gemeinschaftspraxis<br />
mit Wirkung vom 01.01.2006 genehmigt. Die Postanschrift<br />
lautet: Schönberger Straße 11, 24148 Kiel.<br />
Kreis Rendsburg-Eckernförde<br />
Herr Priv.-Doz. Dr. med. habil. Ludger Gerdesmeyer<br />
seit dem 01.01.2006 als Facharzt für Orthopädie und<br />
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie für<br />
24119 Kronshagen, Eckernförder Str. 311-315.<br />
Frau Dr. med. Elke Langenau seit dem 01.01.2006<br />
als Fachärztin für Pathologie für 24340 Eckernförde,<br />
Horn 5.<br />
Die Fachärzte für Allgemeinmedizin, Herren Michael<br />
Severus und Dr. med. Florian Seidel, haben mit Wirkung<br />
vom 01.01.2006 die Genehmigung zur Führung<br />
einer Gemeinschaftspraxis in Rendsburg erhalten.<br />
Die Zulassung von Herrn Dr. med. Georg Tacke,<br />
prakt. Arzt in Molfsee, wurde in eine Zulassung als<br />
Facharzt für Innere Medizin mit hausärztlicher Tätigkeit<br />
umgewandelt.<br />
Herr Dr. med. Hans-Joachim Horns ab 01.04.2006<br />
gemäß § 101 Abs. 1 Nr. 4 sowie Abs. 3 Satz 1 SGB V<br />
(Job-Sharing) in Verbindung mit den Nrn. 23 a bis g<br />
Bedarfsplanungs-Richtlinien-Ärzte als Facharzt für Orthopädie<br />
für 24340 Eckernförde, Langebrückstraße 20.<br />
Herr Dr. med. Hans-Joachim Horns, Herr Dr. med.<br />
Norbert Lins und Herr Dr. med. Kay Harten haben<br />
mit Wirkung ab 01.04.2006 die Genehmigung zur<br />
Führung einer Gemeinschaftspraxis als Fachärzte für<br />
Orthopädie in Eckernförde erhalten.<br />
Herr Dr. med. Michael Klockemann und Frau Dr.<br />
med. Birgit Pabst, Preetzer Chaussee 77, 24147<br />
Klausdorf, und Herr Dr. med. Matthias Claußen,<br />
Wiesenweg 15 c, 24242 Felde, haben die Genehmigung<br />
zur Führung einer ortsübergreifenden Berufsausübungsgemeinschaft<br />
als Fachärzte für Anästhesio-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 77<br />
Mitteilungen der Kassenärztlichen Vereinigung
Mitteilungen der Kassenärztlichen Vereinigung<br />
78<br />
logie in Form einer Partnerschaft mit Wirkung vom<br />
01.01.2006 erhalten. Die Postanschrift lautet: Preetzer<br />
Chaussee 77, 24147 Klausdorf.<br />
Frau Dr. med. Angelika Böger und Frau Dr. med.<br />
Elke Langenau haben mit Wirkung vom 01.01.2006<br />
die Genehmigung zur Führung einer Gemeinschaftspraxis<br />
als Fachärztinnen für Pathologie in Eckernförde<br />
erhalten.<br />
Die Zulassung von Frau Dr. med. Ingrid Johannsen,<br />
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie in<br />
Eckernförde, wurde in eine Zulassung als Fachärztin<br />
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie<br />
umgewandelt.<br />
Herr Dr. med. Malte Scheidt und Herr Dr. med.<br />
Thomas Mehne, Fachärzte für Allgemeinmedizin in<br />
Mielkendorf, haben mit Wirkung vom 01.01.2006 die<br />
Genehmigung zur Führung einer Gemeinschaftspraxis<br />
erhalten.<br />
Kreis <strong>Schleswig</strong>-Flensburg<br />
Frau Regina Buß ab 01.04.2006 als Fachärztin für Allgemeinmedizin<br />
für 24837 <strong>Schleswig</strong>, Am Damm 2 b.<br />
Herr Dr. med. Dr. med. dent. Wolfgang Neugebauer,<br />
Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie in 24960<br />
Glücksburg, Im Ruhetaler Weg 2, und Herr Dr. med.<br />
Stefan Erbersdobler, Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie<br />
in 24103 Kiel, Wall 55, haben mit<br />
Wirkung vom 01.01.2006 die Genehmigung zum<br />
Führen einer ortsübergreifenden Gemeinschaftspraxis<br />
erhalten. Die Postanschrift lautet: Wall 5, 24103<br />
Kiel.<br />
Kreis Segeberg<br />
Herr Dr. med. Ulf Richter, Bad Segeberg, und Frau<br />
Dr. med. Annette Richter, Lübeck, Fachärzte für<br />
Anästhesiologie, haben mit Wirkung vom 01.01.2006<br />
die Genehmigung zur Führung einer überörtlichen<br />
Gemeinschaftspraxis erhalten. Die Postanschrift lautet:<br />
23562 Lübeck, Weberkoppel 36 a.<br />
Die Zulassung von Herrn Dr. med. Uve Barmwater,<br />
prakt. Arzt in Bad Bramstedt, wurde in eine Zulassung<br />
als Facharzt für Allgemeinmedizin umgewandelt.<br />
Herr Dr. med. Jochen Gerlach, Facharzt für Allgemeinmedizin<br />
in Kaltenkirchen, zusätzlich als hausärztlich<br />
tätiger Facharzt für Innere Medizin.<br />
Herr Eckart Boehnke ab 01.04.2006 als hausärztlich<br />
tätiger Facharzt für Innere Medizin für 22850 Norderstedt,<br />
Europaallee 4.<br />
Herr Eckart Boehnke und Frau Marlies Richter-<br />
Boehnke haben ab 01.04.2006 die Genehmigung zur<br />
Führung einer Gemeinschaftspraxis als hausärztlich<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
tätige Fachärzte für Innere Medizin in Norderstedt<br />
erhalten.<br />
Herr Dr. med. Dominik Ahlquist gemäß § 101 Absatz<br />
1 Nr. 4 sowie Absatz 3 Satz 1 SGB V (Job-Sharing)<br />
in Verbindung mit den Nummern 23 a bis g Bedarfsplanungsrichtlinien-Ärzte<br />
als Facharzt für Allgemeinmedizin<br />
für 24568 Kaltenkirchen, Brauerstraße<br />
1-3.<br />
Herr Dr. med. Dominik Ahlquist, Frau Ute Ahlquist<br />
und Frau Nicole Glet, Fachärzte für Allgemeinmedizin,<br />
haben mit Wirkung vom 01.01.2006 die Genehmigung<br />
zur Führung einer Gemeinschaftspraxis in<br />
Kaltenkirchen erhalten.<br />
Dem Medizinischen Versorgungszentrum Wahlstedt<br />
wurde die Anstellung des Herrn Marek Rossmann<br />
als Facharzt für Allgemeinmedizin in einer Vollzeittätigkeit<br />
mit Wirkung vom 15.12.2005 genehmigt.<br />
Kreis Steinburg<br />
Frau Dr. med. Friderike Prinzler als Fachärztin für<br />
Innere Medizin (hausärztlicher Versorgungsbereich)<br />
für 25524 Itzehoe, Lindenstraße 27.<br />
Herr Dr. med. Frank Zemke als Facharzt für Innere<br />
Medizin (fachärztlicher Versorgungsbereich) für<br />
25524 Itzehoe, Lindenstraße 27.<br />
Frau Dr. med. Friederike Prinzler, Fachärztin für Innere<br />
Medizin (hausärztlicher Versorgungsbereich),<br />
Herr Dr. med. Sven Böse, Facharzt für Innere Medizin<br />
und Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt<br />
Gastroenterologie, und Herr Dr. med. Frank Zemke,<br />
Facharzt für Innere Medizin (fachärztlicher Versorgungsbereich),<br />
haben mit Wirkung vom 02.01.2006<br />
die Genehmigung zur Führung einer versorgungsübergreifenden<br />
Gemeinschaftspraxis in Itzehoe erhalten.<br />
Das Medizinische Versorgungszentrum Itzehoe seit<br />
dem 01.01.2006 für 25524 Itzehoe, Robert-Koch-<br />
Straße 2.<br />
Ärztliche Leiter: Herren Dr. med. Hartmut Berg, Dr.<br />
med. Holger Kienel, Walter Neumann und Dr. med.<br />
Martin Geiss-Tönshoff.<br />
Kreis Stormarn<br />
Herr Dr. med. Lennart Nissen und Herr Dr. med.<br />
Joachim Busacker haben mit Wirkung vom 01.01.2006<br />
die Genehmigung zur Führung einer Gemeinschaftspraxis<br />
als Fachärzte für Allgemeinmedizin in Barsbüttel<br />
erhalten.<br />
Herr Dr. med. Thomas Hofstötter, Facharzt für Kinder-<br />
und Jugendmedizin in Reinbek, hat mit Wirkung<br />
vom 01.01.2006 gemäß § 32 b Ärzte-ZV in Verbindung<br />
mit dem Angestellte-Ärzte-Richtlinien die Ge-
nehmigung zur Beschäftigung von Herrn Dr. med.<br />
Stephan Michele Eiselt als angestellten Arzt in einer<br />
Ganztagstätigkeit in seiner Praxis erhalten.<br />
Folgende Ärzte wurden rechtskräftig zur<br />
Vertragspraxis zugelassen:<br />
Die Fachärzte für Chirurgie und Fachärzte für Chirurgie,<br />
Schwerpunkt Unfallchirurgie, Herren Dr.<br />
med. Ralf Erik Hilgert und Christian Powierski, haben<br />
mit Wirkung vom 01.01.2006 die Genehmigung<br />
zur Führung einer Gemeinschaftspraxis in 25335<br />
Elmshorn, Flamweg 9, erhalten.<br />
Folgende Ärzte wurden zur Teilnahme<br />
an der vertragsärztlichen Überweisungspraxis<br />
ermächtigt. Diese Beschlüsse sind<br />
noch nicht rechtskräftig, sodass hiergegen<br />
noch Widerspruch eingelegt bzw.<br />
Klage erhoben werden kann:<br />
Kreis Dithmarschen<br />
Die bis zum 31.12.2005 befristet gewesene Ermächtigung<br />
von Herrn Dr. med. Hartmut Wiegand, Chefarzt<br />
der Neurochirurgischen Klinik des Westküstenklinikums<br />
Heide, zur Teilnahme an der vertragsärztlichen<br />
Versorgung zur Durchführung diverser Leistungen<br />
wurde bis zum 30.06.2006 verlängert.<br />
Die bis zum 31.12.2005 befristet gewesene Ermächtigung<br />
von Herrn Dr. med. Reinhard Jensen, Oberarzt<br />
an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des<br />
Westküstenklinikums Heide, zur Teilnahme an der<br />
vertragsärztlichen Versorgung zur Durchführung diverser<br />
Leistungen wurde bis zum 31.12.2007 verlängert.<br />
Herr Dr. med. Johannes Geisthövel, Chefarzt der<br />
chirurgischen Abteilung des Westküstenklinikums<br />
Brunsbüttel, wurde mit Wirkung vom 01.01.2006,<br />
befristet bis zum 31.12.2007, längstens jedoch bis zum<br />
Ende seiner ärztlichen Tätigkeit am vorgenannten<br />
Klinikum, in folgendem Umfang ermächtigt:<br />
1. Durchführung chirurgischer Leistungen auf Überweisung<br />
durch niedergelassene und zugelassene<br />
Fachärzte für Chirurgie und Fachärzte für Orthopädie.<br />
2. Darüber hinaus ist Herr Dr. Geisthövel ermächtigt,<br />
im Rahmen der chirurgischen Versorgung Patienten<br />
mit Wohnsitz in einem Radius um Brunsbüttel<br />
von ca. 20 km auf Überweisung durch niedergelassene<br />
Vertragsärzte zu behandeln.<br />
Stadt Flensburg<br />
Herr Dr. med. Wulf Staemmler, Chefarzt der Medizinischen<br />
Klinik II des Malteser Krankenhauses St.<br />
Franziskus-Hospitals in Flensburg, wurde mit Wirkung<br />
vom 01.01.2006, befristet bis zum 31.12.2006,<br />
längstens bis zum Ende seiner ärztlichen Tätigkeit an<br />
der Medizinischen Klinik II des St. Franziskus-Hospitals<br />
in Flensburg, zur Teilnahme an der vertragsärztlichen<br />
Überweisungspraxis zur Durchführung der<br />
nachstehend aufgeführten Leistungen ermächtigt:<br />
1. 13424 i. V. m. 13257, 13400, 13421, 13422 auf<br />
Überweisung durch gastroenterologisch tätige Vertragsärzte<br />
bei malignen Prozessen, beginnende Stenosen,<br />
Angiodysplasien und als Blutstillungsmaßnahme<br />
nach Polypenabtragung.<br />
2. 13400, 13401, 13410, 13411, 13430, 13431, 34500<br />
auf Überweisung durch gastroenterologisch tätige<br />
Vertragsärzte, 13423 auf Überweisung durch gastroenterologisch<br />
tätige Vertragsärzte, die auch polypektomieren.<br />
3. 13400, 02320 zur Anlage einer PEG auf Überweisung<br />
durch Vertragsärzte,<br />
4. 13215 + 01600, 01310, 01311, 01312 + 01601,<br />
01602, 02100, 13661, 34280 sind Bestandteil der<br />
Ermächtigung.<br />
Herr Dr. med. Peter Lorenzen und Herr Dr. med.<br />
Wolfgang Ries, Oberärzte an der Medizinischen Klinik<br />
des Ev.-luth. Diakonissenkrankenhauses Flensburg,<br />
wurden mit Wirkung vom 01.01.2006, befristet<br />
bis zum 31.12.2010, längstens jedoch bis zum Ende<br />
ihrer ärztlichen Tätigkeit am vorgenannten Krankenhaus,<br />
als Leiter einer nephrologischen Schwerpunktabteilung<br />
i. S. v. § 11 Abs. 3 Anlage 9.1 BMV-Ä/-<br />
EKV ermächtigt:<br />
1. zur Behandlung von chronisch niereninsuffizienten<br />
bzw. nierentransplantierten Patienten auf Überweisung<br />
durch Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt<br />
Nephrologie, sowie zur Durchführung von<br />
LDL-Apheresen auf Überweisung durch fachärztlich<br />
tätige Internisten,<br />
2. zur Behandlung von terminal erkrankten Patienten<br />
mit der kontinuierlichen ambulanten Peritonealdialyse<br />
(CAPD) auf Überweisung durch Fachärzte<br />
für Innere Medizin, Schwerpunkt Nephrologie, beschränkt<br />
auf 7 Patienten pro Quartal.<br />
Die Ermächtigung erstreckt sich nicht auf die Leistungen,<br />
die unter die Vorschriften des § 115 a SGB V<br />
fallen.<br />
Die bisherige Ermächtigung von Herrn Dr. med.<br />
Christoph Stahl, bisher Chefarzt der orthopädischen<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 79<br />
Mitteilungen der Kassenärztlichen Vereinigung
Mitteilungen der Kassenärztlichen Vereinigung<br />
80<br />
Abteilung des St. Franziskus-Hospitals in Flensburg,<br />
wurde mit Wirkung vom 01.01.2006 dahingehend<br />
umgestellt, dass Herr Dr. Stahl als Chefarzt der orthopädischen<br />
Abteilung der Ev.-luth. Diakonissenanstalt<br />
Flensburg ermächtigt ist. Die bisherige Befristung<br />
der Ermächtigung bis zum 31.03.2007 bleibt bestehen.<br />
Herr Dr. Stahl hat mit Wirkung vom 01.01.2006 auf<br />
seine bisherige Ermächtigung zur Durchführung diverser<br />
Sonographien verzichtet.<br />
Kreis Herzogtum Lauenburg<br />
Herr Dr. med. Roland Preuss, Chefarzt der Inneren<br />
Abteilung des DRK-Krankenhauses Mölln-Ratzeburg<br />
gGmbH, Mölln, wurde mit Wirkung vom 01.01.2006,<br />
befristet bis zum 31.12.2007, längstens jedoch bis zum<br />
Ende seiner ärztlichen Tätigkeit am vorgenannten<br />
Krankenhaus, ermächtigt zur Teilnahme an der vertragsärztlichen<br />
Versorgung zur Durchführung folgender<br />
Leistungen:<br />
1. interventionelle/operative Endoskopie auf Überweisung<br />
durch Vertragsärzte:<br />
a) PEG gemäß der Nr. 02320 EBM,<br />
sowie nach Vordiagnostik:<br />
b) Bougierung gemäß der Nr. 13410 EBM,<br />
c) Stenteinlagen gemäß der Nr. 13411 EBM,<br />
d) Sklerosierung gemäß der Nr. 13401 EBM,<br />
e) ERCP gemäß den Nrn. 13430 und 13431 EBM,<br />
f) Polypektomien gemäß der Nr. 13402 und 13423<br />
EBM.<br />
Im Zusammenhang mit den in Punkt 1 aufgeführten<br />
Leistungen ist ggf. die Nr. 13400 EBM zusätzlich abrechenbar.<br />
2. H2-Atemtest gemäß der Nr. 02401 EBM auf Überweisung<br />
durch Vertragsärzte.<br />
3. Endosonographie nach Vordiagnostik gemäß den<br />
Nrn. 33042, ggf. 33081, 33090 und ggf. 33092,<br />
13400 EBM auf Überweisung durch Vertragsärzte.<br />
4. Koloskopien gemäß den Nrn. 13257, 13421, 13422<br />
und 13423 EBM auf Überweisung durch koloskopierende<br />
Ärzte.<br />
5. Bronchoskopie gemäß der Nr. 13662 EBM auf<br />
Überweisung durch Vertragsärzte.<br />
6. Gefäßsonographische Untersuchungen gemäß den<br />
Nrn. 33060, 33061, 33070, 33071, 33072, 33073<br />
und 33075 EBM auf Überweisung durch Vertragsärzte.<br />
7. Durchführung von Leistungen gemäß der Nrn.<br />
02340, 02342 und 02343 EBM auf Überweisung<br />
durch Vertragsärzte.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
Stadt Kiel<br />
Die Herren Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Bernhard<br />
Kimmig, Direktor an der Klinik für Strahlentherapie<br />
des Universitätsklinikums <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, Campus<br />
Kiel, Dr. med. Razvan-Mircea Galalae und Dr.<br />
med. Jürgen Schultze, Oberärzte an der v. g. Klinik,<br />
wurden mit Wirkung vom 01.01.2006, befristet bis<br />
zum 31.12.2007, längstens jedoch bis zum Ende ihrer<br />
ärztlichen Tätigkeit an der v. g. Klinik, ermächtigt<br />
zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung<br />
in folgendem Umfang:<br />
1. Durchführung von Leistungen nach den Nrn.<br />
25210, 25211, 25213, 25320, 25321, 25322,<br />
25323, 25330, 25331, 25332, 25333, 25340,<br />
25341, 25342, 34360 und 34460 EBM auf Überweisung<br />
durch Vertragsärzte. Im Zusammenhang<br />
mit der Durchführung der vorgenannten Leistungen<br />
wird ein Gesamtjahreskontingent von 650 Fällen<br />
festgelegt.<br />
2. Auf das Kontingent nach Nr. 1 werden nicht angerechnet<br />
Fälle,<br />
a) bei quantitativem Bedarf im Rahmen des Ausfallkonzepts<br />
auf Überweisung durch zugelassene<br />
Strahlentherapeuten,<br />
b) bei qualitativen Sonderfällen auf Überweisung<br />
durch zugelassene und ermächtigte Strahlentherapeuten.<br />
Für die Fälle unter Buchstabe a) gilt grundsätzlich der<br />
Vorrang der niedergelassenen Vertragsärzte.<br />
Frau Dr. med. Joanna Miller, Oberärztin am Institut<br />
für Transfusionsmedizin des Universitätsklinikums<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, Campus Kiel, wurde mit Wirkung<br />
vom 01.01.2006, befristet bis zum 31.12.2007,<br />
längstens jedoch bis zum Ende ihrer ärztlichen Tätigkeit<br />
am vorgenannten Institut, ermächtigt zur Teilnahme<br />
an der vertragsärztlichen Überweisungspraxis<br />
zur Durchführung von blutgruppenserologischen, immunologischen<br />
sowie solchen Untersuchungen, die<br />
im Zusammenhang mit dem Transfusionswesen stehen.<br />
Die Ermächtigung beschränkt sich auf komplizierte,<br />
von der Norm abweichende Fragestellungen.<br />
In begründeten Einzelfällen ist auch die EBM-Ziffer<br />
32856 abrechenbar.<br />
Frau Prof. Dr. med. Liselotte Mettler und Herr Dr.<br />
med. Andreas Schmutzler, Ärzte an der Klinik für<br />
Gynäkologie und Geburtshilfe des Universitätsklinikums<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, Campus Kiel, wurden mit<br />
Wirkung vom 01.01.2006, befristet bis zum 31.12.2007,<br />
längstens bis zum Ende der ärztlichen Tätigkeit an<br />
dieser Klinik, ermächtigt zur Teilnahme an der vertragsärztlichen<br />
Versorgung zur Durchführung von In-
vitro-Fertilisationen (hier sind auch das ICSI-Verfahren<br />
und Follikelpunktionen enthalten) auf Überweisung<br />
durch Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.<br />
Die Einschränkung auf Überweisung<br />
durch Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe<br />
entfällt im Falle der Spermaabgabe durch den<br />
Ehemann. Im Zusammenhang mit der Durchführung<br />
der vorgenannten Leistungen gilt ein Gesamtjahreskontingent<br />
von 60 Fällen.<br />
Frau Prof. Dr. med. Ingrid Schreer und Herr Dr.<br />
med. Fritz Schäfer, Ärzte an der Klinik für Gynäkologie<br />
und Geburtshilfe des Universitätsklinikums<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, Campus Kiel, wurden mit Wirkung<br />
vom 01.01.2006, befristet bis zum 31.12.2007,<br />
längstens bis zum Ende der ärztlichen Tätigkeit an<br />
dieser Klinik, ermächtigt zur Teilnahme an der vertragsärztlichen<br />
Versorgung zur Durchführung der<br />
nachstehend aufgeführten Leistungen:<br />
1. Mamma-Sonographie bei sonographischen Risikobefunden<br />
und bei einer notwendigen Erweiterung<br />
der Diagnose zur sonographisch gesteuerten Punktion<br />
auf Überweisung durch Fachärzte für Radiologie<br />
und Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.<br />
In diesem Zusammenhang sind die EBM-<br />
Ziffern 02341, 33041 und 33091 abrechenbar.<br />
2. Die in den Gebührenpositionen 99356 bis 99364<br />
EBM enthaltenen Leistungen im Rahmen der Modellvereinbarung<br />
„Qualitätsgesicherte Mamma-<br />
Diagnostik“ zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> mit allen Krankenkassenverbänden.<br />
3. Durchführung von Mammographien im Rahmen<br />
der Nachsorge nach brusterhaltender Behandlung<br />
auf Überweisung durch Fachärzte für Radiologie<br />
und Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.<br />
Herr Prof. Dr. med. Paul-Martin Holterhus, Oberarzt<br />
an der Klinik für Allgemeine Pädiatrie des Universitätsklinikums<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, Campus Kiel, wurde<br />
mit Wirkung vom 08.12.2005, befristet bis zum<br />
31.03.2007, längstens jedoch bis zum Ende seiner<br />
ärztlichen Tätigkeit an vorgenannter Klinik, in folgendem<br />
Umfang ermächtigt:<br />
Spezialambulanz für Endokrinologie:<br />
Diagnostik (einschließlich Funktionsdiagnostik) und<br />
Therapie schwerer Krankheitsbilder aus dem Bereich<br />
Endokrinologie einschließlich Wachstumsstörungen.<br />
Im Rahmen dieser Ermächtigung sind folgende Ziffern<br />
des EBM abrechenbar: 01310, 01311, 01430,<br />
01600, 01601, 01602, 04115, 04120, 04311, 04324,<br />
04333,13350.<br />
Die Durchführung von Leistungen gemäß der Ziffer<br />
04120 EBM ist nur in besonders zu begründenden<br />
Einzelfällen möglich. Ferner erstreckt sich die Ermächtigung<br />
auf die Diagnostik und Therapie bei Kindern<br />
und Jugendlichen mit Diabetes mellitus. Die Ermächtigung<br />
erstreckt sich auf Überweisung durch<br />
niedergelassene Kinderärzte und in besonders zu begründenden<br />
Einzelfällen auf Überweisung durch niedergelassene<br />
Vertragsärzte.<br />
Herr Dr. med. Andreas van Baalen, Oberarzt der Klinik<br />
für Neuropädiatrie des Universitätsklinikums<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, Campus Kiel, wurde mit Wirkung<br />
vom 08.12.2005, befristet bis zum 31.03.2007,<br />
längstens jedoch bis zum Ende seiner ärztlichen Tätigkeit<br />
an vorgenannter Klinik, ermächtigt zur Teilnahme<br />
an der vertragsärztlichen Versorgung zur Behandlung<br />
von Patienten mit den nachstehend aufgeführten<br />
Erkrankungen:<br />
1. auf Überweisung durch zugelassene Fachärzte für<br />
Kinder- und Jugendmedizin, Fachärzte für Kinderund<br />
Jugendpsychiatrie bzw. Fachärzte für Kinderund<br />
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie<br />
a. Kopfschmerzen unklarer Zuordnung,<br />
b. Verhaltens- und Aufmerksamkeitsstörungen,<br />
c. allgemeine neurologische Entwicklungsstörungen,<br />
d. Kranke mit neuromuskulären Störungen,<br />
2. auf Überweisung durch Vertragsärzte Diagnostik<br />
und Therapie von Epilepsien bei sonst gesunden<br />
Patienten.<br />
Im Rahmen der Ermächtigung sind folgende Ziffern<br />
des EBM abrechenbar: 01310, 01311, 01600, 01601,<br />
01602, 01620, 04115, 04120, 04311, 04312, 04313,<br />
04333, 04350, 16310, 16311, 16321, 16322, 30740<br />
und 35220.<br />
Stadt Lübeck<br />
Die Herren Priv.-Doz. Dr. med. Roland Axt-Fliedner<br />
und Priv.-Doz. Dr. med. habil. Martin Roland Krapp,<br />
Oberärzte an der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe<br />
des Universitätsklinikums <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>,<br />
Campus Lübeck, wurden mit Wirkung vom<br />
01.01.2006, befristet bis zum 31.12.2007, längstens<br />
jedoch bis zum Ende ihrer ärztlichen Tätigkeit an der<br />
vorgenannten Klinik, ermächtigt zur Teilnahme an<br />
der vertragsärztlichen Versorgung auf Überweisung<br />
durch Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe<br />
zur Betreuung von Risikoschwangerschaften<br />
und Schwangerschaften, bei denen Auffälligkeiten<br />
durch niedergelassene Gynäkologen gesehen werden.<br />
Im Rahmen dieser Ermächtigung sind folgende Gebührenziffern<br />
des EBM abrechnungsfähig: 01310 bis<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 81<br />
Mitteilungen der Kassenärztlichen Vereinigung
Mitteilungen der Kassenärztlichen Vereinigung<br />
82<br />
01312, 01600, 01601, 01602, 01773, 01774, 01775,<br />
01782, 01786, 08220, 08341 und 32047.<br />
Frau Prof. Dr. med. Gabriele Gillessen-Kaesbach,<br />
Herr Dr. med. Manfred Schürmann und Herr Dr.<br />
med. Yorck Hellenbroich, Ärzte am Institut für Humangenetik<br />
des Universitätsklinikums <strong>Schleswig</strong>-<br />
<strong>Holstein</strong>, Campus Lübeck, wurden mit Wirkung vom<br />
01.01.2006, befristet bis zum 31.12.2007, längstens<br />
bis zum Ende der ärztlichen Tätigkeit am vorgenannten<br />
Institut, ermächtigt zur Teilnahme an der vertragsärztlichen<br />
Überweisungspraxis zur Durchführung<br />
humangenetischer Leistungen nach Kapitel 11 des<br />
EBM. Darüber hinaus sind auch die in den Gebührenpositionen<br />
01601, 01602, 01793 und 01835 des<br />
EBM enthaltenen Leistungen abrechenbar.<br />
Herr Prof. Dr. med. György Kovacs , Arzt an der Klinik<br />
für Strahlentherapie des Universitätsklinikums<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>, Campus Lübeck, wurde mit Wirkung<br />
vom 08.12.2005, befristet bis zum 30.06.2007,<br />
längstens bis zum Ende der ärztlichen Tätigkeit an<br />
der vorgenannten Klinik, ermächtigt zur Teilnahme<br />
an der vertragsärztlichen Überweisungspraxis zur<br />
Durchführung von Leistungen nach den Gebührenpositionen:<br />
1. 01602, 02100, 25210 bis 25214 EBM, die jedoch<br />
nur im Zusammenhang mit der Durchführung von<br />
Strahlentherapie,<br />
2. 25321 bis 25323, 25340, 25341 EBM für strahlentherapeutische<br />
Leistungen mittels Linearbeschleuniger,<br />
3. 34360 und 34460 EBM,<br />
4. 25210 (nur Hochvolttherapie), 25211, 25213,<br />
25310, 25330 bis 25333 und 25340 bis 25342 EBM.<br />
Frau Dr. med. Katharina von Hof-Strobach, Ärztin<br />
an der Klinik für Strahlentherapie und Nuklearmedizin<br />
des Universitätsklinikums <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>,<br />
Campus Lübeck, wurde mit Wirkung vom 01.01.2006,<br />
befristet bis zum 30.06.2008, längstens jedoch bis zum<br />
Ende ihrer ärztlichen Tätigkeit an vorgenannter Klinik,<br />
zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Überweisungspraxis<br />
zur Durchführung der zur Indikationsstellung<br />
und Dosisbestimmung im Rahmen der Radiojodtherapie<br />
notwendigen Untersuchungen mit einer<br />
einmaligen Nachuntersuchung, in besonders zu<br />
begründenden Einzelfällen mehrmaligen Nachuntersuchungen<br />
ermächtigt. Außerdem beinhaltet die Ermächtigung<br />
die Durchführung spezieller Leistungen<br />
aus der nuklearmedizinischen Strahlendiagnostik<br />
(Gebührenziffern 17350 und 17351 EBM) auf Überweisung<br />
durch Vertragsärzte.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
Kreis Nordfriesland<br />
Herr Dirk Burchardt, Ltd. Arzt der Röntgenabteilung<br />
des Klinikums Nordfriesland, Klinik Niebüll,<br />
wurde mit Wirkung vom 01.01.2006, befristet bis<br />
zum 31.12.2007, längstens jedoch bis zum Ende seiner<br />
ärztlichen Tätigkeit am vorgenannten Klinikum,<br />
zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Überweisungspraxis<br />
zur Durchführung folgender Leistungen<br />
ermächtigt:<br />
1. Röntgenleistungen für die Fälle der an der Überweisungspraxis<br />
ermächtigten Ärzte des Kreiskrankenhauses<br />
Niebüll,<br />
2. gesamte Röntgendiagnostik, einschließlich Mammographie<br />
und ggf. auch Mammasonographie, außer<br />
Skelettröntgen und Röntgen von Abdomen<br />
und Galle; Leistungen nach den Nrn. 34230,<br />
34240, 34241 EBM sind nicht Bestandteil dieses<br />
Teils der Ermächtigung,<br />
3. gesamtes pädiatrisches Röntgen,<br />
4. farbkodierte Dopplersonographie der Gefäße bei<br />
Überweisung zur Angiographie,<br />
5. gesamte Computertomographie,<br />
6. Auf Überweisung von Herrn Dr. Kunze sowie in<br />
seiner Abwesenheit können die Herrn Dr. Kunze<br />
im Rahmen der partiellen Teilnahme an der fachärztlichen<br />
Versorgung genehmigten Röntgenleistungen<br />
erbracht werden.<br />
Die Ermächtigung von Herrn Dr. med. Thorsten<br />
Oesterle, Oberarzt der Gynäkologischen Abteilung<br />
am Klinikum Nordfriesland gGmbh, Klinik Husum,<br />
wurde mit Wirkung vom 08.12.2005 erweitert. Herr<br />
Dr. Oesterle ist somit in folgendem Umfang ermächtigt:<br />
Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung zur<br />
Durchführung:<br />
1. der erweiterten sonographisch gezielten Diagnostik<br />
bei Verdacht auf Störungen der fetalen Entwicklung<br />
auf Überweisung durch Fachärzte für Frauenheilkunde<br />
und Geburtshilfe und Ärzte, die Mutterschaftsvorsorge<br />
durchführen. In diesem Zusammenhang<br />
sind die Ziffern 01310, 01311, 01312,<br />
01600, 01601, 01602, 01773, 01774, 01775, 01786,<br />
08215 EBM abrechenbar,<br />
2. von Leistungen nach der Gebührennummer 01780<br />
EBM auf Überweisung durch Vertragsärzte,<br />
3. von Leistungen nach den EBM-Ziffern 01311,<br />
01312, 01600, 01601, 01602, 08320, 33041, 33091<br />
auf Überweisung durch Fachärzte für Frauenheilkunde<br />
und Geburtshilfe.
Die bisherige Befristung der Ermächtigung bis zum<br />
31.03.2006 bleibt bestehen.<br />
Herr Dr. med. Martin Brügmann, Oberarzt der Rehabilitationsklinik<br />
Nordfriesland in St. Peter-Ording,<br />
wurde mit Wirkung vom 08.12.2005, befristet bis<br />
zum 31.12.2007, längstens bis zum Ende seiner ärztlichen<br />
Tätigkeit an vorgenannter Klinik, ermächtigt<br />
zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung<br />
zur Durchführung der nachstehend aufgeführten<br />
Leistungen im Rahmen der Versorgung hämatologischer<br />
und onkologischer Patienten auf Überweisung<br />
durch fachärztlich tätige Internisten, Strahlentherapeuten,<br />
Gynäkologen, Chirurgen, Urologen sowie die<br />
vor Ort ansässigen Hausärzte:<br />
01310, 01311, 01312, 01510, 01511, 01512, 01601,<br />
02100, 02101, 02110, 02111, 02340, 02341, 02342,<br />
13215, 13220, 13250, 13500, 13502, 32159, 32163,<br />
32168, 32169, 33040, 33042, 33091, 33092.<br />
Im Zusammenhang mit der Durchführung der vorgenannten<br />
Leistungen gilt ein Gesamtjahreskontingent<br />
von 400 Fällen. Die Ermächtigung erstreckt sich<br />
nicht auf die Leistungen, die unter die Vorschriften<br />
des § 115 a SGB V fallen.<br />
Die bis zum 31.12.2005 befristet gewesene Ermächtigung<br />
von Frau Dr. med. Maja Zimmermann, Ltd.<br />
Ärztin der Anästhesiologie am Kreiskrankenhaus<br />
Föhr-Amrum, zur Teilnahme an der vertragsärztlichen<br />
Versorgung zur Durchführung diverser Leistungen<br />
wurde bis zum 31.12.2007 verlängert.<br />
Kreis Ostholstein<br />
Herr Dr. med. Gerdt Hübner, 23758 Oldenburg,<br />
Mühlenkamp 5, wurde mit Wirkung vom 01.01.2006,<br />
befristet bis zum 31.12.2010, zur Teilnahme an der<br />
vertragsärztlichen Überweisungspraxis als Facharzt<br />
für Innere Medizin, Schwerpunkt Hämatologie und<br />
Internistische Onkologie, ermächtigt. Seine vertragsärztliche<br />
Tätigkeit ist auf die Leistungen beschränkt,<br />
die im Zusammenhang mit dem Schwerpunkt Hämatologie<br />
und Internistische Onkologie stehen.<br />
Herr Dr. med. Paul Gaus, Oberarzt der Anästhesieabteilung<br />
der Sana Kliniken Ostholstein GmbH, Klinik<br />
Eutin, wurde mit Wirkung vom 17.11.2005, befristet<br />
bis zum 31.12.2007, längstens bis zum Ende<br />
seiner ärztlichen Tätigkeit an der Anästhesieabteilung<br />
der vorgenannten Klinik, zur Teilnahme an der<br />
vertragsärztlichen Überweisungspraxis zur Durchführung<br />
der nachstehend aufgeführten Leistungen im<br />
Rahmen der Schmerztherapie ermächtigt:<br />
1. Diagnostische und therapeutische Blockaden peripherer<br />
Nerven sowie rückenmarksnahe Anästhesien,<br />
ausgenommen Quaddel- und Neuraltherapie,<br />
2. spezielle Schmerztherapie bei Therapieresistenz<br />
nach Abklärung des Grundleidens,<br />
3. spezielle Schmerztherapie bei incurablem Grundleiden.<br />
Im Rahmen dieser Ermächtigung sind folgende Gebührenpositionen<br />
des EBM 2000plus abrechnungsfähig:<br />
01310, 011311, 01312, 01600, 01601, 01602,<br />
01620, 01621, 02100, 05215, 05220 sowie schmerztherapeutische<br />
Leistungen nach den Gebührenpositionen<br />
02360, 30700, 30701, 30710, 30712, 30720,<br />
30721, 30722, 30723, 30724, 30730, 30731, 30740,<br />
30750, 30751, 30760 und 35100.<br />
Frau Annette Luise Schmitz und Herr Stefan<br />
Rieckhof, Oberärzte der Klinik für Anästhesiologie<br />
und Intensivmedizin am Klinikum Neustadt, wurden<br />
mit Wirkung vom 17.11.2005, befristet bis zum<br />
31.12.2007, längstens bis zum Ende ihrer ärztlichen<br />
Tätigkeit an der vorgenannten Klinik, zur Teilnahme<br />
an der vertragsärztlichen Überweisungspraxis zur<br />
Durchführung der nachfolgend genannten Leistungen<br />
im Rahmen der Schmerztherapie ermächtigt:<br />
1. Diagnostische und therapeutische Blockaden peripherer<br />
Nerven sowie rückenmarksnahe Anästhesien,<br />
ausgenommen Quaddel- und Neuraltherapie,<br />
2. spezielle Schmerztherapie bei Therapieresistenz<br />
nach Abklärung des Grundleidens,<br />
3. spezielle Schmerztherapie bei incurablem Grundleiden.<br />
Im Rahmen dieser Ermächtigung sind folgende Gebührenpositionen<br />
des EBM 2000plus abrechnungsfähig:<br />
01310, 01311, 01312, 01600, 01601, 01602,<br />
01620, 01621, 02100, 05215, 05220 sowie schmerztherapeutische<br />
Leistungen nach den Gebührenpositionen<br />
02360, 30700, 30701, 30710, 35100, 30712,<br />
30720, 30721, 30722, 30723, 30724, 30730, 30731,<br />
30740, 30750, 30751, 30760.<br />
Frau Schmitz ist zusätzlich berechtigt, folgende Gebührenpositionen<br />
im Zusammenhang mit Leistungen<br />
des Kapitels 30.7 EBM 2000plus durchzuführen:<br />
35110, 35111, 35120, 35140.<br />
Die bis zum 31.12.2005 befristet gewesene Ermächtigung<br />
von Herrn Dr. med. Malte Grabener, Chefarzt<br />
der gefäßchirurgischen Abteilung der Sana Kliniken<br />
Ostholstein GmbH, Klinik Eutin, zur Teilnahme an<br />
der vertragsärztlichen Überweisungspraxis zur Durchführung<br />
diverser Leistungen wurde bis zum<br />
31.12.2007 verlängert.<br />
Die bis zum 31.12.2005 befristet gewesene Ermächtigung<br />
von Herrn Prof. Dr. med. Josef Hoch, Chefarzt<br />
der Klinik für Hand-, Brust- und Plastische Chirurgie<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 83<br />
Mitteilungen der Kassenärztlichen Vereinigung
Mitteilungen der Kassenärztlichen Vereinigung<br />
84<br />
des Klinikums Neustadt, zur Teilnahme an der vertragsärztlichen<br />
Versorgung zur Durchführung diverser<br />
Leistungen wurde bis zum 31.12.2007 verlängert.<br />
Herr Dr. med. Thomas Schaum, Assistenzarzt an der<br />
Sana-Klinik Oldenburg, wurde mit Wirkung ab<br />
01.04.2006, befristet bis zum 31.03.2008, längstens<br />
bis zum Ende seiner ärztlichen Tätigkeit an vorgenannter<br />
Klinik, wie folgt zur Teilnahme an der vertragsärztlichen<br />
Überweisungspraxis ermächtigt:<br />
1. Durchführung von Behandlungen von Diabetikern<br />
entsprechend einer diabetologischen Schwerpunktpraxis,<br />
d. h. Behandlung und Schulung von<br />
Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2,<br />
Behandlung und Schulung von Gestationsdiabetikerinnen,<br />
Behandlungen von Patienten mit diabetischem<br />
Fußsyndrom sowie Behandlung und Schulung<br />
von Patienten im Rahmen des DMP Vertrages<br />
für Typ 1 und Typ 2 Diabetiker.<br />
2. Durchführung von doppler- und duplexsonographischen<br />
Untersuchungen bei Patienten mit diabetischem<br />
Fußsyndrom.<br />
Die bis zum 31.12.2005 befristet gewesene Ermächtigung<br />
von Herrn Dr. med. Wolfgang Kunkel, Chefarzt<br />
der chirurgischen Abteilung der Sana Kliniken Ostholstein-Klinik<br />
Oldenburg, wurde bis zum 31.03.2006<br />
verlängert.<br />
Kreis Pinneberg<br />
Die bis zum 31.12.2005 befristet gewesene Ermächtigung<br />
von Herrn Dr. med. Jens-Henning Frese, Oberarzt<br />
an der Medizinischen Klinik des Klinikums Pinneberg,<br />
zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung<br />
zur Durchführung diverser Leistungen wurde<br />
bis zum 31.12.2007 verlängert.<br />
Herr Doctor-Medic Stefan Tardos, Ltd. Arzt der Medizinischen<br />
Klinik am Klinikum Pinneberg, wurde mit<br />
Wirkung vom 08.12.2005, befristet bis zum 31.12.2007,<br />
längstens bis zum Ende seiner ärztlichen Tätigkeit an<br />
der vorgenannten Klinik, ermächtigt zur Teilnahme<br />
an der vertragsärztlichen Versorgung auf Überweisung<br />
durch zugelassene Fachärzte für Innere Medizin<br />
mit den Schwerpunkten Gastroenterologie, Onkologie<br />
oder Pneumologie zur Durchführung folgender<br />
Leistungen:<br />
1. Langzeit-ph-Metrie des Ösophagus (13401 i. V. m.<br />
13400 EBM),<br />
2. Ösophagus Druck-Messung (13401 i. V. m. 13400<br />
EBM),<br />
3. H2-Atemtest (02401 EBM),<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
4. Endosonographie im oberen Intestinaltrakt (33090<br />
i. V. m. 33042 EBM).<br />
Die bis zum 31.12.2005 befristet gewesenen Ermächtigungen<br />
von Frau Annelies Jaedicke und Inge<br />
Langbehn, Wedel, zur Teilnahme an der vertragsärztlichen<br />
Versorgung zur Durchführung diverser<br />
Leistungen wurden bis zum 31.03.2006 verlängert.<br />
Die bis zum 31.12.2005 befristet gewesene Ermächtigung<br />
von Herrn Dr. med. Thomas Dewitz, Chefarzt<br />
der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum<br />
Elmshorn, zur Teilnahme an der vertragsärztlichen<br />
Versorgung zur Durchführung diverser Leistungen<br />
wurde bis zum 31.03.2006 verlängert.<br />
Kreis Rendsburg-Eckernförde<br />
Die bestehende Ermächtigung von Herrn Dr. med.<br />
Dirk Johnsen, Leitender Arzt der Klinik für Kinderund<br />
Jugendmedizin des Kreiskrankenhauses Rendsburg,<br />
zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Überweisungspraxis<br />
zur Durchführung diverser Leistungen,<br />
wurde mit Wirkung vom 17.11.2005 wie folgt erweitert:<br />
1. Mitbetreuung von Kindern und Jugendlichen mit<br />
einer hämatologischen und onkologischen Grunderkrankung<br />
auf Überweisung durch Vertragsärzte<br />
(Nummern 01310, 01311, 04311, 01601, 01602,<br />
02100 EBM 2000plus),<br />
2. Durchführung von konsiliarischen Beratungen und<br />
Untersuchungen in ausgewählt schwierigen Fällen<br />
zur Abklärung des weiteren diagnostischen und<br />
therapeutischen Vorgehens auf Überweisung durch<br />
Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin. Insoweit<br />
sind lediglich die EBM-Nummern 01310, 01311<br />
sowie 01601 und 01602 abrechenbar sowie im Einzelfall<br />
sonographische Leistungen.<br />
Die zeitliche Befristung der Ermächtigung bis zum<br />
30.06.2007 bleibt bestehen.<br />
Die bestehende Ermächtigung von Herrn Dr. med.<br />
Joachim Georgi, Chefarzt der Abteilung Innere Medizin<br />
der Ostseeklinik Damp GmbH, zur Teilnahme<br />
an der vertragsärztlichen Überweisungspraxis als internistischer<br />
Rheumatologe zur Durchführung diverser<br />
Leistungen wurde mit Wirkung vom 17.11.2005<br />
erweitert auf die Durchführung von Leistungen nach<br />
den EBM-Nummern 02100 und 02101 zur Infusion<br />
mit intravenös applizierbaren TNF-Alpha-Antikörper<br />
(zurzeit Remicade). Die zeitliche Befristung der<br />
Ermächtigung bis zum 30.09.2006 bleibt bestehen.<br />
Herr Priv.-Doz. Dr. med. Joachim Brossmann, Chefarzt<br />
der Abteilung für Diagnostische und Interventio-
nelle Radiologie des Kreiskrankenhauses Rendsburg,<br />
wurde mit Wirkung vom 01.01.2006, befristet bis<br />
zum 31.12.2007, längstens bis zum Ende seiner ärztlichen<br />
Tätigkeit in der vorgenannten Abteilung des<br />
Kreiskrankenhauses Rendsburg zur Teilnahme an der<br />
vertragsärztlichen Überweisungspraxis zur Durchführung<br />
von Leistungen gemäß den Ziffern 99361-99363<br />
der Anlage 10 des Versorgungsvertrages nach § 73 c<br />
SGB V über qualitätsgesicherte Mamma-Diagnostik<br />
(QuaMaDi) ermächtigt.<br />
Die Herren Dr. med. Issifi Djibey, Ltd Oberarzt, Dr.<br />
med. Jens-Henning Wacks, Oberarzt, Dr. med.<br />
Bernd Glücklich, Dr. med. Christos Papachrysanthou,<br />
Ltd. Ärzte der Abteilung für Gefäß- und Thoraxchirurgie<br />
des Kreiskrankenhauses Rendsburg, wurden<br />
mit Wirkung vom 01.01.2006, befristet bis zum<br />
31.12.2007, längstens jedoch bis zum Ende ihrer ärztlichen<br />
Tätigkeit am vorgenannten Kreiskrankenhaus,<br />
ermächtigt zur Teilnahme an der vertragsärztlichen<br />
Überweisungspraxis zur Durchführung von konsiliarischen<br />
Beratungen und Untersuchungen zur Abklärung<br />
des weiteren diagnostischen und therapeutischen<br />
Vorgehens. Im Rahmen der Ermächtigung sind<br />
die Gebührenziffern 01310, 01311, 01312, 01600,<br />
01601, 01602, 02310, 07215, 33060, 33061 und<br />
99018 nach Abrechnung (KV-interne Ziffer) EBM<br />
abrechenbar, insgesamt beschränkt auf 250 Fälle pro<br />
Quartal. Die Beschränkung auf die vorgenannte Fallzahl<br />
gilt nicht, sofern die vorgenannten Leistungen<br />
auf Überweisung durch Fachärzte für Chirurgie, Orthopädie,<br />
Neurologie und dopplersonographisch tätige<br />
Ärzte durchgeführt werden. Die Ermächtigung erstreckt<br />
sich nicht auf die Leistungen, die unter die<br />
Vorschriften des § 115 a SGB V fallen. Die Ermächtigung<br />
beinhaltet außerdem keine Leistungen, die das<br />
Kreiskrankenhaus Rendsburg im Rahmen der Zulassung<br />
nach § 115 b SGB V erbringt.<br />
Die bis zum 31.12.2005 befristet gewesene Ermächtigung<br />
von Herrn Dr. med. Siegfried Göbel, Chefarzt<br />
der Klinik für Strahlentherapie und Nuklearmedizin<br />
am Kreiskrankenhaus Rendsburg, zur Teilnahme an<br />
der vertragsärztlichen Versorgung zur Durchführung<br />
diverser Leistungen wurde bis zum 30.09.2008, längstens<br />
bis zum Ende seiner ärztlichen Tätigkeit an dieser<br />
Klinik, verlängert.<br />
Die bis zum 31.12.2005 befristet gewesene Ermächtigung<br />
von Herrn Dr. med. Burkhard Spreter von<br />
Kreudenstein, Schülp, zur Teilnahme an der vertragsärztlichen<br />
Versorgung zur Durchführung diverser<br />
Leistungen wurde bis zum 31.12.2007 verlängert.<br />
Der Zulassungsausschuss stellt in diesem Zusammenhang<br />
fest, dass auch folgende EBM-Ziffern im Rah-<br />
men dieser Ermächtigung abrechenbar sind: 04312,<br />
04351, 04352, 04353, 16311, 33052.<br />
Herr Dr. med. Steffen Oehme, seit dem 01.01.2006<br />
Chefarzt der Abteilung Orthopädie I der Ostseeklinik<br />
Damp, wurde mit Wirkung vom 01.01.2006, befristet<br />
bis zum 31.12.2007, längstens bis zum Ende seiner<br />
ärztlichen Tätigkeit an vorgenannter Abteilung, ermächtigt<br />
zur Teilnahme an der vertragsärztlichen<br />
Versorgung auf Überweisung durch Fachärzte für<br />
Chirurgie und Fachärzte für Orthopädie zur Abklärung<br />
des weiteren diagnostischen und therapeutischen<br />
Vorgehens zur Durchführung von konsiliarischen<br />
Untersuchungen und Beratungen. In diesem<br />
Zusammenhang sind lediglich die EBM-Ziffern<br />
01310, 01311, 01312, 01601, 01602 abrechenbar.<br />
Die Ermächtigung erstreckt sich nicht auf die Leistungen,<br />
die unter die Vorschriften des § 115 a SGB V<br />
fallen.<br />
Kreis <strong>Schleswig</strong>-Flensburg<br />
Die bis zum 31.12.2005 befristet gewesene Ermächtigung<br />
von Herrn Dr. med. Andreas Hohmann, Chefarzt<br />
der Radiologischen Abteilung des Martin-Luther-Krankenhauses<br />
<strong>Schleswig</strong>, zur Teilnahme an der<br />
vertragsärztlichen Überweisungspraxis zur Durchführung<br />
diverser Leistungen wurde bis zum 31.12.2007<br />
verlängert.<br />
Die bis zum 31.12.2005 befristet gewesene Ermächtigung<br />
von Frau Dr. med. Claudia Wardius, Assistenzärztin<br />
der Radiologischen Abteilung des Martin-Luther-Krankenhauses<br />
<strong>Schleswig</strong>, zur Teilnahme an der<br />
vertragsärztlichen Überweisungspraxis zur Durchführung<br />
der konventionellen Röntgentherapie wurde bis<br />
zum 31.12.2007 verlängert.<br />
Die bis zum 31.12.2005 befristet gewesene Ermächtigung<br />
von Herrn Dr. med. Bernd Heuer, Oberarzt an<br />
der neurologischen Abteilung der Fachklinik für Psychiatrie,<br />
Neurologie und Rehabilitation in <strong>Schleswig</strong>,<br />
zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung<br />
zur Durchführung diverser Leistungen wurde bis zum<br />
31.12.2007 verlängert.<br />
Herr Dr. med. Gerhard Podszus, Leiter des Zentrums<br />
für Gefäßchirurgie am Martin-Luther-Krankenhaus<br />
<strong>Schleswig</strong>, wurde mit Wirkung vom 08.12.2005, befristet<br />
bis zum 31.12.2007, längstens bis zum Ende<br />
seiner ärztlichen Tätigkeit am vorgenannten Krankenhaus,<br />
ermächtigt zur Teilnahme an der vertragsärztlichen<br />
Überweisungspraxis zur Durchführung von<br />
konsiliarischen Beratungen und Untersuchungen zur<br />
Abklärung des weiteren diagnostischen und therapeutischen<br />
Vorgehens bei Patienten mit dokumentierten<br />
angiologischen Vorbefunden. Im Rahmen die-<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 85<br />
Mitteilungen der Kassenärztlichen Vereinigung
Mitteilungen der Kassenärztlichen Vereinigung<br />
86<br />
ser Ermächtigung sind die EBM Ziffern 01310, 01311,<br />
01312, 01601 und 01602 abrechenbar.<br />
Kreis Segeberg<br />
Herr Dr. med. Rolf Michael Küster, Oskar-Alexander-<br />
Str., 24576 Bad Bramstedt, wurde mit Wirkung vom<br />
01.01.2006, befristet bis zum 31.12.2007, ermächtigt<br />
zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Überweisungspraxis<br />
zur Betreuung rheumakranker Kinder.<br />
Herr Dr. med. Gerhard Kiepe, Oberarzt des Neurologischen<br />
Zentrums der Segeberger Kliniken GmbH,<br />
Bad Segeberg, wurde mit Wirkung vom 01.12.2005,<br />
befristet bis zum 31.12.2007, längstens bis zum Ende<br />
seiner ärztlichen Tätigkeit am Neurologischen Zentrum<br />
der Segeberger Kliniken GmbH, zur ambulanten<br />
Versorgung im Rahmen der Langzeitpflege von apallischen<br />
Patienten mit einem Pauschalhonorar von<br />
€ 60,- pro Patient und Quartal ermächtigt.<br />
Die bis zum 31.12.2005 befristet gewesene Ermächtigung<br />
von Herrn Dr. med. Hans-Peter Schrenk, Chefarzt<br />
der Abteilung für Chirurgie der AK Segeberger<br />
Kliniken GmbH, zur Teilnahme an der vertragsärztlichen<br />
Versorgung zur Durchführung diverser Leistungen<br />
wurde bis zum 31.12.2007 verlängert.<br />
Herr Dr. med. Fritz Helmut Gabriel, Oberarzt der Inneren<br />
Abteilung der Paracelsus-Klinik Kaltenkirchen,<br />
wurde mit Wirkung vom 08.12.2005, befristet<br />
bis zum 31.12.2007, längstens bis zum Ende seiner<br />
ärztlichen Tätigkeit an vorgenannter Klinik, ermächtigt<br />
zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung<br />
auf Überweisung durch endoskopierende Ärzte<br />
zur Durchführung der in den EBM-Ziffern 34248 und<br />
34251 enthaltenen Leistungen.<br />
Kreis Stormarn<br />
Herr Dr. med. habil. Detlev Branscheid, Chefarzt der<br />
Abteilung für Thoraxchirurgie im Zentrum für Thoraxerkrankungen<br />
am Krankenhaus Großhansdorf, ist<br />
ermächtigt zur Teilnahme an der vertragsärztlichen<br />
Überweisungspraxis zur Durchführung von konsiliarischen<br />
Beratungen und Untersuchungen zur Abklärung<br />
des weiteren diagnostischen und therapeutischen<br />
Vorgehens im Rahmen der Krankheitsbilder<br />
des thoraxchirurgischen Bereiches. Dazu gehören<br />
auch therapeutische Maßnahmen aus dem Bereich<br />
der Thoraxchirurgie. Die Ermächtigung erstreckt sich<br />
nicht auf solche Leistungen, die unter die Vorschriften<br />
des § 115 a SGB V fallen. Die Ermächtigung beinhaltet<br />
des weiteren keine Leistungen, die das Krankenhaus<br />
Großhansdorf im Rahmen der Zulassung<br />
nach § 115 b SGB V erbringt. Die Ermächtigung ist<br />
bis zum 31.12.2006 befristet.<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006<br />
Öffentliche Ausschreibung von Vertragspraxen<br />
gemäß § 103 Abs. 4 SGB V<br />
Die Kassenärztliche Vereinigung <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
schreibt auf Antrag von Ärzten/Psychotherapeuten<br />
deren Vertragsarztsitze zur Übernahme durch Nachfolger<br />
aus, da es sich um für weitere Zulassungen gesperrte<br />
Gebiete handelt:<br />
Kreis Herzogtum Lauenburg<br />
13679/2005<br />
Praxis eines Facharztes/einer Fachärztin<br />
für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde<br />
Bewerbungsfrist: 31.01.2006<br />
14707/2005<br />
Praxis eines Facharztes/einer Fachärztin für Orthopädie<br />
Bewerbungsfrist: 15.02.2006<br />
14848/2005<br />
Praxis eines Facharztes/einer Fachärztin für<br />
Innere Medizin (fachärztlicher Versorgungsbereich)<br />
Bewerbungsfrist: 31.01.2006<br />
Stadt Kiel<br />
14569/2005<br />
Praxis eines Facharztes/einer Fachärztin<br />
für Innere Medizin (hausärztlicher Versorgungsbereich)<br />
Bewerbungsfrist: 31.01.2006<br />
Stadt Lübeck<br />
14457/2005<br />
Praxis eines Facharztes/einer Fachärztin<br />
für Innere Medizin (hausärztlicher Versorgungsbereich)<br />
Bewerbungsfrist: 31.01.2006<br />
Kreisregion Stadt Neumünster<br />
Kreis Rendsburg-Eckernförde<br />
14621/2005<br />
Praxis eines Facharztes/einer Fachärztin für<br />
Neurologie und Psychiatrie<br />
Bewerbungsfrist: 31.01.2006<br />
Kreis Nordfriesland<br />
14220/2005<br />
Praxis eines Facharztes/einer Fachärztin<br />
für Kinder- und Jugendmedizin<br />
Bewerbungsfrist: 31.01.2006<br />
Kreis Ostholstein<br />
14150/2005<br />
Praxis eines Facharztes/einer Fachärztin<br />
für Allgemeinmedizin<br />
Bewerbungsfrist: 31.01.2006
14566/2005<br />
Praxis eines Facharztes/einer Fachärztin<br />
für Allgemeinmedizin<br />
Bewerbungsfrist: 31.01.2006<br />
14653/2005<br />
Praxis eines Facharztes/einer Fachärztin für<br />
Innere Medizin (hausärztlicher Versorgungsbereich)<br />
Bewerbungsfrist: 15.02.2006<br />
Kreis Pinneberg<br />
14224/2005<br />
Praxis eines Facharztes/einer Fachärztin<br />
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe<br />
Bewerbungsfrist: 15.02.2006<br />
Kreis Segeberg<br />
14291/2005<br />
Praxis eines Facharztes/einer Fachärztin<br />
für Allgemeinmedizin<br />
Bewerbungsfrist: 15.02.2006<br />
Die abgabewilligen Ärzte/Psychotherapeuten möchten<br />
zunächst noch anonym bleiben. Interessenten<br />
können Näheres bei der Kassenärztlichen Vereinigung<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong> erfahren (Tel.: 04551/<br />
883327, 883291, 883346, 883378, 883259).<br />
Bewerbungen um diese Vertragsarztsitze sind zu richten<br />
an die Kassenärztliche Vereinigung <strong>Schleswig</strong>-<br />
<strong>Holstein</strong> in der Bismarckallee 1-3, 23795 Bad Segeberg.<br />
Der Bewerbung wären die für die Zulassung zur<br />
Vertragspraxis erforderlichen Unterlagen beizufügen,<br />
nämlich:<br />
� Auszug aus dem Arztregister,<br />
Der Präsident des <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>ischen Landessozialgerichts<br />
hat folgenden Vertragsarzt mit Wirkung<br />
vom 1. Januar 2006 für die Dauer von 5 Jahren<br />
zum ehrenamtlichen Richter in Angelegenheiten<br />
des Vertragsarztrechtes ernannt:<br />
� Bescheinigung über die seit der Approbation (bei<br />
Psychotherapeuten seit der Diplomierung) ausgeübten<br />
ärztlichen/psychotherapeutischen Tätigkeiten,<br />
� ein Lebenslauf.<br />
Außerdem müsste ein polizeiliches Führungszeugnis<br />
nach der Belegart „O“, ein so genanntes Behördenzeugnis,<br />
bei der zuständigen Behörde des Heimatortes<br />
des Bewerbers beantragt werden, das der KV <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong><br />
dann unmittelbar vom Bundeszentralregister<br />
in Berlin übersandt wird.<br />
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Ärzte/<br />
Psychotherapeuten, die für diesen Planungsbereich<br />
und diese Fachrichtung eine Eintragung in die Warteliste<br />
beantragt haben, nicht automatisch als Bewerber<br />
für diese Praxis gelten. Es ist in jedem Fall eine<br />
schriftliche Bewerbung für diesen Vertragsarztsitz erforderlich,<br />
die Eintragung in die Warteliste befreit<br />
hiervon nicht.<br />
Um die Übernahme von ausgeschriebenen Vertragsarztsitzen<br />
von Hausärzten (Fachärzte für Allgemeinmedizin,<br />
prakt. Ärzte, und hausärztlich tätige Internisten)<br />
können sich sowohl Fachärzte für Allgemeinmedizin<br />
als auch hausärztlich tätige Internisten bewerben.<br />
Um die Übernahme von ausgeschriebenen Vertragspsychotherapeutenpraxen<br />
können sich Psychologische<br />
Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten,<br />
Ärzte für Psychotherapeutische<br />
Medizin sowie Ärzte, die beabsichtigen, ausschließlich<br />
psychotherapeutisch tätig zu werden, bewerben.<br />
Berufung von Vertragsärzten(innen) bzw. Psychotherapeuten(innen) als<br />
ehrenamtliche Richter(innen) der Sozialgerichtsbarkeit<br />
am Sozialgericht Kiel<br />
Dr. med. Volker von Kügelgen<br />
Facharzt für Allgemeinmedizin, 24148 Kiel<br />
Liebe Leserinnen und Leser!<br />
Bitte denken Sie daran, dass Sie Ihre Einsendungen auf Chiffre-Anzeigen direkt<br />
an die Quintessenz Verlags-GmbH, Ifenpfad 2-4, 12107 Berlin, senden.<br />
(Tel. 030/76180-663, Fax 030/76180-693, E-Mail central@quintessenz.de)<br />
Vielen Dank!<br />
Die Redaktion des <strong>Schleswig</strong>-<strong>Holstein</strong>ischen <strong>Ärzteblatt</strong>es<br />
<strong>Schleswig</strong>-<strong><strong>Holstein</strong>isches</strong> <strong>Ärzteblatt</strong> 1/2006 87<br />
Mitteilungen der Kassenärztlichen Vereinigung